1
Ein
verletzter Löwe will noch brüllen
Viele Professoren halten eine »Last Lecture«.
Vielleicht habt ihr auch schon bei einer dieser typisch
amerikanischen Uni-Veranstaltungen im Auditorium gesessen:
Professoren werden gebeten, über das zu reden,
was ihnen am wichtigsten ist, so, als wäre es die letzte Vorlesung
ihres Lebens. Und die Zuhörer fragen sich automatisch, welche
Lebensweisheiten sie selbst der Welt vermitteln würden, wenn sie
ein letztes Mal die Chance dazu hätten. Was würden wir gerne als
unser Vermächtnis hinterlassen, wenn wir morgen vom Erdboden
verschwänden?
An der Carnegie Mellon University gab es
jahrelang eine Last Lecture Series, doch
bis die Veranstalter schließlich fanden, dass nun ich an der Reihe
sei, war diese Vorlesungsreihe umbenannt worden. Nun lief sie unter
dem Titel Journeys: Den ausgewählten
Professoren wurde vorgegeben, »Reflexionen über ihre persönliche
und berufliche Reise« anzubieten. Das war nicht gerade eine
aufregende Definition, aber ich erklärte mich einverstanden. Man
trug mich für den Veranstaltungstermin im September ein.
Zu dieser Zeit war mein Pankreaskrebs bereits
diagnostiziert worden, aber ich war optimistisch. Vielleicht würde
ich ja zu den Glücklichen zählen, die ihn überlebten.
Während ich die Behandlungen über mich ergehen
ließ,
bombardierten mich die Journey-Veranstalter mit E-Mails. »Worüber wirst du
reden?«, fragten sie. »Maile uns bitte eine kurze Zusammenfassung.«
Es gibt Formalien im akademischen Leben, die man nicht einfach
ignorieren kann, selbst wenn man gerade mit anderen Dingen
beschäftigt ist und beispielsweise versucht, nicht zu sterben.
Mitte August wurde mir mitgeteilt, dass das Plakat für die
Vorlesung gedruckt werden solle und ich mich endlich für ein Thema
entscheiden müsse.
In genau dieser Woche erhielt ich die Nachricht,
dass die letzte Behandlung nicht angeschlagen hatte und ich nur
noch ein paar Monate leben würde.
Ich wusste, dass ich die Vorlesung jederzeit
absagen konnte. Alle hätten das verstanden. Plötzlich gab es so
viel Wichtigeres zu tun. Ich musste mit meinem eigenen Kummer und
mit der Trauer all derer klarkommen, die mich liebten. Ich musste
mich mit aller Kraft ins Zeug werfen, um die Angelegenheiten meiner
Familie in Ordnung bringen. Trotzdem konnte ich den Gedanken an
diese Vorlesung nicht abschütteln. Ich war wie besessen von der
Idee, eine Last Lecture zu halten, die wirklich eine letzte sein
würde. Aber was sollte ich sagen? Wie würde man es aufnehmen? Würde
ich es überhaupt durchstehen können?
»Sie würden es akzeptieren, wenn ich einen
Rückzieher mache«, erklärte ich meiner Frau Jai, »aber ich will es
wirklich tun.«
Jai war von jeher mein Cheerleader. Wenn ich
mich für etwas begeisterte, tat sie es auch. Doch die Idee von
einer letzten Vorlesung kam nicht gut bei ihr an. Gerade erst waren
wir von Pittsburgh ins südöstliche Virginia gezogen, damit Jai und
die Kinder nach meinem Tod in der
Nähe ihrer Familie sein könnten. Jai fand, dass ich meine kostbare
Zeit lieber mit unseren Kindern verbringen sollte oder damit, die
Kisten in unserem neuen Haus auszupacken, als Stunden für die
Vorbereitung einer Vorlesung zu verschwenden und dann nach
Pittsburgh zurückzureisen, um sie zu halten.
»Nenne mich meinetwegen egoistisch«, sagte Jai,
»aber ich will dich ganz. Die Zeit, die du mit der Ausarbeitung des
Vortrags verbringst, ist verlorene Zeit, denn sie wird dich ständig
von den Kindern und mir fernhalten.«
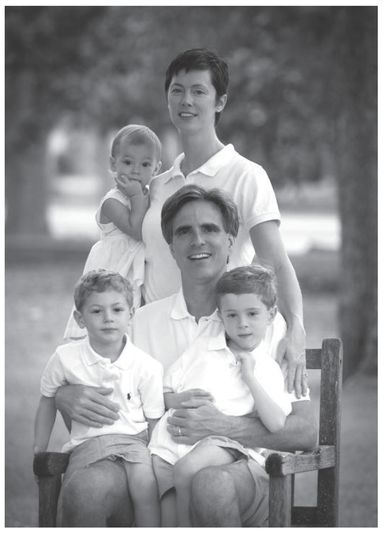
Logan, Chloe, Jai, ich und Dylan
Ich verstand ihre Vorbehalte. Als ich krank
wurde, hatte ich mir geschworen, auf Jai einzugehen und ihre
Wünsche zu berücksichtigen. Ich empfand es geradezu als meine
Mission, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihr Leben von
den Bürden zu entlasten, die ihr durch meine Krankheit auferlegt
wurden. Deshalb verbrachte ich viele Stunden zwischen Schlafen und
Wachen damit, Arrangements für die Zukunft meiner Familie zu
treffen, die ohne mich stattfinden wird. Trotzdem kam ich nicht
gegen den Drang an, diese letzte Vorlesung zu halten.
Im Laufe meiner akademischen Karriere hielt ich
so manche ziemlich gute Rede. Doch wenn man als der beste Redner
eines Computer Science Department gilt, dann ist das, als hielten
sie dich für den größten der sieben Zwerge. Diesmal hatte ich
jedoch tatsächlich das Gefühl, dass mehr in mir steckt und ich den
Menschen etwas Besonderes anbieten könnte, wenn ich alles gäbe.
»Weisheit« ist ein großes Wort, aber vielleicht ist es das passende
für diesen Moment der Erkenntnis.
Jai war noch immer unglücklich über meine
Entscheidung. Schließlich beschlossen wir, die ganze Sache mit
Michele Reiss zu besprechen, einer Psychotherapeutin, zu der wir
seit ein paar Monaten gingen, weil sie sich darauf spezialisiert
hatte, Paaren beizustehen, die mit der tödlichen Krankheit eines
Partners konfrontiert sind.
»Ich kenne Randy«, sagte Jai zu Dr. Reiss. »Er
ist ein Workaholic. Ich weiß, wie er sein wird, wenn er diese
Vorlesung vorbereitet. Es wird ihn völlig in Anspruch nehmen.« Sie
hielt diese Lecture für eine total unnötige Ablenkung von all den
erdrückenden Fragen, mit denen wir uns herumschlagen mussten.
Jai war noch wegen etwas anderem aufgebracht.
Wenn
ich die Vorlesung am angesetzten Termin halten wollte, dann würde
ich am Tag vorher nach Pittsburgh fliegen müssen, und das war Jais
einundvierzigster Geburtstag. »Es ist mein letzter Geburtstag, den
wir gemeinsam feiern können«, sagte sie zu mir. »Du willst mich
tatsächlich an diesem Tag alleinlassen?«
Natürlich war es ein schmerzlicher Gedanke,
diesen Geburtstag nicht mit Jai zu verbringen. Trotzdem ließ mich
der Gedanke an die Vorlesung nicht los. Ich hatte begonnen, sie als
den letzten Akt in meiner Karriere zu betrachten, als eine
Möglichkeit, mich von meiner »Arbeitsfamilie« zu verabschieden.
Außerdem ertappte ich mich bei der Vorstellung, dass sie das
oratorische Äquivalent jenes letzten Balls sein würde, den der
Schläger vor seinem Abschied vom Baseball ins Upper Deck
schmettert. Die Schlussszene aus Der
Unbeugsame, in der der alternde Spieler Roy Hobbs zur
Überraschung aller diesen himmelhohen Homerun schlägt, hat mir
schon immer gefallen.
Dr. Reiss hörte Jai und mir zu. In Jai, sagte
sie, sehe sie eine starke, liebende Frau, die Jahrzehnte eines
erfüllten Lebens mit einem Ehemann vor sich gesehen hatte, der mit
ihr zusammen die Kinder aufzog. Nun musste unser gemeinsames Leben
auf wenige Monate verdichtet werden. In mir sah Dr. Reiss einen
Mann, der noch nicht bereit war, sich vollständig ins Privatleben
zurückzuziehen, und ganz gewiss nicht bereit, sich auf sein
Sterbebett zu legen. »Diese Vorlesung wird für viele Menschen, die
mir etwas bedeuten, eine letzte Möglichkeit sein, mich noch einmal
in Fleisch und Blut zu sehen«, erklärte ich rundheraus. »Und mir
gibt sie nicht nur die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was mir
am meisten bedeutet, sondern auch die Chance, noch einmal alles zu
tun, was mir
auf dem Weg aus dem Leben möglich ist, um das Bild zu zementieren,
das die Menschen von mir in Erinnerung behalten werden.«
Mehr als nur einmal hatte Dr. Reiss Jai und mich
auf ihrer Bürocouch sitzen sehen, eng aneinandergeschmiegt, beide
in Tränen aufgelöst. Sie sagte, sie nehme den großen Respekt wahr,
den wir einander entgegenbrächten, und sei oft tief bewegt gewesen
von unserer Entschlossenheit, unsere letzte Zeit zusammen wirklich
gut hinzukriegen. Doch bei der Frage, ob ich diese letzte Vorlesung
halten sollte oder nicht, könne sie sich nicht einschalten, das sei
nicht ihre Aufgabe. »Das müsst ihr selbst entscheiden«, sagte sie
und drängte uns, einander genau zuzuhören, damit wir einen
Beschluss fassen konnten, der für uns beide richtig war.
Angesichts von Jais Zurückhaltung wusste ich,
dass ich meine Motive ganz ehrlich betrachten musste. Warum
bedeutete mir diese Vorlesung so viel? Bot sie sich als eine
Möglichkeit an, mir und allen anderen zu beweisen, dass ich noch
immer höchst lebendig war? Oder zu zeigen, dass ich noch immer
genug Kraft hatte, um zu funktionieren? War es das Bedürfnis eines
Mannes, der das Rampenlicht liebt, ein letztes Mal auf den Putz zu
hauen? Die Antwort auf all diese Fragen war: Ja. »Ein verletzter
Löwe will wissen, ob er noch brüllen kann«, sagte ich zu Jai. »Es
geht um Würde und Selbstachtung, und das ist nicht ganz das Gleiche
wie Eitelkeit.«
Aber hier spielte noch etwas anderes eine Rolle:
Ich begann diese Vorlesung als mein Medium zu betrachten, auf dem
ich in jene Zukunft gleiten konnte, die ich nie sehen würde.
Ich erinnerte Jai an das Alter unserer Kinder:
fünf Jahre, zwei Jahre, ein Jahr. »Schau«, sagte ich, »mit seinen
fünf
Jahren wird sich Dylan vermutlich ein paar Erinnerungen an mich
bewahren. Aber an wie viel wird er sich wirklich erinnern? Was
wissen wir denn noch aus der Zeit, als wir fünf waren? Wird Dylan
noch wissen, wie ich mit ihm gespielt habe und worüber er mit mir
gelacht hat? Bestenfalls wird er sich vage erinnern. Und was ist
mit Logan und Chloe? Sie werden sich vermutlich an gar nichts
erinnern. Null. Vor allem Chloe. Und ich sage dir, wenn die Kinder
älter sind, dann werden sie durch diese Phase gehen, dann werden
sie sich schmerzlich danach sehnen, etwas zu erfahren: Wer war mein
Vater? Wie war er? Diese Vorlesung könnte ihnen einmal helfen,
Antworten auf ihre Fragen zu finden.« Ich würde sicherstellen,
erklärte ich Jai, dass Carnegie Mellon den Vortrag aufzeichnete.
»Ich besorge dir eine DVD. Wenn die Kinder älter sind, kannst du
sie ihnen vorspielen. Es wird ihnen helfen, zu verstehen, wer ich
war und was mir wichtig war.«
Jai ließ mich ausreden, dann stellte sie die
naheliegende Frage: »Wenn es etwas gibt, das du den Kindern sagen
willst, oder einen Rat, den du ihnen geben willst, warum stellst du
dann nicht einfach eine Videokamera auf und sagst es ihnen hier im
Wohnzimmer?«
An dem Punkt hatte sie mich fast. Aber eben nur
fast. Der natürliche Lebensraum des Löwen ist der Dschungel, und
mein Dschungel war noch immer der Campus, umringt von meinen
Studenten. »Eines habe ich gelernt«, sagte ich zu Jai, »nämlich,
dass es nichts schadet, wenn Außenstehende zum ausgleichenden
Element bei Dingen werden, die Eltern ihren Kindern sagen wollen.
Wenn ein großes Publikum an den richtigen Stellen lacht oder
applaudiert, dann kann das dem, was ich den Kindern sagen will,
vielleicht noch mehr Gewicht verleihen.«
Jai lächelte mich an, ihren sterbenden Showman,
und lenkte endlich ein. Sie wusste, dass ich mich nach einer
Möglichkeit verzehrte, den Kindern etwas zu hinterlassen. Okay,
vielleicht bot diese Vorlesung ja wirklich einen Weg.
Nachdem ich grünes Licht von Jai bekommen hatte,
stand ich vor einer ziemlichen Herausforderung. Wie konnte ich
diese akademische Vorlesung so gestalten, dass sie in zehn Jahren
oder noch später Anklang bei meinen Kindern finden würde?
Definitiv wusste ich nur, dass ich mich dabei
nicht auf den Krebs konzentrieren wollte. Meine medizinische
Geschichte war, wie sie war, und ich war sie schon x-mal von vorne
bis hinten durchgegangen. Eine Abhandlung über meinen intimen
Umgang mit der Krankheit oder über die neuen Perspektiven, die sie
mir eröffnete, interessierte mich nicht. Viele Leute erwarteten
wahrscheinlich, dass ich über das Sterben reden würde. Aber ich
wollte unbedingt über das Leben reden.

»Was macht mich einzigartig?«
Das war die Frage, die sich mir am
vordringlichsten stellte. Wenn ich sie beantworten konnte, dann
konnte ich vielleicht auch herausfinden, was ich den anderen
eigentlich mitteilen wollte. Ich saß mit Jai im Vorzimmer eines
Arztes in der Johns-Hopkins-Klinik. Wieder einmal warteten wir auf
einen Bericht der Pathologie. Da platzte ich mit meinen Gedanken
heraus.
»Der Krebs macht mich nicht einzigartig«, sagte
ich. So viel steht fest. Bei über 37 000 Amerikanern wird
alljährlich allein Pankreaskrebs diagnostiziert.
Also grübelte ich, wie ich mich selbst
definierte: als einen
Lehrer, einen Computerwissenschaftler, einen Ehemann, einen Vater,
einen Sohn, einen Freund, einen Bruder, einen Mentor meiner
Studenten - jede dieser Rollen schätzte ich. Aber unterschied mich
auch nur eine davon von anderen Menschen?
Ich hatte zwar immer schon ein gesundes
Selbstbewusstsein, aber ich wusste, dass es für diese Vorlesung
mehr als nur meines Stolzes und der Tapferkeit bedurfte. Also
fragte ich mich: »Was habe ich als einzelner Mensch wirklich
anzubieten?«
Und dann, genau dort in diesem Wartezimmer,
wusste ich plötzlich, was es war. Es überkam mich wie ein
Geistesblitz: Was auch immer ich erreicht hatte, es war alles eine
Folge meiner kindlichen Vorlieben und aus den Träumen und Zielen
meiner Kindheit entstanden - und dass ich mir fast alle diese
Träume erfüllen konnte, hat viel mit meinem spezifischen Charakter
zu tun. Meine Einzigartigkeit, das wurde mir nun bewusst, lag in
der Besonderheit der Träume, die meine sechsundvierzig Lebensjahre
definiert hatten, von den bedeutsamen bis hin zu den ausgesprochen
schrulligen. Ich saß in dem Wartezimmer und wusste, dass ich mich
trotz des Krebses für einen rundum glücklichen Mann hielt, weil ich
diese Träume ausgelebt hatte. Aber verwirklicht hatte ich sie nicht
zuletzt auch dank der außergewöhnlichen Menschen, die mich auf
meinem Weg so vieles gelehrt hatten. Wenn es mir gelingen würde,
meine Geschichte mit der gleichen Leidenschaft zu erzählen, mit der
ich sie gelebt hatte, dann würde meine Vorlesung vielleicht auch
anderen helfen, einen Weg zur Verwirklichung ihrer Träume zu
finden.
Ich hatte meinen Laptop mitgenommen und begann,
angefeuert von dieser Erleuchtung, eilig eine E-Mail an die
Veranstalter der Vorlesung zu schreiben. Endlich hätte ich einen
Titel für sie, schrieb ich: »Ich entschuldige mich für die
Verzögerung. Nennen wir’s ›Deine Kindheitsträume wahr
machen‹.«