16
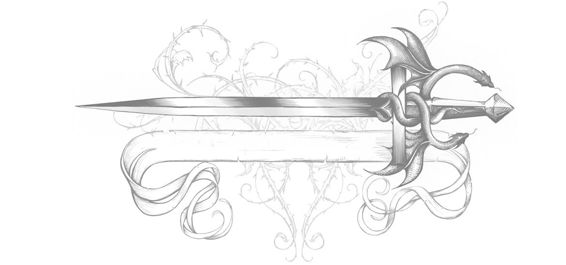
Lissen Carak · Michael
Michael sah dem Hauptmann zu, während dieser schlief. Die Morgendämmerung kam näher, und er fluchte darüber, wach zu sein. Er stand auf, pinkelte in einen Topf, trank ein halbes Glas schalen Weines und spuckte ihn sofort in den Hof.
Dieser Ort stank wie ein Schlachthaus, und die meisten Soldaten hatten eng nebeneinander im Turm geschlafen. In ihren Rüstungen.
Er ging zum Tisch, öffnete seinen Beutel, nahm ein Wachstäfelchen heraus, zog auch seinen Stift hervor und schrieb:
Die Belagerung von Lissen Carak. Fünfzehnter Tag.
Gestern hat der Feind versucht, die Brückenburg zu erstürmen, und obwohl es ihm gelungen ist, seine Ungeheuer in den Burghof zu bringen, wurde er zurückgeschlagen. Wie haben mehr als vierzig Männer, Frauen und Kinder aus den Karawanen verloren und auch drei Soldaten und zwei Bogenschützen sowie vier Männer aus der Miliz. Es waren unsere bisher schlimmsten Verluste.
Aber der König kommt. Am dreizehnten Tag erreichten uns Ritter des Ordens vom heiligen Thomas bei Anbruch der Nacht und sagten uns, wir seien gerettet. Aber wir haben den ganzen Tag hindurch gekämpft, und der König ist nicht gekommen.
Wo steckt er?
Michael betrachtete die letzte Zeile und radierte sie schließlich mit dem stumpfen Ende seines Stiftes wieder aus. Dann schüttelte er den Kopf und weckte den Hauptmann.
In der Nähe von Lissen Carak · Der König
Die Sonne war ein Feuerbogen tief im Osten.
Die großartige goldene Rüstung des Königs sowie seine strahlend roten und blauen heraldischen Abzeichen fingen die ersten Strahlen der Sonne ein, sodass er geradezu in Flammen zu stehen schien.
Hinter ihm befanden sich dreihundert der bestgerüsteten Ritter, die Albia je gesehen hatte; ihre schweren Pferde hatten sie im Lager gelassen.
Der goldene Helm bewegte sich nach rechts und links und prüfte die lange Reihe der ritterlichen Krieger, die zu beiden Seiten bis in den Wald reichte, und hinter jedem der Ritter stand ein ebenfalls gerüsteter Knappe.
Der König hob den goldenen Panzerhandschuh, senkte ihn wieder, und die Vorhut setzte sich auf der alten Brückenstraße in Bewegung. Die dreihundert Ritter hielten einen Abstand von je einer Manneslänge zueinander; ihre Reihe war eine halbe Meile lang, und die Männer an beiden Enden hatten Jagdhörner, auf denen sie wie Jäger bliesen.
Die Gestalt des Königs schien freudig hin und her zu tanzen.
Er drängte durch den Wald, und der Wald teilte sich vor ihm. Es gab nichts, was einem Mann in voller Rüstung hätte Widerstand leisten können – kein Zweig, keine Ranke, wie dornenbesetzt auch immer, kein dichtes Röhricht. Nichts konnte einen Ritter aufhalten oder auch nur bremsen.
Die Reihe stapfte in Schrittgeschwindigkeit voran.
Eine halbe Meile.
Eine Meile.
Er hob die Hand, und sein eigener Hornbläser stieß einen langgezogenen Ton aus. Die Reihe hielt an.
Die Soldaten hoben ihre Visiere und tranken Wasser, doch es war noch früh am Morgen und recht kühl in den dunklen Wäldern.
Die Männer zupften Zweige aus ihren Kniepanzerungen, aus den Armhöhlen und den Ellbogenkappen.
Und dann, beim Schall von zwei Hörnern, setzte sich die Reihe wieder in Bewegung; es war wie bei einer gewaltigen Bärenjagd.
Eine Meile hinter ihnen folgte der Rest der Armee.
Die Vorhut drang tiefer in den Wald ein, angeführt vom König höchstpersönlich.
Bill Redmede sah die Gestalten in ihren Rüstungen zu Fuß kommen, und die Bitternis in seinem Herzen hätte ausgereicht, um Stahl zu schmelzen.
So viel zu Thorn und seiner Verachtung für die Menschen.
Bill wandte sich an seinen Leutnant Nat Tyler von der Albin-Ebene. »Die verdammten Adligen haben einen Spion, Bruder.«
Tyler beobachtete den unerbittlichen Vormarsch der gerüsteten Männer. »Und wir stecken tief im Gebüsch.«
»Thorn hat gesagt, sie würden über die Straße reiten«, meinte der andere Wildbube. »Verdammt.«
»Wir sollten abhauen«, sagte Tyler.
»Das ist unser großer Tag!«, wandte Bill ein. »Heute töten wir den König!«
Siebzig Fuß entfernt von ihnen stand der König allein in einem Schaft aus Licht im tiefen Wald und hob die Arme. In der einen Hand hielt er ein vier Fuß langes Schwert und in der anderen einen glänzenden Schild.
Redmede zog seinen großen Bogen, spannte ihn, zielte und schoss.
Neben ihm gab Tylers Bogen einen tiefen knallenden Laut von sich – die Harfe des Todes.
Überall sprangen nun die Wildbuben aus dem Hinterhalt und feuerten auf den König.
Die Gestalt des Königs glitzerte, als er auf den Absätzen herumwirbelte, sich den Schild über den Kopf hielt und den ersten Pfeilschwarm mit dem Schwert in der Luft zerhackte.
Überall um ihn herum stürmten nun die Ritter auf die Bogenschützen zu.
Der König wich nicht von der Stelle. Er drehte sich schnell hin und her, hieb mit seinem Schwert zu, schwankte vor und zurück.
»Gütiger Jesus«, murmelte Bill. Nicht ein einziger Pfeil hatte ihn getroffen. »Zu weit. Verdammt, zu weit!«
Aber die Wildbuben waren Räuber und Partisanen und keine schlachterprobten Männer. Sie wirbelten herum und rannten davon.
Hundert Schritt weiter hinten formierte sich die Reihe der Wildbuben neu. Nat Tyler brachte sie am Rand einer Wiese in Formation, die eine Drittelmeile lang und etwa zweihundert Fuß breit war. Es handelte sich um eine alte Biberwiese, die von einem sich schlängelnden Bach durchzogen war. Bill führte die Männer durch den Bach, der ihnen bis zur Hüfte reichte. Dahinter bildeten sie eine neue Reihe.
»Schon besser«, sagte Nat Tyler mit einem grimmigen Lächeln.
Die Soldaten mussten eine Pause eingelegt, sich ausgeruht und Wasser getrunken haben. Die Sonne stand schon viel höher, als sie endlich erschienen – aber nun kamen sie alle zusammen. Sie rückten in einer einzigen Linie vor. Diesmal rief der Hauptmann der Wildbuben ihnen zu, sie sollten sich ihre Ziele sorgfältig auswählen und den König den Meisterschützen überlassen. Schon flogen die Pfeilschwärme über das offene Gelände.
Er konnte nicht länger jeden Pfeil in der Luft zerhacken. Die schweren Schäfte prallten an seinem Schild und am Helm ab. Er beugte sich vor wie ein Mann, der in einem Sturm unterwegs war, aber sein Herz sang, denn dies war eine große Waffentat. Er lachte und rannte schneller.
Unter seinen Füßen tat sich der Bach auf, und er fiel geradewegs ins tiefe Wasser.
Zwei Bauern traten an den Rand des Baches und schossen ihre Pfeile aus geringster Entfernung auf ihn ab.
Gaston sah, wie der Angriff ins Stocken geriet, und blies in sein Horn. Die Männer fielen irgendwo hinein. Es war entweder eine Reihe von Gruben oder ein verborgener Graben …
Ein Pfeil prallte von seiner Brustplatte ab, dellte sie dabei tief ein, und dann packte er den König mit gepanzerter Faust und riss ihn mit einem einzigen Zug aus dem schlammigen Wasser. Neben ihm schoss sein Knappe vor Wut einen Kurzpfeil über den Bach und traf – eher aus Glück als Geschick – einen Bauern in die Brust, der kreischend nach vorn klappte. Als der König wieder festen Boden unter den Füßen hatte, rannte er sofort auf einen Biberdamm zu, der die einzige Brücke über das Wasser darstellte.
Gaston folgte ihm ebenso wie jeder andere Ritter in seiner Nähe. Der Damm befand sich zur Hälfte im Wasser und war keineswegs völlig fest, sondern nur eine hastige Anhäufung von Zweigen und verfaultem Holz. Doch der König schien geradezu darüberzuschweben, während Gastons rechtes Bein sogleich ins Wasser rutschte, das so kalt wie Eis war. Er verlor das Gleichgewicht, ruderte mit den Armen, hätte beinahe sein Schwert verloren, und dann prallte auch noch ein Pfeil gegen seinen Helm.
Der König rannte weiter über den unebenen Damm. Die erste Hälfte führte zu einem Felsen, der aus dem Wasser ragte, und die zweite Hälfte war noch schlechter, denn sie lag eine Spanne tief unter Wasser. Dennoch rannte der König darüber und schaffte es bewundernswerterweise, das Gleichgewicht zu halten, während das aufstiebende Wasser unter ihm glitzerte und die Schützen weiterhin Pfeile auf ihn abschossen. Einer davon gelangte an seinem Schild vorbei und bohrte sich unter der Panzerung in die Schulter. Ein anderer flog gegen seinen Helm, doch dann war er zwischen den Schützen, und sein Schwert bewegte sich schneller als eine Libelle an einem Sommerabend. Gaston bemühte sich, zu ihm aufzuschließen, und keuchte wie ein Pferd am Ende eines langen Galopps. Er war nass, das linke Bein wurde kurz vom Schlamm angesogen, doch dann war er bei dem König, hatte die Reihe der Bogenschützen durchbrochen, als die Hörner das Signal zum Angriff gaben.
Er folgte dem König auf einen kleinen Hügel hinauf, der sich inmitten der Wiese erhob, und nun durchquerten immer mehr Ritter den Bach hinter ihnen. Weit zur Linken preschten etliche Ritter über die schmale Fußbrücke bei der Straße, und nun waren die bäuerlichen Schützen wieder in Gefahr und rannten davon.
Doch als sie sich zurückzogen, griffen die Lindwürmer an.
Gaston sah den ersten – gewahrte das Flackern seines Schattens und schaute in ungläubigem Staunen hoch, als die Welle des Schreckens ihn und auch die albischen Ritter traf. Die Albier schwammen geradezu durch das handgreifliche Entsetzen, und er selbst weigerte sich anzuhalten, auch wenn er einen Augenblick lang kaum mehr atmen konnte. Die Ritter hasteten weiter vor, obwohl das pferdegroße Ungeheuer ein ganzes Dutzend von ihnen mit einem einzigen Schwung seiner Krallen und seines Schnabels tötete.
Insgesamt waren es drei dieser Kreaturen.
Gaston sah zu, wie der König einem Wesen der Hölle gleich auf den ersten Lindwurm zusprang. Sein Schwert schnitt die eine Schwinge am Ansatz ab und riss gleichzeitig eine Schwertlänge von Schuppen aus dem Hals des Wesens. Da wirbelte es zu ihm herum, doch schon war er verschwunden, war unter dem peitschenden Hals hindurchgetaucht, und seine Klinge fuhr hoch in den Bauch des Lindwurms und schnitt das Ungetüm vom Hintern bis zum Brustkorb auf. Als das Gedärm herausfiel, war er schon wieder verschwunden.
Gaston folgte ihm zum zweiten Lindwurm, der soeben den Bischof von Lorica mit einem einzigen Schlag zu Boden geworfen und den Kopf seines Knappen vom Körper gefetzt hatte. Gaston hob seinen Speer und rammte ihn in den Kopf des Ungeheuers. Dabei verlor er auf dem unebenen Boden, der mit Gezweig gespickt war, das die Biber übrig gelassen hatten, das Gleichgewicht. Er taumelte, verlor auch noch seinen Speer, wirbelte herum und zog sein Schwert, als der Kopf, aus dem noch der Speer hing, auf ihn zuschoss.
Er schlug mit aller Kraft auf das Maul.
Das Haupt des Lindwurms warf ihn zu Boden.
Es ragte über ihm auf. Nun stachen Speer und Schwert darin, und der König sprang darauf. Blut tropfte aus der Pfeilwunde in seiner linken Schulter, während der Mann mit nur einer Hand den Hals des Monstrums durchschlug und den Kopf abtrennte.
Die überlebenden Ritter jubelten brüllend, und Gaston kämpfte sich langsam wieder auf die Beine. Er war vom heißen Blut des Wesens durchtränkt und griff nach seinem Schwert, das noch im Kiefer der Bestie steckte. Es fiel ihm nicht leicht, die Waffe herauszuziehen.
Der dritte Lindwurm befand sich bereits wieder in der Luft, hatte eine Spur aus zerschmetterten Rittern hinterlassen, machte jedoch hoch oben kehrt und warf sich auf den König, den er mit sich zu Boden riss.
Jeder noch lebende Ritter machte sich nun über den Lindwurm her, und die Schläge fielen wie ein Stahlregen auf ihn herab. Fleischstücke flogen in die Höhe wie Staub unter den ersten Tropfen des Regens.
Der Lindwurm kauerte sich zusammen und versuchte sich wieder in die Lüfte zu erheben, doch Gaston rammte ihm den Speer in den Hals, und nur wenige Fuß entfernt traf Ser Alcaeus das Wesen so heftig mit seinem Hammer, dass es ins Taumeln geriet. Der König kämpfte sich unter ihm frei, kam auch tatsächlich auf die Beine und stieß ihm sein Schwert bis zum Anschlag in die Eingeweide, bevor er auf die Knie sackte.
Der Lindwurm kreischte auf.
Der König fiel zu Boden, seine goldene Rüstung war mit dem Blut dreier mächtiger Feinde beschmiert.
Ser Alcaeus schwang seinen Hammer hoch über dem Kopf, schrie allen Trotz heraus und rammte den Bleikopf in den Schädel des Lindwurms. Das Biest brach über dem König zusammen.
Ein Dutzend gepanzerter Hände zerrten das tote Wesen von dem König herunter, während hinter ihnen Trompeten erschallten und die Kavallerie zwischen den Bäumen hervorbrach.
Gaston rannte zum König. Er legte den Kopf des Königs auf sein Knie und öffnete das Visier.
Der Blick seines wahnsinnigen Vetters traf ihn.
»Bin ich nicht der größte Ritter der ganzen Welt?«, brüllte er. »Ich bin doch kein Feigling, der es zulässt, dass sein Lehensherr getötet wird!«
In seinen Augen flackerte es. »Zieh mir endlich den Pfeil aus der Schulter, und leg mir einen Verband an. Das ist meine Schlacht!« Dann erlosch das Licht in seinen Augen.
Gaston hielt seinen Vetter fest, während einige Knappen die Blutung zu stillen versuchten und ihm Brustpanzer und Kettenhemd abnahmen. Die Überreste der Vorhut rückten weiter voran.
»Er hat es heute Morgen verlangt«, sagte eine Stimme hinter Gaston, und plötzlich verneigten sich die Knappen.
Dort stand der König von Albia in Jean de Vraillys Rüstung.
»Er sagte, er wisse, dass ich in einem Hinterhalt getötet werden sollte, und er wollte, dass ihm die Ehre zuteil werde, meine Stelle einzunehmen.« Der König schüttelte den Kopf. »Er ist ein wahrhaft großer Ritter.«
Gaston schluckte seine Entgegnung herunter und fragte sich, was sein verrückter Vetter da getan hatte. Und warum. Aber die wahnsinnigen Augen waren vermutlich für immer geschlossen.
Lissen Carak · Thurkan
Thurkan sah dem Fall des Königs zu. Seine Sehkraft war außerordentlich, und von seinem Aussichtsplatz zwei Berge entfernt konnte er erkennen, wie sich die Abnethog auf die Ritter stürzten.
Natürlich hatte er ihnen gesagt, dass er ihren Angriff flankieren werde.
Den Wildbuben hatte er das Gleiche gesagt.
Aber Thorn war zum Untergang verdammt, und Thurkan hatte gewiss keine Lust, seine eigenen Leute noch länger leiden zu lassen.
Er wandte sich an seine Schwester. »Wenn sich die Menschen gegenseitig bekämpfen, werden wir ein Festmahl haben.«
»Ich sehe nichts dergleichen«, sagte Mogan.
»Ich auch nicht«, meinte Korghan.
Hinter ihnen standen vierzig weitere ihrer Art – genug Qwethnethog, um das Schlachtenglück zu wenden. »Geh und sag den Sossag und den Abonacki, dass die Schlacht verloren ist«, teilte Thurkan seiner Schwester mit.
»Das ist sie auch erst, wenn wir fliehen«, beharrte sie. »Bei Fluss und fließendem Wasser, ist das etwa dein Wille?«
Thurkan runzelte die Stirn; tiefe Runzeln erschienen auf seinem Kinn. »Thorn muss sterben, und zwar jetzt, solange er noch schwach ist. Sonst nämlich wird er uns zur Strecke bringen.«
Mogan hielt ihre Schnauze nahe an die ihres Bruders. »Ich will einfach nicht glauben, dass es hier nur um die Rivalität zwischen zwei Mächten geht«, fuhr sie ihn an. »Ich habe ebenso meinesgleichen verloren, wie du deinesgleichen verloren hast. Uns ist ein Festmahl versprochen worden, und …«
»Wir hatten ein Festmahl bei Albinkirk und ein weiteres auf der Straße.« Thurkan schüttelte den Kopf. »Ich habe meine Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Thorn muss gehen. Wir werden gelenkt.« Er dehnte die Krallen an seinen Füßen und bewegte jede in einem kleinen Bogen. »Irgendetwas hat Einfluss auf uns. Ich kann es spüren.«
Mogan schnaubte verächtlich. »Also gut«, sagte sie. »Ich gehorche. Aber nur unter Protest.« Sie rannte in den Wald hinein, so flink wie eine Hirschkuh.
»Nach Westen«, sagte Thurkan zu seinem Bruder.
»Ich kann dir helfen«, meinte dieser.
»Vielleicht. Aber Mogan kann unseren Clan nicht anführen und auch keine neuen Eier besamen. Du jedoch vermagst dies.« Er drehte seinen großen Kopf. »Gehorche, Bruder.«
Verärgert schnalzte Korghan mit der Zunge. »Also gut, Bruder.«
Die beiden Clantruppen machten sich auf den Weg nach Westen, während die Ritter des Königs bereits den Berg erkletterten und auf sie zukamen.
Bill Redmede rannte, verschoss einen Pfeil aus seinem schwindenden Vorrat und rannte weiter. Seine Pfeile mit den Dolchspitzen waren aufgebraucht, und er hatte nur noch seine Jagdpfeile.
Diese gottverdammten Adligen hatten mehr Panzer, als er je gesehen hatte. Und die Ungeheuer – er war ein Narr gewesen, dass er ihnen je vertraut hatte. Damit hatte er gewiss seine Seele verwirkt. Er war verbittert, müde, wütend und besiegt.
Aber er hatte den König fallen sehen. Das verschaffte ihm zwar einen gewissen Trost, doch es schien den Rest der Adligen nicht aufzuhalten, und wie alle seiner Art erwartete Bill ein hässlicher Tod, wenn er erwischt wurde. Also hielt er einen Herzschlag lang inne, trat dann hinter dem Baum hervor, der ihm Deckung geboten hatte, schoss irgendeinem verdammten Lord einen Pfeil in die Armbeuge, drehte sich um und rannte weiter.
Er schaffte es die zweite Anhöhe hoch, von wo aus sie heute Morgen aufgebrochen waren und der große Dämonenlord seine Anweisungen gegeben hatte.
Alle Dämonen waren nun verschwunden. Verdammt sollten sie sein! Schlechte Verbündete für freie Menschen!
Der Fluss war jetzt nahe.
Am Fuß der Erhebung befanden sich Ritter in roten Wappenröcken, und er beobachtete, wie sie den Hang heraufkamen. Die meisten von ihnen waren abgestiegen, und ein Pfeilschwarm verriet ihm, dass seine Jungs noch immer Widerstand leisteten. Sie kämpften gegen die königliche Garde.
Er sollte verdammt sein, wenn er noch mehr Wildbuben verlor.
Damit drehte er sich um und rannte quer den Hang hinunter.
Er trat in dem Augenblick hinter Nat Tyler, in dem dieser seinen letzten Pfeil verschoss. »Komm, Nat – die Boote!«
Wie ein wildes Tier wirbelte Tyler herum, doch dann kam er wieder zu Sinnen, blies in sein Horn, und ein Pfeifen antwortete ihm.
»Folgt mir!«, rief Bill und lief wieder den Hügel hinauf. Die Beine wurden ihm schwer, und seine Lunge schrie nach Luft.
Hinter ihm schossen die Wildbuben ihre letzten Pfeile ab und rannten ebenfalls los – das »Rette-sich-wer-kann«-Signal war geblasen worden.
Bill rannte, und die Wildbuben rannten hinter ihm her. Als er sah, wie drei seiner Männer einem Ritter mit gezogenem Schwert und Schild gegenüberstanden, blieb er kurz stehen. Dann legte er einen weiteren Schaft in seinen Bogen ein. Noch ein Ritter brach zwischen den Bäumen hervor, überquerte den Grat des Hügels, hob sein Visier …
Die Gelegenheit für einen Schuss war allzu gut.
Hawthor Veney war stolz, dass er es allein bis zum Hügelgrat geschafft hatte. Es war sein erster Kampf, und er war ein königlicher Gardist. Sein roter Wappenrock rief es heraus, und die Wildbuben waren seine Feinde, die er gnadenlos verfolgte. Er erwischte einen von ihnen und hieb von hinten auf ihn ein. Es war ein unbeholfener Schlag, bei dem sich seine Waffe in den Hals des Mannes grub, doch der Mann ging zu Boden, Blut schoss aus der Wunde, und der Ritter riss seine Waffe aus dem Körper des Toten und rannte weiter.
Der Nächste, den er erwischte, fiel auf die Knie und bettelte um Gnade. Er war vielleicht vierzehn Jahre alt.
Hawthor hielt inne, doch ein älterer Gardist, der inzwischen zu ihm aufgeschlossen hatte, köpfte den Jungen. »Nissen machen Läuse«, sagte er und lief an ihm vorbei. Hawthor fasste sich ein Herz und lief ebenfalls weiter. Es war schwer, in der Rüstung zu laufen. Und noch beschwerlicher war es, einen Hang mit weichem Boden und verfilztem Unterholz zu erklettern. In seiner Lunge stach es, und als sich die Wildbuben immer wieder sammelten und tödliche Pfeile auf die Gardisten abfeuerten, musste Hawthor gegen den Drang ankämpfen, sein Visier zu öffnen.
Er kam an einigen Männern vorbei, sah Licht zwischen den Bäumen – der Hügelkamm näherte sich. Rechts von ihm hörte er Rufen. Er drehte sich dorthin um und hörte den Klang von Stahl gegen Stahl. Er schaute vor und zurück. Es musste zwar ganz nahe sein, doch mit geschlossenem Visier konnte er nicht erkennen, von wo es kam. Dann flackerte eine Bewegung vor ihm auf. Er lief einige Schritte darauf zu, blieb stehen und sah sich wieder um.
Er hörte das Schaben von gegeneinanderprallenden Klingen. Eine Stimme rief: »Rette sich, wer kann!«
Er keuchte wie ein Pferd nach einem Wettrennen. Er hatte Angst. Er hatte Angst, sie könnten hinter ihm sein. Er schob sein Visier hoch, drehte den Kopf …
Und starb.
In der Nähe von Lissen Carak · Bill Redmede
Bill hatte bereits einen weiteren Pfeil in seinen Bogen eingelegt, nachdem er den letzten dem Ritter ins Gesicht geschossen hatte – nun fühlte er sich besser. Aber zwei weitere seiner Männer lagen am Boden, und er hatte gewiss nicht vor, sich an dem Handgemenge zu beteiligen. Er lief davon.
Sie überquerten den Grat und hasteten auf der anderen Seite des Hügels auf ihre Boote zu. Eine Handvoll Ritter aus der Vorhut versuchten sie aufzuhalten, doch die Wildbuben rannten einfach um sie herum. Erschöpfte Männer ohne Rüstung waren gegenüber erschöpften Männern in Rüstung im Vorteil.
Bill sah den Grafen der Grenzmarken, der zum Greifen nahe schien, und er verfluchte sein Schicksal, dass er so dicht bei seinem Todfeind war und nichts gegen ihn unternehmen konnte.
Er rannte an dem Mann vorbei, weiter den steilen Abhang hinunter, auf das weite Feld, das vor gar nicht langer Zeit noch umgepflügt worden war. Nat Tyler kam links von ihm zwischen den Bäumen hervor, genau wie mehrere Dutzend weiterer Männer – nur eine Handvoll im Vergleich zu ihrer Zahl vor drei Wochen. Aber es war genug, um von Neuem zu beginnen.
Noch über die letzte Anhöhe, den Deich – und dann waren sie bei den Booten. Es waren fünfzig leichte Barken. Sie hatten in der vorletzten Nacht drei vorsichtige Fahrten benötigt, um alle Mann herzubringen, und jetzt …
Und jetzt hätten sie alle zusammen in ein einziges Boot gepasst.
Er warf seinen Bogen in den Rumpf des leichten Schiffes, schob es ins Wasser, sprang hinein und hastete bis zum Bug. Er lenkte es vom schlammigen Ufer weg, und mithilfe eines Paddels hielt er seine Position mitten im Strom. Nun kletterte ein junger blonder Mann ebenfalls in das Boot hinein und brachte es mit seiner Unbeholfenheit zum Schaukeln. Beinahe wäre es gekentert, doch bald ließen sie sich von den Stromschnellen wegtreiben.
Hinter ihnen wurden zwanzig weitere Boote zu Wasser gelassen. Die geschickteren Schiffer brachten sie in Bewegung, und die ungeschickteren starben, als die königliche Wache sie erreichte.
Von den Wildbuben sprangen etliche ins Wasser, ließen ihr Gepäck und ihre Bögen sowie die unschätzbar wertvollen Pfeile zurück, während einige die Geistesgegenwart besaßen, auch den Rest der Boote aus dem Schlamm zu ziehen und sie bis zur Flussmitte zu rudern, wo sie die Schwimmer aufnahmen.
Mehr als hundert Wildbuben waren in dieser Katastrophe gerettet worden.
Sie paddelten davon. Nun war deutlich zu sehen, dass die Brückenburg noch in der Hand der Söldner war. Der Bolzen einer Armbrust flog dicht über dem Wasser auf sie zu und bohrte ein Loch in eines der Boote.
Tyler winkte, deutete flussabwärts, winkte noch einmal und paddelte dann heftig, um sein Boot zu drehen.
Bill schaute in die aufgehende Sonne und ihren hellen Widerschein auf dem breiten Fluss – und sah Blitze. Es waren rhythmische Blitze: Ruderbänke auf schweren Schiffen, die flussaufwärts ruderten. Er zählte zwanzig – und noch einmal zwanzig …
Eine Katastrophe. Eine Katastrophe nach der anderen.
Er drehte den Kopf. »Weniger Kraft und mehr Gewandtheit, Kamerad. Wir müssen dieses Boot wenden und flussaufwärts paddeln … und dann wird uns deine Kraft zugute kommen.«
Zwei Armbrustbolzen flogen auf Armeslänge vorbei wie Schwalben, die auf der Jagd nach Insekten waren, bevor sie außer Sichtweite niedersanken.
Der Mann im Heck schüttelte den Kopf. »Ich bin kein Schiffer, Bruder«, gab er zu.
»Ganz gleich, Junge. Zieh dein Paddel nach links – genau so. Bald haben wir gedreht.« Bill war nicht umsonst zum Anführer aufgestiegen. Er war geduldig und besonnen, auch wenn alles auf dem Spiel stand.
Kurz darauf hatten sie das Boot gewendet, und die starken Arme seines Gefährten schoben es voran, sodass es sich wie ein springender Hirsch aufbäumte. Zwar war es die reine Kräfteverschwendung, aber Bill ließ zu, dass er sich müde machte, und steuerte vom Bug aus. Ein weiterer Pfeilschwarm flog aus den Armbrüsten der fernen Schiffe herbei, und er verlor drei Boote. Sie alle hatten sich auf der Breitseite zum Feind befunden, und alle drei hatten Bolzen abbekommen.
Bill Redmede war ein alter Schiffer. Und ein Meisterschütze dazu. Er verstaute sein Paddel, nahm seinen Bogen vom Boden des leichten Gefährts und rieb Holz und Sehne rasch mit Wachs ein. Dann sprang er auf das Dollbord, wobei sich das Boot bedenklich neigte.
»Gütiger Christus«, rief sein Kamerad entsetzt.
Er spannte den Bogen und schoss – es war nur eine einzige fließende Bewegung. Er hatte hoch gezielt. Dann kniete er, um in Deckung zu sein, und beobachtete den Flug seines Bogens.
Im gleißenden Sonnenschein verlor er den Blickkontakt. Aber nun fühlte er sich besser, nahm sein Paddel wieder auf und ruderte emsig weiter.
In der Nähe von Albinkirk · Desiderata
Desiderata trug ein geborgtes Kettenhemd zusammen mit einer Männerhose, einem schweren Wollkleid, das so eng geschnürt war, wie ihre Damen die Bänder hatten ziehen können, und auf ihrem Kopf saß eine Schutzkappe. Eigentlich hätte es lächerlich aussehen sollen, aber es wirkte im Gegenteil eher martialisch und anziehend, wenn man von den Reaktionen der Gildenmänner und Hochländer ausgehen durfte, die überall um sie herum auf dem Vordeck und in den Ruderreihen standen.
Lady Almspend befand sich an ihrer Seite. Sie trug ebenfalls ein Kettenhemd, trug einen Schaller auf dem Kopf und ein Schwert an der Hüfte. Sie sah lächerlicher aus als die Königin, strahlte Ranald Lachlan aber an, dessen Aufmerksamkeit zwischen seiner Liebe und dem Herannahen des Kampfes hin und her gezogen wurde. Die Herde war im Lager eingepfercht, und zwanzig Männer seines Bruders waren als Wachen zurückgelassen worden. Er stand in Kettenhemd und Beinschienen da, sein offener Helm und Lederrock wirkten im Vergleich zu den Armbrustschützen der Gilden von Lorica, von denen die meisten über schicke Rüstungen und Helme mit Visieren verfügten, so wie es die letzte Mode auf dem Kontinent war, beinahe barbarisch. Er hatte die Hände auf seine große Axt gelegt.
Die Königin sah ihn an. Er wirkte jetzt stiller, als sie ihn im ganzen letzten Jahr erlebt hatte. Ihrer Schreiberin zufolge sollte er sogar tot gewesen sein. Die Königin vermutete, dass dies eine sehr ernüchternde Erfahrung gewesen sein musste.
»Kobolde am Flussufer«, sagte Ranald und deutete mit der gepanzerten Hand auf sie.
»Hab sie«, sagte einer der Gildeoffiziere. »Kobolde steuerbord. Sucht eure Ziele aus. Feuer!«
Ein Dutzend Pfeile flogen los.
»Der König muss siegreich gewesen sein«, sagte Lady Almspend. »Die Männer, die vor uns über den Fluss fliehen, gehören nicht zu uns.«
Ranald drehte sich so schnell zu ihr um, dass sein Nackenschutz gegen den Helm klatschte. »Gute Augen, Mylady.« Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln und freute sich, sie gerade bei seiner Lieblingsbeschäftigung zur Gesellschaft zu haben. Lange beobachtete er die Boote vor ihnen, während er die Sonne mit seiner gepanzerten Hand abschirmte. »Das sind Menschen. Sie tragen so etwas wie eine Uniform. Jetzt, wo sie ihre Boote gewendet haben …«
Der Gildenoffizier war in den Bug geklettert. »Das sind Wildbuben, bei Gott! Rebellen! Verräter! Häretiker!« Er hob seine Armbrust, zielte sorgfältig und schoss einen Bolzen ab.
In diesem Augenblick feuerten die Kobolde am Nordufer Pfeile auf sie ab.
Die Königin zuckte zusammen. In ihrer Kehle kratzte es. Zum ersten Mal hatte sie Angst.
»Wir sind zu weit nach Westen gekommen«, sagte Ranald. »An beiden Ufern sind Feinde, und der König wird noch nicht wissen, dass wir hier sind.«
Die Königin hatte am gestrigen späten Nachmittag eine Botschaft vom König empfangen, und sie hatte befohlen, die ganze Nacht hindurch zu rudern. Die Nachrichten, die der Bote überbracht hatte, hatten zugetroffen. Heute war der Tag – und sie wollte ihn erleben.
Sie stand auf dem Vorderdeck, beschattete die Augen mit der Hand und blickte erst nach vorn, dann nach rechts und nach links. Links sah sie etwas Rotes aufblitzen, dann noch etwas – und dann erschien ein halbes Dutzend königlicher Gardisten am Ufer. Sie winkte ihnen zu, und ihre Hofdamen jubelten.
»Geht hier vor Anker«, befahl sie.
Ein halbes Dutzend Koboldpfeile gingen über dem Dollbord nieder. Die meisten waren von den Lederbehängen abgelenkt worden, die die Ruderer schützten. Einer aber hatte sein Ziel gefunden, und dem Mann fiel das Ruder aus den Händen, während er aufschrie. Der Pfeil hatte sich tief in seine Schulter gebohrt.
Kobolde pflegten ihre Pfeile zu vergiften, und seine Schreie ließen das Blut der Königin gefrieren. Seine schrecklichen Zuckungen, das viele Blut, das ihm an der Brust herunterfloss … als sie am Ufer gelegen hatten, hatte er noch mit ihren Hofdamen gescherzt und gelacht und Wurst gegessen.
Es war ein ebenso großer Schock für sie wie der Anblick eines Kobolds.
Ein Pfeil schoss aus dem Himmel nieder wie ein Falke auf der Jagd nach Beute, traf auf ihren Helm, kratzte an ihrem Rücken entlang und warf sie zu Boden.
Sie lag auf dem Deck. Plötzlich war der Tag dunkler geworden, und ihr Rücken war feucht.
»Seht nach der Königin!«, brüllte Ranald.
Sie griff nach dem goldenen Licht der Sonne; es war überall um sie herum, was für ein prächtiger Tag …
»Sie wird verbluten! Er steckt in ihrem Rücken!«. Ranald tat irgendetwas.
»Ist er vergiftet?«, fragte Lady Almspend.
»Das glaube ich nicht. Gebt mir Euer Federmesser. Verdammt – eine Schwalbenschwanzspitze.« Lachlan klang verängstigt.
Sie schwebte über ihnen allen und konnte sehen, wie der Hochländer mit einem Messer in ihrem Rücken herumgrub. Er hatte ihr das Kettenhemd über die Hüften geschoben und den Schaft des Pfeiles abgeschnitten. Selten hatte sie sich selbst so unelegant gefühlt.
»Er hat ihre Niere getroffen«, sagte Lachlan, setzte sich auf den Absätzen zurück und wirkte plötzlich ganz verloren. »Heiliger Jesus.«
Wie alle anderen auch hatte der Hauptmann in seiner Rüstung geschlafen. Sein behelmter Kopf lag in einer Ecke der Ringmauer, dort wo der westliche Teil gegen den Nordturm stieß. Vier Angriffe zur Rückeroberung des Turmes waren abgewehrt worden, und nun war er so müde …
»Schiffe auf dem Fluss, Hauptmann.« Jack Kaves, einer der Meisterschützen, stand über ihm. »Ich habe Euch einen Becher Bier geholt. Michael hat versucht, Euch zu wecken, und dann ist er auf die Suche nach Wein gegangen.«
Der Hauptmann nahm das Bier, spülte sich damit den Mund durch und spuckte es schließlich über die Mauerbrüstung auf den Berg aus Koboldleichen, danach nahm er einen tiefen Schluck. Der halbe Koboldberg bewegte sich noch, sodass sich der Haufen zu winden schien. Außerdem drangen jaulende Laute wie von kleinen Kätzchen aus ihm, die noch schrecklicher anzuhören waren als die Schreie von Menschen.
Doch es schrien keine Menschen mehr. Die Verwundeten hatte man den Berg hinauf zur Festung gebracht, als die Angriffe einmal abgeflaut waren. Die Ritter vom heiligen Thomas waren nicht nur Kämpfer, sondern auch Heilkundige, ebenso wie ihre geistlichen Schwestern, und sie leisteten Erste Hilfe und spannten Bahren an ihre Pferde. Der Feind aber tötete jeden Verwundeten, dessen er habhaft werden konnte.
Ganz langsam stand der Hauptmann auf. Das Gewicht seiner Rüstung und seine Müdigkeit machten dies zu einem schmerzhaften Prozess. Der Hals tat ihm so weh, als wäre er von einem Pferd getreten worden. »Michael?«, fragte er verwirrt und sah sich um.
»In den Vorratsräumen«, sagte Kaves.
»Hilf mir, den Helm abzunehmen«, bat der Hauptmann. Er löste den Kinnriemen, und Kaves hob ihm den Helm vom Kopf. Die Nackenpanzerung war blutverklebt, das Visier war verschwunden.
Er setzte seine Helmkappe ab. Meg hatte sie gefertigt, und mit dem eingehenden Interesse, das oft mit völliger Erschöpfung einhergeht, bemerkte er, dass sie auch sein Wappen aufgestickt hatte – eine hübsche Arbeit.
Die Kappe war mit Macht aufgeladen. Er hatte es noch nicht bemerkt – vielleicht war er bisher nicht in der Lage dazu gewesen. Er hielt sie dichter an seine Augen und sah, dass jeder Stich einen kleinen Regenbogen aus Licht enthielt. Das Ganze sah winzigen Fischschuppen nicht unähnlich.
Jack Kaves stieß einen Pfiff aus.
Der Hauptmann drehte sich um und sah seinen Helm an, der einen großen Spalt zeigte, wo eine Waffe ihn durchdrungen hatte. Ohne große Mühen konnte sich der Hauptmann an die Sensen des Kobold-Anführers erinnern, wie sie auf sein visierloses Gesicht eingestochen und es doch nicht getroffen hatten.
»Also gut«, sagte er und beugte sich vor, während Jack einen Topf mit Flusswasser über seinem Kopf ausgoss.
Der alte Bogenschütze gab ihm einen Stofffetzen, mit dem er sich Haare, Gesicht und Bart abtrocknete. Dabei ging er über die Mauer und spürte, wie sich die Feuchtigkeit unter seiner Brustplatte ausbreitete. Er konnte beinahe zuhören, wie sie rostete. Michael würde …
Da waren tatsächlich Schiffe auf dem Fluss – fünfzig Galeeren, die offensichtlich von Menschen gerudert wurden.
Er stand da und sah sie eine ganze Weile an.
Jack Kaves stand neben ihm und hielt eine Wurst in der Hand. »Was bedeutet das, Hauptmann?«, fragte er.
Der Hauptmann schenkte ihm ein schiefes Grinsen. »Das bedeutet, dass wir gewinnen werden«, sagte er. »Wenn wir es nicht völlig vermasseln, werden wir gewinnen.«
In der Nähe von Albinkirk · Desiderata
Lady Almspend schüttelte den Kopf und band die Spitzen ihrer Ärmel zurück. »Seid doch nicht ein solcher Einfaltspinsel. Das ist Fett. Ihr da – holt mir mein Nähzeug. Die Stacheln – dafür habe ich das passende Werkzeug.«
»Wirklich?«, fragte Lachlan.
Almspend ergriff die Hand der Königin. »Ich weiß, dass Ihr mich hören könnt, Mylady. Bleibt bei uns. Zieht Kraft aus der Sonne – werdet stark. Mit ein wenig Glück kann ich Euch hier herausholen.«
Lachlan grunzte.
Ein Ruderer kam mit ihrem Lederbeutel die Leiter zum Vorderdeck herauf.
»Wirf ihn auf die Planken«, befahl sie. Er gehorchte, doch dabei zerbrach ein Tintenfässchen und färbte jedes einzelne Hemd, das sie besaß.
Sie durchwühlte den Beutel nach dem, was sie suchte: einer Schere.
Sie legte die Schere über den Pfeilschaft, schloss die beiden Hälften und zog langsam. Die Königin jammerte; ein langer Speichelfaden mischte sich mit dem Blut, das aus ihrem Mund tropfte.
Lachlan spuckte aus. »Sie wird …«
»Mund halten«, meinte Lady Almspend nur. Sie zog noch ein wenig an der Schere und legte sie dann über die Widerhaken.
»Zieht ihn jetzt heraus«, sagte sie zu Lachlan.
Er zupfte halbherzig und sah sie dabei an.
»Holt ihn heraus, oder sie stirbt«, beharrte Lady Almspend.
Lachlan reckte die Schultern, zögerte und zog dann daran. Mit einem schrecklich saugenden Geräusch kam der Pfeil frei.
Blut spritzte aus der Wunde.
Lissen Carak · Peter
Nita Qwan wusste, dass die große Schlacht begonnen hatte. Aber er kochte gerade. Er hatte einen kleinen Ofen aus Flusslehm gebaut, ihn selbst gebrannt, und nun backte er eine Pastete.
Ein Drittel der Sossag-Krieger sahen ihm dabei zu. Manchmal klatschten sie sogar. Das brachte ihn zum Lachen.
Die beiden Kobolde waren ebenfalls zurückgekommen. Wenn man sich ihre Körper nicht allzu genau ansah, wirkten sie wie grobschlächtige, ein wenig missgestaltete Hinterwäldler.
Bäuchlings lagen sie im Gras hinter dem Menschenkreis, sodass ihre Flügelschalen wie umgedrehte Boote aufragten. Waren sie mit seinen Kochkünsten zufrieden, so rieben sie die Beine gegeneinander.
Seine Pastete war so groß wie ein Mühlrad.
Sein Feuer war sogar noch größer. Er hatte eine Grube ausgehoben und sie mit Kohle angefüllt, die er durch das geduldige Verbrennen von Hartholz gewonnen hatte.
Es gab keinen Grund, warum dies funktionieren sollte, aber es hielt ihn beschäftigt und war eine Ablenkung für die anderen Krieger.
Nita Qwan fragte sich, was Ota Qwan wohl vorhatte. Der Mann hatte seine Farbe erneuert, seinen Bronzekragen poliert, sein Schwert sowie seinen Speer und alle seine Pfeile geschärft, und nun lag er bei den anderen Kriegern und sah Peter beim Kochen zu.
Und wartete.
Die Schwierigkeit bei einer jeden Pastete bestand darin, dass man nie genau wusste, wann sie fertig war.
Mit einer Schlacht schien es sich genauso zu verhalten.
Nita Qwan setzte sich eine Weile vor seine Pastete, dann ging er zu Ota Qwan hinüber und hockte sich neben ihn.
Der Kriegshäuptling hob den Kopf von den Armen. »Schon fertig?«, fragte er.
Nita Qwan zuckte mit den Achseln. »Nein«, sagte er. »Oder vielleicht doch.«
Skahas Gaho lachte.
»Warum sind wir nicht im Feld?«, fragte Nita Qwan.
»Weil die Pastete noch nicht fertig ist«, antwortete Ota Qwan, und alle älteren Krieger lachten lauthals. In ihrem Gelächter lag eine Einmütigkeit, die Peter verriet, dass Ota Qwan irgendeine wichtige Probe für seine Eigenschaft als Anführer bestanden haben musste. Er war ihr Oberhaupt, und niemand stellte dies infrage. Es war eine zwar kaum merkliche, aber dennoch vorhandene Veränderung.
Ota Qwan rollte herüber und wischte die Fettschicht, die seine Farbe auf der Haut hielt, mit den Farnblättern sorgfältig ab. »Thorn wird auf dem Feld gegen die Ritter kämpfen«, sagte er. »Auf einem Feld, auf dem jede Deckung verbrannt ist.«
Die älteren Krieger nickten wie im Chor.
Ota Qwan zuckte die Schultern. »In der letzten Nacht hätten wir beinahe eine ganze Menge Krieger verloren«, sagte er. »Ich will das Leben meiner Leute nicht noch einmal durch eine solche Dummheit aufs Spiel setzen. Diesmal werden wir gehen, wenn es für uns richtig ist. Oder wir gehen gar nicht. Die Pastete ist dafür ein genauso gutes Zeichen wie jedes andere.«
Am Rande der Lichtung setzte sich eine Frau – Ojig – plötzlich auf, und ihre Schwester, die Kleinhand gerufen wurde, versteifte sich wie ein Hund, der den Wolf gerochen hat. Sie ergriff ihren Bogen, und plötzlich gerieten auch alle anderen in Bewegung. Sie bewaffneten sich, waren auf der Hut …
»Qwethnethog!«, rief Kleinhand.
Nita Qwan hörte zwar keinen Befehl, aber schon nach wenigen Herzschlägen war die Lichtung leer – mit Ausnahme seines Feuers, seiner Pastete und den sechs ältesten Kriegern, die um Ota Qwan herumstanden.
Die Qwethnethog trat aus dem Unterholz und bewegte sich so schnell wie ein Rennpferd. Es dauerte einige lange Schritte, bis sie langsamer geworden war. Sie warf einen Blick von den Männern zum Feuer und wieder zurück.
»Skadai«, sagte sie mit ihrer schrillen Stimme.
»Tot«, erwiderte einer der betagten Krieger.
»Aah«, klagte sie, machte eine fremdartige Geste mit ihren Klauen und drehte sich um. »Wer führt das Volk der Sossag an?«
Ota Qwan trat vor. »Ich geleite sie in den Krieg«, sagte er.
Die Qwethnethog sah ihn an und drehte den Kopf von der einen zur anderen Seite. Nita Qwan bemerkte, dass ihr Helmkamm von einem tiefen Scharlachrot war; diese Farbe zog sich bis auf ihre Stirn. Doch der Kamm war kleiner als bei einem männlichen Exemplar ihrer Art. Obwohl sie starken Schrecken ausstrahlte, fand er es lustig, dass er sich inzwischen so gut mit der Wildnis auskannte und ein Männchen von einem Weibchen sowie den einen Klan von einem anderen unterscheiden konnte. Sie gehörte zu den Qwethnethog des Westens, die in den Bergen oberhalb der Sossag-Seen lebten.
»Mein Bruder spricht für alle Qwethnethog der Berge«, sagte sie mit ihrer schrillen Stimme. »Wir verlassen das Feld und werden nicht mehr für Thorn kämpfen.«
Ota Qwan sah die Männer rechts und links neben sich an. »Wir danken dir«, sagte er. »Gehe in Frieden.«
Das große Ungeheuer drehte sich um und schnüffelte. »Das riecht köstlich«, sagte es zu niemandem im Besonderen.
»Bleib doch, und nimm dir ein Stück«, hörte Nita Qwan sich selbst sagen.
Sie hustete – er vermutete, dass es sich um nachgeahmtes Gelächter handeln sollte. »Du bist keck, junger Mann«, sagte sie. »Komm ein anderes Mal zu mir, und koch für mich.« Sie klickte mit ihren Krallen und war bereits wieder in den Wäldern verschwunden – schneller als ein Reh.
Sobald sie fort war, kam ein Dutzend Frauen aus dem Wald hervor – allesamt Matronen. Sie sprachen in der Sprache der Sossag so schnell, dass Nita Qwan nicht einmal einzelne Worte verstehen konnte.
So machte er sich daran, seinen behelfsmäßigen Ofen zu öffnen.
Die Pastete war gut durchgebacken, und die Kruste hatte eine schöne Farbe – ein sattes Goldbraun, durchschossen mit dunklerem Braun. An der einen Seite jedoch war sie fast schwarz. Vielleicht hatte der Ofen irgendwo einen Riss bekommen – er hatte keine Ahnung, warum denn sonst ein Teil des Randes so angesengt sein mochte.
Aber es war ihm gleich, denn nun kamen die Sossag wie eine rächende Armee herbei und rissen ihm die Pastetenstücke aus den Händen, sobald er sie abgeschnitten hatte. Er hatte genug gebacken, und diese Menschen beschwerten sich in der Regel nicht.
Auch Ota Qwan nahm ein Stück – ein verbranntes. »Gut durch«, meinte er. »Jetzt sind wir gestärkt und können die ganze Nacht hindurch marschieren.«
Mit vier Bissen schlang er sein Stück herunter und trank dazu einen Becher Wasser. Nita Qwan machte es ihm nach und bemerkte, dass seine Frau bereits seine Körbe gepackt hatte. Einen davon nahm er auf den Rücken. Sie lächelte ihn scheu an.
Er lächelte zurück.
Er schulterte auch seinen Bogen und sein Schwert, und dann liefen sie ohne ein weiteres Wort in den Wald hinein.
Bei Albinkirk · Desiderata
Die Galeere legte am Kai der Brückenfestung an. Die Garnison war bereits alarmiert, Soldaten standen auf den Mauern. Der Hauptmann wartete am Kai.
Die Galeere war voller Frauen, von denen eine schöner als die andere war. Das hatte er nicht erwartet.
Eine dieser Frauen – klein, blond und gehetzt wirkend – stand auf dem Vorderdeck. »Ich brauche einen Heiler«, sagte sie. »Einen guten.«
Der Hauptmann wandte sich zu Michael um. »Hol mir einen Ordensritter«, befahl er und drehte sich wieder zu der Frau um. »Das sind ausgezeichnete Heiler«, erklärte er. Doch leider hatten sie sich bei Sonnenaufgang aufgemacht, um den Graben zu säubern, und bis jetzt waren sie noch nicht zurückgekehrt.
»Ich weiß«, sagte sie mit einem abfälligen Ton in der Stimme. »Wie lange wird es dauern?«
»Ein paar Minuten«, sagte er hoffnungsvoll.
»Ihr bleiben aber keine paar Minuten«, erwiderte die Frau und machte eine entsetzte Miene, während sie ein Schluchzen zu unterdrücken schien. »Sie hat sehr viel Blut verloren.«
»Wer ist sie?«, fragte er, als er ein Bein auf das Dollbord zu stellen versuchte. Einige Ruderer reichten ihm die Hände und zogen ihn ins Boot.
»Die Königin«, sagte sie. »Ich bin Lady Almspend, ihre Schreiberin. Und dies hier ist Lady Mary, die erste ihrer Hofdamen.«
Die Königin.
Der Rote Ritter beachtete die Leute nicht, die sich um die Gestalt auf dem Deck versammelt hatten. Die Frau, die dort lag, verlor noch immer entsetzlich viel Blut. Er spürte es.
Und er hatte nur sehr wenig Kraft – und kaum Macht. Das meiste hatte er im Kampf gegen die Kobolde aufgebraucht. Und wenn er sie hier und jetzt zu heilen versuchte, würde er damit verraten, dass er ein Hermetiker war.
So viel Blut.
Sie war jung – und durchtränkt von eigener Macht.
In diesem Augenblick begriff er, dass er diese Macht ergreifen konnte, wenn die Königin starb. So wie er die Macht des Anführers der Kobolde in sich hineingenommen hatte. Sie war schutzlos, weit offen, und versuchte die Macht dazu einzusetzen, sich zu stärken. Sie trank die Strahlen der Sonne – Helios’ reine Macht. Sie war außerordentlich mächtig.
Er legte ihr die Hand auf den Rücken.
»Nun?«, fragte Lady Almspend ungeduldig. »Könnt Ihr ihr helfen?«
Vade retro, Satanas, dachte der Hauptmann. Er nahm seine Kappe vom Kopf und drückte sie in die Wunde. Dann legte er einen Finger auf die Kappe, deren Farbe sich von schmutzigem Weiß zu strahlendem Scharlachrot wandelte.
Beinahe hätte er gegrinst. Er war nun mit einer ganzen Legion von Heilern verbunden. Es fiel leicht, das zu vergessen.
Ohne Prudentia schien der Palast leer und verlassen zu sein. Aber er kannte jetzt die grundlegenden Phantasmata des Heilens – und fragte sich, ob es ihm möglich war, die Macht von Megs Gewebe anzutasten und sie durch die Kanäle zu leiten, deren Errichtung er in lange vergangenen Unterrichtsstunden gelernt hatte.
»Amicia?«, fragte er.
Sie war da. »Hallo!«, sagte sie, ergriff seine Hand, lächelte – und ließ die Hand wieder fallen.
»Ich muss jemanden heilen.« Er wünschte …
»Zeig mir die Person«, sagte Amicia rasch.
Er nahm sich die Zeit, kurz bei der gestürzten Statue niederzuknien und mit der Hand über Prudentias Marmorrücken zu streichen. »Ich vermisse dich«, sagte er. »Hilf mir, wenn du kannst.«
Dann ergriff er Amicias Hand und legte sie auf die Königin.
Die Hand deutete auf zauberisches Wirken und Weben, das er jetzt kannte – durch sie erfahren hatte. In einem schwindelerregenden Augenblick befand sie sich auf ihrer Brücke und verwendete ihren eigenen Palast der Erinnerung, während er neben Prudentias Podest stand und das in sich sammelte, was von seiner Macht übrig geblieben war.
Es reichte nicht.
Amicia schüttelte den Kopf. »Ich habe nichts zu geben«, sagte sie. Er hob den Blick zu ihr, und selbst im Ätherischen war ihre Erschöpfung deutlich zu erkennen. »So viele Verwundete«, sagte sie.
Er seufzte und überprüfte die Macht, die in seine Kappe eingewoben war. Er wirkte Magie, so wie Harmodius es ihm beigebracht hatte, und wurde von Amicias sicherer Hand geleitet – es waren drei Zauber, von denen jeder den anderen überlagerte und ergänzte, wie Gleichungen auf einer Schiefertafel. Lösen, Binden, Heilen. Er nutzte dazu das, was von der Lebenskraft des Kobold-Häuptlings noch übrig war.
»Heilige Barbara, Stier, Thales. Demetrios, Fische, Herakleitus. Ionnes der Täufer, Löwe, Sokrates!«, beschwor er, deutete mit dem Finger, drehte sich um die eigene Achse, und der Raum bewegte sich. Die imaginierten Hebel drehten sich im Einklang mit der Geschwindigkeit seiner Muskeln, und der Raum wirbelte bald wie ein Kreisel.
Es war die komplexeste Beschwörung, die er je versucht hatte – und die Macht, die von ihr abstrahlte, verblüffte ihn; es war ein Widerhall der entfesselten Macht, die sich in dem Raum um ihn herum zusammenballte.
Die Kappe opferte sich selbst in einem Paroxysmus der Macht – ein kurzes Aufflackern, und alle Macht drang in die Königin ein.
Ein roter Nebel zog sich über ihren Rücken von den Schultern bis zu dem einen braungebrannten Bein und um die Hüfte herum bis zur Niere. Grau-weiße Ascheflocken fielen von der Haut ab.
Der Hauptmann taumelte von ihr zurück.
Die Königin schrie auf und seufzte dann, als würde sie von ihrem Liebhaber gestreichelt werden. Und dann stieß sie ein leises Jammern aus.
Lady Almspend klatschte in die Hände. »Bei der Macht Gottes, Ser! Das war großartig!«
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Das war ich nicht«, gab er zu. »Oder zumindest nicht ich allein.« Seine Stimme glich einem heiseren Krächzen.
Die Wunde blutete wieder. Sie wurde sogleich fest verbunden – sehr vorsichtig, weil sie noch offen zu sein schien.
Wieder schüttelte der Hauptmann den Kopf. »Aber ich habe den Fluss der Macht gespürt«, sagte er enttäuscht.
»Ich fühle jetzt weniger Schmerzen«, sagte die Königin tapfer. »Das war gute Arbeit, Ritter.«
Ein rothaariger Riese warf seinen Mantel über die Königin. »Wir müssen sie ans Ufer bringen.«
Der Hauptmann schüttelte abermals den Kopf. »Dazu würde ich nicht raten. Die Burg ist Dreh- und Angelpunkt der gesamten Schlacht, und ich habe sie die ganze Nacht hindurch gehalten. Ich würde das Risiko nicht eingehen, die Königin von Albia dorthin zu bringen.«
Doch andere Boote ruderten nun ebenfalls auf den Kai zu, ankerten oder wurden festgezurrt, während sich die Armbrustschützen auf ihnen um die Kobolde am Nordufer kümmerten. Die kühneren Bootsmänner setzten ihre Schiffe unter die Brücke, um dem Feind auf den Wiesen nördlich des Flusses eine Flanke zu bieten.
»Ich habe zwanzig tapfere Männer, die sich Eurer Garnison anschließen könnten«, sagte Rotbart.
»Ich hätte lieber all diese netten Armbrustschützen«, erklärte der Hauptmann und lächelte, um seiner Bemerkung jeden möglichen Stachel zu nehmen. »Also gut. Bringt die Königin an Land, aber stört euch nicht an den Koboldeingeweiden. Wir hatten noch keine Zeit zum Aufräumen.«
Er richtete sich an Deck auf, konnte kaum mehr gehen. Er kletterte über die Bordwand auf den Kai, und es gelang ihm nur mit Mühe, die notwendigen Befehle zu geben.
Über einem Pfahl brach er zusammen. Er wusste, dass Rotbart neben ihm stand und etwas sagte, aber er hatte lange nicht mehr geschlafen, hatte seine Kräfte nicht auffrischen können und hatte soeben einen Zauber gewirkt. Davon war ihm nun übel. Prudentia hatte ihn gewarnt, dass so etwas geschehen würde, wieder und wieder.
Er streckte die Arme in das schwache Sonnenlicht. Zog die Panzerhandschuhe aus und hob die Hände der Sonne entgegen.
Was würde Mutter davon halten?, fragte er sich. Sobald die Sonnenstrahlen über seine Hände leckten, spürte er das Prickeln der Macht in den Armen. Der Kopfschmerz wich. Die Bedrückung …
Amicia?
Hauptmann?, fragte sie barsch.
Die Sonne. Streck dich nach der Sonne aus, und sauge die Macht aus ihr.
Ich kann nicht. Das ist mir nicht gegeben.
Wie ärgerlich. Um mit Harmodius zu sprechen: Macht ist bloß Macht und nichts als Macht. Ergreife sie.
Habe ich da meinen Namen gehört?
Zeig ihr, was du mir gezeigt hast. Zeig ihr den Weg zur Sonne.
Mit Vergnügen, sobald ich einen Augenblick Zeit habe, in dem ich nicht um mein Leben kämpfen muss. Harmodius’ Abbild im Ätherischen wirkte zerlumpt.
Dann benutz die Quelle, entgegnete der Hauptmann.
Ohne dass er es gewollt hatte, befand er sich plötzlich auf ihrer Brücke über dem Fluss. Doch der Fluss war nur noch ein Rinnsal, die Felsen darin waren trocken und das Laub verwelkt.
Er ergriff ihre Hand, und sie seufzte.
»Wir werden gewinnen«, sagte er. »Es wird knapp, aber wir werden trotzdem gewinnen.« Er wusste nicht, wie sich die Quelle an ihrem Ort der Macht manifestieren würde. Am Ende ihrer hölzernen Brücke beschwor er eine Einfassung und eine Handpumpe herauf. »Streck die Hände aus«, sagte er.
Sie lächelte. »Die Sonne ist nicht für mich, aber die Quelle kann ich benutzen.«
»Die Macht ist da. Macht ist Macht. Nimm, was du brauchst.« Er bediente die Handpumpe, und ein Schwall von Macht schoss aus dem Kran heraus wie unter Druck stehendes Wasser und benetzte ihren grünen Rock.
Sie lachte. Macht wogte um sie beide herum und strömte in das Wasser unter der Brücke sowie in die Bäume.
Das Licht wurde strahlender, und das Wasser sang.
»Oh!«, sagte sie und griff nach der Quelle …
Brunnenrand und Handpumpe verschwanden, während der Strom unter ihren Füßen anschwoll.
»Oh!«, sagte sie noch einmal und schloss die Augen. »O mein Gott!«
Er seufzte. Das war nicht das Ergebnis, auf das er gehofft hatte.
Jenseits der Paläste des Äthers riefen Männer seinen Namen.
Er beugte sich vor und küsste sie innig.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte er.
»Das sind königliche Gardisten«, rief Rotbart und deutete zuerst auf das Südufer des Flusses und dann auf das Gebiet östlich der Brücke. »Ich kenne sie.«
»Pferde!«, rief der Hauptmann Michael zu. »Ein Kriegspferd für dich, und ein weiteres für mich und auch ein Reittier für den roten Riesen. Milus, du übernimmst das Kommando, bis ich zurück bin. Holt einen Heiler oder eine Heilerin von der Festung. Sagt ihnen, dass die Königin von Albia im Sterben liegt.« Es fiel ihm schwer, sie zu verlassen. Es war nicht seine Art, eine Aufgabe unerledigt zu lassen. Nun hatte er zwar neue Kraftreserven, aber sie benötigten eine zarte und geübte Hand. Und er brauchte noch eine Reserve für den Kampf.
Die Königin wurde an ihm vorbeigetragen.
»Verdammt«, murmelte er zu sich selbst, streckte die Hand aus und legte sie auf die entblößte Schulter der Königin. Er gab ihr alle Macht, die er noch besaß – alles, was er durch Amicia an der Quelle erhalten hatte, und alles, was er aus der Sonne gezogen hatte.
Er taumelte von ihr zurück. Spuckte Galle ins Wasser und sackte auf die Knie.
Sie gab einen Laut von sich und rollte die Augen nach oben.
Michael packte ihn an der Schulter und drückte ihm eine Feldflasche in die Hand. Er trank. In der Flasche befand sich Wein, gemischt mit Wasser, und er spuckte es aus. Und trank noch einmal.
»Hilf mir auf«, befahl er.
Rotbart ergriff seine andere Schulter. »Ihr seid ein Kriegsherr?«, fragte er barsch.
Der Hauptmann musste lachen. »Ich verzeihe dir die ungenaue Bezeichnung.«
Der Wein war gut.
Nun reichte ihm Michael ein Stück Honigkuchen. »Esst dies.«
Er aß.
Er ließ Gesicht und Hände von der Sonne bescheinen, und er aß.
Fünfzehn Fuß entfernt versuchte Ser Milus einer ledernen Feldflasche auf den Grund zu kommen. Er nickte und spuckte. »Ist der Kampf vorbei?«
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern. »Er sollte es sein«, murmelte er und hörte, wie die Pferde eingefangen wurden. Er hörte das schwere Klappern der Hufe auf den Pflastersteinen des Hofes und das Knarren und Knirschen des Zaumzeugs.
»Jacques hat ihn«, sagte Michael.
»Ich hasse dieses Pferd«, erklärte der Hauptmann. Er aß den Rest seines Honigkuchens, trank noch ein wenig Wein und Wasser und zwang sich dazu, die Leiter zur Spitze des Nordturms hinaufzusteigen.
Sechzig Fuß über der Erde lösten sich plötzlich viele Rätsel.
Er konnte nicht hinter die Erhebungen südlich des Flusses sehen, aber das strahlende Glitzern von Rüstungen verriet ihm, dass die Soldaten, die sich nun über den letzten Hügelkamm ergossen, aus der königlichen Armee stammen mussten.
Im Westen war der Wald voller Kobolde, und im Norden, in einer Entfernung von fast einer Meile, waren drei Gestalten zu erkennen – jede größer als ein Kriegspferd –, die aus den Wäldern hervorkamen, zusammen mit einer langen Reihe von Infanterie zu beiden Seiten.
Die neue Blide, die auf den Ruinen des Nordturms errichtet worden war, schoss ihre Ladung ab, und ein Steinhagel ging kurz vor den Kreaturen der Wildnis nieder. Doch sie scheuten wenigstens davor zurück.
Soweit er sehen konnte, brodelte das Unterholz am Waldrand vor heimlicher Bewegung.
»Warum bist du noch hier? Selbst wenn du gewinnst, wirst du die Festung nicht einnehmen. Du hast verloren, du Narr«, murmelte der Hauptmann. »Lass es also sein. Lebe jetzt, und kämpfe später.« Er schüttelte den Kopf.
Einen Augenblick lang dachte er daran, sein Innerstes zu Thorn hin auszustrecken. Denn wenn Thorn blieb und weiterkämpfte, würden noch viele Männer des Hauptmanns sterben, und inzwischen liebte er sie. Sogar Sym.
Ich bin müde und rührselig.
Er kletterte die Leiter wieder hinunter und sah, dass Jacques sein neues Schlachtross an der Leine hielt. Michael befand sich beim Ausfalltor. Jack Kaves winkte ihm zu.
Der Hauptmann warf das Bein über den Sattel und ächzte. Der große Hengst scheute und warf den Kopf herum.
»Ich hasse dieses Pferd.« Er schaute auf Jacques hinunter. »Geh, und suche Jehannes. Sofort.«
»Ser Jehannes ist verwundet«, erklärte Jacques.
»Dann such Tom.«
»Jawohl«, erwiderte Jacques.
»Jeder Soldat unserer Truppe soll aufsitzen und sich zum Fuß der Erhebung begeben«, sagte der Hauptmann. »Alle Bauern und Gildenleute, die noch beim Graben sind, sollen herkommen.«
Jacques nickte. »Eigentlich könnten wir die Festung auch allein halten«, meinte er. Sein Lächeln hatte etwas Argloses; er wirkte wie ein Junge, der einen Stein in ein Wespennest wirft und nichts Böses dabei empfindet.
Der Hauptmann nickte ebenfalls. »Das könnten wir tun. Und wir könnten Lösegeld für sie verlangen. Oder sie an den Meistbietenden verkaufen.« Er klang wehmütig. »Wir könnten die Schlimmsten der Schlimmen sein. Die Ritter des üblen Leumunds. Wir könnten reich sein. Und gefürchtet.« Er zuckte mit den Schultern. »Irgendwann im letzten Monat sind wir zu Paladinen geworden, Jacques.«
Jacques nickte. »Es ist an der Zeit, mein Prinz.«
»Hör auf damit, Jacques«, sagte der Hauptmann. Er riss den Kopf seines Pferdes herum, trieb es ein paar Schritte zurück und salutierte vor Raucher, dem Bogenschützen, der den Befehl über das Tor hatte. »Öffne es«, rief er. »Und auch das Brückentor.« Dann wandte er sich wieder an Jacques. »Vergiss nicht, die Heiler zu holen.«
Rotbart gesellte sich zu ihnen. Er saß auf einem alten Gaul, der schon bessere Tage gesehen hatte.
»Tut mir leid wegen des Pferdes«, sagte der Hauptmann. »Ich bin der Hauptmann.«
»Ist das etwa Euer Name?«, fragte der rote Riese. »Ich bin Ranald. Ranald Lachlan.«
»Du gehörst zur königlichen Garde?«, fragte der Hauptmann. Dann geriet er ins Grübeln. »Lachlan? Tom Lachlans Bruder etwa?«
»Sein Vetter«, sagte der andere Mann. »Kennt Ihr Tom Schlimm?«
»Wer kennt ihn nicht?«, gab der Hauptmann zurück. »Jetzt sollten wir uns aber auf den Weg zum König machen.« Seine Stimme zitterte ein wenig.
»Amen«, antwortete der Hochländer. »Und kennt Ihr ihn? Den König?«
»Eine interessante Frage«, sagte der Hauptmann. »Nein, eigentlich nicht.«
Michael folgte ihnen, und die Hufe ihrer Pferde klapperten laut, als sie die Brücke überquerten. Mitten auf ihr griff der Hauptmann in die Börse, die an seinem Schwertgürtel hing, und holte einen Schlüssel hervor – kunstvoll geschmiedet, wunderschön und offenbar aus reinem Gold. Er beugte sich aus dem Sattel, ächzte über den Druck gegen seine Muskeln an Rücken und Hals – wie lange ist es her, dass ich gegen diesen gottverfluchten Lindwurm gekämpft habe? Er steckte den Schlüssel in das Schloss des großen Tores auf der Brücke, drehte ihn herum – und das gesamte Tor verschwand.
»Netter Trick«, murmelte Ranald.
In der Nähe von Lissen Carak · Der König
Der König sammelte seine Gardisten und die Ritter der Vorhut. Diese hatte fünfzig Soldaten und genauso viele Knappen verloren; die Männer waren bereits erschöpft, und dabei war der Morgen noch jung. Zwei seiner adligen Anführer waren tot – sowohl der Bischof von Lorica als auch der Marschall waren schon im ersten Gefecht gefallen. Der Captal de Ruth hatte eine tödliche Wunde erhalten, als er den König verteidigt hatte. Nun lag er im Sterben.
Die Diener kamen mit den Pferden herbei, und die Kriegsmaschinen rollten dahin. Ärzte suchten unter den Verwundeten nach solchen, die noch gerettet werden konnten, und seine Jäger, die nach Osten gezogen waren, um die Flanke während des Angriffs auf die Vorhut zu schützen, kehrten allmählich zurück. Auch sie hatten etliche Männer bei dem Kampf gegen die Ungeheuer im Wald am Fluss verloren – und auch sie waren nicht siegreich gewesen. Die Kreaturen der Wildnis waren durch ihre Reihen gebrochen und nach Osten geflohen. Sechzig Männer waren dabei gestorben. Gute Männer. Ausgebildete Männer.
Das war wohl kaum der große Sieg gewesen, den sich der König gewünscht hatte. Er war in einen Hinterhalt geraten, doch seine Kolonne hatte überlebt. Das war alles.
»Boten, Sire. Von jenseits des Flusses«, rief ein Herold.
Der König blickte nach Nordwesten und sah sie – drei Männer überquerten die Brücke in schnellem Galopp.
»Blast zum Sammeln«, rief der König.
Immer mehr königliche Jäger kamen aus Westen herbei; sie bewegten sich wie mit großer Erschöpfung und Müdigkeit.
Der Graf der Grenzmarken ritt zu ihm hinüber und salutierte. »Das Hauptkontingent unserer Ritterschaft befindet sich eine halbe Stunde hinter mir in der Hauptschlacht«, berichtete er und sackte dabei in sich zusammen. »Beim heiligen Georg, Mylord, das war der härteste Kampf, den ich je erlebt habe.«
»Die Gardisten sagen, dass sich jenseits des Flusses Kobolde befinden«, bemerkte der König.
»Kobolde?« Der Graf schüttelte den Kopf. »Ich habe heute Morgen einen Schlag gegen einen Lindwurm geführt, Sire. Das ist die Wildnis, Mylord, die um ihr Leben kämpft.«
»Ich dachte, die Wildnis sei besiegt«, gab der König zurück.
Der Graf der Grenzmarken schüttelte den Kopf. »Wo ist Murien? Was ist mit den Burgen an der Mauer geschehen?«
Febus de Lorn, der Jäger des Königs, verneigte sich ehrerbietig. »Sie kommen nicht aus dem Norden, Mylords, sondern aus dem Westen. Ich habe Gwyllch – Kobolde – jenseits des Flusses gesehen, und Bothere hat mit Jägern gesprochen, die behaupten, Trolle in den Niederungen westlich der Straße entdeckt zu haben. Und Dhags kommen ebenfalls aus dem Westen herbei, Mylords.«
Der König sah den herbeinahenden Boten entgegen. Nein, es waren keine Boten, denn alle drei steckten in Rüstungen. Zwei ritten auf Kriegspferden, und der dritte …
»Par dieu, meine Herren, wenn das nicht Ranald Lachlan ist, dann bin ich ein Sängersohn.« Der König wendete sein Pferd und ritt auf das Trio zu.
Lachlan winkte. Der König hatte nur Augen für ihn. Sie ritten zueinander und umarmten sich.
»Bei allen Heiligen, Ranald, ich hätte nicht erwartet, dich je auf einem verlassenen Schlachtfeld zu begrüßen!« Der König lachte. »Wie ist es dir ergangen?«
Ranald wandte den Blick ab. »Je nun«, sagte er, und ein Schatten fiel über sein Gesicht. »Das werde ich Euch berichten, wenn wir die Zeit dazu haben, Mylord. Diese Herren wollen sich mit Euch unterreden. Das hier ist der Hauptmann der Truppe, die Lissen Carak für die Nonnen hält. Und dies hier ist sein Knappe Michael.«
Der König streckte vor dem Ritter die Hand aus – er war ein Mann von mittlerer Größe mit einem schwarzen Bart und noch schwärzeren Ringen unter den Augen. Er erschien absurd jung, um schon ein Befehlshaber zu sein, aber er trug eine großartige Rüstung.
»Messire?«, sagte er.
Der Mann starrte ihn an. Dann plötzlich, als wäre er sich seines schlechten Benehmens bewusst geworden, ergriff der Mann seine Hand und verneigte sich im Sattel. »Mylord«, sagte er.
»Ihr haltet die Festung?«, fragte der König interessiert.
»Die Festung und die Brückenburg«, erwiderte der Hauptmann.
Dem König kam das Gesicht des jungen Mannes irgendwie vertraut vor, aber er konnte es nicht recht einordnen. Etwas …
»Mylord, wenn Ihr Eure Streitkräfte dorthin führen könntet, wären wir wohl in der Lage, die Festung zu sichern und die Dorfbewohner zu evakuieren. Dann würde sich der Feind einer frisch verproviantierten und besser bemannten Festung gegenübersehen, auf deren Einnahme er nicht mehr hoffen kann, und wir würden dabei nicht einen einzigen weiteren Mann verlieren.« Der Hauptmann sprach schnell, während sein Blick auf den fernen Waldrand gerichtet war. »Der Feind – der Magus Eures Vaters, wie es heißt – hat eine Menge Fehler begangen. Nicht der geringste bestand darin, die Klugheit und das Wissen unserer Seite zu unterschätzen. Ich glaube, er hat vor, einen weiteren umfassenden Angriff zu beginnen und seinen Ruf durch die heldenhaften Bemühungen seiner Verbündeten zu festigen.« Der junge Mann grinste schief. »Vor zwanzig Tagen habe ich einen Graben für genau diesen Augenblick ausheben lassen, Mylord. Wenn Ihr Eure Bogenschützen in diesem Graben postiert und Eure Ritterschaft hinter der Brückenburg zusammenzieht, dann könnten wir diesem anmaßenden Magus meiner Meinung nach eine schwere Niederlage bereiten.«
»Darf ich Euren Namen und Eure Herkunft erfahren, Messire?«, fragte der König. Der Plan war durchdacht – der Junge trug einen klaren Kopf auf den Schultern, und sein reines Albisch machte ihn eindeutig zu einem Untertan des Königs, ob er nun ein Söldner war oder nicht.
Der dunkelhaarige Mann richtete sich im Sattel auf. »Die Männer nennen mich den Roten Ritter«, sagte er.
»Ich hatte eigentlich geglaubt, Ihr wäret ein Gallyer oder zumindest viel älter«, sagte der König. Dann wandte er sich an den Grafen der Grenzmarken. »Mylord, würdet Ihr den Platz des Marschalls einnehmen und die königliche Garde kommandieren? Und wo ist der Comte d’Eu? Er hat doch jetzt das Kommando über die Vorhut, oder?«
Der Graf der Grenzmarken drehte sich zu dem jungen Ritter um. Sein Banner trug etliche Lacs d’Amour. »Wie viele Lanzen habt Ihr, Mylord?«
»Sechsundzwanzig, Graf – und die Ritter des heiligen Thomas. Dazu kommen noch einige Hundert fähige Soldaten in Gestalt eines Kontingents von Kaufleuten aus Harndon. Und ich habe das Vergnügen, die Hilfe des königlichen Magus zu besitzen – Harmodius.« Der junge Knabe verneigte sich noch einmal im Sattel.
»Harmodius ist hier?«, fragte der König. Plötzlich wirkte dieser Tag viel heller.
Der junge Mann sah weg. »Es ist zu einer tragenden Säule unseres Widerstands geworden«, sagte er. »Wenn Eure Lordschaft es erlaubt, werde ich jetzt zurückreiten und alles für Euren Empfang vorbereiten.«
Der König lächelte. Was für ein seltsamer junger Mann! »Wir sind gleich hinter Euch. Geht!«
Der Mann verbeugte sich noch einmal, und gemeinsam ritten sie über die Brücke.
Der König wandte sich an den Grafen der Grenzmarken. »Er wirkt vielleicht etwas seltsam, scheint aber recht fähig zu sein, würdet Ihr das nicht auch sagen?«
Der Graf zuckte die Achseln. »Er hat diesen Ort zwanzig Tage lang gegen Richard Plangere und seine Legionen der Hölle verteidigt. Darf es Euch da nicht gleich sein, ob er ein wenig seltsam wirkt?«
»Er erinnert mich an irgendjemanden«, meinte der König und warf einen Blick zu Lachlan hinüber, der bei der Kommandogruppe geblieben war. »Kannst du uns etwas über unseren jungen Söldner verraten?«
Lachlan zuckte die Achseln. »Nein, Mylord. Aber über die Königin. Sie wurde von einem Pfeil in den Rücken getroffen. Nun ruht sie sich aus, und es geht ihr gut, was sie zu großen Teilen dem jungen Knaben dort vorn zu verdanken hat. Er hat seine Macht dazu eingesetzt. Ich habe es gesehen.«
»Die Königin? Die Königin ist verletzt?«, fragte der König.
»Sie erholt sich zurzeit in der Brückenburg. Der junge Hauptmann hat nach Heilern geschickt.«
Der König stellte sich in die Steigbügel. »Herhören, Wachen! Los geht’s!«
Der Graf der Grenzmarken blieb beim königlichen Stab, der auf seinen Pferden in der Staubwolke saß, die der plötzliche Aufbruch des Königs aufgewirbelt hatte.
Er schüttelte den Kopf. »Ein großartiger Ritter«, sagte er und beobachtete seinen König. Dann seufzte er. »Also gut, Messires, hört mir zu. Die königlichen Wachen werden als Erste den Fluss überqueren, gefolgt von den Jägern und dem restlichen Haushalt. In einer zweiten Schlachtenreihe werden dann die Ritter …«
In der Nähe von Lissen Carak · Gaston
Gaston, der Graf von Eu, war so müde, wie er es nie zuvor gewesen war, und etwas stimmte auch mit seiner linken Hüfte nicht – sie schien sich nicht mehr so frei bewegen zu lassen wie zuvor –, aber es gelang ihm, das Bein über den breiten Rücken des Schlachtrosses zu werfen, und er ritt unter seinem eigenen Banner voran, während sich die Männer seines Vetters hinter ihm zusammenfanden – zweihundert Ritter und Soldaten. Einhundert Adlige lagen tot oder verwundet in den Wäldern und auf den Wiesen entlang der Straße – ein absurd hoher Preis für das kühne Verlangen seines Vetters, der Mann zu sein, der den Hinterhalt überwand, vor dem ihn sein Engel gewarnt hatte.
Sein Vetter, der nun in den Armen des Todes lag. Der nichts anderes gewollt hatte, als der größte Ritter der Welt zu sein.
Gaston wollte nur noch nach Gallyen ziehen – heim; auf dem Richterstuhl in seiner Burg sitzen und zur Erntezeit darüber entscheiden, welcher Wein der beste war. Er dachte an die Bauern unter der Brücke, und sein Herz war nun voller Verständnis. Er schwor – würde Gott einen solchen Schwur annehmen? – nach Hause zu gehen und um Constances Hand anzuhalten.
Auf dem Kamm der letzten Erhebung saß der Freund des Königs, der Graf der Grenzmarken, zusammen mit einer Reihe weiterer Adliger unter dem flatternden königlichen Banner. Der Comte d’Eu stellte sich in die Steigbügel – verdammt, wie seine linke Hüfte schmerzte – und blickte auf den Fluss hinunter, an dem die rot gewandete königliche Garde soeben auf die große Brücke mit den drei Bögen zumarschierte. Auf der anderen Seite formierten sich zwei Kompanien in sauberer Keilformation am Fuß des Berges, auf dem die Festung lag – ein halbe Meile nördlich des Flusses. Von der Festung Lissen Carak bis zur Brücke verlief ein Graben, der so schwarz war, als hätte es in ihm gebrannt.
Am Westrand der Wiesen und ausgebrannten Gehöfte, die zum Herrschaftsgebiet der Äbtissin gehört hatten, schwärmten Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Kreaturen wie Ameisen umher, die aus ihrem Hügel vertrieben worden waren.
Während er zusah, schwang plötzlich der lange Arm einer Blide oben auf der Festung. Er schien sich äußerst langsam zu bewegen, doch seine Ladung – die aus dieser Entfernung unsichtbar war – flog rasend schnell, als das Gegengewicht gelöst wurde. Der Comte versuchte zu erkennen, wo der Schuss niederging, aber es gelang ihm nicht. Der Graf der Grenzmarken winkte ihm zu. »Mylord«, sagte er, »Ihr kommandiert jetzt die Vorhut?«
»Allerdings. Mein Vetter ist schwer verwundet«, antwortete Gaston. »Ich habe weniger als zweihundert Lanzen, und viele meiner jüngeren Ritter sind völlig erschöpft.«
»Dennoch bittet Euch der König, alle nötigen Anstrengungen zu unternehmen, damit Eure Männer den Fluss überqueren können. Ihr müsst absitzen und die Positionen einnehmen, die für Euch vorbereitet wurden.« Der Graf deutete auf die schwarze Narbe, die von dem Festungsberg bis zur Brücke durch die Erde lief.
»Ich sehe sie«, bestätigte Gaston. »Aber ich habe nicht genügend Männer, um den Graben in seiner gesamten Länge zu besetzen.«
»Euch werden die königliche Garde und all unsere Bogenschützen zur Seite stehen«, fügte der Graf der Grenzmarken hinzu. »Setzt Euch in Bewegung, Mylord!«
Gaston sah, wie sich die Kreaturen des Schwarms nun tiefer und tiefer in das Feld hinter dem Waldrand hineinwagten.
»À moi!«, befahl er. »En avant!«
Lissen Carak · Thorn
Thorn beobachtete, wie sich die königliche Armee zur Überquerung des Flusses formierte. Er war bereit zuzuschlagen – mit einem einzigen Hammerschlag würde er ganz Albia für sich gewinnen.
Von dem Hinterhalt, der sie immerhin den ganzen Morgen lang in Atem gehalten hatte, schien die königliche Armee erstaunlich unversehrt geblieben zu sein. Das kam unerwartet. Die Qwethnethogs allein hätten größte Verheerungen innerhalb ihrer Reihen anrichten müssen.
Er verspürte ein Kräuseln von Macht, erkannte es als solches und fluchte. Sowohl die dunkle Sonne als auch sein früherer Lehrling hatten überlebt. Er musste seine eigene Anmaßung eingestehen, die ihm vorgegaukelt hatte, mit ihnen fertig zu werden. Das war der Fluch seiner ganzen Existenz. Warum glaubte er andauernd, dass alles nach seinem Willen ginge?
Weil es so sein sollte.
Er spürte eine andere Quelle der Macht – näher bei ihm, und sie roch wie ein Qwethnethog. Wie Thurkan.
Er nickte und zog die Macht in sich zusammen. Die Gegenwart der Qwethnethogs auf dieser Seite des Flusses war sehr verräterisch.
Der große Dämon wollte seine Kräfte mit denen von Thorn messen. Thorn warf seinen Steinkopf hin und her.
Idiot. Verräter. Ich habe das alles doch nur für dich getan.
Türkisgrünes Feuer spielte an seinen steckenartigen Baumgliedern entlang, und sein Bart aus grau-grünem Moos sonderte Macht ab. Die Elfen flitzten über die Lichtung, erregten sich am Überfluss seiner gewaltigen Vorräte, und er saugte sie mit einem einzigen Schluck aus. Ihre zerbrechlichen kleinen Körper sackten zu Boden.
Der gewaltige Dämon betrat die Lichtung von Süden. Seine Haut war vom Durchschwimmen des Flusses noch nass, und grüne und braune Blitze spielten um die Seiten seines Kopfes bis hinunter zu den langen, sichelbewehrten Armen und über den kostbar verzierten Schnabel und die gesamte Rüstung.
Thorn ließ ihn kommen.
Als sie nur noch wenige Pferdelängen voneinander entfernt waren, hob Thorn den knorrigen Arm. »Halt«, sagte er. »Wenn du kämpfen willst, dann spar dir deine Kräfte für die Unterwerfung unserer Feinde.«
Thurkan blieb zwar stehen, schüttelte aber den großen Kopf. »Gewaltigere Mächte als du oder ich streiten hier heute miteinander«, sagte er. »Du bist nur ein Spielstein in den Plänen einer weit größeren Macht.«
Das waren nicht die Worte, die Thorn erwartet hatte, und sie trafen ihn – sie trafen ihn mit der Macht, die jenen Worten eigen ist, die ihre ganz eigene Wahrheit in sich tragen.
»Das ist unmöglich«, sagte Thorn.
»Warum sonst sollten die Menschen all die Vorteile haben, die uns nicht zugestanden werden? Das, was du Glück nennst – wir haben es nicht. Alles, was wir tun, scheint den Feind zu begünstigen. Wir sollten uns von diesem Feld zurückziehen.« Thurkan hielt eine Axt hoch. »Oder wir müssen uns von dir befreien.«
Thorn brauchte Zeit, um die Vermutung zu überprüfen, dass er benutzt worden war. Er war doch derjenige, der die anderen benutzte – die Feindschaft zwischen den Hinterwallern und den Albiern, das Verlangen der Kobolde nach neuem Lebensraum, den Jagdinstinkt der Lindwürmer und Trolle.
Doch er selbst war nicht der, der benutzt wurde.
»Wir sind missbraucht worden«, beharrte Thurkan. »Befiehl den Rückzug; wir werden an einem anderen Tag kämpfen!«
Thorn dachte darüber nach.
Und er dachte an die gewaltige Masse seiner Infanterie – an die Wichte in ihren großartigen Rüstungen, an die fünftausend Irk-Bogenschützen, die Schwadronen von Trollen, die zum Kampf gegen die feindlichen Ritter bereit waren. An die Hinterwaller und die Lindwürmer und all die anderen Dämonen.
»Selbst wenn das, was du sagst, stimmen sollte, werden wir einen großen Sieg erringen«, sagte Thorn. »Wir werden das Königreich von Albia vom Antlitz des Kontinents tilgen. Wir werden hier herrschen.«
Thurkan schüttelte den großen Kopf. »Du machst dir etwas vor«, sagte er. »Du hast niemals genügend Kobolde, die diese große Zahl von gerüsteten Kämpfern besiegen könnten. Thorn, ich nenne dich beim Namen – ich nenne dich dreimal bei deinem Namen, damit du meinen Worten zuhörst. Eine Schlacht, sagt mein Großvater, ist das Ergebnis einer Situation, in der sich beide Seiten einbilden, sie könnten mit einem einzigen Streich einen eindeutigen Sieg erringen. Und nur eine der beiden Seiten hat recht. Heute glaubt der König von Albia, er könne uns besiegen. Und du glaubst trotz allem, dass du ihn besiegen kannst. Ich sage, wir werden auf diesem Feld verlieren. Zieh dich zurück, und ich werde weiterhin dein treuer Verbündeter sein. Befiehl den Angriff, und ich werde mit Feuer und Klauen über dich herfallen.«
Viele Herzschläge lang knabberte Thorn an Thurkans Worten, und nicht die leiseste Brise milderte die betäubende Hitze des späten Frühlings zwischen den Bäumen. Die Geräusche der Insekten waren verstummt. Kein Gwyllch zwitscherte; es war, als warte die ganze Natur auf Thorns Entscheidungen.
»Nicht umsonst nennen dich die Menschen den Redner, Thurkan«, gestand Thorn ein. »Du verstehst es ausgezeichnet zu sprechen. Aber ich zweifle deine Motive an. Du willst diese Armee für dich selbst haben. Du betrachtest nur dasjenige als gut, was für die Qwethnethog gut ist.« Er holte Luft und stieß sie langsam wieder aus, um seine Wut zu besänftigen. Dann wirkte er ein einzelnes Phantasma, einen lange vorbereiteten Schlag, der wie ein einziger, kräftiger Hieb wirkte.
Der Dämon reagierte sofort darauf und zog seine eigene, nicht unbeträchtliche Macht zu einer gewaltigen Mauer hoch, die den Hieb auffing.
Flink wie ein Berglöwe führte Thorn den nächsten Schlag.
Der einzelne Blitz aus grünem Licht drang durch die Mauer wie ein Rammbock durch die Wand eines Lehmhauses, und der große Dämon sackte ohne einen einzigen Laut zu Boden. Still lag er dort, mit Ausnahme des zuckenden linken Hinterbeins, das noch von seinem Hinterhirn gesteuert wurde und in Wut und Enttäuschung über den eigenen Tod immer wieder auf den Boden schlug.
»Angriff«, befahl Thorn seinen anderen Hauptmännern. Zu dem Leichnam sagte er: »Einer von uns hatte unrecht, Thurkan.« Er sog die Macht des Dämons in sich auf und erhob sich mächtiger, als er je gewesen war.
Das hätte ich schon vor einem Jahr tun sollen, dachte er und lächelte. Dann trat er auf das Feld hinaus und setzte sich an die Spitze seiner Armeen.
In der Nähe von Lissen Carak · De Vrailly
Jean de Vrailly lag sterbend in dem zufriedenen Bewusstsein, dass er eine wunderbare Waffentat vollbracht hatte – eine, über die die Menschen noch in Hunderten von Jahren sprechen würden. Sein Vetter hatte ihn verlassen. Das war auch ganz richtig so, denn die Schlacht ging ja weiter, und die Standarte des Königs schritt voran. Er aber lag mit dem Kopf auf den Beinen seines Knappen Jehan, der ebenfalls eine schreckliche Wunde davongetragen hatte.
Die Schmerzen waren so groß, dass de Vrailly kaum mehr denken konnte. Dennoch befand er sich in einer Ekstase der Erleichterung, denn nun büßte er mit jedem schwächer werdenden Herzschlag für all seine Sünden. Die riesigen Wunden in seiner Seite, aus denen bei jedem Atemzug Blut und Galle austraten und durch die Luft eindrang, waren eine lebendige Buße und genau das, woraus Ritterlegenden entstanden. Er würde in reinem Zustand zu seinem Schöpfer gehen.
Er bedauerte nur, dass er noch so vieles hätte tun können, und in den dunkleren Augenblicken seines Sterbens überlegte er, wie er seine Hüften etwas weiter hätte bewegen und dem Schlag des Lindwurms dadurch entgehen, vielleicht sogar unverletzt bleiben können. Es war so knapp gewesen.
Die Manifestation des Erzengels überraschte ihn – zum einen, weil er sich den Anordnungen des Engels widersetzt hatte, und zum anderen, weil der Engel bisher immer darauf bestanden hatte, nur ihm allein zu erscheinen.
Nun aber zeigte er sich in seiner glorreichen Rüstung, von Kopf bis Fuß in blendend weißer Panzerung und mit dem roten Kreuz auf dem weißen Wappenrock. Er war so ganz ohne jeden Schatten, dass es sogar den Tod abzustoßen schien.
Überall auf der Biberwiese hörten die Männer auf zu schreien. Diener fielen auf die Knie. Männer erhoben sich trotz ihrer Schmerzen auf die Ellbogen oder rollten sich herum, obwohl ihre Eingeweide im Matsch hingen – denn das hier musste der Himmel sein, der auf die Erde herabgestiegen war.
»Du Narr«, sagte der Erzengel sanft – und mit beträchtlicher Zuneigung. »Du stolzer, eitler, anmaßender Narr.«
Jean de Vrailly betrachtete das makellose Gesicht in dem Wissen, dass sich in sein eigenes die tiefen Furchen des Schmerzes eingegraben haben mochten. Und dass er auf den Tod zuschritt. Aber er hob den Kopf. »Ja!«, sagte er.
»Du warst wirklich großartig.« Der Erzengel beugte sich über ihn und berührte ihn an der Stirn. »Du warst würdig«, sagte er.
Einen Augenblick lang fragte sich Jean de Vrailly, ob der Erzengel ein Mann war. Die Berührung schien so zart zu sein.
Die Worte machten ihn froh. »Zu stolz, um den König von Albia zu verraten«, sagte er.
»Es existiert ein feiner philosophischer Unterschied zwischen dem Töten und dem Sterbenlassen«, sagte der Erzengel leise. »Dank dir sind all meine Pläne zu Asche geworden, und ich muss ein neues Gebäude errichten, damit gewisse Dinge geschehen können.« Er lächelte den sterbenden Ritter zärtlich an. »Du wirst das gewiss bedauern. Mein Weg war der bessere.«
Jean de Vrailly gelang ein Lächeln. »Pah!«, sagte er. »Ich bin ein großer Ritter gewesen, und ich sterbe in großen Schmerzen. Gott wird mich zu sich aufnehmen.«
Der Erzengel schüttelte den Kopf. »Vielleicht«, sagte er. »Aber ich bin der Meinung, dass du noch ein wenig leben und beim nächsten Mal vielleicht auf mich hören solltest.« Er beugte sich noch tiefer herunter und zog sich den strahlend hellen Panzerhandschuh von der Hand – es war eine schlanke Hand von unerkennbarem Geschlecht – und fuhr damit über den Körper des Ritters. Diese Berührung traf de Vrailly wie der Schock, den er bei seiner ersten Wunde erlitten hatte – und siehe da, er war geheilt.
Er holte tief und zitternd Luft und spürte dabei keine Schmerzen mehr.
»Du darfst mich nicht heilen«, fuhr de Vrailly ihn an. »Es wäre unritterlich von mir, als geheilt davonzugehen, während meine tapferen Leute am Rande eines grausamen Todes liegen.«
Der Erzengel drehte den Kopf, schob sich die langen Haare aus der Stirn und richtete sich auf. »Du bist der anspruchsvollste Sterbliche, der mir je begegnet ist«, sagte er.
De Vrailly zuckte mit den Achseln. »Ich werde beten und beten, wenn es das sein sollte, was du von mir verlangst, Taxiarch.«
Der Engel lächelte. »Ich gewähre dir auch die Heilung der anderen Männer – derer, die nicht schon vom Leben in den Tod geschritten sind. Und ich gewähre dir einen großen Ruhm am heutigen Tag – denn warum sonst sollte dich ein Engel des Herrn besuchen, wenn er dir nicht große Macht in der Schlacht zu verleihen gedenkt? Geh hin und erobere, du anmaßender kleiner Sterblicher. Aber ich sage dir dieses. Solltest du jemals versuchen, dich mit der größten Macht zu messen, die die Wildnis je hervorgebracht hat, so wirst du unterliegen. Das ist nicht mein Wille, sondern der des Schicksals. Hast du mich verstanden?«
»Das feige Schicksal würde mich niemals von einem Kampf abhalten«, sagte de Vrailly.
»Ah«, meinte der Engel. »Wie sehr ich dich doch liebe!« Er schwenkte seinen Speer über die Biberwiese.
Hundert Ritter und genauso viele Knappen, Soldaten und Diener waren geheilt, ihre Schmerzen waren weggespült, ihre Körper waren wieder unversehrt. In vielen Fällen fühlten sie sich besser als zu Beginn der Schlacht. Die chronischen Beschwerden eines als Bauer geborenen Soldaten, eines Gallyers, die er an seinem linken Unterschenkel gelitten hatte, waren verschwunden, und nun konnte er wieder aufrecht gehen. Ein Diener, dem das Licht des einen Auges gefehlt hatte, konnte wieder mit zwei Augen sehen.
Und das alles war allein durch das Schwenken eines Speeres geschehen.
Allerdings wurden auch einige Dutzend verwundeter Wildbuben geheilt.
»Geh und rette den König«, sagte der Erzengel. »Falls das wirklich dein Wille ist.«
Jedermann auf der Wiese kniete nieder und betete, bis der gerüstete Erzengel in einer Verpuffung der weihrauchgeschwängerten Luft verschwand.
Lissen Carak · Desiderata
Desiderata lag in einem Fleck aus hellem Sonnenlicht. Ihre Macht war gedämpft; sie fühlte sich wie eine Kerze unter einem Scheffel. Flackernd.
Es war so ungerecht! Ein einzelner Pfeil, der aus dem Himmel niedergeschossen kam, und schon war sie erledigt. Sie hatte ihren Gemahl unterstützen und vielleicht auch ihren Anteil am Ruhm erwerben wollen. Und stattdessen – das hier.
Der seltsame junge Mann hatte die Schmerzen in die Ferne verbannt. Das war ein Segen. Sie spürte seine Ehrenhaftigkeit wie eine helle Flamme. Ritter und Heiler – was für eine großartige Kombination. Es verlangte sie danach, ihn besser kennenzulernen.
Die Hofdamen um sie herum schwiegen.
»Jemand soll etwas singen«, sagte sie.
Lady Mary stimmte ein Lied an, und die anderen fielen langsam ein.
Desiderata lag auf einem Dutzend Soldatenmänteln.
Und dann kam der alte Harmodius. Er erschien unangekündigt, betrat einfach den Hof und kniete neben ihr nieder.
Es freute sie, seinen Blick zu sehen. Obwohl sie eine lebensgefährliche Wunde erhalten hatte, schien er ihre Gegenwart angenehm zu finden. »Da bist du ja, alter Narr«, sagte sie glücklich.
»Ich bin Narr genug, um die Schlacht zu verlassen und Euch zu retten, meine Liebe«, sagte er.
Vorsichtig rollte er sie mithilfe von Lady Almspend und Lady Mary auf die Seite und zog ihr den Leinenstoff vom Rücken. »Ihr habt einen wirklich schönen Rücken«, sagte er im Plauderton.
Sie atmete tief ein und aus und war nun doch noch zufrieden.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann sah, wie der König am Kopf seines Hausstands auf die Brücke zuritt, und er sah die Armee des Königs – mit mehr Soldaten, als er selbst je kommandiert hatte – die Erhebung herunterkommen.
Er ritt an dem Graben entlang – an jenem Graben, der noch vor Kurzem von zweihundert Bogenschützen und Dienern aus seiner eigenen Truppe besetzt gewesen war sowie mit allen Bauern der umliegenden Gehöfte.
Seine optimistische Gewissheit, dass der Feind einen taktischen Fehler gemacht hatte, war auf der Stelle verflogen, wie vom Winde weggeweht, und nun beobachtete er eine endlose Reihe von Kobolden, die das offene Gelände bis zum Graben überquerten und in einem Zustand der Panik zu sein schienen. Das Atmen fiel ihm schwer.
Der Prior saß neben Tom Schlimm auf seinem Schlachtross im Nichtschatten einer verbrannten Eiche.
Der Hauptmann lenkte sein Pferd zu ihnen und vergeudete dann seine Kraft damit, sein junges Kriegspferd zu bändigen, als der Hengst mit dem Reittier des Priors einen Streit anfangen wollte. Schließlich riss er gnadenlos an den Zügeln des großen Pferdes.
»Ich vermisse Grendel«, sagte er zu Tom.
»Jacques aber nicht, wie ich wetten möchte«, meinte Tom und schaute über die vom Sonnenschein bestrahlten Felder. »Sie kommen.«
Der Hauptmann nickte. Über ihnen verschoss die Blide eine weitere Ladung kleiner Steine. Sie flogen in die anbrandende Welle aus Leibern hinein und rissen ein großes Loch in die feindlichen Reihen.
Doch dieses Loch schloss sich fast sofort wieder.
»Es ist so dumm«, jammerte der Hauptmann. »Das Verbrennen der Gehöfte war alles, was er an Schaden anrichten musste.« Er drehte den Kopf dorthin, wo sich die königliche Garde in den Graben ergoss, angeführt von zweihundert in Scharlachrot und Purpur gekleideten Armbrustschützen aus Lorica. »Und dieser Angriff wird die Festung bestimmt nicht einnehmen, selbst wenn er über den Graben hinauskommen sollte.«
Die endlose Woge aus Kobolden und größeren, schlimmeren Wesen wallte über die verbrannte Ebene und auf die schwarze Linie seines Grabens zu.
Bis zum näher gelegenen Ende würde es die Verstärkung nicht rechtzeitig schaffen.
Die Bauern und Gildenmänner standen zu weit voneinander entfernt, und das wussten sie auch. Die unerfahrenen Schützen aus Lorica blieben plötzlich stehen, obwohl sie erst ein Drittel des Grabens besetzt hatten, und schossen. Wie eine Miliz.
Aber sie waren ja auch eine Miliz.
»Die Bauern werden den Graben halten«, sagte Tom, während er auf dem Stängel einer Blume herumkaute. Es war ein seltsam befremdender Anblick. »Die Gildenmänner hingegen werden einknicken. Das haben sie auch zuvor schon getan.«
Der Hauptmann sah den Prior an. »Messire, Ihr seid so viel älter als ich – an Jahren, an Erfahrung, und Ihr kennt diesen Ort auch besser. Ihr seid es, der mich führen oder mir Befehle erteilen sollte.«
Der Prior ließ es zu, dass sein Pferd den Kopf senkte und ein wenig graste. »Nein, das stimmt nicht. Ihr habt eine ganze Streitmacht bis hierher geführt. Sollte ich jetzt etwa die Kommandanten austauschen?«
Der Hauptmann zuckte mit den Achseln. »Ich wünschte, Ihr würdet es tun.«
Tom beobachtete die herannahenden feindlichen Linien. »Ihr wisst, dass wir sie angreifen müssen«, sagte er. »Das könnte uns etwa zehn Minuten Zeit schenken.« Er grinste, was ihm das Aussehen eines kleinen Jungen verschaffte. »Hundert Ritter, zehntausend Kobolde – und Trolle, Irks, Dämonen …« Er sah den Hauptmann an. »Ihr wisst, dass wir es tun müssen.«
Der Prior schaute zunächst Tom und dann wieder den Hauptmann an. »Ist er immer so?«, fragte er.
»So ziemlich«, bemerkte der Hauptmann zu dem Älteren. »Kommt Ihr mit? Ich bin mir aber keineswegs sicher, dass von uns jemand zurückkehren wird.«
Der Prior zuckte die Achseln. »Ihr seid vom Glück begünstigt«, sagte er. »Und Glück ist besser als das größte Geschick oder Genie. Ich kann die Macht in Euch spüren, junger Mann. Und ich glaube, Eure Gegenwart hier beruht auf dem Willen Gottes, und Gott sagt mir, dass ich dorthin gehen soll, wohin Ihr geht.«
Der Hauptmann rollte mit den Augen. »Das denkt Ihr Euch gerade aus«, sagte er.
»Habt Ihr in diesem Ton auch mit der Äbtissin gesprochen?«, fragte der Prior.
Der Hauptmann war peinlich berührt und sah weg.
»Wir werden Euch folgen«, fuhr der Prior fort. »Wenn die Festung fällt, verliert unser Orden alles.«
Der Hauptmann nickte. »Dann sollt Ihr Euren Willen bekommen. Tom, wir überqueren den Graben auf den beiden Brücken und formieren uns dahinter in offener Schlachtreihe.« Er sah sich um und bemerkte Pampe, Michael, Francis Atcourt und Lyliard; sie waren ausnahmslos bleich vor Erschöpfung.
»Tötet alles, was euch unter das Schwert kommt«, sagte der Hauptmann mit einer Spur Sarkasmus. »Folgt mir.«
Der König betrat den Hof der Brückenburg und traf dort seinen Magus Harmodius an, der gerade neben der Königin kniete. Er untersuchte die Wunde in ihrem Rücken, und Lady Almspend legte dem König eine Hand auf die Schulter und hielt ihn dadurch ab, sich den beiden noch mehr zu nähern.
»Gebt ihnen einen Augenblick Zeit, Mylord«, flüsterte sie ihm zu.
»Da kommen sie!«, rief eine Stimme von den Mauern herüber.
Armbrüste wurden unter schnell aufeinander folgenden knallenden Geräuschen abgefeuert.
Der König wusste nicht, was er tun sollte. »Ich muss sie sehen!«, sagte er zu Lady Almspend.
Lady Mary trat auf ihn zu. »Bitte, Mylord. Einen Augenblick noch.«
»Hier geht es um Sieg oder Niederlage!«, jammerte der König.
»So schnell ihr könnt, Jungs! Das Schicksal des Hauptmanns hängt von uns ab!«, brüllte die Stimme auf der Mauer.
»Mein Geliebter?«, rief Desiderata.
Harmodius trat zurück, sein Gesicht war ganz blass, während der König zu Desiderata lief.
Sie streckte ihm die Hand entgegen. »Du musst gehen und diese Schlacht gewinnen«, sagte sie.
»Ich liebe dich. Du machst mich zu einem besseren König – zu einem besseren Menschen. Zu einem besseren Ritter. Ich darf dich nicht verlieren«, sagte der König.
Sie lächelte. »Ich weiß. Geh jetzt, und gewinne diese Schlacht für mich.«
Er beugte sich zu ihr herunter und küsste sie, obwohl aus ihrem Mundwinkel noch ein Blutfaden rann.
Als er sich von ihr losriss, folgte ihm Harmodius.
»Ich würde dich gern fragen, was du hier tust, aber wir sind in Eile«, sagte der König.
Harmodius kniff die Augen zusammen. »Diese Schlacht ist schwieriger, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, und selbst jetzt noch hat unser Feind seine Macht in einem Maße verstärkt, sodass ich niemals an sie heranreichen kann«, sagte er. »Wenn ich die Königin heile, wird er mich bemerken und mich hier angreifen. Und dann wird er mich vernichten. Das ist ebenso sicher wie das Aufgehen der Sonne am Morgen.«
Der König blieb stehen. »Was können wir tun?«, fragte er.
Harmodius schüttelte den Kopf. »Es gibt Schutzmechanismen in der Festung – insbesondere in der Kapelle.« Er zuckte mit den Achseln. »Aber wenn ich sie dorthin bringe, dann könnte ich die Armee nicht mehr schützen, und dann wird er uns alle vernichten.«
Der König runzelte die Stirn. »Rette sie«, befahl er und wiederholte: »Rette sie. Ich werde einige meiner Ritter abstellen, um sie auf einer Bahre in die Festung zu tragen, und du kannst sie in die Kapelle bringen – selbst dann noch, wenn alle Feinde der Welt zwischen uns und der Festung stehen sollten.«
Harmodius sah seinen König an, der bereit war, die Armee für die Liebe zu seiner Königin zu opfern.
Aber seine eigenen Gefühle waren ebenso stark. »Also gut«, sagte er.
Lissen Carak · Pater Henry
Ihm gefiel nicht, was er tun musste. Ihm gefiel auch nicht, dass ihn alle hassten, und so wollte er mit ihnen rechten. Er wollte ihnen zeigen, was aus ihnen werden würde.
Sie würden so wie diese Frau werden. Wie all diese Hexen.
Die Seile durchzunagen, das war einfach. Aber die Bogenschützen hatten ihn verletzt, und sein Rücken war von den Peitschenhieben aufgerissen. Es dauerte lange, und es war äußerst schmerzhaft. Er machte eine Pause und ruhte sich aus. Und schlief ein.
Und erwachte, als er Stimmen hörte, die sich dem Keller näherten. Von unten.
Er kaute wieder an seinen Fesseln herum, war rasend vor Wut – wie ein Tier in der Falle. Als er seine Muskelkraft erschöpft hatte, betete er. Er überwand den Schmerz.
Darin war er gut.
Nach zahlreichen weiteren Stunden hatte er die Seile durchgebissen. Und dann kletterte er durch die Falltür in den nächst tieferen Kellerraum. Er bewegte sich vorsichtig, verlor nur einmal das Bewusstsein und wachte Minuten – oder Stunden – später wieder auf.
Er schaffte es bis zur Hauptrampe, die in die unteren Kellergewölbe führte, und hier hörte er zwei Bogenschützen, die Wache standen.
Er betete … und Gott wies ihm den Weg. Wer auch immer in den Keller gegangen sein mochte, er hatte eine Tür offen gelassen. Er zog sich zu ihr hin und warf einen Blick hinunter. Dann tastete er umher und fand eine Laterne sowie eine Kerze und Zunder. Das war Gottes Wille.
Er schleppte sich die Stufen bis tief in die Finsternis hinunter.
Die Söldner, tüchtig wie immer, hatten Orientierungspfeile auf die Felswände gemalt. Denen folgte er.
Lissen Carak · Thorn
Thorn beobachtete, wie sein großer Angriff vom Waldrand aus voranschritt. Dabei verspürte er Angst.
Er hatte in den Wochen der Belagerung zu viele Kreaturen verloren, und nun befürchtete er, nicht mehr genügend Reserven für sein Überleben zu besitzen.
Doch seine Angst hatte einen anderen Ursprung.
Als sein Angriff begonnen hatte, war etwas am anderen Flussufer erschienen, dessen Machtfülle für Thorn das war, was er selbst für einen Kobold-Schamanen darstellte. Diese Macht hatte ein einzelnes Phantasma von einer solchen Komplexität und Gewalt gewirkt, dass es Thorns stärkste Magie bei Weitem überstieg. Und dann war sie einfach wieder verschwunden.
Eine Macht. Eine gewaltige Macht der Wildnis.
Thorn stand am Rande der verbrannten Felder und sah zu, wie der Angriff auf den verhassten Feind zurollte. Er sah die Verwirklichung seiner Rache am König und an dessen nutzlosen Adligen, und er beobachtete, wie seine Kobolde schließlich die leere Unterstadt einnahmen und durch ihre Straßen strömten.
Doch ihn beherrschte nur ein einziger Gedanke: Verdammt sei dieser Dämon. Er hatte vollkommen recht. Ich wurde hintergangen.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann führte seine Männer in einer Reihe über die Bretter, die über den verbrannten, zu Glas geschmolzenen Graben gelegt worden waren. Als er hinüberschritt, winkten ihm von unten zwei Bauernjungen mit ihren Hellebarden zu und jubelten.
Warum denn nicht? Sie mussten schließlich nicht auf eine Horde von Kobolden zureiten.
Er lachte, drehte sich um und stellte fest, dass sich Jacques sowie Carlus mit der Trompete an der Hüfte hinter ihm befanden, und Michael trug sein Banner.
»Bildet eine Front«, rief er.
Die Reihe der Kobolde war etwa sechshundert Schritt entfernt.
Er sah zur Brückenburg zurück und hoffte den König auszumachen.
Dann blickte er über den Fluss, aber die Hauptstreitmacht eilte soeben erst den Hang hinunter. Zweitausend Ritter.
Der König war ein wenig spät dran.
Er sah eine Handvoll Ritter die Brücke überqueren. Das Banner war aus Gallyen, und er kannte niemanden.
Bewegung!, dachte er.
Er schaute zurück.
Seine Männer bildeten zusammen mit den Ordensrittern zwei Reihen, die zweihundert Ellen breit waren.
Und er befand sich inmitten von ihnen.
Die Formation der Kobolde war nun noch vierhundert Schritt entfernt – ungefähr.
»Vorrücken! Los!«, rief er, und Carlus verbreitete diesen Befehl mit seiner Trompete.
»Daran werdet ihr euch immer erinnern, Jungs!«, rief Tom Schlimm von seinem Platz in der Formation aus.
Die Erde zitterte unter den Hufen der großen Pferde, obwohl diese recht langsam dahinschritten. Ihre Rüstungen klapperten und klirrten, ebenso wie die Panzerungen ihrer Reiter. Das war der Klang einer Ritterkompanie.
Noch zweihundertfünfzig Schritte.
»Trab!«
Einhundertfünfzig gerüstete Männer auf Schlachtrössern brachten die Erde zum Erbeben.
Ein letztes Mal hatte der Feind sie unterschätzt. Mehr als ein Dutzend der großen Trolle tobten und brüllten etliche hundert Schritt hinter der Frontlinie. Nun kamen sie heran – und zwar schnell. Aber ebenso wie der König waren auch sie viel zu spät dran.
Der Hauptmann hatte jedoch den Eindruck, dass die Trolle auf offenem Gelände nicht besonders gut und auch nicht leicht zu lenken waren. Oder war das nur seine eigene Überheblichkeit?
Doch jetzt zählten Taktik und Strategie nicht mehr.
Er drehte den Kopf, was ihm Schmerzen bereitete, und sah die gallyschen Ritter durch den Graben hasten. Auch die loricanischen Armbrustschützen bewegten sich dort. Ser Milus war zu sehen und brüllte ihnen Befehle zu.
Wenn der Feind zuschlug, würden in ihren Reihen keine Lücken mehr sein.
Die beiden Formationen näherten sich mit der Geschwindigkeit eines galoppierenden Pferdes. Die Kobolde wichen nicht zurück, aber sie breiteten sich über das gesamte Gelände aus, verloren den Zusammenhalt, waren wie ein Schwarm von Insekten, der sich über die Erde ergoss.
»Angriff!«, brüllte er. Carlus und Jacques hatten ihn in dem Lärm des Hufgetrappels möglicherweise nicht gehört, aber nun senkte er seine Lanze und richtete sie auf das erste Ziel. Er verankerte sie in der schalenartigen Vorrichtung unter seinem Arm, und nun blies Jacques das Signal zum Angriff.
Der Hauptmann beugte sich über seine Lanze.
Einige prächtige Herzschläge lang war es genauso, wie er es sich vorgestellt hatte, als er noch ein kleiner Junge gewesen war und vom Ruhm geträumt hatte.
Er selbst war der Wind und das Donnern der Hufe und auch die Spitze seines Speeres.
Die schmalen Körper der Kobolde waren wie Strohpuppen, die auf dem Feld aufgestellt waren, und die Lanzen durchstießen sie so leicht, dass die Kreaturen starben, ohne die Waffen dabei nach unten zu reißen. Die stärkeren Soldaten waren in der Lage, drei, vier oder sogar fünf jener Kreaturen zu töten, bevor ihre Lanzen brachen oder die Spitzen den Boden berührten und fallen gelassen werden mussten.
Die Pferde trabten so weit auseinander, dass die Reiter die feindlichen Linien durchdringen, sich in die Lücken zwischen den Kreaturen setzen und sie auseinandertreiben konnten.
Einige tödliche Herzschläge lang vernichteten die Ritter die Kobolde, und es gab nichts, was diese dagegen hätten unternehmen können.
Aber wie Schlamm, der eine Egge verklebt, verlangsamte die schiere Anzahl der Kobolde allmählich den Vormarsch der Ritter, und selbst ihre schweren Pferde scheuten immer öfter – oder sie konnten ihren Hufen auf dem so dicht mit Kobolden übersäten Boden nicht mehr trauen. Der Angriff wurde zunehmend zäh und kam beinahe zum Erliegen.
Und dann schlugen die Kobolde zurück.
Lissen Carak · Pater Henry
Pater Henry hielt am Fuß der Treppe an und sammelte all seinen Mut. Und seinen Hass. Er befand sich tief unter der Erde, seine Kerze flackerte, und er hatte keine Ahnung, wie weit es noch nach draußen sein mochte. Außerdem litt er Schmerzen.
Er betete, dann ging er weiter. Er ging und betete.
Natürlich war es nicht viel weiter, als wenn er draußen die Burgstraße entlanggegangen wäre.
Schließlich kam er an eine zweiflügelige Tür, die so hoch wie zwei Menschen und so breit wie ein Kirchenportal war. Er erwartete, dass sie verriegelt sein würde, und zwar mit der gesamten Macht der Hölle. Aber die Sigille lagen kalt und leer daneben. Er griff nach den beiden großen Klinken. Zwischen ihnen steckte ein Schlüssel.
Lissen Carak · Der König
Der König ließ seine Königin auf einer Bahre von vier Pferden tragen. Er selbst und die Ritter seines Hausstands wichen durch das Tor der Brückenburg, während die gesamte Garnison auf den Mauern Pfeil nach Pfeil in die herannahende Linie des Feindes schoss.
Er bemerkte, dass der Prior und der Söldnerritter ihre Soldaten über zwei schmale Holzbrücken auf die Ebene führten.
Er sah nach rechts und nach links und versuchte zu begreifen, warum sie den Feind angriffen.
Aber es war ein glorreicher Anblick.
Die Ritter ließen sich Zeit, bildeten eine saubere Formation, und die endlose Horde der Feinde rannte schweigend auf sie zu. Das vermutlich Schlimmste an den Kobolden war ihre Stille. Er hörte, wie der Söldner Befehle brüllte, und sein Trompeter wiederholte sie.
»Fertig«, sagte Ser Alan.
Der König deutete auf den Graben. »Unsere Freunde waren so zuvorkommend, uns den Weg freizumachen«, sagte er und gab seinem Pferd die Sporen.
Während er ritt, beobachtete er den Angriff.
Es war großartig, und es ärgerte ihn nur, dass er nicht daran teilnahm. Er beugte sich zu Ser Alan zurück. »Sobald wir die Königin in die Festung gebracht haben, werden wir uns zu ihnen gesellen«, sagte er und deutete auf den Angriff, der wie eine Sense durch die feindlichen Linien schnitt.
Ser Ricar schüttelte den Kopf. »Mylord«, protestierte er, »wir haben nur sechzig Ritter.«
Der König sah weiterhin dem Angriff zu, während sein gesamter Hausstand auf den Graben zutrabte. »Er hat auch nicht viel mehr.«
»Aber Ihr seid der König!«, wandte Ser Alan ein.
Der König verspürte das Einsetzen der Unentschlossenheit, die ihn auf jedem Schlachtfeld überfiel. Seine lebenslange Ausbildung an den Waffen hatte ihn gelehrt, seine Ritter in einem solch wundervollen Angriff führen zu müssen – einem Angriff, der nun aber bereits ein wenig von seiner Wucht verlor, dreihundert Schritte vom Graben zu seinen Füßen entfernt.
Er war sich auch des Umstandes bewusst – so wie man sich eines fernen Rufes bewusst ist –, dass es gar nicht seine Aufgabe als König war, Heldentaten mit der Waffe zu vollbringen.
Desiderata hatte allerdings gesagt …
Der Kampf war so nah.
Und seine Königin brauchte ihn nicht. Der Weg bis hinauf zum Festungstor war frei.
»Ritter!«, brüllte der König. »Zu mir!«
Lissen Carak · Pater Henry
Der Priester hatte die geheimen Türen geöffnet. Er wich zurück und sah, wie die Kobolde durch die große Öffnung strömten. Sie wanden sich auf sehr unmenschliche Weise und verschwanden auf der Treppe, die nach oben führte. Einen Moment lang sah er ihnen zu, dann prallte etwas gegen seinen Kopf.
Er fiel. Aus den Augenwinkeln bemerkte er eine Art Stachel.
In einem Moment des Schwindels begriff er, dass dieser Stachel durch seinen Kopf gerammt worden war.
Er versuchte sich zu bewegen, brachte es aber nicht fertig.
Etwas schmerzte nun stärker als sein Rücken.
So langsam wie ein umstürzender Baum ging er zu Boden. Er versuchte zu beten, konnte es aber nicht, denn die Kobolde drückten sich an ihm vorbei. Also kreischte er und versuchte …
Er versuchte zu sterben, bevor sie ihn auffressen konnten.
Lissen Carak · Ser Gawin
Ser Gawin war bei Tagesanbruch aufgestanden und hatte sich zur Kapelle geschleppt, um dort zu beten. Lange kniete er im Morgenlicht und nahm außer dem Schmerz in seiner Seite und dem zermalmenden Bewusstsein seiner Niederlage überhaupt nichts wahr.
Doch schließlich erhob er sich, da er hörte, wie die Soldaten riefen, ein jeder solle sich auf sein Pferd schwingen. Er bekreuzigte sich, ging mit so festen Schritten wie möglich aus der Kirche und schleppte sich vor Ser Jehannes.
»Ich kann reiten«, sagte er.
Jehannes schüttelte den Kopf. »Er hat nichts von den Verwundeten gesagt. Ich selbst werde auch nicht reiten, mein Junge. Bleib hier.«
Gawin wollte ihm nicht gehorchen. Je länger er sich auf den Beinen befand, desto besser fühlte er sich. »Ich kann reiten«, wiederholte er.
»Dann reite morgen«, meinte Jehannes. »Tom hat seine Soldaten schon beisammen. Wenn du eine Hilfe sein willst, dann bewaffne dich so gut wie möglich, geh umher, und blicke zuversichtlich drein. Da draußen steht es schlecht.« Ser Jehannes deutete in den Hof der Festung, wo die Bauersfrauen und Nonnen schweigend zusammenstanden. Die meisten von ihnen beobachteten die Ereignisse auf den Feldern unter ihnen. »Wir haben etwa vierzig Männer, die die Festung halten müssen, und die Damen dort haben das Gefühl, schutzlos zurückgelassen worden zu sein.«
»Heiliger Jesus«, fluchte Gawin. »Vierzig Männer?«
»Der Hauptmann versucht den Sieg davonzutragen«, sagte Jehannes. »Verrückter Bastard. Wir hätten einfach in der Festung sitzen bleiben und den König das machen lassen sollen, was er machen will. Aber dieser kleine Mistkerl muss ja immer den verdammten Helden spielen.«
Gawin schenkte dem älteren Mann ein schiefes Grinsen. »Ein Familienleiden«, sagte er und ging davon.
Es dauerte lange, bis er seine Rüstung gefunden hatte, die unpoliert auf einem Haufen lag – nicht im Krankensaal, sondern in einem Verschlag neben der Apotheke.
Aber es wollte ihm nicht gelingen, die Rüstung überzustreifen.
Am Ende schaffte er es, die Brust- und Rückenpanzerung anzulegen und zu verschließen, indem er sich der Länge nach auf den Boden warf und sie wie eine Auster mit seinem Körpergewicht zudrückte. Der Schmerz in seiner Seite hielt ihn jedoch davon ab, die Riemen festzuzurren.
»Ich schließe Euch die Riemen, wenn Ihr mich lasst«, sagte eine Stimme.
Es war die Novizin. Diejenige, deren Erscheinen seinen Bruder so nervös gemacht hatte. Diejenige, die ihre Macht dazu eingesetzt hatte, ihn zu heilen.
»Ihr seid …«
»Amicia«, sagte sie und nickte einem Bogenschützen zu, der still auf der anderen Seite des Raumes stand. Er wirkte unglücklich und müde. »Er wurde zu meinem Schutz abgestellt, aber jetzt ist er äußerst gelangweilt, weil ich mich noch nicht in einen Kobold oder einen Drachen verwandelt habe. Bewegt Euch nicht.«
Ihre Hände wirkten seltsam zielstrebig. Und stark.
»Ihr verwendet die Macht«, sagte er.
»Ich gebe Euch ein wenig Kraft«, erwiderte sie. »Etwas Böses naht heran – ich kann es spüren. Etwas, das aus der Wildnis kommt. Wir müssen es aufhalten.« Sie klang entsetzt und gleichzeitig hellsichtig. Zerbrechlich.
Gawin glaubte ihr. Er sah zu dem Bogenschützen hinüber. »Wie heißt du?«, fragte er.
Der Junge wollte ihm nicht in die Augen sehen. »Sym, Mylord«, sagte er mürrisch.
»Sym, kannst du kämpfen?«, fragte Gawin.
»Allerdings«, bekräftigte Sym. Und sah noch immer weg. »Das ist das Einzige, worin ich gut bin. Aber aus welchem Grund bin ich abkommandiert worden? Zum Beschützen der Nonne des Hauptmanns.«
Die Finger an Gawins Schulter versteiften sich für kurze Zeit.
Nun sah Sym die beiden unter seinen Augenbrauen hinweg an. »Entschuldigung. Aber ich wäre lieber bei meinen Gefährten.« Er zuckte die Achseln. »Das ist der große Kampf. Ich habe noch nie an so einem teilgenommen. Alle Älteren reden großspurig über diesen und jenen Kampf, aber dieser hier ist der größte, den die Truppe je bestritten hat, und verdammt, bei Gott, ich will daran teilhaben.« Er sah wieder weg. »Ich möchte auch ein Held sein.«
Gawin lachte. Und überraschte sich selbst mit der Reinheit und Ungezwungenheit seines Lachens. »Das will ich ebenfalls«, sagte er und klopfte sich auf die Schultern. Er konnte das Gewicht seiner Armschienen nicht ertragen, doch er war ja bereits an Brust und Rücken geschützt, und Amicia zog ihm noch die Handschuhe über. Mit Syms Hilfe gelang es ihm schließlich, den Helm aufzusetzen und den Nackenschutz über das Haar zu ziehen.
Er dachte daran, etwas Neckisches zu Amicia zu sagen – Ihr seid der bestaussehende Knappe, den ich je hatte –, aber er schluckte es herunter.
Als Sym den Nackenschutz über den Rückenpanzer legte, tat sie etwas – etwas, das als Wort begann, dann zu einem blassgelben Feuer wurde und schließlich mit dem Geräusch endete, das eine platzende Seifenblase macht.
»Heilige Mutter Maria«, sagte sie und bekreuzigte sich. »Sie sind hier. Hier bei uns. In der Festung. Folgt mir!«, rief sie und rannte zur Tür.
Sym gehorchte sofort und ließ Gawin zurück, der noch nach seinem Langschwert suchte, das er schließlich in einer Ecke fand. Er ergriff Syms Schild, der daneben stand, und lief hinter den beiden her.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Was das geborgte Schlachtross des Hauptmanns auch immer für Schwächen haben mochte, es hatte wenigstens ein großes Herz, und es liebte den Kampf.
Das Pferd schwang vor und zurück, wirbelte auf den Vorderhufen herum, trat mit den eisenbeschlagenen Hinterhufen aus und hielt den Hauptmann im Mittelpunkt eines sorgsam geräumten Kreises, der völlig frei von Feinden war. Kobolde, die unter das Pferd zu gelangen versuchten, um diesem die Sehnen durchzuschneiden oder gar noch Schlimmeres zu tun, wurden zu einer klebrigen Masse zertrampelt oder einfach beiseitegetreten.
Der Hauptmann wusste schon lange nicht mehr, wie viele Kreaturen er getötet hatte. Sein Arm war müde – aber er hatte diesen Feldzug bereits so müde begonnen, dass er seine Waffe kaum hatte heben können.
Nun zogen sich die Kämpfer enger zusammen, wie sie es immer wieder geübt hatten – Pferd zu Pferd und Mann zu Mann.
Der Hauptmann schwang sein Schwert aus der Schulter heraus und schnitt einem Feind beide Arme ab, so wie ein Weinbauer eine Rebe beschneidet. Dabei lehnte er sich weit vor und balancierte in den Steigbügeln, dann schlug er einer anderen Kreatur in den Kopf, machte so den Weg vor sich frei, und George – irgendwann in diesem Kampf hatte der Hauptmann sein Pferd George getauft – wich ein paar Schritte zurück.
Und setzte sich hinter Tom Schlimm, der ein Mühlrad der Zerstörung war.
Er überließ Tom die Arbeit, hob sein Visier und sog die frische Luft in tiefen Zügen ein.
George aber wollte in die erste Reihe zurück.
Der Hauptmann stand in den Steigbügeln und überblickte die Schlachtenreihe. Seine Leute hatten eine gute Formation gebildet, in der es zwar Zwischenräume gab, aber es waren nicht viele.
Seine Leute ritten auf ihr Begräbnis zu.
Er hatte kein Zeitgefühl mehr – das hatte niemand in einem solchen Nahkampf. Aber hinter ihm strömten die purpurnen und gelben Waffenröcke in den Graben zu Meister Randoms Gildenmännern. Eine feste Reihe aus Scharlachrot stellte sich hinter ihnen auf. Und dahinter überquerte dichtes Grün die Brücke. Es waren die Bogenschützen aus der königlichen Jagd.
»Jacques!«, brüllte er.
Sein Diener befand sich zwei Pferdelängen von ihm entfernt und kämpfte um sein Leben.
»Carlus!«, brüllte er.
Der Trompeter drehte sich nicht einmal zu ihm um.
»Verdammt«, sagte der Hauptmann. Es war eine Sache von Sekunden und hart erkämpften Ellen, und ihm lief die Zeit davon. Sie mussten sich vom Feind befreien.
Er ließ George seinen Willen, woraufhin das Kriegspferd in einen von Jacques’ Gegnern hineinrannte. Eine Tonne Kriegspferd gegen hundert Pfund Irk, das war kein wirklicher Wettstreit.
Sein Schwert fällte einen anderen Irk, und dann ging Jacques zu Boden, als sein Pferd stürzte – getötet von einem der Dutzend Kreaturen unter seinen Hufen. So schnell war Jacques verloren. Der Hauptmann wendete, erschlug einen Irk unter Georges Hufen und beobachtete, wie ein Speer Carlus unter dem Kinn erwischte und ihn damit sofort tötete. Er ging nieder, zusammen mit seiner Trompete, und jetzt war eine Schneise geöffnet. Der Hauptmann schlug um sich, sein Schwert köpfte einen Kobold, als dieser gerade in Jacques’ Kehle biss. Er brüllte und sah sich nach Hilfe um, aber da war niemand.
Lissen Carak · Desiderata
Unter dem Schutz von Ser Driant und fünf weiteren Rittern wurde die Bahre der Königin über die lange und gewundene Straße hoch zum großen Tor der Festung getragen.
Der König hatte seinen Rittern befohlen, hinter ihm eine dichte Formation zu bilden.
»Noch einmal, Mylord«, sagte Ser Alan. »Ich würde den König gern daran erinnern, dass Lord Glendower, wenn er noch lebte, dies niemals erlauben würde.«
Bei dem Wort erlauben wich jede Vernunft aus dem Kopf des Königs. »Ich bin der König«, sagte er. »Ihr habt mir zu folgen.«
Die meisten der Söldnersoldaten und ihres Gefolges hatten fast genau in der Mitte des Schlachtfeldes einen dicken Knoten gebildet. Der König richtete den stachelbewehrten Kopf seines Pferdes auf das Banner des Hauptmanns aus. »Folgt mir!«
Lissen Carak · Harmodius
Harmodius spuckte vor Wut, wendete sein Pferd und folgte dem König, der sich in die Arme des Feindes warf, obwohl ihn alles andere gerettet hätte.
Die Königin würde sterben. Und er, Harmodius, liebte sie auf eine Weise, wie es der König niemals vermochte – sie war ein vollkommenes Kind der Hermetik. Ein Engel, der auf die Erde gekommen war.
Aber wie es einem Künstler mit seinem Lieblingsbild ergehen mag, so konnte Harmodius es nicht ertragen, den König sterben zu sehen. Nicht hier – nicht so nahe dem Triumph oder wenigstens der Rettung.
Wir alle treffen die falschen Entscheidungen, dachte Harmodius. Wenn er hier starb, würden seine neu gewonnen Erkenntnisse mit ihm sterben.
Es war wie in einer alten Tragödie, in der den Menschen Weisheit zugestanden wurde, nur damit sie diese sofort wieder verloren.
Doch es blieb ihm keine Zeit mehr, die er auf solche Gedanken verschwenden konnte.
Lissen Carak · Thorn
Thorn sah beinahe ungläubig zu, wie sich das Ziel seines Feldzuges ungeschützt nach vorn warf. Es wäre ihm niemals möglich gewesen, den König auf hermetische Art zu solch einem dummen Zug zu zwingen.
Den König.
Er war auf die Festung zugeprescht, und Thorn hatte seine eigene Niederlage plötzlich ganz deutlich vor sich gesehen, denn in der Festung wäre der König unangreifbar.
Aber nein.
Nun führte dieser Narr seine Ritter in die Höhle von Thorns Ungeheuern.
Und seine Kobolde befanden sich in der Festung.
Einen Augenblick lang konnte er sich nicht entscheiden, ob er den König durch seine Macht töten oder dafür die ausgesuchtesten Kreaturen aussenden sollte.
Er kam zu dem Ergebnis, dass er gewonnen hatte, wenn er den König tötete, gleichgültig wie die Schlacht ausgehen mochte. Welche Macht ihn auch immer benutzte, er würde ihr die Stirn bieten können, wenn er den König von Albia tötete. Es würde einen Bürgerkrieg auslösen. Es würde die Macht der Menschen über Albia schwächen.
Er sammelte die Macht in sich.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Die Truppe um ihn herum starb.
Wegen der fast alles verbergenden Rüstungen wusste er nicht, wer fiel – er konnte immer nur einen kurzen Blick erübrigen. Aber als die Kobolde sie umzingelten und immer dichter bedrängten, gingen die gerüsteten Soldaten zu Boden – entweder weil ihren Pferden die Sehnen durchtrennt worden waren, oder weil sie von Speeren oder glückhaften Pfeilen getroffen wurden.
Tom schlug neben ihm zu wie ein ganzes Hammerwerk, Pampe glich einem Racheengel, und die Ordensritter kämpften wie die Legionen des Himmels.
Als er sein Schwert abermals hob und senkte, hätte er am liebsten über die Sinnlosigkeit des Ganzen gekichert, wäre er nicht so beschäftigt gewesen. Sie hatten Zeit geschunden, und die Hauptschlacht sollte inzwischen gewonnen sein. Aber die Bitterkeit … wenn Carlus nicht mitsamt der Trompete gefallen wäre, wenn Jacques fünfzig Herzschläge länger gelebt hätte …
Er erschlug zwei weitere Kobolde, bevor er den Troll sah.
Dieser bäumte sich auf, sein Steingesicht war glatt und schwarz, als er einen schrillen Ton ausstieß, der über dem Waffengeklirr und dem stillen Kampf der Kobolde deutlich zu hören war.
Doch es war nicht nur einer.
Es waren sechs.
Die Furchtwelle, die ihnen vorauswogte, brachte die Kobolde unter den Hufen seines Pferdes zum Zittern, und ihre Angriffe gingen ins Leere. George bäumte sich auf, trat aus und stürzte sich nach vorn.
Die Welle des Schreckens stürzte über sie hinweg.
Der Hauptmann packte sein Schwert mit beiden Händen, und George setzte auf den ersten Troll zu, während der Rote Ritter das Schwert hoch über den Kopf hob. Eigentlich solltest du bei diesen Wesen besser eine Lanze benutzen, dachte er.
Der Troll sah ihn, drehte sich um, legte den Kopf mit dem starken Geweih so zurück, dass dieses seinen Nacken schützte, und griff an. Er versuchte, das Geweih unter das Schwert des Roten Ritters zu drücken und ihn vom Pferd zu heben.
Mitten im Lauf drehte George um.
Schneller als ein menschlicher Gedanke prallten die beiden Wesen aufeinander.
George verlagerte sein Gewicht wie eine Katze, schwang herum, trat mit dem Huf aus und versetzte dem Ungeheuer einen so gewaltigen Schlag gegen die Stirn, dass das Steingesicht zerbrach.
Der Troll kreischte, drehte den Kopf, sein Geweih peitschte durch die Luft. Er sprang und erwischte das gepanzerte Pferd an der rechten Lende. Georges Hinterläufe verloren den Kontakt mit dem Boden, und das Pferd drehte sich auf den Vorderhufen um sich selbst …
Die Angriffslinie öffnete sich wie ein beiseitegezogener Vorhang, als sich die beiden Geschöpfe umeinanderdrehten. Der Hauptmann fühlte sich, als stünde ihm plötzlich alle Zeit der Welt zu – als wäre dieser Augenblick seit dem Anbeginn der Welt vorhergesagt worden. Die Drehung des Trolls – die Drehung seines Schlachtrosses – die offene Linie hinter dem Ungeheuer …
Zweihändig schlug er mit seinem Schwert zu; es war wie der Sturz einer Sternschnuppe auf die Erde, und er traf dort, wo zwei Platten aus gehärtetem Fleisch zusammentrafen. Er durchtrennte das Rückgrat des Trolls, zog das Schwert wieder heraus, Blut spritzte …
George sprang weg, taumelte, und der Hauptmann wurde aus dem Sattel geworfen.
Er landete mit der Schulter auf etwas Schwammigem und rollte davon herunter. Seine Schulterplatten knirschten dabei wie die Wagenräder eines Kesselflickers, während die Muskeln an seinem Hals, die seit dem frühen Frühling immer wieder in Mitleidenschaft gezogen worden waren, abermals gezerrt wurden.
Doch er beendete die Rolle auf den Knien und sprang sofort auf die Beine. Rechts von ihm schlugen Tom und Pampe auf einen weiteren Troll ein, aber hinter ihnen löste sich der dicke Knoten der Kämpfer allmählich auf, während sich die verbliebenen Trolle über die Pferde hermachten. Rüstungen zerbrachen, Menschen starben.
Lissen Carak · Ser Gawin
Gawin folgte Sym, während dieser wieder der Novizin folgte – die Treppe hinunter, durch den Hof zum Eingang und zu den Kellergewölben, wo die Vorräte gelagert wurden.
Zwei Bogenschützen bewachten die schwere Eichentür zu den Kellern.
»Die Wildnis dringt über unseren Fluchtweg hoch!«, rief Amicia, Angst und Verzweiflung verliehen ihren Worten Macht.
Jede Bauersfrau im Hof und jede Nonne hörten sie.
Die beiden Bogenschützen sahen einander an.
Sym war dicht hinter ihr. »Befehl des Hauptmanns!«, rief er mit dünner, schriller Stimme – was nicht sehr heldenhaft klang.
Der größere der beiden Bogenschützen spielte an seinen Schlüsseln herum.
Gawin rannte quer über den Hof und gesellte sich zu ihnen.
Die Frauen waren erstarrt, und er hatte einen Augenblick Zeit, den Ausdruck ihrer Gesichter zu beobachten – Panik zeichnete sich darauf ab, Entschlossenheit und eine dumpfe Art von Wut, dass es auch noch dazu kommen sollte, wo sie doch schon so viel verloren hatten.
Ja, er verstand diese Mienen, die von Verlust kündeten. Und von Versagen.
»Bewaffnet euch!«, rief er ihnen zu.
Der größere Bogenschütze öffnete die eisenbeschlagene Tür, und Sym rannte sofort die Treppe hinunter in die Dunkelheit.
Gawin drückte sich an der Novizin vorbei.
Im ersten Keller war es düster, aber noch hell genug, um etwas sehen zu können. Etliche Speere lehnten gegen einen der großen Wagen der Truppe. Im Vorbeilaufen nahm Gawin eine der Waffen an sich.
Vor ihm befand sich eine weitere Tür, die sich gerade öffnete.
Sym konnte es nicht mehr verhindern, aber er rammte dem Kobold sein Schwert in den gepanzerten Brustkorb, riss es wieder heraus und trat so heftig gegen die Kreatur, dass diese nach hinten kippte …
Gawin erspähte Stufen, die in die Tiefe führten, und ein Gewoge von Wesen, das die Treppe anfüllte.
»Halte die Tür!«, brüllte Gawin. Er stach mit seinem Speer zu und spürte, wie die Stahlspitze die Haut um den Hals des nächsten Kobolds durchdrang. Es war, als würde man ein Messer in einen Hummer stecken. Etwas verursachte ein knallendes Geräusch, sein Speer kam wieder frei, und er stieß das Wesen von sich.
Sym hieb mit seinem Schwert immer wieder zu; Verzweiflung und Schrecken verliehen seinem Schwertarm Flügel.
Die Treppe brodelte vor Kobolden.
Er tötete einen weiteren.
Und noch einen.
Die Novizin drehte sich um, hob die Hände und sprach ein einziges Wort auf Archaisch, daraufhin erfüllte ein golden-grünes Licht den Keller.
Lissen Carak · Desiderata
Aufgrund der Macht, die sie in sich hatte, konnte Desiderata kaum atmen. Außerdem kehrten die Schmerzen zurück. Aber sie spürte den Feind – das Zentrum aller Macht der Wildnis, seine smaragdene Intensität, durchschossen mit schwarzer, sich sammelnder Kraft. Sie spürte es genauso deutlich, wie sie die Macht der Sonne auf ihren Armen spürte.
»Was geschieht hier?«, fragte Ser Alan. Vorsichtig setzte er auf der Schwelle zur Kapelle ihre Bahre ab.
Die Frau war schon älter; sie war einfach gekleidet, wie eine Dienerin oder eine Bauersfrau. In den Händen hielt sie einen Speer. »Wenn Ihr beliebt, Ser Ritter, es sind Kobolde in die Keller eingedrungen, und die ganze Garnison versucht die Tür zu halten.«
»Gütiger Christus!«, fluchte Ser Alan. Die anderen Ritter der Eskorte zogen ihre Schwerter.
Lissen Carak · Thorn
Thorn beobachtete, wie sich der König und seine Ritter dienstwillig zum Mittelpunkt der Schlacht vorkämpften.
Manchmal gingen seine Pläne doch auf.
Seine Trolle – die großartigen Dhags – hieben die Ritter in Stücke. Dabei starben sie zwar ebenfalls, aber ihm standen schließlich noch viele von ihnen zur Verfügung. Und er konnte weitere beschaffen. Die Wildnis war so fruchtbar, wie sich die Menschen das niemals vorstellen konnten.
Er ließ den König weiterkämpfen, immer weiter, bis seine kühne Truppe den Ring aus Haut und Knochen durchbrach, der um die Söldner herum lag. Um die dunkle Sonne.
Nun waren der König und die dunkle Sonne zusammengekommen.
Er nahm seine angesammelte Macht, klaubte jeden Faden auf, den er erhaschen konnte – die Macht, die zu Thurkan gehört hatte, die Seelen des Feenvolkes, die Essenz der Sossag-Schamanen …
Einen Augenblick lang kostete er sie.
Nichts gab es mehr, was ihn hätte unterbrechen oder ablenken können, als er seine Macht beinahe liebevoll zwischen seine beiden Feinde legte.
Das Gebäude seiner Erinnerungen war kein Palast, sondern ein Knäuel aus Seilen und Fäden, und er flocht sie in seinem Geist mit der Meisterschaft eines Äons.
Dann legte er die Hand auf das geflochtene Band und wirkte seinen Zauber.
Harmodius spürte ihn, sah ihn und begegnete ihm mit seiner eigenen Magie: mit einem Spiegel. Auch seine Entgegnung wies Schleier und Verkleidungen auf, Fallen innerhalb von Fallen. So wie er es gelernt hatte.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann spürte den Augenblick, in dem die großen Phantasmata gleichzeitig entfesselt wurden. Es war, als erfüllten Feuer oder Blitze jeden Zoll der Luft zwischen den beiden Zauberern.
Er war Harmodius. So wie er einen Augenblick lang Amicia gewesen war.
Es war keine Zeit mehr.
Ihm blieb so wenig – aber er gab es, unmittelbar in Harmodius’ Arme hinein. Er griff zu und nahm etwas von Amicia, die selbst um ihr Leben kämpfte – und von Miram und ihrem Nonnenchor. Und vom Sonnenlicht um ihn herum.
Aber es war nicht genug.
Der Hauptmann streckte sein Innerstes zu der großen eisenbeschlagenen Tür hin aus, warf sie auf, und grünes Licht flutete in ihn hinein.
Er lenkte es in Harmodius hinein, damit der Gegenzauber gestärkt wurde.
Ein Donnerschlag erschallte – ein Aufblitzen von weiß-grünem Feuer, das in den Himmel schoss. Der Vorhang der Wirklichkeit kräuselte sich, sodass der Schleier vor der Welt einen Augenblick lang zur Seite gezogen wurde. Der Hauptmann sah die schwarze Nacht, von weißen Sternen durchbohrt, und die Dämmerung des Chaos sowie die aufsteigende Rauchsäule der Macht, welche das Heraufziehen der Welt andeutete.
Lissen Carak · Desiderata
Desiderata spürte, wie Harmodius’ Macht anwuchs und auf den smaragdenen Riesen traf – und sie sah die Subtilität seines Geistes bei diesem Zauber.
Aber die Macht des Smaragdenen war dennoch zwanzigmal stärker als die des Hofmagus, und eine Flutwelle aus Grün rollte über ihn hinweg – wurde gespiegelt, kanalisiert, verteilte sich, aber sie war noch immer überwältigend, wie ein anschwellender Fluss vor schmalen Kanälen und niedrigen Deichen, die er allesamt zu überspülen und unter einer uneindämmbaren Flut zu begraben imstande wäre.
Und doch hingen gewaltige Mengen dieser smaragdenen Macht in der Luft, waren von Harmodius’ Gegenzauber abgelenkt worden. Oder sie waren ein Teil dieses Gegenzaubers.
Das Kräuseln der Macht durchfuhr den König, der entsetzt mitansehen musste, wie Ser Alan neben ihm verbrannte. Seine Rüstungsriemen verkohlten, sein Gesicht war dunkelrot, als er schrie – und Mann und Pferd brachen zusammen. Hinter ihm runzelte Harmodius die Stirn. Seine Hand verschrumpelte, wurde zu Asche und verwehte, und innerhalb weniger Herzschläge war der ganze Magus verzehrt. Er wandelte sich zu Asche, zerfiel und wurde vom Wind davongetragen.
Thorn wurde in dem Augenblick von dem Spiegel getroffen, als er sein Phantasma vervollständigen wollte, und ein wenig von seiner eigenen, sorgsam gehorteten Macht wurde zu ihm zurückgeworfen und verbrannte ihn schließlich.
Er schrie. Er zuckte. Doch draußen auf dem Schlachtfeld flackerte Harmodius’ Innerstes und verlosch.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann schlug zu; sein Schwert ging eher aufgrund der Schwerkraft nieder als infolge seiner eigenen Muskelkraft.
Im Äther hielt er Harmodius bei der Hand.
Nimm mich auf, Junge.
Innerhalb eines Augenblicks musste der Hauptmann verstehen und handeln. Er öffnete den Weg in seinen Palast, ergriff den Geist des toten Magus mit der einen ätherischen Hand und wob seinen eigenen Zauber mit der anderen. Die Luft draußen war vor abgesonderter Macht ganz schwer geworden, grün und reif, und er pflückte sie, geleitet von dem thaumaturgischen Wissen seiner Lehrerin und dem Zauber Amicias …
Und da war er. Er stand auf dem Podest, auf dem Prudentia immer gestanden hatte.
»Besser der Sklave eines schlechten Meisters …«, murmelte der Magus.
Plötzlich war sich der Hauptmann unsicher, ob er es dieser … Wesenheit hatte erlauben dürfen, sich in seinen Palast zurückzuziehen.
»Im Sturm ist jeder Hafen recht, Junge«, sagte der Magus. »Geh und kämpfe gegen die Ungeheuer, oder du bist bald so tot wie ich.«
Und wieder hob er sein Schwert. Die Luft war noch immer mit Macht gesättigt.
George war hinter ihm, hatte sich wieder auf die Beine gekämpft.
Verstärke meine Stimme, befahl er dem toten Magus.
»Keilformation! Zu mir! Michael – das Banner zu mir!« Seine Stimme erschallte wie die eines Gottes aus dem Altertum.
In einem Augenblick, der aus der Zeit gefallen schien, fragte sich der Hauptmann, ob so die Legenden über diese Götter zustande gekommen waren.
Dann war er wieder ganz in der Gegenwart.
Kniet nieder!, befahl er den Kreaturen der Wildnis.
Dreimal heiliger Hermes, Junge! Du forderst ihn heraus! Hör auf damit!
Ein Drittel der Kreaturen um ihn herum hörte zu kämpfen auf, fiel zurück oder stand einfach nur verblüfft da.
Lissen Carak · De Vrailly
Ser Jean de Vrailly führte die Armee des Königs den letzten Hang hinunter, und die Hufe klapperten wie Hagelschlag, als die Pferde die Brücke überquerten. Er hatte mehr als tausend Ritter bei sich, und niemand – nicht einmal der Graf der Grenzmarken – stellte seine Befehlsberechtigung infrage. Ein Erzengel hatte ihm Glorie verliehen, und jeder Mann in der Hauptschlacht wusste das.
Jean sah, dass die königliche Standarte in der Falle steckte, weit draußen im Meer der Feinde, zusammen mit einem anderen Banner, das er nicht kannte: Wappen in Gold auf schwarzem Feld. Ein geckenhaftes Banner.
Doch er lachte, als er die Schlacht sah, und führte die ersten Kolonnen hinter der Brücke nach links – nach Westen auf die untergehende Sonne zu.
Die Soldaten in dem langen Graben stiegen nun allmählich heraus – entweder aufgrund der treuen Entschlossenheit, ihren König zu retten, oder aus Eifer, am bevorstehenden Angriff teilzunehmen.
Gut für sie. Hier gab es genug Ruhm für alle zu erwerben.
Er ritt weiter nach Westen, während ihm die lange Reihe der Ritter folgte und die südliche Flanke des Feindes allmählich einkreiste.
Hinter ihm stellte sich der Comte d’Eu in die Steigbügel und deutete mit seiner Lanze auf das Gewühl um die königliche Standarte herum. »À moi!«, brüllte er.
Daniel Favor, ein ehemaliger Fuhrmann, kletterte über den Rand des Grabens und stellte sich ins windumtoste Gras. Überall um ihn herum sahen ihn die Bauern aus den Dörfern bei Lissen Carak bewundernd an.
Adrian Pargeter kletterte ebenfalls aus dem sicheren Graben, legte seine Armbrust auf den Boden und zog sein Schwert. Ältere Gildenmänner sahen einander an. Ein graubärtiger Tuchhändler fragte seinen lebenslangen Rivalen: »Sollen wir das wirklich machen?« Und dann stiegen beide aus der verglasten Erde und zogen ebenfalls ihre Schwerter.
Ranald Lachlan sprang aus dem Graben, schwenkte seine Axt und deutete auf den Feind. »Kommt!«, rief er.
Nach wenigen Augenblicken war der Graben leer.
Lachlan warf seine Axt in die Luft. Sie beschrieb einen großen, glitzernden Bogen über seinem Kopf und fiel dann in seine Hand zurück.
Und nun griff die dünne Linie der Männer an.
Lissen Carak · Ser Gawin
Gawin sah, wie Sym ins Taumeln geriet, und zwei der gerüsteten Wesen ergriffen ihn und zerrten ihn zu Boden. Syms Dolch stach zu, weidete einen anderen Kobold aus, der auf ihn gefallen war … und dann war der Bogenschütze verschwunden, und Gawin stand allein in der Tür.
Ein hellgrünes Licht blitzte auf, und nun konnte Gawin viel zu weit sehen. Die kriechenden Wesen unter ihm auf der Treppe wurden braun, ihre Augen brannten aus, und Dutzende von ihnen sanken zu Boden. Alle Lebenskraft sickerte aus ihnen, während ihre Körper zerfielen.
Gawin keuchte auf.
Etwa ein Dutzend der Wesen waren noch übrig – eine kriechende, wogende Masse aus Armen und Beinen –, und er hieb wie ein Wahnsinniger auf sie ein, dann aber taumelte er zurück …
Ein Schwarm bewaffneter Männer stürzte sich auf die Kobolde, zerhackte sie mit Äxten, erstach sie mit Speeren – es waren sechs Ritter, die er nur allzu gut kannte. Es handelte sich um Ser Driant und andere Männer aus dem Haushalt des Königs.
Gawin wurde zu Boden gerissen. Seine Aufmerksamkeit war für einen Augenblick abgelenkt, und zwei der Wesen erwischten ihn …
Aber schließlich war er Harthand, und so ballte er die Linke zur Faust und rammte sie gegen ein ovales Auge, packte den Arm seines Gegners und riss ihn aus. Es war, als zerfetze man altes Leder. Dann schwang er den krallenbewehrten Arm wie eine Keule und hieb das blutende Wesen damit zu Boden. Nun riss er ihm den Hüftschutz ab, rammte dem zweiten Kobold das Knie gegen die weiche Stelle in der Mitte der Brust, und als die Kreatur ihre Arme um ihn schloss, rammte er ihr den Dolch in den Rücken. Nun drangen von allen Seiten Speere in das Geschöpf.
Er kämpfte sich auf die Beine und hielt seinen Dolch wie die Kralle einer Gottesanbeterin. Doch die einzigen Gestalten, die in dem grün erhellten Kellerraum noch standen, waren Männer in Rüstungen.
Gawin sackte zusammen.
Ser Driant streckte eine blutbefleckte Hand nach ihm aus. »Ser Gawin?«, fragte er.
Gawin sah sich nach der Novizin um.
Sie war gegen eine Wand gesackt. Zu ihren Füßen lagen die Überreste des Bogenschützen Sym. Die Gesichtshaut war dort, wo sich die Wesen auf ihn gestürzt hatten, in Fetzen gerissen. Sie goss ihre Macht in ihn hinein.
»Du kannst ihm nicht helfen«, sagte Gawin. »Wie groß deine Gabe auch immer sein mag, du kannst ihm nicht mehr helfen.«
Sie beachtete ihn gar nicht.
Ser Driant packte ihn an der Schulter. »Ist sie eine Heilerin?«, fragte er.
Lissen Carak · Thorn
Thorn spürte die Herausforderung als einen Schlag in den Magen.
Die dunkle Sonne.
Die junge Macht glühte vor frischer Lebenskraft. Er hatte neue Beute gerissen und – war stärker geworden.
Thorn riss sich zusammen.
Ich bin verletzt. Er ist es nicht. Und ich bin übertölpelt worden.
Was ist, wenn er mich besiegen kann?
Die Luft zwischen ihnen war von der grünen Macht seines letzten Phantasmas, die nur halb aufgebraucht war, dick geworden. Er musste diese Macht bloß ergreifen …
Wenn er dabei allerdings angegriffen wurde, wäre es sein Ende.
Was ist, wenn das alles von Anfang an geplant war? Wenn ich dazu gebracht werden sollte, mich zu verausgaben, um vernichtet werden zu können?
O Thurkan, vielleicht muss ich mich bei dir entschuldigen.
Vorsichtig umwickelte er sich mit den Sigillen der Verbergung, während er falschen Trotz in die Welt hinausbrüllte.
Angriff!, befahl er seinen Kreaturen.
Hoch über ihm packte in der Festung seiner Feinde jemand die Macht der Wildnis, rau und grob, und formte sie zu einem mächtigen Phantasma.
Aha!
Er wartete gar nicht erst darauf, dass sich die Falle schloss. Er floh.
Lissen Carak · De Vrailly
Jean de Vrailly hatte den Augenblick gut gewählt. Er hatte Albias Ritter etwa eine Meile entlang des Flusses nach Westen geführt. Eine Handvoll Kobolde hatte versucht, sich ihm entgegenzustellen. Sein Schwert war von ihrem höllischen Blut noch feucht, und ihnen die Köpfe abzuschlagen war so einfach gewesen, wie die Fenchelpflanzen im Garten seiner Mutter umzumähen.
Und jetzt …
Oh, der Ruhm!
Er hob den Arm, ballte die Faust und wendete sein Pferd. »Halt!«, befahl er. »Jetzt werfen wir uns dem Feind entgegen!« Das war kein militärisches Kommando, aber er hatte noch nie zuvor so viele Ritter befehligt, und dabei kannte er deren Kommandos in ihrer eigenen Sprache nicht einmal. Also verließ er die Reihe und galoppierte an der Kolonne entlang. »Seht mich an!«, rief er. »Kommt! Wendet eure Pferde!«
Sobald ihn ein halbes Dutzend Ritter verstanden hatten, verstanden ihn auch alle anderen. Und die große Kolonne, tausend Pferde lang, drehte sich zu einer Reihe aus tausend Pferden, die sich hintereinander befanden, während er an ihnen vorbeipreschte, die Lanze hoch über den Kopf hielt und die königlichen Insignien von Albia auf seiner Brust glitzerten.
Ich werde König sein.
Er wusste nicht, woher dieser Gedanke gekommen war, aber plötzlich war er da. De Vrailly grinste, wendete sein Pferd und sah sich dem Feind gegenüber. Er befand sich im Mittelpunkt dieser gewaltigen Formation. Weit rechts von ihm befanden sich seine eigenen Ritter, die bereits von ihren Pferden gestiegen waren, und die Männer aus der königlichen Garde, die von seinem Vetter angeführt wurden – sie hatten einen Vorstoß in die feindliche Linie gemacht. Dabei waren sie schrecklich in der Unterzahl.
Aber das war jetzt gleichgültig.
Denn er lag wie der Querbalken eines T vor dem Feind, und dieser hatte all seine Reserven bereits mobilisiert. Es gab keine Macht auf Erden – weder in der Wildnis noch außerhalb von ihr –, die tausend Ritter aufzuhalten vermochte, die in einer Reihe angriffen.
Er hob seine Lanze und spürte die erstaunliche, engelgleiche Kraft, die ihn erfüllte. »Für Gott und Ehre!«, brüllte er.
»Deus vult!«, riefen die Ritter. Die Männer schlossen ihre Visiere.
Und dann setzte sich die Reihe in Bewegung.
Die Schlacht war vorbei, lange bevor die erste Lanze ihr Ziel traf. Der gesamte rechte Flügel des Feindes hatte damit begonnen, sich in den Wald zurückzuziehen, sobald die Ritter über die Brücke gesetzt hatten – und jetzt, da ihr Angriff erfolgte, gaben auch die Lindwürmer, die Trolle und die Handvoll Dämonen auf. Einige drehten sich einfach um und rannten auf die Wälder zu. Sie besaßen nicht das schlechte Urteilsvermögen der Menschen. Wie jedes Tier in der Wildnis, das sich einem größeren Jäger gegenübersah, flohen sie einfach. Die Lindwürmer stiegen in die Luft, die verbliebenen Trolle rannten mit steinfüßiger Anmut, und die Dämonen preschten mit der Schnelligkeit eines Rennpferdes davon – unerreichbar.
Nur die Kobolde und Irks blieben und kämpften.
Und im Mittelpunkt, gezwungen von Thorns Willen, versuchten ein Dutzend mächtiger Kreaturen und eine Horde von Kobolden den König und die dunkle Sonne zu töten.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Dem Hauptmann war es nicht mehr möglich, sein Schwert zu heben und zuzuschlagen. Er hielt die Waffe in beiden Händen – mit dem linken Panzerhandschuh drückte er die Klinge nach unten und benutzte sie wie einen Kurzspeer, den er in Gesichter und gepanzerte Brustkörbe trieb.
Augenblicke des Schreckens flossen zusammen – eine sichelförmige Kralle drang durch den Schlitz seines Visiers, aber entweder aus Gründen des Glückes oder durch Geschick wurde die rasiermesserscharfe Kralle zu seinen Haaren abgelenkt, und er überlebte.
Drei Irk-Krieger zerrten ihn mit ihrem schieren Gewicht zu Boden; ihre dünnen, aber starken Glieder hämmerten in rasender Wut und Mordlust gegen den Stahl seiner Rüstung. Langsam wie Honig, der in Schnee eindrang – so zumindest erschien es ihm –, bohrte sich seine rechte Hand an der scheußlichen Kraft ihrer Glieder vorbei bis zu dem Dolch an seiner Hüfte, und dann konnte er sich auf das eine Knie stützen. Jetzt waren sie verschwunden, sein Dolch aber tropfte vor Blut.
Er spürte das beruhigende Schaben einer stählernen Rüstung an seinem Rücken. Zwar hatte er keine Ahnung, wer das war, aber er war dankbar dafür, dass es sich nicht um einen Körperpanzer handelte.
Und dann war der Dämon da.
Dieser Herr der Wildnis war größer als ein Kriegspferd. Der Hauptmann hatte ihre Abwesenheit vom Schlachtfeld nicht bewusst wahrgenommen, doch jetzt erkannte er, dass er sie vorhin tatsächlich nirgendwo gesehen hatte.
Der Kamm auf seinem Kopf war von einem tiefen Blau – völlig anders als bei demjenigen, dem er in den Wäldern im Westen gegenübergestanden hatte.
Das Wesen betrachtete ihn eindringlich, griff ihn aber nicht an.
Er beobachtete es ebenfalls und wünschte, er hätte seinen Speer – der im Augenblick gegen seinen Rüstungsständer in der Festung lehnte – und ein Pferd sowie eine Wurfmaschine und zwanzig ausgeruhte Freunde an seiner Seite.
Das Ungeheuer verfügte über eine Streitaxt von der Größe einer Wagenachse. Der Kopf bestand aus Feuerstein. Und er war blutverkrustet.
Das Wesen drehte den Kopf.
Wenn er noch frisch und kräftig gewesen wäre, hätte er es nun, da es abgelenkt war, angesprungen. Stattdessen holte er nur tief Luft.
Wieder sah es ihn an.
»Du bist die dunkle Sonne«, sagte es schließlich. »Ich kann dich überwältigen, aber wenn du mich angreifst, werde ich hier sterben. Also …« Es salutierte mit der großen Streitaxt vor ihm. »Mögest du lange leben, Feind meines Feindes.«
Es drehte sich um und rannte davon.
Der Hauptmann sah ihm nach und beobachtete, wie es die Kobolde aus dem Weg stieß. Er hatte keine Ahnung, wer oder was es sein mochte. Oder warum es ihn nicht getötet hatte.
Er zitterte.
Und kämpfte gegen weitere Kobolde. Er schnitt eine Kreatur mit Tentakeln von dem Prior herunter, der ihm dafür kurz salutierte und sich wieder an die Arbeit machte. Später sah er den König zu Boden gehen, und es gelang ihm, schützend je einen Fuß neben den Kopf des Königs zu stellen. Und dann strömten alle Ungeheuer der Wildnis auf ihn zu.
Einige Zeit verging, und er stand zwischen Pampe und Tom Schlimm. Der Körper des Königs von Alba lag noch immer zwischen seinen Füßen. Der letzte Ansturm der Ungeheuer war so heftig gewesen, als wollten sie die ganze Welt zerstören – ein endloser Regen von Schlägen, denen nur die besten Rüstungen standhalten konnten, denn die schiere Erschöpfung hatte den Muskeln die Fähigkeit geraubt, den Angriffen etwas entgegenzusetzen.
Tom tötete noch immer.
Auch Pampe tötete noch immer.
Michael stand noch …
… und so hielt auch der Hauptmann stand, denn er musste ja.
Sie drangen auf ihn ein, und er überlebte es.
Dann endlich kam der Augenblick, da die Schläge aufhörten. Da es nichts mehr gab, wogegen er ankämpfen musste, da kein neuer Feind mehr da war.
Bevor er darüber nachdenken konnte, schob der Hauptmann das Visier hoch und sog die Luft ein. Und dann bückte er sich und untersuchte den König.
Der Mann lebte.
Vor einer Stunde hatte der Hauptmann noch eine lederne Flasche gehabt. Danach suchte er sich mit der Langsamkeit und Ungeschicklichkeit ab, die den völlig Erschöpften so eigen war.
Sie war nicht zu finden.
Er spürte einen Panzer im Rücken, drehte sich um und stand vor dem Hauptmann der königlichen Garde – Ser Richard Fitzroy. Der Mann quälte sich ein Lächeln ab.
»Ich werde eine Kirche erbauen«, sang Michael. »Ich werde der Jungfrau Maria tausend Kerzen anzünden«, fuhr er fort.
»Reib dir diesen Mist von der Klinge«, sagte Tom. Er holte einen Leinenfetzen aus seiner Tasche und ließ den Worten Taten folgen.
Pampe grinste nicht einmal. Sie zog ein Taschentuch unter ihrem Brustpanzer hervor und wischte sich damit durch das Gesicht. Dann erst nahm sie wahr, was der Hauptmann gerade tat, und reichte ihm eine Holzflasche mit Wasser, die sie an einem Riemen über der Schulter getragen hatte.
Er kniete sich hin und gab dem König von Albia das Wasser.
Dieser lächelte.
Der Ritter, der in der Zwischenzeit zu ihm geritten war, spendete ein wenig Schatten. Seinem gewaltigen Kriegspferd fiel es schwer, in dem nachgebenden Haufen toter Kobolde einen sicheren Stand zu finden. Sein Reiter riss heftig an den Zügeln und fluchte auf Gallysch. Er sah sich um, als erwartete er etwas.
Der König gab ein Grunzen von sich, da beugte sich der Hauptmann noch tiefer über ihn. Dabei brannte seine Schulter, und Helm und Nackenschutz fühlten sich wie Bußgewichte an.
Eine Hornkralle steckte zwischen den Beinpanzern des Königs, hatte sich tief in den Oberschenkel gegraben. Sein Blut durchtränkte den Boden.
»Ich habe Euch gerettet«, sagte der Ritter, der sie auf seinem Pferd überragte. »Ihr könnt Euch entspannen – Ihr seid in Sicherheit.« Tatsächlich war eine Welle von Rittern soeben dabei, die letzten Kreaturen zu erledigen, die entweder zu dumm oder von Thorns Willen zu stark gefesselt waren, um die Flucht zu ergreifen. »Heute haben wir einen mächtigen Sieg errungen. Wo ist der König, bitte?«
Zum ersten Mal seit vielen Stunden war der Hauptmann in der Lage, sich gründlich umzusehen. Es fühlte sich wie Stunden an, aber später stellte es sich heraus, dass es nur wenige Minuten gewesen waren.
Seine Truppe …
Seine Soldaten waren gefallen. Sie lagen in einem Kreis am Boden, ihre hellen Stahlrüstungen, beschmiert mit Blut, leuchteten im Grün, Grau, Weiß und Braun der Feinde, die sie umgaben.
Aber ihre roten Wappenröcke glichen stark denen, die von den Rittern des Königs getragen wurden.
Die Ritter des königlichen Haushalts lagen zwischen ihnen, und auch einige Ritter des heiligen Thomas in ihrem Schwarz. Viele von ihnen befanden sich jedoch noch auf den Beinen – mehr als ein Dutzend.
»Der König ist hier«, sagte Fitzroy.
»Tot?«, fragte der ausländische Ritter.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. Er mochte diesen Fremden nicht. Die Gallyer waren ausgezeichnete Ritter, aber äußerst schwierige Leute.
Seine Gedanken schweiften ab.
Gib ihm den König nicht, sagte Harmodius.
Der Hauptmann versteifte sich vor Schreck. Wie hast du das gemacht? Prudentia hat außerhalb meines Palastes der Erinnerung nie zu mir gesprochen.
Sehe ich etwa wie Prudentia aus?, murmelte Harmodius. Überantworte den König nicht diesem Mann. Bring ihn höchstpersönlich zur Festung. Bring ihn zu Amicia, und zwar mit deinen eigenen Händen.
»Gebt ihn mir«, sagte der ausländische Ritter. »Ich werde dafür sorgen, dass er einen guten Schutz erhält.«
»Den hat er hier bereits«, sagte Ser Richard.
Tom Schlimm beugte sich vor. »Hau ab, Junge.«
Der Hauptmann legte Tom die Hand auf die Schulter.
»Ihr müsst Manieren lernen«, sagte der Ritter vom Pferd aus. »Wenn mein Angriff nicht gewesen wäre, dann wäret Ihr alle jetzt tot.«
Tom lachte. »Du hast bloß meine Opferzahl gesenkt, Wicht.«
Sie sahen sich böse an.
Der Prior stapfte zu ihnen hinüber. »Ser Jean? Captal?«
De Vrailly setzte sein Pferd einige Schritte zurück. »Messire.«
»Eine Bahre für den König«, sagte der Hauptmann.
Einige Ritter kamen auf ihren Pferden heran. Er sah das Banner des Grafen von Towbray, und da war auch der Graf der Grenzmarken. Sie beeilten sich, nun da der König gefunden war. Towbray fand die Knappen des Königs und die königliche Standarte und erhob sie. Sie war blutbeschmiert.
Leises Jubeln setzte ein.
Eine lange Reihe von Infanteristen schritt über das Feld der Toten. Vorsichtig mussten sie sich ihren Weg bahnen und nahmen sich dazu Zeit. Als sie herbeigekommen waren, hatte der Hauptmann dem König mit Michaels Hilfe die Brust- und Rückenpanzerung abgenommen und das Kettenhemd gehoben. Ein Dutzend Ringe waren durchtrennt worden, und der Schlag gegen den Schenkel war so heftig gewesen, dass er den Schutzstahl nach innen gebogen hatte, sodass dieser in das Bein eingedrungen war. Der König hatte viel Blut verloren.
Kann ich etwas tun?
Du könntest den Blutfluss stillen. Ich habe deine Macht verschwendet, um dich am Leben zu erhalten. Amicia?
Ich bin hier.
Der Hauptmann lächelte, kniete nieder und legte die Hand auf den entblößten Oberschenkel des Königs, während Michael ihm die Hose und die Unterhose abstreifte. Ohne bewusste Anstrengung entfesselte er Amicias Macht.
Den eigentlichen Zauber hingegen bewirkte Harmodius.
Dem Hauptmann wurde ein wenig übel; er fühlte sich, als wäre er drei Personen gleichzeitig.
Dir ist übel? In seinem Kopf hörte er das Lachen des toten Magus.
Und dann waren die Soldaten der königlichen Garde da – sie waren überall –, und der König wurde hochgehoben und auf einen Umhang gelegt, der von zwei Speeren gespannt wurde … Die ganze Zeit hindurch hielt er die Hand des Hauptmanns fest. So bewegten sie sich gemeinsam, Hand in Hand, über das Schlachtfeld. Es war der längste Weg, den der Hauptmann je gegangen war. Die Sonne strahlte wie ein neuer Feind herab, Insekten überfielen sie wie eine Plage, und der Boden war unsicher.
Doch schließlich hatten sie die Leichen hinter sich gelassen und stiegen die lange Straße zur Festung hinauf.
Die Soldaten, an denen sie vorbeikamen, hielten inne und verneigten sich oder knieten nieder. Die Männer auf dem Feld unter ihnen sangen das Te Deum, und die Musik erhob sich wie das Gewebe eines mächtigen Phantasmas. Der Hauptmann spürte die heiße Hand des Königs in der seinen und versuchte nicht allzu viel darüber nachzudenken.
Die Königin lag in der Kapelle – auf dem Altar. Sie hob den Kopf und lächelte.
Der König stieß einen Seufzer aus, als wenn er bis jetzt den Atem angehalten hätte.
Der Hauptmann sah Amicia. Sie stand im Licht des Fensters hinter dem Altar. Sie erschien kaum mehr menschlich, eher wie eine Göttin aus Licht und Farbe. Dabei glitzerte sie vor Macht.
Christus! Sieh sie dir nur an, Junge.
Der Hauptmann beachtete die Worte des Toten nicht weiter.
Er konnte den Blick nicht von Amicia abwenden.
Sie heilte jede verletzte Person, die zu ihr gebracht wurde. Die Macht drang so leicht in sie ein, als atme sie sie ein. Sie trank das ungenutzte Grün von Thorns Hammerschlag, und sie trank die Macht der Sonnenstrahlen, die durch das zerbrochene Kapellenfenster eindrangen – dabei nahm sie die Macht der Quelle in sich auf. Alle drei Ströme vereinigte sie in sich und gab sie in einer Regenbogenwolke wieder von sich. Soldat nach Soldat näherte sich ihr, kniete nieder und stand geheilt wieder auf. Die Männer taumelten davon und begaben sich für den Schlaf in die Arme ihrer Kameraden.
Amicia hielt die Hände über den König, als wäre er nichts als ein weiterer Soldat oder eine der Frauen, die bei der verzweifelten Verteidigung des Hofes verwundet worden war, oder auch ein Kind, das durch den Zusammenbruch des Westturmes verletzt worden war – und er war geheilt.
Dann drehte sie sich um und sah den Hauptmann an.
Ihm stockte der Atem.
Er verspürte den närrischen Drang, sie zu küssen.
Sie berührte ihn. »Du musst deine Macht öffnen, sonst kann ich dich nicht heilen«, sagte sie und schenkte ihm ein Lächeln. »Vor ein paar Tagen bist du noch nicht so mächtig gewesen.«
Er seufzte. »Du auch nicht«, sagte er.
Es war derselbe Raum. Er hatte beinahe Angst davor, ihn zu betreten, aber er machte nun einen besseren Eindruck. Kein Moos befand sich mehr auf dem Boden, und Prudentias Statue war wiederhergestellt und in eine Nische gebracht worden, die zuvor nicht existiert hatte.
Der Magus hingegen stand auf der Säule in der Mitte des Raumes.
Der Hauptmann ging an ihm vorbei zur Tür.
»Bedenke, was du tust, Junge«, sagte der tote Magus. »Sie ist eine Macht – weder stärker noch schwächer als du.«
Der Hauptmann beachtete ihn gar nicht und öffnete die eisenbeschlagene Tür.
Und da war sie.
Und er war geheilt.
Sie betrachtete das Postament und riss vor Entsetzen die Augen auf. »Mein Gott«, sagte sie. »Was hast du getan?«
Und dann war sie verschwunden.
Nördlich von Lissen Carak · Peter
Sie hielten auf einer Waldlichtung an. Der Boden war beständig nach Norden angestiegen, und sie bewegten sich inzwischen fast genau in nördlicher Richtung. Das war alles, was Nita Qwan wusste – außer dass er noch nie in seinem Leben so müde gewesen war wie jetzt.
Sie legten sich in einem Knäuel hin und schliefen ein.
Am Morgen stand Ota Qwan als Erster auf, und sie liefen wieder los. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie sich über einen Bergrücken kämpften. Einige junge Krieger wurden zurückgeschickt, um die Matronen und Mütter von Neugeborenen zu holen, die nicht so schnell wie die Übrigen waren.
Als auch die letzte Frau den Bergkamm überquert hatte, wurden vorsichtig Feuer entzündet, Essen wurde gekocht und verspeist.
Als Nita Qwan endlich wieder das Gefühl hatte, das Leben könnte doch lebenswert sein, trat Ota Qwan mit einem Speer in den Mittelpunkt des Kreises aus Feuern. Kleinhand, die Älteste der Frauen, stellte sich ihm entgegen.
Er übergab ihr den Speer. »Unser Krieg ist vorbei«, sagte er. »Ich gebe dir den Kriegsspeer zurück.«
Kleinhand ergriff ihn. »Die Matronen werden ihn aufbewahren, bis ein neuer Feind kommt. Unser Dank gehört dir, Ota Qwan. Du hast uns überrascht und Gutes geleistet.«
Sonst sagte niemand etwas – es gab weder Applaus noch Kritik.
Eine Stunde später liefen sie bereits weiter in nördliche Richtung.