8
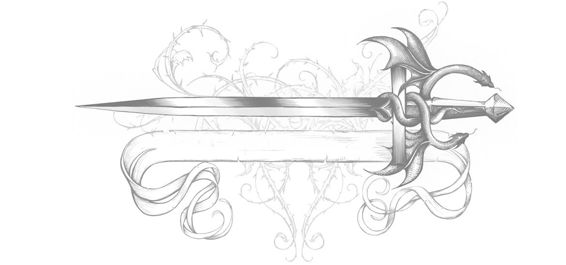
Nördlich von Albinkirk · Peter
Der erste Gedanke von Peter dem Koch war: Ich bin noch immer ein freier Mensch.
Er war zwei Tage auf der Straße nach Osten marschiert und keinem anderen Menschen begegnet. Gestern Nachmittag hatte er Rauch gerochen und eine Festung im Süden gesehen, von der er annahm, dass sie zur Stadt Albinkirk gehörte, auch wenn seine Ortskenntnisse des westlichen Albia fast nicht vorhanden waren und er sich nur an die Bemerkungen der Söldner und der Männer halten konnte, die ihn gefangen genommen hatten.
Die beiden Kaufleute mussten also nach Osten unterwegs gewesen sein. Und er war ungefähr wieder dort, wo er aufgebrochen war.
Oder er bewegte sich im Kreis.
Der Anblick von Albinkirk, das noch etwa fünf Meilen entfernt sein mochte, bedrückte ihn. Schließlich war es der Ort, an dem er hatte verkauft werden sollen. Also nahm er den ersten vernünftigen Pfad nach Norden, in die Berge hinein, und folgte ihm, auch wenn er dafür seinen ganzen Mut zusammennehmen musste.
Aber er würde nicht mehr zurückgehen.
Er hatte sich inzwischen seines Jochs entledigt. Es war einfacher gewesen, als er vermutet hatte. Mit ein wenig Zeit und unter Zuhilfenahme einiger großer Felsbrocken hatte er es einfach zu kleinen Stücken zerschmettert.
Wie alle Sklaven und viele andere Untertanen hatte er gehört, dass es Menschen gab, die in Frieden mit der Wildnis lebten. Selbst zu Hause gab es jene, die …
Am besten dachte er nicht über diese Menschen nach. Sie verkauften ihre Seele.
Er wollte nicht daran denken. Aber er ging weiter nach Norden, hatte sich die Axt über die Schulter gelegt und marschierte, bis die Dunkelheit einsetzte. Er kam an einem Dutzend verlassener Gehöfte vorbei und stahl so viele Nahrungsmittel, wie er tragen konnte. Er fand auch einen guten Bogen, leider ohne Köcher und Pfeile. Es war seltsam, die leeren Häuser entlang des Weges zu betreten. In einigen hatten die Eigentümer alles sorgfältig weggelegt. Die Truhen waren voller Laken, die Regale voller grün glasierter Teller aus den Bergen im Osten sowie moreanischem Geschirr und ein wenig Zinn. Er machte sich nicht die Mühe, etwas davon mitzunehmen – mit Ausnahme eines guten Hornbechers, den er auf einem Kaminsims fand.
In anderen Häusern stand noch das Essen auf dem Tisch; das Fleisch verweste, das Brot war altbacken. Als er das erste Mal eine Mahlzeit auf einem Tisch vorfand, aß er sie, doch später musste er immer wieder aufstoßen, bis er sich erbrach.
Im zwölften Haus hörte er auf, vorsichtig zu sein.
Er betrat die Scheune, und dort fand er eine Sau. Sie war zurückgelassen worden, weil sie entweder zu schwer oder trächtig war, oder der Bauer war zu weichherzig – oder auch nur zu vernünftig – gewesen, um sie in ihrem Zustand nach Albinkirk zu treiben.
Peter fragte sich gerade, ob er es übers Herz bringen würde, sie zu schlachten, als er hörte, wie die Tür der Scheune quietschte.
Er sah, wie die Kreatur der Wildnis eintrat. Sie war nackt, leuchtend rot, die Parodie von Haaren auf ihrem Kopf wirkte wie eine schockierende Flammenzunge. Sie hatte einen Pfeil in ihren Bogen eingelegt; die Eisenspitze blinkte bösartig und war auf Peters Brust gerichtet.
Peter nickte. Seine Kehle hatte sich zusammengeschnürt. Er kämpfte gegen den Kloß in seinem Hals und gegen das Zittern seiner Arme an und sagte mühsam: »Hallo.«
Das rote Wesen verzog die Lippen, als hätte es etwas Schlechtes gerochen, und Peters Blickwinkel veränderte sich. Es war ein Mensch – ein Mann in roter Bemalung, und seine Haare waren voll von rötlichem Schlamm.
Peter drehte sich ein wenig um, damit er den Mann besser sehen konnte, und hielt die leeren Hände hoch. »Ich werde kein Sklave mehr sein«, sagte er.
Der rote Mann hob den Kopf und sah an seiner Nase entlang Peter an, der erzitterte. Der Pfeil, der in dem gespannten Bogen steckte, blieb ganz still.
»Ti natack onah!«, sagte der rote Mann in einem Ton der Autorität. Es war eine menschliche Stimme.
»Ich verstehe nicht«, erwiderte Peter. Seine Stimme zitterte. Der rote Mann war offensichtlich so etwas wie ein Anführer, was bedeuten konnte, dass noch andere in der Gegend waren. Was immer sie sein mochten, sie waren jedenfalls nicht das, was Peter erwartet hatte. Sie machten ihm Hoffnung, und gleichzeitig zerschmetterten sie diese wieder.
»Ti natack onah!«, wiederholte der Mann mit wachsender Eindringlichkeit. »TI NATACK ONAH.«
Peter hob die Hände. »Ich ergebe mich!«, sagte er.
Der rote Mann schoss seinen Pfeil ab.
Er flog an Peter vorbei, verfehlte ihn nur um Armesbreite, und Peter spürte, wie sich seine Gedärme entleerten. Er ging in die Hocke, die Knie versagten ihm den Dienst. Er schlang die Arme um sich und verfluchte seine Schwäche. So schnell werde ich also wieder zum Sklaven.
Hinter ihm ertönte ein Schrei.
Der rote Mann hatte seinen Pfeil in den Kopf der Sau geschossen. Nun zuckte sie noch einige Male, dann war sie tot.
Plötzlich stand die Scheune voller bemalter Männer – rot, rot und schwarz, schwarz mit weißen Handabdrücken, schwarz mit einem aufgemalten Schädel. Sie wirkten erschreckend, und sie bewegten sich mit einer fließenden, muskulösen Anmut, die schlimmer war, als er es sich bei den Kreaturen der Wildnis vorstellte. Während er zusah, schlachteten sie die Sau und ihre ungeborenen Ferkel. Dann wurde er grob, aber ohne Boshaftigkeit aus der Scheune geschleift, und der rote Mann entzündete eine Fackel mit sehr gewöhnlich wirkenden Hilfsmitteln und setzte die Schindeln der Scheune in Brand.
Trotz des wochenlangen Regens loderte sie sofort lichterloh.
Weitere Krieger kamen herbei, dann noch mehr – innerhalb einer Stunde waren es etwa fünfzig. Sie gingen durch die Hütte, und als das Dach der Scheune in das brennende Inferno stürzte, sammelten sie halb verbrannte Balken und machten ein kleineres Feuer daraus, dann ein zweites und noch eines, bis sie eine ganze Reihe von Feuern hatten, die an der Wand der kleinen Hütte entlangliefen. Nun steckten sie die ungeborenen Ferkel an grüne Erlenstecken und einige Eisenstäbe, die sie in der Hütte gefunden hatten, und brieten sie. Andere Männer fanden den unterirdischen Vorratsraum und warfen getrocknetes Getreide in die Flammen – sowie unzählige Äpfel.
Inzwischen waren etwa hundert bemalte Männer und auch Frauen zusammengekommen, und die Dunkelheit setzte ein. Die meisten hatten Bögen und Pfeile, einige auch ein langes Messer oder ein Schwert, in einigen Fällen sogar zwei Schwerter. Ein paar trugen die Haare lang herabfallend und in leuchtenden Farben, doch die meisten hatten nur einen einzigen Haarstreifen auf dem Kopf und einen weiteren vor ihren Genitalien. Sie hatten eine seltsame Wirkung auf Peter, und erst als sich sein Hirn allmählich an ihren Anblick gewöhnt hatte, bemerkte er, dass sie kein Gramm Fett am Körper hatten.
Kein Fett.
Wie Sklaven.
Niemand beachtete ihn. Er stellte keine Bedrohung dar, aber er war auch zu nichts zu gebrauchen. Er hatte ein Dutzend Gelegenheiten wegzurennen, und er begab sich tatsächlich bis zum Rande der Lichtung, auf der das Gehöft lag. Um Platz für die Feldfrüchte zu bekommen, hatte der Bauer dort Bäume gefällt, die älter als Peters Großvater gewesen sein mussten. Hier blieb Peter stehen, legte sich auf den niedrig hängenden Zweig eines Apfelbaums und sah dem Treiben zu.
Bevor die rötliche Sonne ganz aus dem Himmel verschwunden war, hatte er seine Hose ausgezogen – billig, schmutzig, zerrissen – und ging im Hemd zu den anderen zurück. Einige von ihnen trugen Hemden aus Hirschhaut oder Leinen, und er hoffte, dass er ihnen etwas verdeutlichen konnte.
Über seiner Schulter hingen noch seine Tasche und seine Axt.
Und der Bogen.
Er stellte sich in die Nähe des Scheunenfeuers, spürte die Wärme, und sein Magen machte Purzelbäume, als er das bratende Schweinefleisch roch.
Einer der bemalten Männer hatte nun auch die Hütte in Brand gesteckt. Lachen ertönte. Ein anderer hatte sich verbrannt, weil er Fleischstücke aus dem Leib der Sau hatte stehlen wollen, während die Krieger um ihn herum wie Dämonen lachten.
Falls es ein Signal gegeben hatte, hatte Peter es nicht gehört. Plötzlich fielen sie alle über die Ferkel her, als wäre eine Tischglocke geläutet worden. Sie aßen gierig. Es war, als sehe er Tieren beim Fressen zu. Wenige Laute waren zu hören, nur das Kauen und das Abreißen des Fleisches von Knochen, unterbrochen vom Ausspucken von Knorpel und verbrannten Stücken sowie dem anhaltenden Gelächter.
Wenn dieses nicht gewesen wäre, hätte es wie ein Albtraum gewirkt. Aber das Lachen war warm und menschlich, und Peter stellte fest, dass er näher und näher an das Feuer herangetreten war, angezogen vom Duft des Bratens und dem Klang des Lachens.
Der rote Mann, der vorhin auf ihn gezielt hatte, befand sich nun in seiner Nähe. Plötzlich trafen sich ihre Blicke, und der rote Mann schenkte ihm ein Grinsen und deutete mit einem Rippenspeer auf ihn.
»Dodeck?«, fragte er. »Gaerleon?«
Die anderen Krieger in seiner Nähe drehten sich um und sahen Peter an.
Ein Mann – größer als die meisten, mit öligem Schwarz bemalt und mit ebenso öligem Haar sowie einem einzelnen roten Streifen quer über dem Gesicht – wandte sich ihm ebenfalls zu und grinste. »Willst du essen?«, fragte er. »Skadai bietet es dir an.«
Peter machte einen weiteren Schritt voran. Er war sich des Umstandes deutlich bewusst, dass seine Beine, sein Hals und sein Gesicht nackt und ganz anders als die dieser Menschen waren.
Der rote Mann – Skadai – winkte ihm zu. »Iss«, sagte er.
Ein anderer Krieger lachte und sagte etwas in der fremden Sprache. Skadai lachte ebenfalls, ebenso wie der schwarze Krieger.
»War das deine Sau?«, fragte der schwarze Krieger.
Peter schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Ich bin bloß zufällig hier vorbeigekommen.«
Der schwarze Krieger schien dies seinen Freunden zu übersetzen und gab ihm dann eine Portion Schweinefleisch.
Er aß es. Er aß zu schnell, verbrannte sich Hände und Zunge an dem Fleisch und Fett.
Der schwarze Krieger reichte ihm eine Kalebasse, die sich als mit Wein gefüllt herausstellte. Peter trank, verschluckte sich und gab sie zurück. Plötzlich schmerzten die Verbrennungen an seinen Händen.
Alle beobachteten ihn.
»Ich war ein Sklave«, sagte er plötzlich. Als könnten sie das verstehen! »Ich werde nie mehr ein Sklave sein. Lieber sterbe ich. Ich werde auch für euch kein Sklave sein.« Er holte tief Luft. »Aber wenn ihr das von mir nicht verlangt, würde ich mich euch gern anschließen.«
Der schwarze Krieger nickte. »Ich bin auch ein Sklave gewesen«, sagte er und lächelte schief. »Na ja, so was Ähnliches.«
Am Morgen standen sie im ersten Licht der Dämmerung auf und bewegten sich die schmale Straße hinunter, auf der Peter am vergangenen Tag heraufgekommen war. Sie gingen in vollkommenem Schweigen und verständigten sich nur durch Pfiffe und Vogelrufe. Peter schloss sich dem schwarzen Krieger an, der sich Ota Qwan nannte. Ota Qwan wiederum folgte Skadai, der nach Peters Auffassung der Hauptmann war. Aber bisher hatte er keine Befehle gegeben.
Niemand sprach mit Peter, doch es wurde ohnehin kaum gesprochen, und daher konzentrierte er sich ganz darauf, sich so zu bewegen, wie sie es taten. Er verhielt sich sowieso nie laut im Wald, und niemand ermahnte ihn zu weiterer Vorsicht. Er folgte Ota Qwan so gut wie möglich durch einen Erlensumpf, einen sanften Hügel hinauf, der mit Birken bestanden war, dann nach Westen einen Wildpfad entlang durch lichte Buchenwälder und schließlich an einem See vorbei, der rechts neben einer langen Anhöhe lag, während der große Fluss weiter links von ihnen lag.
Manchmal folgten sie Pfaden durch die Wildnis, manchmal auch nur dem Verlauf des Geländes, und ganz allmählich ergab ihr Weg für Peter einen Sinn. Sie folgten einem relativ geraden Kurs nach Westen und vermieden dabei den Fluss. Er hatte keine Ahnung, wie zahlreich sie waren, und konnte sie nicht einmal zählen, als sie zur Nacht anhielten, denn sie legten sich einfach in mehreren Haufen aus Körpern und Gliedern auf den Boden. Niemand hatte ein Laken oder eine Decke, nur wenige trugen Hemden, und die Nacht war kalt. Peter hasste es, vorn und hinten von anderen berührt zu werden, aber seine Abscheu war im Schlaf rasch vergessen.
Im regnerischen Grau der Zeit kurz vor Tagesanbruch bot er Ota Qwan ein wenig altbackenes Brot an, der es dankbar ergriff, einen kleinen Bissen nahm und die Kruste weiterreichte. Die Männer beäugten das Brot gierig, aber niemand beschwerte sich, als es vertilgt war, ohne dass jeder etwas davon erhalten hätte. Auch Peter hatte keinen Bissen abbekommen. Eigentlich hatte er erwartet, dass man es ihm zurückgab. Er zuckte nur die Achseln.
In der zweiten Nacht, die er zusammen mit den bemalten Menschen verbrachte, konnte er überhaupt nicht mehr schlafen. Es regnete leicht. Das Gefühl nasser, bemalter Haut an seiner eigenen verursachte ihm eine Gänsehaut. Darum sonderte er sich von den anderen ab. Doch schließlich kroch er angewidert zu ihnen zurück, weil er fast erfroren wäre.
Der nächste Tag war eine Qual. Die ganze Gruppe bewegte sich nun schneller. Sie kamen an eine Wiese, die von aderähnlichen Kanälen durchzogen wurde. Diese Kanäle waren so breit, wie der ausgestreckte Arm eines Mannes lang war, und die bemalten Menschen sprangen mit Leichtigkeit hinüber, während Peter mehrmals ins Wasser fiel. Stets aber wurde ihm eine helfende Hand gereicht, auch wenn es unter dröhnendem Lachen geschah.
Die Bemalten trugen geschmeidige, dünne Lederschuhe, die oft von derselben Farbe wie ihre Körperbemalung waren, sodass er sie zuerst gar nicht bemerkt hatte. Seine eigenen billigen Sklavenschuhe zerfielen allmählich, und die große Wiese war mit spitzen, harten Auswüchsen übersät, die geradewegs aus dem Boden hervorsprossen. Er verletzte sich mehrfach die Füße, und wieder wurde ihm unter Gelächter geholfen.
Nun humpelte er stark, war erschöpft und sich seiner Umgebung überhaupt nicht mehr bewusst. Daher wäre er fast gegen Ota Qwan geprallt, als dieser plötzlich stehen blieb.
Kaum eine Pferdelänge von ihm entfernt stand eine Gestalt wie aus einem Albtraum – ein wunderschönes Ungeheuer, so groß und schwer wie ein Ackergaul, mit einem gepanzerten Kopf wie ein behelmter Engel, mit einem Adlerschnabel statt eines Mundes und matten Augen von der Farbe frisch geschmiedeten Eisens. Es hatte Schwingen, die zwar klein, aber herzzerreißend schön waren.
Peter konnte es nicht ansehen. Zum dritten Mal in genauso vielen Tagen war er so erschrocken, dass er nicht mehr in der Lage war, klar zu denken.
Ota Qwan legte ihm eine beruhigende Hand auf die Schulter.
Skadai hob die Hand. »Lambo!«, sagte er.
Das Ungeheuer grunzte und hob eine krallenbewehrte Klaue.
Nun bemerkte Peter, dass seine linke Klaue mit Leinen umwickelt war. Es wirkte wie die Bandage bei einer verletzten Menschenhand.
Erneut grunzte das Ungeheuer – falls es etwas sagte, waren seine Töne so tief, dass Peter sie nicht verstehen konnte. Und schon war es im Unterholz verschwunden. Skadai drehte sich um und hob seinen Bogen. »Gots onah!«, brüllte er.
Überall um sie herum ertönte zur Antwort ein Brüllen, und Peter stellte erstaunt fest, dass sich in seiner unmittelbaren Nähe Dutzende, vielleicht sogar an die hundert bemalte Krieger befanden.
Er packte Ota Qwan am Arm. »Was … was war das?«, fragte er.
Ota Qwan schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Das war das, was die Menschen einen Adversarius nennen«, sagte er. »Ein Wächter der Wildnis.« Er sah Peter einen Augenblick lang an. »Das ist ein Dämon, kleiner Mann. Willst du noch immer einer von uns sein?«
Peter holte Luft, was nicht ganz einfach war. Seine Kehle war wieder wie zugeschnürt.
Ota Qwan legte ihm den Arm um die Schulter. »Die kommende Nacht werden wir in einem richtigen Lager verbringen. Vielleicht können wir uns dann unterhalten. Bestimmt hast du Fragen. Ein bisschen was weiß ich.« Er zuckte die Achseln. »Ich lebe gern bei den Sossag, bin einer von ihnen. Ich würde nie zurückgehen, nicht mal, wenn ich ein Graf werden könnte. Aber es ist nicht für jedermann das Richtige. Die Sossag sind freie Menschen. Wenn du nicht mehr bei ihnen sein willst, kannst du auch einfach weggehen. Die Wildnis wird dich vielleicht töten, aber die Sossag werden es nicht tun.«
»Freie Menschen?«, fragte Peter. So etwas hatte er schon einmal gehört.
»Du musst noch eine ganze Menge lernen.« Ota Qwan klopfte ihm auf die Schulter. »Jetzt gehen wir erst mal weiter. Reden können wir später.«
Dormling · Hector Lachlan
Hector Lachlan betrat den Innenhof der großen Herberge zu Dormling wie ein Prinz, der in sein Reich kommt, und die Menschen traten hinaus; manche applaudierten sogar. Der Wirt erschien persönlich und schüttelte ihm die Hand.
»Wie viele Köpfe?«, fragte er.
Lachlan grinste. »Zweitausendsechshundertelf«, sagte er. »Aber, Meister, das schließt die Ziegen mit ein, und Ziegen mag ich eigentlich nicht besonders.«
Der Wirt zu Dormling – ein vornehmer und mächtiger Titel, auch wenn er zu einem kahlköpfigen dicken Mann in einer Schürze gehörte – klopfte Lachlan auf den Rücken. »Wir erwarten Euch schon seit zehn Tagen. Euer Vetter ist bereits hier. Er sagt, es soll schlimm sein … im Süden.« Er fügte hinzu: »Wir hatten schon befürchtet, Ihr könntet verletzt oder gar tot sein.«
Lachlan nahm den Becher Wein entgegen, den ihm die Tochter des Vogts in die Hand drückte. »Ich trinke auf dich, Mädchen«, sagte er.
Sie errötete.
Hector wandte sich wieder an den Wirt. »Die Berge sind wie leergefegt«, sagte er, »was den Ärger im Süden erklärt. Wie weit im Süden? Ist es der König?«
Der Wirt schüttelte den Kopf.
»Euer Vetter hat mir berichtet, dass Albinkirk in Brand gesteckt wurde«, sagte er. »Aber kommt doch herein, setzt Euch, und bringt Eure Männer mit. Die Pferche sind bereit, sogar für zweitausendsechshundertelf Tiere. Und ich würde gern einige davon kaufen. Wenn ich Euch heute Abend eine Fleischschnitte servieren soll, Hector Lachlan, dann müsst Ihr mir zuerst die Kuh dafür verkaufen. So schlecht steht es um meine Vorräte.«
Die Bediensteten der Herberge zu Dormling schwirrten wie eine Rächerarmee auf die Viehtreiber herab. Sie trugen Tabletts mit Lederbechern darauf, die Starkbier enthielten, sowie Berge von Weißbrot und kräftigem Käse. Als auch der jüngste und staubigste Hirte seinen Willkommensbecher sowie Brot und Käse erhalten hatte, war Hector bereits vom Dreck der Straße befreit und saß in einem Raum, der der Halle eines Adligen in nichts nachstand. Er betrachtete die neuen Wandbehänge aus dem Osten und lächelte dem Rücken einer hiesigen Frau zu – einer erwachsenen Frau mit ihrem eigenen Kopf, wie er soeben herausgefunden hatte. Er rieb sich den Armmuskel dort, wo sie so heftig wie eine Krabbe hineingekniffen hatte, und lachte.
»Cawno hat versucht, Zoll von mir zu verlangen«, fuhr er fort.
Der Wirt und der Rest der Zuhörer schüttelten die Köpfe.
Der Viehtreiber zuckte die Achseln. »Also haben wir die Straße geöffnet. Ich bezweifle, dass genug von seinen Männern überlebt haben, um die Festung zu halten, falls jemand beschließen sollte, sie jetzt anzugreifen.« Viehtreiber waren nie daran interessiert, Land zu besitzen. Sie waren immer auf großer Fahrt.
Sein Vetter Ranald drängte sich durch die Menge.
»Wie schön, dich zu sehen«, sagte Hector und erdrückte ihn fast mit seiner Umarmung. Dann sank er wieder auf seinen Stuhl und nahm einen tiefen Schluck Bier. »Albinkirk steht in Flammen? Das sind schlechte Nachrichten. Was ist mit dem Jahrmarkt?«
Ranald schüttelte den Kopf. »Ich war schnell unterwegs und bin nicht langsamer geworden. Ich war schon auf der Ostseite, als ich die fünfte Brücke erreicht habe. So bin ich dort geblieben und quer durch das Land geritten.« Er zuckte die Schultern. »Ich habe nichts gesehen.«
Der Wirt zuckte ebenfalls die Achseln. »Wenn ich gewusst hätte, das Ihr heute hier eintrefft, hätte ich diese beiden verdammten Hausierer aufgehalten«, sagte er. »Sie haben behauptet, zu einer Handelskarawane zu gehören, die von Theva nach Westen unterwegs war. Sie haben all ihre Waren und Sklaven verloren.«
Hector nickte. »Das wäre möglich.« Es war die Jahreszeit der großen Karawanen.
»Es waren zwei Moreaner. Angeblich ein Hinterhalt. Die ganze Karawane wurde vernichtet. Meine Söhne sagen, sie haben vor zehn Tagen eine große Karawane aus Theva auf der Straße nach Süden gesehen, die nicht hier vorbeigekommen ist. Ich vertraue den Moreanern nicht, aber sie hatten eigentlich keinen Grund zu lügen.«
»Wer hat den Hinterhalt gelegt?«, wollte Hector wissen.
»Dessen waren sie sich nicht sicher«, antwortete der Wirt.
»Sie haben gesagt, es sei die Wildnis gewesen«, meinte ein kecker junger Bauer, der Stammgast in dieser Herberge war und einer der Töchter des Vogts einen Heiratsantrag gemacht hatte. »Das heißt, der Jüngere hat das behauptet.«
Der Wirt zuckte noch einmal die Schultern. »Das stimmt. Einige sagen, es war die Wildnis.«
Hector nickte langsam. »Auf der ganzen Reise hierher habe ich kein einziges Tier gesehen, das größer als ein Hund gewesen wäre«, sagte er und schüttelte dann in müdem Abscheu den Kopf. »Die Wildnis soll gegen Albinkirk marschiert sein? Und wo steckt dann der König? Sein Volk isst ebenfalls mein Vieh.«
Der Wirt seufzte. »Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe zwei meiner Söhne und ein Dutzend anderer Männer auf die schnellsten Pferde gesetzt, damit sie Euch Neuigkeiten bringen. Wir wollen sehen, was sie uns berichten werden. In den Wäldern sind Hinterwaller gesichtet worden. Sossags. Ich glaube, wären sie tatsächlich da gewesen, dann hätte niemand überlebt, um von ihnen zu berichten. Aber vielleicht bin ich auch nur ein allzu misstrauischer Bastard.«
Hector holte tief Luft. »Also herrscht Krieg.«
Der Wirt wandte den Blick ab. »Ich hoffe nicht.«
Hector nahm noch einen Schluck Bier. »Hoffnung in der einen Hand und Mist in der anderen – was davon riecht wohl am stärksten? Wann werdet Ihr wieder von Euren schnellen Reitern hören?«
»Morgen«, sagte der Wirt.
»Vorausgesetzt, die Hinterwaller haben sie nicht gefressen.« Hector trat sein Schwert zur Seite, um mehr Platz für seine Beine zu haben, und kippte mit dem Stuhl zurück, bis er gegen die Wand stieß. »Bei den fünf Wunden Christi, Wirt! Das wird ein Abenteuer, von dem man noch lange sprechen mag. Wir treiben die Herde mitten in eine Armee der Wildnis hinein. Nicht mal mein Vater hat so was getan.«
»Es wäre aber eine Verschwendung von Mut und Pfeilen, falls der Jahrmarkt nicht stattfinden sollte«, sagte der Wirt. »Lissen Carak besteht vielleicht nur noch aus niedergebrannten Katen und geborstenen Steinen, wenn Ihr dort eintrefft.«
Hector kippte seinen Stuhl wieder nach vorn, bis die vorderen Beine mit einem dumpfen Laut auf den Boden trafen. »In Euren Worten liegt eine gewisse Wahrheit«, sagte er. »Und es hat keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken, bevor ich nicht mehr Nachrichten bekommen habe.« Er sah das Dutzend Männer im Raum nacheinander an. »Aber ich habe einen echten Harfenspieler und ein Dutzend andere Spielleute in meinem Tross, und wenn Dormling nicht vom Pferd auf den Esel gekommen ist, wette ich einen goldenen Edling gegen eine Kupferkatze, dass wir heute Nacht Musik und Tanz haben wie die Elfen. Lasst uns nicht mehr vom Krieg sprechen. Wir wollen tanzen und Wein trinken!«
Die große Kellnerin in der Tür trat mit dem Fuß auf und nickte zustimmend.
Die jüngste Tochter des Vogts klatschte in die Hände. »Deshalb nennt man Euch also den Fürsten der Viehtreiber«, sagte sie bewundernd. »Auf Hector, den Fürsten der Grünen Berge!«
Hector Lachlan runzelte die Stirn. »Die Grünen Berge haben keinen anderen Fürsten als den Wyrm von Erch«, sagte er. »Der Drache duldet keinen Rivalen und kann alles hören, was die Menschen sagen, also sollten wir mich nicht als Herrn irgendeines Berges bezeichnen, nicht wahr, Wirt?«
Der Wirt nahm einen tiefen Schluck von seinem Bier, legte seiner Tochter den Arm um die Schulter und erklärte: »Liebes, du solltest nie wieder so etwas sagen. Der Wyrm ist kein Freund der Menschen – aber er ist auch nicht unser Feind, solange wir ihm aus dem Weg gehen und die Schafspferche dort errichten, wo er sie haben will. Ist das klar?«
Sie brach in Tränen aus und floh aus dem Zimmer, während alle Augen sie beobachteten. Dann war der dunkle Moment vorbei, und die Frau in der Tür klatschte in die Hände. »Der Wyrm ist mir egal«, sagte sie keck. »Ich will den Harfenspieler!«
Der Palast von Harndon · Desiderata
Desiderata lag auf dem Tagesbett in ihrem Gemach; sie trug nicht mehr als ein langes Hemd aus reinem Leinen und eine seidene Hose mit roten Lederbändern. Missbilligend stieß ihre Zofe Schnalzlaute über die mangelnde Kleidung ihrer Herrin aus und machte sich an die gewaltige Aufgabe, ihre Schuhe aufzuheben.
Desiderata hatte eine Schriftrolle, ein Kassenbuch und einen Bleistift mit Silberkappe auf den Knien und schrieb hastig etwas nieder. »Warum machen sie die Karrenräder nicht alle gleich groß?«, fragte sie.
Diota zog eine Grimasse. »Weil die Stellmacher ihre Maße nicht miteinander teilen, Herrin.«
Desiderata richtete sich auf. »Wirklich?«
Diota schnalzte noch einmal und suchte nach einem zweiten Hausschuh aus Damast. »Jeder Stellmacher hat seine eigenen Maße, die er für gewöhnlich von seinem Vater oder Großvater geerbt hat. Einige bauen ihre Karren nicht breiter als die schmalste Brücke. Ich bin im Hochland aufgewachsen, wo die Orchideenbrücke die schmalste im Land war, und niemand hätte dort einen Wagen gebaut, der breiter wäre als sie, und kein Stellmacher …«
Desiderata gab einen Laut der Ungeduld von sich. »Ich habe dich verstanden. Aber Militärwagen …« Sie schüttelte den Kopf. »Es gibt keine Militärwagen. Wir haben Vasallen, die uns ihre Wagen leihen. Sie erhalten ihre Gehöfte dafür, dass sie uns einen Wagen und einen Fahrer stellen. Kannst du dir etwas Unpraktischeres vorstellen? Wenn ihr Wagen zusammenbricht, hat der König das Nachsehen.« Sie kaute an ihrem silbernen Bleistift herum. »Er braucht einen eigenen Wagenzug. Karren müssen für den Krieg gebaut werden, und die Wagenmacher müssen dafür bezahlt werden.« Schnell schrieb sie etwas auf.
»Ich könnte mir vorstellen, dass das zu teuer ist, Mylady«, sagte Diota.
Desiderata schüttelte den Kopf. »Weißt du, was es kostet, die Räder eines Wagens zu reparieren? Der Krieg muss nicht unbedingt so teuer sein.«
»Ihr bringt mich zum Lachen, Mylady«, sagte Diota. Nun hatte sie beide roten Kalbslederschuhe gefunden – was für sich genommen bereits einem Wunder gleichkam – und steckte Spanner in alle Schuhe, damit sie in Form blieben.
Desiderata schenkte ihrer Magd ein Lächeln, um das die Knappen bei Hofe kämpfen mussten. »Ich bringe dich zum Lachen, meine Liebe?«
»Ihr seid die Königin der Schönheit, habt den Kopf voller Romanzen und Sternenschimmer, und jetzt wollt Ihr einen Versorgungszug organisieren.« Diota schüttelte den Kopf.
»Ohne Futter und Nahrungsmittel sind ein Ritter und sein Pferd wertlos. Wenn wir wollen, dass sie Ruhm erringen, müssen sie angemessen gefüttert werden.« Sie lachte. »Du glaubst, mein Kopf sei voller Sternenschimmer, Magd! Schau doch bloß mal in den Kopf eines jungen Mannes. Ich wette, dass die Hälfte der Burschen, die versuchen, mich mit ihren Blicken auszuziehen und darum kämpfen, mir die Hand küssen zu dürfen, zu großen Taten ausziehen würden, ohne auch nur einen Futtersack für ihre Schlachtrösser mitzunehmen. Und an ein Öltuch für die Pflege ihrer Klinge denken sie gewiss genauso wenig wie an einen Wetzstein oder an Werkzeug zum Feuermachen.« Sie warf den Kopf herum und schüttelte ihre Haarmähne. »Ich habe die Ritter mein ganzes Leben lang beobachtet. Die Hälfte sind gute Kämpfer, aber nur etwa ein Zehntel von ihnen geben fähige Soldaten ab.«
Diota machte eine Grimasse. »Männer! Was muss man dazu sonst noch sagen?«
Desiderata lachte und nahm eine zweite Schriftrolle auf. »Ich komme mit meinen Plänen für das große Turnier allmählich weiter. Bald wird der König fast all seine Ritter hier versammelt haben, und deshalb werde ich das Datum um einen Monat verschieben. Der vierte Sonntag nach Pfingsten ist keine schlechte Zeit für ein so großes Schauspiel. Dann sind die Felder bestellt, und nur das Heu muss noch eingebracht werden.«
»… nach Pfingsten – der Viehmarkt zu Lorica«, sagte Diota.
Desiderata seufzte. »Natürlich!« Sie verzog das Gesicht. »Verflixt.«
»Dann haltet das Turnier doch in Lorcia ab.«
»Hm«, überlegte Desiderata laut. »Das wäre sehr gut für die Stadt und auch gut für unsere dortigen Beziehungen, denn sie würden einen großen Gewinn erzielen. Aber soweit ich weiß, musste mein Gemahl in Lorica einige Zugeständnisse machen.«
»Weil Euer vollendeter Ritter die Zwei Löwen niedergebrannt hat«, spuckte Diota aus. »Ausländischer Dreck!«
»Zofe!« Desiderata warf ein Kissen nach ihr und traf sie am Hinterkopf.
»Er ist ein Rüpel in Rüstung.«
»Angeblich ist er der beste Ritter der Welt«, rief die Königin. »Du darfst ihn nicht nach allgemeinen Maßstäben …«
»Beim guten Christus«, unterbrach Diota sie. »Wenn er der beste Ritter der Welt ist, dann sollte er die Maßstäbe setzen.«
Sie sahen einander böse an. Aber Diota kannte ihre Pflichten. Sie lächelte. »Ich bin sicher, dass er ein großer Ritter ist, Mylady.«
Die Königin schüttelte den Kopf. »Ich gestehe, dass ihm irgendetwas fehlt«, sagte sie.
Diota schnaubte verächtlich.
»Danke, Zofe. Das reicht. Trotz deines unhöflichen Benehmens magst du recht haben. Zweifellos muss der König Lorica etwas Gutes tun. Da käme das Turnier gerade recht, wenn es zur richtigen Zeit abgehalten wird, wenn die Armee auf dieser Straße zurückkehren wird und wenn die Stadtväter einverstanden sind. Und ich würde mein Turnier bekommen.« Sie läutete eine silberne Glocke, und sofort öffnete sich die Tür zu ihrem Gemach. Ihre Schreiberin Lady Almspend trat ein; sie war eine der wenigen Frauen von Albia, die auf der Universität ausgebildet worden waren.
»Zwei Briefe bitte, Becca.«
Lady Almspend machte einen Knicks, setzte sich an den Schreibtisch und holte aus ihrem Beutel einen silbernen Stift sowie ein Tintenfässchen hervor.
»An den Bürgermeister und den Schulzen von Lorica. Die Königin von Albia entbietet ihnen Grüße …«
Sie diktierte rasch und flüssig und machte nur dann eine Pause, wenn ihre Schreiberin mit gleicher Flüssigkeit Titel und Höflichkeitsfloskeln einfügte. Es war üblich, dass sich Könige und Königinnen berühmter Gelehrter als Schreiber bedienten, da sich die meisten Adligen nicht die Mühe machten, diese Fertigkeiten zu erlernen, und andere mit ihren Schreibarbeiten beauftragten. Rebecca Almspend gelang es jedoch, zarte Gedichte zu schreiben, über die Troubadoure der letzten zwei Jahrhunderte zu forschen und daneben auch noch die Zeit zu finden, ihre Aufgaben gründlich zu erledigen.
»An Seine albische Majestät, von seiner ergebenen, liebenden Gemahlin …«
Lady Almspend schenkte ihr einen schelmischen Blick.
»Schreibt, was ich meine – und nicht, was ich sage«, meinte Desiderata.
»Euer Gnaden werdet mir vergeben, wenn ich anmerke, dass Eure Selbstdarstellung als eigensinnige Schönheit Eure offensichtliche Klugheit bisweilen ein wenig überschattet«, sagte Lady Almspend.
Sanft fuhr Desiderata mit den Fingernägeln über den Arm ihrer Schreiberin. »Sorgt dafür, dass mein Brief zurückhaltend klingt und er nur erfährt, wie brillant ich bin, wenn er sich Gedanken über die Pläne für seine neuen Kriegswagen macht«, sagte sie. »Zeige ich ihm dagegen, wie klug ich bin, wird ihm das nur Qualen bereiten. Meine liebe Becca, die Männer sind so, und Ihr werdet niemals einen Liebhaber gewinnen, nicht einmal einen bebrillten Kaufmannsfürsten, der Euren Kopf anbetet, weil Ihr in der Lage seid, lange Zahlenkolonnen zu schreiben, wenn Ihr Euer Gesicht mit einem Schleier bedeckt und jedem Liebhaber beweisen wollt, dass Ihr die Klügere von Euch beiden seid.« Die Königin wusste nur zu gut, dass ihre vergeistigte Schreiberin die Hingabe des stärksten und männlichsten der königlichen Gardisten errungen hatte, was bei Hofe höchstes Erstaunen ausgelöst hatte. Sogar die Königin hätte gern gewusst, wie das hatte geschehen können.
Lady Almspend hielt sich völlig reglos, und die Königin bemerkte, dass sie sich gerade eine heftige Erwiderung verkniff.
Die Königin küsste sie. »Fasst Euch, Becca. In gewisser Hinsicht bin ich noch gelehrter als Ihr.« Sie lachte. »Außerdem bin ich die Königin.«
Über diese Wahrheit musste sogar die biedere Lady Almspend lachen. »Ihr seid wahrlich die Königin.«
Später, als die Königin Recht sprach, ließ sie zwei Knappen des Königs rufen und schickte sie mit den Briefen fort. Der eine war erfreut, zur Armee gehen zu können, wenn auch nur für einen oder zwei Tage, der andere war niedergeschlagen, weil er bloß in eine Handelsstadt reiten durfte und einem Ritter im Ruhestand einen Brief zu übergeben hatte.
Die Königin erlaubte beiden, ihr die Hand zu küssen.
Nördlich von Harndon · Harmodius
Harmodius verbrachte die zweite schlaflose Nacht. Er versuchte nicht daran zu denken, wie leicht ihm so etwas vor vierzig Jahren gefallen war. Doch als er heute Nacht auf einem erschöpften Pferd sehr langsam die Straße entlangritt, konnte er nur hoffen, dass seine Hände nicht vom Sattelknauf abrutschten und das Pferd nicht stolperte, kein Hufeisen verlor oder einfach unter ihm zusammenbrach.
Er hatte all seine Energiereserven aufgezehrt. Er hatte Wächter aufgerichtet und Phantasmata mit der Unbekümmertheit eines wesentlich jüngeren Mannes gewirkt.
In gewisser Weise war es wunderbar gewesen.
Junge Magier haben Energie, alte haben Geschick. Irgendwo im Zwischenraum von Jung und Alt liegt der größte Moment eines jeden Zauberers. Harmodius hatte angenommen, dass der seine vor zwanzig Jahren gewesen war, doch in der letzten Nacht hatte er einen Feuervorhang ausgeworfen, der fünf Achtelmeilen lang gewesen war, und er hatte ihn auf seinem galoppierenden Pferd wie eine dämonische Pflugschar vor sich hergeschoben.
»Ha!«, sagte er laut.
Eine Stunde nachdem er die Feuerklinge gelöscht hatte, war er einem Fremden auf einem ebenfalls erschöpften Pferd begegnet, der ihn mit wachsamen Augen beobachtet hatte.
Harmodius hatte sein Pferd gezügelt. »Was gibt es Neues?«, hatte er gefragt.
»Albinkirk«, hatte der Mann gekeucht. Mit einem moreanischen Akzent. »Nur die Burg hält stand. Ich muss es dem König berichten. Die Wildnis hat zugeschlagen.«
Harmodius hatte sich über den Bart gestrichen. »Steigt einen Augenblick ab. Wäret Ihr bereit, dem König auch eine Botschaft von mir zu überbringen?«, hatte er gefragt und dann hinzugefügt: »Ich bin der Magus des Königs.«
»Und ich bin Ser Alcaeus Comnena«, hatte sich der dunkelgesichtige Mann vorgestellt und das Bein über den Rumpf seines Pferdes geworfen.
Harmodius hatte ihm ein wenig süßen Wein gegeben und erfreut zugesehen, wie sich der fremde Ritter um sein Pferd kümmerte; er hatte es abgerieben und seine Beine überprüft.
»Wie ist die Straße?«, hatte der Ritter gefragt.
Harmodius hatte sich einen Augenblick der Befriedigung gegönnt. »Ich glaube, Ihr werdet sie passierbar finden. Alcaeus? Ihr seid der Vetter des Kaisers.«
»Allerdings«, hatte der Mann gesagt.
»Seltsam, Euch hier zu treffen«, hatte Harmodius gesagt. »Ich habe einige Eurer Werke gelesen.«
»Ich erröte, doch Ihr könnt es nicht sehen. Ihr müsst Lord Harmodius sein, und ich habe alles gelesen, was Ihr über die Vögel geschrieben habt.« Er lachte ein wenig wild. »Ihr seid der einzige Barb… der einzige Ausländer, dessen Hocharchaisch je bei Hofe laut vorgelesen wird.«
Harmodius hatte ein Werlicht entzündet und wie wild eine Botschaft geschrieben. »Ach ja?«, hatte er dabei geistesabwesend gefragt.
»Aber seit fünf Jahren habt Ihr nichts mehr geschrieben, oder? Oder seit zehn?« Der jüngere Ritter hatte den Kopf geschüttelt. »Es tut mir leid, Mylord. Ich hatte Euch für tot gehalten.«
»Das ist auch nicht ganz falsch. Hier, übergebt das dem König. Ich gehe nach Norden. Sagt mir, habt Ihr Hermetiker gegen Albinkirk kämpfen gesehen?«
Ser Alcaeus hatte genickt. »Etwas Gewaltiges ist auf die Mauern zugekommen. Es hat die Sterne aus dem Himmel gezogen und sie gegen die Burg geschleudert.«
Sie hatten sich die Hände gereicht.
»Ich würde Euch gern unter angenehmeren Umständen wiedersehen«, hatte Ser Alcaeus gesagt.
»Ich Euch ebenfalls, Ser.«
Und mit diesen Worten waren beide davongeritten – der eine nach Norden, der andere nach Süden.
Wer kann die Sterne aus dem Himmel holen und sie gegen Burgmauern werfen?, fragte sich Harmodius und stellte besorgt fest, dass es darauf nur eine einzige Antwort gab.
Das letzte Licht des Tages hatte ihm den Rauch über Albinkirk gezeigt. Wenn die Stadt untergegangen war, dann war er seines Planes beraubt worden.
Sein ursprünglicher Antrieb war fast ganz verschwunden. Offensichtlich war eine Armee der Wildnis aus dem Norden Albas gekommen, und er hatte Angst – bis ins Mark seiner kalten und alten Knochen –, dass das ganze Werk des alten Königs Hawthor zunichtegemacht wurde. Schlimmer noch – das, was den Zauber über ihn geworfen hatte, befand sich irgendwo dort draußen. Bei der Armee.
Dennoch lenkte er sein Pferd nicht wieder in Richtung Süden. Als er die Straße erreichte, die nach Westen und in die Wälder hineinführte und frische Wagenspuren im Boden zu sehen waren, folgte er ihnen.
Seine Entscheidung hatte handfeste Gründe. Er hatte bereits gegen drei Banden der Wildnis gekämpft, um bis hierherzugelangen. Gegen eine vierte wollte und konnte er nicht mehr losziehen.
Zwei Stunden später gab ein Pferd irgendwo in der Finsternis ein langes Schnauben und dann ein leises Wiehern von sich. Sein eigenes Pferd antwortete ihm.
Harmodius richtete sich im Sattel auf.
Er ließ es zu, dass sein Pferd vorwärtstaumelte. Die Pferde würden einander schneller finden, wenn er sich nicht einmischte, und so trieben sie lange Minuten dahin. Mit kraftlosen Augen starrte er in die Dunkelheit, die sich wie ein lebendiges Wesen gegen die Straße presste.
Das andere Pferd wieherte noch einmal.
Sein Pferd antwortete mit einem Laut, der beinahe wie das Schreien eines Esels klang.
»Halt! Du da auf der Straße – halt an und steig ab, oder du wirst gleich so viele Armbrustpfeile in dir stecken haben, dass du ein Stachelschwein spielen kannst.« Die Stimme war laut und schrill und klang sehr jung, was den Sprecher noch gefährlicher machte. Harmodius glitt von seinem Pferd und ahnte tief in seinem Innern, dass er wohl nicht mehr aufsteigen würde. Seine Knie schmerzten. Die Waden schmerzten ebenfalls. »Ich bin abgestiegen«, sagte er.
Eine Laterne öffnete ihr unheilvolles Auge vor ihm; das grelle Öllicht blendete ihn fast.
»Wer bist du?«, fragte die unerfreuliche junge Stimme.
»Ich bin der verdammte König von Albia«, fuhr Harmodius den Sprecher an. »Ich bin ein alter Mann mit einem erschöpften Pferd und würde gern ein Feuer mit dir teilen, und wenn ich eine Koboldhorde wäre, dann wärst du schon lange tot.«
Aus der Dunkelheit ertönte ein Kichern.
»Da hast du es, Adrian. Leg die Waffe ab, Henry. Wenn er reitet, dann ist er keine Kreatur der Wildnis. Klar? Hast du das noch immer nicht begriffen, Junge? Wie lautet dein Name, alter Mann?« Diese neue Stimme klang befehlsgewohnt, ohne den Ruch des Adligen zu haben. Der überhebliche höfische Akzent war nicht zu bemerken.
»Ich bin Harmodius Silva, der Magus des Königs.« Er trat in den Schein der Laterne, sein Pferd folgte ihm. Es war genauso begierig nach Ruhe und Nahrung wie sein Reiter. »Und das ist keine Lüge«, fügte er hinzu.
»Das klingt aber auch nicht unbedingt wie die Wahrheit«, sagte die neue Stimme. »Komm zum Feuer und trink einen Becher Wein mit uns. Adrian, zurück auf deinen Posten, Junge. Henry, wenn du diese Waffe gegen mich richtest, schlag ich dir die Nase ein.«
Der Mann steckte in einer Rüstung und hatte eine schwere Axt in den Armen liegen. Nun streifte er einen Panzerhandschuh ab und ergriff Harmodius’ Hand. »Man nennt mich den alten Bob«, sagte er. »Ich diene als Soldat sowohl den Großen als auch den nicht ganz so Großen«, lachte er. »Seid Ihr wirklich Lord Silva?«
»Allerdings«, antwortete Harmodius. »Habt ihr hier tatsächlich ein sicheres Lager und einen Becher Wein? Ich gebe gern einen Silberleoparden, wenn sich jemand um mein Pferd kümmert.«
Der Soldat lachte. »War’s eine lange Nacht?«
»Drei lange Nächte. Beim Blute Christi und seiner Auferstehung, ich habe drei Tage lang gekämpft.«
Nun traten sie in den Lichtkreis eines großen Feuers, über dem ein mächtiges Gestell thronte, an dem drei schwere Kessel hingen, und an einem Seitenausleger hingen zwei Lampen. Es war das stärkste Licht, das er seit Sonnenuntergang gesehen hatte. Im Lampenschein erkannte er, dass etwa ein Dutzend Männer über etwas hockten, das auf dem Boden lag. Daneben befand sich das große Rad eines schweren Wagens. Dahinter war ein weiteres zu erkennen.
»Ihr habt Meister Randoms Karawane erreicht«, sagte der Soldat. »Fast fünfzig Wagen, und alle Gilden von Harndon sind repräsentiert.«
Harmodius nickte. Er hatte zwar noch nie etwas von einem Meister Random gehört, aber ihm war während der letzten drei Tage klar geworden, dass er zehn oder mehr Jahre fern der Welt gelebt hatte.
»Hier seid Ihr ziemlich sicher«, sagte der alte Bob. »Heute haben uns die Kobolde einen Hinterhalt gelegt.« Er zuckte die Achseln und wirkte nicht gerade erfreut darüber.
»Habt ihr Verluste erlitten?« Harmodius wollte gern etwas über die Zahl und Stärke des Gegners wissen, aber sein Verlangen nach Neuigkeiten lag im Wettstreit mit seiner Erschöpfung.
»Der junge Ritter.« Der alte Bob deutete mit seiner großen Axt auf die Gruppe der Männer, die sich um etwas herum versammelt hatten, das sich auf dem Boden befand. »Er wurde schwer verwundet, als er draußen in der Wildnis gegen einen Dämon gekämpft hat.«
Harmodius seufzte. »Macht Platz«, sagte er.
Jemand hielt eine Kerze, und der Pferdeheiler säuberte gerade die Wunden des Mannes mit Weinessig. Der junge Ritter hatte eine Menge Blut verloren und wirkte in seinem nackten Zustand besonders blass und verwundbar. Für die Frühlingsfliegen bedeutete er ein Festmahl.
Ohne nachzudenken, wirkte Harmodius einen Zauber und belegte die Fliegen mit einem kleinen Bann.
Die Müdigkeit, die wie ein Kettenhemd um ihn lag, drückte ihm plötzlich das Herz zusammen. Aber er kniete sich dennoch neben den Verwundeten, und der alte Bob hielt die Laterne darüber.
Einen Moment lang sah der verletzte Ritter wie der König aus.
Harmodius beugte sich tiefer über ihn und untersuchte die Wunden. Es waren drei Stiche und einige Schnitte – nichts, was einen gesunden Mann zu töten imstande war. Doch dann bemerkte er die Verbrennungen. Im gelblichen Kerzenschein wirkten die Augen des Mannes wie rote Gruben.
»Gütiger Jesus«, sagte der Magier.
Das, was er für Schmutz an der Schulter des Mannes gehalten hatte, war gar kein Schmutz. Sein Kettenhemd hatte sich ihm ins Fleisch gesengt. Die Verbrennungen waren nicht rot, sie waren schwarz.
»Er stand einem Adversarius gegenüber«, sagte einer der Männer. »Einem Dämon der Hölle, der Feuer auf ihn geworfen hat.«
Harmodius spürte, wie ihm die Augen zufielen. Er besaß nicht die Macht, diese tapfere Seele zu retten, was sehr enttäuschend war, vor allem da er nur ein wenig organische Macht benötigte, um die Verbrennungen zu lindern. Es bedurfte keiner großen Macht, aber großer Geschicklichkeit, das entsprechende Phantasma zu bilden.
Doch der Umstand, dass die benötigte Macht organischen Ursprungs war, brachte ihn auf einen Gedanken.
Er betastete seine eigenen Reserven, die er über die Jahre sorgfältig verzaubert hatte – getränkt in Sonnenmacht, imprägniert mit dem reichen goldenen Licht der Heiligen Sonne. Aber alles war kalt und leer. Genauso verhielt es sich mit seinem größten Speicher – seiner eigenen Haut. Leer, kalt und müde.
Und doch, nach der Logik des Experiments in seinem Turm …
»Tretet alle beiseite«, befahl er. Ihm fehlte die Kraft, das zu erklären. Entweder es wirkte, oder es wirkte nicht. »Ich bin erschöpft«, sagte er zu dem alten Soldaten. »Du weißt, was das bedeutet?«
»Das heißt, Ihr könnt nicht heilen, oder?«, meinte der alte Bob.
»So ungefähr. Ich werde versuchen, eine Quelle in der Nähe anzuzapfen. Wenn es mir nicht gelingt, wird nichts passieren. Aber wenn es doch gelingt …« Harmodius rieb sich die Augen. »Bei Hermes und allen Heiligen, wenn es gelingt, wird wahrscheinlich etwas passieren.«
Der alte Bob schnaubte verächtlich. »Drückt Ihr Euch immer so klar aus?« Er streckte einen Becher vor. »Trinkt erst einmal. Guter, roter Wein.«
Harmodius schob ihn beiseite. Die anderen Männer wichen zurück oder flohen zum Feuer. Niemand hatte vor, einem Zauberer bei der Arbeit zuzusehen – mit Ausnahme des alten Bob, der ihn mit der vorsichtigen Neugier einer Katze beobachtete.
Harmodius griff in die Finsternis, bis er einen Teich aus jener grünen Macht fand, von der er wusste, dass sie dort war. Und nicht mal weit entfernt. Er bediente sich einfach ihrer Kraft …
… und die Nacht explodierte in einem ungeheuren Kreischen.
Man arbeitete nicht viele Jahre mit den gewaltigsten Kräften des Universums, ohne dabei eine Konzentrationsfähigkeit zu erlangen, die an die schiere Unbarmherzigkeit grenzte. Harmodius richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die Macht, die schwierig zu handhaben und zu ergreifen war, und irgendwie fühlte sie sich falsch an. Diese Falschheit hätte ihn sofort zurückgestoßen, wenn er nicht durch sein früheres Experiment die wissenschaftliche Bestätigung dafür gehabt hätte, dass eine Kreatur der Wildnis und die Hermetik aufeinander einwirken konnten.
Das Kreischen ging weiter, und die Männer um ihn herum fielen in eine Art disziplinierter Panik. Sie ergriffen ihre Waffen und beruhigten die Pferde. Harmodius war sich ihrer bewusst, doch es reichte nicht aus, um die eiserne Kette seiner Verbindung zu der fernen grünen Quelle der Macht zu durchtrennen, die er wie ein Säugling festhielt, der gierig an der Brust nuckelte.
Unbarmherzig.
Und dann war es in ihm und erfüllte ihn mit seinem seltsamen, bitteren, wintergrünen Hauch, und da war Angst, viel mehr, als er für seine kleine Zauberei benötigte. Aber er arbeitete damit, wirkte zunächst eine komplexe Bindemagie und dann zwei gleichzeitige Phantasmata, die ihn selbst in zwei voneinander unabhängig arbeitende Teile spaltete, wie sein Meister es ihn vor so langer Zeit gelehrt hatte. Und dann war plötzlich so viel Macht da, dass er sich noch einmal abspalten und ein Bewusstsein als Wache in die Finsternis aussenden konnte. Der Griff nach der grünen Energie, so wie er ihn bewirkt hatte, schien wie der Tritt in einen Ameisenhaufen gewesen zu sein.
Eine Dorfhexe konnte die Macht durch jede ihrer beiden Hände fließen lassen. Harmodius hingegen war es möglich, jeden einzelnen Finger als Kanal zu benutzen, und er war in der Lage, andere Dinge an seinem Körper – Ringe und Ähnliches – als Speicher oder Klammern einzusetzen.
Und nun setzte er viele davon ein.
Zunächst blickte er in die Wunden hinein. Sie waren schlimmer, als es im Feuerglanz den Anschein gehabt hatte. Die Haut war schwarz versengt, und an einigen Stellen reichten die Verletzungen bis in das Fett- und Muskelgewebe.
Es waren tödliche Verbrennungen.
Der Mann entglitt ihm, als Harmodius sich daran machte, die Schmerzen zu lindern und die schlimmsten Wunden zu heilen.
Es gab nichts Schwierigeres als das Heilen von Verbrennungen, und trotz all seiner Macht war Harmodius kein Heiler. Ein Dutzend Herzschläge lang jonglierte er mit etlichen Machtfühlern, versuchte das verbrannte Gewebe zu erneuern und fügte ihm dabei bloß noch weitere Verbrennungen zu. Die erforderliche Selbstbeherrschung war ungeheuerlich, und in seiner Enttäuschung und Erschöpfung entglitt ihm mehr von der grünen Macht, als ihm lieb war. Sie rollte erst in Wellen durch ihn hindurch, dann gab er sie ungemildert an die Schulter des jungen Mannes weiter.
Harmodius hatte von Heilungswundern gehört, aber er hatte noch nie eines gesehen. Unter seiner Hand aber heilte nun ein Fleck von der Größe einer Bronzemünze. Die Brandwunde, die unter Harmodius’ verstärktem Blick pulsierte, wurde einfach blass und blasser und war schließlich ganz verschwunden.
Es war unglaublich.
Harmodius hatte keine Ahnung, was er getan hatte, aber er war ein empirischer Magus, und so griff er nach noch mehr Macht, zog sie aus ihrer Quelle wie jemand, der einen großen Meeresfisch mit einer kleinen Angel an Land ziehen wollte, pumpte sie dann durch seine Hände in die Flecken aus versengtem Fleisch …
… und es verheilte.
Er tastete nach noch mehr Macht, ergriff sie, kämpfte mit der Quelle und überwand deren Widerstand mit seiner schieren Willenskraft, sog die grüne Macht in seine Seele und gab sie durch die Hände an den Ritter weiter, dessen Augen sich plötzlich unter einem lauten Schrei öffneten.
Harmodius taumelte zurück.
Die Schreie aus dem Wald verstummten.
»Warum hast du mich umgebracht?«, fragte der junge Ritter anklagend. »Ich war so schön!«
Er sackte zusammen, und seine Augen schlossen sich wieder.
Harmodius streckte die Hände aus und berührte ihn. Er schlief, und die Haut an Hals, Brust, Rücken und Schultern blätterte ab. Die schwarzen Stellen und der Schorf wichen dem neuen Fleisch, das sich darunter gebildet hatte.
Neues, bleiches Fleisch.
Mit Schuppen.
Harmodius zuckte zurück und versuchte zu begreifen, was er getan hatte.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann erwachte und war noch immer müde. Er stand auf, rief nach Toby und taumelte zu seinem Waschbecken.
Toby kam herein. Während er auf einem Keks herumkaute, legte er die Kleidung des Hauptmanns zurecht. Er bewegte sich vorsichtig, und aus seinem abgewandten Kopf schloss der Hauptmann, dass etwas nicht stimmte. Was immer es sein mochte, er würde es selbst herausfinden müssen.
»Was gibt es Neues, Toby?«, fragte der Hauptmann.
»Kobolde auf dem Feld«, sagte der Junge und kaute weiter.
»Wo ist Michael?«, fragte der Hauptmann, als niemand kam, um ihm beim Anlegen und Festknöpfen seiner Hose zu helfen.
Toby hatte noch immer den Blick abgewandt. »In der Kapelle, nehme ich an.«
»Nur wenn Jesus in der letzten Nacht persönlich zu Michael gekommen ist«, meinte der Hauptmann. Morgens war er immer unleidlich. Toby trug daran keine Schuld, aber der Junge vergötterte den Knappen und würde ihn niemals verpetzen.
Der Hauptmann legte sich die Hose selbst an, nahm ein altes Wams und schnürte es auf. Er rief erst nach Michael, als er bereit war, die Ärmel zuzubinden. Als der junge Mann noch immer nicht erschien, nickte er Toby zu. »Ich gehe auf die Suche nach ihm«, sagte er.
Toby wirkte erschrocken. »Ich werde gehen, Meister!«
Der Hauptmann war verärgert. »Wir können zusammen gehen«, sagte er, und schon trugen ihn seine langen Beine aus dem Gemach und den Gang hinunter zur Kommandantur, wo Michael schlief.
Toby versuchte, früher als er bei der Tür zu sein, doch aufgrund seiner kürzeren Beine und seiner ehrerbietigen Haltung blieb er stets einen Schritt zurück.
Der Hauptmann warf die schwere Eichentür auf.
Michael sprang aus seinem Schlafsack. In seiner rechten Hand steckte ein langer Dolch. Er war nackt. Genau wie das schöne Mädchen, das er hinter sich schob.
»Michael?«, sagte der Hauptmann und sah dabei den Dolch an.
Michael errötete. Die Röte begann knapp oberhalb seiner Lenden, fuhr in Flecken über Brust und Hals bis zum Gesicht. »O mein Gott … Mylord, es tut mir so leid …«
Der Hauptmann sah das Mädchen an. Ihre Schamesröte wirkte sogar noch feuriger.
»Das ist doch meine Wäschemagd«, sagte er und hob eine Braue. »Nun scheint sie allerdings die deine zu sein.«
Sie verbarg ihren Kopf.
»Zieht euch an. Michael, draußen herrscht heller Sonnenschein, und wenn diese arme junge Frau die Treppe zum Hof hinuntergeht, wird jede Person in der Festung wissen, wo sie in der letzten Nacht gewesen ist: entweder bei dir, bei mir oder bei Toby. Vielleicht bei allen dreien. Toby hat zumindest den Vorzug, in ihrem Alter zu sein.«
Michael versuchte, seinen Dolch wegzustecken.
»Ich liebe sie!«, sagte er heftig.
»Wunderbar. Diese Liebe wird einen ganzen Berg von Schwierigkeiten erschaffen, die vielleicht damit enden, dass du nicht mehr in meinen Diensten stehen wirst.« Der Hauptmann war wütend.
»Wenigstens ist sie keine Nonne!«, verteidigte sich Michael.
Das brachte den Hauptmann zum Verstummen. Und erfüllte ihn mit schwarzem Zorn. Innerhalb eines einzigen Herzschlages wurde seine müde, abgehobene Belustigung zu dem drängenden Verlangen, Michael zu töten. Er gab sich alle Mühe, nicht die Waffe zu ziehen. Oder seine Fäuste zu gebrauchen. Oder seine Macht.
Michael wich einen Schritt zurück, und Toby stellte sich zwischen den Hauptmann und den Knappen.
Plötzlich umfingen starke, schwere Arme den Hauptmann von hinten. Er wand sich, war von Sinnen vor Wut, konnte den Griff aber nicht abschütteln. Er versuchte, sich breitbeinig hinzustellen und mit dem Kopf nach seinem Gegner zu stoßen, aber der Mann hob ihn einfach vom Boden hoch.
»He!«, rief Tom Schlimm. »He, ihr!«
»Seine Augen glühen!«, sagte Michael mit zitternder Stimme, während sich Kaitlin Lanthorn in die Ecke kauerte.
Tom drehte den Hauptmann um und versetzte ihm eine Ohrfeige.
Alles erstarrte. Die Macht des Hauptmanns hing in der Luft, war auch für jene mit Händen zu greifen, die nicht mit ihr begabt waren. Kaitlin Lanthorn sah sie als Wolke aus Gold und Grün um den Kopf des Hauptmanns.
»Lass mich los, Tom«, sagte er.
Tom stellte ihn wieder auf den Boden. »Worum geht es hier?«
»Mein Idiot von einem Knappen hat eine örtliche Jungfrau defloriert – einfach nur aus Spaß.« Der Hauptmann holte tief Luft.
»Ich liebe sie!«, brüllte Michael. Die Angst ließ seine Stimme hoch und weinerlich klingen.
»Vermutlich«, meinte Tom. »Ich liebe auch alle Frauen, die ich vögele.« Er grinste. »Sie ist nur eine von den Lanthorn-Schlampen. Hier ist kein Schaden entstanden.«
Kaitlin brach in Tränen aus.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Die Äbtissin …«, begann er.
Tom nickte. »Ja. Sie wird es nicht so gut aufnehmen.« Er sah Michael an. »Ich will dich gar nicht erst fragen, was du dir dabei gedacht hast, denn das kann ich mir gut genug vorstellen.«
»Schaff ihn mir aus den Augen«, sagte der Hauptmann. »Toby, du sorgst dafür, dass sich das Mädchen anzieht, und bring sie … ich weiß auch nicht wohin. Kannst du sie von hier wegschaffen, ohne dass es jemand mitbekommt?«
Toby nickte ernsthaft. »Ja«, sagte er in seinem drängenden Wunsch zu helfen. Toby mochte es nicht, wenn seine Helden wütend waren, besonders nicht aufeinander. Er wollte unbedingt etwas dagegen tun.
Der Hauptmann hatte nun schreckliche Kopfschmerzen, und dabei hatte der Tag kaum erst angefangen.
»Was tust du hier überhaupt?«, fragte er Tom.
»Pampe hat eine Patrouille draußen, und in der Brückenburg befinden sich die Überreste einer Karawane«, erklärte Tom. »Schlechte Neuigkeiten.«
Eine Stunde später erstattete Pampe Bericht, reichte ein Kind vom Sattel ihres Kriegspferdes herunter und salutierte stramm vor ihrem Hauptmann.
»Dreiundzwanzig Wagen. Alle verbrannt. Sechzig Leichen gefunden, noch nicht verwest, und kein großer Kampf.« Sie zuckte die Schultern. »Ein wenig angenagt.« Sie senkte die Stimme, da sich mindestens ein Dutzend Leute in Hörweite befanden und begierig auf Neuigkeiten waren. »Viele bis auf Sehnen und Knochen aufgefressen, Hauptmann.«
Der Hauptmann betastete seinen Bart, betrachtete die verzweifelten Leute, die um sein Pferd herumstanden, und wusste, dass jegliche Zuversicht, die durch seine Ausfälle ins feindliche Lager gewonnen worden war, nun unter einer frischen Welle des Entsetzens zerstreut wurde.
»Zurück an die Arbeit!«, rief der Hauptmann.
»Wir haben keine Arbeit!«, rief einer der Männer zurück, und die Menge brummte verärgert.
Der Hauptmann saß bereits auf seinem Pferd, weil er eine Patrouille hinausführen wollte. Er war selbst rastlos und bedrückt und wollte etwas unternehmen – irgendetwas, das ihn abzulenken vermochte.
Aber er war der Hauptmann. Und nickte Gelfred zu. »Begib dich nach Norden, aber schnell. Du weißt ja, was wir wollen.«
Er schwang den bespornten Stiefel über Grendels Rücken und glitt aus dem Sattel. »Mutwill Mordling, Pampe, zu mir. Der Rest von euch – gut gemacht! Ruht euch ein wenig aus.«
Er führte die beiden nach drinnen. Michael stieg ebenfalls ab und sah so wütend aus, wie sich der Hauptmann fühlte, weil er eine Gelegenheit verloren hatte, quälendes Entsetzen durch ehrliche Furcht zu ersetzen. Nun war ihm klar, dass er keine Möglichkeit bekommen würde, seine Sünde zu sühnen. Doch er nahm sein eigenes Schlachtross und das des Hauptmanns und ging mit ihnen ohne eine Bemerkung zu den Ställen.
Schwester Miram – die schwerste und daher am leichtesten zu erkennende der Nonnen – schritt gerade mit einem Korb voller süßem Brot für die Kinder durch den Hof. Der Hauptmann fing ihren Blick auf und winkte ihr zu.
»Die Äbtissin wird es hören wollen«, sagte er zu ihr. Sie drückte ihm einen Keks in die Hand und schenkte ihm einen Blick, unter dem Milch sauer werden konnte – es war ein Blick tiefster Missbilligung.
Unter dem Keks befand sich ein kleines Stück Pergament.
Treffen heute Nacht.
Ein Blitz durchschoss ihn.
Die Äbtissin traf ein, als er noch in seinem Gemach stand. Er hatte gerade die gepanzerten Handschuhe ausgezogen und auf den Tisch gelegt; den Helm hatte er noch anbehalten. Pampe nahm ihn ihm ab, und er drehte sich um und sah die Äbtissin, die die Hände vor sich verschränkt hatte. Ihr Brusttuch war gestärkt und saß ausgezeichnet, während ihre Augen hell leuchteten.
Der Hauptmann musste lächeln, erhielt aber keine Erwiderung darauf.
Er seufzte. »Wir haben eine weitere Karawane verloren, die unterwegs zum Jahrmarkt war – sechs Meilen weiter westlich, auf der Straße nach Albinkirk. Mehr als sechzig Tote. Die Überlebenden setzen Eure Leute in Panik, und meinen helfen sie auch nicht gerade.« Er seufzte. »Unter ihnen sind Flüchtlinge aus Albinkirk, das, wie ich leider berichten muss, an die Wildnis gefallen ist.«
Zu Pampe sagte er: »In Zukunft bringt ihr alle neuen Flüchtlinge zu Ser Milus, egal in welchem Zustand sie sich befinden. Er soll sich mit ihren Tobereien auseinandersetzen.«
Pampe nickte. »Darauf hätte ich selbst kommen sollen«, sagte sie müde.
»Nein, ich selbst hätte eher darauf kommen sollen, Pampe«, erwiderte der Hauptmann.
Mutwill Mordling schüttelte den Kopf. »Es ist noch schlimmer, als Ihr denkt, Hauptmann. Ihr stammt nicht aus dieser Gegend, oder?«
Der Hauptmann sah den Bogenschützen eindringlich an, und Mutwill verzagte. »Entschuldigung, Ser«, sagte er.
»Zufällig kenne ich die Berge im Norden gut genug«, bemerkte der Hauptmann ruhig.
Aber Mutwill war noch nicht ganz besiegt. Er holte etwas aus seiner Tasche und legte es auf den Tisch.
Als die Äbtissin es sah, wurde sie so bleich wie Pergament.
Der Hauptmann hob eine Braue.
»Abenaki«, sagte er.
»Oder Quost, vermutlich aber Sossag.« Mutwill nickte ehrerbietig. »Ihr seid tatsächlich von hier.«
»Wie viele?«, fragte der Hauptmann.
Mutwill schüttelte den Kopf. »Mindestens einer. Was für eine Frage ist das denn?« Die Feder, die er auf den Tisch gelegt hatte – eine Reiherfeder –, war mit den Stacheln eines Stachelschweins verziert, die hellrot eingefärbt und sorgfältig um den Stamm der Feder gewickelt waren.
Mutwill sah sich wie ein Zauberkünstler um und holte einen zweiten Gegenstand hervor. Es handelte sich um einen kleinen Beutel, der mit verschlungenen Lederbändern verziert war. Als seine Zuschauer unverständig dreinschauten, zeigte er ihnen ein zahnlückiges Grinsen. »Irks. Fünf Fuß voller zäher und kräftiger Muskeln. Sie fertigen erstaunliche Dinge. Meine Mutter hat sie immer das Elfenvolk genannt.« Er sah die Äbtissin an. »Sie essen gerne Frauen.«
»Das reicht, Mutwill.«
»Ich wollte es nur erwähnen. Und es gab Spuren.« Er zuckte die Achseln.
»Gut gemacht, Mutwill. Und jetzt lass mich eine Weile in Ruhe.« Der Hauptmann deutete mit dem Kinn auf die Tür.
Mutwill hätte einen guten Grund gehabt, mürrisch zu sein, doch er stellte fest, dass ein Silberleopard über den Tisch zu ihm hingeschoben wurde. Er biss hinein, grinste und ging mit der Münze davon.
Der Hauptmann sah die Äbtissin an, sobald sie allein waren. »Was geht hier vor?«, fragte er mit freundlicher, aber kühler Stimme. »Das ist kein zufälliger Gewaltausbruch der Wildnis, kein losgelöster Zwischenfall, bei dem ein Dutzend Kreaturen über die Mauern klettern und uns angreifen. Das ist ein Krieg. Zuerst die Dämonen, Lindwürmer und Irks und nun auch noch die Hinterwaller. Jetzt fehlen bloß noch ein paar Kobolde, und vielleicht betritt dann auch noch der Drache das Feld. Äbtissin, wenn Ihr etwas wisst, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es mir zu sagen.«
Sie hielt seinem Blick stand. »Ich kann nur Vermutungen anstellen«, sagte sie und zog die Mundwinkel herunter. »Ich nehme an, dass das jüngste Lanthorn-Mädchen die Nacht hier verbracht hat?«, meinte sie neckisch.
»Ja, das hat sie. Ich habe sie immer wieder vergewaltigt und heute Morgen nackt in den Hof geworfen«, sagte der Hauptmann mit deutlicher Verärgerung. »Verdammt, es ist wichtig.«
»Ist Kaitlin Lanthorn etwa nicht wichtig? Mein Jesus sagt mir, dass sie genauso bedeutend ist wie Ihr, Ser Ritter. Und wie ich. Vielleicht sogar noch bedeutender. Erspart mir bitte Euer Geprahle. Ich weiß, warum Ihr so gereizt seid. Sie hat die Nacht mit Eurem Knappen verbracht. Ich habe soeben ein paar Minuten mit dem Mädchen darüber gesprochen.« Sie sah ihn eindringlich an. »Wird er sie heiraten?«
»Das könnt Ihr nicht ernstlich glauben«, entgegnete der Hauptmann. »Er ist der Sohn eines großen Lords. Er mag sich zwar mit seiner Familie überworfen haben, aber sie wird ihm schon bald vergeben. Männer seiner Art heiraten keine Bauernschlampen.«
»Vor ein paar Tagen war sie noch Jungfrau«, sagte die Äbtissin. »Sie wird nicht zur Hure, nur weil sie so genannt wird. Und Ihr steht nun in meinen Augen nicht unbedingt besser da.«
»Ausgezeichnet«, meinte der Hauptmann. »Sie ist also ein feines, aufrechtes Mädchen mit untadeliger Moral, und mein abscheulicher Knappe hat sie in sein Bett gelockt. Ich werde dafür sorgen, dass er zur Rechenschaft gezogen wird – sowohl moralisch als auch in klingender Münze. Können wir jetzt bitte endlich auch mal über die wahre Bedrohung sprechen?«
»Vielleicht tun wir das schon. Bisher haben die Kreaturen der Wildnis hier bei Weitem nicht so großen Schaden angerichtet wie Eure Männer«, sagte die Äbtissin.
»Das stimmt nicht, Mylady. Ich schwöre bei meiner Ehre: Ich werde dafür sorgen, dass dieser jungen Frau Gerechtigkeit widerfährt. Ich muss gestehen, dass sie heute Morgen nicht wie eine Hure aussah, und sie ist noch sehr jung. Es ist mir sehr peinlich, dass mein Knappe so etwas getan hat.«
»Wie der Herr, so’s Gescherr«, sagte die Äbtissin.
Der Hauptmann ballte die Fäuste. Er beherrschte sich, lockerte sie wieder und legte die Hände zu einem Dach zusammen.
»Ich glaube, Ihr wollt dem wahren Thema aus dem Wege gehen. Schwester Hawisia wurde ermordet. Ihre Ermordung war geplant. Vielleicht war sie das Ziel, vielleicht wart Ihr es auch. Der Dämon, der die Tötung vorgenommen hat, erhielt Hilfe aus der Festung. Die Männer, die dem Dämon geholfen haben, sind dann miteinander in Streit geraten, und der eine hat den anderen umgebracht und die Leiche an der Straße nach Westen begraben. Kurz danach sind wir eingetroffen. Wir haben einen Lindwurm aufgespürt und ihn getötet. Gelfred und ich haben zwei Dämonen gefunden; der eine ist gestorben, während der andere entkommen konnte. Wir haben die Gegend durchstreift und sind auf eine Armee gestoßen, die sich unter einem mächtigen Zauberer zusammengefunden hat. Und an diesem Morgen sind die Wälder um und herum voller Feinde, und die Straße nach Albinkirk ist gesperrt. Albinkirk ist an die Wildnis gefallen, und ich behaupte, dass Ihr mehr wisst, als Ihr mir sagt, Mylady. Was geht hier wirklich vor?«
Sie wandte den Kopf ab. »Ich weiß gar nichts«, sagte sie in einem Tonfall, der sie als schlechte Lügnerin auswies.
»Habt Ihr den heiligen Hain fällen lassen? Haben Eure Bauern die Dryaden vergewaltigt? Bei allem, was Euch heilig ist, Äbtissin, wenn Ihr mir nicht helft, das alles zu verstehen, werden wir hier sterben. Das ist eine vollständige Invasion, und zwar die erste, die es seit Eurer Geburt gibt. Woher sind sie gekommen? Ist der Norden gefallen? Warum ist die Wildnis in solcher Stärke hierhergezogen? Ich bin mit der Mauer aufgewachsen. Ich bin in Hinterwaller-Dörfern gewesen und habe gegessen, was sie essen. Es sind viel mehr, als wir zuzugeben bereit sind – Zehntausende sind das. Wenn sie alle die Wildnis unmittelbar unterstützen, werden wir in einem Meer aus Feinden weggespült werden. Was genau geht hier vor?«
Die Äbtissin holte tief Luft, als wollte sie sich stärken, dann hob sie eine Braue. »Wirklich, Hauptmann, ich weiß nicht mehr als Ihr. Ich verstehe die Handlungen der Wilden nicht. Und die Wildnis ist doch bloß ein Name, den wir der Gesamtheit des Bösen geben, nicht wahr? Reicht es nicht aus, dass wir heilig sind und uns selbst, unseren Gott und unsere Lebensart zu erhalten versuchen? Wollen sie uns das alles wegnehmen?«
Der Hauptmann sah sie eindringlich an und schüttelte den Kopf. »Ihr wisst mehr. Mit der Wildnis verhält es sich nicht so einfach.«
»Sie hasst uns«, sagte die Äbtissin.
»Aber es gibt keinen Grund, gerade jetzt gegen Euch aufzumarschieren«, erwiderte der Hauptmann.
»Östlich von Albinkirk gibt es verbrannte Bäume und neu angelegte Felder«, sagte Pampe.
Die Äbtissin drehte sich zu ihr um, als wollte sie die Frau zurechtweisen, aber sie zuckte nur mit den Schultern. »Wir müssen uns ausdehnen, weil unser Volk wächst. Es sind mehr Mäuler zu stopfen, und deshalb werden mehr Äcker benötigt.«
Der Hauptmann sah Pampe an. »Wie viele verbrannte Bäume? Ich erinnere mich nicht an sie.«
»Sie stehen auch nicht unmittelbar an der Straße. Ich weiß es nicht. Fragt Gelfred.«
»Sie gehen bis Albinkirk«, gab die Äbtissin zu. »Wir waren damit einverstanden, dass sie den Wald brandroden und sich neue Bauern ansiedeln. Warum auch nicht? Das war die Politik des alten Königs, und wir brauchen das Land.«
Der Hauptmann nickte. »Das war in der Tat die Politik des alten Königs, und sie hat zur Schlacht von Chevin geführt.« Er rieb sich den Bart. »Ich hoffe, dass einer meiner Boten es bis zum König geschafft hat, denn jetzt stecken wir in einem ziemlich großen Misthaufen.«
Michael kam mit Weinbechern herbei. Er wurde sehr rot, als er die Äbtissin sah.
Der Hauptmann blickte ihn an. »Ich brauche alle Offiziere, Michael. Hol auch Ser Milus von der Brückenburg hierher.«
Michael seufzte, servierte den Wein und ging wieder.
Die Äbtissin schürzte die Lippen. »Ihr wollt uns doch nicht etwa verlassen?«, fragte sie.
Der Hauptmann schaute durch das Fenster nach Westen. »Nein, Mylady, das will ich nicht. Aber es muss Euch klar gewesen sein, dass es eine Reaktion der Wildnis geben wird.«
Sie schüttelte den Kopf; Wut und Enttäuschung kämpften in ihr um die Oberherrschaft. »Beim heiligen Thomas und beim heiligen Mauritius, Hauptmann, Ihr rügt mich zu schwer. Ich habe nur das getan, was mein Recht, ja sogar meine Pflicht ist. Die Wildnis war geschlagen – das haben mir wenigstens der Wirt und der König gesagt. Warum sollte ich meine Ländereien nicht auf Kosten einiger alter Bäume ausdehnen? Und als die Morde begannen … Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie damit in Verbindung stehen. Erst als …«
Der Hauptmann beugte sich vor. »Ich will Euch sagen, was ich denke«, meinte er. »Hawisia hat einen Verräter enttarnt und ist dafür gestorben.«
Die Äbtissin nickte. »Das wäre möglich. Sie hatte darum gebeten, in die Außengebiete gehen zu dürfen, wobei das eigentlich meine Pflicht gewesen wäre.«
»War sie Eure Cellerarin? Hat sie die Stellung bekleidet, die jetzt Schwester Miram innehat?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Sie hatte zwar mehr Macht als die anderen Schwestern, aber sie war zu jung, um schon ein Amt zu bekleiden.«
»Und sie war nicht gut gelitten«, sagte Pampe.
Die Äbtissin zuckte zusammen, erwiderte aber nichts darauf.
Der Hauptmann stützte den Kopf in die Hände. »Egal. Wir sind jetzt hier, genau wie der Feind. Ich vermute, dass die Wildbuben, die Dämonen oder beide Euch töten und die Abtei in einem Handstreich einnehmen wollten. Hawisia hat das irgendwie verhindert, entweder weil sie dem Verräter entgegengetreten ist oder weil sie Euren Platz eingenommen hat. Wir werden es vermutlich nie erfahren.« Er schüttelte den Kopf.
Die Äbtissin warf einen Blick auf ihre Hände. »Ich habe sie geliebt«, sagte sie.
Der Rote Ritter kniete sich vor ihr hin und legte seine Hände auf die ihren. »Ich schwöre, ich werde mein Bestes tun, um diese Festung zu halten und Euch zu retten. Aber, Mylady, ich habe noch immer das Gefühl, dass Ihr mehr wisst. Es ist etwas Persönliches um diese ganze Angelegenheit, und Ihr habt noch immer einen Verräter in Euren Mauern.« Als sie ihm nicht antwortete, stand er wieder auf. Sie küsste ihn auf die Wange, und er lächelte. Dann gab er ihr einen Becher Wein.
»Eure üblichen Kontrakte sehen wohl anders aus, Ser Ritter«, sagte sie.
»Verdammt, Mylady, das hier ist mein üblicher Kontrakt. Es ist ein Krieg zwischen rivalisierenden Baronen, aber diesmal ist es nicht möglich, mit dem gegnerischen Baron zu verhandeln, und man kann ihn auch nicht auf andere Weise von seinem Weg abbringen oder ihn einfach töten. All das sind Möglichkeiten, einem Kampf aus dem Wege zu gehen. Aber in jeder anderen Hinsicht seid Ihr und die Wildnis wie Lords, die sich um eine Grenze streiten. Ihr habt einen Teil seines Landes genommen, und dafür überfällt er Euch und bedroht Euer Heim.«
Während der Hauptmann sprach, trafen seine Offiziere allmählich ein: Tom Schlimm, Ser Milus, Ser Jehannes, Mutwill Mordling und Bent. Die anderen schliefen entweder oder waren auf Patrouille.
Für die Äbtissin wurde ein Stuhl gebracht.
»Lasst euch nieder, wo immer ihr könnt«, sagte der Hauptmann zu den Übrigen. »Ich werde versuchen, es kurz zu machen. Ich würde sagen, wir sind fast umzingelt, und unser Feind hat sich nicht die Mühe gemacht, Gräben zu ziehen und Belagerungsmaschinen aufzustellen. Aber seine Streitkräfte sind so groß, dass er die Wälder und jede Straße um uns herum sperren kann. Er hat Hinterwaller zu seiner Verfügung – für die gottlosen Ausländer unter euch: Das sind Männer und Frauen, die freiwillig in der Wildnis leben.« Der Hauptmann schenkte Ser Jehannes ein freudloses Lächeln. »Ich vermute, dass er etwa hundert oder mehr Hinterwaller hat, dazu tausend Irks und vielleicht fünfzig bis hundert andere Kreaturen, von denen wir schon einigen begegnet sind – Lindwürmer, Dämonen und dergleichen sind darunter.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich vermute, unser Feind ist ein mächtiger Magier.«
Tom Schlimm stieß einen Pfiff aus. »Ein Glück, dass wir den Angriff auf ihr Lager überlebt haben.«
Der Hauptmann nickte. »Wenn ihr schnell und planvoll vorgeht, habt ihr ein wenig Glück verdient«, sagte er. »Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir ungeheures Glück gehabt haben, diesem Überfall heil entronnen zu sein.«
»Und was jetzt?«, fragte Pampe.
»Zunächst bist du nun der Konstabler, Jehannes. Milus, du bist der Marschall. Tom, du bist die Erste Lanze. Pampe, du bist ab jetzt Korporal. Und so bin ich auf einen Schlag drei Ritter los. Milus, gibt es unter deinen Flüchtlingen ein paar fähige Jungen? Die Kaufleute vielleicht?«
Milus kratzte sich unter dem Kinn. »Als Bogenschützen? Verdammt, ja. Aber als Soldaten? Kein einziger. Allerdings kann ich Euch verraten, was sich da unten in meinem kleinen Königreich befindet: zwei Wagenladungen mit Rüstungen in Fässern und ein paar sehr hübsche Schwerter sowie ein Dutzend schwere Armbrüste. Alles war zum Verkauf auf dem Jahrmarkt vorgesehen.«
»Bessere Sachen, als wir haben?«, fragte der Hauptmann.
»Weißer Stahl – die neuen gehärteten Panzer.« Ser Milus leckte sich die Lippen. »Die Schwerter sind gut und die Speerspitzen noch besser. Die Armbrüste sind so schwer wie alles, was wir haben.«
Die Äbtissin lächelte. »Sie waren für mich bestimmt.«
Der Hauptmann nickte. »Beschlagnahmt alles. Sagt den Eigentümern, dass wir ihnen dafür Gutscheine geben, die am Ende beglichen werden, falls wir dann noch leben sollten. Wie schwer sind diese Armbrüste?«
»Die Bolzen sind unterarmlang und so dick wie das Handgelenk eines Kindes«, sagte Ser Milus.
»Befestigt sie auf Gestellen. Zwei für euch und der Rest hier oben für mich.« Der Hauptmann sah die Äbtissin an. »Ich will ein Bollwerk anlegen.«
»Wie Ihr meint«, sagte sie.
»Ich will, dass all Eure Bauern und alle Flüchtlinge mitarbeiten, und Ihr müsst mir dabei helfen, dass sie nicht frech werden. Sie sollen schnell arbeiten und folgsam sein.« Der Hauptmann zog eine Schriftrolle hervor und breitete sie aus.
»Mein Knappe ist ein begabter junger Mann, und er hat das hier gezeichnet«, sagte er. Michael errötete unwillkürlich. »Wir wollen Mauern in V-Form an beiden Seiten anlegen und Gräben vor den Mauern ausheben, dreihundert Schritte von der Brückenburg entfernt, wo die Straße von der Unterstadt den Hügel hinaufführt. Das wird es uns ermöglichen, Soldaten und Vorräte ungehindert von der Unterstadt zur Brückenburg und zurück zu schicken. Der Boden der Gräben soll mit Planken ausgelegt werden, damit die Männer schnell vorankommen, ohne gesehen zu werden, und drei Brücken werden errichtet, damit unsere Überfallkommandos schnell auf die Felder gelangen. Seht Ihr das hier? Ein netter hohler Ort unter den Planken. Gut für eine kleine Überraschung.« Er grinste, und die meisten seiner Soldaten erwiderten dieses Grinsen.
»Außerdem werden wir eine Mauer entlang der Torstraße bauen, die bis zum Hügelkamm verläuft. Das hätten wir ohnehin schon lange tun sollen. Und Türme hier und da, auf Erdbastionen.« Er rieb sich den Bart. »Zuerst bauen wir Rampen für die neuen Gestelle mit den Armbrüsten – hier und hier –, damit der Feind etliche Kämpfer verliert, falls er während unserer Bauarbeiten angreifen sollte. Und schließlich befestigen wir den Pfad vom Ausfalltor zur Unterstadt.«
Alle Soldaten nickten.
Außer Tom. Tom spuckte aus. »Wir haben aber nicht die verdammten Männer, um diese Mauern zu halten«, sagte er. »Vor allem nicht in beide Richtungen.«
»Stimmt. Aber die Errichtung der Mauern wird die Bauern ruhig und beschäftigt halten, und wenn unser Feind angreift, wird er dafür bezahlen müssen.«
Tom grinste. »Natürlich.«
Der Hauptmann wandte sich an die anderen. »Ich nehme an, unser Feind hat nicht viel Erfahrung im Kampf gegen Menschen«, sagte er. »Aber selbst wenn er sie haben sollte, haben wir aufgrund dieser Ablenkungen keine großen Verluste.«
Die Äbtissin wirkte gequält. Ihr Blick war gehetzt, und sie wandte sich ab. »Er ist ein Mensch. Das heißt, er war es einmal.«
Der Hauptmann fuhr zusammen. »Wir kämpfen gegen einen Menschen?«
Die Äbtissin nickte. »Ich habe den Druck seiner Gedanken gespürt. Er hat einen gewissen Grund, mich zu … fürchten.«
Der Hauptmann sah sie an, blickte ihr so eindringlich in die braun und blau gesprenkelten Augen wie ein Liebhaber, und nun hielten sie ihrem Blick gegenseitig stand.
»Es geht Euch nichts an«, sagte sie geziert.
»Ihr haltet Einzelheiten zurück, die für uns wichtig sein können«, warf ihr der Hauptmann vor.
»Im Gegensatz dazu seid Ihr die Offenheit in Person«, entgegnete sie.
»Nicht ganz falsch«, murmelte Tom.
Der Hauptmann sah Ser Milus an. »Wir beschränken die Patrouillen auf zwei am Tag, und wir schicken sie in unregelmäßigen Abständen auf mein Kommando los. Unser einziges Interesse besteht von jetzt an darin, weitere Karawanen hierher in Sicherheit zu bringen oder sie umzulenken. Albinkirk ist verloren. Pampe – wie weit seid ihr heute geritten?«
Sie zuckte die Achseln. »Vielleicht acht Meilen.«
Der Hauptmann nickte. »Morgen … Nein, morgen schicken wir gar keine los. Nicht einen einzigen Mann. Morgen graben wir. Und übermorgen senden wir drei Patrouillen in alle Richtungen – außer nach Westen – aus. Und den Tag danach werde ich die halbe Truppe über die Straße nach Westen führen, und zwar so schnell wie möglich. Wir nehmen uns zwanzig Meilen vor, sammeln dabei alle Kaufleute oder Handelskarawanen ein, denen wir begegnen, und werfen einen Blick auf Albinkirk. Dann kommen wir zurück und töten alles, was uns angreifen sollte.«
Tom nickte. »Ja, aber gegen hundert Hinterwaller in einem Hinterhalt können auch wir nichts ausrichten, von ein paar zusätzlichen Dämonen, Lindwürmern und vielleicht hundert Irks mal ganz abgesehen, die danach unsere Leichen fressen werden.«
Der Hauptmann verzog die Lippen. »Wenn wir in die Verteidigungsstellung gehen und uns hier verschanzen, sind wir alle tot«, sagte er. »Es sei denn, der König führt seine Armee hierher und rettet uns.«
Die Äbtissin stimmte ihm zu.
»Soweit ich weiß, sind die Festungen entlang der Mauer schon gefallen«, meinte der Hauptmann. Er kniff die Augen zusammen, als hätte dies eine besondere Bedeutung für ihn. »Wie dem auch sei, wir dürfen nicht auf Hilfe von außen warten und auch nicht hoffen, dass das hier ein einmaliger Vorfall ist. Wir müssen uns so verhalten, als hätten wir einen endlosen Vorrat an Männern und Material zur Verfügung, und außerdem müssen wir versuchen, die Straße nach Osten offen zu halten. Wir müssen den Feind in Schlachten locken, die wir selbst bestimmen.« Er sah seine Offiziere nacheinander an. »Haben das alle verstanden?« Dann begegnete sein Blick dem der Äbtissin. »Wir sollten uns jetzt bereitmachen, die Brücke zu zerstören.«
Sie nickte. »Dafür gibt es ein Phantasma. Es wird ständig überwacht. Wenn ein bestimmter Schlüssel im Schloss des Tores umgedreht wird, fällt die ganze Brücke in den Fluss.«
Die Offiziere bekundeten ihre anerkennende Zustimmung.
Der Hauptmann erhob sich. »Sehr gut. Milus, Jehannes, ihr habt den Befehl über mein Bauvorhaben. Tom, Pampe, ihr führt die Patrouillen an. Bent, du kümmerst dich um die Gestelle für die Armbrüste und bringst sie an den vier geschützten Positionen unter, die Michael eingezeichnet hat.« Er lächelte. »Bent, dir obliegen die Wachwechsel innerhalb der Festung. Mach dir dabei keine Gedanken, wer Soldat, wer Diener und wer Bogenschütze ist. Wichtig ist allein, dass die Anzahl der Männer stimmt.«
Alle nickten.
»Habt Ihr vor, ein Nickerchen zu machen?«, fragte Tom Schlimm.
Der Hauptmann lächelte die Äbtissin an. »Mylady und ich werden einen hübschen Nebel steigen lassen«, sagte er. »Sie ist ein äußerst … potenter Magus.«
Nun hatte er das Vergnügen zu sehen, wie sich ihre Augen vor Überraschung weiteten.
»Und Ihr, Hauptmann?«, fragte Jehannes vorsichtig.
»Ich bin nur ein durchschnittlich begabter Magus.« Er nickte seinem neuen Konstabler zu. »Ach, Michael, bleib bitte hier.«
Die anderen Offiziere traten zur Seite. Michael hingegen stand unbehaglich in der Tür, und nach wenigen Augenblicken waren sie nur noch zu dritt.
»Was hast du zu deinen Gunsten zu sagen?«, fragte die Äbtissin den Knappen.
Michael wand sich. »Ich liebe sie«, sagte er.
Zu seiner großen Überraschung lächelte sie.
»Unter den gegebenen Umständen war dies die beste Antwort, die du geben konntest. Wirst du sie heiraten?«, fragte sie.
Der Hauptmann gab ein schnaubendes Geräusch von sich.
Michael richtete sich auf. »Ja.«
»Du bist wahrhaft ein schneidiger junger Narr«, sagte die Äbtissin. »Wessen Sohn bist du?«
Michael kniff die Lippen zusammen. Die Äbtissin winkte ihn zu sich heran, und er trat an ihre Seite. Sie beugte sich vor, berührte seine Stirn, und es ereignete sich ein so großartiger Ausbruch von Farbe und Glitzern, als wäre ein sonnenerhellter Spiegel zersplittert.
»Towbrays Sohn«, sagte sie und lachte. »Ich kenne deinen Vater. Du siehst doppelt so gut aus wie er und bist auch doppelt so anmutig. Ist er noch immer der schwache Mann, der mit jedem Windstoß die Seiten wechselt?«
Michael blieb standhaft. »Ja, das ist er«, sagte er.
Die Äbtissin nickte. »Hauptmann, ich werde in dieser Sache nichts unternehmen, bis unser Krieg ausgestanden ist. Aber was ich jetzt sage, sage ich als Frau, die zusammen mit den Großen am Hof gelebt hat – und auch als Astrologin. Dieser Junge könnte es sehr viel schlechter getroffen haben als mit Kaitlin Lanthorn.«
Michael sah seinen Herrn an, den er mehr fürchtete als zehn Äbtissinnen. »Ich liebe sie, Mylord«, sagte er.
Der Hauptmann dachte an die Botschaft in seinem Panzerhandschuh und daran, was die Äbtissin soeben gesagt hatte. Er hatte die Macht ihrer Worte gespürt, die an eine Prophezeiung gegrenzt hatten.
»Also gut«, sagte er. »Die besten Romanzen erblühen mitten in einer zünftigen Belagerung. Michael, es wird dir nicht vergeben, aber es wird Pardon gewährt. Dieses Pardon erstreckt sich aber nicht auf weitere Herumtollereien in meinem Gemach. Ist das klar?«
Die Äbtissin sah den Knappen lange und eindringlich an. »Wirst du sie wirklich heiraten?«, fragte sie.
»Ja«, erwiderte der Knappe trotzig, verneigte sich und verließ den Raum.
Der Hauptmann grinste die Äbtissin an. »Und die Schwestern werden mit ihr gehen? Sie werden das Burgleben ganz schön durcheinanderwirbeln; daran hege ich keinen Zweifel.«
Sie zuckte die Achseln. »Er sollte sie heiraten. Ich spüre, dass es richtig ist.«
Der Hauptmann seufzte. Und er seufzte ein weiteres Mal, als er erkannte, dass niemand da war, der ihm jetzt die Rüstung abnehmen konnte.
»Sollen wir ein wenig Nebel machen?«, fragte er.
Sie streckte die Hand aus. »Nichts würde ich lieber tun.«
Lissen Carak · Tom Schlimm
Tom Schlimm starrte auf den Rücken des Hauptmanns, der in Stahl gekleidet so schimmernd wie eine Klinge wirkte, als er die Äbtissin den Korridor hinunter zur Treppe geleitete. Jehannes tat so, als wollte er an ihm vorbeigehen, und Tom streckte den Arm aus und hielt ihn auf.
Sie sahen einander finster an, und wenn sie Fangzähne gehabt hätten, dann hätten sie diese jetzt gebleckt.
»Geh es ganz ruhig an«, sagte Tom.
»Ich nehme keine Befehle von einem Jungen entgegen«, erwiderte Jehannes. »Und er ist nichts anderes als ein Junge. Ein unerfahrener Junge. Er ist kaum älter als sein Knappe. Dieser begabte junge Mann.« Er spuckte aus.
»Ganz ruhig, hab ich gesagt.« Tom sprach mit der Endgültigkeit, die Kämpfe verursachen konnte und sie manchmal auch beendete. »Du wärest niemals Hauptmann geworden. Dazu hast du weder den Verstand noch das Geld, aber vor allem hast du nicht die Abstammung. Er aber verfügt über alle drei Dinge.«
»Ich habe gehört, der Junge hätte fast die Burg verloren, weil er seine Finger nicht von einer bestimmten Nonne lassen konnte. Er hat sich mit ihr verlustiert, während du deinen Ausfall geritten hast. Das hab ich zumindest gehört.« Jehannes trat einen Schritt zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Weißt du, warum ich mich vor Lachen bepissen muss, wenn ich dich beobachte?« Tom beugte sich vor, bis seine Nase beinahe die des älteren Mannes berührte. »Wenn er seine Befehle gibt, gehorchst du wie ein dressiertes Hündchen. Und deshalb hasst du ihn. Weil er der geborene Anführer ist. Er macht das nicht erst seit Kurzem, sondern er ist der Bastard eines wichtigen Mannes, ist in einem der großen Häuser aufgewachsen, hatte die besten Lehrer, die besten Waffenmeister, die besten Bücher und außerdem fünfhundert Diener. Er kann besser Befehle geben als ich, weil ihm nie der Gedanke kommt, jemand könnte ihm nicht gehorchen. Das ist bei dir anders. Du gehorchst einfach. Und später hasst du ihn deswegen.«
»Er ist keiner von uns. Wenn er das hat, was er haben will, wird er gehen.« Jehannes sah sich um.
Tom lehnte sich wieder zurück, bis seine Schulter gegen die Steinwand stieß. »Da hast du unrecht, Jehan. Er ist einer von uns. Er ist ein gebrochener Mann, eine verlorene Seele, was für einen Unsinn du uns auch immer erzählen magst. Er hat es bewiesen, und er schätzt uns. Er …« Tom spuckte aus. »Ich mag ihn.« Dabei zuckte er die Achseln. »Er ist ein Verrückter. Er würde jederzeit auch allein kämpfen.«
Jehannes rieb sich das Kinn. »Ich habe dich verstanden.«
»Um mehr bitte ich gar nicht«, sagte Tom. Er tat nichts Offensichtliches, doch eine kaum merkliche Hüftbewegung führte dazu, dass Jehannes sich aufrichtete, im nächsten Augenblick seinen Dolch in der Hand hatte und ihn in Schulterhöhe hielt.
»Ich will ihn nicht benutzen«, sagte er. »Aber droh mir nicht, Tom Lachlan. Spar dir das für die Bogenschützen auf.«
Der Ritter drehte sich um, ging davon und steckte seinen Dolch wieder in die Scheide.
Tom sah ihm mit einem schwachen Lächeln auf den Lippen nach.
»Hast du alles mitbekommen, Michael?«, fragte er und richtete seine riesenhafte Gestalt zur vollen Größe auf.
Michael errötete.
»Das war nicht für die Ohren deines Herrn bestimmt. Hast du mich verstanden? Männer reden nun mal. Manchmal mithilfe ihres Körpers, und manchmal schwatzen sie wie alte Fischweiber. Den Hauptmann hat das nicht zu bekümmern.« Er sah Michael an, der sich in den Türrahmen drückte.
Michael hatte Angst, aber er war auch willensstark. »Ich bin sein Knappe.«
Tom rieb sich das Kinn. »Dann musst du dich entscheiden. Wenn du hörst, wie sich zwei Bogenschützen darüber unterhalten, einen dritten zu bestehlen, würdest du sie dann denunzieren?«
Michael zwang sich, ihm in die Augen zu blicken. »Ja.«
»Gut. Und wenn sie sich darüber unterhalten, eine Nonne zu vergewaltigen?«, fragte er.
Michael hielt seinem Blick stand. »Ja.«
»Gut. Und wenn sie darüber reden, wie sehr sie ihren Herrn hassen?«
Michael hielt inne. Schließlich sagte er: »Ich verstehe, was du meinst.«
»Er ist nicht ihr Freund, sondern ihr Hauptmann. Das kann er ziemlich gut, und er wird mit jedem Tag noch besser. Aber was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar?« Tom beugte sich zu ihm vor.
»Ja.« Michael wich nicht vor ihm zurück. Er versuchte aufrecht zu stehen.
Tom nickte. »Du hast Schneid, junger Michael. Versuch am Leben zu bleiben. Vielleicht können wir noch einen Soldaten aus dir machen.« Er grinste. »Dieses – dein – Mädchen ist wirklich nett. Du solltest schnell handeln, wenn du sie ganz für dich haben willst.«
Draußen auf dem Hof hatten sich ein Dutzend Bogenschützen und zwei Knappen um eine junge Frau versammelt, und sie schälten alle eifrig Mohrrüben.
Lissen Carak · Pater Henry
Der Priester beobachtete, wie die Söldner aus dem Raum ihres Anführers kamen. Der Hauptmann war die Quelle der Infektion. Sie trat vor ihm nach draußen, und der Bastard hielt ihre Hand, als ob sie Liebende wären. Vielleicht waren sie das sogar. Wenn er eine Brut des Satans war, dann würde es ihm gut anstehen, eine alte Hure zu befriedigen. Adlige. Sie waren alle gleich.
Galle stieg in seiner Kehle auf, und seine Hand zitterte ein wenig bei dem Gedanken daran, dass er … dass er …
Er senkte den Kopf, damit er sie nicht mehr ansehen musste, und widmete sich wieder der Arbeit an seiner Predigt. Aber es dauerte lange, bis seine Hände wieder ruhig geworden waren und das alte Pergament so sauber und dünn abschaben konnten, wie er es brauchte.
Und als der Größte der Söldner die Treppe herunterkam, fing er den Blick des Priesters auf und grinste.
Henry spürte, wie die Angst ihn gleich einer Welle aus kaltem und schmutzigem Wasser durchströmte. Was wusste der Mann?
Er stand von seinem Arbeitstisch auf, sobald der Riese vorbeigegangen war, und schlich durch die Kapelle zum Altar. Dort griff er unter das Tuch und vergewisserte sich, dass alles noch da war. Sein Kriegsbogen. Und seine Pfeile.
Er sackte vor Erleichterung zusammen, eilte zu seinem Arbeitstisch zurück und stellte sich vor, wie sich einer seiner Pfeile in die Lende des Riesen bohrte. Und wie er aufschrie.
Dormling · Hector Lachlan
Die schnellen Reiter hatten nichts herausgefunden, was imstande gewesen wäre, Hectors Pläne zu ändern. Er betrachtete die grobe Zeichnung des Landes und schüttelte den Kopf. »Wenn ich nach Osten ziehe, könnte ich meine Tiere genauso gut über die Berge nach Theva bringen«, sagte er. »Aber das habe ich nicht vor. Meine Kunden warten in Harndon und Harnford auf ihr Vieh. Und westlich der Berge gibt es außer der Straße keine Möglichkeit, ein paar Tausend Stück Vieh zu treiben.«
Der Wirt hatte die Nacht damit verbracht zu tanzen und sowohl sein eigenes Bier als auch abscheuliche ausländische Schnäpse zu trinken. Nun aber pochte es in seinem Kopf. »Dann wartet hier, und schickt eine Botschaft zum König«, schlug er vor.
Lachlan schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall. Ich breche beim ersten Dämmerschein auf. Was könnt Ihr mir geben, Wirt? Wie viele Männer?«
Der Wirt verzog das Gesicht. »Vielleicht zwanzig.«
»Zwanzig? Ihr habt hier hundert Schwerter, die bloß Euer Geld verschwenden und dumm herumstehen.«
Nun war es der Wirt, der den Kopf schüttelte. »Die Wildnis kommt«, sagte er. »Ich kann nicht einfach abhauen wie die anderen. Ich muss diesen Ort halten.«
»Das könnt Ihr auch mit dreißig Männern. Gebt mir den Rest.«
»Vielleicht mit dreißig, die sind wie Ihr – mit dreißig Helden also. Aber mit gewöhnlichen Männern? Nein, ich brauche mindestens sechzig.«
»Das heißt, Ihr gebt mir vierzig? Schon besser. Das ist beinahe eine Centurie. Damit habe ich genug Männer, die die beiden Enden der Herde bewachen können, und es bleiben noch einige übrig.« Lachlan warf einen weiteren Blick auf die Karte. »Wenn wir aus den Bergen herauskommen, wird es schlimmer werden. Ich brauche Pferde. Also will ich fünfzig Eurer Schwerter und zweihundert Pferde haben.«
Der Wirt lachte. »Das wollt Ihr?«
»Ja. Für ein Drittel meines Gewinns.«
Der Wirt riss die Augen auf. »Ein Drittel?«
»Vom Gewinn. In Silber, wenn ich auf meinem Heimweg wieder an Eurer Schwelle stehe.« Lachlan lächelte, als hätte er gerade einen geheimen Witz gerissen.
»Und ich bekomme nichts, wenn Ihr sterbt«, sagte der Wirt.
»Ich gestehe, dass mich meine Schulden nicht mehr sonderlich stören, wenn ich tot bin«, meinte Lachlan.
Der Wirt dachte eine Weile nach. Die große Dienerin trat ein, und der Wirt war überrascht, dass sie und Lachlan nur ein flüchtiges, höfliches Lächeln austauschten. Er war sich sicher gewesen, dass die Dunkelhaarige dem Viehtreiber gefiele.
»Ich brauche Euer Gewerbe, und Ihr seid ein wohlbekannter Mann«, sagte der Wirt. »Aber jetzt versucht Ihr, mir all meine Pferde und die Hälfte meiner Soldaten wegzunehmen und in ein verrücktes Abenteuer zu führen, das nur wenig Gewinn, dafür aber eine Menge Todesfälle verspricht.« Er rieb sich den Kopf. »Nennt mir einen Grund, warum ich Euch helfen sollte.«
Lachlan trat seine Schwertklinge zur Seite des Stuhls und lehnte sich zurück. »Wenn ich Euch sagen würde, dass ich den größten Gewinn in der Geschichte meiner Familie machen werde, wenn ich es schaffe, diese Herde nach Süden zu treiben …«, meinte er.
Der Wirt nickte. »Ja, aber …« Die fröhliche Anmaßung des Viehtreibers erzürnte ihn.
»Wenn ich sagen würde, dass dann der König in meiner Schuld steht und sich neue Märkte für mein Fleisch öffnen …«, fuhr Lachlan fort.
»Vielleicht«, sagte der Wirt.
»Und wenn ich sagen würde, dass ich in der letzten Nacht bei Eurer Jüngsten gelegen habe und sie meinen Sohn in ihrem Leib trägt und ich dies hier für ihren Brautpreis tue und dafür, zu Eurer Familie gehören zu können?«
Ruckartig richtete sich der Wirt auf; Wut legte sich über sein Gesicht.
»Werdet nicht wütend auf mich, Will Tollins. Sie ist aus freien Stücken zu mir gekommen, und ich werde sie heiraten und bis ans Ende meiner Tage glücklich mir ihr sein.« Aber Lachlan legte die Hand auf den Griff seines Schwertes.
Der Wirt sah ihm in die Augen. Da saßen sie nun, List gegen List, unbeweglich für lange Zeit.
Und dann lächelte der Wirt. »Willkommen in meiner Familie.«
Lachlan streckte eine große Hand aus, und der andere Mann ergriff sie.
»Fünfundvierzig Schwerter und alle Pferde, die ich bis morgen früh zusammentreiben kann, und dafür erhalte ich die Hälfte Eurer Gewinne – ein Viertel für mich selbst und ein Viertel als Brautpreis für Sarah. Und Ihr heiratet sie noch heute.« Er hielt die raue Hand des Viehtreibers gepackt und spürte keine Falschheit in dieser Geste.
Hector Lachlan, der Fürst der Viehtreiber, zog seine Hand zurück, spuckte hinein und streckte sie wieder aus. Will Tollins, der Wirt von Dormling, ergriff sie daraufhin abermals, und die Schenke zu Dormling erlebte eine zweite Nacht wüster Gelage.
Am nächsten Morgen führte Lachlan seine Männer und seine Herden auf die Straße in das wässerige Sonnenlicht. Jeder Mann trug ein Hemd aus glänzenden Stahlringen; jeder Ring war in einer Schmiede geschlossen worden, jedes dieser Kettenhemde saß auf einem schweren Wams aus Elchleder, das mit Schafswolle ausgepolstert worden war, und jeder Mann hatte einen schweren Bogen oder eine Armbrust oder auch ein mindestens vier Fuß langes Schwert, und manche trugen Äxte über der Schulter, die so groß waren wie sie selbst. Jeder Mann hatte einen hohen Helm mit einer Krempe, die den Regen vom Gesicht fernhielt, und einer scharfen Spitze. Sie steckten in langen Umhängen und ledernen Schaftstiefeln, die ihnen wie eine Hose bis zur Hüfte reichten. Die Männer des Vogtes hatten scharlachrote Kapuzen mit hineingewebten schwarzen Streifen, während Lachlans Männer ein verschlungenes Gewebe aus Rot und Blau und Grau trugen, das die Farbe zu ändern schien, wenn sie sich im Regen oder zwischen den Bäumen befanden. Und Sarah Lachlan stand im Hof ihres Vaters mit einer Girlande aus Frühlingsjasmin im Haar und küsste ihren Mann immer wieder, während die Flamme ihres Haares den Morgen wie eine zweite Sonne erhellte. Ihr früherer Verehrer, der Bauer, hatte sich eine große Axt über die Schulter gelegt und stand im Licht der wässerigen Sonne. Er war finster entschlossen, lieber wegzugehen und zu sterben, als ein Leben ohne sie zu führen.
Lachlan legte den Arm um ihn. »Es gibt noch andere Mädchen, mein Junge«, sagte er.
Darauf nahm Hector Lachlan sein großes Elfenbeinhorn, setzte es an die Lippen und blies hinein. Ein tiefer Ton hallte meilenweit durch das Tal bis zum Cohocton. Das Wild hob die Köpfe und lauschte, und die Bären hielten in ihrer rauschhaften Nahrungsaufnahme inne, und die Biber, die sich einen Überblick über die Schäden verschafften, die der Frühlingsregen an ihren Dämmen verursacht hatte, schauten von ihren Berechnungen auf. Und andere Wesen – geschuppt oder krallenbewehrt, braun oder grün – hoben verwundert ebenfalls die Köpfe. Der Hornschall hallte von den Bergen bis zu den Klippen.
»Ich bin Hector Lachlan, Viehtreiber aus den Grünen Bergen, und heute breche ich auf, um meine Herde nach Harndon zu treiben«, brüllte er. »Tod einem jeden, der sich mir entgegenstellt, und ein langes Leben für alle, die mir helfen!« Er blies noch einmal in sein Horn, küsste seine neue Frau, nahm ein Amulett von seinem Hals und gab es ihr.
»Wünsch mir Glück, Liebste«, sagte er.
Sie küsste ihn und schenkte ihm keine einzige Träne. Aber sie sah ihren Vater trotzig an und stellte entsetzt fest, dass er lächelte.
Hector drückte sie fest gegen seine Rüstung, dann schritt er durch das Tor. »Es geht los!«, rief er, und langsam geriet der Zug in Bewegung.
Westlich von Albinkirk · Gerald Random
Gerald Random kratzte sich zum zehnten Mal an diesem Morgen unter seiner Leinenkappe am Kopf und wünschte sich, er könnte die Karawane so lange anhalten lassen, bis er sich die Haare gewaschen hatte.
Der Magus ritt neben ihm und war im Sattel fast eingeschlafen. Random sah ihn so besitzergreifend an wie jemand, dem eine wunderschöne Frau plötzlich versprochen hatte, mit ihm zu schlafen. Es war ein ungeheurer Glücksfall, diesen Zauberer neben sich zu haben – fast wie eine Gestalt gewordene Abenteuergeschichte.
Heute Morgen hatte die Karawane einen Wagen weniger. Der Karren des Hufschmieds war schlecht abgestellt gewesen und im Regen in den Boden eingesunken. Beiden Ochsen hatte man die Kehle durchschneiden müssen. Der Hufschmied hatte keine einzige Träne darüber vergossen, und seine Werkzeuge waren auf die vierzig anderen Wagen verteilt worden. Ihm selbst war auch für die Rückreise ein Platz in einem der Wagen versprochen worden. Insgesamt war es nur ein kleiner Verlust, aber die gesamte Karawane war erschöpft, und Random dachte zum ersten Mal ernsthaft darüber nach, umzudrehen und in den Süden zurückzukehren. Er konnte es sich auf keinen Fall leisten, die ganze Karawane zu verlieren. Doch wenn sie lediglich ihr Ziel nicht erreichte, ohne dabei die Waren zu verlieren, würde ihn das höchstens zehn Jahre zurückwerfen. Wenn aber alles vernichtet wurde, dann war er ruiniert.
Und tot, du Narr, dachte er. Tote werden weder Bürgermeister noch Schulze.
Allerdings hatte er die Karawane bisher bereits erfolgreich durch einen Hinterhalt und einen offenen Kampf geführt, und in der letzten Nacht hatten die meisten ein wenig schlafen können. Er war sich ziemlich sicher, dass er mit dem Magus an seiner Seite bis zum Jahrmarkt in Lissen Carak kam.
Aber was war, wenn sie dort eintrafen und feststellen mussten, dass es keinen Markt gab? Je weiter sie nach Nordwesten kamen, desto weniger wahrscheinlich wurde es, dass der Jahrmarkt abgehalten wurde. Oder dass es dort überhaupt noch einen Konvent gab.
Andererseits wäre eine Rückkehr sowohl feige als auch gefährlich. Und der alte Magus hatte es ganz deutlich gesagt. Er wollte nach Lissen Carak gehen, nicht aber zurück und am Fluss entlang zum König.
Er kratzte sich wieder am juckenden Kopf.
Sie befanden sich sieben Meilen westlich von Albinkirk, wenn seine Schätzung stimmte. Das hieß, dass es noch etwa zwei Tage bis zur Furt des Cohocton und einen weiteren ganzen Tag weiter nach Norden bis zum Konvent dauern würde, denn schließlich mussten sie sich der Geschwindigkeit der Ochsen anpassen.
Nun war die Sonne ganz aufgegangen, und der Himmel strahlte zum ersten Mal seit drei Tagen wahrhaft blau. Die Kleidung der Männer konnte trocknen, sie wärmten sich auf, und allmählich verbreitete sich das fröhliche Geplapper einer wohlgeordneten Truppe. Die Männer aßen altbackenes Brot und tranken ein wenig Wein oder dünnes Bier, wenn es frisch war, ansonsten sprachen sie dem herben Apfelwein zu, während die Kolonne munter dahinrollte.
Die Soldaten waren allerdings nervös. Der alte Bob hatte ein Dutzend berittene Männer hundert Pferdelängen weit in den Wald geschickt, der vor der Karawane lag. Der Rest sicherte unter Guilbert das Ende und war bereit, jederzeit und in jede Richtung auszuschwärmen.
Sie hielten nicht an, um ihr Mittagsmahl einzunehmen, sondern rollten einfach weiter.
Als die Sonne am Himmel schon sank, kam der alte Bob zurück und berichtete, dass sie bald zu einer der freien Flächen kommen würden, die man für jene Karawanen angelegt hatte, die zum Jahrmarkt unterwegs waren.
»Es ist nicht gerade großartig dort«, sagte er, »aber es gibt frisches Wasser und genug Platz.«
Himbeersträucher wucherten überall auf der Lichtung, und ein kleinerer Konvoi schien vor einigen Tagen dort gelagert zu haben, hatte sich aber wohl nur am Rande der Straße aufgehalten und das Dickicht unangetastet gelassen.
Guilbert schickte seine Männer in voller Rüstung in das Himbeergestrüpp. Mit ihren Schwertern hackten sie etliche Ranken ab, die Bogenschützen banden sie zusammen und schichteten aus ihnen in den letzten drei Stunden des Tageslichts kleine Bollwerke auf, während die Jungen Wasser holten und kochten und sich die älteren Männer um die Tiere kümmerten und die Wagen im Kreis aufstellten.
Da der Abend trocken war, setzten sie den Rest der Lichtung in Brand. Das Gestrüpp stand sofort in hellen Flammen und fraß sich nach wenigen Minuten in den Saum der Bäume hinein.
Der Magus wachte auf und beobachtete, wie die Funken in den klaren Nachthimmel stiegen.
»Das war äußerst dumm«, sagte er.
Random aß gerade ein wenig Knoblauchwurst. »Warum?«, fragte er. »Wir bereinigen das Feld, damit wir im Notfall besser schießen können. So gibt es keine Verstecke mehr für die kleinen Kobolde und die spinnenartigen Irks.«
»Der Ruf des Feuers ist so stark wie der eines Namens«, sagte der alte Magus. »Das Feuer ist der Fluch der Wildnis.« Dabei sah er den Kaufmann finster und bedeutungsschwer an.
Aber Random hatte solche Blicke schon sein ganzes Leben hindurch ertragen müssen. »Die Karawane ist sicherer, wenn das Gelände um sie herum sauber ist«, sagte er wie ein wütender Junge.
»Nicht wenn sechs Lindwürmer herkommen. Nicht wenn ein Dutzend goldene Bären zu der Auffassung gelangen, dass Ihr in ihr Gebiet eingedrungen seid. Nicht wenn einige Dämonen beschließen sollten, dass Ihr das Waldrecht gebrochen habt. Dann wird Euch auch Euer sauberes Gelände nicht retten.« Doch er schien aufzugeben. »Außerdem haben die Irks nichts mit Spinnen zu tun. Sie gehören zur Elfenwelt. Wo ist mein Patient?«
»Der junge Ritter? Er schläft tief und fest. Manchmal wacht er auf, redet mit sich selbst und schläft wieder ein.«
»Das ist auch das Beste für ihn«, sagte Harmodius. Er schritt den Wagenkreis ab, fand seinen Mann und betrachtete ihn.
Nach einem langen Blick zog Harmodius sein Laken zurück, und der junge Mann öffnete die Augen.
»Ihr hättet mich einfach leben lassen sollen«, sagte er und sah gequält drein. »Süßer Jesus, ich meine, Ihr hättet mich sterben lassen sollen.«
»Nie höre ich Dank«, meinte der Magus.
»Ich bin Gawin Murien«, erwiderte er und stöhnte. »Was habt Ihr mit mir gemacht?«
»Ich weiß, wer Ihr seid«, erwiderte der Magus. »Jetzt können sie Euch mit Fug und Recht Ledernacken nennen.«
Keiner von beiden lachte.
»Ich weiß wirklich nicht, was ich mit Euch gemacht habe. Ich werde versuchen, es während der nächsten Tage herauszufinden. Grübelt deswegen nicht allzu sehr.«
»Ihr meint, ich soll mir keine Gedanken machen, weil ich mich langsam in einen verdammten und verfluchten Feind der Menschheit verwandle, der am Ende versuchen wird, all seine Freunde zu töten und aufzufressen?«, fragte Gawin. Er bemühte sich, ruhig zu sprechen, doch in seiner Stimme lag Panik.
»Ihr habt eine lebhafte Fantasie«, sagte Harmodius.
»Das höre ich andauernd.« Gawin betrachtete seinen Oberarm und zuckte vor Grauen zurück. »Gütiger Gott, ich habe Schuppen! Das war gar kein Traum!« Plötzlich war seine Stimme laut geworden, und er kniff die Augen zusammen. »Beim heiligen Georg – Mylord, muss ich Euch darum bitten, mich zu töten?« Sein Blick schweifte in die Ferne. »Ich war so schön«, sagte er mit ganz veränderter Stimme.
Harmodius verzog das Gesicht. »Das klingt sehr dramatisch. Ich habe die Macht, die Euch geheilt hat, irgendwo aus der Wildnis geholt.« Er zuckte die Achseln. »Ich hatte zwar nicht die vollständige Kontrolle über diese Macht, aber das war gleichgültig. Ohne sie wäret Ihr gestorben. Und welcher Meinung Ihr jetzt auch immer sein mögt: Der Tod wäre nicht besser gewesen!«
Der junge Ritter rollte zur Seite und schloss die Augen. »Als ob Ihr das wissen könntet! Geht fort und lasst mich schlafen. O gesegnete Jungfrau, bin ich jetzt dazu verdammt, ein Ungeheuer zu werden?«
»Das bezweifle ich sehr«, sagte Harmodius, obwohl er wusste, dass dies nicht besonders beruhigend klang.
»Bitte lasst mich allein«, beharrte der Ritter.
»Also gut. Aber ich werde wiederkommen und nach Euch sehen.« Harmodius streckte die Fühler seiner Macht aus und zuckte unter dem zurück, was er fand. Gawin hatte seine Reaktion bemerkt.
»Was geschieht mit mir?«
Harmodius schüttelte den Kopf. »Nichts«, log er.
Eine Stunde nach Sonnenuntergang griff der Feind an. Aus der Dunkelheit schwirrten Pfeile herbei, und zwei Gildenmänner, die Wache geschoben hatten, fielen – der eine still, der andere mit den panischen Schreien eines Mannes, der große Schmerzen litt.
Guilbert ließ die Wagen anspannen und bemannen; nach hundert Herzschlägen war es geschehen. Das war auch gut so, denn plötzlich ergoss sich eine Woge von Kobolden, angekündigt durch ein unheimliches Rascheln, auf die Nordseite der Lichtung, auf der sich die Wagen befanden.
Aber Guilbert war ein alter Soldat, und sein Dutzend Bogenschützen feuerte brennende Pfeile in die aufgeschichteten Bündel aus Gestrüpp. Die meisten loderten sogleich hell auf. Im flackernden Schein dieser Brände machten sich die Gildenmänner und Soldaten ans Töten. Nachdem die Kobolde das Gestrüpp überwunden hatten, gelang es ihnen nicht, die großen Wagen zu erklettern. Bei dem Versuch starben sie zu Dutzenden.
Aber die roten Pfeile, die wie bösartige Libellen über die Feuer flogen, störten die Verteidiger doch sehr. Zwar besaßen diese Pfeile nicht die Kraft, eine gute Rüstung zu durchschlagen, und die Steinköpfe splitterten schnell, aber sie bohrten sich tief in ungeschütztes Fleisch, und all jene, die getroffen wurden, bekamen innerhalb von einer Stunde Fieber, auch wenn sie nur einen Kratzer an der Hand davongetragen hatten.
Harmodius ging von Mann zu Mann und zog das Gift durch seine Zauberei heraus. Er hatte einen ganzen Tag gehabt, an dem er sich ausruhen und die Macht in sich sammeln konnte, und nun war er voller Sonnenlicht; seine Kraft war zurückgekehrt, seine Amulette waren aufgeladen – nur seine beiden Zauberstäbe nicht, die dazu noch mehr Zeit, Aufmerksamkeit und Kraft benötigten.
Als die Feuer heruntergebrannt waren, warf er ein mächtiges Lichtphantasma über einen Baum, der am Rande des Himbeerdickichts stand. Er wiederholte diesen Vorgang sechsmal an verschiedenen anderen Stellen um die Wagenburg herum, damit die Angreifer deutlicher zu sehen waren und ihre Bogenschützen geblendet wurden. Aber der hermetische Aufwand war ungeheuer, und überdies schrie er damit seine Macht in die Welt hinaus.
Als sein sechstes Licht allmählich schwand und die tödlichen, wespenartigen Pfeile wieder flogen, spürte Harmodius die Gegenwart eines mächtigen Feindes. Eines Beherrschers der Kunst.
Eines anderen Magus.
Es gab einen Augenblick der Warnung – möglicherweise, als der andere einen Verteidigungszauber wirkte.
Harmodius tat es ihm gleich. Dann schob er sein Amulett wie ein Mann, der mit Schwert und Schild kämpft, über das offene Gelände zwischen sich und der anderen Kraftquelle. Wenn er sein Amulett dicht an den Körper hielt, konnte es nur ihn allein bedecken und beschützen. Aber je näher es dem anderen Magus kam, desto eher war es auch in der Lage, die ganze Karawane unter seinen Schild zu nehmen.
Das war eine einfache mathematische Übung, die die meisten Anwender der Magie nie erlernten.
Es kostete ein klein wenig mehr Energie, den Schutzzauber dort drüben aufrechtzuerhalten.
Energie explodierte an seinem magischen Schild und wurde abgeleitet. Irks und Kobolde starben unter dem Ansturm von Phantasmata, die eigentlich für sie hätten arbeiten sollen.
Harmodius lächelte böse. Wer auch immer dort draußen sein mochte, er hatte eine gewaltige, grobe Macht und nur sehr wenig Erfahrung im Umgang mit ihr.
In seiner Jugend war Harmodius ein guter Schwertkämpfer gewesen. Und der hermetische Kampf hatte große Ähnlichkeit mit einem Schwertkampf. Harmodius hatte schon immer einen Traktat darüber schreiben wollen.
Als sich sein Widersacher auf einen weiteren Angriff vorbereitete, schoss Harmodius durch den layrinthischen Palast seiner Erinnerung und holte Amulette und Schutzzauber mit einer nie dagewesenen Schnelligkeit hervor.
Der nächste Angriff des Feindes erfolgte mit größerer Kraft; es war ein titanisches, wütendes Aufwallen der Macht, die als ein unheimlicher grüner Streifen durch die Nacht schoss.
Sein erster Schutz wurde überwunden. Der Feind hatte die Richtung geändert, da er die Kraft von Harmodius’ Vorwärtsverteidigung erkannt hatte.
Der zweite Schutz jedoch fing den Angriff ab, lenkte ihn auf den dritten Schutz, der ihn weitergab – und zwar zurück an den Feind, der nun von seinem eigenen Phantasma getroffen wurde.
Seine Schutzmagie flackerte in einem tiefen Blaugrün – und Harmodius schlug zu. Im Tempo der feindlichen Angriffe schoss er eine Linie aus hellem, engelgleichem Weiß ab – eine Linie, die wie eine Lanze war und seinen Zeigefinger mit den Schutzzaubern des Gegners verband. Dies kostete Harmodius fast keine Kraft, aber sein Gegner, der sich an der falschen Stelle geschützt hatte, musste nun seine ganzen Reserven aufbrauchen, um …
… gar nichts abzuwehren. Der Lichtstrahl war nicht mehr als dies. Es war keine Kraft dahinter.
Wie ein Fechtmeister, der einen eleganten, tödlichen Stich versetzen wollte, zog Harmodius Macht für seinen Angriff zusammen und schleuderte sie – dies alles geschah während des Zehntteils eines einzigen Herzschlages, den ein entsetzter Gildenmann tat. Als der Stoß geführt wurde – über den ersten Schutz hinweg, unter dem zweiten sich duckend und durch die geschwächte Energie des dritten hindurch –, spürte Harmodius, wie sein Gegner zusammenbrach. Er konnte spüren, wie der andere die Erfahrung der Niederlage machte.
Ohne es zu wollen, streckte er seine Fühler aus und ergriff etwas. Genauso hatte er es gemacht, als er die Macht in sich eingesogen hatte, mit der er den jungen Ritter gerettet hatte. Doch diesmal packte er das Innerste des feindlichen Zauberers viel schneller und fester.
Die Macht seines Gegners wurde wie eine Kerze gelöscht.
Harmodius holte tief Luft und erkannte, dass er nun viel mächtiger als zu Beginn dieser Nacht war.
Ohne jeden Widerstand entzündete er ein siebtes Licht.
Die Irks wichen ins Unterholz zurück, und der Rest der Nacht kroch so langsam dahin wie nie zuvor, doch wenigstens erfolgten keine weiteren Angriffe.
Westlich von Albinkirk · Gerald Random
Eine Pferdelänge von dem Magus entfernt stand Random beim alten Bob. Der letzte Austausch der Phantasmata war unglaublich schnell erfolgt. Random hatte ihn beobachtet.
In der Ferne schrie etwas auf.
Ein grausames Lächeln spielte um Harmodius’ Lippen.
Random warf dem alten Bob, der ihn nun ansah, einen raschen Blick zu. »Das war …«
Der alte Bob schüttelte den Kopf. »Sagenhaft«, sagte er.
Am Morgen musste sich die Karawane der Wahrheit stellen. Die zerschmetterten Leichen von hundert Kobolden lagen zwischen den Wagen. Niemand konnte mehr verleugnen, wogegen sie gekämpft hatten. Einige Männer übergaben sich. Alle bekreuzigten sich und beteten.
Random näherte sich dem Magus, der mit überkreuzten Beinen auf dem Boden saß und die aufgehende Sonne begrüßte, indem er die Arme verschränkt in den Schoß gelegt hatte.
»Darf ich Euch stören?«, fragte Random.
»Ich wünschte, Ihr würdet es nicht tun«, brummte der Magus.
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Random, »aber ich brauche Informationen.«
Ruckartig öffnete der Magus die Augen. »Falls Ihr mich nicht in Ruhe lasst, werde ich weniger Pfeile im Köcher haben, wenn sie wiederkommen«, sagte er.
Random verneigte sich. »Ich glaube, wir sollten jetzt umdrehen und zurückgehen.«
Der Magus runzelte die Stirn. »Tut, was Ihr tun müsst, Kaufmann. Aber lasst mich in Ruhe!«
Random schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich denn nicht zurückgehen?«
Harmodius’ Stimme klang ungehalten. »Woher soll ich das wissen, Geld raffende Laus? Macht doch, was Ihr wollt. Aber lasst mich in Ruhe!«
Der alte Bob saß schon wieder im Sattel, und Guilbert stand neben seinem Pferd, über dessen Rücken ein seltsam geschwungener Bogen lag. Heute würde er an der Spitze reiten.
Der alte Bob deutete auf Messire Random. »Also?«, fragte er.
»Wir fahren weiter nach Lissen Carak«, sagte Random.
Der alte Bob rollte mit den Augen. »Verdammt, warum denn das?«
Random schaute auf den Magier zurück und zuckte mit den Schultern. »Er hat mich wütend gemacht«, sagte Random mit entwaffnender Ehrlichkeit.
Der alte Bob betrachtete den Haufen toter Kobolde. »Habt Ihr schon einmal gegen sie gekämpft?«, fragte er.
Random nickte.
»Alle sollen zu diesem Haufen geführt werden und die Leichen ansehen«, empfahl der alte Bob. »Aber vorsichtig. Bei Tageslicht. Jeder soll sie berühren. Jeder soll sehen, wo ihre Schwächen liegen.« Er zuckte die Schultern. »Das wird helfen.«
Das wäre Random nie in den Sinn gekommen. Aber es war ein guter Rat, und so befahl er dessen Durchführung und sah zu, wie der alte Bob eine der Leichen von dem Haufen zerrte.
Die Gildenmänner zuckten zusammen, als er die Leiche auf den Boden warf.
»Habt keine Angst, Jungs«, sagte der alte Bob. »Dieses Wesen ist tot.«
»Verdammte Kakerlake«, meinte einer der Scherenschleifer.
»Keine Kakerlaken. Eher …« Der alte Bob zuckte mit den Schultern. »Frag den Magus, ob er dir sagt, was sie in Wirklichkeit sind. Aber sieh dir dieses Vieh an. Sie haben weiche Teile und auch harte. Hart sind sie an der Brust und weich wie Käse unter den Armen.« Zum Beweis zog er seinen Dolch und rammte ihn ohne die geringste Mühe dort in die schmutzig braune Haut, wo sie wie eine Membrane aus der Chitinpanzerung des Torsos hervorkam. Eine grün-schwarze Flüssigkeit quoll hervor und bedeckte seine Klinge.
»Ein kräftiger Stoß ist immer tödlich«, sagte der alte Bob und rammte seinen Dolch durch die harte Schale des Wesens. Sofort erfüllte ein abscheulicher, fauliger Gestank die Luft. Einer der Salzsieder musste sich übergeben.
Der alte Bob trat zu ihm hinüber und versetzte ihm einen Tritt. »Das kannst du machen, wenn du kämpfst und bevor du stirbst. Klar? Sieh es dir an. Sieh es dir an!« Er drehte sich um und betrachtete die verblüfften Lehrlinge. »Jeder berührt es. Nehmt sie euch von dem Haufen, und stecht sie mit euren Schwertern ab. Na los!«
Als Guilbert zum vorderen Ende der Karawane ritt, murmelte er Harold Rotbein so laut zu, dass auch andere es hören konnten: »Nur weil ihn der alte Magus verrückt gemacht hat? Das ergibt doch keinen Sinn.«
Auch für Random ergab es keinen Sinn.
Aber nachdem sie sich wieder seit einer Stunde auf der Straße befanden, ritt Harmodius neben den Kaufmann und verneigte sich im Sattel.
»Ich bitte für den Fall um Entschuldigung, dass ich zu barsch gewesen sein sollte«. sagte er, »aber der Sonnenaufgang ist ein sehr wichtiger Augenblick.«
Random lachte. »Barsch?«, meinte er. Es war ein wunderbarer Tag, die Wälder waren grün, und er kommandierte die größte Karawane seines Lebens.
Und er ritt neben einer lebenden Legende in den Krieg.
Dann lachte er wieder, und nun stimmte auch der alte Magus in sein Lachen ein.
Dreißig Wagen hinter ihm hörte der alte Bob ihr Gelächter und rollte mit den Augen.
Nördlich von Albinkirk · Peter
Die Sossag hatten fast ihre ganze Streitmacht versammelt und nach Süden über den Wall geführt. Das sagte Ota Qwan mindestens zehnmal am Tag, und am zweiten Tag im Lager sah Peter tatsächlich die Krieger der Sossag, die sich auf einer großen Lichtung südlich des Lagers versammelt hatten. Er hörte mit dem Zählen auf, als er mehrere Hundert erreicht hatte, aber es mussten mindestens tausend bemalte Krieger und dazu noch einige Hundert unbemalte Männer und Frauen sein. Inzwischen hatte er erfahren, dass die Bemalung eine Bereitschaft zum Sterben im Kampf ausdrückte. Unbemalte konnten kämpfen – oder auch nicht –, sofern andere Dinge für sie wichtiger waren, wie zum Beispiel eine neue Frau oder neue Kinder.
Auch hatte Peter gelernt, dass die Sossag an den Kochkünsten nicht sonderlich interessiert waren. Er hatte versucht, bei ihnen eine gewisse Stellung zu erlangen, indem er sich mit Kupfertopf und Bratpfanne abgab, aber sein Rindereintopf mit gestohlenem Wein wurde von der Gruppe, mit der er nun reiste, laut und rasch verzehrt, ohne dass ein Lob für ihn dabei abgefallen wäre. Sie nannten sich die Sechsfluss-Sossag oder auch die Assegatossag, also »jene, die dorthin gehen, wo der Kürbis verrottet«, wie ihm Ota Qwan erklärt hatte.
Sie aßen und machten sich wieder an die Arbeit. Niemand dankte ihm oder sagte ihm, dass es ein feines Mahl gewesen sei.
Als er sich darüber beschwerte, lachte Ota Qwan. »Das war doch nur Nahrung«, sagte er. »Die Sossag sind keine Feinschmecker, und wir alle wissen, was Hunger ist. Dein Essen ist sehr gut gewesen, weil genug für alle da war.«
Peter schüttelte den Kopf.
Ota Qwan nickte. »Bevor ich zu Ota Qwan wurde, wusste ich, wie man kocht und wie man gut isst.« Er lachte. »Jetzt verstehe ich viele Dinge, aber nichts davon bezieht sich auf guten Wein oder knuspriges Brot.«
Peter ließ den Kopf hängen, und Ota Qwan klopfte ihm auf den Rücken.
»Du wirst dir deinen Platz schon noch erobern. Alle sagen, dass du hart arbeiten kannst. Und das ist genau das, was die Leute von einem Neuen erwarten.«
Peter nickte.
Doch am zweiten Abend machte er sich viele neue Freunde. Das Essen hatte aus einer einfachen Suppe mit einigen Gewürzen und Hirschfleisch bestanden, das Ota Qwan beigesteuert hatte. Eines der Reptilienungeheuer war herbeigekommen, hatte an dem Hirschkadaver geschnuppert und seltsame schreiende Laute ausgestoßen, bis Skadai herbeigelaufen kam.
Peter hatte zwar Angst gehabt, aber das Wesen hatte sie in Ruhe gelassen, das Hirschfleisch war in die Suppe gewandert, und alles war gut gewesen.
Als die Suppe verteilt wurde, kamen zwei Kobolde aus dem Wald. Sie waren schlank, ohne dürr zu sein. Wenn sie aufrecht standen, erreichten sie nur die Größe eines Kindes, und ihre Köpfe glichen eher denen von Insekten. Die Haut war straff über die leichten Knochen gespannt, und der Körper hatte einen knollenartigen, gepanzerten Torso und vier Auswüchse, die stark an die Gliedmaßen von Säugetieren erinnerten. Die Beine waren dünn und muskulös und die Arme so fest wie eine Peitsche. Sie waren ganz scheußlich, und ihr Anblick kam einem Albtraum gleich. Sie gaben sich nicht oft mit den Sossag ab, auch wenn Peter schon einmal gesehen hatte, wie Skadai mit einer Gruppe von ihnen gesprochen hatte.
Es schien drei Arten von ihnen zu geben. Die am häufigsten vorkommende war rotbraun und bewegte sich sehr schnell; die zweite Gruppe bestand offensichtlich aus Kriegern, die eine noch schwerer gepanzerte Schale und blassere, beinahe silberne Haut besaßen. Die Krieger waren fast so groß wie die Menschen, und jeder Auswuchs hatte an seinem Ende einen Stachel. Die Sossag benutzen den albischen Namen für sie: Wichte.
Und schließlich gab es das, was die herrschende Klasse darzustellen schien. Sie waren so lang und dünn wie große Gottesanbeterinnen. Die Sossag nannten sie Priester.
Diese beiden Kreaturen hier waren einfache Arbeiter. Jeder trug einen Bogen und einen Speer, und sie waren bis auf eine Feldflasche und einen Köcher nackt. Peter versuchte, das fließende Gleiten von Platte auf Platte an ihrem Unterbauch nicht anzustarren. Es war verwirrend.
Sie blieben bei seinem Feuer stehen. Beide drehten gemeinsam den Kopf; ihre seltsamen, mandelförmigen Augen nahmen das Feuer und den Mann gleichzeitig auf.
»Guk es?«, fragte der Nähere der beiden. Seine Stimme klang kratzig; es war beinahe ein Kreischen.
Peter versuchte seine Angst zu überwinden. »Ich verstehe nicht«, sagte er.
»U guk es?«, fragte der andere. »Gud es?«
Der Erste schüttelte Kopf und Unterleib. Es war eine sehr fremdartige Bewegung, aber Peter begriff, dass sie Ungeduld ausdrückte. »Schwill ess«, kreischte er.
Peter verstand ihre Schreie noch immer nicht, aber die ausgestreckte Klauenhand schien auf seinen Suppentopf zu deuten.
Keiner der Sossag stand auf und kam ihm zu Hilfe. Wie gewöhnlich hatten sie sich vollgestopft und lagen nun fast reglos auf dem Boden, auch wenn jeder Einzelne ihn beobachtete. Ota Qwan lächelte – es war ein hartes, grausames Lächeln.
Peter drehte den Kreaturen den Rücken zu und löffelte ein wenig Suppe in eine Schüssel. Er tat eine Idee wilden Oregano hinzu und gab sie dem ersten der beiden Ungeheuer.
Dieses ergriff die Schüssel, und Peter beobachtete, wie es daran roch. Er wünschte, er wäre nicht so neugierig gewesen. Als er zusah, wie sich die nicht ganz menschliche Nase des Wesens teilte und ein Loch enthüllte, das von stachligen Haaren eingerahmt wurde …
Das Wesen machte ein lautes, kratzendes Geräusch mit zweien seiner Arme und schüttete den ganzen Inhalt der Schüssel in das Loch in seinem Kopf.
Dann warf es den Kopf in einem unnatürlichen Winkel nach hinten und kreischte.
Und dann streckte es die Schüssel aus und wollte einen Nachschlag haben.
Peter füllte zwei weitere Schüsseln, tat Oregano in beide und gab jedem Kobold eine.
Der gesamte Prozess wurde wiederholt.
Der kleinere der beiden Kobolde öffnete und schloss seinen Schnabelmund drei- oder viermal und gab dabei einen chemischen Gestank von sich, bei dem sich Peter der Magen umdrehte.
»Ess gud«, zwitscherte der Kobold.
Lange, biegsame Zungen aus abscheulichem Rosa und Purpur tasteten sich aus ihren Mündern und leckten die Schüsseln leer.
Gemeinsam gaben sie noch einen langen, kratzenden Laut von sich, dann rannten sie leicht vornübergebeugt davon.
Peter stand mit zwei leeren Suppenschüsseln vor seinem Feuer. Er zitterte ein wenig.
Skadai kam herbei. »Du bist geehrt worden«, sagte er. »Sie nehmen uns nur selten wahr.« Er wirkte, als wolle er noch etwas sagen, aber dann schürzte er die Lippen, klopfte Peter auf die Schulter, lächelte und stolzierte davon, wie es seine Art war.
Peter versuchte noch immer herauszufinden, was er von diesem Vorfall halten sollte, als eine der Frauen zu ihm kam und ihm die Hand auf den unteren Teil des Rückens legte.
Diese Hand knapp oberhalb seines Hinterns diente der Verständigung und übermittelte ihm einen wahren Schatz an Informationen, was er niemals für möglich gehalten hätte. Sie besagte so viel, dass er eine Stunde später zwischen ihren Beinen lag … und nur wenige Augenblicke danach trat ihm ein anderer Mann gegen den Kopf.
Ein solcher Tritt hätte ihn töten können, aber der bemalte Mann war barfuß, und Peter hatte eine kurze Vorwarnung erhalten. Obwohl er ein Sklave und ein Koch gewesen war, hatte er doch vorher eine Ausbildung im Kriegshandwerk genossen. Als der Tritt ihm den Kopf herumwarf, riss er sich von der Umarmung der dunkelhaarigen Frau los und griff auch schon nach dem Messer, das er um den Hals trug.
Der bemalte Mann hatte wohl vermutet, dass er eine leichte Beute sein würde. Er kreischte auf, vielleicht vor Wut, und griff erneut an. Peter war unter der Macht des Tritts auf den Rücken gerollt und hielt sein Messer in der Hand. Als der bemalte Mann – sein Rot, Schwarz und Weiß war mit Flecken durchmischt, die nach einer Hautkrankheit aussahen – ihn wieder ansprang, tötete ihn Peter mit großer Leichtigkeit. Er rammte dem Mann seinen Dolch tief in den Bauch. Der andere schrie vor Entsetzen und Verzweiflung und riss die Augen auf.
Peter führte das Messer nach oben und schnitt ihm den Bauch auf; seine Eingeweide quollen heraus, und Peter war ganz und gar mit dem Blut des Mannes bedeckt.
Dann stach er in die Augen des Mannes – erst in das eine und dann in das andere.
Nun war der fleckige Mann tot.
Peter sackte zu Boden und blieb einen Moment lang liegen. Jeder der letzten hundert Herzschläge war ihm ebenso bewusst wie ein offenes Buch, das er sorgfältig las, und die Reste seiner Erektion erinnerten ihn daran, dass er in dieser kurzen Zeit von einem Lebensextrem in ein anderes gefallen war.
Er versuchte aufzustehen, aber seine Knie zitterten, und überall um ihn herum standen Männer.
Sossag-Männer.
Skadai streckte die Hand aus und zog ihn mit einer Kraft auf die Beine, die bedrohlich wirkte. Aber sie war es nicht.
Dann kam auch Ota Qwan und hielt ihn fest, damit er nicht umfiel.
»Mach den Mund auf«, sagte er.
Peter gehorchte. Skadai steckte ihm einen Finger in den Mund, der in das Blut des Getöteten getaucht war, und begann mit einem Gesang. Ota Qwan packte ihn am Arm. »Es ist wichtig«, sagte er. »Hör mir zu. Skadai sagt: ›Nimm deinen Feind – Grundag – in deinem Körper auf.‹« Ota Qwan drückte abermals zu. »Skadai sagt: ›Nun sind du und Grundag eins. Was du warst, ist er. Was er war, bist du.‹«
Peter wollte sich beim Geschmack des kupferigen warmen Blutes in seinem Mund übergeben.
»Mach es dir bloß nicht zur Gewohnheit, Sossag zu töten«, sagte Ota Qwan.
»Er hat mich angegriffen!«, schrie Peter.
»Du hast mit seiner Frau geschlafen, die dich nur dazu benutzt hat, einen minderwertigen Mann loszuwerden. Sie hat ihm die Scham erspart, von ihrem Laken weggeschickt zu werden, indem sie es so eingerichtet hat, dass du ihn tötest. Klar?« Ota Qwan drehte sich zu einer Gruppe der bemalten Männer um und sagte etwas. Alle lachten.
Peter spuckte aus. »Was ist daran so komisch?«
Ota Qwan schüttelte den Kopf. »Das ist unser Humor. Du wirst es später auch verstehen.«
»Sag es mir jetzt.«
»Sie haben gefragt, wie du warst. Ich habe ihnen gesagt, du wärest dir nicht sicher gewesen, ob dein Schwanz oder dein Messer eingedrungen ist.« Ota Qwans Augen waren von hellem Blau, und der Mann war eindeutig belustigt. »Du bist jetzt ein Mann und ein Sossag. Deine eigenen Leute zu töten sollte dir nicht zur Gewohnheit werden, aber nun hast du die Wildnis kennengelernt.«
Peter spuckte noch einmal. »Alle kämpfen gegen alle«, sagte er. Sein ganzes junges Leben hindurch war er zum Töten ausgebildet worden, und sein erstes Versagen in dieser Disziplin hatte ihn zum Sklaven gemacht. Aber dieser plötzliche Erfolg jetzt fühlte sich eher wie eine Vergewaltigung als wie ein Sieg an. Er war mit Blut und Schlimmerem bedeckt, und dennoch beglückwünschten ihn diese Männer. »Es gibt kein Gesetz.«
Ota Qwan schüttelte den Kopf. »Sei nicht dumm«, sagte er. »Es gibt sogar viele Gesetze. Aber das wichtigste von ihnen lautet, dass der Stärkste der Stärkste ist. Und jedes Wesen, gleichgültig ob stark oder schwach, gibt eine gute Mahlzeit ab.« Er lachte. »Es ist nicht anders als am Hof des Königs. Aber hier ist es ehrlich und aufrichtig, denn niemand lügt. Skadai ist schneller und gefährlicher, als ich es je sein werde. Daher werde ich ihn niemals herausfordern. Aber ein anderer Mann – oder auch eine Frau – könnte es tun, und dann würden die Matronen die Art des Kampfes festlegen, und der Herausforderer muss sich Skadai stellen – oder ihn vielleicht nur angreifen, aber diese Art von Sieg führt nicht immer dazu, dass der Stärkere die Macht und das Ansehen erlangt, die er sich wünscht. Verstehst du, was ich sage?«
»Nur allzu gut«, meinte Peter. »Ich will mich waschen.« Peter wollte sich von den Resten des Mannes und seiner Farbe befreien – und auch von seiner Aura der Gewalt.
»Ich sage dir das, weil dich die anderen Krieger jetzt als Mann betrachten, und du könntest von ihnen herausgefordert werden. Oder du wirst einfach nur umgebracht. Bisher habe ich dich beschützt.« Ota Qwan zuckte mit den Schultern.
»Warum sollte mich jemand umbringen wollen?«, fragte Peter.
»Um die Zahl der Männer zu erhöhen, die derjenige bereits getötet hat. Oder um Senegral, die jetzt deine Frau ist, für sich zu beanspruchen. Wer weiß?« Er lachte. »Grundag ist schnell gestorben, weil er dachte, dass du nur ein Sklave bist. Er war kein starker Mann, aber er war ein Kämpfer, und seine Dummheit hat dafür gesorgt, dass einige Männer Angst vor ihm hatten. Vor dir haben sie jedoch keine Angst, auch wenn es sehr beeindruckend war, wie du ihm den Bauch aufgeschlitzt und die Augen ausgestochen hast. Aber viele Männer wollen Senegral besitzen, und sie sagt nicht gern nein.«
Inzwischen hatte Peter den Fluss erreicht, und trotz des kalten Wassers und der scharfkantigen Felsen warf er sich in die Untiefe, in der die Männer für gewöhnlich ihre Becher ausspülten. Er achtete nicht auf die vom Wasser aufgequollenen Überreste des Getreides, das aus hundert Schalen gewaschen worden war. Und auch die Egel waren ihm gleichgültig. Er wollte nur das klebrige Blut und die Innereien von Händen, Bauch und Lenden waschen.
Aus dem Wasser heraus sagte er: »Vielleicht sollte ich Senegral töten.«
Ota Qwan lachte. »Eine elegante Lösung, aber dann würden ihre Brüder und Schwestern sicherlich dich töten.«
Das Wasser weckte sein Hirn und fror seine Haut ein. Er steckte den Kopf unter Wasser, kam rasch wieder an die Oberfläche, und seine Füße schmerzten von dem Versuch, auf den spitzen Steinen das Gleichgewicht zu halten. »Was kann ich denn tun?«, fragte er.
»Bemal dich!«, rief Ota Qwan. »Als Krieger auf einer Mission bist du von einer solchen Behandlung ausgenommen, es sei denn, du stachelst zu ihr an. Menschen sind nicht so flink wie andere Tiere, nicht so todbringend im Kampf, ihre Glieder sind nicht so geschmeidig, und sie haben auch keine Krallen. Aber im Rudel sind wir die gefährlichsten Tiere der Wildnis, und wenn wir uns bemalen, stellen wir ein Rudel dar. Hast du das verstanden?«
Peter schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Aber ich werde mich bemalen, auch wenn mich das verpflichtet, Krieg gegen Menschen zu führen, die ich nicht kenne, nur um zu Hause ein wenig Frieden zu bekommen.« Er lachte, was seltsam und wild und auch etwas verrückt klang. »Aber sie haben mich versklavt, und deswegen müssen sie nun die Suppe auslöffeln.«
Ota Qwan nickte. »Von dem Augenblick an, wo ich dir begegnet bin, wusste ich, dass du einer von uns sein würdest«, sagte er. »Verachte uns nicht. Wir tun das Gleiche wie andere Menschen, wir bezeichnen es bloß nicht so nett. Wir führen jetzt Krieg, um Thorn zu unterstützen, aber gleichzeitig werden dabei all die anderen tödlichen Wesen und Raubtiere unsere Stärke sehen und uns deshalb in Ruhe lassen. Sie werden uns fürchten. Und dann können wir in Ruhe nach Hause gehen und Kürbisse ziehen. Es geht uns nicht immer nur um Krieg und Messer in der Finsternis.«
Peter seufzte. »Hoffentlich nicht.«
»Du musst dich schon sehr bald bemalen, glaube ich«, sagte Ota Qwan. »Und du brauchst einen Namen. Ich werde jemanden beauftragen, dir einen zu geben.«
Er streckte Peter die Hand entgegen und half ihm aus dem Fluss, dann brachte er ihn zu einem Feuer und entfernte dort die Horde von Blutegeln, die sich an dem früheren Koch festgesaugt hatten. In früheren Zeiten hätten ihn diese Egel entsetzt, aber nun ertrug Peter ihre Entfernung mit Gleichmut und sah nicht einmal hin, was ihm ein anerkennendes Grunzen von einem der älteren Männer einbrachte.
Dann sprach Ota Qwan, und alle Männer sowie einige Frauen versteiften sich und schenkten ihm die größte Aufmerksamkeit. Danach gingen sie zu ihren Schlafsäcken und kehrten mit hübschen runden Schachteln aus Holz und Töpferware zurück. Einige waren mit bemerkenswerten Mustern geschmückt, die mit gefärbten Haaren oder feinen Federn aufgetragen worden waren, während andere aus Gold und Silber bestanden.
Jedes kleine Töpfchen enthielt eine andere Farbe – Rot, Schwarz, Weiß, Gelb oder Blau.
»Darf ich dich bemalen?«, fragte Ota Qwan.
Peter lächelte. »Natürlich«, sagte er. Er war völlig erschöpft und schlief schon fast ein.
Drei Männer und eine bemalte Frau übernahmen die Arbeit unter Ota Qwans Anleitung. Es dauerte eine ganze Stunde, und als sie fertig waren, war Peter auf der einen Körperseite schwarz und auf der anderen rot.
Sein Gesicht hingegen war komplizierter bemalt worden. Er hatte die Finger der Frau auf den Wangen und um die Augen herum gespürt. Ihr Ausdruck der Hingabe und der leicht geöffnete Mund wurden durch den Fisch, der um ihre Augen herumgemalt war, seltsam verzerrt.
Als sie fertig waren, brachte einer der Männer einen kleinen runden Spiegel in einem Hornbehälter herbei. Peter betrachtete die Maske auf seinem Gesicht und nickte zustimmend. Rote, weiße und schwarze Striche wirkten wie Heringsgräten. Es sagte ihm etwas, aber er war sich nicht ganz sicher, was es war.
Er überließ ihnen sein Hemd, das er jetzt nicht mehr brauchte.
Dann ging er durch die vom Feuerschein erhellte Finsternis, und die Luft fühlte sich auf seiner bemalten Haut kühl an. Die Wärme der anderen Lagerfeuer spürte er sogar aus der Entfernung. Ota Qwan führte ihn von einem zum anderen, und die Krieger murmelten ihm zu. Er nickte und verneigte sich immer wieder.
»Was sagen sie?«, wollte er wissen.
»In der Hauptsache begrüßen sie dich. Einige meinen, dass du jetzt viel größer bist. Der alte Mann rät dir, deine Bemalung sauber zu halten und dich nicht mehr mit Schlamm zu beschmieren, wie du es zu tun gewöhnt warst.« Ota Qwan lachte. »Denn natürlich bist du früher Grundag gewesen. Verstanden?«
»Christus«, sagte Peter. Doch die gemurmelten Willkommensgrüße stärkten sein Rückgrat. Er hatte triumphiert. Er musste sich nicht in seiner Tat suhlen.
Er lebte, war groß und stark und mochte die Farbe auf seinem Körper durchaus.
An seinem eigenen Feuer zeigte ihm Senegral alle Besitztümer Grundags und reichte ihm einen Becher mir warmem, gewürztem Tee, den er sofort trank. Ota Qwan stand am Rand des Lichtkreises und beobachtete ihn.
»Sie sagt, du sollst dir den guten Bogen ansehen, den du jetzt hast. Aber einige deiner Pfeile sind sehr schlecht. Du solltest entweder bessere herstellen oder sie dir durch Tausch besorgen. Und sie sagt, sie wolle versuchen, keine anderen Männer zu reizen, wenn du dich so um sie kümmerst, wie sie es will.«
Peter untersuchte die sorgfältig neben dem Borkenkorb ausgelegten Dinge und hielt jedes in den Feuerschein. Es handelte sich um zwei ausgezeichnete Messer und einen guten Bogen, aber ohne die dazu passenden Pfeile, dann um einige Pelze, eine Hose und zwei schmucklose Mokassins. Ein Horntopf enthielt schwarze Farbe, ein Glasbehälter rote Farbe. Außerdem gab es noch zwei Becher und einen Kupfertopf.
»Ich dachte, die Frauen stellen für ihre Männer Schuhe her?«, fragte Peter.
Ota Qwan lachte. »Frauen, die ihre Männer sehr schätzen, machen ihnen großartige Mokassins«, erklärte er.
»Ich verstehe«, sagte Peter und packte alles in den Korb zurück. Die Frau kam herbei und stellte sich neben ihn. Er fuhr ihr mit der Hand unter den Rock und über den Schenkel nach oben. Sie stieß einen leisen Seufzer aus, und bald waren sie wieder ganz genau dort, wo sie vorhin gewesen waren, als ihm der inzwischen tote Mann gegen den Kopf getreten hatte.
Sie stöhnte auf, und später lachte er laut über die Absurdität des Ganzen. Er wollte, dass Ota Qwan ihr seine Gedanken übersetzte, aber natürlich war der Mann inzwischen gegangen.
Warum hilft er mir?, dachte Peter noch, und dann war er bereits eingeschlafen.
Am Morgen standen alle bemalten Männer auf, nahmen nur die wenigen Sachen mit, die sie für ihre Gewalttaten brauchten, und folgten Skadai. Peter ergriff den Bogen und das beste Messer sowie seine Farbe und ein einzelnes rotes Wolllaken und schritt nackt hinter Ota Qwan her. Es fiel ihm überraschend leicht, keine Fragen zu stellen, sondern einfach nur bei den anderen zu bleiben.
Später fragte er Ota Qwan, wo er sich Pfeile besorgen konnte. Stumm gab ihm der Mann ein Dutzend.
»Warum?«, fragte Peter. »Kämpft nicht jeder gegen jeden?«
Ota Qwan lachte. »Du weißt gar nichts«, sagte er. »Folgst du mir etwa nicht? Wirst du mir gehorchen, wenn die Pfeile fliegen und der Stahl die Luft erfüllt?«
Peter dachte darüber nach. »Vermutlich.«
Ota Qwan lachte noch einmal. »Komm, wir suchen dir einen Namen aus.«
Südlich von Albinkirk · De Vrailly
Jean de Vrailly bezwang seine Ungeduld, und wie immer verwandelte sie sich in Wut. Das Erblühen dieser Wut verschaffte ihm stets das Gefühl, sündig, schmutzig und kein vollwertiger Mann und Ritter zu sein. Während sie über die Frühlingsblumen und entlang der hohen Bergkämme von Albias fruchtbarem Kernland ritten, zügelte er plötzlich sein zweites Schlachtross und stieg zur Verwirrung seiner Waffengenossen ab. Er kniete sich in den Schmutz neben der Straße und betete.
Der milde Schmerz des langen Kniens beruhigte ihn immer wieder.
Bilder stiegen an die Oberfläche seines Denkens, als er sich die Kreuzigung Christi vorstellte, und ebenso, als er sich als einer der Ritter sah, die zur Rettung des heiligen Grabes ausgesandt wurden, oder als er sich in die Meditation über die heiligen drei Könige versenkte und sich als einfachen Wächter betrachtete, der auf seinem Pferd hinter den Weisen saß, die das neugeborene Lamm anbeteten.
Verachtung durchbrach seine Tagträume. Er verabscheute den König von Albia, der in jedem Ort anhielt, um vor seinen Untertanen zu posieren und ihr Seufzen sowie ihr schallendes Gelächter hervorzurufen versuchte. Er bemühte sich, ihre Ängste zu ersticken und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Das alles wurde mit zu viel Theatralik durchgeführt und kostete zu viel Zeit. Es war selbst für ein Kind offensichtlich, dass etwas im Norden geschah, das ein sofortiges Einschreiten der Panzerhand des Reiches erforderte.
Abscheu. Die Ritter von Albia waren langsam, träge, voller Gemeinheit und Barbarei. Sie tranken, sie fraßen zu viel, sie rülpsten und furzten bei Tisch, und nie, niemals übten sie den Kampf. Jean de Vrailly und sein Gefolge ritten in voller Rüstung von Ort zu Ort, trugen fest gepolsterte Jacken unter ihren Kettenhemden und darüber glänzende Stahlplatten – drei Schichten Schutz, die jeder Ritter im Osten an einem jeden Tag seines Lebens trug – in der Stadt, in der Kirche und selbst dann, wenn er nur mit der Dame seines Herzens ausritt.
Die Wildnis hatte seit einem Jahrhundert keinen wesentlichen Ausfall mehr in den Osten unternommen, doch die Ritterschaft stand bereit, jederzeit gegen sie zu kämpfen.
Aber hier, wo verwilderte Bäume auf jedem Bergkamm standen und Überfälle der Wildnis jede Stadt entlang des Horizonts bedrohten, trugen die Ritter farbenfrohe Hemden mit modisch lang herabhängenden Ärmeln, spitze Schuhe und sorgfältig eingewickelte Hüte wie die Turbane aus dem fernen Osten, während ihre Rüstungen in Weidenkörben oder Eichenfässern verstaut waren.
Und nun, vier Tagesreisen von Albinkirk entfernt, befand sich eine Abteilung jüngerer königlicher Ritter und Knappen auf der Beize. Sie waren auf ihren Zeltern zu den Hügelkämmen im Westen geritten, und am liebsten hätte er sie für ihre leichtfertige Dummheit bestraft. Diese verweichlichten Barbaren mussten lernen, was Krieg wirklich bedeutete. Sie mussten lernen, ihre Lederhandschuhe auszuziehen und das Gewicht des kalten Stahls in ihren zarten Händen zu spüren.
Er betete und fühlte sich besser. Es gelang ihm, den König anzulächeln und einem jungen Knappen zuzunicken, der in schlechter Manier die Kolonne entlanggaloppierte und dabei eine Staubwolke aufwirbelte. Er saß auf einer heißblütigen Stute aus dem Osten, die als Rennpferd hundert Leoparden teuer, als Kriegspferd aber völlig wertlos war.
Doch als die Armee, die jeden Tag anwuchs, weil aus jeder Stadt, aus jeder Grafschaft und jedem Herrensitz neue Ritter, Soldaten und Bogenschützen hinzukamen, zur Nacht anhielt, befahl de Vrailly seinen Knappen, seinen Pavillon so weit entfernt wie möglich vom Rest der Armee aufzuschlagen – draußen bei den Pferden, umgeben von Tieren. Er nahm zusammen mit seinem Vetter ein einfaches Soldatenmahl zu sich, rief dann Pater Hugh, seinen Kaplan, herbei, damit er die Messe hören und seine Sünden der Leidenschaft beichten konnte. Schließlich badete er spirituell gesäubert im Wasser des Albin, des mächtigen Stromes, der vor seinem Zelt dahinfloss. Er entließ seine Knappen und Sklaven, trocknete sich ab und lauschte dem Klang von dreitausend Pferden, die an diesem wunderbaren Frühlingsabend auf der Weide grasten. Der Duft der Wildblumen überlagerte sogar den Geruch der Pferde.
Als er trocken war, zog er ein weißes Hemd, eine weiße Hose und eine weiße Jacke an – einen Wappenrock der einfachsten Art. Er entrollte einen kleinen, kostbaren Teppich aus dem fernen Osten und öffnete ein tragbares Diptychon – zwei Gemälde, die man für die Reise zusammenklappen konnte und die die Jungfrau Maria sowie die Kreuzigung zeigten. Er kniete vor den Bildern nieder, betete, und als er sich leer und sauber fühlte, öffnete er sich.
Und sein Erzengel kam.
Kind des Lichts, ich grüße dich.
Wie jedes Mal, wenn der Engel kam, brach de Vrailly in Tränen aus. Nie glaubte er, dass diese Visitationen echt sein konnten, bis die nächste all die vorangegangenen bestätigte. Sein Unglaube – sein Zweifel – war zugleich seine Bestrafung.
In Tränen verneigte er sich. »Segne mich, Taxiarch, denn ich habe dich viele Male verleugnet.«
Er versuchte, nicht unmittelbar in das strahlende Antlitz zu blicken, das in seiner Erinnerung aus gepunztem Gold zu bestehen schien, doch tatsächlich sah es mehr nach beweglichem, glitzerndem Perlmutt aus. Wenn er es zu eingehend betrachtete, könnte dies den Zauber brechen …
Es ist nicht dein Fehler, dass der König von Albia nicht das getan hat, was wir wünschten. Es ist nicht durch dich geschehen, dass dieses Königreich zur Unzeit von den Mächten des Bösen angegriffen wurde. Aber wir werden obsiegen.
»Ich erliege der Wut, der Verachtung, der Selbstherrlichkeit und dem Zorn.«
Nichts davon kann dir helfen, der beste Ritter der Welt zu werden. Erinnere dich daran, wie du dich im Kampfe zeigst, und sei dieser Mann zu allen Zeiten.
Kein Priester hatte es ihm je so gut erklärt. Wenn er kämpfte, gab er alle weltlichen Belange auf und war nur noch die Spitze an seinem Speer. Die Worte des Erzengels hallten in ihm wider – wie das Aufeinanderprallen zweier Klingen, die von starken Männern geführt wurden; es war wie der Schall eines trompetenden Hengstes.
»Ich danke dir, Herr.«
Sei guten Mutes. Eine große Prüfung wird kommen. Du musst bereit dafür sein.
»Ich bin immer bereit.«
Der Erzengel legte ihm die leuchtende Hand auf die Stirn, und für einen kurzen Augenblick schaute de Vrailly in das strahlende Antlitz hinauf und warf einen Blick auf die ausgestreckte, vollkommen geformte Hand sowie das goldene Haar, das so viel heller als das von de Vrailly war und ihm doch irgendwie glich.
Gesegnet seiest du, mein Kind. Wenn die Standarte fällt, wirst du wissen, was getan werden muss. Zögere nicht.
De Vrailly runzelte die Stirn.
Aber der Engel war verschwunden.
Er roch noch den Weihrauch, und er verspürte großen Frieden. Sein Geist war getröstet und matt, als hätte er gerade eine Frau gehabt. Doch er empfand weder Scham, noch kam er sich schmutzig vor.
Er lächelte, holte tief Luft und sang leise die ersten Noten des Te Deum.
Westlich von Albinkirk · Harmodius
Harmodius lag auf einem Bündel aus Pelzen, balancierte den Steingutbecher mit warmem Wein auf seinem Brustkorb und sah zu, wie Random mit einem heißen Schürhaken in einem anderen Humpen herumstocherte und Honig sowie Gewürze hineingab.
Hinter dem Kaufmann saß Gawin Murien und flickte einen Schuh. Er sagte zwar nichts, aber er konzentrierte sich ganz auf die Aufgaben eines Soldaten, und Harmodius behielt ihn im Auge. Seine linke Schulter war schon von der Brustwarze bis zum Hals und dem Ansatz des Oberarms voller Schuppen. Offenbar breiteten sie sich nicht mehr aus, aber die einzelnen Schuppen wurden größer und härter. Der junge Mann schien sie seltsamerweise nicht mehr zu beachten. Seit der ersten Nacht hatte er kein Wort darüber verloren.
Harmodius war mit allen Wassern gewaschen und hatte schon viele junge Männer gesehen. Dieser hier bereitete sich auf seinen Tod vor, und deshalb beobachtete Harmodius ihn aufmerksam. Der zweite Ring an seiner rechten Hand enthielt ein Phantasma, das den Jungen wie einen Schlag mit einer geistigen Axt fällen würde.
»Ich mag Süßes und bin nun einmal ein Leckermaul«, sagte Random und grinste. »Meine Frau sagt, dass all meine Versuche, Reichtum und Ruhm zu erlangen, nur dazu dienen sollen, meinen Vorrat an Keksen und Honig aufzustocken.«
Harmodius trank wieder aus seinem Becher. Der Wein war viel süßer, als er es mochte, aber heute Abend, unter dem Sternvorhang und mit einem schrecklichen Feind knapp außerhalb der Reichweite des Feuerscheins, kam ihm dieser Hippocras gerade recht.
Eine Gegenwart.
Es war ein milder Schock, als würde man eine frühere Geliebte eine Taverne betreten sehen. Irgendwo nicht sehr weit entfernt manifestierte sich etwas Mächtiges. Entweder war es sehr mächtig und recht weit entfernt, oder es war nur beeindruckend und erschreckend und befand sich auf dem angrenzenden Feld.
»Zu den Waffen!«, rief Harmodius und sprang auf die Beine. Er sammelte sich einen Augenblick lang und streckte seine verstärkten Sinne aus.
Gawin Murien steckte schon in seinem Lederwams und setzte sich gerade den Helm auf.
Random trug einen Brust- und Rückenpanzer über seiner Reisekleidung und holte nun eine Armbrust aus demselben Wagen, in dem auch die Zutaten für den gesüßten Wein lagerten.
Andere Männer nahmen den Alarmruf auf; die meisten waren vollständig angekleidet, bewaffnet und gerüstet, doch Harmodius beachtete sie gar nicht, sondern richtete seine innere Kraft an dem orangefarbenen Schein des Feuers vorbei auf diejenigen aus, von denen sie umgeben waren.
Nichts. Nicht ein einziger Kobold.
Harmodius kannte die Gesetze der Identität beim Gebrauch der Macht. Es gab immer zwei Möglichkeiten, einen anderen Benutzer zu orten. Man konnte es still tun, die eigenen Sinne einstellen und auf das Pulsieren einer Gegenwart warten. Oder man konnte den Puls der eigenen Macht in die Nacht aussenden, was jeder Kreatur der Wildnis, die auch nur die geringste Empfindungskraft für solche Dinge besaß, seine Identität verriete.
Er entschied sich für die stillere, passivere Möglichkeit, auch wenn sie eigentlich nicht in seiner Natur lag und er vor Macht beinahe platzte. Seit vielen Jahren hatte er sich nicht mehr so fähig gefühlt. Er wollte mit seiner Macht spielen, ganz so wie ein Mann, der ein neues Schwert schwang und den Farnen und Fenchelstängeln die Köpfe abschnitt.
Harmodius gebrauchte seine Macht. Und er machte sich die Kraft seiner Ungeduld zunutze.
Er trieb seine Sinne weiter hinaus.
Noch weiter.
Hoch im Norden bemerkte er Trolle. Ihre großen, missgestalteten Umrisse waren in ihrer mangelnden Symmetrie genauso schrecklich wie ihre schwarze, kristalline Fremdartigkeit. Sie marschierten.
Im Westen fand er einen Benutzer der Macht mit großem Talent, aber wenig Ausbildung. Doch er wusste nicht, wie er diese Entdeckung einordnen sollte. Handelte es sich um eine Dorfhexe, einen Koboldschamanen oder einen der lebenden Bäume der Wildnis? Er hatte keine Ahnung und tat dieses Wesen als zu schwach ab. Es konnte nicht die Quelle der Macht sein, die er gespürt hatte.
Worum auch immer es sich dabei gehandelt haben mochte, sie schien die Welt verlassen zu haben – fortgegangen auf dem Pfad, den sie sich gewählt hatte. Entweder hatte sie sich einen neuen Ort geschaffen oder war zu einem gesprungen, der bereits vorher existiert hatte.
Die Ausübung der Macht war wie ein Leuchtfeuer zurückgeblieben, und Harmodius hatte zu seinem Unglück feststellen können, dass sie sich hinter ihnen befand – viele Meilen im Südosten. Er stürzte sich darauf wie ein Raubtier auf einen Hasen – und floh genauso schnell wieder davor, als er die ungeheure Gewalt bemerkte, von der sie kündete.
Als kleiner Junge im Fischerdorf war Harmodius, der damals noch einen anderen Namen getragen hatte, einmal mit zwei Freunden in einem winzigen Boot auf das Meer hinausgerudert, weil sie Meerforellen und Lachse hatten angeln wollen. Delphine und kleine Wale hatten sie begleitet und ihnen manchmal den Fang abgenommen. Aber später am Tag, als sie einen schweren Fisch einholten, hatte Harmodius einen Seehund gesehen, einen gigantischen Seehund, so lang wie sein Boot, der blitzartig kehrtgemacht hatte und nach ihrem wunderbaren Fisch gierte …
… gerade als ein Leviathan, der ebenso viel größer als der Seehund gewesen war, wie dieser größer als der Lachs gewesen war, unter dem Boot umdrehte und sich den Seehund schnappte.
Die Größe der Kreatur unter dem Boot – die das Fünfzigfache von dessen Länge maß – und ihr riesiges, rollendes Auge, der Blutschaum, der ohne den geringsten Laut an die Oberfläche trat, als der Seehund gerissen wurde, der daraus entstehende sanfte Wellengang und schließlich das vielleicht Schrecklichste, nämlich die mächtige Schwanzflosse, die in einer Entfernung von hundert Ellen die Wasseroberfläche durchbrach und Gischt auf die Insassen des Bootes schleuderte …
In seinem ganzen Leben hatte Harmodius nie wieder etwas gesehen, das ihn so berührt und so gründlich von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit überzeugt hatte. Es war mehr als Angst gewesen: die Entdeckung, dass manche Dinge so groß waren, dass sie einen nicht einmal dann wahrnahmen, wenn sie einen gerade vernichteten.
Er hatte den Lachs an Bord gezogen, der im Unwissen um die Rolle gestorben war, die er beim Tod des mächtigen Seehundes gespielt hatte. Und diese Lektion war an dem Jungen nicht verschwendet gewesen.
An all das dachte er nun, als er vor der Ungeheuerlichkeit der Kreatur floh, die sich etwa fünfzig Meilen weiter südlich für kurze Zeit im Tal des Albin aufgehalten hatte.
Er kehrte in seine eigene Haut zurück.
Random sah ihn besorgt an. »Ihr habt geschrien!«, sagte er. »Wo sind sie?«
»Wir sind in Sicherheit«, antwortete Harmodius, aber seine Stimme klang beinahe wie ein Schluchzen. Niemand ist sicher. Was ist das gewesen?
Östlich von Albinkirk · Hector Lachlan
Östlich von Albinkirk stieg die Sonne über dem Westhang des Parnassus auf, der westlichsten Erhebung des Morea-Gebirges, wo die Flüsse herunterstürzten, angeschwollen vom letzten Schnee und dem Frühlingsregen, und den Oberlauf des Albin überfluteten.
Hector Lachlan trank Tee und beobachtete den östlichen Pass. Er war hoch – viel zu hoch. Hector fragte sich, wie er die Herden darüberführen sollte.
Hinter ihm schlugen seine Männer das Lager ab, packten den Wagen, legten Kettenhemden und Waffen an, und die Jüngsten – oder diejenigen, die Pech gehabt hatten – befanden sich bereits draußen bei den Herden.
Während er zusah, zog sich Donald Redmane, sein Tanist, am Ufer nackt aus, stürzte sich in das Wasser und benutzte den Rand eines zerstörten Biberdamms als Tauchplattform. Er war fröhlich und kraftvoll und wurde nur wenige Augenblicke später an dem Seil um seine Hüfte wieder herausgezogen, wobei er mit Schulter und Schlüsselbein an den Steinen entlangschrammte.
Lachlan zuckte zusammen.
Heute zogen die Herden in den Nordwesten zur Wegkreuzung bei Albinkirk, die Hector eigentlich hatte vermeiden wollen. Und sein Tanist, sein zuverlässiger Verwandter, Stellvertreter und noch vieles mehr, machte sich auf den Rückweg zu der Herberge, um dort einige Männer zu heilen, auf die er nicht verzichten konnte.
In jener Nacht hatte irgendetwas einen Hengst in der Herde getötet, und Lachlan, der in seinem ganzen Leben noch nie gegen einen Irk gekämpft hatte, nahm an, dass eine solche Kreatur dafür verantwortlich war, denn das Pferd hatte viele Stiche und Schnitte von etwas erlitten, das viel kleiner als es selbst gewesen sein musste. Doch der Grund für diese Tat war ihm nicht klar. Er verdoppelte seine Wachen und wusste gleichzeitig, dass es kaum etwas nützen würde. In den Bergen gab es Steinmauern und tiefe Schluchten mit natürlichen Befestigungsanlagen, mit denen er seine Herden schützen konnte, aber hier auf der Straße … Und dabei befand er sich in einem Land, das die Viehtreiber für sicher hielten. Etwas jagte ihn jedoch. Er konnte es spüren.