4
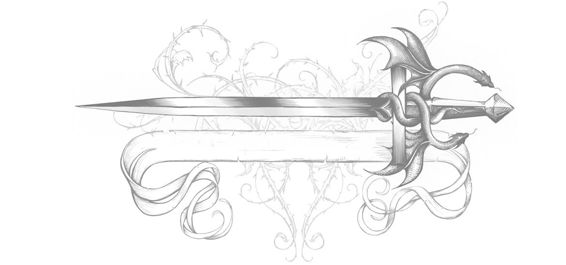
Südlich von Lorica · Ser Gawin
Gawin Murien von Strathnith, unter seinesgleichen als Harthand bekannt, ritt in seiner Rüstung am Fluss Albin in nördlicher Richtung entlang; unfreiwillig war er zum umherfahrenden Ritter geworden. Und je weiter er nach Norden ritt, desto größer wurde sein Zorn.
Adam, der ältere seiner beiden Knappen, pfiff unablässig Lieder, beugte sich aus dem Sattel zu jeder vorbeikommenden Frau herunter und betrachtete die Welt mit rückhaltloser Zustimmung. Ihm tat es nicht leid, den Hof von Harndon verlassen zu haben. Weit gefehlt. Fern der großen Halle, fern der Tänze, Kartenspiele, Jagden und Tändeleien lebten die Knappen bei Hofe in Baracken unter der vollkommenen Herrschaft der Ältesten und Gröbsten. Jüngere Männer erhielten wenig zu essen und viel Arbeit und hatten keinerlei Aussicht auf Ruhm. Adam war der Knappe eines bekannten Ritters, und nur beim Reisen bekam er die Gelegenheit, sich einen eigenen Platz in den Heldenliedern zu erobern. In Harndon hatte er bloß blaue Augen und schlechtes Essen gefunden.
Toma, der jüngere Knappe, ritt dagegen mit gesenktem Kopf. Aus ihm wurde Adam nicht klug. Stets waren seine Antworten nur Gemurmel, und alles, was er tat, blieb unbeholfen. Er wirkte sehr jung für sein Alter und schien tiefer im Elend zu stecken, als es einem Jungen frommte.
Gawin wollte etwas für ihn tun, doch es fiel ihn ja bereits schwer, seinen eigenen Zorn zu verarbeiten.
Es war nicht gerecht.
Die Worte waren bedeutungslos. Sein einfältiger Vater hatte ihm von Geburt an jede Vorstellung von Gerechtigkeit aus dem Leib geprügelt. Gawin wusste, dass die Welt nichts als Kampf bereithielt. Sein Glück musste man sich selbst verschaffen. Er kannte noch tausend andere derartige Redensarten, die alle die gleiche Botschaft verkündeten, aber bei Gott und allen Heiligen, Gawin hatte seine Strafe abgebüßt, sich seinem Ungeheuer entgegengestellt und das verdammte Wesen wortwörtlich in einem einzigen Zweikampf mit seinen gepanzerten Handschuhen getötet, nachdem sein Schwert zerbrochen war. Er erinnerte sich so lebhaft daran, wie er sich auch daran erinnerte, aus schieren Schuldgefühlen heraus in den Kampf gegen diese verdammte Kreatur gezogen zu sein.
Ich habe meinen Bruder umgebracht.
Bei diesem Gedanken wurde ihm noch immer übel.
Er wollte sich dem Feind nicht noch einmal stellen, nicht für alle hübschen Damen bei Hofe und nicht für alle Ländereien, die er erben würde. Er war kein Feigling. Er hatte es getan. Vor den Augen seines Vaters und denen fünfzig anderer Männer. Vermutlich gab es in ganz Albia – vom einen Ende des Reiches bis zum anderen – keine fünfzig Ritter, die einen Dämon im Zweikampf besiegt hatten. Und auch er hatte es gewiss nicht tun wollen.
Doch er hatte es getan. Und damit hätte die Sache erledigt sein sollen.
Doch natürlich hasste ihn der König, so wie er selbst all seine Brüder und seine Mutter hasste und seinen Vater verachtete.
Verdammt sei der König. Ich reite nach Hause zum Vater.
Strathnith war eine der größten Festungen im Reich. Es war eine Zitadelle am Großen Wall, die die Murien seit Generationen gehalten hatten. Der Nith war ein mächtiger Fluss – fast schon ein Binnenmeer –, der die Grenze zwischen dem Reich und der Wildnis bildete. Sein Vater herrschte über die Festung und Tausende von Männern und Frauen, die ihre Steuern an ihn zahlten und dafür von ihm beschützt wurden. Er dachte an die große Halle und die uralten Zimmer; einige Trakte der Festung waren noch von den Archaikern erbaut worden. Und er dachte an die Klänge aus der Wildnis, die über den breiten Fluss getragen wurden.
Und ebenso an das beständige Gezänk und die Anklagen im Zustand der Trunkenheit. An die Familienkämpfe.
»Gütiger Christ, ich könnte mir genauso gut ein verfluchtes Ungeheuer suchen und es töten«, sagte er laut. Heimzukehren bedeutete in ein Leben im andauernden Kriegszustand zurückzukommen – im Feld ging es gegen die Dämonen und in der Halle gegen seinen Vater. Und gegen seine Brüder.
Ich habe meinen Bruder umgebracht.
»Ich werde es ihnen zeigen«, sagte er.
Er war nach Süden geschickt worden, der junge Held, um sich am Hof eine Braut zu erobern. Um eine Familie zu gründen, die die Wertschätzung des Königs erringen sollte.
Ein weiterer von den brillanten Plänen seines Vaters.
Er hatte sich tatsächlich verliebt, aber nicht in eine Frau. Er hatte sich vielmehr in alle Frauen verliebt. Und in den Hof. In die Musik. Das Kartenspiel. Die Würfel. In guten Wein und Witz. In das Tanzen.
Strathnith jedoch bot nichts von alledem. Er musste immer wieder daran denken. Wenn er es sich recht überlegte, hatte sein abscheulicher Bruder vielleicht sogar recht gehabt.
Seine Mutter …
Er verbannte diesen Gedanken.
»Lorica, Mylord«, rief Adam. »Soll ich uns eine Herberge suchen?«
Der Gedanke an eine Herberge beendete seinen Augenblick des Selbstzweifels. Herbergen – gute – waren wie kleine Höfe. Ein wenig rauer vielleicht, ein wenig häuslicher. Gawin lächelte.
»Die beste«, sagte er.
Adam grinste, gab seinem Pferd sanft die Sporen und ritt der untergehenden Sonne entgegen. Wein. Und vielleicht auch ein Mädchen. Ganz kurz dachte Gawin an Lady Mary, die ihn so offensichtlich liebte. Sie hatte einen wunderschönen Körper und, wie er zugeben musste, auch einen flinken Geist. Und sie war die Tochter eines Grafen. Also war sie eine gute Partie.
Er zuckte mit den Schultern.
Die Herberge Zu den zwei Löwen war sehr alt und auf den Fundamenten einer archaischen Kavalleriebaracke erbaut. Dabei sah sie aus wie eine Festung. Sie hatte ihre eigene Ringmauer, die von Loricas Stadtmauer abging, und einen Turm an der nordöstlichen Ecke, wo es einst ein Stadttor gegeben hatte. Gegen den Turm lehnte sich ein massives Gebäude mit weißem Verputz und dicken schwarzen Balken sowie mit einem Walmdach aus Stroh und teuren Kupfereinfassungen um die Kamine. Glasfenster öffneten sich auf die Veranda, die an der Vorderseite und an der Südseite entlanglief, und vier riesige, neu gemauerte Kamine erhoben sich aus dem Dach.
Es war, als sei ein Stück des Palastes von Harndon auf das Land gebracht worden. Lorica war eine wichtige Stadt und Zu den zwei Löwen eine wichtige Herberge.
Adam kam zurück und hielt sein Pferd an. »Ein Ritter des Königs ist hier sehr willkommen«, sagte er mit einem Grinsen. Adam gefiel es, einem großen Mann zu dienen – strahlte es doch auf ihn ab. Insbesondere vierzig Meilen nördlich der Stadt.
Ein wohlhabender, rasiermesserdünner Mann in einem feinen, mit Seide eingefassten und mit silbernen Kreuzen und einem Pelzband geschmückten Umhang kam heraus und verneigte sich bis fast auf den Boden. »Edard Blodget, Mylord. Zu Euren Diensten. Ich werde meine Herberge nicht als niedrig und gering bezeichnen, denn sie ist die beste an der ganzen Straße. Aber Ritter des Königs sehe ich immer besonders gern.«
Gawin war verblüfft, dass ein Mann aus dem einfachen Volk so gut gekleidet war und so offen sprach – er war verblüfft, aber nicht verärgert. Und erwiderte die Verneigung bis zum Boden. »Ser Gawin Murien«, stellte er sich vor. »Das Rittertum bedeutet nicht zwangsläufig Reichtum, Meister Blodget. Darf ich fragen …?«
Meister Blodget schenkte ihm ein schmallippiges Lächeln. »Euer Zimmer steht Euch für einen Silberleoparden bereit. Wenn Ihr es mit Euren Knappen teilt, kostet das zwei Katzen mehr.« Er hob eine Braue. »Ich kann es aber auch billiger machen, Mylord. Dann allerdings müsstet Ihr in einem Gemeinschaftsraum nächtigen.«
Gawin überdachte den Inhalt seiner Börse. Er hatte ein gutes Erinnerungsvermögen, und so sah er deren Inhalt vor seinem geistigen Auge: vier Silberleoparden und ein Dutzend schwere Kupferkatzen. Zwischen ihnen glänzte ein Paar Edelrosen, pures Gold, jedes Stück zwanzig Leoparden wert. Kein Vermögen, bei Weitem nicht, aber doch genug, um in seiner ersten Nacht auf der Straße – und später auch in der zweiten – nicht knausern zu müssen.
»Adam wird sich um alles kümmern. Ich bevorzuge es, wenn wir drei in einem abgetrennten Zimmer schlafen. Mit einem Fenster, wenn das nicht zu viel verlangt ist?«
»Sauberes Leinen, Brunnenwasser und Stallplätze für drei Pferde. Das Packpferd kostet eine weitere halbe Katze.« Blodget zuckte mit den Achseln, als ob derart kleine Summen eigentlich unter seiner Würde seien, was sie vermutlich sogar waren. Das Zu den zwei Löwen war ungefähr ein Drittel so groß wie die massive Festung von Strathnith und stellte einen Wert von mindestens … Gawin versuchte sich im Kopfrechnen, wünschte sich seinen Lehrer herbei und kam schließlich zu einer Summe, die einfach nur falsch sein konnte.
»Ich fühle mich geschmeichelt, dass Ihr mich persönlich begrüßt«, sagte Gawin und verbeugte sich noch einmal.
Blodget grinste vom einen Ohr zum anderen.
Noch etwas, das ich bei Hofe gelernt habe – die Männer lieben es genauso sehr wie die Frauen, wenn man ihnen schmeichelt, dachte Gawin.
»Heute Abend tritt eine Truppe von Sängern bei mir auf, Mylord. Sie sind auf dem Weg zum Hof – das hoffen sie zumindest. Werdet Ihr uns zum Abendessen im Schankraum Gesellschaft leisten? Es ist keine große Halle, aber schlecht ist dieser Raum auch nicht. Es wäre uns eine große Ehre, wenn Ihr bei uns säßet.«
Natürlich bin ich Schmeicheleien genauso zugänglich wie jeder andere Mann.
»Wir werden uns bei Musik und Mahl zu Euch setzen«, sagte er und machte eine kleine Verneigung.
»Die Abendmesse wird in Sankt Eustachius gehalten. Ihr könnt die Glocke gar nicht überhören«, sagte der Herbergswirt. »Das Abendessen wird unmittelbar nach der Messe aufgetischt.«
Harndon · Edward
Meister Pyle erschien nach der Abendmesse im Hof und bat um einen Freiwilligen.
Edward hatte eine Freundin, aber sie war ebenfalls beschäftigt. Sie würde es jedoch verstehen, denn die Gelegenheit, mit dem Meister zusammenzuarbeiten, war der Traum eines jeden Gesellen.
Diesmal mischte der Meister das Pulver auf andere Weise. Edward bekam nicht mit, wie er es tat. Er musste eine schwere Eisenschüssel für die Treibarbeit in den Hof schieben und dafür eine Menge Abfall – Reste von misslungenen Arbeiten und weiches Holz, das für behelfsmäßige Feuerstellen benutzt wurde – entfernen, damit nichts Feuer fangen konnte. Es war zwar keine Arbeit, die ein besonderes Geschick verlangte, aber immerhin war er unmittelbar für den Meister tätig.
Diesmal war der Rauch, der aus dem Pulver strömte, dichter, und die Flamme brannte weißer.
Meister Pyle betrachtete sie eingehend und fächelte vor seinem Gesicht herum, damit sich der stinkende Rauch verzog. Er schien zu lächeln.
»Nun«, sagte er und sah Edward an. »Bist du bereit für deine Prüfung, junger Mann?«
Edward holte tief Luft. »Ja«, sagte er und hoffte, dass es nicht allzu großspurig klang.
Aber Meister Pyle nickte nur. »Der Meinung bin ich auch.« Er sah sich im Hof um. »Räum das alles auf, ja?«
In jener Nacht flüsterten die Lehrlinge auf dem Dachboden miteinander. Die älteren wussten genau, wann der Meister Fortschritte machte. Sie lasen es an der Art ab, wie er den Kopf hielt. Und sie erkannten es daran, dass plötzlich Belohnungen aus der Börse des Meisters flossen; außerdem erhielten sie neue Aufgaben, und einige Lehrlinge wurden auf ihre Eignung zum Gesellen hin überprüft. Lise, die älteste Messerschmiedin, war vor einer Woche zu den Gildenmeistern gerufen worden. Sie hatte die Prüfung bestanden.
Und so wurde auch aus Edward Chevins, dem altgedienten Lehrjungen und bisweilen auch Ladenjungen, ein Geselle. Es war so plötzlich gekommen, dass ihm jetzt ganz schwindlig wurde, und bevor der nächste Morgen verstrichen war, hatte die Gilde bereits seine Papiere überprüft, hatten die Gildenmeister ihn examiniert, war er mit den Nerven am Ende, zitterten seine Hände – und er stand allein und schwitzend in einem reich ausgeschmückten Raum, der geeignet gewesen wäre, einen König zu empfangen. Der siebzehnjährige Klingenschmied war überwältigt.
Edward war ein großer, schlaksiger junger Mann mit rötlich gelbem Haar und zu vielen Sommersprossen. Als er nun unter dem Bleiglasfenster des heiligen Nikolaus stand, fielen ihm zwanzig bessere Antworten auf die Frage ein, die man ihm gestellt hatte: »Wie erreichst du ein helles, gleichmäßiges Blau auf einer Klinge mit schwerer stumpfer Seite und Nadelspitze?«
Er ächzte. Die vier anderen Jungen, die zusammen mit ihm ihre Prüfung abgelegt hatten, sahen ihn mit einer Mischung aus Mitgefühl und Hoffnung an. Vermutlich glaubten sie, dass das Versagen eines anderen ihre eigene Aussicht auf den Erfolg erhöhte.
Eine Stunde später kamen die Meister in die Halle. Sie sahen alle ein wenig rot im Gesicht aus, als hätten sie getrunken.
Meister Pyle trat vor und steckte ihm einen Ring an den Finger – einen Ring aus feinem Stahl. »Du hast es geschafft, mein Junge«, sagte er. »Gut gemacht.«
Lorica · Ser Gawin
Das Brüllen einiger Männer im Hof weckte Gawin aus seinem Schläfchen auf. Wütende Stimmen haben eine ganz eigene Klangfarbe – vor allem dann, wenn ihre Träger auf Gewalt sinnen.
Adam stand bereits neben seinem Bett und hielt ein schweres Messer in der Hand. »Ich weiß nicht, wer sie sind, Mylord. Männer aus Übersee. Ritter. Aber …« Knappen sprachen niemals schlecht über Ritter. Es war auch nicht empfehlenswert. Daher zuckte Adam nur mit den Schultern.
Gawin rollte sich aus dem Bett; er trug nicht mehr als eine Unterhose. Also zog er sich rasch ein Hemd über, und mit Tomas Hilfe schlüpfte er in seine Hose und die ausgepolsterte Jacke, an deren Saum er die Hose befestigte.
Unten im Hof übertönte eine Stimme die der anderen deutlich. Sie hatte einen Akzent, klang aber mächtig, beherrscht und geschliffen. Die Worte endeten in einem langen, schallenden Lachen, das wie Glockenklang anmutete.
Gawin ging zum Fenster und warf es auf.
Im Hof befanden sich ein Dutzend Männer in Rüstungen. Zumindest drei von ihnen waren wahre Ritter und trugen eine Rüstung wie die von Gawin. Ihre Soldaten waren fast genauso gut ausgestattet. Vielleicht waren das sogar allesamt Ritter.
Jeder trug dasselbe Wappen: eine Rose, rot, auf goldenem Feld.
Er kannte es nicht.
Der Anführer mit dem prächtigen Lachen hatte silbriges Haar und feine Gesichtszüge. In seiner Rüstung sah er wie eine Statue des heiligen Georg aus. Er war schön.
Gawin fühlte sich im Vergleich zu ihm schlecht gekleidet und irgendwie tölpelhaft.
Meister Blodget stand vor diesem Heiligen und hatte die Hände in die Hüften gestemmt.
»Aber«, sagte der Ritter mit einem Lächeln auf dem Gesicht, »das ist genau das Zimmer, das ich haben möchte, Meister Herbergswirt!«
Blodget schüttelte den Kopf. »In diesem Zimmer logiert ein Edelmann – ein Ritter des Königs. Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst, Mylord. Nur das ist gerecht.«
Der Ritter schüttelte den Kopf. »Dann wirf ihn hinaus.«
Toma hatte das Wams seines Meisters geholt und half ihm nun hinein. Während Adam die Bänder verknotete, holte Toma sein Reitschwert.
»Folge mir«, fuhr Gawin den verängstigten Jungen an und sprang bereits die Treppe hinunter. Er lief durch den Schankraum, der ganz und gar leer war, weil jedermann draußen auf dem Hof stand und den Spaß beobachtete.
Er trat durch die Tür, und der Ritter drehte sich um und sah ihn an. Er lächelte.
»Vielleicht will ich mein Zimmer ja gar nicht verlassen!«, rief Gawin. Es war ihm peinlich, dass seine Stimme zitterte. Hier hatte er doch nichts zu befürchten. Es war bloß ein Missverständnis – aber eines, bei dem ein Ritter einen guten Eindruck schinden konnte.
»Ihr?«, fragte der andere. Sein Erstaunen war nicht gespielt, sondern echt. »Ihr seid ein königlicher Ritter? Ah, Gaston, man braucht uns hier!«
Aus der Nähe betrachtet waren die Männer im Hof riesig. Der kleinste war noch immer einen Kopf größer als Gawin, und dieser war nicht gerade ein kleiner Mann.
»Ich habe die Ehre«, sagte Gawin und suchte nach passenderen Worten. Aber ihm lag mehr daran, die Spannung zu lösen, als daran, Punkte für Scharfzüngigkeit zu sammeln.
Derjenige, der Gaston genannt worden war, lachte auf. Der Rest fiel mit ein.
Der schöne Ritter beugte sich aus seinem Sattel herunter. »Befehlt Euren Männern, alle Sachen aus diesem Eckzimmer herauszuschaffen«, sagte er und fügte in einem besonders widerwärtigen Tonfall hinzu: »Ich würde es als eine Ehre betrachten.«
Gawin stellte fest, dass er wütend geworden war.
»Nein«, sagte er.
»Das war schlecht gesprochen und nicht höflich«, erwiderte der Ritter und runzelte die Stirn. »Ich werde das Zimmer bekommen. Warum also macht Ihr diese Sache so schwierig? Wenn Ihr wirklich ein Ehrenmann seid, dann solltet Ihr es mir guten Mutes und in dem Bewusstsein abtreten, dass ich besser bin als Ihr.« Er zuckte die Achseln. »Oder Ihr fordert mich zum Kampf heraus. Auch das wäre ehrenvoll.« Er nickte. »Aber es macht mich wütend, wenn Ihr bloß hier herumsteht und mir sagt, dass ich das Zimmer nicht haben kann.«
Gawin spuckte aus. »Dann werden wir kämpfen, Ser Ritter. Nennt mir Euren Namen und Titel, und ich werde die Waffen und den Ort wählen. Der König hat in zwei Monaten ein Turnier verkündet, also vielleicht …« Noch während er sprach, stieg der Mann ab.
Er gab Gaston die Zügel seines Pferdes und zog sein Schwert – ein vier Fuß langes Kriegsschwert. »Dann kämpft.«
Gawin kreischte auf. Zwar war er auf diese Reaktion nicht stolz, doch er war ungerüstet und hatte nur sein Reitschwert dabei – eine gute Waffe, die aber bloß mit einer Hand geführt werden konnte und eigentlich ausschließlich dazu da war, die Stellung ihres Trägers zu verdeutlichen sowie den Abschaum der Straße auf Abstand zu halten.
»Garde!«, rief der Mann.
Gawin zog sein Schwert aus der Scheide, die Toma ihm entgegenhielt. Er hob die Klinge und wehrte den ersten schweren Schlag seines Gegners ab. Still dankte Gawin seinem überragenden Waffenmeister – und dann hieb der Riese abermals auf ihn ein, und er wich zur Seite aus, wodurch das schwerere Schwert von ihm abglitt wie der Regen von einem Dach.
Der große Mann sprang so schnell wie eine Katze vor, schlug ihm mit der gepanzerten Faust ins Gesicht und schickte ihn damit zu Boden. Nur eine schnelle Kopfdrehung hatte ihn davor bewahrt, Zähne zu spucken. Aber er war ein Ritter des Königs – er rollte herum, spuckte Blut, sprang wieder auf die Beine und zielte auf die Leiste seines Gegners.
Ein einhändiges Schwert hatte in einem Kampf gegen eine schwerere Waffe gewisse Vorteile. Es war schneller, auch wenn der Kämpfer in diesem Fall kleiner war als sein Gegner.
Gawin lenkte seine ganze Wut auf sein Schwert und stieß zu – dreimal, in drei unterschiedlichen Figuren, und versuchte den Giganten mit rasenden Schlägen einzuschüchtern. Das Schwert prallte von der spiegelblanken Rüstung seines Gegners ab, doch der dritte Schlag hätte den Kampf eigentlich entscheiden müssen.
Wäre sein Gegner nicht in Stahl gekleidet gewesen.
Der Riese griff an, trieb Gawin zwei Schritte zurück, und Toma schrie auf. Der Junge war nicht auf einen Kampf vorbereitet gewesen und hatte wie erstarrt dagestanden, doch nun versuchte er wegzulaufen und geriet dabei zwischen die Abwehrschläge seines Herrn. Gawin wäre beinahe hingefallen, da prallte das Schwert des größeren Mannes gegen sein eigenes und lenkte es so ab, dass es tief in Toma hineinfuhr.
Der Ritter trat Gawin in die Lende, als dieser sich umdrehte und nach Toma sehen wollte, dessen Kopf von der Klinge beinahe in zwei Hälften gespalten war. Gawin ging zu Boden und übergab sich vor Schmerz, doch der große Ritter zeigte keine Gnade. Er sprang Gawin auf den Rücken, sodass dessen Nase in den Schlamm des Hofes gedrückt wurde. Dann riss er Gawin das Schwert aus der Hand.
»Gebt auf«, sagte er.
Aber die Nordländer standen in dem Ruf, stur und rachsüchtig zu sein. In diesem Augenblick schwor sich Gawin, den Mann zu töten, wer auch immer er sein mochte, und wenn es ihn sein Leben und seine Ehre kosten sollte.
»Haut ab«, sagte er durch den Matsch und das Blut in seinem Mund.
Der Mann lachte. »Nach dem Gesetz der Waffen seid Ihr nun mein Gefangener, und ich werde Euch zu Eurem König bringen und ihm zeigen, wie sehr er mich braucht.«
»Feigling!«, brüllte Gawin, auch wenn ihm sein Verstand zuflüsterte, dass es klüger wäre, eine Ohnmacht vorzutäuschen.
Eine gepanzerte Hand drehte ihn um und zerrte ihn auf die Beine. »Entfernt Eure Sachen aus meinem Zimmer«, sagte der fremde Ritter. »Dann werde ich so tun, als hätte ich Eure Worte nicht gehört.«
Gawin spuckte Blut. »Wenn Ihr glaubt, dass Ihr mich vor den König schleppen und dabei einer Anklage wegen Mordes entgehen könnt …«
Der blonde Mann schnaubte verächtlich. »Ihr habt Euren Knappen selbst getötet«, sagte er und erlaubte sich dabei ein winziges Lächeln. Zum ersten Mal hatte Gawin Angst vor ihm. »Und einen Mann, der Euch im Zweikampf besiegt hat, einen Feigling zu nennen, das zeugt von sehr schlechten Manieren.«
Gawin wollte wie ein Held sprechen, aber Wut, Trauer, Angst und Schmerz legten ihm die Worte in den Mund. »Ihr habt Toma umgebracht! Ihr seid kein Ritter! Ihr habt einen ungerüsteten Mann in einer Herberge mit einem Kriegsschwert angegriffen!«
Der andere Mann runzelte die Stirn und beugte sich zu ihm vor.
»Ich sollte Euch die Kleidung vom Leibe reißen und Euch von den Stallburschen vergewaltigen lassen. Wie könnt Ihr es wagen, mich – mich! – einen untauglichen Ritter zu nennen? Kleiner Mann, ich bin Jean de Vrailly! Ich bin der größte Ritter der Welt, und das einzige Gesetz, das ich anerkenne, ist das Gesetz des Rittertums. Ergebt Euch, oder ich werde Euch an Ort und Stelle erschlagen.«
Gawin blickte in dieses wunderschöne Gesicht, das weder von Wut oder Erregung noch von anderen Gefühlen verzerrt wurde, und wollte es anspucken. Sein Vater hätte das getan.
Ich will leben.
»Ich ergebe mich«, sagte er und hasste sich selbst dafür.
»All diese albischen Ritter sind doch wertlos«, lachte de Vrailly. »Bald werden wir hier herrschen.«
Sie ließen Gawin allein mit dem Leichnam seines Knappen zurück.
Ich habe ihn umgebracht, dachte Gawin. Heiliger Christus.
Aber es war noch nicht vorbei, denn Adam war ein tapferer Mann, und als solcher starb er in der Tür des Eckzimmers.
Einer der Ausländer warf Gawins Ausrüstung aus dem Fenster, nachdem er seinem Knappen beim Sterben zugehört hatte. Die anderen lachten.
Gawin kniete neben Toma, und als die Glocken nach einer Stunde zum Abendgebet riefen, kam der Herbergswirt zu ihm.
»Ich habe den Schulzen und den adligen Herrn holen lassen«, sagte er. »Es tut mir so leid, Mylord.«
Gawin fiel nichts ein, was er hätte erwidern können.
Ich habe meinen Bruder umgebracht.
Ich habe Toma umgebracht.
Ich wurde besiegt und habe mich ergeben.
Ich hätte sterben sollen.
Warum hatte er sich bloß ergeben? Der Tod wäre besser gewesen als dies hier. Sogar der Wirt bemitleidete ihn.
Lorica · De Vrailly
Gaston wischte sich das Blut von der Klinge und betrachtete vor allem die vier letzten Zoll, mit denen er immer wieder in den Kopf des jungen Knappen gehackt und dadurch seine Gegenwehr zunichte gemacht hatte, bis er überwältigt und tot gewesen war. Seine Waffe hatte dabei ein wenig Schaden genommen und würde einen guten Schleifer benötigen, damit die Klinge wieder scharf wurde.
De Vrailly trank aus einem silbernen Becher Wein, während ihm seine Knappen die Rüstung auszogen.
»Der Mann im Hof hat dich verletzt«, sagte Gaston und hob den Blick. »Versuche nicht, es zu verbergen. Er hat dir eine Schnittwunde zugefügt.«
De Vrailly zuckte mit den Schultern. »Er hat mit seiner Waffe heftig herumgewedelt. Es ist nichts.«
»Er hat deinen Schutz überwunden.« Gaston rümpfte die Nase. »Diese Albier sind eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht werden wir noch ein paar richtige Kämpfe erleben.« Er sah seinen Vetter an. »Er hat dich schwer getroffen«, betonte er, denn de Vrailly rieb sich nun schon zum dritten Mal in genauso vielen Minuten das Handgelenk.
»Pah! Sie gehen nicht besonders geschickt mit ihren Waffen um.« De Vrailly trank noch etwas Wein. »Sie tun nichts anderes als Krieg gegen die Wildnis zu führen. Sie haben vergessen, wie man gegen andere Männer kämpft.« Er zuckte mit den Schultern. »Das werde ich ändern, und dadurch werden sie die Wildnis besiegen können. Ich werde sie zu härteren und besseren Kämpfern machen.« Er nickte in sich hinein.
»Hat dir das dein Engel gesagt?«, fragte Gaston mit offensichtlichem Interesse. Die Begegnung seines Vetters mit einem Engel hatte der ganzen Familie genutzt, aber es war noch immer eine Sache, die ihn verwirrte.
»Mein Engel hat es mir befohlen. Ich bin nichts anderes als ein Werkzeug des Himmels, Vetter.« De Vrailly sagte es ohne den geringsten Hohn.
Gaston holte tief Luft und suchte im Gesicht seines älteren Vetters nach einer Spur von Humor, doch er fand keine. »Du hast dich den besten Ritter der Welt genannt«, sagte er und versuchte sich an einem Grinsen.
De Vrailly zuckte mit den Achseln, während ihm Johan, sein älterer Knappe, den rechten Oberarmschutz abnahm und sich dann an der Armpanzerung über der Gelenkwunde zu schaffen machte. »Ich bin der größte Ritter der Welt«, wiederholte er. »Mein Engel hat mich auserwählt, weil ich die beste Lanze im Osten führe. Ich habe sechs Schlachten gewonnen; ich habe in zwölf Waffengängen gefochten und bin nie verwundet worden. Ich habe in jedem meiner Kämpfe Männer getötet: in dem Handgemenge in Tours …«
Gaston rollte mit den Augen. »Also gut, du bist der beste Ritter der Welt. Und jetzt sag mir noch, warum wir nach Albia gekommen sind – außer um die Einwohner zu belästigen.«
»Ihr König wird ein Turnier verkünden«, sagte de Vrailly. »Ich werde es gewinnen und als der Bevorzugte des Königs daraus hervorgehen.« Er nickte. »Und dann werde ich faktisch der König sein.«
»Das hat dir der Engel gesagt?«, fragte Gaston.
»Willst du seine Worte etwa infrage stellen, Vetter?« De Vrailly zog die Stirn kraus.
Gaston erhob sich und steckte sein Schwert zurück in die Scheide. »Nein, ich glaube bloß nicht alles, was man mir sagt, ob es nun aus deinem Mund oder dem von jemand anderem kommt.«
De Vrailly kniff seine wunderschönen Augen zusammen. »Willst du mich etwa einen Lügner nennen?«
Gaston schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Wenn wir so weitermachen, werden wir gleich gegeneinander kämpfen. Auch wenn du vielleicht der beste Ritter der Welt bist, ich habe dir doch die Knöchel mehr als einmal blutig geschlagen, oder?«
Ihre Blicke begegneten sich, und Gaston sah das Glitzern in de Vraillys Augen. Gaston hatte den Vorteil, ihn schon sein ganzes Leben lang zu kennen.
De Vrailly zuckte die Achseln. »Hättest du diese Fragen nicht vor unserer Abreise stellen können?«
Gaston rümpfte die Nase. »Wenn du ›Kampf‹ sagst, dann kämpfe ich. Oder? Du sagst: Ruf deine Ritter zusammen, wir erobern Albia. Ich sage: Schön, wir werden reich und mächtig sein. Oder?«
»Ja!«, meinte de Vrailly und lächelte dabei.
»Aber wenn du mir sagst, dass ein Engel Gottes dir sehr eingehende militärische und politische Anweisungen gibt …« Nun war es Gaston, der mit den Schultern zuckte.
»Morgen früh werden wir den Grafen von Towbray treffen. Er wird uns in seine Dienste nehmen. Er wünscht sich das, was sich auch mein Engel wünscht.« Zum ersten Mal schien de Vrailly zu zögern.
Gaston nutzte die Gelegenheit. »Vetter, was wünscht sich dein Engel?«
De Vrailly trank noch mehr Wein, stellte dann den Becher auf die Truhe und schüttelte sich die rechte Armschiene ab, während sein jüngerer Knappe die untere Schiene löste. »Wer kann schon wissen, was sich ein Engel wünscht?«, fragte er ruhig. »Aber die Wildnis hier muss vernichtet werden. Das ist es, was der Vater des Königs geplant hatte. Weißt du, dass sie deshalb Schneisen zwischen den Ortschaften geschlagen haben? Sie haben auf windreiche Tage gewartet und Feuer gelegt. Die alten Ritter des Königs haben vier große Schlachten gegen die Wildnis geschlagen. Was würde ich dafür geben, daran teilgenommen zu haben! Die Kreaturen der Wildnis sind zum Kampf hervorgekommen – ganze Armeen von ihnen!« In seinen Augen leuchtete es.
Gaston hob eine Braue.
»Der alte König war größtenteils erfolgreich, aber schließlich musste er im Osten weitere Ritter anwerben. Seine Verluste waren fürchterlich.« De Vrailly wirkte jetzt ganz so, als sähe er es mit eigenen Augen. »Sein Sohn, der jetzige König, hat gut gekämpft, um das zu halten, was sein Vater der Wildnis abgerungen hatte, aber er nimmt ihr kein neues Land mehr ab. Mein Engel wird das ändern. Wir werden die Wildnis wieder hinter den Wall zurücktreiben. Ich habe es gesehen.«
Gaston stieß den lange angehaltenen Atem aus. »Vetter, wie fürchterlich waren diese Verluste?«
»Sehr schlimm, vermute ich. In der Schlacht bei Chevin hat König Hawthor angeblich fünfzigtausend Mann verloren.« De Vrailly zuckte mit den Schultern.
»Diese Zahl ist so gewaltig, dass sie mir Kopfschmerzen verursacht«, sagte Gaston. »Das entspricht der Bevölkerung einer großen Stadt. Wurden die Verluste ersetzt?«
»Beim Erlöser, nein! Glaubst du, wenn es so wäre, könnten wir mit dreihundert Lanzen die Herrschaft über dieses Land zu erringen versuchen?«
Gaston spuckte aus. »Gütiger Christus …«
»Keine Blasphemien, bitte!«
»Dein Engel will, dass wir dieses Reich mit dreihundert Lanzen erobern, damit wir Krieg gegen die Wildnis führen können?« Gaston trat nahe an seinen Vetter heran. »Soll ich dir eine Ohrfeige geben, damit du aufwachst?«
De Vrailly erhob sich. Mit einer kurzen Geste entließ er seine Knappen. »Es ist nicht schicklich, dass du mein Wort in dieser Frage anzweifelst, Vetter. Es genügt schon, dass du deine Ritter gerufen hast und mir folgst. Gehorche mir. Das ist alles, was du wissen musst.«
Gaston machte ein Gesicht wie ein Mann, der auf einen üblen Gestank gestoßen ist. »Ich bin dir immer gefolgt«, sagte er.
De Vrailly nickte.
»Und ich habe dich vor einer Reihe von Fehlern bewahrt«, fügte Gaston hinzu.
»Gaston«, sagte de Vrailly mit sanfterer Stimme, »wir sollten uns nicht streiten. Ich werde vom Himmel beraten. Sei nicht eifersüchtig darauf!«
»Gern würde ich deinem Engel auch einmal begegnen«, sagte Gaston.
De Vrailly kniff die Augen zusammen. »Vielleicht ist mein Engel nur für mich bestimmt«, sagte er. »Schließlich bin ich allein der größte Ritter.«
Gaston seufzte, ging zum Fenster und blickte auf die einsame Gestalt hinunter, die noch immer im Hof kniete, während die beiden Leichname bereits in Leinen gewickelt und für die Beerdigung vorbereitet waren.
»Was hast du mit diesem Mann vor?«, fragte Gaston.
»Ich bringe ihn zum Hof und beweise damit mein Geschick. Und dann kassiere ich Lösegeld für ihn.«
Gaston nickte. »Wir sollten ihm einen Becher Wein anbieten.«
De Vrailly schüttelte den Kopf. »Er tut für seine Schwachheit Buße – für die Sünde des Stolzes, weil er es gewagt hat, sich mir entgegenzustellen, und für sein Versagen als Kämpfer. Eigentlich sollte er dort für den Rest seines Lebens in Scham knien.«
Gaston sah seinen Vetter an, der das Gesicht halb abgewendet hatte. Er betastete seinen kurzen Bart. Was immer er hatte sagen wollen, es wurde durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. Johan steckte den Kopf hinein.
»Ein Amtmann aus dem Ort, Monsieur. Er will Euch sprechen.«
»Schick ihn weg.«
Nach einer Weile, während der sich Gaston ebenfalls Wein eingeschenkt hatte, erschien Johan wieder. »Er sagt, er müsse darauf bestehen, mit Euch zu sprechen. Er ist kein Ritter, sondern nur ein hochgeborener Mann. Er trägt keine Rüstung. Er sagt, er ist der Schulze.«
»Ach ja? Schick ihn trotzdem weg.«
Gaston legte seinem Vetter die Hand auf die Schulter. »Ihre Schulzen sind Amtmänner des Königs, oder? Frag ihn, was er will.«
Es war zu hören, wie Johan zuerst sprach, dann brüllte, und schließlich wurde die Tür aufgeworfen. Gaston zog sein Schwert, genau wie de Vrailly. Ihre Gefährten kamen aus den angrenzenden Zimmern herbei; einige steckten noch in voller Rüstung.
»Ihr seid Jean de Vrailly?«, fragte der Neuankömmling, dem es vollkommen gleich zu sein schien, dass er von bewaffneten Ausländern umringt war, die ihn um mindestens einen Kopf überragten. Er trug Wams und Hose sowie hohe Stiefel, und an seiner Hüfte hing ein Langschwert. Er war etwa fünfzig Jahre alt und neigte zur Dickleibigkeit. Nur der Pelzbesatz an seiner Kappe, sein Gehabe sowie das Schwert an seiner Hüfte deuteten an, dass er ein Mann von gewisser Bedeutung war. Sein Blick sprühte Feuer.
»Das bin ich«, antwortete de Vrailly.
»Ich verhafte Euch im Namen des Königs wegen des Mordes an …«
Der Schulze wurde durch einen einzigen Schlag von Raymond St. David bewusstlos geschlagen; sein Körper sackte zu Boden. »Pah«, sagte St. David.
»Sie sind dermaßen verweichlicht«, meinte de Vrailly. »Hat er Soldaten bei sich?«
»Nicht einen einzigen«, antwortete Raymond und grinste. »Er ist allein gekommen!«
»Was ist denn das für ein Land?«, fragte Gaston. »Sind sie etwa alle verrückt?«
Am Morgen führten Gastons Männer den stumpfäugigen albischen Ritter vom Hof und setzten ihn zusammen mit seiner Rüstung auf einen Wagen, an den seine Pferde gebunden wurden. Er versuchte den Albier in ein Gespräch zu verwickeln, wurde von dem Hass im Blick des Mannes aber abgeschreckt.
»Auf die Schlachtrösser!«, befahl sein Vetter. Bei diesem Befehl setzte ein allgemeines unmutiges Grummeln ein, denn kein Ritter wollte auf seinem Kriegspferd reiten, wenn es die Gelegenheit nicht unbedingt erforderte. Ein gutes und voll ausgebildetes Kriegspferd stellte den Gegenwert von mehreren Rüstungen dar, und ein einziger gezerrter Muskel, ein Schnitt oder auch nur ein schlimmer Huf waren kostspielige Verletzungen.
»Wir müssen den Grafen beeindrucken.«
De Vraillys Ritter stellten sich im großen Hof der Herberge auf, während sich die geringeren Kämpfer auf dem Feld vor der Ortschaft bereitmachten. Sie hatten fast tausend Speere dabei und etwa dreihundert Lanzen. Gaston war schon draußen vor dem Tor gewesen und hatte sich um die einfachen Soldaten gekümmert, und nun war er zurückgekommen.
Der Wirt – ein mürrischer Kerl mit scharf geschnittenem Gesicht – kam heraus und sagte etwas zu dem albischen Ritter auf dem Wagen.
De Vrailly grinste ihn an, und Gaston wusste schon, dass es wieder Schwierigkeiten geben würde.
»Du!«, rief de Vrailly. Seine klare Stimme hallte durch den Hof. »Ich habe etwas gegen dein Maß an Gastfreundschaft einzuwenden, Ser Herbergswirt! Deine Dienstleistungen sind armselig, der Wein ist schlecht, und du hast versucht, dich in die Angelegenheiten eines Edelmannes einzumischen. Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?«
Der rattengesichtige Herbergswirt stemmte die Hände in die Hüften. Gaston schüttelte den Kopf. Er wollte sich tatsächlich mit einem Ritter streiten.
»Ich …«, begann er, als einer von de Vraillys Knappen, der schon auf seinem Pferd saß, dem Wirt von dort aus einen Tritt versetzte. Der Fuß traf ihn an der Schläfe, und er fiel ohne einen weiteren Laut zu Boden.
Die anderen Knappen lachten und sahen de Vrailly an, der dem Bewusstlosen eine kleine Börse zuwarf. »Hier ist Geld, Wirt.« Er lachte. »Wir wollen diesen Leuten beibringen, sich wie zivilisierte Menschen und nicht wie Tiere zu benehmen. Brennt die Herberge nieder!«
Bevor der letzte Wagen ihrer kleinen Armee auf die Straße gerollt war, stieg eine Rauchwolke hoch über Lorica in den Himmel auf.
Eine Stunde später befand sich Gaston an der Seite seines Vetters, als sie den Grafen von Towbray und dessen Gefolge an der Stelle trafen, wo die Straße von Lorica die Nordstraße kreuzte. Der Mann hatte fünfzig Lanzen dabei – nach albischen Maßstäben eine große Streitmacht. Der Graf steckte in voller Rüstung und trug seinen Helm. Er hatte einen Herold vorausgesandt, der den Captal de Vrailly und all jene, die ihn begleiten, zum Treffen mit dem Grafen einlud, und zwar im Schatten einer großen Eiche, die einsam an der Straßenkreuzung wuchs.
Gaston lächelte über die Vorsicht des Grafen. »Hier ist ein Mann, der das Wirken der Welt versteht«, sagte er.
»Er ist bei uns aufgewachsen«, stimmte ihm de Vrailly zu. »Komm, wir reiten zu ihm. Er hat sechs Lanzen bei sich. Wir nehmen genauso viele mit.«
Der Graf hob sein Visier, als sie sich begegneten. »Jean de Vrailly, Sieur de Ruth?«, fragte er.
De Vrailly nickte. »Ihr erinnert Euch nicht an mich«, sagte er. »Ich war noch sehr jung, als Ihr durch den Osten gereist seid. Dies hier ist mein Vetter Gaston, Herr von Eu.«
Towbray reichte ihnen nacheinander die gepanzerte Hand. Seine Ritter sahen unbeteiligt zu, hatten die Visiere geschlossen und die Waffen zur Hand.
»Hattet Ihr Schwierigkeiten in Lorica?«, fragte der Graf und deutete auf die Rauchsäule am Horizont.
De Vrailly schüttelte den Kopf. »Keine Schwierigkeiten«, sagte er. »Ich habe nur ein paar überfällige Lektionen erteilen müssen. Diese Leute haben vergessen, was ein Schwert ist, und außerdem haben sie vergessen, welchen Respekt sie einem Mann des Schwertes zu zollen haben. Ein armseliger Ritter hat mich herausgefordert – natürlich habe ich ihn besiegt. Ich bringe ihn nun nach Harndon, um Lösegeld für ihn zu fordern, nachdem ich ihn dem König gezeigt habe.«
»Wir haben die Herberge niedergebrannt«, unterbrach ihn Gaston. Er hielt es für eine dumme Tat, und sein Vetter ermüdete ihn allmählich.
Der Graf sah de Vrailly böse an. »Welche Herberge?«, fragte er.
De Vrailly erwiderte seinen Blick. »Es gefällt mir nicht, in diesem Ton befragt zu werden, Mylord.«
»Zu den zwei Löwen. Kennt Ihr sie?« Gaston beugte sich hinter seinem Vetter vor.
»Ihr wollt die Zwei Löwen niedergebrannt haben?«, erstaunte sich der Graf. »Diese Herberge gibt es schon seit unvordenklichen Zeiten. Sie hat archaische Fundamente.«
»Ich vermute, sie sind auch immer noch da, sodass ein anderer Bauer seinen Schweinekoben darüber errichten kann.« De Vrailly runzelte die Stirn. »Sie sind wie die Ratten umhergehuscht, um das Feuer zu löschen, und ich habe sie nicht davon abgehalten. Aber man hat mich beleidigt. Darum musste ich ihnen diese Lektion erteilen.«
Der Graf schüttelte den Kopf. »Ihr habt so viele Männer mitgebracht. Ich sehe etwa dreihundert Ritter. Stimmt das? In ganz Albia gibt es nur etwa viertausend Ritter.«
»Ihr wolltet eine starke Streitmacht haben. Und Ihr wolltet über mich verfügen«, sagte de Vrailly. »Hier bin ich also. Wir haben ein gemeinsames Ziel – und ich habe Euren Brief. Ihr schriebt, ich sollte alle Kämpfer mitbringen, die ich bekommen kann. Hier sind sie.«
»Ich vergesse bisweilen, wie reich der Osten ist, mein Freund. Dreihundert Lanzen?« Der Graf schüttelte den Kopf. »Ich kann sie fürs Erste bezahlen, aber nach dem Frühlingsfeldzug müssen wir zu einer neuen Übereinkunft kommen.«
De Vrailly sah seinen Vetter an. »Allerdings. Im Frühling werden wir eine ganz andere Übereinkunft haben.«
Plötzlich wurde die Aufmerksamkeit des Grafen von dem Karren in der Mitte der Kolonne in Anspruch genommen.
»Gütiger Christus«, sagte er. »Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass Ser Gawin Murien Euer Gefangener ist? Seid Ihr denn verrückt geworden?«
De Vrailly zerrte sein Pferd so heftig herum, dass Gaston Blut an seinem Maul sah.
»Auf diese Weise redet Ihr nicht mit mir, Mylord!«, beharrte de Vrailly.
Der Graf preschte an der Kolonne entlang und achtete dabei nicht auf seine Soldaten, die sich bemühten, mit ihm mitzuhalten. Er ritt auf den Wagen zu.
Argwöhnisch beobachtete Gaston seinen Vetter. »Du wirst diesen Grafen nicht umbringen, nur weil er dich verärgert hat«, sagte er leise.
»Er hat gesagt, ich sei verrückt«, gab de Vrailly zurück und kniff den Mund zusammen. In seinen Augen glitzerte es. »Seine fünfzig Ritter können wir in einer leichten Morgenübung vernichten.«
»Du wirst ein Königreich voller Leichen hinterlassen«, wandte Gaston ein. »Wenn der alte König wirklich fünfzigtausend Mann vor einer Generation in einer einzigen Schlacht verloren hat, dann muss dieses Königreich fast entvölkert sein. Du kannst nicht einfach jeden töten, den du nicht magst.«
Der Graf holte den albischen Ritter aus dem Wagen und setzte ihn auf ein Pferd, dann ritt er mit geschlossenem Visier zurück, während seine Soldaten dicht hinter ihm folgten.
»Messire«, sagte er, »ich habe im Osten gelebt und weiß, wie dieses Missverständnis entstanden ist. In Albia, Messire, herrscht nicht beständig das Recht des Krieges. Wir haben etwas, das wir das Recht des Gesetzes nennen. Ser Gawin ist der Sohn eines der mächtigsten Lords des Reiches – eines Mannes, der mein Verbündeter ist. Und Ser Gawin hat so gehandelt, wie jeder Albier es getan hätte. Es war nicht erforderlich, dass er sich zu dieser Stunde in voller Rüstung befand – nicht wenn er sich gerade in einer Herberge entspannte. Er befindet sich mit Euch doch nicht im Kriegszustand, Messire. Nach unserem Gesetz habt Ihr ihn heimtückisch angegriffen und könnt dafür zur Verantwortung gezogen werden.«
De Vrailly zog eine Grimasse. »Dann entschuldigt Euer Gesetz Schwachheit und wertet Stärke herab. Er wollte kämpfen und wurde besiegt. Gott hat in dieser Angelegenheit gesprochen, und dazu ist nun nichts mehr zu sagen.«
Die Augen des Grafen waren hinter seinem Visier zu erkennen. Gaston legte die Hand an sein Schwert. Während der Graf vernünftig und ruhig sprach, hatte sich seine Hand an den Griff einer Axt getastet, die an seinem Sattel hing. Seine Ritter hatten allesamt die gleiche Haltung eingenommen – ein wenig vorgebeugt, eine Hand zur Unterstützung auf den Pferdenacken. Sie befanden sich am Rande eines Gewaltausbruchs, waren nur noch einen Schritt von einer blutigen Katastrophe entfernt. Er spürte es genau.
»Ihr werdet Euch für den barbarischen Tod seiner Knappen bei ihm entschuldigen, oder unsere Vereinbarung wird aufgelöst.« Die Stimme des Grafen zitterte nicht, während er die Hand fest auf der Axt hielt. »Hört mir zu, Messire. Ihr könnt diesen Mann nicht zum Hof bringen. Sobald der König Eure Geschichte angehört hat, wird man Euch verhaften.«
»Es gibt in diesem Land nicht genügend Soldaten, die mich verhaften könnten«, sagte die Vrailly.
Die Männer des Grafen zogen ihre Schwerter.
Gaston hob die leeren, gepanzerten Hände und setzte sein Pferd zwischen die beiden Edelmänner. »Meine Herren! Hier liegt ein Missverständnis vor. So ist es schon immer gewesen, wenn sich Ost und West begegneten. Mein Vetter hat nur innerhalb seiner Rechte als Ritter und Seigneur gehandelt. Und Ihr sagt, dass sich dieser Ser Gawin ebenfalls innerhalb seiner Rechte bewegt hat. Müssen wir, die wir so weit gereist sind, nur um Euch zu dienen, Mylord, für dieses Missverständnis etwa bezahlen? Gott gefällt es, dass wir alle Menschen von Verstand und gutem Willen sind. Ich für meinen Teil will mich bei dem jungen Ritter entschuldigen.« Gaston sah seinen Vetter finster an.
Auf dem schönen Gesicht zeichnete sich Verständnis ab. »Also gut«, sagte er. »Er ist der Sohn Eures Verbündeten? Dann will ich mich ebenfalls bei ihm entschuldigen. Aber, beim guten Gott, er braucht unbedingt eine bessere Ausbildung an den Waffen!«
Gawin Murien hatte sich inzwischen so weit erholt, dass es ihm möglich war, seine Rüstung auf eines der Pferde zu legen und ein anderes zu besteigen. Dann folgte er dem Grafen die Kolonne entlang, so wie ein Kind seiner Mutter folgt.
Der Graf hob sein Visier. »Gawin!«, rief er. »Die ausländischen Ritter … sie haben andere Gebräuche. Der Herr de Vrailly will sich bei Euch entschuldigen.«
Der Albier nickte deutlich.
De Vrailly hielt sein Pferd außerhalb seiner Reichweite an, während Gaston näher an ihn heranritt. »Ser Ritter«, sagte er, »ich für meinen Teil bedauere den Tod Eurer Knappen zutiefst.«
Der albische Ritter nickte erneut. »Das ist sehr höflich von Euch«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme.
»Und was mich angeht«, erwiderte de Vrailly, »so will ich kein Lösegeld für Euch fordern, denn der Graf beharrt darauf, dass ich Euch nach Eurem Waffenrecht gesetzeswidrig entgegengetreten bin.« Die Worte kamen dermaßen unwillig aus ihm heraus, als hätte man sie mit einem Angelhaken hervorgezogen.
Murien sah in seinem fleckigen Wams und seiner Hose, die durch das lange Knien im Hof der Herberge ruiniert war, nicht gerade wie ein strahlender Held aus. Nichts an ihm glänzte oder glitzerte. Er hatte sich nicht einmal seinen Rittergürtel umgelegt, und sein Schwert lag noch auf dem Bett im Wagen.
Abermals nickte er. »Ich habe Euch verstanden«, sagte er.
Er wendete sein Pferd und ritt davon.
Gaston sah ihm nach und fragte sich, ob es nicht für alle besser gewesen wäre, wenn sein Vetter ihn im Herbergshof getötet hätte.