10
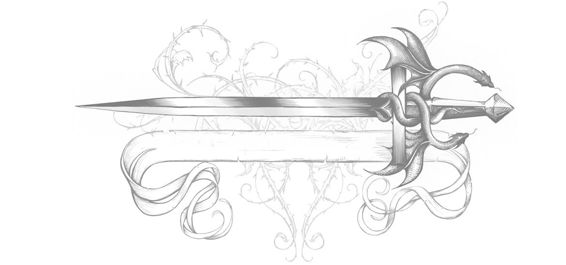
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Peter
Peter lag auf dem Erdboden hinter einem Baum, der so groß wie ein kleines Haus war, und konnte gar nichts sehen. Er wartete auf die Schlacht.
Aber mehr als alles andere wollte er sich erleichtern. Zuerst war es nur eine kleine Irritation an der Wurzel seines Penis gewesen, allmählich aber umhüllte es all seine Gedanken. Nach der ersten von mehreren Ewigkeiten überlagerte das Verlangen, sich zu entleeren, sowohl Angst als auch Schrecken.
Von Zeit zu Zeit trieben auch noch andere Gedanken auf ihn zu – die Möglichkeit, ein besseres Versteck zu finden; der Wunsch, einen Blick auf den Feind werfen zu können; besseren Schutz zu suchen. Er hatte keine Erfahrung mit dem Krieg im Westen und konnte sich nicht vorstellen, wie es sein mochte, einem Mann in einer Stahlrüstung gegenüberzustehen.
Er verfügte über ein Messer, einen Bogen und neun Pfeile.
Und er musste pissen.
Bald schien es ihm möglich, dass er es einfach laufen lassen und in seinem eigenen Urin liegen konnte, solange es nötig war.
Er fragte sich, ob er wohl der Einzige mit diesem Drang war. Er fragte sich auch, ob Ota Qwan ihm hatte raten wollen, sich zu erleichtern, bevor sie sich in den Hinterhalt legten. Oder ob er es ihm absichtlich nicht geraten hatte. Der schwarz bemalte Mann hatte etwas Grausames an sich. Peter spürte bereits, dass Ota Qwan nur wenig Freunde hatte, weil er allzu gern Salz in eine Wunde streute. Und er hatte den Eindruck, dass die Schonzeit zwischen ihnen vorbei war. Am Anfang hatte Ota Qwan Peters Gesellschaft so verzweifelt gesucht, wie dieser einen Verbündeten unter den Fremden haben wollte, aber jetzt, als sich eine Kriegerschar um ihn herum bildete, machte Ota Qwan eine seltsame Veränderung durch. Es war keine gute.
Und er musste wirklich pissen.
Für ihn gab es keine Möglichkeit, die Zeit zu messen. Eine Ameise krabbelte von dem in einem Mokassin steckenden linken Fuß bis zur rechten Schulter hoch. Etwas Größeres überquerte sein Knie. Zwei Kolibris flogen herbei und besuchten eine Blume neben seinem Kopf, und er lag so still in seinem qualvollen Drang, sich zu erleichtern, dass das Männchen, dessen Frühlingsfederkleid leuchtend rot war, fast auf seinem bemalten Gesicht gelandet wäre.
Dreihundert Mann – nein, mehr noch, vielleicht waren es fünfhundert – lagen zu beiden Seiten der Straße, die den Hang hinunter zu einer Furt durch einen tiefen Fluss führte. Sie befanden sich irgendwo östlich von Albinkirk. Niemand gab ein Geräusch von sich.
Er musste pissen.
Er hörte das metallische Kratzen eines Hufeisens über Stein, und dann ein Kreischen – einen Schrei, der von der anderen Seite seines Baumes zu kommen schien.
Niemand regte sich.
Der Schrei wurde wiederholt und plötzlich abgeschnitten, und nun war ein anderes Geräusch zu hören – schnelles Hufgeklapper.
Plötzlich stand Skadai auf dem Weg, nur einige Armlängen von ihm entfernt, und rief leise etwas. »Dodak-geer-lohn!«, sagte er. »Gots onah!«
Überall um Peter herum erhoben sich die Krieger aus ihrem Hinterhalt, rieben sich die Glieder oder kratzten sich Borken und Laub von der Haut. Die Hälfte von ihnen machte sich sofort daran, Wasser zu lassen. Peter tat es ihnen gleich. Er hatte nie gewusst, dass Urinieren zu einem so großen Vergnügen werden konnte.
Aber Skadai blieb in Bewegung. Ota Qwan klopfte Peter auf die Schulter. »Beeil dich«, sagte er, als ob Peter ein Kind wäre.
Peter nahm seinen Bogen auf und folgte den anderen.
Sie liefen etwa zwanzig Pferdelängen auf dem Weg nach Osten und stießen auf ein totes Pferd sowie auf einen Mann, der unter dem Tier eingeklemmt war. Man hatte ihm die Kehle durchgeschnitten. Sein Blut sammelte sich zwischen den Steinen und tröpfelte in einer klebrigen Spur hangabwärts auf den Fluss zu.
Nachdem sie lange Zeit weitergelaufen waren, schwärmten sie plötzlich zwischen den großen Bäumen aus. Der Fluss lag inzwischen hinter ihnen, und Peter hatte große Angst. Sie rannten geradewegs auf den Feind zu – oder zumindest hatte es den Anschein.
Skahas Gaho musste es genauso sehen, denn als sie einmal stehen blieben, stellte er sich vor Ota Qwan und sagte etwas, das eindeutig ein Protest war.
Ota Qwan schlug ihn. Es war kein heftiger Hieb, aber ein schneller, und der jüngere Krieger krümmte sich vor Schmerz zusammen.
Ota Qwan sprach schnell; Speichel flog ihm dabei aus dem Mund.
Skadai lief beinahe lautlos herbei, hörte Ota Qwan zu, nickte und rannte an der lockeren Linie der Krieger entlang, die sich zu beiden Flanken so weit zwischen den Bäumen erstreckte, wie das Auge reichte. Hier waren die Bäume derart gewaltig – in der Hauptsache handelte es sich um uralte Ahorne und Buchen mit wunderbaren Kronen –, dass zwei Männer sie nicht mit ausgestreckten Armen umfangen konnten. Aber wegen des hohen Blätterbaldachins gab es nur wenig Unterholz, und obwohl der Waldboden mit Sonnenschein gesprenkelt war, wuchs mit Ausnahme der prächtigsten Irisse, die Peter je gesehen hatte, nur wenig auf dem Teppich aus altem Laub.
Skahas Gaho richtete sich wieder auf, sah Skadai böse an und spuckte in Ota Qwans Richtung. Er sagte etwas zu den anderen Kriegern und rannte dann an der Formation entlang. Brant drehte sich um und wollte ihm folgen, während Ota Qwan eine Braue hob.
Peter handelte, ohne nachzudenken. Er schob Ota Qwans Bogenarm heftig beiseite.
Der Krieger versuchte ihm mit der Spitze seines Bogens einen Schlag gegen das Ohr zu versetzen, aber Peter packte die Waffe und drehte Ota Qwans rechten Arm mit einer einzigen Bewegung um, sodass dem Mann die Schulter ausgerenkt zu werden drohte.
»Ich wurde nicht als Sklave geboren«, sagte Peter. »Leg dich nicht mit mir an.«
»Sie wollen desertieren!« Ota Qwan sah zu, wie die beiden Männer wegliefen.
»Du hast Skahas Gaho geschlagen, anstatt mit ihm zu sprechen.« Am liebsten hätte Peter laut aufgelacht, als er bemerkte, dass er Ota Qwan gerade die Grundlagen der Anführerschaft erklärte. Er hielt den Arm des Mannes noch immer in festem Griff und hatte keineswegs vor, ihn loszulassen.
Der andere versteifte sich, dann sackte er in sich zusammen. »Er wollte nicht gehorchen. Er wollte sich Skadai widersetzen!«
Nun ließ Peter den schwarz bemalten Mann los. »Ich bin erst seit drei Tagen ein Sossag, aber mir scheint, dass dich Skadais Schwierigkeiten nichts angehen. Du hast nicht wie ein Sossag, sondern wie ein Albier gedacht.« Peter zuckte die Achseln.
Die anderen drei Männer, die um sie herumstanden – Pal Kut, Stachelkopf und Mullet –, beobachteten sie aufmerksam.
»Aber du wirst mir gehorchen«, zischte Ota Qwan Peter an. »Oder?«
Peter nickte. »Das werde ich«, sagte er und stellte fest, dass ihm diese Worte ein unangenehmes Gefühl verursachten.
Pal Kut rief etwas. Nun bewegte sich die Formation wieder schnell vorwärts, die Männer rannten beinahe. Die meisten hatten bereits Pfeile in ihre Bogen eingelegt.
Peter rannte zu seinem Platz in der Reihe, zog mit zitternden Fingern einen Pfeil hervor, ließ ihn fallen, drehte sich um, weil er ihn aufheben wollte, denn er besaß zu wenige, als dass er auf einen einzigen verzichten konnte. Er bückte sich, und in diesem Augenblick explodierte die ganze Welt.
An der Front, mitten in der Viehtreiberherde, stieß ein Bulle ein langes, tiefes Röhren aus. Und plötzlich war die Luft voller Pfeile; sie flogen in beide Richtungen. Und die Sossag stießen einen gewaltigen Schrei aus …
… und griffen an.
Peter hatte seinen Pfeil eingelegt. Er rannte vor und sah, wie Pal Kut von einem Pfeil in die Eingeweide getroffen wurde, der so groß und kräftig war, dass er unter einer Blutfontäne am Rücken wieder austrat. Der Pfeilkopf war wie eine Schwalbe geformt und glitzerte in einer schrecklichen rot-blauen Bösartigkeit.
Peter rannte weiter und folgte Ota Qwan.
Er sah seinen ersten Feind – einen großen blonden Jungen in einem Kettenhemd, der sich gelassen hinter einem Busch erhob und einen Pfeil auf einen Krieger abschoss, den er nicht kannte – und schoss aus so geringer Entfernung auf ihn, dass sein Gegner durch die Wucht des Pfeils aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und wie ein geköpftes Huhn einige Schritte umhertaumelte, bevor er zusammenbrach.
Ota Qwan sprang den Mann mit einem heiseren Schrei an und schoss auf Armeslänge seinen eigenen Pfeil auf ihn ab. Der Stachelkopf drang an der Schulter durch das Kettengewebe. Ein Dutzend Krieger überfielen den verwundeten Jungen, und nach wenigen Herzschlägen war er tot und skalpiert.
Ota Qwan nahm dem Jungen das Schwert ab – vier Fuß langer, glänzender Stahl – und schwang es. Alle Krieger, die seinen Angriff beobachtet hatten, stießen einen lauten Schrei aus, und dann stürmten sie schon wieder voran.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Hector Lachlan
Sobald die Berichte der Späher eintrafen, wusste Hector Lachlan, dass er in ernsten Schwierigkeiten steckte. Im Gebirge nördlich der Herberge hielt der Wyrm von Erch die Hinterwaller in Schach. Es kostete Hector etliche Tiere, den Wyrm bei Laune zu halten, aber so war es in den Bergen nun einmal. Seit tausend oder mehr Jahren hielt der Wyrm die Wildnis aus den Bergen heraus, zum Nutzen vieler Generationen von Klanleuten und Viehtreibern.
Hier im Süden sollte es eigentlich die Aufgabe des Königs sein, die Hinterwaller fernzuhalten. Der Otterbach wurde von einigen als Grenze zwischen den Grünen Bergen und dem Königreich Albia betrachtet. Für Lachlan stellte diese Gegend einfach nur sicheren Boden dar, wem auch immer sie gehören mochte. Der Otterbach war ein Nebenfluss des Albin. Von der nächsten Erhebung aus würde Albinkirk sichtbar sein, selbst wenn es noch einen ganzen Tag dauerte, die Mastrinder zur Südfurt zu treiben.
Aber es war wichtig, dass sie beinahe da waren. Die Klanmänner und Treiber kannten die Hinterwaller. Diese waren wild, böse und im Umgang mit Waffen äußerst geschickt. Und sie hatten seinem Zug einen Hinterhalt gelegt, was bedeutete, dass sie seine Herden ausgespäht hatten, ihren Umfang kannten und das Gefühl hatten, ihn besiegen zu können. Das bedeutete, dass es sich um dreihundert oder vierhundert Krieger handeln musste.
Hector zögerte nicht. Es war eine Situation, wie er sie sich schon viele Male vorgestellt hatte, auch wenn er sie noch nie hatte durchleben müssen.
Er wandte sich an Donald Redmane, seinen Tanisten. »Geh zur Nachhut zurück. Nimm so viele Tiere wie möglich mit und begib dich schnell zur Herberge.«
Donald war ein guter Mann – treu ergeben und hartnäckig. Nicht besonders klug zwar, aber ein wunderbarer Mann im Kampf; außerdem hatte er eine schöne Stimme und geschickte Hände. »Geht Ihr, Lachlan. Ich kann sie hier aufhalten.«
Lachlan schüttelte den Kopf. »Mit all deinen Prellungen und den anderen Verletzungen? Mach dich auf den Weg. Sofort.«
Redmane schüttelte sein Haar aus. »Beim Wyrm, Hector. Wir sind einen Tagesmarsch von Albinkirk entfernt. Warum treiben wir die Tiere nicht auf diese Bastarde zu und erledigen die Überlebenden mit dem Schwert?«
Hector warf einen Blick auf den Wald. »Nein. Mein Wort darauf, Donald, sie sind uns mindestens im Verhältnis von zwei zu eins überlegen, und wenn wir die Herde in diesem Wald loslassen …« Er hielt inne, weil er nicht ganz verzagen wollte.
Dann drehte er sich um und sah den Späher an. »Reite zur Herberge. Nimm zwei Pferde mit, damit du sie wechseln kannst. Reite wie der Wind, Junker. Vielleicht befinden sie sich schon im Hochland. Komm erst dann zurück, wenn du hundert Schwertkämpfer mitbringen kannst.«
Die anderen Männer in seiner Nähe lösten ihre Schwerter aus den Scheiden. Andere überprüften ihre Bögen, und einer nahm seine Kappe ab, ersetzte sie durch eine neue und trat zu seinem Reittier, um seinen Helm zu holen.
»Ihr, die ihr bei mir in der Nachhut seid, habt heute Pech«, sagte Hector. »Ich fürchte, für keinen von uns wird es ein Abendessen geben.«
Ian Kuhfladen, ein großer Mann mit schlammig braunem Gesicht, schenkte ihm ein Grinsen. »Pah. Hab noch nie jemanden getroffen, den ich nicht hätte umbringen können.«
»Wir werden uns den Hinterwallern im Wald stellen, wo sie uns nicht niederschießen können«, sagte Hector. »Zieht den Kampf so lange wie möglich hinaus. Wenn ich das Horn blase, kommt jeder zu mir, und wir bilden einen Schildwall.« Er sah sich um. Die Pflichten wurden jeden Tag neu verteilt, denn es war viel schlimmer, am Ende der Herde zu gehen, als sich vor ihr zu befinden. Deswegen hatte er weder alle Ältesten noch alle Jüngsten oder alle besten Kämpfer um sich herum versammelt. Einige der Männer kannte er nicht einmal. Aber sie alle waren gut bewaffnet. Es waren fünfzig Mann, und nicht ein einziges Gesicht verriet das Entsetzen, das jeder von ihnen spüren musste. Es waren gute Männer, die nicht viel Aufhebens machen würden.
Als Hochländer wussten sie, wie man starb.
Er dachte an seine neue Braut und hoffte, sie werde ihm einen Sohn schenken, denn er hatte noch keinen, auch wenn er schon einige Bastarde gezeugt hatte. Dann packte er den Steigbügel seines Boten.
»Hör mir zu«, sagte er. »Teile meiner Frau mit, falls sie einen Sohn zur Welt bringen sollte, wird er groß und stark werden, und wenn er reich und beliebt genug ist, soll er eine Armee nach Norden führen und eine blutige Schneise durch die Hinterwaller schlagen. Ich verlange fünfhundert Leichen als mein Wergeld. Das soll sie ihm sagen, wenn er alt genug ist. Und sag ihr, dass ihre Lippen das Süßeste waren, das ich je genossen habe. Ich werde mit ihrem Geschmack auf meinen eigenen Lippen sterben.«
Der junge Mann war bleich. Er hatte beobachten müssen, wie ein Kinderfreund von ihm gestorben war, und nun wurde er allein auf eine hundert Meilen lange Reise geschickt – vermutlich der einzige Überlebende des gesamten Viehzugs.
»Ich könnte auch bei Euch bleiben«, sagte er.
Hector grinste. »Ich bin sicher, dass du das könntest, Junge, aber du bist meine letzte Botschaft an meine Frau und mein Kind. Du musst gehen.«
Der Bote wechselte das Pferd. Ein Bulle blökte, und die Kühe drehten langsam um. Das Ende der Kolonne bewegte sich bereits nach Norden, weg von den feindlichen Linien, die irgendwo dort draußen waren.
Dann wandte er sich wieder an seine Männer, von denen die meisten inzwischen die Helme aufgesetzt und die Waffen ergriffen hatten und zum Kampf bereit waren. Der einsame Priester, sein Halbbruder, hob das Kreuz hoch in die Luft, und alle Männer knieten nieder, während Paul MacLachlan für ihre Seelen betete. Als sie alle Amen gesagt hatten, steckte der Priester das Kreuz wieder unter seinen Umhang und legte einen Pfeil in seinen Bogen.
Sein Vetter Ranald besaß eine große Axt – ein wunderbares Ding, das er nun durch die Luft wirbeln ließ. Er trug Panzerhandschuhe und hatte eine feine Ausrüstung, die auch einem Ritter zur Zier gereicht hätte; schließlich hatte er einmal für den König im Süden gedient.
»Ranald übernimmt das Kommando, falls ich sterben sollte«, sagte Hector. »Wir bewegen uns jetzt in den Wald hinein. Die Jüngsten gehen voran und beginnen die Scharmützel. Lasst euch nicht überrollen. Schießt, wenn ihr könnt, und zieht euch dann wieder zurück. Ihr kommt sofort wieder zu mir, wenn ihr mein Horn hört. Wir müssen aushalten, bis die Sonne den höchsten Stand erreicht, denn dann wird Donald mit den Tieren weit genug weg sein, und wir sind nicht umsonst gestorben.«
Ranald nickte. »Danke, Vetter. Du erweist mir eine große Ehre.«
Hector zuckte mit den Achseln. »Du bist der beste Mann dafür.«
Ranald nickte noch einmal. »Ich wünschte, dein anderer Bruder wäre hier bei uns.«
Hector warf einen Blick zwischen die Bäume. Er konnte die herannahenden Feinde spüren. Vielleicht – vielleicht würden sie zu lange im Hinterhalt liegen oder am Ende doch vor dem Kampf zurückscheuen.
Aber es waren eine hohe Anzahl von Bewegungen tief zwischen den Bäumen zu erkennen. Die Hinterwaller kamen.
»Das wünschte ich mir auch«, sagte Hector und schaute die Reihe seiner Männer an. »Wir brechen auf. Los, verteilt euch.«
Rasch bewegten sie sich auf den Wald zu. Seine größte Angst bestand darin, dass der Feind bereits den Waldrand erreicht haben könnte. Aber so war es nicht, und er konnte seine fünfzig Männer tief in den Wald hineinführen, wo die Schwertlilien blühten wie Kreuze auf einem Friedhof.
Er stellte je zwei Männer hinter einen Baum und schickte die jüngsten und schnellsten einen Speerwurf vor die sehr offenen Linien. Dann brüllte noch einmal ein Bulle in der Ferne, und plötzlich flogen die Pfeile.
In den ersten Augenblicken der Schlacht wäre Hector fast gestorben. Ein Pfeil traf seinen Helm, wirbelte ihn herum, und ein zweiter Pfeil prallte gegen den Nasenschutz und bog ihn nach innen. Der Pfeil war nur einen Fingerbreit vom Auge entfernt gewesen.
Seine Männer schlugen sich gut, aber die Jungen an der Front wurden überrannt und getötet – und das war sein Fehler. Die Hinterwaller waren schneller, kühner und gnadenloser, als er es sich hatte vorstellen können, und doch fügten sie diesen Wilden einen gehörigen Schaden zu. Als sich Hectors lockere Angriffslinie zurückzog und die Männer in ihren schweren Rüstungen nach Deckung suchten, zögerten die Hinterwaller einen Augenblick zu lange, bevor sie ihnen folgten, was ihnen die Möglichkeit gab, noch einmal zuzuschlagen und eine schmale Linie aus Leichen zurückzulassen.
Ein einsamer Hinterwaller, der von Kopf bis Fuß rot angemalt war, stand zwischen zwei großen Bäumen und rief etwas, dann rannte er vor. Er griff Ian Kuhfladen an, und Kuhfladen stand nie wieder auf – doch nur eine Handvoll Bemalter folgte dem Roten.
Dank sei Gott, dachte Hector.
Seine Männer waren in die letzte Deckung vor der Wiese zurückgezwungen worden, und die Sonne stand noch nicht einmal in halber Höhe am Himmel.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Peter
Peter besaß keine Pfeile mehr und hatte einen tiefen Schnitt am rechten Schienbein davongetragen. Er war von dem wild geschwungenen Schwert eines fliehenden Mannes getroffen worden, und es hatte ausgereicht, um ihn für einige Minuten auf den Erdboden zu schicken.
Er hatte den großen Dolch des toten Mannes ergriffen, der beinahe so groß wie ein Kurzschwert war, und er hatte demselben Leichnam auch den Faustschild abgenommen. Nun befand er sich nicht mehr in der Nähe von Ota Qwan – der schwarz bemalte Krieger war schon früher verschwunden –, sondern dicht hinter Skadai, der sich mit größerer Anmut bewegte, als Peter es je bei einem Krieger beobachtet hatte.
Gegen wen auch immer sie kämpfen mochten, der Feind war tapfer, mächtig, still und viel zu gut bewaffnet.
Die Sossag starben. Schon lagen fünfzig Mann am Boden, vielleicht sogar mehr. Peter glaubte, es sei an der Zeit, die Niederlage einzugestehen. Aber Skadai war anderer Meinung. Er rannte geradewegs in die feindlichen Linien hinein, griff einen großen Krieger an und schlitzte ihm mit einem Messer die Kehle auf.
Angesichts eines solchen Wagemutes konnte Peter nicht zurückbleiben.
Als der Feind das nächste Mal kehrtmachte und weglief, gesellte sich Peters wilder Schrei zu dem von Skadai, und er sah Ota Qwan, der plötzlich ganz in der Nähe erschien und ebenfalls mit einstimmte. Die drei verließen ihre Deckung, wo sie sich vor den Pfeilen geschützt hatten, und griffen wieder an. Rechts von Ota Qwan sprang auch Skahas Gaho auf die Beine, hatte sein Schwert in der Hand und gesellte sich zu den anderen. Es waren insgesamt nicht viele – vielleicht ein Dutzend.
Ein Pfeil flog aus dem Sonnenlicht wie eine Hornisse herbei und traf Skadai in der Lende. Er stolperte, taumelte und brach zusammen.
Peter lief weiter. Der Mann, der den Pfeil abgeschossen hatte, war ein wenig hinter seinen Gefährten zurückgeblieben, und Peter rannte auf ihn zu. Sein ganzes Selbst war auf diesen Mann konzentriert, einen rothaarigen Riesen in einem feinen Kettenhemd, das im Waldschatten schimmerte. Er trug einen Eisenkragen und lange Lederhandschuhe.
Peter riss den Mund auf und schrie. Der Mann warf den Bogen zur Seite und zog sein Schwert. Ein Pfeil ritzte die Hinterseite von Peters Schenkel auf, bevor er zwischen seinen Beinen weiterflog. Peter hielt seinen Schild vor sich, und das Schwert des Mannes hieb darauf ein. Peter drückte den Schild vor, in den sich das Schwert gebohrt hatte, und mit seinem eigenen riesigen Dolch schlug er in das Gesicht des Mannes. Zähne flogen umher, und ein Auge war schon zerschnitten, bevor sich der Mann überhaupt umdrehen konnte. Dann packte Peter die Klinge mit der anderen Hand und drückte sie gegen die gepanzerte Kehle des Mannes, er sägte und sägte, bis er die Luftröhre durch den Eisenkragen hindurch zerquetscht hatte.
Pfeile trafen seinen sterbenden Gegner – es waren mindestens ein Dutzend, abgefeuert von seinen Freunden. Peter wirbelte herum, und jeder Pfeil, der auf ihn gezielt gewesen war, traf nun den Rothaarigen. Er sackte in Peters Händen nach unten und war tot, bevor er auf dem Boden ankam. Peter ließ seine Waffe fallen, bückte sich und hob das große Schwert auf. Ota Qwan schrie triumphierend, sein Schrei wurde von den anderen in einer langen Reihe aufgenommen.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Hector Lachlan
Der Priester, Paul Mac Lachlan, starb schrecklich. Er war nie ein großer Schwertkämpfer gewesen, und einer der bemalten Teufel hatte ihm das Gesicht aufgeschlitzt, ihn erdrosselt und seinen Leichnam als Schild benutzt.
Es demoralisierte Hectors Männer, als sie sahen, wie einer der Ihren so mühelos von einem Mann ohne Rüstung überwunden und getötet werden konnte.
Doch Hector war der Ansicht, dass er dem Feind große Verluste beigebracht hatte. Alle Geschichten besagten, dass die Hinterwaller nicht gern Verluste hinnahmen, doch seine Männer hatten mindestens fünfzig, wenn nicht sogar noch mehr von ihnen getötet.
Und ihr roter Anführer lag am Boden.
Das musste man dem Priester lassen – er hatte den Kerl mit einem Pfeil niedergestreckt.
Hector grinste die Männer um ihn herum an. »Wir müssen besser werden«, sagte er.
»Armer Paul«, meinte Ranald. Einer der Wilden skalpierte den Priester, und Ranald schoss einen Pfeil auf den bemalten Bastard ab. Er kreischte auf.
Hector hielt sein Horn über dem Kopf, und alle übrig gebliebenen Männer waren jetzt bereit.
»Wir durchbrechen ihre Linie und errichten unseren Schildwall da drüben«, sagte er. Es wäre dumm, sich weiter ins offene Gelände zurückzuziehen.
Die Hinterwaller schöpften Mut aus dem Erfolg ihres letzten Ausfalls, und nun rückten sie wieder vor. Seine Männer verschossen ihre letzten Pfeile. Als Hector zusah, gingen wieder etliche Hinterwaller zu Boden. Wenn noch mehr Wald hinter ihm wäre, würde er sich jetzt wieder zurückziehen. Doch in seinem Rücken befanden sich nur noch Wiesen und Wildblumen.
Er hielt sein Horn an die Lippen und blies es.
Jeder Mann, der ihm noch verblieben war, drehte sich um und rannte ihm entgegen. Innerhalb weniger Herzschläge hatten sie ihn erreicht, und diesmal flog nur eine Handvoll feindlicher Pfeile auf sie zu.
Er wartete nicht auf die Nachzügler. Als er genügend Männer beisammenhatte, stürmte er vorwärts.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Peter
Peter verließ allmählich der Mut.
Ota Qwan hingegen nicht. Er sprang auf die Beine und schoss bereits vor, als sich noch einer der anderen Krieger mit dem Messer in der Hand über den Leichnam des rothaarigen Kriegers beugte – und dafür gleich mit dem Leben bezahlen musste.
»Gots onah!«, brüllte Ota Qwan.
Aber die Krieger folgten ihm nicht.
Peter konnte kaum mehr Luft schnappen. Der Albtraum des Nahkampfes mit dem Rothaarigen hatte ihm nicht nur den Atem, sondern auch seine Kraft und allen Mut geraubt. Er wollte sich nur noch hinlegen und schlafen.
Die Wunde in seinem Bein schmerzte, und besorgt fragte er sich, wie tief sie sein mochte.
Ota Qwan stürmte voran, als unter den gerüsteten Feinden ein Horn ertönte.
Peter zwang sich, dem schwarz bemalten Mann zu folgen. Als er zurückblickte, sah er, wie sich auch Skahas Gaho und Brant aus dem Gras erhoben.
Sie folgten ihm, und es waren noch zehn weitere bei ihnen. Sie sprangen hinter ihm her, und er rannte so schnell wie möglich hinter Ota Qwan her.
Rechts von ihnen entsetzte der Feind sie plötzlich, indem er angriff – nicht bloß eine Handvoll Männer, sondern eine feste Keilformation, die mitten in ihre eigene Linie hineinwies.
Peter war so weit rechts, dass ihm nicht einmal der letzte Mann des Keils nahe genug kam, um gegen ihn zu kämpfen; er rannte in dem Augenblick an ihm vorbei, als dieser unschlüssig stehen geblieben war, und nun hörte er tiefer im Wald Schreie.
Ota Qwan lief weiter. Peter glaubte nicht, dass er den Angriff des Feindes überhaupt bemerkt hatte, aber er folgte dem Mann.
Skahas Gaho bückte sich und skalpierte den Rothaarigen.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Hector
Hector war noch frisch und unverletzt. Die erste Gruppe der Hinterwaller starb so schnell unter seiner Schwertspitze, wie er seinen Kriegsschrei dreimal ausstoßen konnte; dann war seine Keilformation allein im Wald.
Beim Kriegshandwerk kommt es darauf an, schnell zu sein und darauf zu hoffen, dass der Feind einen Fehler macht. Das war der Grundsatz seines Vaters gewesen, und es war auch sein eigener. Darum hielt er nicht an und bildete auch keinen Schildwall.
»Folgt mir!«, brüllte er und preschte weiter voran.
Weiter und weiter.
Die Hinterwaller waren schneller, aber keineswegs in besserer körperlicher Verfassung als die Viehtreiber, und das trügerische Gelände sowie eigenes Pech – gezerrte Muskeln und Wunden – überließen sie der Gnade der gerüsteten Männer. Diese jedoch kannten keine Gnade. Auf hundert Schritte starb je ein Dutzend Hinterwaller.
Hector rannte weiter. Seine Seite schmerzte, und in seinen Beinen brannte es. Es war anstrengend, in voller Rüstung mehrere Schritte zurückzulegen.
Und es war ungeheuer anstrengend, ganze fünfhundert Schritte zu rennen. Es glich einer Prüfung.
Die meisten seiner Männer blieben bei ihm. Die wenigen, die anhielten, starben.
Die Hinterwaller flohen, doch sogar in ihrer panischen Flucht bewegten sie sich noch wie ein Schwalbenschwarm oder eine Fischschule, und jene, die von dem Angriff nicht bedroht waren, erholten sich zuerst. Schon flogen wieder Pfeile zwischen den Bäumen hindurch.
»Weiter!«, schrie Hector, und seine Männer gaben ihr Bestes.
Ein Hinterwaller-Junge stolperte über eine Wurzel und fiel. Ranald köpfte ihn mit einer bloßen Drehung seines Handgelenks.
Weiter und weiter.
Und dann musste Hector stehen bleiben. Er stützte sich auf den Griff seines großen Schwertes, und in seiner Seite pochte es.
Ranald legte ihm die Hand auf den gepanzerten Ellbogen. »Du brauchst Wasser«, sagte er.
Eine Scheunenlänge entfernt fanden sie den jungen Clip, den Bauern aus der Herberge, der mit aufgeschlitzter Kehle unter seinem toten Pferd lag. Einen Bogenschuss entfernt lag die Furt, die sie hatten durchqueren wollen. Hinterwaller-Pfeile erfüllten wieder die Luft, und Hector ließ etwa dreißig Mann zurück, als er die Furt durchquerte und sich eine kurze Ruhepause gönnte. Seine Männer tranken Wasser, legten sich unter die Bäume und atmeten durch. Diejenigen, die noch Pfeile besaßen oder einige vom Boden aufgehoben hatten, suchten sich sorgfältig ihre Ziele aus – und es begann von Neuem.
Ranald kratzte sich am Bart. Ein Pfeil hatte seinen Brustpanzer getroffen, diesen aber nicht durchschlagen, ihm jedoch durch die Wucht des Aufpralls eine Rippe gebrochen. Er atmete schwer. »Das war es wert«, sagte er.
Hector nickte. »Jetzt ist Mittag, und wir haben sie eine Meile zurückgedrängt.« Dann zuckte er die Achseln. »Hätten wir sie schlagen können, wenn es mir gelungen wäre, alle Männer zusammenzuhalten?«
Ranald spuckte ein wenig Blut. »Nein. Sie sind zu gewitzt, und wir haben nicht annähernd genug von ihnen getötet. Hector Lachlan, es ist eine Freude und eine Ehre, dich zu kennen.« Ranald streckte die Hand aus, und Hector ergriff sie. »Wir sollten uns aber nichts vormachen. Ich vermute, dass mindestens fünfhundert von diesen Verrückten da draußen im Wald stecken. Wenn du dort einen Mann hineinschickst, sind das Glück und fünfzig Feinde gegen ihn.«
Hector schüttelte den Kopf. »Es tut mir so leid, dass ich dich hergeführt habe, Vetter.«
Ranald zuckte trotz seiner Erschöpfung und dem Gewicht seines Kettenhemdes die Achseln. »Für mich ist es eine Ehre, zusammen mit dir zu sterben.« Er lächelte in den sonnenhellen Himmel. »Wegen eines bestimmten Mädchens, das ich liebe, tut es mir leid. Aber es ist eine gute Art zu sterben.«
Lachlan schaute hoch in die Sonne. Pfeile flogen in dichten Schwärmen, und einige kamen von ihrer Seite des Flusses. Die Wilden hatten die Furt also auch gefunden.
Trotz allem war der Himmel blau, die Sonne warm und golden, und die Blumen des Waldes sahen so wunderschön aus. Er lachte und streckte sein Schwert in die Luft. »Bringen wir es hinter uns!«, brüllte er.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Peter
Peter folgte Ota Qwan, bis seine Lunge nach Luft schrie, und dann wurde er langsamer, ebenso wie der schwarz bemalte Mann – als wären sie mit einem Seil zusammengebunden. Sie hatten eine offene Wiese erreicht, auf der eine kleine Viehherde graste. Alle Köpfe hoben sich und sahen sie an. Es waren ein einzelnes Pferd und ein Dutzend Schafe.
Und keine Menschen.
Ota Qwan machte vor Freude einen Luftsprung und tanzte auf dem Gras. »Wir haben sie geschlagen! All ihre Herden gehören uns!« Er umarmte Skahas Gaho.
Der größere Krieger sprach nicht Ota Qwan, sondern Peter an. »Wo?«, fragte er und tat so, als schwinge er mit beiden Händen einen Bidenhänder oder eine schwere Axt.
Peter deutete in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Er war todmüde, und die Wunde in seinem Bein schmerzte beständig. Alle Wut des Kampfes war in ihm abgeebbt und hatte nichts als eine große Leere hinterlassen. Aber Peter konnte nie etwas aufgeben, das er einmal begonnen hatte.
Ota Qwan schüttelte den Kopf. »Das Vieh! Wir brauchen das Vieh, oder alles war umsonst.«
Peter sah den schwarz bemalten Mann müde an. »Hast du etwa unsere Toten nicht gezählt, Ota Qwan? Es ist umsonst gewesen. Da Skadai tot ist, kann niemand mehr den Sossag sagen, sie sollen mit dem Angriff aufhören.« Er zuckte mit den Achseln. »Und das hier ist bloß ein winziger Teil ihrer Herden.«
Ota Qwan sah ihn an. Allmählich dämmerte ihm die Wahrheit.
»Wir müssen es beenden. Wir können jeden töten, der noch auf den Beinen steht – wenn wir uns Zeit lassen.«
Du hast das Zeug zum Kriegsführer. Irgendwie wusste Peter, dass dies im Augenblick Ota Qwans einziger Gedanke war.
Mit ihren zwei Handvoll Gefährten machten sie kehrt und gingen auf die fernen Schreie zurück, die den gegenwärtigen Rand der Schlacht markierten. Niemand, nicht einmal Ota Qwan, hatte noch die Kraft zu laufen, also gingen sie schnell und ruckartig.
Die Sonne hatte den höchsten Stand bereits hinter sich gelassen, als die Männer den letzten Teil des steilen Hangs hinunterkletterten und das Wasser auf Felsen durchquerten, die von Blut klebrig waren.
Noch immer kämpften einige Männer.
Ein Dutzend der gerüsteten Riesen standen in einem Kreis zusammen, und etwa zweihundert Sossag hatten einen weiteren Kreis um sie geschlossen. Zwischen diesen beiden Ringen lag ein Wall aus Körpern, von denen sich einige noch bewegten. Während sie den Fluss durchquerten, sprangen zwei beherzte junge Männer auf den Kreis aus Stahl zu und starben. Der eine wurde von einer Axt geköpft, der andere von einem vier Fuß langen Schwert aufgespießt.
Ihre Leichen wurden auf die wachsende Barrikade aus Toten geworfen.
Und dann begannen die blutverschmierten Dämonen zu singen. Sie waren nicht sehr talentiert darin, aber ihre Stimmen erhoben sich gemeinsam, und die Sossag hielten einen Augenblick lang vor Respekt an. Ein Totenlied war eine große Sache – eine Magie, die niemand durchbrechen durfte. Sogar Ota Qwan schwieg.
Ihr Lied hatte viele Verse, und als es endlich vorbei war, schienen ihre Gesichter, die vor Leidenschaft geglüht hatten, in sich zusammenzusinken.
Ota Qwan sprang auf einen Baumstumpf. »Durchbohrt sie mit euren Pfeilen! Weicht zwischen die Bäume zurück, und schießt! Mein Fluch möge auf jedem Mann ruhen, der versucht, diesen Kreis zu erstürmen!«
Einige Männer hörten auf ihn. Pfeile flogen, und als einer von ihnen eine Rüstung traf, wirbelte zumindest ein wenig Staub auf, auch wenn die kurzen Bögen nicht die Kraft hatten, den Stahl zu durchschlagen.
Aber es waren sehr viele Pfeile.
Peter sah, wie Sossag unter Pfeilen starben, die aus dem Kreis abgefeuert wurden. Die Pfeile flogen schneller und schneller, und die Hochländer stimmten wieder einen Gesang an. Dann griffen sie an, und die Sossag liefen weg – wieder einmal.
Aber nicht weit.
Peter hatte keine Pfeile mehr. Er hob einen Speer auf, der mit Federn geschmückt war, und als der Feind das nächste Mal einen Ausfall machte, wartete Peter den richtigen Augenblick ab und schleuderte den schweren Speer auf einen der Angreifer. Der Schaft drehte sich und geriet ins Taumeln, doch die Waffe schlug gegen die gepanzerten Beine des Mannes, und er stolperte. Peter rannte auf ihn zu, ein Dutzend Sossag folgten ihm, und sie zerrissen den Hochländer zu blutigen Fetzen.
Abermals sammelten sich die Feinde in einem Kreis, und wieder feuerten die Sossag ihre Pfeile auf sie ab. Dabei kamen sie näher, kühner geworden durch die offensichtliche Erschöpfung und Verzweiflung des Gegners. Noch einmal befahl ihr Anführer einen Ausfall, wirbelte sein Schwert durch die Luft und führte sie auf den nächsten Sossag zu. Sie wollten nicht entkommen, sondern so viele Sossag töten wie möglich. Es gelang ihnen, etwa ein Dutzend der bemalten Männer umzubringen, bevor sie zwei von ihren eigenen verloren. Ota Qwan brüllte seinen Leuten zu, sie sollten zurückweichen und schießen. Peter gesellte sich zu ihm.
Die Sossag wichen zwischen die Bäume zurück und verschossen ihre letzten Pfeile.
Ein weiterer Riese ging kreischend zu Boden.
Die Sossag schrien, doch es klang dünn und müde.
Ota Qwan sah sich um. »Wenn sie das nächste Mal angreifen, müssen wir sie im Gegenzug ebenfalls angreifen und erledigen. Wir dürfen keinen von ihnen entkommen lassen. Wir müssen den Matronen sagen können, dass wir sie alle getötet haben.«
Peter spuckte aus. Sein Mund war ganz trocken, und er war noch nie in seinem Leben so müde gewesen – weder als Sklave noch als freier Mann.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Hector Lachlan
Alan Großnase, Ranald Lachlan, Ewen der Seemann, Erik Schwarzherz und Hector – diese Männer waren noch übrig.
Hector wurde erneut von einem Pfeil getroffen, der seine Rippen kitzelte. Er war bereit zu sterben. Er hatte keine Kraft mehr, keine Freude an der Schlacht und dabei so große Schmerzen, dass deren Ende ihm wie ein Sieg erschien.
Als er dies dachte, drang ein Pfeil in Ewens Kehle, und er ging zu Boden.
Er zermarterte sein Hirn auf der Suche nach einem Lied, mit dem sie sterben konnten. Er war kein Barde, kannte aber einige Gesänge. Allerdings fielen ihm lediglich Trinklieder ein. Er lächelte, als er daran dachte, wie ihm seine junge Frau etwas vorgesungen hatte. Es war ein Schlaflied gewesen.
Er kannte es gut. Die Hochländer nannten es »Die Klage«; das war ein Lied über den Verlust.
Ein prächtiges Lied, wenn es zum Ende kam.
Hector richtete sich auf, holte tief Luft und begann zu singen. Er schwang sein Schwert nach hinten über die Schulter und hieb einen Pfeil mitten in der Luft entzwei. Dann nahm Ranald die Melodie auf, und Alan Großnase war auch da, seine Stimme war kräftig und traf jeden Ton, und Erik Schwarzherz trat über Ewens Leichnam hinweg und stimmte brüllend in den Chor ein.
Irgendwann verschossen die Sossag keine Pfeile mehr.
Hector beendete das Lied und hob sein Schwert – ein Salut an den Feind, der ihm am Ende dieses Friedensgeschenk gemacht hatte.
Ein Krieger, schwarz angemalt von Kopf bis Fuß, hob ebenfalls sein Schwert – nur einen Pfeilschuss entfernt. Und Hector sah, dass sich die Hinterwaller während des Gesangs gesammelt hatten.
Gut. Es würde ein sauberes Ende in einem aufrechten Kampf sein.
Ranald seufzte. »Dein Bruder wird es sich nie verzeihen, dass er dies hier verpasst hat«, sagte er. Und sie griffen an.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Peter
Als es vorbei war, saß Peter auf dem Erdboden und weinte. Er wusste nicht, warum er weinte; er wusste nur, dass sein Körper diese Entspannung brauchte.
Skahas Gaho kam herbei und legte ihm die Hand auf die Schulter. Brant war zu Aas für die Raben geworden. Ota Qwan hatte eine Wunde in der Brust, die ihn vermutlich töten würde. Er hatte sie empfangen, als der letzte Riese vorwärtsgetaumelt war und drei Sossag mit sich gezerrt hatte. Er hatte sie abgeschüttelt und mit seiner großen Axt einen letzten Schlag geführt, bevor es Ota Qwan und Peter gelungen war, ihn zu fällen.
Der Wald war voller Tod.
Doch selbst nach diesem Tag des heftigsten Kampfes – Peter konnte sich keine schlimmere Schlacht vorstellen – waren noch immer Hunderte von Sossag unverwundet oder konnten sich wenigstens bewegen, und Ota Qwan hatte noch so viel Luft in seiner Lunge, dass es ihm möglich war, die anderen loszuschicken, damit sie jedes Stück Vieh zusammentrieben, das sie finden konnten, bevor sie sich auf den Weg nach Hause machten.
Peter saß neben Ota Qwan, hielt seine Hand und beobachtete, wie das Blut aus der Brust des Mannes quoll.
Bei Sonnenuntergang kamen die Feen.
Peter hatte nie zuvor eine gesehen, aber er kannte Männer, die an sie glaubten. Nun saß er bei dem sterbenden Ota Qwan. Hundert verwundete Sossag ächzten oder gaben noch schlimmere Geräusche von sich, und die Aasfresser hatten sich der Leichen bereits bemächtigt.
Peter war so müde, dass es ihm gleichgültig war.
Die Erste, die er sah, wirkte wie ein Schmetterling, allerdings war sie zehnmal so groß und schimmerte schwach, als würde die Sonne sie zum Strahlen bringen. Hinter ihr befanden sich vier Weitere in einer Formation.
Peter fragte sich, ob es Räuber waren oder Aasfresser oder so etwas wie die Pest. Und dann ließ sich die Erste auf Ota Qwans Brust nieder.
Was ist er dir wert, Mann des Eisens?
Peter zuckte zusammen und fragte sich, ob er geträumt hatte.
Eine Fee ist für einen Menschen das, was ein Kolibri für eine Hummel ist. Zumindest dachte Peter so etwas, als er das juwelenartige Wesen anstarrte.
Was ist er dir wert? Ein Jahr deines Lebens?
Peter überlegte nicht lange. Ja, dachte er.
Der rosafarbene Umriss trieb an Ota Qwans Brustkorb entlang, streckte den Arm aus und berührte Peter – anmutig, so unendlich anmutig, doch der Griff war härter als jedes Sklaveneisen, das je geschmiedet worden war. Etwas wurde aus seiner Brust gerissen; es war, als drangen glühende Nadeln in sein Herz und zogen es durch die Rippen heraus. Er musste sich in den Schoß übergeben.
Die Feen lachten. Ihr Gelächter schien in seinem leeren Kopf widerzuhallen wie das Brüllen von Zechern in einer Höhle …
Und Ota Qwan hustete, spuckte und richtete sich auf.
»Nein«, sagte er plötzlich. Seine für gewöhnlich allzu ruhige Stimme war nun von Verwunderung beschwingt. »Nein! Das hast du nicht getan!«
Peter weinte, denn nun hatte er einen Grund dafür – was immer es sein mochte, das er soeben verloren hatte.
Und die Feen lachten.
So süß, so süß. So fern! So selten.
Ein Handel ist ein Handel.
Vielleicht geben wir dir ein anderes. Du warst so süß und bist so selten.
Ihr Lachen klang eher wie ein Fluch.
Otterbachtal, östlich von Albinkirk · Ranald Lachlan
Ranald Lachlan erhob sich aus dem schwarzen Fluch, tauchte durch die Schmerzen und in die weiche Dunkelheit der Aprilnacht ein. Er setzte sich auf, hatte keinen einzigen Gedanken im Kopf, und der Pfeil, der sein Kettenhemd durchdrungen hatte, fiel von ihm ab. Er schnitt sich die Hand an seinem eigenen Langschwert, das zwischen den blutfleckigen Blumen neben ihm lag.
Und dann wusste er, wo er war.
Sag nie, dass wir nicht alles gewähren, was wir versprechen!
So süß, so süß!
Peter hat dich gerettet. Peter hat dich gerettet!
Feenvolk. Nun wusste Ranald, dass er tot gewesen war – oder jedenfalls so knapp vor dem Tod, dass es keinen Unterschied machte –, und jemand namens Peter hatte den üblichen Handel mit ihnen abgeschlossen. Ein Stück deiner Seele für das Leben deines Freundes.
Die Hinterwaller befanden sich überall um ihn herum in der monderhellten Dunkelheit. Einen Moment lang überlegte er, ob er sich davonstehlen sollte – aber sie beobachteten ihn. Es waren mindestens hundert.
Fluchend kämpfte er sich auf die Beine.
Der schwarze Tod war hinter ihm, und in wenigen Herzschlägen würde er ihm auch wieder gehören. Ranald spuckte aus.
Ah, Rebecca, ich habe es versucht. Ich liebe dich, dachte er. Er hob die Axt, die Meister Pyle für ihn gefertigt hatte – nun war sie ausreichend auf die Probe gestellt worden –, und legte sie sich auf die Schulter.
Am Fuß der kleinen Erhebung, wo er seinen letzten Kampf ausgetragen hatte, sah er das Glimmen des Mondlichts, und eine der dunklen Gestalten stand auf. Sie wurde von vier Wesen aus dem Feenvolk beleuchtet, die wie ätherische Leibwächter wirkten.
Der Mann war schwarz angemalt. Ranald erinnerte sich an ihn. Er kam die Erhebung hoch, und Ranald erwartete ihn. Die Hände hatte er um den Schaft seiner Axt gelegt.
»Geh«, sagte der schwarze Mann.
Ranald musste sich das Wort vergegenwärtigen. Es war ein Schock, den Mann gotisch reden zu hören und von einem anderen gesagt zu bekommen, er möge weggehen.
»Wir sind das Volk der Sossag«, sagte der Mann. »Was die Feen zurückgeben, rühren wir nicht an.« Die Augen des Mannes strahlten in der Finsternis. »Ich bin Ota Qwan von den Sossag. Ich strecke dir meine Hand im Frieden entgegen. Ich war tot. Du bist auch tot gewesen. Lass uns beide von hier weggehen und leben.«
Ranald war ein tapferer Mann, ein Veteran von fünfzig Kämpfen, und doch war die Erleichterung, die ihn jetzt überspülte, wie ein mütterlicher Kuss oder wie ein Liebesbekenntnis, und nie zuvor hatte er das Gefühl verspürt, so viel zu haben, wofür er leben konnte.
Er blickte auf den Leichnam seines Vetters hinunter. »Kann ich mit den Feen einen Handel um ihn abschließen?«, fragte er.
Das Lachen klang spöttisch.
Zwei! Wir haben zwei gegeben! Und wir werden tagelang speisen!
So süß und so selten.
Ranald wusste, was die Menschen über das Feenvolk sagten. Also verneigte er sich. »Mein Dank an euch, Volk der Feen.«
Dank Peter!
Hahaha.
Und dann waren sie verschwunden.
Ranald bückte sich und nahm das große Schwert aus Lachlans kalter, toter Hand. Er löste die Scheide von seinem riesigen Goldgürtel und ließ diesen als Beute zurück.
»Für seinen Sohn«, sagte Ranald zu dem schwarzen Mann, der nur mit den Schultern zuckte.
»Ich würde diesen Peter gern treffen«, sagte Ranald.
Gemeinsam gingen sie den Hügel hinunter, und die Sossag wichen zurück.
Ein Krieger, der nach Erbrochenem stank, weinte ungezügelt.
Ranald zog den Mann auf die Beine und legte die Arme um ihn. Er wusste selbst nicht, warum er das tat. »Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund du mich gerettet hast«, sagte er, »aber ich will dir dafür danken.«
»Er hat mich gerettet«, sagte Ota Qwan mit einer Stimme, die vor Verwunderung dumpf klang. »Aus irgendeinem Grund haben die Feen beschlossen, dich ebenfalls ins Leben zurückzuholen.« Ota Qwan beugte sich vor. »Ich glaube, du bist derjenige, der mich getötet hat.«
Ranald nickte. »Das glaube ich auch.«
Peter schluchzte und stand erstarrt da.
»Ich bin verletzt«, sagte er. »Und mir ist kalt.«
Ranald wusste, welche Kälte er meinte. Er schüttelte dem Mann die Hand, schulterte das Schwert seines toten Vetters und ging durch einen Korridor aus schweigenden Sossag-Kriegern in Richtung Osten.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Eine Meile vom Konvent entfernt entspannte sich der Hauptmann allmählich und ließ es zu, vom Gefühl des Sieges durchdrungen zu werden.
Sie hatten beinahe dreißig Wagen voller Waren – viele davon würden kaum nützlich sein, doch er hatte Rüstungen und feine Helme in einem Wagen und Waffen in einem anderen gesehen – sowie Wein, Öl, Leinenkleidung …
Aber es war nicht die Rettung der Wagen, die ihn glücklich machte, und auch nicht die des verwundeten Ritters, die zu genießen er sich noch nicht erlaubt hatte.
Es waren die Männer. Zehn gut ausgebildete Söldner, drei Dutzend Gildenmänner mit Bögen – beinahe fünfzig kräftige Kerle. Wenn er es bis zur Festung zurückschaffte, würde er seinen Feind schwer verletzt haben und gleichzeitig an eigener Stärke gewachsen sein.
Als er noch eine halbe Meile von der Festung entfernt und deutlich zu sehen war, dass Lissen Carak nicht in Flammen stand und auch nicht den Angriffen der schwarzen Magie zum Opfer gefallen war, pfiff er fröhlich.
Pampe ritt an seiner Seite. »Auf ein Wort?«, fragte sie.
»Was du willst«, antwortete er.
»Müsst Ihr unbedingt jedes einzelne dieser Ungeheuer töten?«, fragte sie und spuckte ebenso aus wie Tom Schlimm.
Er sah sie eingehend an und bemerkte, dass sie fast verrückt vor Wut war.
»Ich hatte diese Kreatur mit den Stoßzähnen unter meinem Schwert«, sagte sie. »Ich will nicht, dass Ihr mir meine Beute stehlt. Hätte ein anderer Mann das getan, so hätte ich ihn ausgeweidet. Sogar Tom.«
Der Hauptmann ritt eine Weile schweigend dahin. Dann sagte er: »Ich kann nichts dafür.«
»Verdammt«, meinte sie nur.
»Es ist anders, als es klingt, Pampe«, sagte er. »Ich kann wirklich nichts daran ändern. Wenn sie mich sehen, halten sie geradewegs auf mich zu. So ist es schon, seit ich gegen die Wildnis kämpfe.«
Pampe verzog nicht die Lippen – sie verzog das ganze Gesicht. »Was?«, fragte sie, doch ihr Tonfall verriet, dass sie so etwas bereits selbst bemerkt hatte.
Er zuckte die Achseln, aber er war müde und trug vierzig Pfund Rüstung am Körper, und so war es keine deutlich erkennbare Bewegung.
»Warum?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht«, log er.
Sie kniff die Augen zusammen.
Er bot ihr keine weitere Erklärung an.
»Wer ist der Ritter?«, wollte sie wissen.
Der Hauptmann begriff, dass er ein ganzes Feld voller Kuhfladen betreten müsste, wenn er ihre Frage beantwortete. »Frag ihn selbst, sobald er aufwacht«, gab der Hauptmann zurück.
»Er wollte Euch umbringen«, sagte sie. Es war zur Hälfte eine Frage, zur Hälfte aber eine Feststellung.
»Hat dich das etwa noch nie gereizt?«, fragte Jacques hinter ihnen.
Pampes offenes, ehrliches Lachen hallte über den Fluss und kündigte sie in der Brückenburg an.
Pfeifend ritt der Hauptmann weiter.
Vor seinem inneren Auge sah er einen geschlagenen, wütenden Heranwachsenden, der heiße Worte – heiße und wahre Worte – vor einem Mann ausspuckte, der nicht sein Vater war. Er versuchte nach diesem Jungen zu greifen – über den Abgrund der Jahre hinweg.
Was immer uns zustoßen mag, sagte er zu dem niedergeschmetterten Jungen, heute haben wir einen großen Sieg errungen, und die Männer, die es überlebt haben, werden unseren Namen ein ganzes Jahrhundert weitertragen.
Natürlich ritt der verzweifelte, wütende Junge einfach weiter. Er würde sein Pferd zu Tode reiten, dann zu Fuß weitergehen, und schließlich würde er versuchen, sich mit einem Dolch umzubringen. Aber er würde feststellen müssen, dass er dazu nicht den Mut hatte, und so würde er weinend einschlafen. Und aufwachen und es abermals versuchen, dann abermals versagen und sich für das hassen, was er war. Vor allem aber würde er sich für seine Feigheit hassen.
Der Hauptmann wusste es. Er war dabei gewesen. Er hatte noch immer die beiden Messernarben.
»Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute«, sagte er kaum mit Bitterkeit. Er betastete das weiße Taschentuch an seiner Schulter und ritt pfeifend auf den Konvent zu.
Lissen Carak · Die Näherin Meg
Meg beobachtete die Rückkehr von ihrem Fass neben dem Haupttor aus, auf dem sie mit dem Rücken gegen das Abflussrohr des Kapellendaches gelehnt saß und nähte.
Wie viele der Bauern und anderen Leute in der Festung hatte sie gute Gründe, die bewaffneten Männer zu fürchten. Aber heute wirkten sie anders. Heute schien es weniger eine Bande von Schlägern zu sein, die zu Gewalttaten bereit waren, sondern eher eine Heldengruppe aus einem der Lieder.
Der junge Ritter, der ihr Anführer war, ritt als Erster durch das Tor. Er hielt inne und rief seinem Zug etwas zu – er rief nämlich: »Beendet es so, wie ihr es begonnen habt!« Und sie sah, wie sich alle in ihren Sätteln aufrichteten, sogar diejenigen, die blutig waren.
Der einzige Unterschied bestand darin, dass die meisten nun lächelten. Aber da war noch etwas anderes. Ein Stolz umgab sie, den Meg vorher nicht bemerkt hatte.
Der Hauptmann schwang sich von seinem Kriegspferd herunter und gab die Zügel an Toby weiter, der ihn anstrahlte. Der Hauptmann grinste und sagte etwas, das die Miene des jungen Dieners noch mehr aufhellte.
So sahen keine Besiegten aus, dessen war sich die Näherin sicher.
Ser Thomas ritt mit der Ritterin an seiner Seite herein, und die beiden passten kaum gemeinsam durch das Tor, doch keiner von beiden wollte dem anderen den Vortritt lassen.
Meg beendete die Naht schnell, sammelte die Aura des Sieges gegen eine große Übermacht mit jedem Stich und zog sie in die Kappe hinein, die sie gerade nähte.
Die alte Äbtissin schritt die Treppe vor der Halle hinunter, und der junge Hauptmann stieg in seinem hellroten Wappenrock und der goldgeränderten Rüstung hinauf, ließ sich zum Gruß auf das Knie nieder und sprach mit ihr.
Sie nickte, reichte ihm die Hand und hob dann beide Hände mit der Bitte um Stille.
»Gutes Volk!«, rief sie. »Der Hauptmann teilt mir mit, dass unsere kleine Armee durch die Gnade Gottes einen großen Sieg errungen hat. Aber uns steht auch ein baldiger Angriff bevor, und jeder Einzelne sollte sich nun in Sicherheit begeben.«
Die Soldaten schoben die Leute bereits ins Dormitorium und die große Halle des Klosters zurück. Meg sah, wie sich der junge Ritter umdrehte und den Blick einer Novizin auffing.
Aha, dachte sie und lächelte – vor allem, weil die beiden ebenfalls lächelten.
Als die Bogenschützen auf den Mauern sie eindringlich anblickten, nahm sie ihren Nähkorb und huschte ins Dormitorium.
Gerade noch hatte sie gesehen, wie der Priester etwas äußerst Seltsames tat. Er hatte eine Taube aus einem Käfig genommen und sie über die Mauer geworfen.
Vielleicht hätte Meg etwas sagen oder tun sollen, aber während sie der Taube nachblickte, erschien der Rote Ritter auf einem Balkon des Klosters, und der Priester verschwand. Sie hatten einander nicht gesehen. Der Rote Ritter sprach mit jemandem, der hinter ihm stand, und ein Bein erschien auf dem Balkon. Dann hielt der Mann in der Rüstung plötzlich jemanden in seinen Armen. Jemanden, der das einfache Gewand einer Novizin trug.
Die Eindringlichkeit, die die beiden verband, war atemberaubend. Meg konnte sie sehen, konnte sie fühlen, so wie sie die Quelle der Macht tief unter den Verliesen auch spürte und stets wusste, wann die Äbtissin einen Zauber wirkte. Es war großartig.
Aber es war auch vertraulich, und so wandte sie den Kopf ab. Es gab Dinge, die sollten andere Leute einfach nicht sehen.
Zitadelle von Albinkirk · Ser John Crayford
Der Hauptmann von Albinkirk saß vor seinem verglasten Fenster und betrachtete den Wald in der Ferne.
Mylord,
ich muss annehmen, dass mein letzter Bote Euch erreicht hat. Die Zitadelle von Albinkirk hält bislang stand. Es ist schon einige Tage her, seit wir angegriffen wurden, aber wir sind noch immer bedroht und müssen mitansehen, wie die Kreaturen der Wildnis in der Stadt und auf den Feldern herumstreifen.
Gestern empfand ich es als meine Pflicht, einen Ausfall hinter die Mauern der Zitadelle zu machen. Wie haben die Kreaturen auf dem Hauptplatz der Stadt auseinandergejagt und sind auch hinter die Stadtmauern geritten. Gerade als meine kleine Streitmacht auf den Feldern nördlich des Flusses ankam, gesellte sich ein Dutzend ortsansässiger Familien zu uns, die eine der Außenbastionen gehalten haben, und baten um Aufnahme in der Zitadelle. Mit blieb nichts anderes übrig, als sie hereinzulassen, denn sie hatten nichts mehr zu essen. Unter ihnen waren zwei Gildenmänner aus Harndon, Mitglieder der Armbrustschützen vom Orden der Tuchhändler. Sie sagen, dass gestern eine große Schlacht geschlagen wurde, südlich der Furten, in welcher der Rote Ritter obsiegt und mit einer kleinen Truppe einen gewaltigen Hinterhalt der Wildnis zerschmettert hat, wofür wir Gott danken müssen. Aber zwei andere Flüchtlinge aus dem Osten teilten mir dann mit, dass Sossag-Plünderer jede Stadt östlich der Furten bis hin zum Otterbach niedergebrannt haben und die Berge voller Flüchtlinge sind.
All dies mag nur ein Gerücht sein. Falls ich die Männer entbehren kann, werde ich Späher nach Westen schicken und die Äbtissin sowie den Roten Ritter bitten, sich mit uns zusammenzuschließen.
Mylord, hier stehen wir dem schrecklichsten Feind gegenüber. Ich bitte um Eure sofortige Hilfe.
Stets Euer Diener,
John Crayford, Hauptmann von Albinkirk