9
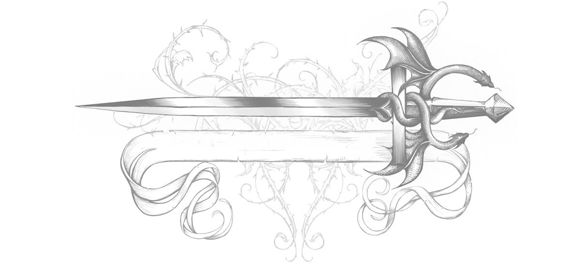
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Zwar war der Nebel dünn und zart, aber er erfüllte seinen Zweck. Er zwang den Feind, der sie beobachtete, zu einem aggressiveren Umgang mit den Tieren, derer er sich bediente. Kaninchen kamen im hellen Tageslicht aus dem Wald. Sperlinge flogen über die neuen Grabungen, zuerst zu zweit, dann in raschen Schwärmen.
Als Ser Jehannes gegen Mittag den doppelten äußeren Graben ausheben ließ und die Kaufleute aus Harndon, Lorica, Theva und Albia ihr Schicksal und ihren augenblicklichen Zuchtmeister verfluchten, weil die Blasen an ihren Händen aufplatzten, wirkte die Äbtissin einen weiteren Zauber. Der Nebel verdichtete sich, und die Tiere erschienen noch zahlreicher.
Als es den beinahe meuternden Kaufleuten erlaubt wurde, ihr Tagwerk zu beenden und zur Messe zu gehen, war der Nebel bereits so undurchdringlich geworden, dass die Wächter auf den Festungstürmen die Basis ihrer eigenen Mauern nicht mehr erkennen konnten. Jedoch war es ihnen noch möglich, auf den Horizont zu blicken. Der Hauptmann hatte nicht vor, sich durch den eigenen Nebel einen Nachteil zuzufügen. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme überflogen fast jede Stunde Lindwürmer die Festung, und die Herzen der Verteidiger setzten jedes Mal aus, wenn die ledrigen Schwingen über ihnen dahinglitten. Draußen zwischen den Bäumen hinter den Feldern gab es Bewegung – die Art von Bewegung, die ein Jäger wahrnimmt, wenn seine Beute einen Baum zum Erzittern bringt oder ein Eichhörnchen auf einen zu dünnen Zweig springt, der es nicht zu tragen vermag.
Michael indes öffnete ein in Pergament gebundenes Buch mit leeren Seiten und schrieb in seiner besten Handschrift hinein:
Die Belagerung von Lissen Carak. Erster Tag. Oder ist es schon der achte Tag?
Heute haben der Hauptmann und die Äbtissin durch ein mächtiges Phantasma einen Nebel hervorgerufen. Der Feind ist überall um uns herum, und viele behaupten, die Luft sei geradezu dick und schwer zu atmen. Der Bogenschütze Maddock wurde von einem Pfeil getroffen, der aus dem Schutz einer Baumgruppe kam, als er sich von den neuen Gräben weggetraut hatte, um einen Hammer zurückzuholen. Offenbar hatte er den Schutz des Nebels verlassen.
Über uns fliegt ein Lindwurm durch die Luft. Ich kann ihn kreischen hören. Und ich kann ihn sogar durch das Dach hindurch spüren – es ist ein Druck auf meinem Kopf.
Michael strich die letzte Bemerkung immer wieder durch, bis kein Wort davon mehr lesbar war.
Der Hauptmann schickt jede Stunde ein berittenes Ausfallkommando hinaus. Jeder Bewaffnete muss einmal daran teilnehmen. Außerdem hat er befohlen, dass schwere Maschinen auf den Türmen errichtet werden sollen. Die Festung besitzt zwei dicke Türme, und auf dem einen steht nun eine mächtige Schleuder, während der andere eine Blide trägt.
Die Menschen aus den Dörfern und die Kaufleute aus den Karawanen haben einen Graben von der Unterstadt bis zur Brückenburg gezogen. Er ist tiefer, als ein Mensch groß ist, und dabei so breit, dass ein kleiner Wagen auf dem Boden dahinfahren kann. Wir säumen ihn mit Planken. Der Hauptmann hat befohlen, dass Beutel auf dem Boden ausgelegt werden. Niemand weiß, was sich darin befindet.
Bei Sonnenuntergang begab sich Michael zu den Mauern und betete zusammen mit allen Männern und Frauen, die sich in der Festung befanden. Sie schickten ihre Stimmen gen Himmel, und dann wirkte die Äbtissin erneut einen Zauber. Er war einfach und hätte von jeder Dorfhexe ausgeführt werden können, doch Michael hoffte, dass er durch die Wünsche und Gebete aller Versammelten verstärkt wurde. Sie wirkte einen Abwehrzauber von der Art, wie ihn die weisen Frauen für die Getreidespeicher auf den Gehöften sprachen und der die kleineren Tiere davon abhielt, das Korn zu fressen. Sie machte es lediglich in größerem Maßstab und mit wesentlich mehr Macht.
Westlich von Albinkirk · Gerald Random
Meister Randoms Karawane brach trotz der Abenteuer der Nacht – oder vielleicht gerade wegen ihnen – früh auf.
Er war stolz auf seine Männer. Sie sangen in der Morgendämmerung, manche rasierten sich vor Spiegeln, die sie an die Wagenseiten gehängt hatten, andere schärften ihre Klingen oder Pfeilspitzen und Armbrustbolzen. Die Männer rollten ihre Laken zum Schutz vor Feuchtigkeit dicht zusammen. Andere kochten Wasser in Kupferkesseln oder erhitzten ein wenig von dem Haferbrei, der aus der letzten Nacht übrig geblieben war. An seinem eigenen Feuer wärmte der alte Magus in einem Kupferbecher gerade Bier.
»Ihr scheint zufrieden zu sein, wenn Ihr Euch selbst bedienen könnt«, sagte Random.
Harmodius hob nicht einmal eine Braue. »Ich möchte Euch das Lob aussprechen, dass Ihr ein großzügiger Mann seid. Aber das Bier ist nicht nur für mich vorgesehen, sondern auch für Euch.«
Random lachte. Er saß mit einer Legende vor dem Lagerfeuer, die ihm an einem kühlen Frühlingsmorgen ein Bier wärmte.
Vögel sangen, Männer sangen, und Random sah, wie der junge Adrian von den Goldschmieden auf einer Wagenkiste saß und zeichnete.
Adrian war ein Vergolder. Er war ein freundlicher Junge, der bald in den Stand eines Gesellen erhoben wurde, was für ihn aber nur ein Durchgangsstadium sein würde. Sein Vater war sowohl talentiert als auch reich. Adrian war mittelgroß, dünn und in guter körperlicher Verfassung, und seine kostbare Rüstung war von Fachleuten hergestellt worden. Er trug eine Brust- und eine Rückenplatte sowie seine Kapuze, und die Panzerhandschuhe lagen in seinem Schoß. Mehr und mehr junge Männer ahmten das Verhalten der Söldner nach; sie trugen ihre Rüstungen den ganzen Tag über und kümmerten sich sorgsam um ihre Waffen.
Random konnte nicht erkennen, was der junge Adrian zeichnete; er saß auf der anderen Seite eines der Goldschmiedewagen. Mit dem warmen Bier in der Hand ging er hinüber und wollte einen Blick darauf werfen.
Er roch das Vieh, bevor er es sah. Es gab einen schrecklichen, schwefeligen Gestank von sich, der von einem ekelhaft süßlichen Geruch überlagert wurde – wie leicht gezuckerte Leber.
Er roch es, aber es warnte ihn nicht.
Das tote Wesen war ein Dämon gewesen.
Der junge Adrian sah von seiner Zeichnung auf. »Henry hat es im Gebüsch gefunden.« Der andere Goldschmiedlehrling stand mit Besitzerstolz neben der Leiche und schien sich von diesem grauenhaften Anblick nicht abstoßen zu lassen.
Aus der Nähe betrachtet wirkte der tote Dämon zutiefst verstörend. Er hatte die Größe eines kleinen Pferdes, eine fein geschuppte Haut wie die eines Flussbarsches, und die Schuppen wechselten von Weiß zu Blassgrau und waren wie feiner Marmor schwarz und blau geädert. Über alldem lag ein in allen Farben des Regenbogens schillernder Glanz. Die Augen waren nicht mehr als leere Höhlen, die Lider waren eingesackt, als hätte der Tod die Augäpfel geraubt. Das Wesen hatte einen schweren, raubtierähnlichen Kopf mit einem Schnabel und Federn auf dem Schädelkamm wie denen, die ein Ritter auf seinem Turnierhelm trug. Schlaff lag es im Tode wie eine verwelkte Blume da. Es hatte zwei Arme am langen Körper, die auf verwirrende Weise wie schwere menschliche Arme wirkten – vielleicht wie die muskulösen Arme eines Schmieds –, und mächtige, kraftvolle Beine, die doppelt so dick wie die Arme waren. Aufrecht musste es so groß gewesen sein wie ein Mann auf einem Wagen.
Beine und Torso wurden von einem schweren Schwanz ausbalanciert, der in scharfen Stacheln auslief.
Es war kein Tier. Schnabel und Stacheln waren mit Blei und Gold eingefasst und wiesen fantastische Muster auf; der Knochenkamm über den Augen trug weitere Verzierungen, und überdies steckte der tote Dämon in einem Wams aus scharlachrot eingefärbtem Leder mit Pelzbesatz – eine wunderbare Arbeit. Random konnte nicht anders – er kniete nieder und betastete das Material, obwohl es entsetzlich stank. Es handelte sich um Hirschleder, dessen Färbung heller und besser zu sein schien als alles, was er je gesehen hatte. Dazu kam noch, dass es mit starken Sehnen vernäht worden war.
Es war keine Verletzung zu erkennen, und das Unheimlichste an diesem Ungeheuer war der Umstand, dass sein fremdartiges Gesicht seltsam schön aussah und einen Ausdruck des Entsetzens trug.
Der alte Magus kam herbei und trank dabei sein Bier. Er blieb stehen und sah den Dämon an.
»Ah«, sagte er nur.
Random wusste nicht, wie er sich mitteilen sollte. »Mir gefällt das Wams«, sagte er.
Harmodius sah ihn an, als ob er verrückt wäre.
»Ihr habt es getötet. Es gehört Euch.« Random zuckte die Achseln. »So haben wir es gemacht, als ich noch zu der Armee des Königs gehörte.«
Harmodius schüttelte den Kopf. »Nehmt es«, meinte er. »Ich schenk es Euch. Für Eure Gastfreundschaft.«
Drei weitere Goldschmiedegesellen halfen ihm, den Dämon auf die Seite zu rollen. Es dauerte fünf Minuten, bis er das Wams ausgezogen hatte. Es hatte ungefähr die Größe einer Pferdedecke und war vollkommen unbeschädigt und sauber. Random rollte es fest zusammen, steckte es in einen Sack und legte es in seinen Wagen.
Die Lehrlinge betrachteten die goldenen Verzierungen.
»Lasst es«, sagte Harmodius. »Ihre Körper verwesen nicht, aber sie verblassen. Ich frage mich …« Er beugte sich über den Leichnam und stieß ihn mit einem Stecken an. Obwohl sie ihn gerade erst auf die Seite gerollt hatten, wichen die Lehrlinge vor ihm zurück, und Henry beeilte sich, einen Bolzen in seine Armbrust einzulegen.
Der Magus zog einen kurzen Stab aus seinem Wams. Er wirkte wie ein Zweig – wie ein verrückter Zweig, der einem Blitz glich – und war mit Öl eingerieben, weswegen er so glänzte wie kein anderer Zweig. An den Enden steckten silberne Kappen.
Harmodius fuhr damit über die Leiche – hin und her. Hin und her.
»Ah«, sagte er noch einmal. Dann sprach er zum Vergnügen aller Anwesenden, die sich niemals hätten träumen lassen, einmal einen Magus bei der Arbeit beobachten zu dürfen, einen Vers auf Archaisch. Bei Tageslicht war es anders. Männer, die sich versteckt hatten, als er bei Nacht gezaubert hatte, starrten nun dorthin wie gemeine Flegel.
Random sah, wie sich die Macht um die Hand des alten Mannes sammelte. Er besaß nicht die Gabe, selbst Zauber zu wirken, aber er hatte ihn bei anderen stets sehen können.
Der alte Mann streckte die Finger in Richtung des Dämons aus.
Dieser schien in wechselnden Farben zu pulsieren – alle Zuschauer stöhnten – und löste sich dann in Sand auf.
In recht wenig Sand.
»Elfenwerk«, sagte Harmodius. »Etwas hat seine Verwesung unterbrochen, als es gestorben ist.«
Es war deutlich zu sehen, dass sie nichts verstanden. Harmodius zuckte mit den Schultern. »Macht euch keine Gedanken«, sagte er. »Ich spreche bloß mit mir selbst.« Er lachte. »Meister Kaufmann, ich würde gern ein Wort mit Euch wechseln.«
Random folgte dem Magus ein paar Schritte fort von den Wagen. Hinter ihnen ritt der alte Bob in voller Rüstung herbei. Der Vergolder zeigte seine Zeichnung, und plötzlich erstarrte Bob.
»Ich habe zwei oder drei von ihnen in den letzten drei Tagen getötet«, sagte Harmodius. »Das ist sehr schlecht. Ich bitte im Namen des Königs um Eure Hilfe. Aber ich warne Euch, denn es wird gefährlich werden. Sogar außerordentlich gefährlich.«
»Welche Hilfe begehrt Ihr?«, fragte Random. »Und was gebt Ihr dafür? Verzeiht mir, Mylord. Ich weiß, dass der ganze Hof glaubt, meinesgleichen lebe nur für Gold. Aber das stimmt nicht. Dennoch, par dieu, Messire, ich habe das gesamte Vermögen mehrerer Männer in diesen Wagen. Und vor allem auch mein eigenes.«
Harmodius nickte. »Ich weiß. Aber es gibt ohne Zweifel einen Übergriff – vielleicht sogar eine Invasion – der Wildnis. Die Dämonen sind die kostbarsten und mächtigsten Verbündeten des Feindes. Ich hatte es als erschreckend angesehen, dass ich einem von ihnen begegnet bin. Zwei bedeuteten, dass wir beobachtet werden und eine fremde Streitmacht hinter uns liegt. Aber drei … das ist undenkbar. Trotzdem bitte ich Euch, einen Boten zum König zu schicken. Sofort. Und zwar einen Eurer besten Männer. Und wir müssen weiter nach Norden ziehen.«
Random nickte.
»Ich habe keine Ahnung, ob der König Euch den Wert dieser Karawane garantieren wird«, sagte er. »Was ist sie denn wert?«
»Sechzigtausend Goldnoble«, sagte Random.
Harmodius sog hörbar die Luft ein, dann lachte er.
»In diesem Fall kann ich Euch versichern, dass der König sie Euch nicht ersetzen wird. Gütiger Christus, Mann, wie könnt Ihr einen so großen Wert in die Wildnis führen?« Harmodius lachte noch einmal.
Random zuckte die Achseln. »Wir haben vor, das Getreide von mindestens tausend Bauernhöfen zu kaufen«, sagte er. »Und Fleisch von den Hochländern – vielleicht tausendfünfhundert Tiere, die für den Markt gemästet werden. Und Bier, Wein, Tierhäute von Hirsch, Biber, Hase, Otter, Bär und Wolf – ein Jahreswert für jeden Kürschner in Harndon. So ist es nun einmal auf dem nördlichen Jahrmarkt, und dabei ist die Wolle noch gar nicht eingerechnet worden.«
Harmodius schüttelte den Kopf. »Ich habe noch nie über den Wert all dieser Dinge nachgedacht«, sagte er. »Oder falls ich es doch einmal getan haben sollte, habe ich es wieder vergessen.«
Random nickte. »Eine halbe Million Goldnoble. Das ist der Gesamtwert des nördlichen Jahrmarkts.«
»Ich wusste gar nicht, dass so viel Gold in der Welt ist«, kicherte Harmodius.
»Das ist es auch nicht. Deshalb haben wir Helme, Armbrüste, feine Weine, Goldschmiedearbeiten und hübsche Ringe und weitere Schmuckwaren – auch Trauben und Datteln und Olivenöl und alle anderen Erzeugnisse, die der Norden nicht hat. Wir handeln. Und das ist auch der Grund, warum meine Karawane durchkommen muss.«
Harmodius warf einen Blick auf die Berge, die am fernen Horizont sichtbar waren. »Darüber habe ich noch nie nachgedacht«, sagte er. »Und jetzt, wo ich es tue, erscheint mir das Ganze sehr – verwundbar.« Er sah sich um. »Was passiert, wenn es keinen Jahrmarkt gibt?«
Random hatte diesen Gedanken in den letzten beiden Tagen schon mehrfach gehabt.
»Dann hat Harndon kein Rindfleisch und bekommt sein Getreide nur von den eigenen Ländereien. Damit wird es keine Felle für Kleidung und Hüte, keinen Honig für das Brot sowie weniger Bier und Met in jedem Haus geben. Und der König nimmt weniger Steuern auf die Handelsgüter und auch aus dem Stapelrecht für die Wolle ein. Das einfache Volk wird hungern. Im Osten werden diejenigen Kaufleute, die sonst unsere Wolle gekauft haben, bankrottgehen. Die meisten Geldverleiher in Harndon würden ebenfalls bankrottgehen, und Hunderte Lehrlinge verlieren ihre Anstellung.« Er zuckte die Schultern. »Und das bezieht sich nur auf den kommenden Winter. Im Frühling wird es noch schlimmer werden.«
Harmodius sah den Kaufmann an, als hätte ihm dieser gerade ein Märchen erzählt. Dann schüttelte er den Kopf. »Dieser Morgen war sehr ereignisreich, Meister Kaufmann. Wir sollten uns auf den Weg machen, wenn Ihr einverstanden seid.«
Random nickte. »Jawohl. Wir werden uns auf den Weg machen – auf den Heimweg. Auch wenn ich dabei eine Menge Geld verliere.« Und niemals Bürgermeister werde.
Lissen Carak · Michael
Die Belagerung von Lissen Carak. Zweiter Tag.
Michael beleckte die Federspitze und bemalte dabei geistesabwesend seinen Mundwinkel mit Gallus- und Eisentinte.
Heute haben all die einfachen Leute beim Ausheben des Grabens mitgeholfen. Ich füge eine kleine Skizze der Arbeiten an, die sich vom Tor der Unterstadt bis zum Bollwerk der Brückenfestung erstrecken; das sind vierhundertvierundzwanzig Schritte. Mit knapp eintausend arbeitenden Männern und Frauen haben wir den Graben in zwei Tagen fertigstellen können. Der Aushub wurde zu beiden Seiten in einem niedrigen Wall aufgeschichtet, und der Hauptmann hat uns befohlen, Stäbe aus unseren Vorräten am Rande des Grabens aufzustellen – sie stammen von den Palisaden, die wir einrammen, wenn wir unser Lager aufschlagen.
Den ganzen Tag hindurch lag ein dichter Nebel über der gesamten Länge des Grabens. Dieses Phantasma wurde von der Äbtissin gewirkt und von den guten Schwestern aufrechterhalten, deren Gebete zu jeder Stunde in der Kapelle zu hören sind.
Der Feind hat den ganzen Tag über versucht, unsere neuen Arbeiten auszuforschen. Die Luft ist von Vögeln erfüllt – es sind Sperlinge und Krähen und Tauben, aber sie wagen es nicht, in den Nebel hineinzufliegen, und das Gebiet unmittelbar von den Festungsmauern scheint ihnen zuwider zu sein.
Der Feind hat Lindwürmer, und sie reiten den ganzen Tag auf den Luftströmungen hoch über uns. Selbst in diesem Augenblick segelt einer über mir.
In den Wäldern westlich von uns sind Axtschläge zu hören. Zweimal täglich kommen große Gruppen von Männern aus dem Waldrand hervor, nähern sich dem Nebel bis auf Bogenschussweite und schießen ihre Pfeile ab. Wir erwidern nichts darauf, allerdings sammeln unsere eigenen Bogenschützen danach die Pfeile ein.
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir drei Ausfälle gemacht: einen nach Norden, einen nach Westen und einen weiteren in annähernd westlicher Richtung entlang des Flusses.
Der Hauptmann ritt nach Westen in den Sonnenuntergang hinein, während seine Rüstung das wenige Licht sammelte, das noch aus dem Himmel fiel. Grendel trug heute seinen Rossharnisch, der aus zwei Lagen schwerer Ketten bestand und bis zu den Fesseln des mächtigen Tieres herabfiel.
Es hatte vier Diener bedurft, den Harnisch über den Rücken des großen Pferdes zu legen. Grendel hasste ihn, aber der Hauptmann war sich ziemlich sicher, dass die Wildbuben ihn angreifen würden.
Er hatte ein Dutzend vollständig gerüstete Soldaten bei sich, auf die die Bogenschützen folgten, und sobald Grendels Hufe die Unterstadt hinter sich gelassen hatten – die leer und verlassen war, mit Ausnahme von zwei Bogenschützen, die an dem steinernen Tor Wache hielten –, senkte er seine Sporen sanft in die Flanken des großen Pferdes, und Grendel setzte zu einem schnellen Trab über die Frühlingsfelder an. Der Nebel verdeckte das Licht und das Gelände. Es war leicht möglich, in diesem Nebel in einen Hinterhalt zu geraten, und so blieb er sehr achtsam.
Aber es war sein eigener Nebel, und dieser besaß einige besondere Eigenschaften.
Er ritt an dem Graben entlang nach Süden und warf immer wieder einen Blick auf die bereits vollbrachte Arbeit. Unter dem hölzernen Boden hatte er eine Überraschung versteckt, aber bei einem so nassen Untergrund diente der Boden noch einem ganz anderen Zweck.
Die Palisaden vermochten einen entschlossenen Feind zwar nicht aufzuhalten, aber wenn ihm genug Zeit blieb, würde er die Arbeiter anweisen, Ranken und Dornengestrüpp hineinzuweben, damit sie eine festere Barriere abgaben.
Er schüttelte den Kopf. Eigentlich war es vollkommen gleichgültig, denn dies alles bedeutete sowieso nur ein Ablenkungsmanöver.
Es gab fünf Brücken über den Graben, von denen jede so breit war, dass zwei voll bewaffnete Reiter mit ihren Pferden nebeneinander darüber vorankommen konnten, ohne dass ihre Pferde nervös wurden. Wenn ihm die Zeit dazu blieb, würde er Mechanismen einbauen lassen, mit denen man die Brücken heben und absenken konnte.
Wenn ihm genug Zeit blieb, würde er aus seinem Gegner einen vollkommenen Narren machen. Aber er glaubte nicht, dass die Zeit dazu reichte. Er spürte – eine bessere Beschreibung gab es dafür nicht – die Verzweiflung seines Feindes. Dieser hatte keine große Erfahrung im Kampf gegen Menschen. Er war überheblich.
Das bin ich auch. Der Hauptmann grinste, wendete Grendel und ritt über die letzte Brücke vor der Brückenburg. Grendels Hufe hallten so dumpf, als würde er über einen Sarg reiten.
Woher kommt dieser Gedanke?
Gestern Abend war er bei Sonnenuntergang zum Apfelbaum gegangen. Sie war nicht gekommen. Er hatte sich darüber gewundert. Noch immer spürte er die Berührung ihrer Lippen.
Ich sollte mich ganz auf das konzentrieren, was vor mir liegt, tadelte er sich.
Er hatte ihr eine Nachricht am Baum hinterlassen. Sie hatte nicht darauf reagiert.
Allmählich ging ihm der Nebel aus. Auf den Frühlingswiesen dahinter wuchs frisches, grünes Gras, das am Ende zu Heu und Futter – oder Unkraut – werden würde. Nun war es rot betupft, als die Sonne unterging.
Er zügelte Grendel und wartete auf seine Begleiter.
Tom ritt neben ihn und hob die gepanzerte Hand. »Alle blicken sich angestrengt um. Der Nebel macht es schwer, etwas zu erkennen, aber seht nur, wie sauber der Boden von hier bis zum Waldrand ist – kein Graben, keine Hecke, kein Steinwall. Behaltet das in Erinnerung. Wenn wir noch einen Ausfall machen, sollte es entlang dieses Weges passieren.«
Ser Jehannes schüttelte den Kopf. »Wir sollten erst einmal den heutigen Tag überleben, bevor wir uns Gedanken um den morgigen machen.«
Der Hauptmann wandte den Blick zu seinem ältesten Offizier zurück. »Im Gegenteil, Messire. Wir wollen schon heute für den morgigen Triumph planen.«
Wut zeichnete sich auf dem Gesicht des alten Ritters ab.
»Friede!«, sagte der Hauptmann. »Darüber reden wir später.« Er sprach mit leichter Stimme, als ob dies im Augenblick unwichtig sei. »Falls wir mit dem Feind in Kontakt kommen sollten, reiten wir durch seine Reihen hindurch, kommen beim Signal der Trompete zusammen und ziehen uns wieder in den Nebel zurück. Mehr nicht. Wenn wir auf Boote treffen, zerstören wir sie. Ist das klar?«
Jehannes hörte aufmerksam zu. Falls er nervös war, zeigte es sich nicht.
Die Pferde tänzelten. Die Männer spuckten aus und versuchten so ruhig zu wirken wie ihr Anführer.
Der Nebel schien zu dünn zu sein, um so vielen Männern Schutz zu gewähren. Aber nichts geschah.
Und dann erklang aus dem Norden der Lärm jubelnder Männer, wiehernder Pferde und der Aufprall von Stahl gegen Stahl.
»Da sind sie also«, murmelte der Hauptmann. Diese vier dürren Worte drückten die ganzen letzten fünfzehn Minuten nervöser Ungeduld aus. Tom grinste. Jehannes hob die Hand und löste den Verschluss an seinem Visier. Dieses Geräusch setzte sich durch die ganze Reihe der Männer fort.
Aber nun schien der Hauptmann nicht mehr in Eile zu sein.
Die Schreie verstärkten sich.
Und dann ertönten raue Waldhorntöne hinter ihnen, und aus dem Norden drang hoher Hörnerschall herbei.
Alles geschah so, wie er es erwartet hatte, und nun, am Rande der Schlacht, befiel ihn ein Augenblick der Panik. Was ist, wenn das alles nur eine Falle ist? Wie kann ich vorhersagen, wie sie sich verhalten werden? Ich tue so, als wüsste ich, was ich tue, aber so einfach kann es nicht sein.
Sein Lehrer in der Kriegskunst war Hywel Writhe gewesen, der Waffenmeister seines Vaters. Seines angeblichen Vaters. Er war ein brillanter Schwertkämpfer und ein ausgezeichneter Turnierkämpfer. Außerdem war er unsterblich in die Lady Prudentia verliebt gewesen, hatte aber keinen Erfolg bei ihr gehabt.
Eine Erinnerung kroch in ihm hoch.
Zu Beginn der Schlacht erkannte der Hauptmann, dass er hintergangen worden war. Seine beiden Lehrer waren nicht nur ineinander verliebt gewesen, sie waren natürlich auch ein Liebespaar gewesen.
Warum denke ich vor dem Kampf ausgerechnet an so etwas?
Er lachte laut.
Hywel Writhe pflegte zu sagen: Krieg ist einfach. Deswegen ziehen ihn die Männer dem wirklichen Leben vor.
Und seine Lektion für seine sechs Schüler, die allesamt große Herren und Heerführer werden sollten, hatte gelautet: Macht nie einen Plan, der so kompliziert ist, dass ihr ihn nicht in einfachen Worten mitteilen könnt.
Der Hauptmann überdachte noch einmal seine Pläne.
»Los«, sagte er.
Im Galopp ritten sie aus dem Nebel heraus nach Norden. Etwa eine halbe Meile weiter führte Pampe ihre Truppe aus dem Pfeilschauer, den die nun wachsam gewordenen Wildbuben, Kobolde und Irks abgefeuert hatten, die sich um ihre kleine Streitmacht sammelten wie Wolken vor einem Sturm.
Der Hauptmann führte seine Männer nach Westen auf die untergehende Sonne zu, aus dem Nebel heraus und am Flussufer entlang.
Auf der Straße befand sich eine unbemannte Barrikade, und er ritt um sie herum und auf die Böschung daneben. Hinter der ersten Biegung waren sie.
Die Boote.
Es mussten sechzig sein, oder noch mehr: Bauernboote, Kanus, Einbäume. Flöße aus zusammengebundenen Ästen. Alle waren aus dem Wasser herausgezogen worden.
Jeder Bogenschütze warf ein in Leinen eingewickeltes Päckchen in eines der Boote. Manche erhielten keines, manche zwei – und er hörte Hörner und Trompeten sowie einige schrille Rufe aus dem Norden.
Sie brauchten zu lange.
Die Bogenschützen am anderen Ende des Ufers fingen einige Pfeile ein und eilten auf ihren Pferden in den Wald hinein, wo sie die feindlichen Schützen zersprengten. Tom verfolgte sie mit einem halben Dutzend Männern, und plötzlich befürchtete der Hauptmann doch, dass sie in einen Hinterhalt gelockt worden waren. Er hatte seine Männer zu weit verteilt, und das Flussufer unter den uralten Bäumen war viel zu groß für seinen armseligen Ausfall. Und nun drang die Hälfte seiner Männer zu tief in das Feindesland ein …
Weitere Rufe ertönten hinter ihm.
Er drehte sich zu Michael um. »Blase zum Sammeln«, sagte er.
Michaels Trompetenspiel war nicht seine stärkste Seite. Erst als er zum dritten Mal ansetzte, war der Ruf deutlich und klar über den Schreien und den schweren Zusammenstößen zu hören, die vom Westufer herandrangen. Der Hauptmann saß furchtbar unschlüssig auf Grendel. Er wollte seine Männer unbedingt zurückholen und hatte gleichzeitig Angst davor, sie alle zugleich am Fluss entlangzurückzuführen.
Tom kam mit erhobenem Schwert zwischen den Bäumen mit ihren tief herabhängenden Ästen hervor.
Der Hauptmann konnte wieder durchatmen.
Mehr und mehr Soldaten und Bogenschützen verließen den Wald; ihre Schwerter glänzten rötlich grün im schwächer werdenden Licht.
»Nichts wie weg von hier«, rief der Hauptmann. Er drehte Grendel um, gerade als zwei Pfeile das Pferd in der Höhe des Widerristes trafen. Es wieherte und bäumte sich auf, und dann lief es los.
Am Rand des Waldes waren im Norden Wildbuben zu sehen; ihre schmutzig weißen Jacken schimmerten im letzten Licht des Tages. Die polierten Köpfe ihrer Kriegspfeile schienen zu flackern, als sie abgeschossen wurden.
Stiefellecker, einer der ausländischen Hornbogenschützen, wurde im Hals getroffen; der Pfeil drang geradewegs durch den Kettenschal unter seinem Helm. Mit einem Krächzen ging er zu Boden, doch sein gut ausgebildetes Pferd hielt die Stellung.
Bill Haken, Stiefelleckers Waffengefährte, sprang wie ein weißer Blitz von seinem Pferd und hievte den getroffenen Schützen darauf. Er wurde zweimal getroffen. Beide Pfeile prallten von seinem Brustpanzer ab, sodass er nicht einmal ins Taumeln geriet.
Nun richtete der Hauptmann Grendels gepanzertes Haupt in Richtung des Waldes. Wenn niemand die Wildbuben am Schießen hinderte, würde seine Kolonne innerhalb weniger Herzschläge ausgelöscht sein. Die meisten Pferde der Bogenschützen waren nicht einmal gepanzert.
Grendel fiel in einen fließenden Galopp; die mehreren Hundert Pfunde seines doppelten Kettenhemdes schienen ihn nicht zu beeinträchtigen.
Ein Pfeil traf das Visier des Hauptmanns, und zwei weitere flogen gegen seinen Helm. Die Stahlspitzen kreischten an seiner Beckenhaube vorbei und waren verschwunden, doch jeder Treffer erschütterte ihn in seinem hochlehnigen Sattel. Ein schwerer Pfeil traf den Sattelbogen, und ein weiterer prallte an seiner Kniekappe ab, und was dann folgte, war wie ein Ritt durch einen Hagelschauer. Er senkte den gepanzerten Kopf und presste die langen Sporen in Grendels Flanken.
Er hatte keine Ahnung, ob sich jemand hinter ihm befand, und seine ganze Welt verengte sich zu dem, was er durch die beiden Augenschlitze seines Helms sehen konnte.
Es war nicht viel – in der Hauptsache Grendels Hals.
Kling.
Klingklangklingschepperding.
Das waren die Treffer an Helm und Schultern.
Klackklickklingbing!
Er richtete sich im Sattel auf, legte die Hand an den Griff seines Schlachtschwertes und zog es. Ein Pfeil traf die Klinge, die in seiner Hand erzitterte.
Er hob den Blick, und da waren sie.
Sie rannten los. Es waren nur sechs. All diese Pfeile stammen von sechs Männern? Mit geübter Hast rannten sie in sechs verschiedene Richtungen.
Sein Schwert erwischte den Ersten mit großer Leichtigkeit. Das Töten von fliehenden Infanteristen war ein wesentlicher Teil der Ritterausbildung. Er ließ den Arm fallen, und der Mann starb. Dann benutzte der Hauptmann seine Sporen und lenkte Grendel hinter dem zweiten Mann her, dem kleinsten der Gruppe. Einer seiner Gefährten blieb stehen, spannte den Bogen und schoss.
Er fluchte, als sein Pfeil an der rechten Armschiene des Hauptmanns harmlos abprallte, und dann starb er.
Grendel wurde langsamer, da drehte der Hauptmann wieder um. Wenn er das Kriegspferd erschöpfte, konnte er nicht mehr fliehen und war ein toter Mann. Außerdem liebte er Grendel. Er spürte, dass er und das Pferd eine Menge gemeinsam hatten.
Zum Beispiel ein gesundes Verlangen zu überleben.
Die vier verbliebenen Wildbuben liefen nicht viel weiter, als es unbedingt nötig war, nachdem sie gehört hatten, wie das Hufgetrappel langsamer wurde und schließlich ganz erstarb.
Plang. Der erste Pfeil prallte von seinem Helm ab.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer der Pfeile seinen Unterarm, die Kehle oder die Augenschlitze erwischte.
Ser Jehannes kam links von den Bogenschützen in vollem Galopp aus dem Wald. Er ritt um den gewaltigen Stamm eines uralten Baumes herum, und der rothaarige Waldbube verlor bei einem einzigen Schwung der großen Klinge des Ritters den Kopf.
Die drei Übrigen rannten nach Westen ins Dickicht hinein.
»Danke!«, rief der Hauptmann.
Jehannes nickte nur.
Er wird mich nie schätzen lernen und noch viel weniger ehren, dachte der Hauptmann.
Er zog an Grendels Zügeln, wendete den Kopf des Tieres und ritt nach Osten.
Die Wiesen und Felder nördlich von ihm schienen sich zu kräuseln. Kobolde rannten in ihrer seltsam geduckten Haltung dicht über dem Boden, und die braunen Irks bewegten sich wie fließender Schlamm.
Doch sie kamen zu spät, und die wenigen Kobolde, die nun stehen blieben und ihre Pfeile abschossen, konnten nichts mehr ausrichten.
Am Rand des Schussfeldes zügelte der Hauptmann sein Reittier. Er zog den rechten Panzerhandschuh aus und nahm ein kleines Stück verkohltes Leinen aus der Handfläche.
Er trat in seinen Palast.
»Er wartet auf dich«, sagte Prudentia.
»Er weiß noch nicht, was ich tun kann«, sagte der Junge. Er hatte seine Symbole bereits ausgerichtet, ging dann zur Tür, aber statt sie zu öffnen, hob er nur die winzige Eisenplatte, die das Schlüsselloch bedeckte, und ein Hauch giftigen Grüns schwebte hindurch.
»Er wartet auf dich«, wiederholte Prudentia.
»Dann wird er wohl noch ein wenig warten müssen«, sagte der Junge. Er war stolz auf seine Arbeit und seine sorgfältigen Vorbereitungen. »Das ist sympathetische Hermetik. Die Dochte an den Feuerbündeln stammen allesamt aus demselben Stück Leinen und sind in Öl getränkt. Und hier habe ich ein Stück, das bereits versengt ist.«
Der grüne Hauch berührte seine Symbole.
»Du bist der klügste Junge, den ich kenne«, meinte Prudentia.
»Seid ihr, du und Hywel, ein Liebespaar gewesen, Prude?«, fragte der Junge.
»Das geht dich nichts an«, erwiderte sie scharf.
Er stellte sich in die Steigbügel, sein versengtes Leinenstück brannte nun glühend rot.
Am Ufer brachen vierundvierzig Feuerbomben aus Ölzeug, alten Lumpen, Wachs und Birkenborke mit einem einzigen, gleichzeitigen Brüllen in Flammen aus.
Harndon · Edward
Edward goss die erste der Röhren seines Meisters im Hof. Er goss sie in Sand und benutzte dazu dieselbe Drehspindel wie bei dem Modell für die Wachszunge, die er in die Gussform gesteckt hatte, damit sie hohl wurde. Die Wände der Röhre machte er so fingerdick, wie der Meister es verlangt hatte.
Als das fertig war, sah es nicht sehr schön aus. Edward zuckte mit den Schultern. »Meister, ich kann es besser. Das Loch wäre gleichmäßiger, wenn ich es bohren würde, aber dazu bräuchte ich noch eine Woche, um den Bohrer und andere Werkzeuge herzustellen. Und ich würde gern ein paar Verzierungen anbringen.« Er fühlte sich unfähig.
Der Meister nahm die Röhre auf und hielt sie lange in den Händen. »Wir wollen es versuchen«, sagte er.
Mit einem Handbohrer fügte er ein kleines Loch hinzu, und Edward beobachtete fasziniert, mit welcher Präzision er dabei vorging und den feinen Stahlbohrer durch die schwere Bronze trieb. Dann trug er die Röhre aus dem Laden in den Hof und schüttete vier Löffel Schwarzpulver hinein. Schließlich suchte er nach etwas, womit er die Röhre verschließen konnte.
Still reichte ihm Edward ein Vogelglöckchen. Das war hohl und nicht vollkommen rund, aber es reichte für diesen Zweck aus.
Der Meister band die Röhre an die Eiche, steckte einen Docht in das gebohrte Loch und entzündete ihn. Beide suchten sofort hinter der Ziegelwand des Stalles Schutz.
Und das war auch gut so.
Das zischelnde, brennende Pulver gab einen Blitz von sich, und dann ertönte ein Knall wie … wie von etwas Hermetischem.
Es hatte die Borke in einem handbreiten Streifen vom Stamm gerissen.
Die Röhre hatte sich aus ihrer Verankerung gelöst und einen Pferdetrog durchschlagen – einen soliden hölzernen Pferdetrog, aus dem sich nun das schmutzige Wasser in den Hof ergoss.
Erst einen Tag später entdeckten die Lehrlinge das Vogelglöckchen. Eigentlich fanden sie nicht das Glöckchen selbst, sondern nur das saubere, runde Loch, das es in das Schieferdach der Schmiede geschlagen hatte.
Edward betrachtete das Loch und stieß einen Pfiff aus.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Von den Pfeilen hatte der Hauptmann sechs große Prellungen davongetragen. Anderen war es schlechter ergangen. Stiefellecker war tot, trotz Bill Hakens – den Adligen als Ser Willem Greville bekannt – emsigen Versuchen, ihn zu retten. Francis Atcourt hatte einen Wildbubenpfeil in die Eingeweide bekommen; er war durch ein Gelenk in der Rüstung gefahren. Wat Simpel und Eichbank waren an den Gliedern getroffen worden und kreischten vor Schmerz und Angst, die Spitzen könnten vergiftet sein.
Wären nicht all die Nonnen gewesen, so wären sie an ihren Wunden gestorben.
Die Geschicklichkeit und Macht der Nonnen war tatsächlich so groß, dass jeder Mann, der nicht gleich getötet wurde, offenbar geheilt werden konnte. Der Hauptmann, der sich gerade erst mit der Vorstellung vertraut machte, dass die Frauen in diesem Konvent allesamt die Macht besaßen, war verblüfft davon, dass sie bereit waren, diese Macht bei seinen Männern anzuwenden. Pampe hatte sechs Verwundete, einschließlich Langpfote, der in jeder Hinsicht einer ihrer besten Männer war.
Aber das Sperrfeuer aus Phantasmata war wirksamer, als es das Sperrfeuer aus Pfeilen gewesen war.
Der Hauptmann ging in seiner Armeekleidung durch den Krankensaal. Die Verwundeten waren so fröhlich, wie nur jemand sein konnte, der aufwachte und feststellen durfte, dass eine scheußliche Wunde völlig verschwunden war. Die Frau namens Eichbank, deren dunkle, holzfarbene Haut und schwere Muskeln ihr diesen Namen gegeben hatten, lag da und lachte schallend über eine von Mutwill Mordlings Geschichten. Wat Simpel war schon fort; der Hauptmann hatte gesehen, wie er draußen bereits wieder Piquet spielte. Langpfote sah Eichbank beim Lachen zu.
»Ich dachte schon, es ist um mich geschehen«, gab er zu, als sich der Hauptmann auf seine Bettdecke setzte, und zeigte ihm die Stelle, wo ihm ein Pfeil in die Brust gedrungen war. »Ich hatte Blut gehustet, und ich weiß, was das heißt.« Er setzte sich auf, hustete und sah die Novizin in der Ecke an. »Die hübsche Nonne da sagt, wenn er nur einen Fingerbreit tiefer gesessen hätte, wäre ich tot gewesen.« Er zuckte die Schultern. »Ich verdanke ihr mein Leben.«
Der Hauptmann drückte Langpfotes Schulter. »Wie fühlst du dich?«, fragte er. Er wusste, dass es eine dumme Frage war, aber sie gehörte nun einmal zu seinen Hauptmannspflichten.
Langpfote sah ihn kurz an. »Na ja«, sagte er dann, »ich habe mich gefühlt, als wäre ich tot, und jetzt bin ich es doch nicht. Das ist gar nicht schlecht – gar nicht schlecht.« Er lächelte, aber es war nicht das übliche Lächeln des Bogenschützen. »Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum wir hier sind, Hauptmann?«
Die ganze Zeit hindurch, dachte er zwar, antwortete aber: »Manchmal.«
»Ich stand noch nie so kurz vor dem Tod«, fuhr Langpfote fort und legte sich zurück. »Ich vermute, in einem Tag bin ich wieder auf dem Damm«, sagte er und lächelte; nun wirkte er wieder mehr wie er selbst. »Oder in zwei Tagen.«
Die schöne Novizin war natürlich Amicia. Sie saß zusammengesunken auf einem Stuhl am Ende des Krankensaales. Als er sie sah, begriff der Hauptmann, dass er gehofft hatte, sie hier zu finden. Er wusste, dass sie die Macht besaß; er hatte sie selbst bei ihr gespürt, aber er hatte sie erst als Heilerin betrachtet, als er bemerkt hatte, wie sie in den Krankensaal hinter dem Dormitorium gegangen war.
Ihre geschlossenen Augen wirkten nicht gerade wie eine Einladung zum Gespräch, und so ging er leise an ihr vorbei und die Treppe hinauf, um Messire Francis Atcourt aufzusuchen. Atcourt war nicht von adliger Abstammung – kein Ritter. Den Gerüchten zufolge sollte er in seinem früheren Leben ein Schneider gewesen sein. Der Hauptmann fand ihn gegen die Kissen gelehnt; er sah sehr blass aus und las. Der Pergamenteinband trug keinen Titel, aber als sich der Hauptmann über ihn beugte, sah er, dass es sich um die Psalmen handelte.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf.
»Schön, Euch zu sehen, Mylord«, sagte Atcourt. »Ich simuliere nur.«
Der Hauptmann lächelte. Atcourt war schon vierzig Jahre alt – oder sogar noch älter. Er konnte Feuer machen, Fleisch tranchieren, einen Lederbeutel herstellen und Pferdegeschirre reparieren. Der Hauptmann hatte gesehen, wie er einem jungen Mädchen gezeigt hatte, ein Kleidungsstück abzusteppen. Er war nicht der beste Soldat der Truppe, aber er war ein kräftiger Mann – jemand, dem man eine Aufgabe anvertrauen konnte. Wenn man ihn bat, sich darum zu kümmern, dass das Essen gekocht wurde, dann wurde es eben gekocht.
Er war nicht die Art von Mann, die gern simulierte.
»Ich freue mich auch, dich zu sehen. Du hast eine Menge Blut verloren.«
»Eure Nonne – die hübsche …«
Der Hauptmann spürte, wie er errötete. »Sie ist nicht meine Nonne …«, stammelte er.
Atcourt lächelte ihn an wie ein Lehrer. »Natürlich nicht.«
Es war seltsam; der Hauptmann hatte es schon öfter bemerkt. Die Soldaten aus einfachen Verhältnissen – mit Ausnahme von Tom Schlimm, der eher eine Naturgewalt als ein Mensch war – hatten bessere Manieren als die Adligen. Und Atcourt wusste sich besonders gut zu benehmen.
»Wie dem auch sei, ich meine die hübsche junge Novizin, die so gut Befehle geben kann.« Atcourt lächelte. »Sie hat mich geheilt. Ich habe gefühlt …« Da lächelte er wieder. »So fühlt sich die Güte an, glaube ich. Und sie hat mir das hier zum Lesen gebracht, also lese ich es auch.« Er verzog das Gesicht. »Vielleicht werde ich noch zum Mönch. Guten Tag, Tom.«
Tom Schlimm ragte plötzlich über ihm auf und nickte seinem Freund zu. »Wenn dich dieser Pfeil nur eine Handbreit tiefer getroffen hätte, dann könntest du jetzt auch in ein Nonnenkloster eintreten.« Er grinste den Hauptmann an. »Die große Nonne ist inzwischen aufgewacht und reckt und streckt sich wie eine Katze. Ich konnt’s nicht mehr mitansehen.« Er lachte sein gewaltiges Lachen. »Was für einen Hals sie hat, was?«
Der Hauptmann versuchte, Tom finster anzusehen, doch es war fast unmöglich, Tom finster anzusehen. Der Hauptmann spürte nun, da er auf dem Bett saß, jeden Muskel und jede seiner sechs Prellungen sehr deutlich.
»Wir alle haben gesehen, wie Ihr diese Bogenschützen angegriffen habt«, sagte Tom und wandte sich ab.
Darauf erwiderte der Hauptmann nichts.
»Eigentlich solltet Ihr tot sein«, fuhr Tom fort. »Wie oft seid Ihr getroffen worden? Achtmal? Zehnmal? Von Kriegsbögen!«
Noch immer schwieg der Hauptmann.
»Ich will damit nur sagen, dass Ihr nicht dumm sein dürft. Ihr hattet teuflisches Glück. Was ist, wenn es Euch mal verlässt?«, fragte er.
»Dann werde ich tot sein«, antwortete der Hauptmann und zuckte die Achseln. »Irgendjemand musste es tun.«
»Jehannes hat es schon getan, und er hat es richtig getan«, sagte Tom. »Beim nächsten Mal hebt Ihr das Schwert und sagt jemandem, er soll gegen die Bogenschützen reiten. Aber jemand anderem.«
Der Hauptmann zuckte noch einmal die Achseln. Endlich sah er wirklich wie ein Zwanzigjähriger aus. Dieses Achselzucken war nichts anderes als die rebellische Weigerung, das anzuerkennen, was ein Erwachsener ihm sagte, und in diesem Augenblick war der Hauptmann nichts anderes als ein sehr junger Mann, der bei einer dummen Handlung erwischt worden war. Und er wusste es.
»Hauptmann«, sagte Tom und war plötzlich ein sehr großer, sehr gefährlicher Mann. »Wenn Ihr sterbt, werden wir das Ganze hier wohl kaum durchstehen. Deshalb lautet mein Rat: Sterbt nicht.«
»Amen«, sagte der Hauptmann.
»Die hübsche Novizin wird bei einem lebenden Mann bestimmt viel entgegenkommender sein als bei einem toten«, sagte Tom.
»Beruht das auf Erfahrung, Tom?«, fragte Atcourt. »Lass das Mädchen in Ruhe. Und lass den Hauptmann in Ruhe. Entschuldigung, Mylord.«
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. Es war schwierig, wütend zu sein, wenn man feststellen durfte, dass die Männer einen mochten und einem Gesundheit wünschten.
Atcourt lachte laut auf. Tom beugte sich über ihn und flüsterte ihm etwas zu. Atcourt fuhr zusammen – zuerst vor Lachen und dann vor offensichtlichem Schmerz.
Der Hauptmann sah ihn an, und Tom nahm Karten und Würfel aus seinem Beutel. Atcourt hielt sich die Seite und grinste.
Der Hauptmann lief die Treppe hinunter; seine Ledersohlen wischten über die Steinstufen. Amicia war nicht mehr da. Er verdammte Toms Anzüglichkeiten und rannte in die Dunkelheit hinaus.
Eigentlich hätte er gern einen Becher Wein gehabt, aber er war sich sicher, dass er davon gleich einschlafen würde – was er auch dringend nötig gehabt hätte.
Er lächelte über seine eigene Dummheit und ging stattdessen zu dem Apfelbaum.
Und da war sie. Sie saß im jungen Sternenlicht und sang sich selbst leise etwas vor.
»Du bist in der letzten Nacht nicht gekommen«, sagte er. Das war eigentlich das Letzte, was er hatte sagen wollen.
Sie zuckte mit den Achseln. »Ich bin eingeschlafen«, antwortete sie. »Was auch für Euch eine gute Sache wäre, Mylord.«
Ihr Tonfall klang abweisend. Nichts an ihr deutete darauf hin, dass sie sich einmal geküsst oder ein sehr persönliches Gespräch miteinander gehabt hatten – nicht einmal eine wütende Unterredung.
»Aber du wolltest mich sehen«, sagte er. Ich klinge wie ein Narr.
»Ich wollte Euch sagen, dass Ihr vollkommen recht hattet. Ich hatte Euch vor der Tür der Äbtissin treffen wollen. Und diese alte Hexe hat mich benutzt. Ich liebe sie, aber sie wirft mich Euch vor. Ich habe es nicht sehen wollen. Sie treibt das Spiel der höfischen Liebe mit Euch und ersetzt ihren Körper dabei durch den meinen.« Amicia zuckte mit den Achseln; diese Bewegung war im Sternenlicht kaum sichtbar.
Das Schweigen dehnte sich aus. Er wusste nicht, was er jetzt sagen sollte. Für ihn klang es sehr wahrscheinlich, und er fand keinen Weg, es besser wirken zu lassen. Und er stellte fest, dass er über die Äbtissin nicht schlecht reden wollte.
»Jedenfalls tut es mir leid, dass ich so barsche Worte gebraucht habe«, sagte er.
»Barsch?«, fragte sie und lachte. »Ihr meint, es tut Euch leid, dass Ihr meine Entschuldigungen beiseitegewischt, meine Frömmigkeit gering geachtet und meine Eitelkeit hervorgehoben habt? Dass Ihr mich als traurige Heuchlerin hingestellt habt?«
»Das alles wollte ich nicht«, sagte er. Nicht zum ersten Mal fühlte er sich ihr schrecklich unterlegen. Die Legionen früherer williger Dienstmädchen hatten ihn nicht auf diese Situation vorbereiten können.
»Ich liebe Jesus wirklich«, fuhr sie fort, »auch wenn ich mir nicht sicher bin, was es eigentlich bedeutet, Gott zu lieben. Und es tut mir so weh wie ein körperlicher Schmerz, dass Ihr Gott verleugnet.«
»Ich verleugne Gott nicht«, sagte er. »Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass dieser miese Bastard wirklich existiert.«
Ihr Gesicht, das im Mondlicht sehr blass wirkte, wurde nun kantig.
Ich bin wirklich zu müde für so etwas, dachte er. »Ich liebe dich«, hörte er sich sagen. Er dachte an Michael und zuckte zusammen.
Sie legte die Hand vor den Mund. »Ihr habt eine seltsame Art, das zu zeigen«, sagte sie.
Er setzte sich plötzlich. Wie die Worte Ich liebe dich war es eigentlich nicht seine eigene Entscheidung. Seine Beine hatten unter ihm nachgegeben.
Sie streckte die Hand nach ihm aus, und als sich ihre Finger berührten, zuckte sie zusammen.
»Oh!«, sagte sie. »Gütiger Jesus, Ihr habt Schmerzen.«
Sie beugte sich über ihn und atmete ihn an. Zumindest hatte er das Gefühl, dass sie das tat.
Er öffnete seine Verteidigungslinien und lief in den Turm. Prudentia schüttelte den Kopf, aber ihre Missbilligung hätte sie auch jeder anderen Frau entgegengebracht. Er öffnete die Tür und war sich sicher, dass ihn die Mauern der Festung vor dem grünen Sturm schützen würden.
Als er die Tür öffnete, war sie bereits bei ihm.
Und das Grün war unmittelbar hinter ihr.
Sie war deutlich zu erkennen und sah so aus, wie Unwissende sich einen Geist vorstellten – ein blasses und farbloses Abbild ihrer selbst.
Er ergriff ihre Hand.
»Lasst Ihr mich herein?«, fragte sie, sah sich um und war ohne Zweifel erstaunt. Sie machte einen Knicks vor Prudentia. »Gütiger, lebendiger Gott, Mylord – lebt sie?«
»Sie lebt in meiner Erinnerung«, sagte er mit einer gewissen Heuchelei. Einige seiner Geheimnisse waren so schlimm, dass er sie nicht teilen konnte.
Sie wirbelte herum. »Das ist ja großartig! Wie viele Sigille besitzt Ihr?«
»Sigille?«, fragte er.
»Zeichen. Wirkungsmächtige Werkzeuge. Phantasmata.«
Er zuckte die Schultern. »Mehr als zwanzig«, sagte er. Es war keine Lüge, sondern nur eine Aufforderung, ihn zu unterschätzen.
Sie kicherte. Hier war sie größer, und ihr Gesicht wirkte elfengleicher und wilder. Ihre Augen glühten wie die einer Katze in der Nacht und machten einen leicht mandelförmigen Eindruck. »Ich wusste um Euch, als ich Euch zum ersten Mal gesehen habe«, sagte sie. »Ihr tragt die Macht wie einen Mantel. Die Macht der Wildnis.«
Er lächelte. »Wir sind uns sehr ähnlich«, sagte er.
Sie hatte seine Hand ergriffen und hielt sie gegen ihre rechte Brust – doch hier war es nicht wie in der Welt. Seine Hand fand ihre Brust nicht. Stattdessen fand er sich selbst auf einer Brücke stehend wieder. Unter ihm rauschte ein Bergbach dahin, murmelte in dunklem, klarem Braun, war voller Blätter. Die Bäume zu beiden Seiten des Ufers waren von üppigem, sattem Grün und reichten bis in den Himmel. Und nun trug sie statt der grauen Kutte ihres Ordens ein grünes Kleid und einen grünen Gürtel.
»Meine Brücke schwebt in der Gefahr, von der Frühlingsflut davongeschwemmt zu werden«, sagte sie. »Aber Euer Turm ist zu beengend.«
Er beobachtete die Macht, die unter der Brücke dahinfloss, und hatte plötzlich ein wenig Angst vor ihr. »Du kannst das alles wirken?«
Sie lächelte. »Ich lerne. Ich ermüde aber schnell und habe nicht Eure zwanzig Sigille zur Verfügung.«
Er erwiderte ihr Lächeln. »Falls mich Prudentia nicht falsch unterrichtet hat, sind wir nun miteinander verbunden, da wir jeweils die Orte des anderen aufgesucht haben.«
»Solange Eure gepanzerte Tür verschlossen ist, kann ich Euch nicht einmal finden«, sagte sie und schenkte ihm einen schelmischen Blick. »Ich habe es versucht.«
Er streckte die Hände nach ihr aus.
Als sie sich um ihre Schultern schlossen, ließ ihre Konzentration nach, oder es war seine eigene, und sie saßen auf der Bank in der Finsternis, die von Apfelduft durchwoben war.
Und küssten sich.
Sie legte den Kopf an seinen Brustpanzer, da öffnete er den Mund.
»Sag bitte nichts«, meinte sie. »Ich will jetzt nicht sprechen.«
Also saß er vollkommen glücklich und schweigend in der Dunkelheit. Es dauerte eine Weile, bevor er bemerkte, dass sie seine Prellungen weggezaubert hatte. Inzwischen war sie eingeschlafen.
Später musste er sich erleichtern. Die Steinbank war trotz der warmen Frühlingsluft eiskalt. Und die Kante der Bank schnitt ihm in den Oberschenkel. Allmählich wurde der Blutfluss in den Beinen unterbrochen, und er fühlte sich, als säße er auf Nadeln.
Dann fragte er sich, ob es seine Pflicht war, sie zu wecken und zu Bett zu schicken. Oder ob er sie aufwecken und mit Küssen angreifen sollte. Doch ihm kam der Gedanke, dass eine ganze Nacht ohne Schlaf nicht gut für ihn war.
Später bemerkte er, dass ihre Augen offen standen.
Sie wand sich von seinem Schoß. Er dachte über ein Dutzend Bemerkungen nach, die allesamt zum Gegenstand hatten, dass sie wärmer war als ihr sanfter Jesus, aber er verwarf sie alle wieder.
Schließlich war er erwachsen.
Er küsste ihre Hand.
Sie lächelte. »Du gibst dich viel schlimmer, als du eigentlich bist«, sagte sie.
Er zuckte die Achseln.
Sie griff in ihren Ärmel und legte etwas in seine Hand. Ein kleines Taschentuch aus Leinen.
»Mein Gelübde der Armut ist nicht viel wert, weil ich nichts besitze«, sagte sie. »Ich habe der Zofe geholfen, den Schmerz in ihren Gliedern zu lindern, und dafür hat sie mir das hier geschenkt. Aber ich habe hineingeweint. Zweimal.« Sie lächelte. »Ich glaube, das macht es zu meinem Eigentum.«
Er drückte es an sein Herz, schob es unter den Waffenrock und küsste dann ihre Hand.
»Was willst du?«, fragte sie.
»Dich«, sagte er.
Sie lächelte. »Eine dumme Antwort. Was willst du vom Leben haben?«
»Sag du es zuerst«, gab er zurück.
Ihr Lächeln wurde tiefer. »Das ist ganz einfach. Ich will, dass die Menschen glücklich sind. Dass sie in Freiheit leben. Und dass es ihnen gut geht. Dass sie genug zu essen haben und bei guter Gesundheit sind.« Sie zuckte die Achseln. »Ich mag es, wenn die Menschen glücklich sind.« Sie sah ihn an. »Und tapfer. Und gut.«
Er zuckte zusammen. »Dann muss dich der Krieg sehr hart treffen.« Und noch einmal zuckte er. »Tapfer und gut?«
»Ja« sagte sie und schüttelte den Kopf. »Du kennst mich nicht sehr gut. Noch nicht. Jetzt bist du an der Reihe. Was willst du?«
Nun war es an ihm, den Kopf zu schütteln. Er wagte es nicht, ihr die Wahrheit zu erzählen, doch er wollte sie auch nicht belügen. Also musste er einen Mittelweg finden. »Ich will Gott und meiner Mutter trotzen.« Er zuckte mit den Schultern, als er zu sehen glaubte, wie sich ihre Miene versteinerte. »Und ich will der beste Ritter auf der ganzen Welt sein.«
Sie sah ihn an. Der Mond war aufgegangen, und ihr Gesicht leuchtete. »Du?«
»Wenn du eine Nonne sein kannst, dann kann ich der beste Ritter sein«, meinte er. »Und wenn du, die Königin der Liebe, deinen Körper verleugnen kannst, um Nonne zu sein, dann kann ich – der von Gott zum Sündigen verflucht wurde – ein großer Ritter sein.« Er lachte.
Sie lachte mit ihm.
So erinnerte er sich später gern an sie – an das gemeinsame Lachen im Mondenschein ohne einen Schatten des Vorbehalts auf ihrem Gesicht. Sie streckte die Arme aus, dann umarmten sie sich, und danach war sie auf leisen Sohlen verschwunden.
Er zitterte noch immer, rannte die Treppe zur Kommandantur hoch und trank einen kalten Becher Hippocras, der einmal heiß gewesen war. Aber bevor er sich Schlaf gönnte, weckte er Toby und schickte ihn zu Ser Adrian, seinem Schreiber. Der Mann kam leise herein; er hatte einen schweren Wollumhang über seine Robe gezogen.
»Ich will mich ja nicht beschweren«, sagte der Schreiber, »aber wisst Ihr, wie spät es ist?«
Der Hauptmann trank einen weiteren Becher Wein. »Ich will, dass du dich umhörst«, sagte er. »Ich weiß nicht, wonach ich suche, aber ich hoffe, du kannst es für mich herausfinden. Ich weiß, dass das nicht sehr sinnvoll klingt. Aber es gibt einen Verräter in der Festung. Ich habe zwar einen Verdacht, allerdings nicht die Spur eines Beweises. Wer hier drinnen kann mit der Außenwelt in Kontakt treten? Wer hegt einen geheimen Hass gegen die Äbtissin? Oder eine geheime Liebe für die Wildnis?«
An den letzten Worten wäre er beinahe erstickt.
Der Schreiber schüttelte den Kopf und gähnte. »Ich werde mich umhören«, sagte er. »Darf ich jetzt wieder zu Bett gehen?«
Der Hauptmann kam sich närrisch vor. »Vielleicht irre ich mich auch«, sagte er.
Der Schreiber rollte die Augen – aber damit wartete er, bis er die Tür der Kommandantur durchschritten hatte.
Der Hauptmann trank seinen Becher leer und warf sich vollständig angezogen auf das Bett. Als die Kapellenglocke läutete, versuchte er, die Schläge nicht zu zählen, damit er so tun konnte, als hätte er noch die ganze Nacht zum Schlafen vor sich.
Die Belagerung von Lissen Carak. Dritter Tag.
Michael hörte den Hauptmann schnarchen und beneidete ihn. Die Bogenschützen hatten gesagt, er sei die halbe Nacht mit seiner hübschen Nonne »beschäftigt« gewesen, und Michael war halb neidisch, halb eifersüchtig auf ihn und bewunderte ihn sehr. Und natürlich war er verdammt wütend. Es war einfach ungerecht.
Der dritte Tag war so ereignislos gewesen, dass sich Michael allmählich fragte, ob sich der Hauptmann geirrt hatte. Er hatte schließlich behauptet, der Feind werde angreifen.
Den ganzen Tag über waren die Lindwürmer hin und her geflogen.
Etwas Gewaltiges röhrte und röhrte, ein hoher, klarer Ton, der schrecklich in den Wäldern widerhallte.
Keine Kampfhandlungen heute. Wir haben beobachtet, wie der Feind Flöße gebaut hat, mit denen er die Boote ersetzt, die wir verbrannt haben. Der Hauptmann hat uns davor gewarnt, dass die Gegner am Ende Kriegsmaschinen bauen werden – und dass die zum Feind übergelaufenen Menschen diesem zeigen werden, wie man sie einsetzt. Der Nebel ist den ganzen Tag bei uns geblieben, sodass man von den Feldern und Wiesen um die Festung herum fast nichts erkennen kann, während die Wächter auf den Zinnen meilenweit schauen können. Die Männer behaupten, die Äbtissin vermag durch den Nebel zu blicken.
Den ganzen Tag über haben wir die Geräusche von Holzhacken gehört.
Gegen Sonnenuntergang marschierte eine große Streitmacht durch den Wald im Westen. Wir konnten beobachten, wie sich die Bäume bewegten, und wir haben das Glitzern der untergehenden Sonne auf den Waffen gesehen. Außerdem haben wir das Brüllen vieler Ungeheuer gehört. Der Hauptmann sagt, eine Streitmacht überquert den Fluss. Er hat befohlen, einen Ausfalltrupp zusammenzustellen, doch dann bildete sich eine noch größere Armee in den Wäldern, die unserem Graben gegenüberliegen. Als es nicht zum Angriff kam, hat er uns zum Abendessen geschickt.
Michael lehnte sich auf seinem Sitz zurück. Er war kein guter Tagebuchschreiber und wusste, dass er wichtige Entwicklungen ausgelassen hatte. Mutwill Mordling hatte auf eine Entfernung von beinahe dreihundert Schritten einen Kobold mit einem Pfeil getötet. Er hatte von einem hohen Turm aus über den Nebel hinweggeschossen, und der Pfeil war von der Dämmerungsbrise getragen worden. Nun war er so betrunken wie ein Pfarrherr, weil ihm seine Gefährten zur Anerkennung ihre Bierrationen überlassen hatten. Aber das schien die Belagerung nicht zu beeinflussen. Und für ihn war es keine besonders hehre oder bemerkenswerte Tat. Michael hatte nur die Geschichten aus der Bibliothek seines Vaters zum Vergleich, und diese erwähnten an keiner Stelle einen Bogenschützen.
Der Hauptmann kam herein. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen.
»Geh zu Bett«, sagte er.
Michael brauchte keine zweite Aufforderung, doch in der Tür blieb er noch einmal stehen.
»Kein Angriff?«, fragte er.
»Deine Gabe, das Offensichtliche auszusprechen, muss dich ungeheuer beliebt machen«, erklärte der Hauptmann wütend.
Michael zuckte die Schultern. »Entschuldigung.«
Der Hauptmann rieb sich den Kopf. »Ich war mir sicher, sie würden heute den Graben angreifen. Aber stattdessen hat er etwas, von dem ich annehme, dass es eine große Streitmacht ist, südlich über den Fluss geschickt, obwohl wir ihre Boote verbrannt haben. Da unten zieht eine Karawane vorbei, und er will sie vernichten. Ich kann ihn nicht davon abhalten, kann es nicht einmal versuchen, bevor ich ihm nicht mit meiner kleinen Falle eine blutige Nase geschlagen habe.« Der Hauptmann trank ein wenig Wein. »Es ist bloße Selbstüberschätzung. Ich kann gar nicht vorhersagen, was der Feind tun wird.«
Michael war zutiefst betroffen. »Bisher habt Ihr Euch gut geschlagen.«
Der Hauptmann zuckte die Schultern. »Das war nur Glück. Und jetzt geh schlafen. Der bessere Teil dieser Belagerung ist vorbei. Wenn er nicht auf meine hübschen Gräben vorrückt …«
»Warum sollte er das tun?«, fragte Michael.
»Fragt da der Hauptmannslehrling oder der Knappe?«, wollte der Hauptmann wissen und schenkte sich noch ein wenig Wein nach. Etwas davon verschüttete er.
»Nur ein interessierter Beobachter«, sagte Michael und stieß zufällig-absichtlich den Becher des Hauptmanns vom Tisch. »Entschuldigung, Mylord. Ich hole Euch noch etwas.«
Der Hauptmann versteifte sich, doch dann gähnte er. »Nein, ich habe genug. Er muss glauben, dass ich den Graben mit meinen Männern angefüllt habe und er mit einem geschickten Angriff meine halbe Streitmacht vernichten kann.«
»Aber Ihr habt ihn doch wirklich mit Männern angefüllt«, sagte Michael. »Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Ihr sie dorthin geschickt habt.«
Der Hauptmann grinste.
Michael schüttelte den Kopf. »Wo sind sie denn?«
»In der Brückenburg«, erklärte der Hauptmann. »Eigentlich war es ein kluger Schachzug, aber entweder hat er das Manöver durchschaut, oder er ist ein so großer Feigling, dass er uns nicht auf die Probe zu stellen wagt.« Er sah in seinen Weinbecher hinein und verzog das Gesicht. »Wo ist das Fräulein Lanthorn?«, fragte er barsch, dann wurde er sanfter. »Warum besuchst du sie nicht?«
Michael verneigte sich. »Gute Nacht«, sagte er nur, schlüpfte hinaus in den Korridor und zog sich seine Liege vor die Tür des Hauptmanns.
Eine ganze Ewigkeit verbrachte er damit, in die von Fackeln erhellte Finsternis zu blicken.
Elissa saß auf einem Fass und unterhielt die halbe Garnison mit einer unanständigen Geschichte. Aber ihre jüngste Schwester war nicht hier.
Mary trank Wein im westlichen Turm mit der Wäscherin Lis, mit Sukey Eichfang, der Tochter der Näherin, mit Tom Schlimm, Ser George Brewes und Francis Atcourt. Karten und Würfel lagen auf dem Tisch, und die Frauen lachten laut. Alle sieben schauten auf, als sich Michael hereinbeugte.
»Sie ist nicht hier!«, rief Tom und lachte schallend. Die anderen Soldaten fielen ein, und Michael floh.
»Wer ist nicht hier?«, fragte Lis.
»Seine Buhle. Der Junge ist verliebt.« Tom schüttelte den Kopf, und seine große Hand strich unter dem Tisch gegen Sukeys Schenkel. Sie versetzte ihm einen Tritt. »Bin verheiratet«, sagte sie, offensichtlich hatte sie keine Angst vor dem kräftigsten Mann in der ganzen Festung.
Tom zuckte mit den Schultern. »Ist doch nicht verboten, es mal zu versuchen«, meinte er.
»Wer ist denn seine Buhle?«, fragte Lis. »Eine von euren Schlampen? Er ist doch eigentlich viel zu nett für eine Auster.«
»Auster?«, fragte Mary.
»Ein Mädchen, das sich mit Ebbe und Flut öffnet und schließt«, meinte Lis und trank noch mehr Wein.
»Also wie du?«, fragte Mary.
Lis lachte. »Mary, du stammst hier aus der Gegend. Die Jungen denken, du bist leicht zu haben. Aber du bist nicht annähernd so wie diese Mädchen.«
Francis Atcourt zuckte mit den Achseln. »Sie sind Menschen wie alle anderen auch, Lis. Und sie spielen Karten und gehen zur Kirche.« Abwehrend hob er die Hände. »Entschuldigung. Ich habe heute einen tiefen Blick in die Vergänglichkeit getan.«
Tom nickte. »Nimm noch einen Schluck.«
Mary sah Lis an, die zwischen Bewunderung und Wut schwankte. »Was du tust …«, begann sie.
»Was ich tue, ist mein Leben zu leben, ohne dass ich mich dabei von einem Mann beherrschen lasse«, sagte Lis. »Die Männer sind gut für ein gelegentliches Spielchen, aber zu sonst nichts nütze.«
Tom lachte.
Ser George warf seine Karten angewidert auf den Tisch. »Was ist das denn – eine Philosophiestunde?«
»Es ist deine verdammte Schwester, die den jungen Knappen reitet«, sagte Lis. Sie wusste nicht recht, warum sie so wütend war.
Verärgert stand Mary auf. »Das sieht Fran ähnlich – zuerst macht sie die Regeln, und dann durchbricht sie sie wieder.«
Lis lachte. »Es ist nicht Fran.«
Mary erstarrte. Dann fragte sie: »Kaitlin etwa? Sie ist nicht … Sie würde nie … sie ist …«
Lis lachte.
Michael fand sie im Stall mit drei Mädchen, die allesamt jünger waren als sie. Sie tanzten. Er ging von Pferd zu Pferd und betrachtete sie. Die Mädchen hörten mit dem Tanzen auf, und eine rief plötzlich, sie sei ein böses Ungeheuer und kreischte auf, während die beiden anderen lachten.
Dann weinte eine von ihnen, und Kaitlin tröstete sie. Michael war durch das Gekreisch zum Narren gehalten worden und stand im nächsten Augenblick bei ihnen.
Kaitlins Blick begegnete dem seinen. Sie hielt das kleine Mädchen an sich gedrückt.
»Wir werden gefressen werden«, jammerte das Kind.
Kaitlin schaukelte sie vor und zurück. »Nein, das werden wir nicht«, sagte sie fest und hob den Kopf.
Michael wusste, dass sie ihn um etwas bitten würde, aber beiden war nicht klar, was das eigentlich war. Also kniete er sich zu den anderen. »Ich schwöre bei meiner Hoffnung, einmal ein Ritter zu sein und in den Himmel zu kommen, dass ich euch beschützen werde«, sagte er.
»Er ist kein Ritter, sondern bloß ein Knappe«, sagte das andere Mädchen mit jener tödlichen Wahrhaftigkeit, die nur den Kindern zu eigen ist. Sie sah Michael mit ihren riesigen Augen an.
Kaitlin betrachtete ihn ebenfalls aufmerksam.
»Ich werde euch trotzdem beschützen«, sagte Michael in unbeschwertem Tonfall.
»Ich will nicht gefressen werden!«, sagte das erste Mädchen. Aber ihre Schluchzer wurden schwächer.
»Ich wette, wir sind klebrig und lecker!«, sagte das zweite Mädchen und grinste Michael an. »Das ist der Grund, warum sie uns angreifen«, sagte sie, als hätte dies eine tiefe und schwierige Frage beantwortet, die sie sich schon seit Langem gestellt hatte.
Kaitlin umarmte beide Mädchen. »Ich glaube, dass einige Leute einfach dumm sind«, sagte sie.
Das dritte Mädchen warf einen Pferdeapfel auf Michael, und nun befand er sich in einem seltsamen Dilemma. Einerseits wollte er mit Kaitlin allein sein, doch während er sie mit den Kindern beobachtete, wünschte er andererseits, dieser Augenblick möge ewig anhalten. Zum ersten Mal dachte er: Ich könnte sie wirklich heiraten.
Amicia streckte ihr Innerstes aus. Seine Tür stand einen Spaltbreit offen, und sie schlüpfte hinein, ein Geist im grünen Licht. Der Kriegsherr, der die Festung belagerte, war so mächtig, dass er wie eine grüne Sonne in ihrem Wald leuchtete, und das grüne Licht hämmerte gegen seine Turmtür.
Da war er; er stand neben der Statue einer Frau.
»Ich wollte gerade nach dir sehen«, sagte er fröhlich und gähnte.
Sie schüttelte den Kopf. »Geh schlafen. Du hast heute Morgen deine Kräfte nicht erneuert.«
Nun schüttelte auch er den Kopf. »Eine Stunde mit dir …«
Sie wich von ihm zurück. »Gute Nacht«, sagte sie und schloss die Tür. Von draußen.
Er schlief so schnell ein, dass er von ihr träumte.
Michael beugte sich herunter und drückte seine Lippen zart auf die ihren, die sich unter seiner Berührung öffneten.
»Ich liebe dich«, sagte er.
Sie lachte. »Dummerchen.«
Er legte die Hand um ihr Kinn. »Ich werde dich heiraten.«
Ihre Augen wurden groß.
Die Tür des angrenzenden Stalls flog auf. »Kaitlin Lanthorn!«, kreischte ihre Schwester. »Du kleine Schlampe!«
Grüne Lichter explodierten im Himmel außerhalb des Stalls, und ein gewaltiger Donner erschütterte die Wände.
»Zu den Waffen!«, brüllten zwanzig Stimmen gleichzeitig auf den Mauern.
Der Hauptmann sprang aus dem Bett, ohne zu wissen, was ihn geweckt hatte, und stand kurz darauf vor seinem Rüstungsgestell – zusammen mit Michael, der gar nicht zu Bett gegangen war, und ließ sich in das Kettenhemd helfen. Er war noch nicht einmal ganz wach, als ihm Michael die letzten Bänder am Rücken festzurrte, dann streifte er sich seine alten Schuhe über die nackten Füße und rannte kurze Zeit später bereits über die Mauer.
»Die Brückenburg!«, rief Bent vom Turm über ihnen. Michael versuchte, dem Hauptmann in seinen Panzer zu helfen, während er gleichzeitig den sternerhellten Himmel und die Mauern beobachtete.
Der Nebel war verschwunden – ein mächtiger Windstoß hatte ihn verweht. Der Hauptmann spürte den Wind und wusste, worum es sich dabei handelte. Er lächelte in ihn hinein.
»Da sind wir also«, sagte er.
Zwei Leuchtfeuer loderten, während eine Menge Rufe ertönten. Es klang eindeutig nach Männern in Gefahr – oder in Wut.
»Wir brauchen eine Möglichkeit, mit der Brückenburg in Verbindung zu treten.« Der Hauptmann lehnte sich auf die Brüstung, während Michael inzwischen sein eigenes Panzerhemd angezogen hatte und die schmerzenden Rippen darunter spürte. Er kniete sich hin, um die metallenen Beinschienen anzulegen. Zwei Diener trugen die Rüstungsteile stets hinter dem Hauptmann her. Es hätte komisch sein können, wenn die Lage nicht so erschreckend gewesen wäre.
Michael gelang es allmählich, dem Hauptmann die vollständige Rüstung anzulegen, während sich dieser unablässig in der Festung hin und her bewegte. Er machte verfängliche Witze mit den Krankenschwestern, schlug in Tom Schlimms Hand ein und befahl Pampe, in dem inzwischen überdachten Teil des Innenhofs aufzusitzen. Michael vermutete, dass die Überdachung die Lindwürmer von den Pferden fernhalten sollte. Es war der gleiche Ausfall, der bereits in der vergangenen Nacht hatte geführt werden sollen, dann aber abgeblasen worden war.
Eine Stunde später wurde die Maschine auf dem Westturm mit einem lauten Knacken abgefeuert. Soweit Michael sehen konnte, hatte der geschleuderte Felsbrocken keinerlei Auswirkungen.
Michael zog sich den Rest seiner eigenen Uniform an, ruhte sich kurz aus und schlief stehend in der Mauerecke vor dem Westturm ein.
Er erwachte von einem lauten Brüllen. Ein Meer aus Feuer floss beinahe zu seinen Füßen, und Kreischen durchdrang die lauten Kriegsrufe. Der Hauptmann legte die Hand um seine Armschiene. »Da kommen sie!«, rief er. »Auf mein Zeichen!«
Michael blickte hoch und sah, wie sich ein Mann weit über den Rand des Westturms beugte. Es war noch nicht hell; der Himmel war grau.
»Willkommen zurück«, sagte der Hauptmann fröhlich. »Hast du ein gutes Nickerchen gemacht?«
»Entschuldigung«, murmelte Michael.
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Echte Soldaten schlafen in solchen Zeiten immer dann, wenn es möglich ist. Unsere Feinde versuchen die Brückenburg und die Unterstadt anzugreifen, während sie, wie ich vermute, einige Männer zu dem ausgesandt haben, was wir gestern erbaut haben. Entweder sie sollen es sich ansehen, oder sie sollen es niederbrennen.« Über diese Aussicht klang er recht erfreut.
Michael holte tief Luft. Ein Diener drückte ihm einen Becher mit warmem Wein in die Hand, und er trank ihn sofort.
Der Hauptmann beugte sich über die Mauer. »Feuer!«, rief er.
Die Blide auf dem Westturm knirschte, und der gesamte Turm bewegte sich einen Fingerbreit.
»Ein Hagelschuss. Sieh nur.«
Michael hatte seine Brüder und Schwestern manchmal damit unterhalten, eine Handvoll Steine ins Wasser zu werfen. Das hier war ähnlich, nur in hundertmal größerem Umfang und mit größeren Steinen. Und statt Wasser trafen die meisten von ihnen den Boden. Der Rest schlug in einer Entfernung von mehreren Hundert Fuß auf Außenskelette, Fleisch und Blut.
»Noch einmal!«, brüllte der Hauptmann.
Auf der Brückenburg wurden die beiden schweren Katapulte gleichzeitig eingesetzt und schleuderten körbeweise Steine von der Größe eines Menschenherzens in die Gräben, die am Tag zuvor ausgehoben worden waren.
Schreie erhoben sich von dem aufgewühlten Boden.
»Ihr scheint sehr zufrieden mit Euch zu sein«, sagte die Äbtissin. Sie war vollständig angezogen und sah genauso aus wie an einem ereignislosen, ruhigen Tag. Soeben hatte sie die Ecke des Westturms umrundet und wurde von Bahrenträgern und zwei Krankenschwestern begleitet.
»Der Feind ist gerade mit beiden Beinen in unsere kleine Falle gestürzt.« Der Hauptmann wandte sich an Bent. »Noch einmal. Und dann schwenkst du die beiden roten Flaggen. Bei diesem Signal wird jeder – jeder in der Festung außer dir und den Männern an den Maschinen – unten auf der Straße angreifen. Auf mein Kommando.«
Es gelang dem Hauptmann, sich vor der Äbtissin zu verbeugen und sich gleichzeitig unter den Sturz der Tür zum Westturm zu ducken. Die Diener hatten inzwischen Grendel gesattelt, und der Hauptmann nahm seinen Platz an der Spitze von Pampes Truppe ein. Michael versuchte, mit ihnen Schritt zu halten, obwohl er vom Schlaf noch immer benommen war und seine Rippen in der Brust brannten.
Jacques stand neben Michaels Pferd. »Du siehst aus, als könntest du ein wenig Schlaf gebrauchen«, sagte der Mann mit einem Lächeln. »Sei nicht zu unbedacht, Junge. Diese Rippen können dich umbringen.« Er beugte sich zu ihm vor. »Genau wie das Küssen von Mädchen, wenn es dich den Schlaf kostet.«
Dann saß Michael auf. Jacques schob ihn mit der Hand in den Sattel, und schon war er durch das niedrige Stalltor in den Hof geritten. Toby hielt den Helm des Hauptmanns, während er in einen halben Brotlaib biss, und der Hauptmann heftete gerade etwas – ein weißes Leinentaschentuch – an seinen Wappenrock. Vor dem Scharlachrot hob es sich auffallend grell ab.
Michael grinste. »Was ist das denn?«, fragte er.
»Honi soit qui mal y pense«, erwiderte der Hauptmann. Er zwinkerte, nahm den Helm von Toby entgegen, schenkte dem Jungen ein Lächeln und lenkte Grendel nur durch den Druck seiner Knie um. »Alle herhören!«, rief er.
Sofort verstummte die Ausfalltruppe.
»Sobald wir das Tor hinter uns gelassen haben, tötet ihr alles, was euch unter das Schwert kommt«, sagte der Hauptmann. »Die Grabenränder sind mit Feuer gekennzeichnet, sodass ihr nicht vom Weg abkommen könnt. Falls ihr mich verlieren solltet, folgt ihr diesem Weg. Wenn ihr hört, dass Carlus zum Rückzug bläst, dreht ihr um und reitet zurück. Habt ihr mich verstanden?«
Nach dieser kurzen Ansprache ritten sie durch das Tor, während die Blide einen weiteren Todesregen über ihren Köpfen aussandte.
Es war die Stunde zwischen Tag und Nacht, und die großen Steinkörbe der Blide hatten alles Leben am Boden in einem annähernd eiförmigen Umkreis vernichtet. Jede Kreatur war zu blutigem oder eitrigem Matsch zerschmettert und der Boden selbst von den Steinen übersät worden. Dort, wo er etwas weicher war, wirkte er wie mit tiefen Pockennarben bedeckt. Büsche und Gräser waren zu Pulver zermahlen. Im Zwielicht wirkte es wie eine Vision der Hölle, und das plötzliche Aufzucken von Feuer in den frisch ausgehobenen Gräben verstärkte dieses Bild noch.
Besonders wenn es durch die Schlitze eines geschlossenen Visiers betrachtet wurde.
Den noch lebenden Menschen und Ungeheuern, die sich von dem zerwühlten Boden wegzuschleppen oder den Geschossen auszuweichen versuchten, die weiterhin von der Brückenburg herabregneten, stand der Sinn nicht mehr nach Kampf. Sie strömten auf die Wälder zu, die mehr als eine Meile entfernt lagen.
Der Hauptmann führte seine Truppe nach Süden – am Fluss entlang über weichen Untergrund – und formierte sie zu einer langen Reihe. Er rief seinen Trompeter und den Bannerträger mit der schwarzen Fahne und seinem persönlichen Wappen herbei und zog sein Schwert.
»Folgt mir bis zum Rand des Waldes und rückt dann zu mir auf.« Er schob das Visier hoch und sah sich um. Tom Schlimm befand sich in seinem Rücken, Pampe an seiner Seite, und auch Ser Jehannes war nicht weit entfernt.
»Tötet alles, was euch unter das Schwert kommt«, sagte er noch einmal. Michael glaubte, dass sie auf dem Weg bis hierher keinen einzigen Mann verloren hatten. Die Kriegsmaschinen hatten den feindlichen Angriff vollkommen aufgelöst. Er holte tief Luft, als der besiegte Feind in einiger Entfernung von ihnen auf erschöpften Füßen – oder Klauen, Tatzen und Krallen – in Richtung der Wälder rannte.
»Angriff!«, brüllte der Hauptmann, und das Banner zeigte auf den Feind. Die Trompete erschallte.
Michael hatte noch nie an einem Angriff teilgenommen.
Es war berauschend, und nichts auf dem Boden schien in der Lage zu sein, sie zu berühren. Sie glitten über Irks und zerschmetterte Menschen und auch über eine vereinzelte größere Kreatur hinweg, die im ersten Licht der Sonne albtraumhaft in ekelhaftem Grün schimmerte. Tom Schlimm rammte dem Ding seine Lanze in die Ohrmuschel, als es Grendel seine Krallen entgegenstreckte. Die Lanzenspitze, die so lang wie ein Unterarm und so breit wie eine Handfläche war, riss ihm die Hirnschale vom Kiefer.
»Lachlan für Aa!«, brüllte der große Mann.
Das Ungeheuer starb, und die Reihe der Ritter preschte über den armseligen Widerstand auf die rennenden Menschen und anderen Wesen zu.
Als die Sonne bereits über dem Horizont stand, hatten sie endlich den Waldrand erreicht, und die Kreaturen der Menschheit und Wildnis waren nur noch eine blutige Masse im Gras hinter ihnen. Genauer gesagt: Diejenigen, auf die sie gestoßen waren, waren nun eine blutige Masse, während Hunderte andere um sie herum nach Norden oder Süden rannten oder sich flach auf den Boden geworfen hatten und beteten, die Pferde mögen über sie hinwegdonnern.
Und dann führte der Hauptmann sie auf demselben Weg zurück zum Tor und brach dabei durch eine Linie verzweifelter Irks, die vergeblich versuchten, sich mit ihren Speeren zu verteidigen, die aber an den Stahlrüstungen zersplitterten. Die Ritter preschten hindurch und bis zum Fuß des Festungshügels, an dem zwanzig Diener mit frischen Pferden auf sie warteten.
Michael war verblüfft. Sein Rausch verebbte allmählich und wurde von Erschöpfung sowie dem pochenden Schmerz seiner Rippen ersetzt, die unter dem Galopp gelitten hatten und von seiner Rüstung kaum noch zusammengehalten wurden.
Alle Ritter und einige Bogenschützen wechselten die Pferde. Die Männer auf den Mauern jubelten ihnen zu.
Der Hauptmann ritt zu Michael. »Du bewegst dich schlecht«, sagte er offen heraus. »Du siehst ganz erbärmlich aus. Wegtreten!«
»Was? Wo …«, stotterte Michael.
Jacques ergriff seine Zügel. Michael bemerkte, dass der Diener eine Rüstung trug – eine gute Rüstung –, als ihm dieser aus dem Sattel half. Am liebsten hätte Michael geweint, doch gleichzeitig konnte er sich nicht vorstellen, noch einmal zu kämpfen.
Dann schwang sich Jacques auf ein schweres Pferd, einen hässlichen Rotschimmel mit einer mageren Nase. »Ich sorge dafür, dass er überlebt, Junge«, sagte Jacques.
So stand Michael nun da und sah zu, wie die anderen die Pferde wechselten und sich neu formierten. Zu seiner Überraschung wandten sie sich von dem geschlagenen Feind ab und ritten im Galopp nach Süden, auf das Tor der Brückenfestung zu, das sich wie durch Magie öffnete und sie hindurchließ. Nun ritten sie über die Brücke und waren bald auf der Straße nach Süden verschwunden.
Während Michael zusah, verließ Gelfred, der Jagdmeister, die Brückenburg mit drei Männern und einem Karren. Jeder der Männer führte zwei Hunde mit sich – wunderschöne Hunde – und bewegte sich rasch nach Westen, während ihnen ein Dutzend Bogenschützen Geleit gab.
Als die ersten Sperlinge und Raben erschienen, stiegen wieder Falken in die Luft auf und kreisten über der Brückenburg. Auf der Mauer erhob sich ein großer Adler mit einem Schrei in die Luft, der jeden kleineren Vogel im Umkreis von drei Meilen entsetzt haben musste.
Gelfred hatte zugeschlagen, und die Äbtissin half ihm.
Weitere Hundepaare rannten aus dem Schutz der Brückenburg und jagten die jungen Hasen, die Kaninchen und alle anderen Tiere, die am Waldrand lauerten. Die Falken sowie der Adler Parcival und die kleineren Vögel – gut ausgebildete Tiere, die aus Theva stammten und auf dem Jahrmarkt verkauft werden sollten – fielen über die Sperlinge, die Raben und übergroßen Tauben her, fuhren durch die Schwärme wie ein Ritter durch eine Gruppe von Bauern, und Federn, Schwingen, Blut, ja ganze tote Tiere regneten herab.
Michael brauchte eine halbe Stunde, bis er den Hügel erklettert hatte und vor dem Festungstor stand. Die Diener beachteten ihn nicht, und er taumelte ein ganzes Stück, bis jemand auf der Mauer die Blutspur bemerkte, die er hinter sich herzog. Zwei Bogenschützen erschienen, stützten ihn und führten ihn durch das Tor.
Amicia nahm ihm die Rüstung ab und fand die steinerne Speerspitze, die sich tief in den Muskel am Hinterschenkel gebohrt hatte. Als sie sie herauszog, floss das Blut wie aus einem offenen Spundloch.
Sie redete schnell und fröhlich, sodass ihm gerade noch genug Zeit für den Gedanken blieb, wie schön sie doch war.
Lissen Carak · Die Äbtissin
Die Äbtissin sah zu, wie der Trupp des Hauptmanns auf der Straße nach Osten zog. Er bewegte sich so schnell, dass er bereits verschwunden war, als die Äbtissin ihren Adler zurückholte.
Ich habe meinen Rang an jeden Edelmann hier verraten, dachte sie und fragte sich, ob ihr diese Belagerung überhaupt noch ein Geheimnis übrig lassen würde.
Parcival, ihr großartiger Ferlander-Adler, mordete sich seinen Weg durch die Schwärme von Wildvögeln wie ein Tiger, der in einem Schafspferch losgelassen wurde. Aber sie erkannte, dass der große alte Vogel müde wurde, und so wirkte sie ihren Lockzauber – nur zur Sicherheit.
Sie wirbelte die Magie über ihrem Kopf herum, und Parcival sah sie, drehte bei dem Aufblitzen des tyrischen Rots um und gab die Verfolgung der besiegten Feinde auf. Er kam zu ihr wie ein Einhorn zu einer Jungfrau – scheu zuerst, doch dann eifrig darauf bedacht, eingefangen zu werden.
Er war zu schwer für sie, doch die junge Theodora half ihr und hatte das Gesicht bald voller Federn, da das Tier immer wieder mit den Schwingen flatterte, denn es war nicht daran gewöhnt, dass seine Herrin eine Helferin hatte. Doch schließlich gelang es ihr, ihm die Stulpen über die Krallen zu ziehen und die Haube aufzusetzen. Nun beruhigte sich der Adler, und die Äbtissin sagte: »Du bist mein tapferer Ritter. Du bist mein feiner Krieger – du armes altes Ding.« Der Adler war erschöpft, mürrisch und gleichzeitig sehr mit sich zufrieden.
Theodora strich ihm über Rücken und Schwingen, da richtete er sich auf.
»Gib ihm ein Stück Hühnchen, Liebes«, sagte die Äbtissin und lächelte die Novizin an. »Es ist wie bei einem Mann, mein Kind. Gib ihm niemals das, was er haben will – gib ihm nur das, was du ihm geben möchtest. Wenn er zu viel frisst, werden wir ihn nie wieder in die Luft schicken können.«
Theodora schaute vom Turm herab. Die Ebene und der Fluss befanden sich tief unter ihr, und das plötzliche Herabstoßen des Adlers aus dieser Höhe hatte die kleineren Vögel zerstreut.
Amicia kam aus dem Krankensaal mit einer Botschaft von Schwester Miram. Die Äbtissin las sie und nickte. »Sag Miram, sie soll alles benutzen, was sie braucht. Es hat keinen Sinn, jetzt noch Vorräte zu schonen.«
Amicias Blick war auf etwas anderes gerichtet. »Sie sind weg«, sagte sie. »Die Spione des Feindes. Sogar die Lindwürmer. Ich spüre es.«
Theodora schien erstaunt darüber, dass eine Novizin es wagte, die Äbtissin unmittelbar anzusprechen.
Doch der Äbtissin schien dies nichts auszumachen. »Du bist sehr einfühlsam«, sagte sie. »Aber an dieser Sache gefällt mir etwas nicht.« Sie ging zum Rand des Turms und blickte nach unten. Dort stand ein Rudel Nonnen auf der breiten Plattform des Torhauses und beobachtete das Ende des feindlichen Rückzugs sowie die allmählich sich auflösende Staubwolke, die den Weg des Hauptmanns markierte.
Eine der Nonnen verließ die Plattform und raffte die Röcke, während sie lief. Die Äbtissin fragte sich beiläufig, warum Schwester Bryanne in solcher Eile sein mochte, bis sie den Priester sah. Er befand sich auf der Mauer, war allein und betete laut für die Vernichtung des Feindes.
Das war in Ordnung, doch ansonsten war Pater Henry wie eine schwärende Pestbeule. Sein Hass auf den Hauptmann und seine Versuche, ihre Nonnen zu disziplinieren, ließen die beiden auf eine Auseinandersetzung zusteuern.
Doch die Belagerung schob jegliche Routine beiseite, und die Äbtissin befürchtete bereits, die Ordnung würde nie wieder einkehren. Und was war, wenn der Kaplan hinausging und starb?
»Was habt Ihr gesagt, Mylady?«, fragte Amicia. Die Äbtissin lächelte sie an.
»Oh, meine Liebe, wir alten Leute sprechen manchmal etwas laut aus, das wir eigentlich für uns hätten behalten sollen.«
Auch Amicia blickte nun nach Osten, wo noch immer ein dünner Staubschleier über der Straße hing, die am Fluss entlang nach Süden führte. Und sie fragte sich wie jede Nonne, jede Novizin, jeder Bauer und jedes Kind in der Festung, warum sie weggeritten waren und ob sie zurückkehren würden.
Nördlich von Albinkirk · Peter
Peter lernte, sich im Wald zu bewegen. Sein Zuhause bestand aus der Grassteppe, aus trockenem Gebüsch und tief in den Fels eingeschnittenen Flussläufen, die den größten Teil des Jahres hindurch ausgetrocknet waren und die restliche Zeit braunes Wasser führten. Hier auf dem weichen Boden, zwischen den mächtigen Bäumen, die sich bis in den Himmel streckten, und den seltsamen Sümpfen auf den Hügeln sowie den endlosen Bächen und Seen war eine ganz andere Art von Heimlichkeit notwendig – und auch eine andere Art von Schnelligkeit, andere Muskeln, andere Werkzeuge.
Die Sossag flossen geradezu über den Boden und folgten Spuren, die aus dem Nichts erschienen und genauso plötzlich wieder verschwanden.
Am Mittag hielt ihn Ota Qwan an. Beide standen schwer atmend da.
»Weißt du, wo wir sind?«, fragte ihn der ältere Mann.
Peter sah sich um und lachte. »Auf dem Weg nach Albinkirk.«
»Ja und nein«, erwiderte Ota Qwan. »Aber für einen Seemann auf dem Meer der Bäume liegst du gar nicht so schlecht.« Er griff in einen Beutel aus zusammengebundener Borke, den er stets an der Hüfte trug, und zog einen gekochten Maiskolben hervor. Dann nahm er einen Bissen und reichte ihn Peter. Dieser biss ebenfalls ab und gab den Kolben an den Mann hinter ihm weiter – der Pal Kut hieß, wenn er sich recht erinnerte, und ein freundlicher Knabe mit rotem und grünem Gesicht und einer Glatze war.
Peter griff in seinen eigenen Beutel und nahm eine kleine Rindenschachtel mit getrockneten Beeren heraus, die er in Grundags Sachen gefunden hatte.
Ota Qwan aß eine Handvoll und grunzte. »Du gibst mit beiden Händen, Peter.«
Der Mann hinter ihm nahm eine halbe Handvoll und hielt sie gegen die Stirn. Das war eine Geste, die Peter noch nie beobachtet hatte.
»Damit sagt er dir, dass er deine Arbeit und das Opfer achtet, das du durch dein Teilen bringst. Wenn wir gestohlene Nahrung miteinander teilen … nun ja, eigentlich hat sie dann ja nie jemandem von uns gehört, nicht wahr?« Ota Qwan lachte, was grausam klang.
»Was ist mit dem Essen, das ich gekocht habe?«, fragte Peter ungehalten.
»Da warst du noch ein Sklave.« Ota Qwan tippte ihm mit dem Finger gegen die Brust. »Mein Sklave.«
»Wohin gehen wir?«, fragte Peter. Es gefiel ihm nicht, wie ihn Ota Qwan behandelte.
Skadai erschien wie aus dem Nichts, nahm die letzte Handvoll Beeren und machte ebenfalls jene Geste der Achtung. »Gute Beeren«, sagte er. »Wir wollen uns Albinkirk ansehen. Und dann gehen wir auf die Jagd.«
Peter schüttelte den Kopf, als der Kriegsführer weiterging. »Wir jagen allein?«
»Als du gestern wie ein Bock gerammelt hast … warte, weißt du überhaupt, wer Thorn ist?«, fragte ihn Ota Qwan, als wäre er ein Kind.
Peter wollte etwas Heftiges erwidern, aber er wusste nicht, um wen es sich dabei handelte, auch wenn er den Namen irgendwann schon einmal gehört hatte. Und er wollte immer mehr über seine neue Welt erfahren. »Nein« sagte er schnippisch.
Ota Qwan beachtete seinen ungebührlichen Tonfall nicht. »Thorn will der Herrscher dieser Wälder sein.« Er zog eine Grimasse. »Er steht im Ruf, ein großer Zauberer und früher einmal ein Mensch gewesen zu sein. Jetzt aber will er Rache an den Menschen nehmen. Gestern allerdings wurde er besiegt – zwar nicht vernichtend geschlagen, aber er hat sich immerhin eine blutige Nase geholt. Wir sind ihm nicht in die Schlacht gefolgt, weil Skadai von dem Plan, den er gehört hat, nichts hält. Deswegen gehen wir jetzt nach Osten und schlagen unsere eigene Schlacht.«
»Besiegt? Von wem?« Peter sah sich um. »Wo hat diese Schlacht stattgefunden?«
»Sechs Meilen von der Stelle, wo du mit Senegral gerammelt hast, sind zweihundert Menschen und doppelt so viele Kreaturen der Wildnis gestorben.« Ota Qwan zuckte die Achseln. »Thorn hat zehnmal so viele Kreaturen und Menschen zur Verfügung, und er ruft noch immer weitere herbei. Aber die Sossag sind keine Sklaven, Diener oder Lehenstreue. Wir sind lediglich Verbündete, und auch das nur dann, wenn es uns passt.«
»Sicherlich ist dieser Thorn jetzt wütend auf uns«, meinte Peter.
»So wütend, dass er uns alle töten, unsere Dörfer zerstören und Skadai zu Tode foltern würde, wenn er es wagte.« Ota Qwan kicherte. »Aber dadurch würde er die Unterstützung aller Kreaturen, Kobolde und Menschen in seinen Diensten verlieren. Das hier ist nämlich die Wildnis, mein Freund. Wenn er gewonnen hätte, dann stünden wir jetzt dumm und schwach da.« Ota Qwan schenkte ihm ein böses Grinsen. »Aber er hat verloren, und so ist er es, der nun dumm und schwach dasteht, während wir das Land um die Stadt Albinkirk herum niederbrennen, die vor vielen Jahren auf unserem Land erbaut wurde. Wir haben ein gutes Gedächtnis.«
Peter sah ihn an. »Ich vermute, du bist nicht als Sossag geboren worden.«
»Ha!«, seufzte Ota Qwan. »Ich wurde südlich von Albinkirk geboren.« Er zuckte die Achseln. »Aber das ist nicht mehr von Bedeutung, mein Freund. Jetzt bin ich ein Sossag. Und wir werden die Gehöfte um die Stadt herum niederbrennen – zumindest die, die Thorn übrig gelassen hat. Er ist auf die Festung der Frauen scharf, die uns überhaupt nicht interessiert.« Ota Qwan lächelte seltsam. »Die Sossag haben sich nie in einem Krieg mit der Festung der Frauen befunden. Und er hat gegen sie versagt.« Ota Qwan richtete den Blick in die Ferne, wo die Berge wie Wellen auf dem Meer wogten. »Fürs Erste. Skadai sagt, Albinkirk soll die Farbe unseres Stahls sehen.«
Diese Worte erregten Peter, der eigentlich geglaubt hatte, er sei zu reif und erwachsen für solche Dinge. Aber der Krieg hatte etwas Schlichtes an sich, das äußerst befreiend sein konnte. Und manchmal tat reiner Hass auch sehr gut.
Doch dann wieder glaubte Peter, dass Ota Qwan eine verletzte Seele war, die sich den Sossag angeschlossen hatte, um sich selbst zu heilen. Aber der frühere Sklave schüttelte den Kopf und sagte: »Sei einer von uns, und du wirst nie wieder ein Sklave sein.«
Am zweiten Tag kamen sie bei Anbruch der Nacht in Sichtweite der Stadt. Peter ging in die Hocke, aß einen dürren Hasen, den er in einem Kräutersud gekocht hatte, und teilte ihn mit seinen neuen Gefährten. Ota Qwan hatte seine Kochkünste gelobt und zugegeben, dass ihre neue Kriegerschar – Pal Kut, Brant, Skahas Gaho, Mullet und Stachelkopf (seinen wahren Namen konnte Peter einfach nicht behalten) – nicht nur wegen Ota Qwans Führungskünsten, sondern auch aufgrund von Peters Kochkünsten zusammengefunden hatte.
Wie auch immer, es war gut, irgendwohin zu gehören. Es war gut, Teil einer Gruppe zu sein. Brant lächelte, als er sein Essen entgegennahm. Skahas Gaho klopfte auf sein Laken, als Peter vor dem Feuer hockte und nach einem Platz Ausschau hielt, auf dem er sich niederlassen konnte.
Schon nach zwei Tagen waren sie zu seinen Kameraden geworden.
Skadai kam in der Dunkelheit zu ihrem Feuer und hockte sich davor hin. Er sprach schnell, lächelte oft und überraschte Peter damit, dass er ihm auf den Arm klopfte. Mit den Fingern aß er eine Schüssel Haseneintopf, grinste und trat zum nächsten Feuer.
Ota Qwan seufzte. Die anderen Männer machten sich nun daran, Steine aus ihren Beuteln zu schärfen und sich um die Pfeilspitzen und Messer zu kümmern. Skahas Gaho, der ein Schwert besaß, eine kurze Waffe mit schwerer Klinge – wie ein moreanischer Xiphos –, ließ den Stahl singen, als er mit seinem Wetzstein darüber fuhr.
»Morgen kämpfen wir«, sagte Ota Qwan.
Peter nickte.
»Nicht Albinkirk«, fuhr Ota Qwan fort. »Wir nehmen uns ein reicheres Ziel vor – etwas, das wir mit nach Hause nehmen können. Etwas, das uns den Winter verkürzt.« Er leckte sich die Lippen. Brant stellte ihm eine Frage und lachte schallend über die Antwort.
Skahas Gaho schärfte weiterhin sein kurzes Schwert, und bald lachten alle Männer. Er strich geradezu zärtlich über seine Waffe. Dann machte er ein paar kürzere, schnellere Bewegungen.
Brant lachte, spuckte aus und entrollte seinen Schlafsack.
Peter tat das Gleiche. Er hatte keine Schwierigkeiten einzuschlafen.
Südlich und östlich von Lissen Carak · Gerald Random
Random war schon seit fünf Tagen auf einen Hinterhalt vorbereitet, und deshalb war es gleichgültig, wann er geschah. Seine Männer hatten es beinahe geschafft.
Beinahe.
Sie ritten durch einen tiefen Wald, und die Straße nach Westen war nicht mehr als eine doppelte Wagenspur, die bisweilen von den Bäumen überwölbt wurde. Doch dieser alte Wald war licht, die großen Stämme standen manchmal sechzig Fuß oder gar noch weiter voneinander entfernt, und es gab kaum Unterholz, sodass seine Eskorte neben den Wagen herreiten und die Vorhut den Weg hundert Pferdelängen im Voraus sichern konnte. Seine Wagen kamen gut voran; es war der fünfte Tag ohne Regen, und die Straße war mit Ausnahme der tieferen Furchen und einiger Löcher, die so groß wie schlammige Teiche waren, trocken.
Der Wald erschien so ausgedehnt, dass es schwerfiel, das Verstreichen der Zeit abzuschätzen, und er hatte keine Ahnung, wie lange sie schon auf dem schmalen Weg gereist waren, als der alte Bob zu ihm zurückritt und ihm sagte, er glaube, den Fluss zu hören.
Bei dieser Nachricht hob sich Randoms Mut, denn das, was er gerade tat, war geradezu selbstmörderisch, und seine Frau würde es niemals gutheißen, sollte sie es jemals herausfinden.
Er befand sich auf dem ersten Wagen, erhob sich und sah sich um. Es war ganz natürlich, auch wenn er eher etwas hören als etwas sehen konnte. Er hörte jedoch nur den Wind in den Bäumen über sich.
»Hinterhalt!«, rief plötzlich jemand aus der Vorhut. Er zeigte auf ein Dutzend Kobolde um einen jungen Troll herum – ein Ungeheuer von der Größe eines Ackergauls mit einem Geweih wie ein Elch und einem glatten Steingesicht, das an das Visier vor einem Helm erinnerte. Das Wesen war mit dicken Obsidianplatten gepanzert.
Der Troll griff sie an – wie ein tollwütiger Hund rannte er geradewegs auf die Wagen zu. Die Pferde gerieten in Panik, nicht aber Randoms Männer, und sofort flogen die Pfeile dicht wie Schneeflocken. Der Troll kreischte auf. Einen Moment lang schien er durch Stahl zu schwimmen, dann stürzte er mit einem lauten Krachen zu Boden.
Die Kobolde verschwanden.
Random, der auf dem Wagensitz stand, wurde von einem Pfeil an der Brustplatte getroffen. Er drang zwar nicht ein, warf ihn aber vom Sitz, und als er sich wieder aufraffen wollte, schmerzten Schulter und Hals, als stünden sie unter Feuer.
Plötzlich sah sich die Vorhut weiteren Kobolden gegenüber.
Der alte Bob preschte auf das Gewühl zu.
Random beobachtete, wie seine Soldaten mit dem Gewicht ihrer Pferde und ihren besseren Waffen sowie ihrer überlegenen Geschicklichkeit die kleineren Kreaturen zerschmetterten. Es war unausweichlich, dass die Kobolde schließlich aufgaben und davonrannten.
Der alte Bob rief zwar etwas, doch seine Worte gingen im Triumph des Augenblicks unter, und die Reiter wendeten ihre Pferde, um den fliehenden Kobolden nachzusetzen … und dann waren plötzlich die Trolle über ihnen: zwei, die von beiden Flanken angriffen. Blut stieg aus dem Handgemenge wie Rauch auf, als sie zustießen, und die Pferde starben schneller, als sie zu Boden fallen konnten.
Random hatte nie zuvor einen Troll gesehen, doch ihm kam der Name, den die Wildnis für sie hatte – Dhag –, in die Erinnerung, ebenso wie das Bild in einem Stundenbuch, das er in Harndon für den Jahrmarkt gekauft hatte. Der darin abgebildete Troll war größer als eine Bauernkate und so schwarz wie die Nacht oder wie kostbarer Samt, mit einer Panzerung aus schwarzem Stein, der einer Rüstung ähnelte, aber ohne Gesicht und mit Geweihstangen auf dem Kopf, die wie Keulen aussahen. Ein Troll konnte eine Brustplatte mit einem einzigen Schlag zerschmettern und den Gegner mit dem nächsten Schlag köpfen; außerdem war er so schnell wie ein Pferd und so leise wie ein Bär.
Die Vorhut war tot, noch bevor Random den Mund wieder schließen konnte. In einem einzigen Atemzug waren sechs Männer umgekommen.
Der alte Bob hatte eine leichte Lanze und senkte nun die Spitze. Er warf sie, und sie bohrte sich in die Seite der einen Bestie zwischen zwei Steinplatten. Ein fleischiges Geräusch entstand, das sogar aus dieser Entfernung deutlich hörbar war.
Ein Dutzend Pfeile trafen nun die Kreatur.
Gawin hatte die Nachhut herbeigeholt, die sich rechts und links neu formierte, und ganze Kompanien aus Gildenmännern kamen von beiden Seiten heran. Ihre Gesichter waren allerdings weiß wie Schnee, und ihre Hände zitterten, aber sie rückten dennoch vor.
»Halt!«, rief Gawin, als Guilbert mit fünf weiteren Wagenwächtern von der anderen Seite herankam.
Nach einem kurzen Blick übernahm Guilbert das Kommando. »Sucht euch ein Ziel aus!«, rief er.
Es war überraschend still im Wald.
Der alte Bob wendete sein Pferd, sah aber nicht das Dutzend Kobolde, das auf ihn zurannte. Einer von ihnen rammte mühelos wie ein Tänzer seinen Speer in Bobs Pferd. Das gedrungene Wesen drehte eine Pirouette, als es das Reittier aufspießte. Das Pferd erstarrte und gab einen schrillen Schrei von sich, als der verwundete Troll angriff. Mit dem ersten Schlag riss es dem alten Bob den Unterkiefer aus dem Gesicht, dann zerschmetterte es seinen Brustpanzer. Eine Blutfontäne spritzte auf.
Der verwundete Troll sackte zusammen. Der zweite blieb bei ihm stehen und machte sich daran, ihn zu fressen. Sein Steinhelm war jetzt geöffnet, und scharfe Fangzähne wurden in der Schwärze des Mundes sichtbar.
Die Welle der Kobolde schwappte auf die Bogenschützen und Soldaten zu, und diesmal flohen die Männer.
Random beobachtete sie mit dem größten Verständnis. Er war entsetzt und konnte sich nicht rühren. Der Anblick des alten Soldaten, der von dem Troll zerrissen wurde, lähmte sein Denken. Er versuchte zu sprechen und sah, wie sich die Gildenmänner rührten, fluchten und flohen. Die Wächter hatten Pferde, und diesen gaben sie nun heftig die Sporen.
»Stehen bleiben!«, rief Guilbert. »Bleibt hier, oder wir sind allesamt tote Männer!«
Sie beachteten ihn nicht.
Und dann lachte Ser Gawin.
Der Klang seines Gelächters hielt die entsetzten Männer nicht davon ab wegzulaufen. Es hielt die berittenen Männer auch nicht davon ab, ihren Pferden weiterhin die Sporen zu geben … doch zahlreiche Männer drehten den Kopf und sahen ihn an.
Mit einem Klicken fiel das Visier vor sein Gesicht.
Sein Schlachtross machte die ersten Schritte, preschte los, wie es ein Pferd, das für Turniere ausgebildet war, zu tun pflegte.
Die Lanze, die er vorhin noch aufrecht in der Hand gehalten hatte, senkte sich nun, der kleine Wimpel daran flatterte, und dann schoss er wie ein Blitz aus Stahl über den Grund zwischen den Wagen und den Kobolden. Sie erstarrten wie Tiere, die den Ruf des Jägers hören.
Der fressende Troll hob den Kopf.
Der Anführer der Kobolde hob ein Horn an seine Lippen und blies einen langen, süßen Ton. Andere Hörner antworteten ihm, und plötzlich war Random aus dem Griff der Angst befreit, die sein Herz umklammert gehalten hatte. Er riss sein Schwert aus der Scheide.
»Erhöre mich, heiliger Christophorus«, betete er, »wenn ich dies hier überlebe, werde ich dir gewiss eine Kirche errichten.«
Gawin Murien hielt die Lanze weiterhin vor sich ausgestreckt. Der Anführer der Kobolde stand auf dem Brustkorb des toten Trolls, und die Lanze des Ritters durchbohrte ihn so rasch, dass Random einen Herzschlag lang glaubte, Gawin habe ihn verfehlt, bis das kleine Ungeheuer von den Beinen gehoben wurde und mit allen Gliedmaßen zuckte – wie eine schreckliche Parodie auf ein aufgespießtes Insekt. Ein dünner Schrei drang aus seiner Kehle, und dann wurde es gegen den Kopf des verbliebenen Trolls gedrückt, an dessen steinerner Härte es mit dem Geräusch einer platzenden Melone zerquetscht wurde. Unter dem Aufprall geriet der Steintroll ins Taumeln.
Er brüllte auf; es war ein langgezogener, röhrender Laut, der im Wald widerhallte.
Gawin donnerte nach rechts davon. Er hielt seine Lanze in Angriffsstellung, ritt durch ein Dickicht und kam an der anderen Seite der Wagen wieder hervor. Nun bewegte sich sein Pferd in langsamerem Gang.
Die Gildenmänner und Soldaten sammelten sich wieder, schienen ihre Fluchtversuche vergessen zu haben. Die Kobolde stürmten allein oder zu zweit auf sie zu, und ein verzweifeltes Handgemenge entstand. Ein Dutzend Gildenmänner fielen, aber ihre Kameraden liefen nun nicht mehr davon, sondern ihr Tod schien sie und weitere Männer nur anzuspornen, wieder ihre Pflicht zu tun.
Vielleicht war es auch Gawins wiederholtem Schlachtruf zu verdanken, der so laut hallte wie das Brüllen der Ungeheuer. »Für Gott und den heiligen Georg!«, schrie er, dass sogar die Wagen erzitterten.
Der Troll senkte sein Geweih und spuckte etwas aus. Große Moosbrocken flogen auf, und ein bitterer Moschusgestank erfüllte die Luft. Dann hob er den gepanzerten Kopf, hob die Schultern und griff mit einem gewaltigen Sprung an.
Random schwang sein Schwert. Sein rechter Arm schien unabhängig von seinem Verstand zu handeln und zerschmetterte einen Kobold mit einem einzigen Schlag. Dann wich er einen Schritt zurück, denn plötzlich bemerkte er, dass sich ein Dutzend dieser Wesen um ihn herum befanden. Er hob sein Schwert, streckte es vor sich aus und ergriff es mit der linken Hand an dem oberen, ungeschärften Teil der Klinge.
Dann griff er sie an. Er hatte das Beispiel des Ritters vor sich und nur das unbestimmte Bewusstsein, dass zu einem Angriff mehr als bloß Getöse und Wutgeheul gehörten. Er spürte den Schmerz der ersten Wunde sowie den Druck der Schläge an Schultern und Rückenpanzer, und es gelang ihm, einen Kobold mit der Schwertspitze zu töten, einen anderen mit dem Griff zu erschlagen, sodass der Kopf des Wesens platzte, und dann auch noch einem dritten die Beine unter dem Leib wegzuziehen. Sie trugen Rüstungen – ob diese ihre eigene gepanzerte Haut darstellten oder aus Leder und Knochen künstlich hergestellt waren, konnte er nicht sagen, aber sein schweres Schwert durchdrang den Schutz mit jedem einzelnen Schlag. Die Kobolde starben.
Licht zuckte auf, als wäre ein Blitz aus dem Himmel gefahren.
In einem einzigen Herzschlag fielen all seine Gegner, und während sie zu Boden stürzten, verwandelten sie sich in Sand. Sein Schwert glitt durch einen von ihnen, und hinter seinen plötzlich zerfallenen Feinden ritt Ser Gawin unmittelbar auf den Troll zu. Eine Pferdelänge vor dem Zusammenprall tänzelte das Schlachtross nach rechts – und Ser Gawins Lanze stieß unter dem Steinvisier in den gezähnten Mund, fuhr eine Armeslänge weit in die Kehle hinein bis zum Rückgrat vor und schickte das Ungeheuer damit zu Boden. Mit seinem gepanzerten Kopf pflügte es durch die Erde, während Ser Gawin und sein Schlachtross weiterritten.
Wieder pulste das Licht auf, und zwei Dutzend weitere Kobolde fielen zu Boden.
»Sammeln!«, rief Guilbert.
Die Gildenmänner gewannen.
Jeder Kobold, den sie zerschmetterten, aufspießten oder zerhackten, stärkte ihren Glauben daran, dass sie diese Schlacht gewinnen konnten.
Noch immer fielen Männer.
Aber die Übrigen würden standhalten.
… bis die Pferde und Ochsen in Panik gerieten und die Kolonne in kürzester Zeit auseinanderrissen. Ein Wagen schob sich durch die größte Ansammlung von Gildenmännern, zerstreute sie, und die Kobolde, die in ihrem Angriff innegehalten hatten oder einfach außerhalb der Reichweite der Waffen geblieben waren, stürmten plötzlich wieder vor. Ein Dutzend weitere Gildenmänner starben unter ihren Händen, und die Wagenmauer, die die rechte Flanke der Kolonne geschützt hatte, war plötzlich verschwunden.
Random stellte sich Rücken an Rücken gegen Guilbert. »Bleibt standhaft!«, brüllte er. »Bleibt standhaft!«
Einige Fuß entfernt zog Harmodius eine Reitpeitsche aus seinem Gürtel.
»Fiat Lux!«, befahl er, während Feuer über die Kobolde strömte. Ein Gildenmann, dem gerade die Kehle aufgerissen wurde, stand ebenfalls in Flammen, aber die Hörner ertönten überall in der Umgebung mit sanftem Schall.
Random schätzte, dass die kleine Gruppe, in der er sich befand, etwa zwanzig Männer umfasste, und mindestens einer von ihnen befand sich bereits auf den Knien und bettelte um Gnade.
Harmodius zog sein Schwert und hob eine Braue.
»Verdammt«, sagte Random.
Harmodius nickte.
Guilbert schüttelte den Kopf. »Die Wagen haben ein Loch in unsere Linien geschlagen«, sagte er. »Die Berittenen befinden sich in dieser Richtung.« Er deutete den Weg zurück – dorthin, woher sie gekommen waren.
Random spuckte aus. Ich werde alles verlieren, dachte er.
Harmodius nickte. »Wir könnten es versuchen«, bemerkte er. »Sind alle bereit?«
Random spürte, dass er etwas beitragen sollte, aber jetzt geschah alles einfach viel zu schnell.
Harmodius hob die Arme, und ein Kräuseln rollte von seinen Händen herunter – wie ein Fehler in einem Glas – und breitete sich kreisförmig aus wie die Wellen, die ein Stein in einem Teich verursachte. Allerdings wurden die Bäume schwarz, das Gras verschwand, und die Kobolde fielen wie Weizen unter einer scharfen Sense.
Gawin, der sich außerhalb des Wirkkreises befand, griff wieder an. Random sah, wie er sein Tier zum Galopp antrieb und den Rand der Verwüstung mit einem großen Sprung überwand. Anscheinend war ihm dabei nichts geschehen.
»Gut gemacht«, meinte Harmodius. »Ein tapferer Knabe.«
Und dann rannten sie auf dem Weg zurück, den sie gekommen waren.
Sie rannten und rannten.
Als Harmodius nicht mehr atmen konnte, stieg Gawin ab, setzte den Magus auf sein Pferd und lief eine Weile daneben her.
Dann, wie in stiller Übereinkunft, blieben alle vor einem tiefen Fluss stehen. Es war der Fluss, den sie schon bei Tagesanbruch überquert hatten. Am anderen Ufer befanden sich bereits etwa ein Dutzend Wagen und alle berittenen Soldaten. Ein verzweifelter Mann nach dem anderen durchquerte den Strom zu Fuß, stand bis zur Hüfte im Wasser – doch es war ihnen egal. Einige blieben mitten im Fluss stehen und tranken gierig.
Die berittenen Männer weinten. Random beachtete sie nicht.
Nur Gawin gab sich nicht der Illusion von Sicherheit hin. Er steckte sein Schwert in die Scheide und sagte zu den Männern auf den Pferden: »Ich bin ebenfalls vor dem Schrecken geflohen, aber es ist dreimal schwerer, die eigene Ehre wiederherzustellen, als sie zu bewahren. Doch hier werden wir alle wieder zu uns kommen. Steigt ab. Wir werden das Flussufer halten, während sich diese guten Männer in Sicherheit bringen. Dabei werden wir sowohl unsere Ehre als auch unseren Frieden finden.«
Die Macht seiner Stimme war so groß, dass einer nach dem anderen abstieg.
Random sah ihnen ungläubig zu.
Es waren insgesamt neun, alle gut gerüstet und bewaffnet, sodass sie nun die Bresche in der Kolonne ausfüllten.
Die Gildenmänner kümmerten sich um ihre Pferde, während weitere Männer herbeikamen – zuerst eine Gruppe von einem Dutzend, mit wilden Blicken, dann zu zweit oder allein, mit zerfetzten Jacken.
Und dann kam keiner mehr.
Von den dreihundert Männern, die an jenem Morgen erwacht und aufgestanden waren, hatten etwa fünfzig überlebt.
Sie besaßen noch ein Dutzend Wagen – in der Hauptsache waren dies die Pferdewagen, deren Tiere auf der Straße geblieben oder die den Kriegspferden gefolgt waren. Als sie auf den nächsten Angriff des Feindes warteten, dessen Hörner deutlich zu hören waren, erschien ein Junge am anderen Flussufer, der nicht älter als fünfzehn Jahre war.
»Ich glaube, ich brauche Hilfe!«, rief er. »Ich kann diese Ochsen hier nicht allein durch die Furt bringen!«
Der Junge hatte vier Wagen gerettet. Er schien nicht zu wissen, dass er eigentlich Angst haben sollte.
»Sie sind fleißig damit beschäftigt, all die Pferde und Kühe zu töten!«, rief er und grinste, als wäre das alles ein großer Spaß. »Da bin ich einfach zu allen Wagen hingegangen, auf denen keine von diesen Bestien gehockt hat!«
Random umarmte ihn, nachdem sie die Ochsen heil ans andere Ufer gebracht hatten. Dann wandte er sich an Gawin. »Ich ehre Eure Bereitschaft, hier zu kämpfen und uns dadurch in Sicherheit zu bringen«, sagte er, »aber ich glaube, wir sollten alle zusammen gehen. Es wird ein weiter Weg sein, und in diesen Wäldern kann es leicht gefährlich werden – jeder Schritt ist ein Wagnis.«
Gawin zuckte mit den Schultern. »Diese Männer können gehen – auch wenn ich glaube, dass sie Euch noch etwas schulden.« Ein Dämon erschien auf der anderen Seite des Flusses, und ein Troll röhrte. »Aber ich werde hierbleiben, solange Gott meinen Händen die Kraft verleiht, diese Furt zu halten«, sagte er. Sehr leise und sanft fügte er hinzu: »Und dabei bin ich einmal so schön gewesen.«
Harmodius nickte. »Ihr, Messire, seid ein wahrer Ritter.«
Gawin zuckte die Achseln. »Ich bin, was ich bin. Ich höre diesen Dämon auf der anderen Seite des Flusses – ich glaube, ich verstehe ihn. Er ruft nach seinen Blutsbrüdern. Ich …« Doch er schüttelte den Kopf.
»Ihr habt uns gerettet«, sagte Harmodius. »Wie ein wahrer Ritter.«
Gawin schenkte ihm ein verletztes Lächeln. »Das ist ein Stand, aus dem ich herausgefallen bin«, sagte er. »Aber ich hoffe, ihn später einmal wieder zu erreichen.«
Harmodius grinste. »Das tun alle Guten.« Er lüftete seinen Hut. Noch immer saß er auf dem Schlachtross, und nun schien er größer zu sein als jemals zuvor.
Jenseits des Flusses röhrten die Trolle abermals, und Random spürte, wie ihm die Galle in den Mund stieg.
Doch dann ertönte über dem süßen Hörnerschall der Kobolde ein weiteres Signal. Es war eine Bronzetrompete, die durch den Wald hallte.
Südlich von Lissen Carak · Amy Hock
Amy Hock lag still da.
Er lag so still da, dass die Ameisen über ihn drüberliefen.
Als er sich erleichtern musste, tat er es, ohne sich zu bewegen.
Am Fuß des Hügels befanden sich Kobolde. Sie fraßen. Er versuchte sie nicht anzusehen, aber sein Blick wurde immer wieder von ihnen angezogen, immer wieder und immer wieder.
Wenn sie zu einem Leichnam kamen, bedeckten sie ihn vollständig, und wenn sie ihn wieder verließen, war nichts mehr von ihm übrig außer Knochen, Haaren und ein paar Sehnen. Einige fraßen allein für sich, doch die meisten speisten im Rudel.
Hinter ihnen gingen zwei große, gehörnte Trolle langsam den Hang hinunter. Zehn Pferdelängen von dem reglosen Späher entfernt hob der größere der beiden den Kopf und rief etwas.
Ein Dutzend Koboldhörner gaben als Erwiderung sanfte, fröhliche Töne von sich.
Gelfred erschien an seiner Seite; sein Gesicht war so weiß wie Kalk.
»Wie viele?«, hauchte er.
Amy Hock schüttelte den Kopf. »Tausende.«
Gelfred war aus anderem Holz geschnitzt. Er stützte sich auf die Ellbogen und betrachtete das Gebiet unter ihm langsam von rechts nach links. »Heiliger Eustachius, steh uns bei«, sagte er.
Einer der Trolle hob den Kopf und entdeckte ihn.
»Lauf!«, rief er.
Gelfred zielte mit seiner Armbrust, und die Sehne schwirrte laut wie ein Glockenschlag. Der Kobold, der sich ihnen am nächsten befunden hatte, klappte zusammen. Der hinter ihm ebenfalls.
»Wir sind schon tot«, sagte Amy Hock bitter.
»Sei kein Feigling«, meinte Gelfred. »Folge mir.« Sie rannten den Hügel auf der anderen Seite hinunter. Der Troll setzte ihnen nach und war im Unterholz viel schneller als sie.
Am Fuß der Erhebung hatten sie nur noch einen Vorsprung von wenigen Pferdelängen vor dem Wesen, doch zu Amys Erstaunen warteten hier zwei Pferde auf sie. Beide Männer sprangen in den Sattel, und dann schossen die Pferde davon; sie waren genauso entsetzt wie ihre Reiter.
Sobald sie ihren Verfolger abgeschüttelt hatten, wurde Gelfred langsamer. »Geh zum Hauptmann. Er befindet sich auf der Straße.«
»Ich werde ihm sagen, dass er zur Festung zurückkehren soll«, sagte Amy Hock, der noch immer wild und erschrocken dreinblickte.
Gelfred schüttelte jedoch den Kopf. Er war ganz blass, seine Angst war offenkundig. Doch er war jemand, der auch in der Angst einen klaren Kopf behielt. »Nein. Auf gar keinen Fall. Sag ihm, dass eine Möglichkeit besteht. Wenn er schnell ist.«
Amy Hock wäre gern geblieben und hätte mit ihm darüber gestritten, doch das wäre vollkommen verrückt gewesen. Er trieb seinem Pony die Hacken in die Flanken und war rasch verschwunden, während Gelfred allein mit tausend Kobolden und einem Troll zurückblieb.
Der Mann kniete sich neben sein Pony, betete und bereitete sich auf seine Aufgabe vor.
Dann blitzte ein Licht auf, und Gelfred verschwand.
Südlich und östlich von Lissen Carak · Tom Schlimm
Der Grund für einen Sieg kann in Glück oder Geschick oder auch in der reinen Macht der Waffen liegen.
Tom Schlimm führte die Vorhut an. Sie hatten die Koboldhörner vor einer Meile gehört und sofort angehalten – eine lange Kolonne zu je zwei Pferden nebeneinander. Die Schlachtrösser schnaubten, während die kleineren Tiere der Bogenschützen den Bissen der größeren auszuweichen versuchten. Neben der Straße wuchs frisches Gras, und alle Pferde hätten es gern gefressen.
Amy Hock galoppierte von Osten heran und sah so aus, als käme er geradewegs aus der Hölle.
Tom lachte, als er ihn sah. »Anscheinend haben wir sie gefunden«, meinte er erfreut.
Amy Hock salutierte vor dem Hauptmann, der erstaunlich ruhig wirkte – eine große Gestalt in Scharlachrot und Silber. »Gelfred sagt …« Er schüttelte den Kopf. »Da sind eine ganze Menge von ihnen, aber Gelfred sagt, entweder jetzt oder nie.«
»Wir sind kurz vor ihnen«, meinte Tom und nickte dem Späher zu. »Gut gemacht, Junge. Du musst ja Eier aus Messing haben, wenn du bei denen da draußen warst.«
Amy Hock zitterte. »Gelfred ist immer noch da.«
Der Hauptmann lauschte. Manchmal waren Klänge genauso leicht deutbar wie Anblicke. Er konnte die Kriegshandlungen geradezu vor sich sehen. Die Straße verlief nach Osten am Südufer des Stromes entlang und führte dann nach Süden zwischen den Bergen hindurch. Doch bevor sie anstieg, durchquerte sie einen Fluss.
»Was ist los?«, fragte Michael.
»Der Feind greift eine Karawane an«, sagte der Hauptmann. Er und Tom wechselten einen raschen Blick.
Hywel Writhe pflegte zu sagen, dass es im Krieg nicht um Schwerthiebe, sondern um Entscheidungen geht.
»Sind sie alle auf dieser Seite des Stroms?«, fragte er.
Amy Hock nickte. »Ja.«
»Alle zusammen?«, fragte er weiter.
»Deswegen hat Gelfred bestimmt gesagt, dass jetzt die richtige Zeit ist.« Amy schüttelte den Kopf. »Es sind Tausende …«
Der Hauptmann sah wieder Tom an. »Aufbruch!«, sagte der Hauptmann.
Tom Schlimm grinste wie ein Verrückter. »Auf mein Zeichen hin!«, brüllte er.
Überall um ihn herum machten sich die Männer bereit. Jeder überprüfte etwas anderes an seiner Ausrüstung – hier einen Riemen, dort einen Helm oder den Dolch an der Hüfte.
Aber die Männer lächelten.
Angeregt sprachen sie miteinander.
Sie würden das tun, wozu sie ausgebildet waren. Sie würden sich wie der Blitz bewegen und wie ein Hammer auf dem Amboss zuschlagen. Glück stieg in ihnen auf, als wären sie Magier, die Worte der Macht mit den Hufen ihrer Pferde aussandten.
Sie ritten geradewegs auf den Hörnerschall zu. Tom zügelte sein Pferd, als er den ersten Kobold sah, und warf einen Blick zurück. Grendel und sein Reiter donnerten die Straße entlang und hielten bei ihm an.
Der Hauptmann warf ihm einen Gruß zu. Er hatte das Visier hochgeschoben.
»Da sind sie«, sagte Tom. Er konnte das Grinsen einfach nicht lassen.
Der Hauptmann lauschte und kratzte sich am Bart.
Wieder begegneten sich ihre Blicke.
»Ich bin noch nie einer Kreatur der Wildnis begegnet, die gleichzeitig in zwei Richtungen kämpfen kann«, sagte Tom. »Sie kämpfen auch gar nicht. Sie jagen. Und dann schlagen sie zu – mit allem, was ihnen zur Verfügung steht.«
»Du meinst, die Wildnis hat keine Reserve?«, fragte der Hauptmann.
»Genau«, antwortete Tom und sah, dass der Hauptmann dasselbe dachte wie er.
»Eines Tages werden sie eine haben«, bemerkte der Hauptmann.
»Aber nicht heute«, sagte Tom.
Der Hauptmann zögerte. Er atmete tief ein und lauschte abermals. Und wandte sich wieder Tom zu, mit breitem und wildem Grinsen.
»Dann sollten wir uns an die Arbeit machen«, sagte er und streckte seine Lanze aus. Carlus, der Trompeter, hob sein langes Bronzeinstrument, und der Hauptmann nickte ihm zu.
Tom machte sich nicht die Mühe, eine Formation zu bilden, denn das Wichtigste war die Überraschung. Er war sich sicher, dass er wusste, was da vor ihm geschah, und im Panzerschutz dieser Gewissheit führte er seine Männer an. Als sein Schlachtross über einen umgestürzten Baum hinwegsetzte, der Weg eine Biegung machte und er Hunderte von diesen kleinen Mistviechern sah, wie sie die Wagen plünderten, hob er nur sein Schwert.
»Lachlan für Aa!«, brüllte er und fing an zu töten.
Südöstlich von Lissen Carak · Der Rote Ritter
Es gehört viel Glück dazu, einen Feind zu erwischen, insbesondere einen siegreichen Feind, der zwar im Verhältnis von zwanzig zu eins überlegen ist, aber dermaßen vom Beuterausch befallen ist, dass er weder richtig kämpfen noch fliehen kann.
Und es ist ein noch größeres Glück, wenn dieser beutetrunkene Feind mit dem Rücken zu einem reißenden Fluss steht, durch den es nur eine einzige Furt gibt, die auch noch von einem verzweifelten Wahnsinnigen verteidigt wird.
Weil er das Kommando führte, und weil er eine Falle fürchtete, befand sich der Hauptmann unter den letzten Männern, die das Schlachtfeld betraten. Er führte ein halbes Dutzend Bogenschützen, zwei Soldaten sowie Jacques und die anderen Diener als Reserve mit sich. Noch immer war er voller Zweifel über seine Entscheidung, die allzu unbedacht und gleichzeitig zwingend zu sein schien, da er die bevorstehende Niederlage des Feindes spüren konnte.
Er folgte dem Hauptangriff und sicherte Tom Schlimm. Jacques befand sich weniger als zwanzig Pferdelängen hinter dem letzten Mann in der Schlacht, doch als er unter den großen Eichen hervorkam, war der Kampf bei den zurückgelassenen Wagen schon vorbei. Er ritt an dem vorbei, was vermutlich das letzte Aufgebot der Karawane gewesen war – ein Dutzend Gildenmänner, die mit dem Kopf nach unten auf dem Boden lagen. Einige waren bereits halb aufgefressen.
Er ritt an den Leichen von drei Dhags vorbei. Vor dem heutigen Tag hatte er nie mehr als einen gleichzeitig gesehen.
Er passierte die Reihe der Wagen, deren Zugtiere tot und im Joch geschlachtet worden waren. Vor anderen Wagen waren die Ochsen oder Pferde noch lebendig, aber in Panik. Viele menschliche Leichname lagen zwischen den toten Kobolden und anderen Wesen – eines sah aus wie ein goldener Bär, der sauber geköpft worden war.
Ungläubig schüttelte er den Kopf.
Er hätte es nicht planen können. Er hätte einen solchen Sieg nicht erreichen können, nicht einmal mit zwei Magiern und der doppelten Anzahl von Männern.
Weiter vorn wurde noch gekämpft. Er hörte Toms Schlachtrufe.
Er erreichte zwei Männer, die ein Dutzend aufgeregte Kriegspferde hielten, und Jacques sandte sogleich vier Diener aus, die die Zügel übernahmen. Die beiden Soldaten grinsten, zogen ihre Schwerter aus den Scheiden und rannten den Weg entlang auf den Kampflärm zu. Der Hauptmann atmete tief durch und dachte an die Männer und Frauen, die in seinen Diensten standen. Sie waren von der Art, die lächelnd in die Schlacht zog. Und er führte sie an. Sie machten ihn glücklich.
Er stieg ab, gab sein Pferd in Jacques’ Obhut, der ihm nun seinen Speer reichte. Und selbst absaß.
»Doch nicht ohne mich, Ihr Wahnsinniger«, sagte Jacques.
»Ich muss das tun«, wandte der Hauptmann ein. »Du nicht.«
Jacques spuckte aus. »Können wir das ein andermal klären?« Auf sein Zeichen erschien Toby, der in seiner Rüstung und dem Topfhelm irgendwie größer und vor allem gefährlicher aussah.
Sie rannten voran. Links von ihnen wurde gekämpft; der Aufprall von Stahl gegen Stahl war deutlich zu hören. Und vor ihnen gab es heftige Bewegungen, und lautes Grunzen ertönte, wie von einem großen Bär in einem Dickicht.
»Verdammt, er darf den Fluss nicht durchqueren!«, brüllte Tom, der sich inzwischen schon fast neben dem Hauptmann befand.
Der Hauptmann umrundete den gewaltigen Stamm einer alten Ulme, und da war das Untier – mit einer Schulterhöhe von fünfundzwanzig Handspannen und gebogenen Stoßzähnen.
Ein Behemoth.
Das Ungeheuer drehte sich um.
Wie jedes Geschöpf der Wildnis sah es den Hauptmann geradewegs an und brüllte herausfordernd.
»Da sind wir ja alle«, meinte Tom genießerisch. »Der Hauptmann ist hier. Jetzt kann der Tanz losgehen!«
Jacques trat neben den Hauptmann und stieß an seine Hüfte. »Darf ich?«, fragte er und schoss bereits einen Pfeil ab, der durch das Fell des Behemoth drang und bis zur Fiederung in seinem Körper verschwand. Sein Kriegsbogen war so lang und schwer wie der von Mutwill Mordling – die meisten Männer hätten ihn nicht einmal spannen können.
Jemand hinter dem Ungetüm rammte ihm ein Schwert tief in die Seite, und dann sägte ein Soldat an seinem Hals. Daraufhin brüllte es vor Wut auf. Nun setzte ein wahrer Pfeilschwarm ein, doch das Ungeheuer richtete sich wieder auf, schüttelte den Soldaten ab und senkte den Kopf.
»Mist«, entfuhr es Jacques.
Eine Feuerlanze überquerte den Fluss und traf den Behemoth mitten in den Kopf. Ein Stoßzahn zerbrach, und der Stumpf fing Feuer. Trotz der allgemein aufgekommenen Angst drehten sich alle Männer um und sahen zu. Die meisten von ihnen hatten noch nie zuvor den Einsatz eines Phantasmas in einer Schlacht beobachtet.
Der Hauptmann griff die Bestie an, denn das schien ihm besser zu sein, als von ihr angegriffen zu werden. Sein Pferd hatte bisher alle Arbeit verrichtet, und so waren seine Beine ausgeruht und stark; nicht einmal die schweren Beinschienen konnten ihn behindern.
Das Feuer war eine gute Ablenkung gewesen, und so rammte er dem Behemoth seinen schweren Speer mitten ins Gesicht und verfehlte das Auge nur knapp. Es knickte ein, und Jacques, der von dem Feuerwerk ebenfalls unbeeindruckt geblieben war, schoss Pfeil nach Pfeil in den ungeschützten Bauch.
Das Ungetüm drehte sich um und wirkte plötzlich weniger furchterregend, als es seine Niederlage und vielleicht auch den nahen Tod spürte. Es versuchte sich zu befreien und in den Fluss zu stürzen, doch es stolperte auf dem felsigen Boden. Ein Dutzend Bogenschützen – es waren sowohl Gildenmänner als auch Söldner – feuerte Pfeile auf die Kreatur ab, deren Blut bald im schnell fließenden Wasser wirbelte. Es riss sich zusammen und sprang. Seine Kraft war beeindruckend, und es zerstreute die Bogenschützen und tötete zwei Gildenmänner, indem es ihre Körper mit seinen gewaltigen Vorderpfoten zu blutigem Matsch zertrampelte. Als der Hauptmann zwischen den Bäumen hinter ihm hervorkam, hob es wieder den Kopf und drehte sich um. Mit seinen großen Augen sah es den Hauptmann an.
»Ich bin’s schon wieder«, sagte er.
Da stieß es ein Brüllen aus, unter dem der Wald erbebte. Einer von Toms Soldaten – Walter La Tour – schlug mit seiner Axt auf den Behemoth ein, wurde aber durch eine einzige Drehung des mächtigen Kopfes beiseite gewischt. Sein Brustpanzer wurde zerschmettert, und all seine Rippen brachen. Er fiel ohne den geringsten Laut zu Boden. Francis Atcourt, der noch am vorangegangenen Tag im Krankensaal gelegen hatte, hieb nun ebenfalls mit seiner Streitaxt zu und tänzelte zur Seite, als sie zerbrach und der brennende Stoßzahnstumpf nach seinem Leben trachtete. Er stolperte über einen verfaulenden Baumstamm, was ihm das Leben rettete, denn dadurch fuhren die Zähne des Ungeheuers knapp über ihn hinweg.
Der Hauptmann rannte dem Ungeheuer entgegen, das sich gerade Atcourt zugewandt hatte und ihm den Rest geben wollte. Es bemerkte den Hauptmann und zögerte nur einen Herzschlag lang.
Als Tom Schlimm sah, wie sein Hauptmann auf das Ungeheuer zuschoss, lachte er. »Ich liebe ihn«, rief er und sprang hinter ihm her.
Das Monstrum sprang ebenfalls, stolperte, und der Hauptmann stieß zu, erwischte das Maul und schnitt es auf. Blut spritzte. Der Stumpf des Stoßzahns erwischte ihn an seinem Armschutz und schleuderte ihn in den Fluss. Er ging unter, sein Helm füllte sich mit Wasser, doch er trieb mit dem Rücken über einen Felsen, konnte sich daran aufrichten und sprang wieder auf die Beine. Seine Bauchmuskeln schrien auf, als er sein ganzes Gewicht sowie das der Rüstung auf seine Hüften verlagerte. Doch dann stand er fest da, knietief im Wasser, und schlug mit seinem Schwert auf die Kreatur ein – zunächst von oben nach unten, dann in entgegengesetzter Richtung, und schließlich rammte er ihr die Klinge ins Auge. Die Bestie fiel.
Tom Schlimm hämmerte mit der Faust auf das Wesen ein, als es sich noch bewegte. »Ich nenne dich – Fleisch!«, schrie er.
Die Söldner lachten. Einige der Soldaten klatschten sogar Beifall, und die Gildenmänner begriffen allmählich, dass sie weiterleben würden. Und jubelten.
Ein letzter Pfeil flog in den Leichnam.
Nervöses Gelächter erhob sich, während der Jubel anschwoll.
»Der Rote Ritter! Der Rote Ritter! Der Rote Ritter!«
Der Hauptmann genoss es drei Atemzüge lang. Drei tiefe, die Lunge füllende Atemzüge lang genoss er es, lebendig und siegreich zu sein. Dann …
»Wir haben es noch nicht hinter uns«, fuhr der Hauptmann die anderen an.
Beim Klang seiner Stimme stand der junge Ritter, der die Verteidigung der Furt übernommen hatte, von der Stelle auf, an der er niedergekniet war, um zu beten – oder vielleicht auch in Erschöpfung niedergesunken war.
Sie sahen einander einen Augenblick zu lange an, wie sich nur Todfeinde oder Liebende ansehen.
Dann wandte sich der Hauptmann von ihm ab. »Holt die Pferde. Steigt auf. Und rettet so viele Wagen wie möglich. Beeilung! Bewegt euch! Tom, du kümmerst dich um die Wagen. Wer ist für sie zuständig? Ihr?« Er deutete auf einen der Männer aus der Kolonne.
Dann drehte er sich zu Jacques um. »Finde heraus, wer die Karawane befehligt, und zähl die Häupter. Der Ritter vor dir …«
»Ich weiß, wer er ist«, sagte Jacques.
»Er wirkt verwundet«, meinte der Hauptmann.
Der Ritter, über den sie gerade sprachen, kam taumelnd herbei. Sein rechtes Bein war klebrig von Blut.
»Ihr seid ein Bastard!«, sagte er und wollte mit seinem Schwert auf den Hauptmann eindreschen. Gerade als Jacques dies zu verhindern versuchte, brach er zusammen.
Tom lachte. »Jemand, der Euch kennt?«, fragte er, kicherte und machte sich wieder an die Arbeit. »In Ordnung, Leute! Bogenschützen, zu mir! Hört mir zu!«
Aber der Hauptmann, auch bekannt als Der Rote Ritter, stand neben dem Körper des zu Boden gegangenen jungen Ritters. Aus Gründen, die keiner von ihnen kannte – außer vielleicht Jacques –, war dies ein zutiefst befriedigender Augenblick. Ein großer Sieg. Und vielleicht auch eine persönliche Rache.
Er hatte Gawin Murien gerettet.
Und er hatte einen Behemoth getötet. Auch im Tod wirkte er nicht kleiner, wie es bei den Lindwürmern der Fall war. Er machte noch immer einen verdammt gewaltigen Eindruck.
Der Hauptmann legte den Kopf in den Nacken und lachte.
Tom sah ihm in die Augen.
»Manchmal ist dieses Leben das beste, was ich mir vorstellen kann«, gestand der Hauptmann.
»Deswegen lieben wir Euch«, erwiderte Tom.
Harndon · Desiderata
Lady Mary stand neben dem leeren Bett und sah zu, wie zwei Kammermädchen aus dem Süden die Federmatratze zusammenrollten.
»Das ist zu viel«, sagte Desiderata.
Diota lachte. »Meine Liebste, ohne ein Federbett werdet Ihr nicht gut liegen. Alle Ritter haben eines.«
»Die Archaiker schliefen auf dem Boden, eingerollt in einen Umhang.« Desiderata wirbelte herum und bewunderte den Fall ihres seitlich geschlitzten Unterkleides und die Art und Weise, wie sich auch die leiseste Brise darin verfing. Seide. Sie hatte auch zuvor schon Seide gesehen – seidene Strumpfbänder, Seide für Stickereien –, doch dies hier war wie etwas, das aus dem Äther stammte. Es war Magie.
»Ihr könnt es nicht ohne ein Oberkleid tragen«, sagte Diota. »Ich kann Eure Brüste sehen, Liebste.«
Lady Mary wandte sich ab und sah aus dem Fenster. Ich vermute, das ist es, was die Königin beabsichtigt hat, dachte sie. Sie wechselte einen Blick mit Becca Almspend, die von ihrem Buch aufsah und ihr ein schmallippiges Lächeln schenkte.
»Auf dem Boden unter einem Umhang zu schlafen klingt nicht schlimmer, als eine Magd in der königlichen Garnison zu sein«, sagte Becca und warf Lady Mary einen düsteren Blick zu. »In einem Militärlager stehlen die Freunde vielleicht nicht die eigenen Laken?«
Die Königin lächelte Lady Mary an. »Wirklich, Mary?«
Mary zuckte die Achseln. »Ich habe sieben Schwestern«, sagte sie. »Ich will niemandem das Laken stehlen. Es passiert einfach so.« In ihren Augen blitzte es.
Die Königin streckte sich, stellte sich wie eine Tänzerin auf die Zehenspitzen und hielt die Arme leicht ausgestreckt, als ob sie für ein Bildnis posierte. »Ich stelle mir vor, dass wir alle zusammen schlafen«, sagte sie.
Lady Almspend schüttelte den Kopf. »Heftet Euren Mantel an Euer Leibchen, das ist mein Rat, Mylady.«
Diota schnaubte verächtlich. »Unter einem Mantel kann sie nicht schlafen. In ihrem Zelt wird sie ein Federbett von der Größe eines Palastes haben.«
Die Königin zuckte mit den Schultern, und die Dienerinnen packten weiter ein.
Lady Almspend arbeitete die Liste des Tages ab. Die Vorbereitungen für den Tross des Königs – und den der Königin – hatten Lady Almspend zu einer deutlich wichtigeren Person gemacht.
»Kriegspferde für die Knappen von Mylady«, sagte sie.
Die Königin nickte. »Wie steht es damit?«
Lady Almspend zuckte die Achseln. »Ich habe den jungen Roger Calverley gebeten, sich darum zu kümmern. Er hat einen klaren Kopf und scheint mit Geld umgehen zu können. Aber er ist zurückgekehrt und hat berichtet, dass einfach keine Kriegspferde mehr zu bekommen sind. Für kein Geld der Welt.«
Die Königin stampfte mit dem Fuß auf. Es machte zwar keinen großen Lärm, da der Fuß klein war und in einem Tanzschuh steckte, doch die Dienerinnen erstarrten. »Das ist nicht hinnehmbar«, sagte sie.
Rebecca hob eine Braue. »Mylady, dafür gibt es militärische Gründe. Ich habe mich heute Morgen beim Frühstück in der Soldatenhalle umgehört.«
Diota hüstelte vor Zorn. Obwohl sie das oft tat, war es noch immer wirkungsvoll. »Ihr seid zum Frühstück in der Soldatenhalle gewesen? Ohne Begleitung?«
Lady Almspend seufzte. »Es wird wohl kaum eine Frau geben, die den Preis von Kriegspferden kennt, oder, Diota?« Sie rollte die Augen, wie es nur eine Frau von siebzehn Jahren versteht. »Ranald hat mich als Gast in die Halle mitgenommen. Und …« Sie hielt inne und räusperte sich ein wenig unbeholfen. »Und ich hatte eine Begleitung.«
»Wirklich?«, fragte Lady Mary. »Sir Ricar vermutlich?«
Lady Rebecca senkte den Blick. »Er war noch nicht aufgebrochen, und er wollte mir unbedingt helfen.«
Diota seufzte.
Die Königin sah sie an. »Und?«
Lady Almspend zuckte die Achseln. »Albia züchtet nicht genug Pferde für all seine Ritter«, erklärte sie. »Also importieren wir sie aus Gallyen, Morea und dem Kaiserreich.« Sie sah ihre Freundin trotzig an. »Das hat mir Ser Ricar erklärt.«
Die Königin sah ihre Schreiberin eindringlich an. »Grundgütiger Jesus und heilige Gottesmutter Maria. Weiß der König das?«
Lady Almspend zuckte noch einmal die Achseln. »Mylady, die letzte Woche hat gezeigt, dass die Männer auch ohne Hilfe der Frauen mit aller Wirksamkeit und sorgfältiger Planung Krieg zu führen imstande sind, so wie sie auch alles andere ohne uns tun.«
Diota gab ein höchst undamenhaftes Schnauben von sich.
Lady Mary lachte lauthals. »Bezieht sich das auch auf den Genuss von Bier?«, fragte sie.
Die Königin schüttelte den Kopf. »Wollt Ihr etwa damit sagen, dass wir nicht genügend Kriegspferde für unsere Ritter haben und dies niemanden stört?«
Lady Almspend zuckte wieder einmal die Achseln. »Ich würde nicht sagen, dass es niemanden stört. Eher nehme ich an, dass sich noch niemand Gedanken darüber gemacht hat.«
»Und was ist mit Ersatzpferden?«, wollte die Königin wissen. »Pferde sterben. Wie die Fliegen. Ich glaube, das habe ich einmal irgendwo gehört.«
Lady Almspend zuckte erneut mit den Schultern.
Lady Mary nickte. »Aber Becca, du musst doch einen Plan haben.« Ein wenig gehässig fügte sie hinzu: »Das hast du doch immer.«
Lady Almspend lächelte sie an; sie schien unempfindlich gegen ihren Spott zu sein. »Zufällig habe ich das, ja. Wenn wir tausend Florins zusammenbekommen, können wir eine ganze Herde moreanischer Pferde kaufen. Ihr Eigentümer lagert draußen vor dem Graben. Ich habe ihn heute Morgen getroffen und ein Gebot auf seinen gesamten Bestand abgegeben. Es handelt sich um einundzwanzig Schlachtrösser.«
Die Königin umarmte sie heftig.
Diota aber schüttelte den Kopf. »Wir haben doch kein Geld, Süßes.«
»Dann verkaufen wir halt meine Juwelen«, meinte die Königin.
Diota trat vor die kleinere Frau. »Seid doch nicht verrückt, Liebste. Diese Juwelen sind alles, was Ihr besitzt, falls der König sterben sollte. Ihr habt kein Kind. Wenn er nicht mehr da ist, wird Euch niemand haben wollen.«
Die Königin sah Diota fest an. »Diota, ich gestehe dir fast uneingeschränkte Freiheiten zu.«
Die ältere Frau zuckte leicht zusammen.
»Aber du redest und redest, und manchmal geht dein Mund mit dir durch«, fuhr die Königin fort, und Diota wich vor ihr zurück.
Die Königin breitete die Arme aus. »Du siehst es vollkommen falsch, Liebste. Wenn der König stirbt, wird mich jeder haben wollen.«
Die darauf folgende Stille wurde nur vom Bellen der Hunde draußen durchbrochen. Diota zitterte. Lady Mary tat so, als wäre sie irgendwo anders, und Becca las weiter.
Aber schließlich drückte Diota das Rückgrat durch. »Ich will nur sagen, dass sich der König um seine Kriegspferde selbst kümmern soll. Teilt den Knappen mit, wo man sie kaufen kann. Sollen sie doch ihre reichen Eltern um das Geld dafür bitten. Wenn Ihr Eure Juwelen verkauft, habt Ihr gar nichts mehr.«
Die Königin stand sehr still da. Dann schenkte sie ihrem alten Kindermädchen ihr unwiderstehliches Lächeln. »Ich bin, was ich bin«, sagte sie. »Verkauft die Juwelen.«