5
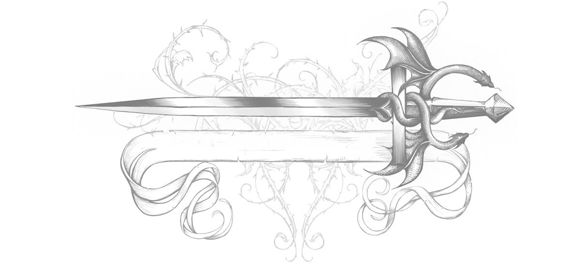
Der Palast von Harndon · Harmodius
Der Magus Harmodius saß in einer Turmstube, war ganz und gar von Büchern umgeben und beobachtete das Spiel der Sonnenstrahlen, die durch die hohen, klarverglasten Fenster einfielen, wenn sie auf die Staubflöckchen trafen. Es war April – der Monat des Regens, aber auch der ersten warmen Sonne, deren Licht endlich die ihr eigene Farbe und Kraft annahm. Heute war der Himmel blau, und der warme Fleck aus Sonnenschein auf dem Boden war genau das Richtige für eine Katze.
Harmodius hatte drei Katzen.
»Miltiades!«, zischte er, und eine alte, graue Katze sah ihn mit träger Unverschämtheit an.
Der mit Gold beschlagene Stock des Mannes fuhr vor und schob die Katze zur Seite, deren jüngster Schlafplatz die sorgsam gezogenen blassblauen Kreidelinien bedrohte, die sich über die dunklen Schieferplatten des Bodens zogen. Die Katze bewegte sich nur um eine Schwanzbreite weiter und schenkte dem Magus einen verächtlichen Blick.
»Vergiss nicht, dass ich dich füttere, du Biest«, murmelte Harmodius.
Das Licht fiel noch immer durch die hohen Fenster ein, kroch die gekalkte Wand hinunter und enthüllte Berechnungen in Kreide, Silber- oder Bleistift. Manche waren auch einfach nur in den Staub gekritzelt. Der Magus benutzte, was ihm gerade zur Hand war, wenn er den Drang zum Schreiben verspürte.
Das Licht kroch weiter die Wand hinunter.
Der Magus spürte in den Räumen unter ihm Männer und Frauen – ein Diener, der ein Tablett mit kaltem Wildbret zur Turmtür trug, ein Edelmann und eine Dame, die in einem wilden Stelldichein befangen waren, das wie ein kleines Feuer fast unmittelbar unter seinen Füßen brannte – wo genau?, es musste sehr öffentlich sein. Und dann war da die Königin, die wie die Sonne loderte. Er lächelte, als er über ihre Wärme fuhr. Oft beobachtete er die anderen, um sich die Zeit zu vertreiben. Es war die einzige Form des Phantasmas, das er regelmäßig auswarf.
Warum eigentlich?, fragte er sich müßig.
An diesem Morgen hatte ihn die Königin jedoch gebeten – ihn dringend aufgefordert –, etwas Besonderes zu tun.
Wirke einfach etwas Wunderbares, Magus!, hatte sie gesagt und in die Hände geklatscht.
Harmodius wartete, bis die Sonne über eine Kreidelinie hinweggeglitten war, die er gezeichnet hatte, und richtete dann den Blick auf einige Zahlen. Er nickte und nippte an seinem kalten Tee, auf dem sich bereits ein dünner Staubfilm gebildet hatte. Was war das für ein Staub? Ach ja, er hatte Knochen gemahlen, um Ölfarbe zu erhalten. Also hatte er nun Knochenstaub in seinem Tee. Das war zumindest nicht vollkommen widerlich.
Alle drei Katzen hoben die Köpfe und stellten die Ohren auf.
Das Licht wurde heller und fiel auf einen kleinen Spiegel mit dem Bild der Sternzeichen des Widders und des Stiers, die auf dem elfenbeinfarbenen Hintergrund ineinander gewunden waren – und schoss dann in einem gebündelten Strahl auf den Boden.
»Fiat Lux!«, brüllte der Magus.
Der Strahl wurde stärker, zog das ganze Licht in seiner Umgebung an, bis die Katzen im Schatten lagen, während der Strahl wie ein Blitz glitzerte. Er glitt über die Kreidezeichen, fiel durch eine Linse und schoss in die goldene Kugel, die auf seinem Stab steckte. Ohne dass er es bemerkte, traf sie ein wenig außerhalb des Mittelpunkts auf. Ein winziges Bruchstück des weißen Strahls rutschte an dem Stab ab, tanzte an der gegenüberliegenden Wand umher, wurde teilweise von der goldenen Kugel zurückgeworfen und zum anderen Teil von der Energie gebrochen, die in dem Stab brodelte. Das grelle Licht flackerte scharf auf, leckte über die Vergoldung eines Triptychons, das auf einem niedrigen Schrank stand, und traf ein Weinglas, das er vor vielen Stunden dort abgestellt hatte. Dann flog das noch immer fest gebündelte Licht über die Ostwand, brannte dabei ein Dutzend oder mehr Zeichen eines Zauberspruches aus, der mit unsichtbarer, geheimer Tinte geschrieben und unter der Wandfarbe verborgen war.
Die älteste Katze zuckte zusammen und stieß ein Zischen aus.
Der Magus fühlte sich plötzlich benommen, wie beim Einsetzen eines Fiebers oder einer starken Erkältung. Aber sein Verstand wurde ganz klar und scharf, und der Stab verströmte die unmissverständliche Aura eines Artefaktes, das sich mit Macht auflud. Er sah das bösartige Lichtfragment, bewegte rasch den Spiegel ein wenig, sodass der Brennpunkt genau auf seinem Stab lag.
Dann klatschte er triumphierend in die Hände.
Die Katzen sahen sich verwirrt um, als hätten sie diesen Raum nie zuvor gesehen – und schliefen wieder ein.
Harmodius ließ den Blick schweifen. »Was im Namen der Triade ist gerade geschehen?«, fragte er.
Er musste sich nicht ausruhen. Sogar nach dem Wirken eines so mächtigen Phantasmas war er ganz und gar von Vorfreude durchdrungen, denn er spürte den Helios in seinem Stab. Er hatte sich selbst versprochen, einen Tag zu warten … vielleicht auch zwei Tage … aber die Versuchung blieb stark.
»Pah«, sagte er laut, und die Katzenohren zuckten. So lebendig hatte er sich schon seit vielen Jahren nicht mehr gefühlt.
Er nahm einen schweren Wischlappen aus Flachs, scheuerte den Boden und entfernte jede Spur der verzwickten Kreidemuster, mit denen er ihn wie mit einem kostbaren Südländerteppich bedeckt hatte. Dann kniete er trotz seines Alters und seiner schweren Robe auf einem Stück weißen Leinens nieder und rieb auch die Spalten zwischen den Schieferplatten sauber, bis nirgendwo mehr eine Spur blassblauer Kreide zu sehen war. Darin war er sehr penibel; keine Spur des letzten Phantasmas sollte übrig bleiben, während er ein neues vollführte. Die Erfahrung hatte ihm diese Lektion gründlich erteilt.
Dann ging er zu einem Seitentisch und zog dessen Schublade auf, in der eine kleine Schachtel aus Ebenholz mit Silberbeschlägen lag. Der Magus liebte schöne Dinge. Da schlecht ausgeführte Beschwörungen in Seelenvernichtung und Tod enden konnten, half ihm die Gegenwart schöner Dinge, ihn zu beruhigen und zu stützen.
In der Schachtel lagen einige aus Bronze gefertigte Instrumente: ein Kompass, eine Schublehre, ein Lineal ohne Markierungen, ein Bleistift aus Silber, Lehm und Wachs mit einer Alaunspitze, der von einem Priester gesegnet war.
Er wickelte einen Faden um den Bleistift, maß die Länge an dem Lineal ab und betete: »O Hermes Trismegistus«, dann fuhr er auf Hocharchaisch fort, reinigte sich, säuberte seine Gedanken, rief Gott und seinen Sohn und den Propheten der Magie an, während ein anderer Teil seines Geistes die genaue Länge des Fadens errechnete, die er brauchen würde.
»Ich sollte das nicht heute tun«, sagte er zu der fettesten Katze. Ihr jedoch schien es eher gleich zu sein.
Er kniete sich wieder auf den Boden – nicht zum Gebet, sondern um zu zeichnen. Er steckte einen Holzsplitter in einen Spalt zwischen den Schieferplatten und benutzte den Faden, um den Bleistift mit zitternden Händen in einem vollkommenen Kreis zu führen. In diesen Kreis zeichnete er mithilfe des Lineals und eines Schwertes ein Pentagramm. Er schrieb eine Anrufung an Gott und eine an Hermes Trismegistus auf Hocharchaisch um die Außenseite, und nur das Jaulen der Katzen nach ihrem Mittagsmahl hielt ihn davon ab, das Werk an Ort und Stelle zu beenden.
»Ihr drei seid die beste Übung für den Umgang mit den Dämonen«, sagte er, während er sie mit frischem Lachs fütterte, der im Albin gefangen und auf dem Markt verkauft worden war.
Sie beachteten ihn nicht weiter, sondern fraßen gierig und rieben sich danach unter dem lauten Bekunden ewiger Liebe an ihm.
Er nutzte die Unterbrechung, öffnete die schwere Eichentür zur Turmstube und ging die hundertzweiundzwanzig Stufen zu seinem Wohnzimmer hinunter, wo Mastiff, der Diener der Königin, in einem Armlehnstuhl saß und las. Als der Magus erschien, sprang der Mann sofort auf die Beine.
Der Magus hob eine Braue, und der Mann verneigte sich. Aber Harmodius war in Eile – in der Eile der Leidenschaft – und ließ kleine Unhöflichkeiten zunächst auf sich beruhen. »Sei so freundlich und lauf zur Königin. Frag sie, ob sie mir die Gefälligkeit erweisen möchte, mich aufzusuchen«, bat er und gab dem Mann eine kleine Kupfermünze – dies war zwischen ihnen ein verabredetes Zeichen. »Und bitte meine Wäscherin, mir ebenfalls einen Besuch abzustatten.« Er gab dem Mann eine Handvoll Silbermünzen, von denen einige so klein wie Pailletten waren.
Mastiff nahm die Münzen entgegen und verneigte sich abermals. Er war an den Magus und seine Seltsamkeiten gewöhnt und eilte davon, als hinge sein Leben von diesem Auftrag ab.
Der Magus schenkte sich einen Becher Wein ein, trank ihn leer, starrte aus dem Fenster und versuchte sich davon zu überzeugen, dass er einen Tag Ruhe einlegen sollte. Wen würde das schon stören?
Aber er fühlte sich zehn Jahre jünger, und als er an das dachte, was er beweisen wollte, schüttelte er den Kopf, und seine Hand zitterte, während sie den Becher hielt.
Er hörte ihren leisen Schritt in dem Korridor, stand auf und verneigte sich tief, als sie eintrat.
»Himmel«, sagte sie; ihre Gegenwart füllte das Zimmer aus. »Ich hatte gerade zu Mary gesagt, wie langweilig mir doch ist!«, lachte sie, und ihr Lachen stieg zu den hohen Deckenbalken auf.
»Ich brauche Euch, Euer Gnaden«, sagte er und machte eine weitere tiefe Verneigung.
Die Wärme ihres Lächelns ließ ihn noch schwindliger werden. Hinterher konnte er nie sagen, ob auch die Lust einen Teil seiner Gefühle für sie ausmachte, die sehr stark, besitzergreifend, furchteinflößend und gefährlich waren.
»Ich habe beschlossen, eine Anrufung durchzuführen, Euer Gnaden, und sähe es gern, wenn Ihr mir dabei Gesellschaft leisten und meine Hand halten würdet. Ich hoffe inständig, dass es ganz wundervoll werden wird.« Er beugte sich über ihre Hand.
»Mein lieber alter Mann«, sagte sie und sah ihn zärtlich an. Er spürte einen Makel an ihren Worten – sie bemitleidete ihn. »Ich ehre deine Bemühungen, aber belaste dich nicht mit dem Versuch, mich zu beeindrucken!«
Er weigerte sich, verärgert zu sein. »Euer Gnaden, ich habe solche Anrufungen schon öfter durchgeführt. Sie sind immer mit Gefahren verbunden, und wie beim Schwimmen unternimmt nur ein Narr sie allein.« Vor seinem geistigen Auge stellte er sich vor, wie er zusammen mit ihr schwamm, und er musste schwer schlucken.
»Ich bezweifle, dass ich einen so mächtigen Fachmann wie dich unterstützen kann – ich, die nur die Strahlen der Sonne auf der Haut spürt, und du, der ihre Macht im innersten seiner Seele empfindet.« Aber sie ging zu der langen Treppe und führte ihn persönlich nach oben. Ihre Schritte fielen ein halbes Jahrhundert leichter auf die Stufen als die seinen. Dennoch atmete er nicht schwer, als sie das obere Ende der Treppe erreicht hatten.
Sie zog ihre roten Schuhe aus und betrat seine Stube vorsichtig mit nackten Füßen, wobei sie den deutlich sichtbaren Zeichen auf dem Boden auswich. Dann blieb sie stehen und betrachtete sie. »Meister, ich habe dich noch nie etwas so … Gewagtes tun sehen«, sagte sie, und diesmal wirkte ihre Bewunderung ungekünstelt.
Sie stellte sich in die Sonne, die nun nicht mehr die Westwand, sondern die Ostwand bedeckte. Die Königin stand so da, betrachtete die Gleichungen und die Gedichtzeilen und kraulte schließlich den fetten alten Kater an den Ohren.
Er schnurrte einen Augenblick lang, dann bohrte er ihr seine Fangzähne in den Handrücken, und als sie ihm daraufhin einen Schlag versetzte, miaute er.
Harmodius schüttelte den Kopf und goss Honig über die punktförmigen Wunden, die der Kater hinterlassen hatte. »Er hat noch nie gebissen«, sagte er.
Sie zuckte die Schultern, schenkte ihm ein schelmisches Grinsen und leckte den Honig ab.
Auch er zog sich nun die Schuhe aus.
Er begab sich zu der beschriebenen Wand, stellte sich dicht davor und las zwei Zeilen, die mit silbernem Stift geschrieben waren. Dann nahm er einen kleinen Stab aus Ebenholz in die Hand, schrieb die beiden Zeilen in die Luft und hinterließ Lettern aus hellem Feuer – dünner als die dünnste Luft und dennoch deutlich sichtbar für ihn und die Königin.
»Oh!«, meinte sie.
Er lächelte sie an. Ganz kurz spürte er sowohl die Versuchung, sie zu küssen, als auch das gleichstarke, aber entgegengesetzte Verlangen, diese Unternehmung sofort aufzugeben.
Sie erinnerte ihn an …
»Pah«, meinte er. »Seid Ihr bereit, Euer Gnaden?«
Sie lächelte und nickte.
»Kaleo se, CHARUN«, sagte der Magus, und das Licht über dem Pentagramm wurde blasser.
Die Königin machte einen Schritt nach rechts und stand nun mitten in dem Sonnenstrahl, der durch die hohen Fenster einfiel, während sich der alte Kater an ihrem nackten Bein rieb.
Schatten erfüllten das Pentagramm. Der Magus hielt seinen Stab hoch und deutete mit dem goldenen Ende wie mit einem Speer zwischen sich und das Zeichen auf dem Boden.
»Wer ruft mich?«, ertönte eine flüsternde Stimme aus einem Spalt in dem Licht, das wie ein Schmetterling über dem Pentagramm flatterte.
»KALEO«, sagte Harmodius nachdrücklich.
Charun manifestierte sich unter dem Schatten. Der Magus spürte, wie es in seinen Ohren knackte, und das Sonnenlicht schien blasser zu werden.
»Aah«, zischte er.
»Macht für Wissen«, sagte Harmodius.
Die Schatten zogen sich zu einer Kreatur zusammen, die wie ein Mensch aussah; allerdings war sie größer als das höchste Bücherregal, nackt, von sattem Weiß, das so blau geädert war wie alter Marmor. Sie hatte feste, lederige Flügel, die majestätisch in einem vollkommenen Bogen, den jeder Künstler bewundert hätte, von hoch über Harmodius’ Kopf bis auf den Boden reichten.
Der Geruch, den das Wesen mitgebracht hatte, war fremdartig – wie der Duft von verbrannter Seifenlauge. Es roch weder sauber noch faulig. Seine Augen waren vollkommen leer. Es trug ein Schwert, das so groß wie ein Mensch und mit schrecklichen Stacheln besetzt war, und sein Kopf drückte engelgleiche Schönheit und fremdartiges Grauen zugleich aus. Ein ebenholzschwarzer Schnabel war von Gold umrahmt, die rissigen, mandelförmigen Augen waren von endlos tiefem Blau, wirkten wie Zwillingssaphire, und den Kopf krönte ein Knochenkamm, dessen Haare wie die Verzierung an einem archaischen Helm wirkten.
»Macht für Wissen«, wiederholte Harmodius.
Die leeren Augen des Dämons richteten sich auf ihn. Wer konnte schon sagen, was ein solches Wesen gerade dachte? Sie sprachen nur selten, und oft verstanden sie nicht, worum der Magus sie bat.
Dann schoss das Schwert so schnell vor, wie ein Adler einen Hasen ergreift, und schnitt einen Kreis in den Boden hinein.
Harmodius kniff die Augen zusammen, aber er wäre niemals so alt geworden, wie er inzwischen war, wenn er zur Panik neigen würde. »Sol et scutum Dominus Deus«, sagte er.
Der zweite Schwertstreich durchstach den magischen Kreis, prallte aber von dem Schild ab, der sich nun über dem Dämon gebildet hatte. Die Kreatur betrachtete diesen Schild, der wie eine purpurrote, mit Weiß durchschossene Blase wirkte, und rammte ihr Schwert dagegen. Funken stoben an den Seiten des Schildes herunter, der wie eine Glocke aus leuchtender Farbe über dem Dämon hing. Rauch stieg vom Boden auf.
Harmodius klopfte mit seinem Stab dort gegen den Rand des Kreises, wo das Schwert seine Zeichen durchschnitten hatte. »Sol et scutum Dominus Deus!«, brüllte er.
Der Spalt im Kreis schloss sich, während die Kreatur sich aufbäumte und dabei zischte.
Die Königin beugte sich zu ihr hin, und Harmodius verspürte nun doch einen Schlag aus purem Entsetzen, weil er befürchtete, sie könnte unabsichtlich den Kreis überschreiten. Doch er konnte nichts zu ihr sagen. Hätte er es getan, dann hätte er die Energie, die er für die Beschwörung brauchte, vermindert. Sein ganzer Wille war auf die Kreatur gerichtet, die sich manifestiert hatte, sowie auf den Kreis, das Pentagramm und den Schild.
Er erkannte, dass er gerade mit zu vielen Bällen jonglierte.
Er dachte daran, den Schild aufzulösen – bis der Dämon plötzlich Feuer spuckte.
Es erblühte wie eine Blume, floss über die gesamte Oberfläche des Schildes, und nun wurde es im Raum sehr heiß. Das Feuer vermochte den Schild nicht zu durchdringen, aber die Hitze konnte dies, und damit hatte sie nun den Wettstreit des Willens völlig verändert. Harmodius musste die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er möglicherweise besiegt wurde, und diese Tatsache faszinierte ihn. Trotz des Schildes roch er die Kreatur so deutlich, wie er die Hitze spürte.
So plötzlich wie die Flammen erschienen waren, zogen sie sich von den Rändern des Schildes auch wieder zurück und krochen in das Maul der Kreatur. Die Hitze ließ spürbar nach.
Desiderata beugte sich vor, bis ihre Nase die nachgiebige Oberfläche des Schildes berührte. Und sie lachte.
Der Dämon wandte sich ihr zu, hielt den Kopf schräg und wirkte plötzlich wie ein Schoßtierchen. Und dann lachte er ebenfalls.
Sie machte einen Knicks und begann einen Tanz.
Der Dämon beobachtete sie hingerissen, und ebenso der Magus.
Sie drückte sich im Schwung ihrer Hüften und in den Bewegungen ihrer über den Kopf gereckten Hände aus und machte nur ein Dutzend Schritte – es war ein Frühlingstanz, naiv und von keiner großen Übung verdorben.
Das Geschöpf in der Machtblase schüttelte den Kopf. »Eyah!«
Es machte einen Schritt auf die Königin zu, und sein Haupt berührte den Rand des Pentagramms. Das Wesen schrie vor Wut auf, fuhr mit seinem Schwert über das Sigill und schnitt einen Spalt in den Schieferboden, der den Kreis unterbrach.
Die Königin streckte den Fuß aus, legte die Zehen über den Spalt, und sofort schloss er sich wieder.
Harmodius keuchte auf. Schnell wie ein Terrier, der es auf eine Ratte abgesehen hat, steckte er seinen Stab durch den Schild und lenkte die Macht, die er aus seinem Phantasma gesammelt hatte, auf den Dämon.
Dieser wirbelte von der Königin weg und stellte sich mit erhobenem Schwert vor den Magus – aber er unternahm nichts. Sein mächtiger Brustkorb hob und senkte sich. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen; er stieg in die Luft, erglühte weiß, wurde zu einem Engel mit Schwanenschwingen, fiel wieder auf den Steinboden, wand sich, wurde zu einem scheußlichen Tausendflüßler, der größer als ein Pferd war und sich in den Grenzen des Schildes zusammenrollte. Harmodius hob seinen Stab. Freude durchzuckte sein Herz – die reine Freude darüber, eine Theorie auf die Probe gestellt und darin mehr Gold als Schlacke gefunden zu haben.
Harmodius zog seinen Stab aus dem Kreis und zischte: »Ithi!«
Das Pentagramm war leer.
Harmodius war zu stolz, um zusammenzusacken. Er trat an die Seite der Königin und schlang die Arme mit einer Vertrautheit um sie, die für ihn selbst überraschend war.
Sie küsste ihn zärtlich.
»Du bist ein alter Narr«, sagte sie, »aber ein brillanter und tapferer alter Narr, Harmodius.« Ihr Lächeln war warm und anerkennend. »Ich hatte ja keine Vorstellung … ich habe noch nie gesehen, dass du so etwas getan hast.«
»Oh«, sagte er in den Duft ihres Nackens hinein – und eine ganze Galaxie neuen Wissens durchdrang ihn dabei. Aber er machte sich von ihr frei und verneigte sich. »Ich verdanke Euch mein Leben«, sagte er. »Was seid Ihr?«
Das Lachen, das sie nun von sich gab, schien allem Bösen zu spotten. »Was ich bin?«, meinte sie und schüttelte den Kopf. »Du lieber alter Narr.«
»Aber ich bin noch weise genug, um zu Euren Füßen zu dienen, Euer Gnaden.« Er verneigte sich besonders tief.
»Du bist wie ein Junge, der ein Hornissennest angreift, weil er sehen will, was dann wohl geschieht. Doch ich rieche den Triumph des kleinen Jungen an dir, Harmodius. Was haben wir heute gelernt?« Sie setzte sich plötzlich in einen Sessel, ohne vorher die Schriftrollen daraus zu entfernen. »Und woher kam dieser plötzliche Ausbruch von Wagemut? Deine Vorsicht ist doch bei Hofe geradezu sprichwörtlich.« Sie lächelte, und einen Augenblick lang war sie nicht mehr das naive junge Mädchen, sondern eine alte und sehr weise Königin. »Einige behaupten, du habest überhaupt keine Macht, sondern seiest nichts anderes als ein königlicher Scharlatan.« Ihr Blick glitt zu dem Pentagramm. »Anscheinend haben diese Personen unrecht.«
Auf ihre knappe Handbewegung hin eilte er los und schenkte ihr Wein ein. »Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was wir heute gelernt haben«, sagte er behutsam. Schon kehrte seine vorsichtige Art zurück. Aber er wusste, dass er recht hatte.
»Rede mit mir, als wäre ich eine Schülerin – eine dumme Schülerin, die sich die Grundzüge der Hermetik aneignen möchte«, sagte sie und trank seinen Wein. Ihre zufriedene Miene und die Art, wie sie den Kopf in den Nacken warf, verrieten ihm, dass auch sie einen Augenblick des Grauens verspürt hatte. Sie war eine Sterbliche. Manchmal vergaß er das. »Weil ich die Macht benutzen kann, nimmst du wahrscheinlich an, dass ich auch ihre Funktionsweise kenne. Dass wir denselben Wissensstand haben. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Sonne bestrahlt mich, und ich spüre die Berührung Gottes, und manchmal kann ich mit seiner Hilfe Wunder wirken.« Sie lächelte.
Er dachte, dass ihre Selbstsicherheit, wenn sie nicht im Zaum gehalten wurde, sie schrecklicher als jedes Ungeheuer machen konnte.
»Nun gut, Euer Gnaden. Ihr wisst, dass es zwei Schulen der Macht gibt – zwei Quellen für das Wirken der Phantasmata.« Er legte seinen Stab vorsichtig in die Ecke, kniete dann nieder und wischte das Pentagramm vom Boden.
»Weiß und schwarz«, sagte sie.
Er sah sie finster an.
Lächelnd zuckte sie die Achseln. »Du bist so schlicht, mein Magus. Es gibt die Macht der Sonne, rein wie das Licht, uneingeschränkt, ungebunden – das Zeichen der Freude Gottes an aller Schöpfung. Und es gibt die Macht der Wildnis, für die den Kreaturen, die sie besitzen, ein Ausgleich gegeben werden muss, und jeder Pakt wird mit Blut besiegelt.«
Harmodius rollte mit den Augen. »Besiegelt! Pakt! Nein, Blut spielt dabei eigentlich keine Rolle.« Er nickte. »Aber dort ist die Macht. Sie steigt vom Boden auf, vom Gras, von den Bäumen und den Geschöpfen, die zwischen diesen Bäumen leben.«
Sie lächelte. »Ja. Ich kann sie fühlen, auch wenn sie mir nicht freundlich gesinnt ist.«
»Wirklich?«, fragte er und schalt sich sogleich einen Narren. Warum hatte er die Königin nicht früher danach gefragt? Ein ungefährlicheres Experiment kam ihm in den Sinn. Aber was vorbei war, war vorbei. »Ihr spürt die Macht der Wildnis?«
»Ja«, sagte sie, »manchmal stärker und manchmal schwächer – sogar in diesen armen toten Wesen, die unsere Halle schmücken.«
Er schüttelte den Kopf über seine eigene Dummheit – über seine Anmaßung.
»Spürt Ihr die Macht der Wildnis auch in diesem Raum?«, fragte er.
Sie nickte. »Die grüne Lampe ist ein Gegenstand aus der Wildnis, nicht wahr? Es ist eine Elfenlampe.«
Er nickte. »Könnt Ihr von der Macht, die aus solchen Dingen strömt, etwas nehmen und sie benutzen, Euer Gnaden?«
Sie erschauerte. »Warum stellst du eine solche Frage? Jetzt muss ich dich doch als geistlos betrachten, Magus.«
Ha, dachte er. Ich bin doch nicht annähernd so anmaßend wie sie.
»Aber ich habe einen mächtigen Dämon des Abgrunds heraufbeschworen, oder?«, fragte er.
Sie lächelte. »Vielleicht nicht aus dem tiefsten Abgrund, aber du hast recht, ja.«
»Würdet Ihr nicht sagen, dass er im Pakt mit der Wildnis steht?«, fragte er.
»Gott ist die Sonne und die Macht der Sonne – und Satan wohnt in der Macht der Wildnis.« Sie leierte diese Worte herunter wie ein Schulmädchen. »Die Dämonen benutzen die Macht der Wildnis. Als Satan sich von Gott lossagte und seine Legionen in die Hölle führte, wurde die Magie in zwei Mächte zerbrochen, die Grüne und die Goldene. Gold steht für die Diener Gottes. Grün steht für die Diener Satans.«
Er nickte und seufzte. »Ja«, sagte er. »Aber es ist natürlich in Wirklichkeit noch wesentlich komplizierter.«
»O nein«, erwiderte sie und zeigte damit wieder ihre eisige Selbstsicherheit. »Ich glaube, die Menschen neigen lediglich oft dazu, die Dinge unnötig zu verkomplizieren. Die Nonnen haben mir das beigebracht. Willst du etwa behaupten, dass sie mich angelogen haben?«
»Ich habe soeben einen Dämon mit der Macht der Sonne gefüttert. Ich habe ihn durch die Macht der Sonne beschworen.« Harmodius lachte auf.
»Nein, du hast ihn damit gebannt.« Ihr silbernes Lachen ertönte. »Du willst mich necken, Magus!«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn gebannt, nachdem ich ihm so viel Macht gegeben hatte, dass er wachsen konnte«, sagte der Magus. »Reines Helios, das ich durch die Hilfe meiner Instrumente zusammengezogen habe, denn ich besitze doch nicht die besonderen Fähigkeiten Euer Gnaden.« Was immer diese auch sein mögen.
Sie sah ihn gleichmütig an. In ihrem Blick lagen weder List noch Tändelei, weder Spott noch feiner Magnetismus, und nicht einmal ihre übliche Belustigung.
»Und was bedeutet das?«, wollte sie mit einem Flüstern wissen.
»Fragt mich das noch einmal, Euer Gnaden, wenn ich ihn in einer Woche erneut beschwöre. Sagt mir, dass Ihr an jenem Tag wieder neben mir stehen werdet. Ich bin Euch verpflichtet, aber mit Euch …«
»Was willst du erreichen, Magus? Bleibt das noch im Bereich dessen, was die Kirche billigt?« Sie sprach langsam und bedächtig.
Er zog die Luft ein. Und stieß sie wieder aus. Die Kirche kann mich mal, dachte er und sagte laut: »Ja, Euer Gnaden.« Nein, Euer Gnaden. Vielleicht nicht. Aber die Kirchenmänner sind keine Wissenschaftler. Sie sind nur daran interessiert, den gegenwärtigen Zustand aufrechtzuerhalten.
Die Königin schenkte ihm ein wunderbares Lächeln. »Ich bin bloß ein junges Mädchen«, sagte sie. »Sollten wir nicht besser einen Bischof fragen?«
Harmodius kniff die Augen zusammen. »Natürlich, Euer Majestät«, sagte er.
Die Nordstraße · Gerald Random
Randoms Karawane bewegte sich schnell – im Vergleich mit anderen Karawanen. Sie legte etwa sechs bis zehn Meilen am Tag zurück, hielt jeden Abend am Rande einer Stadt an und lagerte auf vorbereiteten Feldern, zu denen Futter für die Tiere sowie warmes Brot und frisch zubereitetes Fleisch gebracht wurden. Die Leute waren glücklich, für ihn arbeiten zu dürfen, denn er plante stets sorgfältig, und die Verpflegung war gut.
Aber sie hatten noch hundert Meilen bis Albinkirk vor sich und danach noch mindestens vierzig Meilen nach Osten zum Jahrmarkt, und er war später dran, als ihm lieb war. Die Albinblumen – kleine gelbe Bälle aus süßlich duftenden, flauschigen Blütenblättern, die nur an den Uferfelsen des großen Flusses wuchsen – blühten auf den Wiesen entlang der Straße. Auf Randoms Lieblingsabschnitt der Reise führte die Straße an einer Klippe entlang, hinter der der Albin durch ein sechzig Fuß tiefes Tal floss. Die Albinblumen wirkten wie gelbe Streifen unter ihm und auf den gegenüberliegenden, etwa eine Meile entfernten Felsen. Es war schon viele Jahre her, seit er zum letzten Mal so spät aufgebrochen war, dass er die Albinblumen blühen gesehen hatte. Im Norden wuchsen sie nicht.
Nach drei angenehmen Reisetagen kamen sie in Lorica und bei der Herberge Zu den zwei Löwen an. Doch sein üblicher Rastpunkt und Lieferant von Brot und Viehfutter war nur noch eine rauchende Ruine. Es kostete ihn einen ganzen Tag, einen neuen Lieferanten zu finden und alles zu bekommen, was er brauchte. Dabei hörte er die Geschichte über das Niederbrennen der Herberge und den Schulzen, der von erbosten Ausländern zusammengeschlagen worden war. Doch der Herbergswirt hatte einen Boten zum König geschickt und stand mit verbundenem Kopf im Innenhof. Dort sah er den Arbeitern zu, die die verkohlten Deckenbalken mit einem Kran aus den Trümmern holten.
Überdies hatte er einen seiner kostbaren Söldner mit einer Nachricht über die Morde zum Gildenmeister in Harndon geschickt. Die Bewohner dieser Stadt gaben sich eigentlich nicht mit den Angelegenheiten der unbedeutenderen Ortschaften ab, doch hier ging es um das Geschäft, um Freundschaft und Vaterlandsliebe zugleich.
Am folgenden Tag brachen die Speichen von gleich zwei Wagen. Der Schaden an dem einen Wagen war so groß, dass sogar der eiserne Laufring vom Rad gesprungen war. Das bedeutete, dass sie einen Schmied und einen Stellmacher finden mussten. So war Random gezwungen, nach Lorica zurückzukehren, wo er in einer schäbigen Herberge warten musste, während der Rest seiner Karawane ohne ihn weiter nach Norden rollte. Er hatte diese Angelegenheit selbst zu erledigen, denn die Leute aus Lorica kannten nur ihn, nicht aber seine Mitreisenden – nicht einmal den Tuchhändler Judson oder einen anderen seiner Geldgeber.
Am Morgen waren die beiden Wagen wieder fahrbereit, und widerstrebend bezahlte er den vereinbarten Lohn für die Arbeit eines Stellmachergesellen und zweier Lehrlinge, die die Nacht hindurch gearbeitet hatten. Zusätzlich gab er dem Schmied einen Silberleopard, damit der vor der Frühmesse die Wagenräder wieder aufzog.
Er trank den Rest seines Dünnbiers und bestieg sein Pferd. Der kleine Zug befand sich bereits wieder auf der Straße, nachdem er die Eucharistie von einem Klosterbruder entgegengenommen hatte, der in einer Kapelle an der Straße die Messe gelesen hatte. Diese Messe war von vielen verwilderten Männern und Frauen besucht gewesen – von Taugenichtsen, zwei Vagabunden und einer Truppe von fahrenden Schauspielern. Random wurde von den Armen nie belästigt. Immer gab er ihnen Almosen.
Doch die verwilderten Männer machten ihm Sorgen – sowohl wegen seiner Karawane als auch wegen seiner Geldbörse. Er war noch nie von Männern ausgeraubt worden, mit denen er kurz vorher die Messe besucht hatte, aber er wollte auch kein Risiko eingehen. Er saß auf, wechselte einige bedeutungsschwere Blicke mit den Fahrern, und die Wagen setzten sich in Bewegung.
Einer der Gesetzlosen folgte ihnen auf der Straße. Er hatte ein gutes Pferd und eine Rüstung in einem Weidenkorb, doch er schien kein Interesse an ihnen zu haben. Von Zeit zu Zeit warf Random einen Blick zurück auf ihn.
Schließlich hatte der Mann sie eingeholt. Aber er hatte seine Rüstung nicht angelegt und schien die Karawane nicht einmal wahrzunehmen. Er ritt herbei und überholte sie langsam.
Die Harndoner nannten all jene, mit denen sie zuvor zusammen in der Messe gewesen waren, Bruder oder Schwester, und so nickte Random dem Fremden zu.
»Der Friede Gottes sei mit Euch, Bruder«, sagte er ein wenig zu eindringlich.
Der Mann wirkte überrascht, weil er angesprochen worden war.
In diesem Augenblick erkannte Random, dass es sich keineswegs um einen Gesetzlosen handelte, sondern um einen ziemlich verdreckten Edelmann. Die Unterschiede waren an seiner Kleidung deutlich zu erkennen. Der Mann trug einen großartigen, mit Leder bedeckten Waffenrock, der mindestens zwanzig Leoparden wert war, auch wenn er völlig mit Dreck übersät war. An seinen Stiefeln steckten goldene Sporen. Selbst wenn sie nur aus Silber gewesen wären, hätte doch eine jede einen Wert von etwa hundert Leoparden dargestellt.
Der Mann seufzte. »Mit Euch auch, Messire.«
Er ritt weiter.
Random war in der halsabschneiderischen Welt der Schiffer und Gilden von Harndon nur deshalb zu einigem Reichtum gelangt, weil er bereit war, Fortuna bei den Haaren zu packen, wenn sie sich zeigte. »Ihr seid ein Ritter«, sagte er.
Der Mann zügelte sein Pferd nicht, sondern drehte nur den Kopf. Als das Pferd aber die Gewichtsverlagerung spürte, blieb es von selbst stehen.
Der Mann wandte sich ganz um und sah ihn an. Die Stille war geradezu schmerzhaft.
Wen haben wir denn hier?, fragte sich Random.
Schließlich nickte der Mann, der auf den zweiten Blick eine ganze Generation jünger als Random zu sein schien.
»Ich bin ein Ritter«, sagte der junge Mann, als würde er eine Sünde beichten.
»Ich brauche Männer«, sagte Random. »Ich habe eine Karawane auf der Straße, und da Ihr Sporen aus Gold tragt, wäre es mir eine große Ehre, Eure Hilfe zu erlangen. Meine Karawane besteht aus fünfzig guten Wagen, die nach Norden zum Jahrmarkt unterwegs sind. In meinem Angebot liegt nichts Unehrenhaftes. Ich fürchte nur Banditen und die Wildnis.«
Der Mann schüttelte ganz kurz den Kopf, wandte sich ab, und sein Pferd trottete weiter voran. Es war ein gutes Kriegspferd, das aber mit dem Mann und seiner Rüstung überlastet war, denn das Gewicht war schlecht verteilt und für die Haltung des Tieres schädlich.
»Seid Ihr sicher?«, fragte Random. Ein zweiter Versuch schadete nie.
Der Ritter hielt nicht an.
Random ließ seine Fahrer für ein Mittagsmahl anhalten, und danach reisten sie bis in den Abend und die einsetzende Dunkelheit hinein weiter.
Am Morgen befanden sie sich bereits wieder auf der Straße, als die Sonne erst einen Fingerbreit über dem Fluss stand, der sich wie eine Schlange nach Osten wand. Später am Morgen stiegen sie in das Tal hinunter zur Großen Brücke, die den Rand der Inneren Gaue bezeichnete. In der Kauernden Katze erhielt er zusammen mit seinen Fahrern ein gutes Mahl. Die Männer fühlten sich geehrt, dass er zusammen mit ihnen speiste und sie so gut verköstigte.
Nach dem Mittagessen machten sie sich an die Überquerung der Großen Brücke, deren sechsundzwanzig Brückenbögen von den Archaikern errichtet worden waren und unter großen Mühen in bestem Zustand gehalten wurden. Danach stiegen sie für eine Stunde das andere Ufer hinauf, wobei die Fahrer die Pferde zu Fuß an den Zügeln führten. Sie erklommen die höchste Stelle, und Random sah den Ritter erneut, der vor einer Kapelle an der Straßenseite kniete. Tränen schnitten tiefe Rinnen in den Staub, der auf seinem Gesicht lag.
Random nickte ihm zu und fuhr weiter.
Am Abend hatte er den Rest seiner Karawane eingeholt, die schon das Lager aufgeschlagen hatte, und er wurde von seinen vorausgeschickten Männern herzlich willkommen geheißen. Seine Fahrer unterhielten ihre Gefährten mit allen Ereignissen des Tages, und Guilbert salutierte vor ihm und berichtete, wie es der Karawane ergangen war, während sich Judson darüber ärgerte, dass er so schnell schon wieder da war.
Alles war wie gewohnt.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kam einer der Goldschmiedejungen zu seinem Wagen und salutierte wie ein Soldat. »Messire?«, fragte er. »Da fragt ein Ritter nach Euch.« Der Junge hatte sich eine Armbrust auf die Schulter gelegt und war offensichtlich mächtig stolz, zum einen weil er Wache schob, zum anderen weil er in dieser Karawane mitreiste und auch, weil er jetzt die so ungeheuer wichtige Rolle eines Boten übernommen hatte. Henry Lastifer. Der Name stieg aus dem Gedächtnis des Kaufmanns an die Oberfläche.
Random folgte dem Jungen zum Feuer. Guilbert war dort, und auch der alte Bob, noch einer von seinen Soldaten.
Und der junge Ritter von der Straße. Er saß da und trank Wein. Rasch erhob er sich.
»Darf ich meine Meinung vielleicht noch ändern?«, platzte es aus ihm heraus.
Random lächelte. »Selbstverständlich. Willkommen an Bord, Ser Ritter.«
Guilbert grinste breit. »Mylord wäre passender. Aber er trägt das Zeichen des Königs. Und er hat ein gutes Schwert.« Er wandte sich an den Ritter. »Euer Name, Mylord?«
Der junge Mann zögerte so lange, dass offensichtlich war, er werde lügen. »Ser Tristan?«, sagte er wehmütig.
»Also gut«, meinte Guilbert. »Kommt mit mir. Ich werde Euch einen Schlafplatz für die Nacht suchen.«
»Vergesst nicht, dass Ihr zunächst für Guilbert und erst in zweiter Linie für mich arbeitet«, sagte Random. »Verstanden?«
»Natürlich«, antwortete der junge Mann.
Was tue ich da?, dachte Random. Aber er war zufrieden mit dem Mann, wer immer er sein mochte. Die Ritter des Königs waren sehr gut ausgebildet und sicherlich zum Kampf gegen die Wildnis in der Lage. Selbst wenn der junge Mann ein wenig verwirrt sein sollte … nun, zweifellos war er verliebt. Diese Edelmänner waren geradezu vernarrt in die Liebe.
Er schlief gut.
Nördlich von Lorica · Bill Redmede
Bill Redmede führte seine unausgebildeten jungen Männer den Pfad hoch. Der Irk lag weit vor ihnen und bewegte sich wie Rauch zwischen den mächtigen Baumstämmen umher. Er neigte dazu, aus völlig unerwarteten Richtungen zu der Kolonne zurückzukehren; sogar für einen alten Waldläufer wie Bill waren seine Handlungen unvorhersehbar.
Und die Jungen hatten Angst vor diesem Geschöpf.
Bill mochte diese stille Kreatur, die nur dann etwas sagte, wenn sie auch etwas zu sagen hatte. An Irks war etwas Besonderes. Es fiel schwer, es genau festzumachen, aber sie waren irgendwie vornehm.
»Die rechte Flanke beobachtet die rechte Seite des Weges«, sagte Bill, ohne über seine Worte nachzudenken. »Die linke Flanke hält die linke Seite unter Beobachtung.« Sie befanden sich erst seit drei Tagen auf dem Weg, und schon bemutterte er sie.
»Ich brauche eine Pause«, jammerte der Größte und Stärkste von ihnen. »Christus am Kreuz, Bill! Wir sind doch keine Kobolde!«
»Wenn du einer wärest, würdest du dich schneller bewegen«, entgegnete Redmede. »Seid ihr Jungen etwa keine Hofarbeit gewöhnt?«
Es wurde noch schlimmer, als sie ihr Lager aufschlugen. Er musste ihnen erklären, wie man einen Unterschlupf errichtete. Er hatte sie davon abzuhalten, die Halteschnüre durchzuschneiden, und er wollte ihnen beibringen, wie man Feuer macht – ein kleines Feuer. Wie man sich wärmt, wie man sich trocknet. Und wo man sein Wasser abschlägt.
Zwei von ihnen sangen bei der Arbeit, bis er zu ihnen hinüberging und den einen mit einem Faustschlag zu Boden schickte.
»Wenn dich der König erwischt, weil du gesungen hast, wirst du am Galgen hängen, bis dir die Krähen das Fleisch von den Knochen picken und der verdammte Zauberer des Königs deine Knochen zermahlt, um daraus Farben zu machen«, sagte Bill.
Die wütende Stille junger Männer, die sich ungerecht behandelt fühlten, schlug ihm von allen Seiten entgegen.
»Wenn ihr versagt, werdet ihr sterben«, fuhr er fort. »Das hier ist kein Sommerspaß.«
»Ich will nach Hause«, jammerte der Große. »Du bist ja schlimmer als ein Edelkerl.« Er blickte sich um. »Und du kannst nicht uns alle aufhalten.«
Der Irk materialisierte sich in den Dämmerschatten und sah den Großen neugierig an. Dann wandte er sich an Bill. »Komm«, sagte er mit seiner seltsamen Stimme.
Bill nickte den anderen zu; ihr Streit war unwichtig geworden. »Geht nirgendwohin«, sagte er und folgte dann dem Irk.
Sie durchquerten ein Moorgebiet, kletterten über einen niedrigen Hügelgrat und gingen auf der anderen Seite hinunter und begaben sich in ein dichtes Fichtenwäldchen.
Der Irk drehte sich um und machte eine knappe Kopfbewegung. »Bär«, sagte er. »Ein Freund. Sei freundlich, Mensch.«
In der Mitte des Wäldchens befand sich ein großer goldener Bär. Er lag mit dem Kopf auf den Tatzen da, als wolle er sich ausruhen. Ein wunderschönes Junges stand daneben und leckte ihm über das Gesicht.
Als Bill näher kam, regte sich der Bär. Er hob den Kopf und gab ein zischendes Geräusch von sich.
Bill trat zurück, aber der Irk hielt ihn fest und sagte etwas mit einem zischenden Flüstern.
Der Bär rollte ein wenig zur Seite, und Bill erkannte, dass er eine tiefe Wunde in der Flanke hatte, die voller Eiter war. Außerdem klebte getrockneter Eiter an den Wundrändern. Es stank erbärmlich.
Der Irk hockte sich auf eine Weise nieder, wie es einem Menschen niemals möglich gewesen wäre. Er ließ die Ohren hängen, was Trauer ausdrückte. So etwas hatte Bill noch nie bei einem Irk beobachtet.
»Der Bär stirbt«, sagte der Irk.
Bill wusste, dass er recht hatte.
»Der Bär fragt: Können wir sein Kleines retten?« Der Irk drehte sich um, und Bill erkannte erst jetzt, wie selten diese Elfenkreatur ihn ansah. Als sich ihre Blicke trafen, verspürte er den Respekt des Waldmannes für dieses Geschöpf. Seine Augen waren groß und tief wie bodenlose Teiche …
»Ich kenne mich nicht mit Bären aus«, sagte Bill und hockte sich neben das große Muttertier. »Aber ich bin der Freund einer jeden Kreatur der Wildnis und gebe dir mein Wort, dass ich versuchen werde, dein Junges zu anderen goldenen Bären zu bringen.«
Der Bär spuckte in offensichtlichem Schmerz.
Der Irk sprach – oder eher: Er sang. Es wurde zu einer ganzen Strophe voller fließender Reime.
Der Bär hustete.
Der Irk drehte sich um. »Das Junge – seine Mutter hat es nach der gelben Blume benannt.«
»Gänseblume?«
Der Irk zog eine Grimasse.
»Osterglocke? Krokus? Ich kenne nicht viele Blumennamen.«
»Im Wasser.« Der Irk wurde ungeduldig.
»Lilie?«
Nun nickte er.
Bill streckte die Hand nach dem Jungen aus, da biss es ihn.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann war so müde und von seiner Angst erschöpft, dass er nur noch mühsam den einen Fuß vor den anderen setzen konnte, während der Trampelpfad zu einem Weg und dieser schließlich zu einer Straße wurde.
Nichts anderes machte ihm Sorgen als die herannahende Dunkelheit, die Erschöpfung und die Kälte. Es war spät am Tag, und es wurde immer deutlicher, dass sie im Wald ihr Lager aufschlagen mussten. Im selben Wald, aus dem ein Dämon und ein Lindwurm gekommen waren.
»Warum hat uns das Wesen nicht umgebracht?«, fragte der Hauptmann. Zwei Dämonen.
Gelfred schüttelte den Kopf. »Ihr habt den ersten getötet. Und zwar verdammt schnell.« Seine Augen waren immer in Bewegung. Inzwischen hatten die beiden die große Straße erreicht, und Gelfred zog an den Zügeln seines Pferdes. »Wir könnten beide auf ihm reiten«, schlug er vor.
»Damit würdest du das arme Tier lahm machen«, fuhr ihn der Hauptmann an.
»Ihr habt einen Zauberspruch benutzt.« Gelfred klang nicht anklagend, sondern eher so, als würde es ihm wehtun.
»Ja«, gab der Hauptmann zu. »So etwas tue ich von Zeit zu Zeit.«
Gelfred schüttelte den Kopf. Er betete laut, und sie zogen weiter, bis ein leichter Regen einsetzte und das Licht verdämmerte.
»Wir müssen Wache stehen«, sagte der Hauptmann. »Wir sind sehr verwundbar.« Er konnte kaum mehr klar denken. Während Gelfred das arme Reittier striegelte, sammelte er Brennholz und entzündete ein Feuer. Er machte alles falsch. Er hatte zu großes Holz gesammelt und keine Axt, um es kleinzuhacken. Also sammelte er Anzündholz, brach es entzwei und schichtete es zu einem kleinen Haufen auf. Er kniete sich vor die flache Feuergrube, benutzte seinen Stahl und Flintstein und schlug Funken, bis er ein glühendes Stück Holz hatte.
Dann erkannte er, dass er das Holz nicht richtig aufgeschichtet hatte, sodass die Glut es nicht fangen konnte.
Er musste wieder von vorn anfangen.
Wir sind zwei Narren.
Er konnte spüren, dass die Wälder voller Feinde waren. Oder voller Verbündeter. Es war der Fluch seiner Jugend.
Wohinein bin ich da eigentlich gestolpert?, fragte er sich.
Er machte ein kleines Vogelnest aus trockenem Werg und Birkenrinden, schlug erneut Funken, hielt den Stahl mit der rechten Hand und den Flintstein in der linken. Und entzündete ein Holz …
Ließ es zwischen das Werg und die Borken fallen …
Und blies.
Das Feuer loderte auf.
Er warf Zweige in die Flammen, bis sie stark genug waren, und umrahmte sie mit trockenem Holz, das er sorgfältig mit seinem Jagdmesser gespalten hatte. Er war sehr stolz auf sein Feuer, als es endlich brannte. Wenigstens das hatte er erreicht, falls die Wildnis ihn hier und jetzt zu sich holen sollte.
Gelfred kam herbei und wärmte sich die Hände. Dann spannte er seine Armbrust. »Schlaft, Hauptmann«, sagte er. »Ich halte die erste Wache.«
Der Hauptmann wollte eigentlich reden – er wollte nachdenken, aber sein Körper stellte eigene Forderungen.
Doch bevor er einschlafen konnte, hörte er plötzlich Gelfreds Bewegungen, und sofort sprang er mit dem Schwert in der Hand unter seinem Laken hervor.
Gelfreds Augen waren im Feuerschein so groß. »Ich wollte nur den Kopf anderswo hinlegen«, sagte er. »Es … es ist schwer, ihn hier in der Nähe zu haben. Und das Pferd hasst ihn.«
Der Hauptmann half ihm, den abgeschlagenen Kopf des Lindwurms an eine andere Stelle zu tragen. Dann stand er reglos in der dunklen Eiseskälte da.
Da befand sich etwas in seiner unmittelbaren Nähe. Etwas Mächtiges.
Vielleicht war es ein Fehler gewesen, das Feuer zu machen – so wie es auch ein Fehler gewesen war, nur zu zweit in den Wald zu gehen.
Prudentia? Pru?
Mein lieber Junge.
Pru, kann ich den Mantel über dieses kleine Lager legen? Oder würde ich damit nur Unruhe schaffen?
Leg ihn still darüber, wie ich es dich gelehrt habe.
Er berührte ihre Marmorhand, entließ seine Wächter und seinen Schutz und öffnete die große Eisentür seines Palastes. Draußen herrschte eine grüne Dunkelheit – sie war dichter und grüner, als es ihm lieb war.
Doch er nahm vorsichtig von dem Grün und schloss die Tür wieder.
Unter dieser Anstrengung geriet er ins Taumeln.
Er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Neben dem Haupt des Dämons sank er auf die Knie.
Die Dunkelheit war fast undurchdringlich.
Der Kopf hatte Reste seiner Aura der Angst behalten. Der Hauptmann kniete neben ihm. Seine Knie ruhten auf den feuchten, kalten Blättern, und die Kälte half ihm, wieder zu sich zu finden.
»Mylord?«, fragte Gelfred, der offensichtlich entsetzt war. »Mylord!«
Der Hauptmann atmete schwer.
»Was ist los?«, fragte er.
»Die Sterne sind erloschen«, antwortete Gelfred.
»Ich habe eine … Tarnung über uns gelegt«, erwiderte der Hauptmann und schüttelte den Kopf. »Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.«
Gelfred gab ein seltsames Geräusch von sich.
»Wir sollten uns von diesem … Ding entfernen«, meinte der Hauptmann. Er erhob sich, und gemeinsam stolperten die beiden Männer zurück zu ihrem kleinen Feuer.
Die Pferde zeigten das Weiße ihrer Augen.
»Ich muss schlafen«, sagte er.
Gelfred machte in der Finsternis eine Bewegung. Der Hauptmann betrachtete sie als Zustimmung.
Trotz seiner Angst war er bereits in dem Augenblick eingeschlafen, in dem sein Kopf den Boden berührte, und er erwachte erst, als Gelfred ihm die Hand auf die Schulter legte.
Er hörte Hufgetrappel.
Oder waren es Krallen?
Was immer es sein mochte, er konnte die Ursache der Geräusche nicht erkennen. Und auch sonst nichts.
Das Feuer war erloschen, und die Nacht war so finster, dass nichts zu erkennen war. Aber etwas sehr Großes bewegte sich herum – auf Armeslänge entfernt. Vielleicht waren es auch zwei Geschöpfe.
Gelfred war neben ihm, da legte ihm der Hauptmann den Arm um die Schulter und stützte sie beide auf diese Weise.
Knirsch.
Knack.
Klack.
Und dann war es an ihnen vorbeigezogen und bewegte sich den Hügel hinunter und auf die Straße zu.
Nach einer ganzen Ewigkeit sagte Gelfred: »Es hat uns weder gesehen noch gerochen.«
Der Hauptmann sagte still: Danke, Pru.
»Jetzt übernehme ich die Wache«, sagte er.
Schon nach zehn Minuten schnarchte Gelfred und zeigte dabei so viel Vertrauen zu seinem Herrn, wie der Hauptmann zu sich selbst nicht aufbringen konnte.
Als er in die Finsternis starrte, wurde sie eher zu seinem Freund als zu seinem Feind. Er starrte und starrte, und währenddessen spürte er, wie sein Herzschlag langsamer wurde und die Schmerzen abnahmen. Er machte einen Ausflug in seinen Palast der Erinnerung und betrachtete Schwertwunden, Wächterzauber und Gedichtzeilen.
Hinter der Blase seines Willens zog die Nacht sehr langsam vorbei. Aber immerhin zog sie vorbei.
Endlich färbte ein ganz schwacher Lichtschein den östlichen Horizont, und er weckte Gelfred so sanft wie möglich. Er senkte seinen Schutzzauber, als sie beide wach und wieder bewaffnet waren, doch nichts wartete auf sie. Sowohl das Pferd als auch der Kopf des Lindwurms waren noch da.
Am Rande der Lichtung, auf der sie geschlafen hatten, befanden sich tiefe Spuren von Krallen und einer Afterklaue im blätterübersäten Waldboden.
Gelfred zuckte bei ihrem Anblick zusammen. Der Hauptmann sah zu, wie er den Spuren folgte.
»Müssen wir uns auf Schwierigkeiten gefasst machen, Gelfred?«, fragte er und folgte einige Schritte hinter ihm.
Gelfred warf einen Blick zurück und deutete auf den Boden vor sich. Als der Hauptmann ihn erreicht hatte, sah er verschiedene Spuren – sie gehörten zu drei, vielleicht sogar zu vier Wesen.
»Sie sind von der Art, die Ihr gestern bekämpft habt. Es sind vier. Eines bewegt sich langsamer als die anderen. Zwei sind sehr schnell – und hier haben sie angehalten und geschnüffelt.« Er zuckte die Schultern. »Das ist alles, was ich erkennen kann.«
Neugier – von der Art, die die Katze tötet – trieb die beiden voran. Nach zehn weiteren Schritten gab es sogar Spuren von acht oder zehn Wesen, und nach zehn weiteren Schritten …
»Heiliger Menschensohn und alle Engel!«, entfuhr es Gelfred.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Amen«, fügte er hinzu. »Amen.«
Sie standen am Rande einer kleinen Schlucht, die breit genug für zwei nebeneinander fahrende Wagen und etwas tiefer als ein Mann auf einem Pferd war. Sie führte von Osten nach Westen. Auf dem Boden wuchs kein Unterholz; sie war wie … eine Straße.
Überall in dieser Schlucht fanden sich aufgewühlte Erde und Spuren.
»Das ist eine ganze Armee!«, sagte Gelfred.
»Schnell weg hier«, meinte der Hauptmann. Er drehte sich um, rannte zurück zur Lichtung und lud dem armen Pferd seine Ausrüstung auf.
Und schon zogen sie fort.
Für eine Weile schien jeder Schatten einen Dämon zu verstecken – bis sie daran vorbeikamen. Der Hauptmann fühlte sich nicht erfrischt. Ihm war kalt, er hatte Hunger und schreckte sogar davor zurück, Tee zu kochen. Das Pferd lahmte wegen der Kälte und weil sich in der eisigen, feuchten Frühlingsnacht niemand um es gekümmert hatte. Doch es schritt unbeirrbar voran.
Dann stellte sich heraus, dass sie nicht weit ziehen mussten, was ihnen vermutlich das Leben rettete. Die Lagerwachen waren offenbar vorgewarnt, denn eine Meile von der Brücke entfernt kam Jehannes mit sechs Lanzen in voller Rüstung auf sie zu.
Jehannes’ Augen waren noch immer blutunterlaufen, aber seine Stimme klang fest.
»Was im Namen des Satans habt Ihr getan?«, wollte Jehannes wissen.
»Die Gegend ausgekundschaftet«, gab der Hauptmann zu. Es gelang ihm, mit den Achseln zu zucken, als ob das kein Grund sei, um sich aufzuregen. Auf dieses Schulterzucken war er sehr stolz.
Jehannes sah ihn mit dem Blick eines Vaters an, der sich die Bestrafung seines Sohnes für einen späteren Zeitpunkt aufsparte – doch dann sah er das Haupt, das hinter dem Pferd über den Boden geschleift wurde. Er ritt zurück und betrachtete es. Und bückte sich darüber.
Seine großen und sorgenvollen Augen verrieten dem Hauptmann, dass er recht gehabt hatte.
Jehannes wendete sein Pferd mit einem brutalen Zerren an den Zügeln.
»Ich werde das Lager benachrichtigen. Tom, gib dem Hauptmann dein Pferd. Mylord, wir müssen die Äbtissin verständigen.« Jehannes’ Tonfall hatte sich verändert. Er klang weniger respektvoll als vielmehr sachlich. Nun ging es nur noch ums Geschäft.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Gebt mir Mutwills Pferd. Tom, du bleibst in meinem Rücken.«
Mutwill Mordling stieg mit dem für ihn üblichen Missmut ab und murmelte etwas darüber, dass er immer derjenige sei, der den Kürzeren ziehe.
Der Hauptmann beachtete ihn nicht weiter, stieg mit geringer Mühe auf den Gaul des Bogenschützen und galoppierte los, während sich Mutwill am ledernen Steigbügel eines anderen Mannes festhielt und mit voller Kraft neben ihm herlief. Er schien Siebenmeilenstiefel zu tragen.
Die Wache war bereits vor den Eingang des Lagers getreten. Ein Dutzend Bogenschützen und drei Soldaten waren allesamt kampfbereit. Zum ersten Mal, seit er sich am vergangenen Tag die Lanze unter den Arm geklemmt hatte, wurde dem Hauptmann etwas leichter ums Herz.
Der Kopf des Lindwurms schleifte hinter Gelfreds Pferd über den Boden und hinterließ eine Welle aus Gemurmel und Gestarre.
Der Hauptmann ritt vor seinen Pavillon und sprang aus dem Sattel. Er dachte daran, ein Bad zu nehmen und sich die Dreckklumpen aus dem Haar zu waschen. Doch er befürchtete, keine Zeit dazu zu haben.
Also genehmigte er sich einen Becher Wasser.
Jehannes hatte bereits mit dem Wachoffizier gesprochen und ritt nun zu ihm; auf seinem Kriegspferd wirkte er übermäßig groß und gefährlich.
Zwei Bogenschützen – der Lange Sam und Ohnekopf – spießten das Haupt des Lindwurms auf einen Pfahl.
Der Hauptmann nickte ihnen zu. »Stellt ihn vor das Haupttor, wo ihn jeder Bauer sehen kann«, sagte er.
Jehannes sah den Kopf zu lange an.
»Verdoppelt die Wachen, steckt ein Viertel der Soldaten in Rüstungen und macht einen Plan zur Räumung der Dörfer um die Festung herum«, befahl der Hauptmann. Es fiel ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so müde gewesen zu sein. »Die Wälder sind voll – voll von den Geschöpfen der Wildnis. Sie haben da draußen eine Armee zusammengezogen. Wir könnten jeden Augenblick angegriffen werden.« Er griff nach einem Tintenfass, das auf seinem Feldtisch stand, und kritzelte eine lange Nachricht. Schließlich unterschrieb er sie in Großbuchstaben – es war eine gute Schrift, die von Bildung zeugte.
Der Rote Ritter, Hauptmann.
»Zwei Bogenschützen sollen mit Proviant versehen werden und so schnell wie möglich aufbrechen; jeder von ihnen soll zwei gute Pferde bekommen. Sie müssen zum König nach Harndon reiten.«
»Gütiger Christus«, sagte Jehannes.
»Wir werden uns unterhalten, sobald ich mit der Äbtissin gesprochen habe«, rief der Hauptmann, während Toby ihm sein zweites Reitpferd brachte, das Gnad hieß. Er stieg auf, befahl Tom Schlimm mit einem einzigen Blick zu sich und ritt den steilen Hang zur Festung hoch.
Das Tor stand offen.
Das musste geändert werden.
Er sprang wieder von Gnad herunter und warf Tom die Zügel zu, der mit weitaus weniger Hast abstieg. Der Hauptmann rannte die Treppe zur Halle hinauf und hämmerte gegen die Tür. Der Priester beobachtete ihn von der Kapelle aus, wie er es immer tat.
Eine ältliche Schwester öffnete und verneigte sich.
»Ich muss die Äbtissin sprechen, so schnell wie möglich«, sagte der Hauptmann.
Die Nonne zuckte zusammen, wandte den Blick ab und schloss die Tür wieder.
Er fühlte sich versucht, mit den Fäusten abermals gegen die Tür zu hämmern, aber dann unterließ er es doch.
»Ihr und Gelfred habt dieses … Wesen getötet?«, fragte Tom Schlimm, der nun neben ihn getreten war. Er klang eifersüchtig.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Später«, gab er zurück.
Tom Schlimm zuckte die Schultern. »Muss ein ziemliches Schauspiel gewesen sein«, meinte er wehmütig.
»Du bist … hast du mir nicht zugehört, Tom? Nicht jetzt!« Der Hauptmann ertappte sich dabei, wie er die Fenster des Dormitoriums betrachtete.
»Ich hätt Euch gern begleitet, Hauptmann«, meinte Tom. »Mehr will ich gar nicht sagen. Denkt das nächste Mal an mich.«
»Christ am Kreuze, Tom!«, rief der Hauptmann. Es war sein erster blasphemischer Fluch seit langer Zeit, und er stieß ihn aus, als die verängstigte, ältliche Nonne gerade wieder die schwere Tür öffnete.
Ihr Blick verriet ihm, dass sie schon einige Flüche gehört haben musste. Sie neigte den Kopf ein wenig und deutete damit an, er solle ihr folgen. Also stieg er die letzte Stufe hoch und durchquerte die Halle hinter ihr bis zu jener Tür, die er bisher noch nie durchschritten hatte, durch die ihm aber der Wein und ein Schemel gebracht worden waren.
Sie führte ihn einen Korridor entlang, der von Türen gesäumt war, und eine enge Wendeltreppe mit einer zentralen, reich verzierten Steinsäule hinauf zu einer schönen, blauen Tür. Die Nonne klopfte an, öffnete die Tür und verneigte sich.
Der Hauptmann schritt an ihr vorbei und erwiderte ihre Verneigung. Offenbar war er noch nicht zu müde für Höflichkeitsbezeugungen. Allmählich beruhigte sich sein Geist wieder, und es tat ihm leid, dass er in Hörweite der Nonne geflucht hatte.
Es war wie die Rückkehr des Gefühls in einen Arm, auf dem er geschlafen hatte, und damit ging auch das übliche Stechen und Kribbeln einher. Allmählich verließ ihn die Betäubung, und es kehrten zwar keine Sinne, aber immerhin die Gefühle zurück.
Die Äbtissin saß auf einem niedrigen Stuhl und hielt einen Stickrahmen im Schoß. Das Westfenster fing die mittäglichen Strahlen der Frühlingssonne ein. Ihre Stickerei zeigte einen Hirsch, der von Hunden umgeben war; ein Speer steckte bereits in seiner Brust. Helles Seidenblut floss an seiner Flanke herab.
»Ich habe Euch herbeikommen sehen. Ihr habt Euer Pferd verloren«, sagte sie. »Und Ihr stinkt nach Phantasmata.«
»Ihr schwebt in großer Gefahr«, entgegnete er. »Ich weiß, wie das klingt. Aber ich meine es ernst. Es geht nicht um einige einzelne Kreaturen. Ich glaube, dass irgendeine Macht der Wildnis danach trachtet, diese Festung und die Furt einzunehmen. Wenn es ihnen nicht durch Heimlichkeit und List gelingt, werden sie einen Angriff führen. Und dieser Angriff kann jederzeit erfolgen. Sie haben sich zusammengerottet, und zwar in großer Zahl in Eurem Wald.«
Nachdenklich sah sie ihn an. »Ich vermute, das ist nicht der dramatische Versuch, Eure Entlohnung zu erhöhen?«, fragte sie. Ihr Lächeln war schwach und zeigte sowohl Angst als auch Belustigung. »Nein?«, fragte sie mit belegter Stimme.
»Mein Jäger und ich, wir sind der Spur – der hermetischen Spur – des Dämons gefolgt, der Hawisia umgebracht hat«, erklärte er.
Sie bedeutete ihm, sich auf einen Schemel zu setzen, und er bemerkte, dass ein Glas Wein auf dem kleinen Tisch daneben stand. Er trank ihn. In dem Augenblick, in dem seine Lippen den Becher berührten, rann bereits beißendes Feuer durch seinen Schlund. Er setzte den Becher etwas zu hart ab; das Horn verursachte ein klackendes Geräusch auf dem Holz, und die Äbtissin sah ihn an.
»Ist es schlimm?«, fragte sie.
»Zuerst haben wir den Leichnam eines Mannes gefunden, der wie ein Soldat gekleidet war. Aber er wird ein Wildbube gewesen sein.« Er holte tief Luft. »Erinnert Ihr Euch an die Wildbuben, Äbtissin?«
Ihr Blick glitt von ihm ab und richtete sich in eine andere Zeit. »Natürlich«, sagte sie. »Mein Geliebter ist im Kampf gegen sie gestorben. Ein Grund für Buße. Mein Geliebter. Die Liebe.« Sie lächelte. »Aber meine alten Geheimnisse sind hier nicht von Belang. Ich kenne die Wildbuben – die geheimen Diener des bösen Feindes. Der alte König hat sie ausgerottet.« Sie hob den Blick und sah ihn wieder an. »Aber Ihr habt einen gefunden. Zumindest habt Ihr mir das Blatt eines solchen Wildbuben gezeigt.«
»Er war tot. Es sah so aus, als wäre er vor kurzer Zeit umgebracht worden, und zwar von seinesgleichen.« Der Hauptmann fand eine Karaffe mit Wein und goss sich einen zweiten Becher ein. »Ich könnte wetten, dass er nur wenige Stunden nach Schwester Hawisia gestorben ist. Aber den Sinn darin, den sehe ich nicht.« Er schüttelte den Kopf. »Dann sind wir nach Westen gezogen und der Spur gefolgt.« Er ließ sich schwer auf den Stuhl nieder.
Sie beobachtete ihn.
»Und dann haben wir dieses Geschöpf gefunden.« Er sah sie eindringlich an. »Einen Adversarius. Wisst Ihr, was das ist?«, fragte er.
»Jeder aus meiner Generation weiß das.« Ganz kurz bedeckte sie die Augen mit ihrer Hand. »Dämonen. Die Wächter der Wildnis.«
Er stieß die Luft aus. »Ich hatte geglaubt, die Berichte seien übertrieben.« Dann sah er aus dem Fenster. »Jedenfalls waren es zwei. Ich vermute, dass die Wildbuben und die Dämonen zusammenarbeiten. Wenn dem so ist, dann ist das kein zufälliger Zwischenfall gewesen. Ich glaube, sie sind die Vorboten eines Angriffs und sollen Eure Stärke auf die Probe stellen. Vermutlich wird Eure Festung das Ziel sein. Auf alle Fälle besitzt sie eine ungeheure strategische Bedeutung. Ich muss Euch bitten, meinen Truppen Einlass zu gewähren, dann die Tore zu schließen, Euch zur Verteidigung bereit zu stellen und die Festung mit ausreichenden Nahrungsmitteln zu versehen. Natürlich solltet Ihr auch Eure Lehensleute hereinlassen und dem König eine Botschaft schicken.«
Sie sah ihn lange an. »Solltet Ihr geplant haben, meine Festung für Euch selbst einzunehmen …«, sagte sie und verstummte dann.
»Mylady, ich stimme Euch zu, dass dies eine brillante Kriegslist wäre. Ich stimme Euch sogar darin zu, dass mir ein solcher Gedanke kommen könnte. Ich habe im Osten gekämpft – und dort haben wir so etwas durchaus getan.« Er zuckte mit den Schultern. »Aber das hier ist mein eigenes Land, Mylady. Und wenn Ihr an mir zweifelt – Ihr habt jedes Recht dazu –, dann solltet Ihr einmal einen Blick auf das werfen, was meine Bogenschützen gerade vor den Toren unseres Lagers vorbereiten.«
Sie warf einen Blick aus dem Fenster.
»Ihr könntet mir sagen, dass ein Engel des Herrn vor den Toren Eures Lagers steht und Euren Bogenschützen mitteilt, ich sei die schönste Frau seit Helena, und ich würde Euch nicht glauben, weil ich es nicht sehen kann«, sagte sie. »Aber ich habe Euch gesehen. Ich kann Eure Macht riechen. Und jetzt verstehe ich auch die anderen Dinge, die ich gesehen habe.«
»Ihr seid eine Astrologin«, sagte er und dachte dabei: Ich denke zu langsam.
»Ja. Und Ihr seid sehr schwer zu lesen. Es ist, als ob … als ob Ihr eine Art Schutz gegen meine Kunst besäßet.« Sie lächelte. »Aber ich bin keine Novizin, und Gott hat mir die Macht gegeben, in die Seelen zu blicken. Die Eure ist recht seltsam – wie Ihr sicherlich wisst.«
»Oh, Gott ist sehr gut zu mir gewesen«, meinte er.
»Ihr spottet und seid verbittert, aber wir befinden uns in einer Krise, und ich bin keineswegs Eure spirituelle Mutter.« Ihre Stimme veränderte sich, wurde schärfer und gleichzeitig tiefer. »Aber ich würde es gern sein, wenn Ihr mich in Euch hineinlassen würdet. Ihr braucht Seinen Geist.« Dabei wandte sie sich ab. »Ihr seid mit Finsternis gerüstet. Aber es ist eine falsche Rüstung, und sie wird Euch verraten.«
»Das höre ich immer wieder«, sagte er. »Aber bisher hat sie mir immer gut gedient. Beantwortet mir eine Frage, Äbtissin. Wer hat sich sonst noch in diesem Gehöft aufgehalten?«
Die Äbtissin zuckte mit den Schultern. »Später …«
Der Hauptmann sah sie lange an. »Wer war sonst noch dort?«
Sie schüttelte den Kopf. »Später. Jetzt geht es erst einmal um die Gefahr, die meinem Lehen droht. Ich will nicht versagen. Ich werde diesen Ort verteidigen und halten.«
Er nickte. »Ihr werdet diese Festung also sichern?«, fragte er.
»Noch in dieser Minute.« Sie hob eine Handglocke und läutete sie.
Sofort kam die ältere Nonne herein.
»Hol den Torwächter und den wachhabenden Sergeanten. Und läute die Alarmglocke«, befahl die Äbtissin mit fester Stimme. Dann ging sie zum Kamin, öffnete eine kleine Elfenbeinschachtel, die auf dem Sims stand und in die das Kreuz des Ordens vom heiligen Thomas eingraviert war. Darin befand sich ein Stück milchweißer Birkenborke.
»Seid Ihr Euch sicher?«, flüsterte sie.
»Das bin ich«, antwortete er.
»Ich muss Eure Überzeugung teilen können«, sagte sie.
Er lehnte sich zurück. »Ich hätte all das doch niemals erfinden können. Ihr sagt, Ihr könnt den Geruch des Phantasmas an mir wahrnehmen …«
»Ich glaube Euch, wenn Ihr behauptet, dass Ihr ein weiteres Ungeheuer gesehen und besiegt habt. Außerdem ist es möglich, dass Ihr wirklich einem toten Wildbuben begegnet seid.« Sie zuckte die Achseln. »Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass ein Verräter oder eine Verräterin in unseren Mauern weilt. Aber sobald ich den Ruf ausgesandt habe, wird der Meister meines Ordens mit all seinen Rittern herkommen. Vermutlich wird er fordern, dass der König eine Armee aushebt.«
»Genau diese würde hier gebraucht werden«, sagte der Rote Ritter.
»Ich darf sie aber nicht umsonst rufen«, wandte sie ein.
Der Rote Ritter regte sich auf seinem Stuhl. Rücken und Hals schmerzten ihm, und er verspürte die dumpfe Wut vollkommener Erschöpfung. Er schluckte eine Erwiderung herunter – und noch eine.
»Was würde Euch zufriedenstellen?«, fragte er.
Sie zuckte die Achseln. »Ich glaube Euch. Aber ich muss mir sicher sein.«
Er nickte. Und war unerklärlich wütend.
»Gut«, sagte er, stand auf und verneigte sich.
Sie griff nach seiner Hand.
Er machte einen Schritt zurück. »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«, spuckte er plötzlich aus.
»Hauptmann!«, sagte sie. »Ihr seid doch kein kleines Kind mehr.«
Er nickte, bezwang seinen Zorn und ging mit schnellen Schritten nach draußen.
»Was hat sie gesagt?«, wollte Tom wissen.
»Sie will, dass wir nicht nur Anzeichen der feindlichen Armee, sondern die Armee selbst finden«, antwortete der Hauptmann.
Tom grinste. »Das wird eine wunderbare Heldentat abgeben«, meinte er.
Ser Milus trug bereits das Banner, und der Rest seines Gefolges war in der Lage aufzusitzen. Doch der Sergeant der Festung hatte nur den einen Torflügel geöffnet. Sie würden die Pferde zu Fuß hindurchführen müssen. Auch wenn er über diese Verzögerung fluchte, musste der Hauptmann der alten Hexe Respekt zollen. Sie nahm seine Warnung ernst.
»Hauptmann!«
Er drehte sich um und sah, wie Amicia barfuß über den Hof lief.
»Los geht’s«, brummte Tom. »Ich stelle einen Trupp zusammen.«
»Zwanzig Lanzen«, sagte der Hauptmann.
»Jawohl«, meinte Tom und zwinkerte, als er sich auf den Weg machte.
Nun hatte Amicia ihn erreicht. Er spürte sie durch den Äther hindurch, als sie herbeikam. Er roch sie; es war ein erdiger, weiblicher Duft, so sauber und hell wie ein neues Schwert. Wie der Geschmack der Wildnis.
»Die Äbtissin schickt Euch das hier«, sagte sie gelassen und streckte eine kleine Schriftrolle vor. »Sie sagt, sie werde sofort Schritte ergreifen, damit Ihr nicht glaubt, dass sie Eure Worte unbeachtet lässt.«
Er nahm ihr die Schriftrolle aus der Hand.
»Danke«, sagte er und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich bin müde und etwas gereizt.«
»Ihr habt um Euer Leben gekämpft«, sagte sie und sah ihm fest in die Augen. »Keine Erschöpfung ist wie die der Angst und des Krieges.«
Er hätte es verneinen müssen. Ritter gaben niemals ihre Angst zu. Doch in ihrer sanften Stimme lag eine vollkommene Sicherheit. Sie war heilsam. Und versöhnlich.
Bewundernswert.
Er erkannte, dass er die ganze Zeit hindurch ihre Hand gehalten hatte. Sie errötete, zog sie aber nicht weg.
»Herrin, deine Worte sind Balsam für einen müden Mann.« Er verneigte sich und küsste ihre Hand. Es war wirklich wie Balsam. Oder sie hatte unbemerkt einen Zauber über ihn gewirkt.
Sie lachte. »Ich bin keine Herrin, sondern nur eine einfache Novizin dieses Hauses«, sagte sie.
Er riss sich von ihr los, denn sie standen schon zu lange im Hof, während die erste Sonne des Frühlings sie beschien.
Er las die Rolle, während er über den Kiesweg vom Haupttor zur Unterstadt ritt. Ein großer Teil des Weges war durch Mauern begrenzt, und einige Abschnitte waren gepflastert, sodass er selbst zu den Verteidigungsanlagen gehörte.
Jemand musste eine Menge Geld in diese Festung gesteckt haben.
Er ritt durch den Ort. Seine Schulter schmerzte nicht mehr, doch seine rechte Hand prickelte – wenn auch aus einem völlig anderen Grund. Er lachte laut auf.
Der Palast von Harndon · Desiderata
Desiderata führte ihre Ritter und Hofdamen in den Frühling hinaus.
Das Jahr war noch jung, und selbst die kühnsten ihrer verwegenen jungen Freunde würden heute nicht nackt ins Wasser springen. Aber für einen schnellen Ritt und ein Picknick auf ausgebreiteten Decken war es warm genug.
Lady Mary befehligte die Anordnung der Speisen. Bei Desiderata erforderte jede Spontaneität sorgfältige Vorbereitung und eine Menge Arbeit – die für gewöhnlich Lady Mary zu tun hatte.
Lady Rebecca Almspend, die etwas lebensferne Schreiberin der Königin, saß hinter ihr und hakte alle Gegenstände ab, die gerade ausgepackt wurden. Sie und Lady Mary waren alte Verbündete und Kindheitsfreundinnen.
Rebecca warf ihre Schuhe von sich. »Es ist wirklich Frühling«, sagte sie.
Mary lächelte sie an. »Und es ist die Zeit, in der sich die Gedanken der jungen Männer wieder auf den Krieg richten«, sagte sie.
»Fürwahr. Sie sind gegen den ersten Feind des Jahres ins Feld gezogen, und das reicht schon aus, um jedem Mädchen den Kopf zu verdrehen.« Rebecca runzelte die Stirn. »Ich glaube, er wird um mich anhalten. Eigentlich hatte ich gehofft, dass er es vor seiner Abreise täte.«
Mary schürzte die Lippen und betrachtete die beiden Steintöpfe mit Orangenmarmelade – der Lieblingssorte der Königin. Davon konnte sie Unmengen essen. »Haben wir tatsächlich nur zwei Töpfe mitgebracht?«
»Wirklich, Mary, dieses Zeug ist ungeheuer teuer – die Orangen stammen schließlich aus dem Süden. Und der weiße Zucker von den Inseln.« Rebecca warf den Kopf herum. »Wenn sie dreißig ist, wird sie keine Zähne mehr haben.«
»Das würde doch niemand bemerken«, erwiderte Mary.
»Mary!« Erstaunt stellte Rebecca fest, dass ihre Freundin weinte. Sie glitt von ihrem Baumstumpf herunter und schlang die Arme um Mary. Diese war weithin als sehr mitfühlend bekannt, was zu bedeuten schien, dass sich jedermann an ihrer Schulter ausweinen konnte. Jetzt stand sie mit ihrem Stylus in der einen Hand und dem Wachstäfelchen in der anderen da, drückte beides hinter dem Rücken ihrer Freundin zusammen und fühlte sich ein wenig närrisch.
»Er hat mir nicht einmal Lebewohl gesagt!«, jammerte Mary wütend. »Dein Hochländer liebt dich wenigstens, Becca! Er wird zu dir zurückkommen oder bei dem Versuch sterben. Aber Murien liebt nur sich selbst, und ich bin ein Dummkopf gewesen …«
»Na, na«, murmelte Rebecca. Drüben bei den Weiden, die den Fluss säumten, erklang Gelächter, und die Haare der Königin blitzten auf.
»Schau, sie trägt ihr Haar offen«, sagte Mary.
Beide lachten. Die Königin neigte dazu, bei dem geringsten Anlass die Haare unter der Haube hervorströmen zu lassen.
Rebecca lächelte. »Hätte ich ihr Haar, ich würde es auch offen tragen.«
Mary nickte. Sie trat von der Umarmung ihrer Freundin zurück und wischte sich die Augen. »Ich glaube, wir sind fertig. Sag den Dienern, dass sie die Teller aufstellen können.« Sie warf einen Blick zu den Bäumen und der darüber stehenden Sonne hinüber. Es war so wunderschön – so frühlingshaft, wie man es sich nur vorstellen konnte, wie ein Bild in einem illuminierten Manuskript.
Auf ihr Wort trat Mastiff, der Diener der Königin, hinter einem Baum hervor und verneigte sich. Er schnippte mit den Fingern, und ein Dutzend Männer und Frauen bewegten sich mit der Präzision von Tänzern, während sie die Speisen und Teller anordneten. Dazu benötigten sie nur die Zeit, die ein Mann brauchte, um zum Fluss zu laufen.
Mary berührte Mastiff am Ellbogen. »Ihr wirkt Wunder – wie immer, Ser«, sagte sie.
Er verneigte sich und war offenbar sehr erfreut. »Ihr seid zu freundlich, Mylady«, sagte er. Dann verschwanden er und seine Untergebenen wieder zwischen den Bäumen, und Mary holte die Königin und deren Freunde zum Mittagessen.
Die Königin ging barfuß und trug ein leichtes grünes Kleid. Ihre befreiten Haare fielen ihr über die Schulter, und die junge Sonne beschien ihre bloßen Arme. Einige der jungen Männer waren vollständig bekleidet, aber zwei von ihnen – beide waren Ritter – trugen nur einfache Webhemden und keine Hosen; sie wirkten wie Bauern oder Arbeiter. Die Königin schien die beiden zu favorisieren, und die kurzen Hemden und nackten Beine zeigten ihre Muskeln sehr vorteilhaft.
Als sie sich zum Essen im frischen Gras niederließen, mussten sie die Beine sehr sorgfältig verschränken. Darüber lächelte Mary und warf einen kurzen Blick zu Rebecca hinüber, die ebenfalls grinste und dann wegsah.
Lady Emmota, die jüngste Hofdame der Königin, trug ihr Haar ebenfalls offen, und als sich die Königin setzte, nahm Emmota neben ihr Platz. Die Königin zog sie zu sich herunter, bis ihr Kopf in Desideratas Schoß lag. Die Königin strich ihr durch das Haar. Das junge Mädchen schenkte ihr Blicke voller Anbetung.
Die meisten jungen Ritter bekamen keinen Bissen herunter.
»Wo ist mein Herr?«, fragte die Königin.
Lady Mary machte einen Knicks. »Er befindet sich auf der Jagd und sagte, er werde sich zum Mittagsmahl zu uns gesellen, falls es ihm der Hirsch erlaubt.«
Die Königin lächelte. »Ich muss mich Artemis geschlagen geben«, sagte sie.
Emmota lächelte zu ihr hinauf. »Lasst ihn sein Blut haben«, sagte sie.
Ihre Blicke begegneten sich.
Später, als die jungen Männer mit ihren Schwertern und Schilden gegeneinander kämpften, tanzten die Frauen. Sie woben Girlanden aus Blumen, vollführten Ringtänze und sangen alte Lieder, die keineswegs das Wohlwollen der Kirche besaßen. Als die Sonne allmählich unterging, war ihnen allen warm geworden; ihre Wangen waren gerötet, und sie liefen barfuß durch das Gras. Die Ritter riefen nach mehr Wein.
Die Königin lachte. »Messires«, sagte sie, »keine meiner Damen wird durch Eure Fechtkünste einen grünen Rücken bekommen, wie sehr wir auch durch die steigenden Säfte des Frühlings beeinflusst sein mögen.«
Alle Frauen lachten. Einige der Männer wirkten bestürzt. Ein paar – die besten – lachten über sich selbst und ihre Gefährten, aber niemand gab ihr eine Erwiderung.
Rebecca legte die Hand auf Marys nackten Arm. »Ich vermisse ihn auch«, sagte sie. »Gawin hätte ihr eine gewitzte Antwort gegeben.«
Mary lachte. »Ich liebe sie – und sie hat recht. Emmota wird in die ersten starken Arme sinken, die sich nach ihr ausstrecken. Daran sind das Licht und die Wärme und die nackten Beine schuld.« Als ihr die Königin ein Zeichen gab, ging sie hinüber und bot der Königin die Hand an, damit diese sich erheben konnte. Die Königin küsste ihre Hofdame.
»Ihr sorgt immer so gut für alles, Mary.« Sie ergriff die ihr dargebotenen Hände. »Ich hoffe, Ihr hattet ebenfalls einen angenehmen Tag.«
»Ich bin leicht zufriedenzustellen«, sagte Mary, und die beiden Frauen lächelten einander zu, als hätte sie gerade einen Scherz gemacht, den sonst niemand verstand.
Auf dem Rückweg ritten sie zu dritt nebeneinander; die Königin wurde von Lady Mary und Lady Rebecca flankiert. Hinter ihnen ritt Emmota zwischen zwei jungen Rittern. Sie hatte den Kopf zurückgeworfen und lachte.
»Emmota ist sehr verletzlich«, sagte Mary vorsichtig.
Die Königin lächelte. »Ja. Wir sollten mit diesem Lachen und den schmachtenden Blicken aufhören. Es ist noch viel zu früh im Jahr.«
Sie richtete sich im Sattel auf und drehte sich um – wie ein Kommandant auf einem Wandteppich.
»Ihr Herren, wir machen einen Wettritt bis zu den Toren von Harndon!«
Ser Augustus, einer der jungen Männer im Bauerngewand, lachte laut auf. »Was ist der Gewinn dabei?«, rief er.
»Ein Kuss«, erwiderte die Königin und gab ihrem Pferd die Sporen.
Einer der Knappen blies in ein Horn, und sie preschten in einem Aufruhr aus Farben und Lärm in das verdämmernde Frühlingslicht. Die letzten Sonnenstrahlen fielen auf leuchtendes Grün und Blau, auf helles Scharlachrot, Gold und Silber.
Aber der Kuss der Königin war niemandem hold. Ihre südländische Stute schien den Boden kaum zu berühren, als sie dahinflog, und die Königin war die beste Reiterin an ihrem Hof. Sie hielt den Rücken gerade, die Schultern gereckt, die Hüften entspannt, und Ross und Reiterin schienen wie eine einzige Kreatur zu sein, die das aufgeregte Rudel junger Höflinge anführte – über die Straße, über die Brücke, den lang gestreckten Hügel hinauf, der erst vor Kurzem mit teuren Häusern bebaut worden war, und dann bis vor die Tore der Stadt.
Die Königin gewann um zwei Längen, und Lady Rebecca war die Zweite; sie war ganz rot im Gesicht und hocherfreut über ihr Können.
»Becca!«, rief die Königin begeistert. Als die anderen aufschlossen, küsste sie ihre Schreiberin. »Reitet Ihr wegen Eures Hochländers in der letzten Zeit öfter?«
»Ja«, antwortete Rebecca bescheiden.
Die Königin strahlte sie an.
»Seid Ihr die Königin, oder hat irgendein Wildfang das königliche Pferd gestohlen?«, fragte eine Stimme hinter dem Tor. Diota trat hervor. »Steckt Euch die Haare unter die Haube, Mylady. Und zieht Euch etwas Schickliches an.«
Die Königin rollte mit den Augen.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Rote Ritter trank im Sattel einen Becher Wein. Dann gab er Toby das leere Gefäß.
»Hört her, meine Herren«, sagte er. »Gelfred – wir müssen annehmen, dass sich ihr Lager zwischen uns und Albinkirk befindet.«
Gelfred sah sich um. »Meint Ihr das, weil wir in der letzten Nacht nicht darauf gestoßen sind?«
Der Hauptmann nickte. »Genau. Für den Augenblick jedenfalls wollen wir das annehmen. Das überfallene Gehöft liegt östlich der Festung.«
Ser Jehannes zuckte die Achseln. »Aber den toten Wildbuben habt Ihr westlich von hier gefunden. Und es ist überaus wahrscheinlich, dass er auf dem Rückweg ins Lager war.«
Der Hauptmann sah ihn kurz an und schüttelte dann den Kopf. »Verdammt«, sagte er, »daran hatte ich nicht mehr gedacht.«
Tom Schlimm beugte sich vor. »Im Süden wird es nicht liegen. Sie können sich nicht jenseits des Flusses befinden.«
»Ich vermute sie in nordwestlicher Richtung«, sagte Gelfred. »Ich spüre, dass dort ein hoher Hügelkamm liegt, der parallel zu dem Berg verläuft, auf dem sich die Festung erhebt.«
»Das könnte Tage dauern«, sagte Ser Jehannes.
Der Hauptmann schien vor Tatkraft zu glühen, was bei einem Mann, der in drei Tagen gegen zwei Ungeheuer gekämpft hatte, schier unmöglich schien.
»Messires«, sagte er, »wir werden wie folgt vorgehen. Alle Bewaffneten sollen in einer einzigen Gruppe in der Mitte gehen. Die Pagen reiten voran, zehn Pferdelängen bleiben zwischen den Männern. Wir werden sofort anhalten und absteigen, wenn ich pfeife. Und wir werden ganz still sein und lauschen. Die Bogenschützen folgen am Ende in einer langen Gefechtslinie. Im Falle eines Kampfes werden sie sich zurückhalten, und die Schwertkämpfer bleiben unter meinem Kommando. Wir ziehen nämlich nicht in die Schlacht. Wir wollen lediglich den Beweis dafür finden, dass die Wildnis eine Armee zusammenstellt. Wir werden nur dann kämpfen, wenn wir einen der Unseren retten müssen.« Seine Stimme klang scharf, geschäftsmäßig und dabei so selbstsicher wie die eines Fürsten. Sogar Jehannes musste zugeben, dass es ein guter Plan war.
»Gelfred, wenn wir ihr Lager gefunden haben, werden wir einen kurzen Beweis unserer Gegenwart liefern, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.« Er grinste und zwinkerte Cuddy zu, der sogleich nickte.
»Ihr meint vermutlich eine kleine Vorführung der Künste unserer Bogenschützen«, sagte er.
Der Hauptmann nickte und fuhr fort: »Du und deine Männer, ihr werdet euch in der Nähe verstecken und uns später Bericht über das erstatten, was nach unserem Rückzug geschehen ist. Wir werden nach Osten ins Tal des Cohocton gehen. Falls sie uns verfolgen, wird die Sonne sie blenden.« Der Hauptmann sah Cuddy eindringlich an. »Falls wir verfolgt werden …«
»Dann lasse ich die Jungs absitzen und stelle Euren Verfolgern einen Hinterhalt. Ich kenne das Spiel.«
Der Hauptmann klopfte ihm auf die Schulterrüstung. »Hat das jeder verstanden?«
Sein Knappe Michael war ganz blass geworden. »Wir gehen also in den Wald und suchen nach einer Armee, die aus den Kreaturen der Wildnis besteht?«, fragte er.
Der Rote Ritter lächelte. »Das ist richtig«, sagte er.
Dann wendete er sein Kriegspferd, hob seinen Stab und gab den Befehl zum Aufbruch. Jehannes wandte sich an Tom. »Er ist betrunken.«
»Nein, er ist bloß verrückt – genau wie ich. Er will kämpfen. Lass ihm doch seinen Willen.« Tom grinste.
»Er ist betrunken«, wiederholte Jehannes.
Ser Milus schüttelte den Kopf. »Nur verliebt«, bemerkte er.
Jehannes spuckte aus. »Das wird ja immer schlimmer.«
Zunächst ritten sie nach Westen – die Straße war ihnen sehr vertraut. Sobald sie den Waldrand erreichten, teilten sich die Pagen auf, ritten voraus, und die Gefechtslinie fächerte sich auf. Die Schwertkämpfer begaben sich in engem Verband in den Wald hinter ihnen, und dann folgten die Bogenschützen. Gelfred ritt neben dem Hauptmann, seine Späher waren nirgendwo mehr zu sehen.
Nach einer langen Zeit, die ausgereicht hatte, um die meisten Knappen, die in großer Furcht vor einem plötzlichen Hinterhalt unvorstellbarer Ungeheuer dahinritten, völlig zu verängstigen, ertönte das Pfeifen des Hauptmanns.
Alle zügelten ihre Pferde und glitten zu Boden.
Sehr lange hielten sie sich völlig still.
Die Pfeife des Hauptmanns ertönte abermals, stieß zwei langgezogene Töne aus.
Die Männer stiegen wieder auf und ritten weiter. Es war später Nachmittag. Der Himmel zeigte blaue Flecken, und die Sonne, die Rüstungen und die Nerven sorgten allesamt dafür, dass den Männern warm war.
Oder kalt – aus denselben Gründen.
Angst macht müde. Eine Patrouille in feindlichem Gebiet macht fast genauso müde wie ein Ausbruch von Gewalt. Jedes Mal wenn der Hauptmann still bis tausendfünfhundert gezählt hatte, blies er seine Pfeife. In den Pausen konnten sich seine Männer ein wenig ausruhen.
Die Strahlen der Sonne fielen schräger, ihr Licht rötete sich. Der Himmel im Westen war klar.
Sie machten sich daran, Gelfreds Hügelkamm zu erklimmen. Die Spannung stieg.
Auf halbem Weg zum Kamm ertönte die Pfeife des Hauptmanns wieder, und die Truppe stieg ab.
Der Hauptmann gab Michael, der neben ihm stand, ein Zeichen.
»Pfeife: Pferdeburschen.«
Michael nickte. Er zog seinen rechten Panzerhandschuh aus, nahm die silberne Pfeife, die an einer Kordel um seinen Hals hing, und blies darauf drei lange und drei kurze Töne. Nach einer kurzen Pause wiederholte er dieses Signal.
Überall um sie herum übergaben die Ritter ihre Pferde an die Knappen. Hinter ihnen übernahm jeder sechste Bogenschütze am Fuße des Hügels die Pferde seiner Genossen und führte sie nach hinten.
Der Hauptmann beobachtete all dies und fragte sich, ob die Knappen, die er nicht sehen konnte, ebenfalls dem Signal gehorchten.
Er spürte den Feind. Er roch das Grün der Wildnis. Er lauschte und konnte den Gegner beinahe hören. Beiläufig fragte er sich, warum Amicia nach der Wildnis duftete.
Aus der Ferne ertönte ein trompetendes Geräusch, fast wie das Röhren eines Hirsches.
»Jehannes, du hast jetzt das Kommando über die Kämpfer. Ich kümmere mich um die Knappen. Michael, komm.« Er gab Toby die Zügel seines Pferdes und ging den Hügel hoch. Trotz seiner Rüstung blieb er dabei beinahe lautlos, und doch bewegte er sich so schnell, dass er Jehannes’ Einwände nicht mehr hörte.
Tom Schlimm trat aus der Reihe und folgte ihm.
Die Hügelflanke war steil, die Knappen befanden sich zweihundert Schritte weiter oben. Vor Erleichterung stieß er die Luft aus, als er sie alle sah – zusammengedrängt, aber abgestiegen, und er kam an einem Jungen von höchstens fünfzehn Jahren vorbei, der mit sechs Pferden den Hügel hinunterlief.
Das Ersteigen der Flanke in voller Rüstung erinnerte ihn daran, wie wenig Schlaf er seit dem Kampf gegen den ersten Lindwurm bekommen hatte, aber trotz seiner Erschöpfung spürte er noch immer die Berührung von Amicias Fingern auf seiner Hand.
Michael und Tom hatten Schwierigkeiten, mit ihm mitzuhalten.
Dann hatte er die Knappen erreicht. Jacques sorgte bereits dafür, dass sie ausschwärmten, und lächelte den Hauptmann an.
»Gute Arbeit«, flüsterte er.
»Ich vermute, wir gehen bis zum Kamm hinauf?«, fragte Jacques.
Der Hauptmann blickte erst nach links und dann nach rechts. »Ja«, sagte er und gab Michael ein weiteres Zeichen, der nun den letzten Pfiff ausstieß.
Die Knappen besaßen nur leichte Waffen. Sie waren keine Waldmänner, aber sie huschten den Hügel hinan wie Gespenster und waren tatsächlich so schnell, dass es dem Hauptmann den Atem verschlug. Der Hang wurde steiler und steiler, bis der Kamm beinahe senkrecht vor ihnen aufragte und sich die Knappen von Baum zu Baum hangeln mussten.
Ein Schrei ertönte, Pfeile zischten bösartig, und ein Junge von nicht mehr als sechzehn Jahren brüllte: »Für Gott und Sankt Georg!« Nun erklang der unmissverständliche Lärm von Metall, das gegen Metall schlug.
Ein Pfeil prallte vom Helm des Hauptmanns ab.
Plötzlich fand er die Kraft, bis zum Hügelgrat zu laufen. Hier standen die Bäume dicht, und die Zweige griffen nach ihm. Doch ein Mann in einer Rüstung konnte durch ein ganzes Dornendickicht rennen und nicht den geringsten Kratzer davontragen. Er hielt sich an einer schlanken Eiche fest, zerrte sich mit aller Gewalt hoch und stand endlich auf dem Gipfel.
Dahinter lag eine kleine Senke mit einem Feuer, das von dem Kamm verdeckt worden war. Ein Dutzend Männer hockten davor.
Nein, keine Männer. Keine Menschen.
Irks.
Sie ähnelten Menschen, waren aber dünner und schneller. Ihre Haut war braun-grün wie Baumrinde, die Augen wirkten mandelförmig, und die Zähne schienen so spitz wie bei einem Wolf zu sein. Als der Hauptmann überrascht stehen blieb, klirrte ein Pfeil gegen seinen Brustpanzer. Dann brach ein ganzes Dutzend Knappen zwischen den Bäumen rechts von den Irks hervor und griff an.
Der Hauptmann senkte den Kopf und rannte ebenfalls auf die Irks zu.
Sie feuerten noch ein paar Pfeile ab und hasteten schließlich in nördlicher Richtung davon. Die Knappen verfolgten sie.
Der Hauptmann blieb stehen und öffnete sein Visier. Michael erschien neben ihm, hatte das Schwert gezogen und hielt den Schild in der rechten Hand. Rauch war zu riechen – eine Menge Rauch.
»Wir haben sie gefunden!«, rief Michael.
»Nein. Ein Dutzend Irks, das ist noch lange keine Armee«, erwiderte der Hauptmann und richtete den Blick in den Himmel.
Tom trat von hinten auf ihn zu.
»Tom? Uns bleibt noch eine Stunde guten Lichts. Die Knappen werden ihre Wächter zur Strecke bringen.« Er zuckte die Achseln. »Eigentlich weiß ich nicht viel über den Kampf gegen die Wildnis«, gab er zu. »Mein Instinkt rät mir, weiter vorzurücken.«
Tom nickte. »So ist die Wildnis nun einmal. Sie werden keine Reserve haben. Weitere Wächter wird es nicht geben.«
Der Hauptmann wusste, dass die Entscheidung, die sie nun trafen, eine grundlegende war. Der Gedanke an Verluste hier draußen war unerträglich. Aus Gründen der Vorsicht war es unerlässlich, dass …
Er dachte daran, wie sie seine Hand berührt hatte. Er dachte an ihre Bewunderung.
Er wandte sich an Michael. »Sag den Bogenschützen, sie sollen eine halbe Meile hinter uns einen Hinterhalt legen. Bewaffnete sollen die Pferde am Fuß des Hügels bewachen. Verstanden?«
Michael nickte. »Ich will mit Euch kommen.«
»Nein! Gib mir deine Pfeife. Und jetzt beweg dich! Tom, du begleitest mich.«
Sie rannten den Hügelkamm in nördlicher Richtung entlang und auf den Kampflärm und die Schreie zu.
Später musste der Hauptmann zugeben, dass er die Knappen zu weit voraus hatte laufen lassen. Der tiefe Wald und das verdämmernde Licht machten es fast unmöglich, mit ihnen in Verbindung zu treten.
Mit Tom an seiner Seite brach er durch das Dickicht. Beinahe wäre er in ein steil abfallendes Tal gestürzt; ein kleiner Bach schnitt tief in die Hügelflanke ein. Es schien leichter, sich nach Osten zu bewegen, also tat er das. Dabei kam er an drei Leichen vorbei – es waren allesamt Irks.
Am Fuß des Hanges fand er einen seichten Fluss und – auf der anderen Seite – einen Pfad. Und auf diesem Pfad … Sein Atem ging in keuchenden Stößen.
Zelte. Aber keine Knappen.
Es waren etwa fünfzig Männer, die meisten von ihnen spannten ihre Bögen.
Der Hauptmann blieb stehen. Er hatte bei seinem Abstieg genug Lärm gemacht, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, doch da die Sonne in seinem Rücken stand, war er trotz seiner Rüstung schwerer für sie zu erkennen, als sie es für ihn waren.
Tom und Jacques sowie ein Dutzend Knappen, die ihnen den Hügel hinunter gefolgt waren, huschten in den Schutz der alten Bäume. Weit im Westen waren Schreie zu hören – Schreie und noch etwas anderes.
»Verdammte Wildbuben«, fluchte Jacques.
Die Männer jenseits des Flusses drehten sich beinahe gleichzeitig nach ihnen um. Eine kleine Horde von Kobolden und Irks schoss von Westen auf dem Pfad herbei. Es war seltsam, diese Ungeheuer aus den Mythen in vollem Lauf zu sehen.
Die Wildbuben regten sich.
Einige schossen ihre Pfeile nach Westen ab.
Der Hauptmann sah sich um. »Folgt mir«, sagte er. »Und macht eine Menge Lärm.«
Erstaunt sahen sie ihn an.
»Eins. Zwei. Drei.« Er sprang hinter seiner Deckung hervor und brüllte: »HIER KOMMT DER ROTE RITTER!«
Die Wirkung war bemerkenswert. Der Hauptmann befand sich südlich und ein wenig hinter der Linie der Wildbuben, und sie mussten über die Schulter sehen, um ihn wahrzunehmen. Sofort flohen sie zusammen mit den Kobolden und den Irks.
Die Knappen hinter ihm stießen ihren Schlachtruf aus, und Tom Schlimm brüllte: »Lachlan für Aa!«
Es gab verschiedene Arten von Soldaten. Einige waren dazu ausgebildet worden, unter Feuer zu bestehen, und warteten nur darauf, den Tod zu bringen. Andere dagegen waren wie Jäger, die von einer Deckung zur anderen schlüpften.
Die Wildbuben hatten nicht vor standzuhalten und zu kämpfen. Das war nicht ihre Art. Ein Pfeil von einem mächtigen Bogen schlug gegen den scharlachroten Waffenrock des Hauptmanns, riss ein fingerbreites Loch hinein und traf ihn wie der Tritt eines Esels. Und dann waren die Wildbuben verschwunden.
Der Hauptmann packte Tom Schlimm bei der Schulter. »Halt!«, rief er.
In Toms Augen glitzerte es wild. »Mein Schwert ist doch noch gar nicht nass geworden!«, rief er zurück.
Der Hauptmann nahm seine Hand nicht weg; er war wie ein Mann, der seinen Lieblingshund beruhigte. Und dann pfiff er zum Rückzug – drei lange Töne, dann drei weitere und noch einmal drei.
Die Knappen blieben stehen. Viele wischten ihre Schwerter an toten Dingen ab, und alle tranken aus ihren Wasserflaschen.
Aus dem Osten drang ein lang gezogener Schrei an ihre Ohren. Es war ein fremdartiger Laut und ernüchterte jedermann.
»Über den Kamm! Auf demselben Weg zurück, und zwar in ordentlicher Formation. Sofort.« Der Hauptmann deutete mit der Schwertspitze den Hang hinauf. »Bleibt in der Nähe des Flusses!«, rief er.
Nun war Bellen und Brüllen im Wald zu hören. Dazu kamen höllische Schreie und noch etwas anderes, das gewaltig und schrecklich und geradezu bestialisch war – und so groß wie die Bäume.
Er drehte sich um und wollte den Hang hinauflaufen.
Tom stand noch neben ihm. »Ich hab nicht einen Einzigen getötet«, sagte er. »Lasst mich doch wenigstens einen umbringen!«
Tom wandte sich gerade um, als ein Schwall grünen Feuers keine zwei Pferdelängen von seinem ausgestreckten Schwert entfernt vor ihm auf den Boden traf. Das Feuer explodierte unter großem Gefauche, und plötzlich schienen sogar die Steine zu brennen.
Tom grinste und hob sein Schwert.
»Tom!«, schrie der Hauptmann. »Nicht jetzt!«
Kobolde und Irks überquerten den Fluss am Fuß des Hügels, angeführt von einem Bären, der so groß wie ein Schlachtross war und golden wie die Sonne funkelte. Wenn er brüllte, erfüllte seine Stimme den Wald wie ein Sturmwind.
»Was zum Teufel ist das denn?«, fragte Tom. »Bei Gott, den will ich abmetzeln!«
Der Hauptmann zerrte heftig am Arm des Hochländers. »Komm mit!«, befahl er und rannte los.
Widerstrebend drehte sich Tom um und folgte ihm.
Sie erreichten den Hügelkamm. Der Bär verfolgte sie nicht; er schien damit zufrieden zu sein, die Kobolde und Irks anzuführen. Hinter ihnen aber kam etwas weitaus Schrecklicheres immer näher. Und es war weitaus größer.
Die Knappen hatten knapp unterhalb des Grates auf den Hauptmann gewartet, was von guter Disziplin und Tapferkeit zeugte. Aber sobald er sie eingeholt hatte, wandten sie sich um und rannten auf der anderen Seite zu ihren Pferden hinunter.
Der Hauptmann konnte seine stahlummantelten Füße kaum mehr heben, und nie zuvor waren ihm die Beinschienen so schwer und sinnlos erschienen, als der erste Kobold hinter ihm den Hügel erklomm. Sie waren so nahe.
Westlich von Lissen Carak · Thorn
Thorns erste Reaktion auf den Angriff des Lagers bestand in Panik. Er benötigte lange Minuten, um sich von dem Schock zu erholen, und dann erfüllte ihn die schiere Unverschämtheit des Überfalls mit einer ungeheuerlichen Wut. Als er seine Kreaturen sammelte, stellte er entsetzt fest, wie armselig die wenigen menschlichen Angreifer wirkten. Es waren nur wenige Dutzend, und sie hatten seine Wildbuben den Pfad entlanggetrieben, fünfzig Irks überwunden und einen Außenposten von Kobolden vernichtet, die nach dem Essen ein kleines Nickerchen gehalten hatten.
Er erstickte den Aufruhr, indem er den ersten Irk, der an ihm vorbeikam, auf eindrucksvolle Weise tötete. Die Kreatur explodierte in grünem Feuer. Brennendes Fleisch regnete auf die anderen herab. Der Magus hob die behaarten Arme, und der Aufruhr erstarb.
»Ihr Narren!«, brüllte er sie an. »Das sind weniger als fünfzig Gegner!« Er wünschte, er hätte seine Dämonen bei sich, aber sie streiften bereits durch Albinkirk. Seine Lindwürmer waren zwar in der Nähe, aber eben nicht nahe genug. Er ließ seinen gesamten Willen in zwei der goldenen Bären einfließen und sandte seine Streitkräfte den Hügel hinauf und hinter den Angreifern her. Seine Geschöpfe der Wildnis waren im Wald wesentlich wendiger als die Menschen. Auf ihrem eigenen Territorium waren die Bären schneller als Pferde.
Einer der Kobold-Häuptlinge stand neben ihm; sein milchweißes Gewand erglühte in der untergehenden Sonne.
»Sag deinem Volk, es wird ein Festmahl geben. Alles, was sie fangen, gehört ihnen.«
Exrech salutierte mit seinem Schwert und stieß eine Dampfwolke aus. Halb bestand sie aus Macht, halb aus Duft. Und dann war er verschwunden, rannte mit flinken Gliedern den Hang hoch, während ihm die Kobolde wie eine braune Welle folgten.
Westlich von Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann versuchte, der Letzte zu sein, und schob seine erlahmenden Knappen mittels reiner Willenskraft vor sich her. Doch die schwächeren unter ihnen waren bereits völlig erschöpft. Einer, der ein wenig dicker war, als er eigentlich sein sollte, hielt plötzlich den schweren Atem an.
Der Feind war nur noch fünfzig Schritte entfernt. Und kam mit jedem Herzschlag näher.
»Lauf!«, brüllte Tom.
Der Junge übergab sich, warf einen Blick nach hinten und erstarrte.
Ein Kobold blieb stehen und feuerte einen Pfeil auf ihn ab.
Der Junge schrie auf, fiel in sein eigenes Erbrochenes und trat aus.
Tom warf sich den zuckenden Jungen über die Schulter und rannte weiter. Sein Schwert zuckte vor, erwischte einen Irk oberhalb des Knies, und das Wesen kreischte auf und fiel, während es sich die Wunde mit beiden Händen festhielt.
Der Hauptmann blieb stehen. Sie versuchten, ihn zu umzingeln. Er stieß auf den Nächsten ein und durchbohrte ihn, trug zwei Hiebe gegen seine Beinschienen davon. Und plötzlich hatte es doch etwas genützt, sie den ganzen Nachmittag hindurch getragen zu haben.
Innerhalb weniger Augenblicke waren es Hunderte von Kobolden. Sie schienen in erschreckender Anzahl geradezu aus dem Boden hervorzuquellen, bewegten sich wie Ameisen und bedeckten den Waldboden genauso schnell, wie er selbst zurückweichen konnte. Ihre gepanzerten Köpfe reichten ihm kaum bis zum Gürtel.
Hinter ihm hörte er Trompetenschall und Cuddys Stimme so klar und deutlich wie bei einer Parade: »Spannen! Und – Feuer!«
Der Hauptmann war noch auf den Beinen, aber in seinem linken Oberschenkel spürte er einen stechenden Schmerz. Dort hatte ein Kobold versucht, die Zähne in sein Fleisch zu graben, und seine Beine waren durch den Druck der Kreaturen fast unbeweglich geworden. Doch nun griff etwas durch den Äther nach seiner Seele.
Er geriet in Panik.
Und konnte nichts sehen. Die braunen Kobolde waren überall, klammerten sich so sehr an ihn, dass er nicht mehr kämpfen konnte, sondern nur noch versuchen, auf den Beinen zu bleiben. Der Druck des Phantasmas lag immer schwerer auf seiner Seele.
Dann hörte er durch den Helm und auch durch seine Angst hindurch das Zischen von Kriegspfeilen; es klang wie das Niedergehen von heftigem Eisregen.
Die Pfeile trafen.
Drei von ihnen trafen den Hauptmann.
Westlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn blieb auf dem Hügelkamm stehen und beobachtete die letzten Augenblicke der Feinde. Die Kobolde waren nicht so schnell wie die Irks, die bereits angriffen. Die Welle der Kobolde würde den Kampf beenden.
Sie würde jeden Kampf beenden.
Er bereitete einen Zauber vor, sammelte die rohe Macht der Natur in sich, die durch ein Gewebe aus Portalen und Kanälen floss, die nur halb begreifbar waren.
Am Fuß des Hügels blieb einer der Fliehenden stehen.
Thorn streckte seine innere Macht nach ihm aus, packte ihn und spürte, dass sein Wille an dem Mann abglitt wie Klauen an einem glatten Stein.
Und dann traten fünfzig feindliche Bogenschützen aus ihrem Versteck und erfüllten die Luft mit Holz und Eisen.
Westlich von Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann wurde mehr als ein Dutzend Mal getroffen. Stets war es wie der Tritt eines Esels. Die meisten Pfeile prasselten auf seinen Helm nieder, einer aber fuhr an der Innenseite seines Schenkels entlang und riss Hose und Unterhose auf. Er war blind vor Schmerz und von den andauernden Treffern ganz benommen.
Doch er steckte in einer Rüstung aus gehärtetem Stahl – im Gegensatz zu den Kobolden, die ihn zu töten versuchten.
Als jeder von Cuddys Bogenschützen sechs Pfeile abgeschossen hatte, wurde es in dem V-förmigen Bereich zwischen den Heckenschützen still. Nichts lebte dort mehr.
Cuddy befahl seinen Männern vorzustoßen und ihre Pfeile einzusammeln, während der Hauptmann sein Visier hochklappte. Er spürte, dass da noch etwas war …
Auf dem Hügelkamm zeigte sich eine Gestalt des Grauens, sodass alle sie sehen konnten, und hob die Arme …
Trotz seiner Panik war der Hauptmann noch handlungsfähig geblieben, denn er hatte schon so oft schreckliche Angst gehabt, dass er inzwischen an sie gewöhnt war.
Der Hauptmann berührte Prudentias Hand. Über seinem Kopf drehten sich die drei großen Ebenen seines Palastes wie Glücksräder.
Öffne nicht die Tür!, sagte Prudentia. Er befindet sich unmittelbar dahinter!
Der Hauptmann war bereit, das Opfer zu bringen, und riss die Tür auf.
Dahinter befand sich ein Wesen der Wildnis – unmittelbar vor der Tür zu seinem Geist.
Aus seinem Willen formte er einen langen, scharfen Dolch und rammte ihn in das Geschöpf; dabei lehnte er sich über die Schwelle.
Prudentia packte ihn.
Die Tür wurde zugeworfen.
»Du bist verrückt«, sagte sie.
In der wahren Welt geriet die große Gestalt auf dem Hügel ins Taumeln. Sie fiel nicht hin, aber die Gewalt ihrer Macht geriet ebenfalls ins Wanken. Und löste sich auf.
»Aufsitzen!«, brüllte der Hauptmann. Hinter der ungeheuerlichen Gestalt auf dem Hügel sah er wild umherzuckende, rasch sich nähernde Tentakel und frische Horden von Ungeheuern.
Das gewaltige Wesen, das zwei Baumzwillingen ähnelte, bäumte sich auf, und ein Blitz aus grünem Feuer bedeckte die Hügelflanke. Er reichte nicht so weit, wie der Hauptmann befürchtet hatte, doch einige Bogenschützen wurden in Asche und Knochen verwandelt. Ein Knappe brannte drei Herzschläge lang so grün wie eine scheußliche Stalllaterne, bevor er sich auflöste, und Dutzende verwundeter Kreaturen der Wildnis wurden dabei ebenfalls geopfert.
Hinter ihm stiegen die Männer hastig auf die Pferde, die ihnen von den Knappen gebracht wurden. Darin hatten sie die meiste Übung – im Fliehen.
Aber der Hauptmann spürte, dass der Feind noch mehr Feuer in sich hatte.
Er warf das Bein über Grendels Sattel und …
… gelangte zurück in den Palast.
»Ein Schild, Pru!«, rief er und zog die rohe Macht aus dem Sack, der an ihrem Arm hing, während sich die Sigille über ihm drehten – Xenophon, St. Georg, Widder.
Es war der erste Zauber, den ein Magister lernte. Das Ausmaß der Macht des Adepten.
Er schuf einen kleinen und geschmeidigen Schild und warf ihn seinem Gegner ins Gesicht.
Hinter ihm drängten die Korporale die Männer zur Eile, was kaum nötig war, und die ganze Truppe floh.
Der Hauptmann aber wendete Grendel und ritt in die andere Richtung, so schnell sein Pferd es erlaubte …
Das zweigehörnte Wesen streckte seinen Stab aus …
Der Schild des Hauptmanns aber – sein stärkster, kleinster, bester – verschwand wie eine Motte im Feuer einer Schmiede.
Der Hauptmann spürte, wie sich der Schild auflöste und fühlte die schiere Macht seines Gegners.
Schnell wie eine heranpirschende Katze trabte das Pferd des Hauptmanns auf den Feind zu und …
Er griff wieder in sich hinein, wob einen neuen Schildzauber, der Ross und Reiter bedeckte …
Das grüne Feuer floss wie eine Flutwelle über den Boden und verbrannte alles, was in seinem Weg lag. Es versengte Bäume, vernichtete Gras und Blumen, kochte Eichhörnchen in ihrem eigenen Fell. Es erfüllte die Luft vor Grendels Kopfpanzer …
Es war, als würde man zusehen, wie eine Sandburg unter der Macht der Meereswellen nachgab.
Sein zweiter Schild war schwächer, doch das grüne Feuer hatte sich bereits viele Hundert Ellen über den Boden gefressen, und seine Kraft verebbte. Doch trotzdem nagte es an dem Schild – zuerst langsam, dann immer schneller, als sich Grendel panisch aufbäumte, weil er sich allein in einem Meer aus glühendem Grün befand.
Er nahm alles zusammen – jede Faser aufgespeicherter Macht …
Er roch das brennende Leder, und er sah … Bäume. Aufrecht und schwarz.
Grendel wieherte und ging durch.
Er wollte nur noch schlafen, aber Cuddy brauchte Gewissheit. »Ihr seid in voller Rüstung gewesen …«, sagte der Meisterschütze.
»Das war eine gute Entscheidung«, stimmte ihm der Hauptmann zu.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass wir Euch so oft getroffen haben«, meinte Cuddy und schüttelte den Kopf. Während er redete, arbeitete Carlus, der Waffenmeister und Trompeter der Kompanie, mit Hitze und Kraft daran, die Dellen aus dem wunderschönen Helm des Hauptmanns zu entfernen.
»Ich werde mehr darauf achten, wem ich in der Zukunft Sonderaufgaben erteile«, meinte der Hauptmann.
Cuddy verließ das Zelt und murmelte etwas in sich hinein.
Michael half dem Hauptmann aus dem Rest seiner Rüstung. Die Brustplatte war an zwei Stellen stark beschädigt, die Armschienen hingegen wirkten unberührt.
»Wisch zuerst meine Klinge ab«, murmelte der Hauptmann. »Ich habe gehört, dass das Blut der Kobolde ätzend ist.«
»Kobolde«, sagte Michael und schüttelte den Kopf. »Irks. Magie.« Er holte tief Luft. »Haben wir gewonnen?«
»Frag mich das noch mal in einem Monat, junger Michael. Wie viele Männer haben wir verloren?«
»Sechs Knappen. Und drei Bogenschützen beim Rückzug, als dieses Wesen Feuer auf uns gespuckt hat.« Michael zuckte mit den Achseln.
Der Rückzug war zu einem Tumult geworden. Die meisten Männer waren blind vor Angst ins Lager geritten, als immer mehr Ungeheuer im Gefolge der feuerspeienden Schreckensgestalt auf den Hügel geklettert waren.
»Gut.« Der Hauptmann erlaubte es sich, einen Moment lang die Augen zu schließen, doch dann riss er sie wieder auf. »Ich muss der Äbtissin unbedingt Bericht erstatten.«
»Sie könnten uns erneut angreifen«, sagte Michael.
Der Hauptmann sah ihn eindringlich an. »Was immer sie sind, sie sind nicht vollkommen anders als wir. Sie kennen die Angst. Sie wollen nicht sterben. Heute haben wir sie verletzt.« Und sie haben uns verletzt. Ich war zu voreilig. Verdammt.
»Und was geschieht jetzt?«, fragte Michael.
»Wir schleichen uns in die Festung hinein. Dieses Ding wird kommen und uns belagern.« Langsam stand der Hauptmann auf. Einen Moment lang fühlte er sich, als könnte er fliegen, da er das Gewicht seiner Rüstung nicht mehr ertragen musste. Dann überfiel ihn die Erschöpfung wieder wie ein alter und böser Bekannter.
»Hilf mir«, sagte er.
Die Äbtissin empfing ihn unverzüglich.
»Anscheinend hattet Ihr recht. Eure Männer sehen sehr mitgenommen aus.« Sie wandte den Blick ab. »Das war unwürdig«, erlaubte sie sich zu sagen.
Ihm gelang ein Lächeln. »Mylady, Ihr solltet erst einmal den Zustand sehen, in dem sich unsere Feinde befinden.«
Sie lachte. »Ist das Großspurigkeit oder Wahrheit?«
»Ich glaube, wir haben etwa hundert Kobolde und fünfzig Irks getötet. Und vielleicht sogar ein paar Wildbuben. Und wir haben in das Hornissennest getreten.« Er runzelte die Stirn. »Ich habe ihren Anführer gesehen – eine große, gehörnte Kreatur. Wie ein lebendiger Baum und vollkommen bösartig.« Er zuckte die Achseln und versuchte seine Panik zu vergessen. Und seine Stimme ruhig zu halten. »Sie war gewaltig.«
Die Äbtissin nickte.
Er beschloss, über dieses Nicken erst später nachzudenken. Trotz seiner Erschöpfung erkannte er, dass sie etwas wusste.
Sie ging zum Kamin und nahm das seltsame Elfenbeinkästchen vom Sims. Dann öffnete sie es und ergriff die darin liegende Rinde. Sofort wurde sie tintenschwarz. Er spürte ihre Magie. Dann warf sie die Rinde ins Feuer.
»Was soll ich jetzt tun?«, fragte der Hauptmann. Er war so müde, dass er nicht mehr denken konnte.
Sie schürzte die Lippen. »Das müsst Ihr mir sagen, Hauptmann«, erwiderte sie. »Schließlich habt Ihr hier den Oberbefehl.«
Lissen Carak · Pater Henry
Pater Henry sah zu, wie der Söldner am Arm der Äbtissin die Treppe zur Großen Halle hinunterschritt, und seine Haut kräuselte sich, als er gewahren musste, wie sie von dieser Satansbrut berührt wurde. Der Mann war jung und schön, trotz all seiner Prellungen und der dunklen Kreise unter den Augen. Außerdem hatte er ein Gehabe an sich, von dem Pater Henry wusste, dass es nur Heuchelei sein konnte – der Wurm der Falschheit und vorgetäuschtes Mitgefühl.
Der große Söldner lachte bellend. Und dann erschienen der Sergeant und der Meisterwächter aus dem Bergfried.
Pater Henry kannte seine Pflichten – er durfte nicht erlauben, dass wichtige Entscheidungen ohne ihn getroffen wurden. Also ging er auf die Männer und die Äbtissin zu.
Der Meisterwächter rollte mit den Augen. »Hier ist für Euch nichts zu tun, Pater«, sagte er.
Der alte Soldat hatte ihn noch nie gemocht und war kein einziges Mal zur Beichte erschienen.
Der Söldner erwiderte jedoch seine Verbeugung höflich; allerdings stellte ihn die Äbtissin nicht vor und erlaubte dies auch keinem anderen. Sie deutete auf den Söldner. »Der Hauptmann ist jetzt der Kommandant dieser Festung. Ich erwarte, dass ihm alle die nötige Ergebenheit entgegenbringen.«
Der Meisterwächter nickte, und der Sergeant, der die kleine Garnison befehligte, verbeugte sich. Er war also ein möglicher Verbündeter.
»Mylady!« Pater Henry sammelte stumm seine Einwände. Seine Gedanken bildeten zusammen einen Aufruhr aus verworrenen Bildern und einander widersprechenden Absichten, doch sie wurden durch das Wissen geeint, dass diesem Mann niemals das Kommando über die Festung gegeben werden durfte. »Mylady! Dieser Mann ist ein Glaubensabtrünniger, ein unbußfertiger Sünder und nach seinen eigenen Angaben der Bastard einer unbekannten Mutter.«
Nun sah ihn der Söldner mit reptilienartigem Hass an.
Gut.
»Ich habe nie gesagt, dass meine Mutter unbekannt sei«, erklärte er mit milder Herablassung.
»Ihr dürft einen solchen Abschaum nicht in unsere Festung lassen«, sagte der Priester. Als die anderen ihren Geist vor ihm verschlossen, erkannte er, dass er zu heftig gewesen war. »Als Euer geistlicher Führer …«
»Pater, dieses Gespräch sollten wir zu einer passenderen Zeit und an einem anderen Ort weiterführen«, sagte die Äbtissin.
Wie er ihren Tonfall hasste! Sie sprach zu ihm – zu ihm, einem Mann, einem Priester –, als ob er ein streunendes Kind wäre, und für einen kurzen Augenblick musste das Ausmaß seines Zorns deutlich sichtbar gewesen sein, denn alle außer dem Söldner traten einen Schritt vor ihm zurück.
Der Söldner jedoch sah ihn an, als bemerke er den Priester nun zum ersten Mal, und nickte kurz.
»Ich habe das Gefühl, dass Ihr einen schweren Fehler begeht, Mylady«, setzte der Priester erneut an, doch sie drehte sich mit einer Schnelligkeit zu ihm um, die ihrem Alter Hohn sprach, und legte die Hand auf das Kreuz, das er vor der Brust trug.
»Ich verstehe, dass Ihr mit meiner Entscheidung nicht einverstanden seid, Pater Henry. Doch nun schweigt.« Er erstarrte unter ihrer eisigen Stimme.
»Ich werde nicht schweigen, solange die Macht des Herrn …«
»Me Dikeou«, zischte sie ihn an.
Dieses Biest setzte geheime Kräfte gegen ihn ein. Und er konnte nicht mehr sprechen. Es fühlte sich an, als wäre seine Zunge eingeschlafen. Nicht einmal mehr in Gedanken konnte er ein Wort formen.
Er taumelte zurück und hielt sich die Hände vor den Mund. All seine Vermutungen wurden damit bestätigt, und all seine nichtigen Irrtümer waren in diesem einen Augenblick zu Heldentaten geworden. Sie hatte Hexerei gegen ihn benutzt. Sie war eine Hexe – eine Verbündete des Satans. Wohingegen er …
Sie wandte sich ihm wieder zu. »Dies hier ist ein Notfall, Pater, und Ihr seid gewarnt gewesen. Kehrt in Eure Kapelle zurück und tut Buße für Euren Ungehorsam.«
Er floh.
Nördlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn schritt aus, so schnell ihn seine langen Beine trugen. Ein Schwarm Elfen umsummte seinen Kopf wie Insekten; sie nährten sich von der Macht, die an ihm klebte wie das Moos an einem Stein. »Wir machen weiter«, sagte er zu dem Dämon an seiner Seite.
Der Dämon blickte auf die zerstörten Zelte und die herumliegenden Leichen. »Wie viele hast du verloren?«, fragte er. Sein Kopfkamm bebte vor Aufregung.
»Verloren? Nur eine Handvoll. Die Kobolde sind jung und nicht auf einen Krieg vorbereitet.« Die große Gestalt schüttelte sich wie ein Baum im Sturm.
»Du bist selbst verwundet worden«, sagte Thurkan.
Thorn blieb stehen. »Ist das wieder eines deiner Spielchen um die Vorherrschaft? Einer der Feinde hat mich abgelenkt. Er hat ein wenig Magie zu Hilfe genommen, und ich habe zu langsam reagiert. Es wird nicht wieder vorkommen. Ihr Angriff hat keine Auswirkungen auf uns.«
Die große Gestalt wandte sich um und schlurfte nach Osten. Um sie herum packten die Irks und Kobolde ihre Sachen zusammen und bereiteten sich auf den Marsch vor.
Thurkan sprang wieder neben ihn; es fiel ihm nicht schwer, mit dem riesigen Magier Schritt zu halten. »Warum?«, fragte er. »Warum Albinkirk?«
Thorn blieb stehen. Es hasste es, ausgefragt zu werden, vor allem wenn es sich um einen Störenfried wie Thurkan handelte, der sich Thorn ebenbürtig fühlte, obwohl er doch bloß ein Dämon war. Am liebsten hätte er geantwortet: »Weil ich es so will.«
Aber es war nicht der rechte Moment für eine solche Antwort.
»Macht ruft Macht hervor«, sagte er stattdessen.
Thurkans Kopfkamm zitterte vor Zustimmung. »Und?«, fragte er.
»Die Irks und die Koboldhorden sind ruhelos. Sie sind hierhergekommen – bist du dafür verantwortlich, Dämon?« Thorn bückte sich zu ihm herunter? »Ja?«
»Gewalt ruft Gewalt hervor«, sagte Thurkan. »Menschen haben Geschöpfe der Wildnis getötet. Eine goldene Bärin wurde von Menschen versklavt. Das ist unerträglich. Auch mein Vetter wurde von ihnen ermordet, genau wie einer der Lindwürmer. Dabei sind wir doch die Wächter. Wir müssen handeln.«
Thorn hob seinen Stab. Sie bewegten sich nach Norden von der großen Festung weg, die undeutlich auf ihrem Felsvorsprung in der Ferne zu erkennen war.
»Mit der Streitmacht, über die wir verfügen, werden wir diesen Felsen niemals einnehmen«, sagte Thorn. »Aber es ist nicht mein Kampf. Allerdings sind wir verbündet, und deshalb werde ich euch helfen.«
»Indem du uns von dem wegführst, was wir zurückerobern wollen?«, fuhr ihn der Dämon an.
»Indem ich die Wildnis gegen ein würdiges Ziel ins Feld führe. Gegen ein erreichbares Ziel. Wir werden so sehr zuschlagen, dass es die Königreiche der Menschen erschüttern mag, und das wird ein mächtiges Signal an die Wildnis aussenden. Dann werden sie in großen Zahlen zu uns kommen. Ist es etwa nicht so?«
Thurkan nickte langsam. »Wenn wir Albinkirk niederbrennen, werden viele es erfahren, und viele werden zu uns stoßen.«
»Und dann«, fuhr Thorn fort, »werden wir die Streitmacht und die Zeit haben, uns gegen den Felsen zu wenden, während die Menschen auf den rauchenden Ruinen sitzen.«
»Und du wirst noch viel mächtiger sein, als du es jetzt schon bist«, fügte Thurkan misstrauisch hinzu.
»Wenn du und deinesgleichen wieder aus der Quelle des Felsens trinken und ihr euch in den Höhlen unter dem Felsen paart, dann werdet ihr mir danken«, sagte Thorn.
Gemeinsam gingen sie weiter.