7
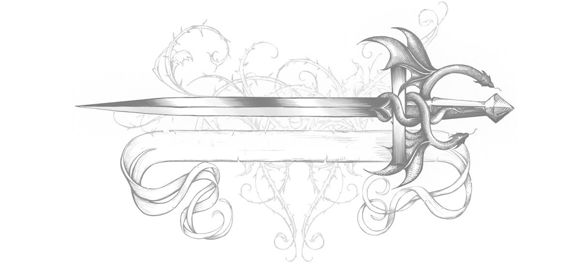
Südlich von Albinkirk · Meister Random
»Die Tore von Albinkirk sind aufgebrochen, Ser«, berichtete Guilbert und zuckte die Achseln. »In der Stadt brennt es, und es sieht aus, als hätte eine verdammte Teufelsfaust – Verzeihung für den Ausdruck – in die Kathedrale geschlagen. Das Banner des Königs flattert noch über der Burg, aber niemand hat auf mein Klopfen und Rufen reagiert.«
Der achtbare Tuchhändler John Judson und St. Paul Silver, ein Goldschmied, lenkten ihre Pferde näher an Random heran, der mit dem alten Bob, Guilberts Freund, sowie mit dem letzten Mann zusammensaß, den er angeworben hatte, einem kahlköpfigen, rotgesichtigen Trunkenbold, dessen Stimme und Benehmen andeuteten, dass die Sporen, die er an seinen Absätzen trug, tatsächlich ihm gehörten.
Der alte Bob war der älteste Mann in der Gruppe und hatte eine mehrfach gebrochene Nase, die vor fleischigen Ausbuchtungen ganz höckerig war. Sein zerzaustes, graumeliertes Haar spross nur noch in einem schmalen Kranz zwischen den Ohren und war immer schmutzig, doch die Augen des Mannes blickten tief und klug und außerdem ein wenig beunruhigend drein, was selbst ein so erfahrener Mann wie Gerald Random empfand.
Er trug eine gute Rüstung, die er niemals ablegte.
»Das zumindest haben die Bauern gestern schon gesagt«, bemerkte der alte Bob gelassen.
Random sah die anderen Handelsreisenden an. »Albinkirk liegt in Trümmern?«, fragte er. »Ich habe in diesen Gegenden schon einmal gekämpft, Freunde. Die Grenze liegt hundert Meilen weiter nördlich, und selbst dann … Die Wildnis befindet sich nicht hier in der Gegend, sondern nordwestlich von uns.«
»Aber irgendetwas muss diese Zerstörungen bewirkt haben«, sagte Judson. Seine Mundwinkel waren weiß, und er hatte die Lippen fest zusammengekniffen. »Ich bin der Meinung, wir sollten umkehren.«
Paul Silver trug Stiefel wie ein Edelmann. Goldschmiede waren oft besser gekleidet als ihre Kunden. So war es nun einmal in dieser Welt. Aber Silver hatte auch dem König gedient und trug ein schweres Schwert – eine kostbare Waffe, die er stets sorgfältig pflegte. »Wir wären doch Narren, wenn wir so täten, als sei nichts geschehen«, stimmte er zu. »Aber ich bin mir nicht sicher, ob eine Kolonne von fünfzig Wagen einfach umdrehen sollte, so schlimm die Lage auch sein mag.«
Bei der nächsten Flussbiegung erhob sich Albinkirk auf einem hohen Hügel. Später im Sommer, wenn die Fluten abgeschwollen und die Berge frei von Eis waren, würden es die Schiffe bis hierher schaffen. Dann trug der Strom keine Baumstämme mehr, die von den Berghängen herabgespült wurden und groß genug waren, um ein Loch in einen Schiffsrumpf zu stoßen. Albinkirk war die nördlichste Stadt, die noch auf dem Wasserweg zu erreichen war, und gleichzeitig war sie die südlichste am Rande des Großen Waldes, der die Berge überzog. Früher hatte sie den großen Jahrmarkt beherbergt, aber eine schlechte Leitung und räuberische Zölle hatten dazu geführt, dass er nun weiter östlich, beim Konvent von Lissen Carak, abgehalten wurde.
Und jetzt war Albinkirk nicht mehr als ein Leichnam. Die Häuser mit den roten Schindeldächern wirkten alt und grau oder waren vom Feuer geschwärzt, und der Turm der Kathedrale war verschwunden.
»Was ist mit der Kathedrale passiert?«, fragte Random.
Der alte Bob schnitt eine Grimasse. »Sie wurde von Drachen angegriffen. Oder von Satan höchstpersönlich.« Er zuckte mit den Schultern.
Random holte tief Luft. Für solche Augenblicke lebte er. Für die großen Entscheidungen. Für das Spiel.
»Wir könnten die Straße verlassen. Wir wenden uns auf dieser Seite des Flusses nach Osten und nehmen die Brücke bei Lissen Carak«, hörte er sich sagen. »Dann haben wir den Fluss zwischen uns und Albinkirk.«
»Lindwürmer lassen sich nicht von Flüssen abschrecken«, sagte der alte Bob.
»Uns bleibt ohnehin kaum eine Wahl«, meinte Guilbert. »Die Tore sind geschlossen, und so können wir die Hauptstraße nicht nehmen.«
»Vielleicht brauchen sie uns in der Stadt«, wandte Random ein.
Judson sah ihn an; in seinem Gesicht zeichnete sich etwas ab, das Random noch nicht kannte. Grauen? Angst? Neugier?
Schließlich nahm der Mann seinen Mut zusammen und sprach das aus, was er dachte. »Ich bringe meine Wagen zurück in Richtung Süden«, sagte er vorsichtig.
Random nickte. Judson hatte das zweitgrößte Kontingent – acht Wagen, die ein Sechstel des Gesamtbestandes ausmachten.
»Ich möchte auch meinen Anteil an den Söldnern mitnehmen«, fuhr Judson fort.
Random dachte kurz darüber nach und schüttelte dann den Kopf. »Wie kommt Ihr darauf, Messire?«
Judson zuckte mit den Achseln, aber in seinen Augen zeigte sich Wut. »Ich habe für acht Wagen in Eurer Karawane bezahlt«, erklärte er. »Das bezieht sich natürlich auch auf die Kosten der Söldner, also nehme ich vier von ihnen mit. Sechs wären allerdings besser.«
Random nickte. »Ich verstehe«, sagte er. »Aber so geht das nicht. Ihr habt Euch meiner Karawane für ein gewisses Entgelt angeschlossen. Natürlich könnt Ihr sie wieder verlassen; das ist Eure eigene Entscheidung. Aber Ihr habt keinen Anteil an der Karawane, sondern nur einen Platz in ihr gekauft.«
»Glaubt Ihr, der königliche Gerichtshof wird es genauso sehen?«, fragte Judson. Die Angst hatte ihn kühn werden lassen. »Ich werde in ein paar Tagen zurück sein und meine Geschichte erzählen.« Er zuckte die Schultern und wandte den Blick ab. »Gebt mir ein halbes Dutzend Schwerter, und ich werde nichts sagen.« Judson sah Paul an und beugte sich schließlich vor. »Wollt Ihr nicht Oberbürgermeister werden, Random? Dann solltet Ihr Euch allmählich an das Spiel gewöhnen.«
Random sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Nein. Ich will nicht mit Euch streiten, aber ich werde Euch kein Schwert mitgeben – und erst recht nicht sechs. Geht Eures Weges. Er sollte ziemlich sicher sein.«
»Ihr schickt mich ohne einen einzigen Kämpfer zurück?«, empörte sich Judson.
»Ich schicke Euch nicht zurück. Ihr geht von selbst. Es ist Eure Entscheidung.« Random sah Guilbert und den alten Bob an. »Oder hat noch jemand von euch kalte Füße bekommen?«
Der alte Bob kratzte sich an etwas Unbeschreiblichem, das auf seiner Nase wuchs. »Die Weiterreise wird zwar nicht einfach sein«, meinte er. »Aber ich muss nicht unbedingt zurückgehen.«
Guilbert sah den älteren Mann an. »Warum wäre es nicht gut?«, fragte er. »Wovon in drei Teufels Namen sprichst du?«
»Von Lindwürmern«, sagte der alte Mann. »Von Dämonen, Irks und Kobolden.« Er grinste und sah nun wahrhaft schrecklich aus. »Die Wildnis liegt vor uns.«
Der Palast von Harndon · Desiderata
Der Turnierplatz befand sich in einem vollendeten Zustand. Der Kies war sorgfältig ausgestreut und ohne den geringsten Makel, die Hindernisse waren frisch mit weißer Farbe gestrichen, wie der Zaun eines Bauern, wenn man von den modischen roten Pfosten an jedem Ende absah, die mit hell polierten Messingkugeln von der Größe einer Männerfaust geschmückt waren.
Die Zuschauerränge waren beinahe leer. Die Königin saß auf ihrem Sitz, die Hofdamen hatten sich um sie herum niedergelassen, und die jungen Ritter in den niederen Rängen warfen ihren Favoritinnen Frühlingsblumen zu.
Und dann gab es noch berufsmäßige Zuschauer – ein Dutzend Krieger, zumeist aus der Garnison der Bogenschützen. Rasch hatte sich die Nachricht verbreitet, der König sei von diesem ausländischen Ritter herausgefordert worden und wollte ihm nun ein oder zwei Dinge zeigen.
Desiderata sah, wie ihr Gemahl still neben der kleinen Holzhütte saß, in der er seine Rüstung angelegt und die Waffen ergriffen hatte. Gerade trank er ein wenig Wasser. Seine Haare waren lang und gepflegt, aber sogar auf diese Entfernung sah sie noch das Grau zwischen dem Dunkelbraun.
Am anderen Ende des Platzes leuchtete das Haar seines Gegners in undurchbrochenem Gold, im Gold des Sonnenuntergangs, im Glanz polierten Messings oder reifen Weizens.
Ser Jean beendete seine Vorbereitungen, worin sie auch immer bestanden haben mochten, und wechselte ein leises Wort mit seinem Vetter, während sein Knappe das größte Kriegspferd hielt, das die Königin je gesehen hatte. Es war ein wundervolles Geschöpf, dessen schimmerndes schwarzes Fell von keinerlei Flecken beeinträchtigt wurde und das einen roten Sattel und blaues, mit Rot und Gold abgesetztes Zaumzeug hatte. Ser Jeans Wappen, ein goldener Schwan auf rotem und blauem Feld, schmückte den Stirnteil seines Helms sowie den ausgepolsterten Wappenrock über seiner Rüstung, die schwere Decke auf dem Rücken seines Pferdes und den seltsamen kleinen Schild, der wie der Bug einer Kriegsgaleone geformt war und vor seiner linken Schulter ruhte.
Es war ein warmer Tag, vielleicht der erste wirklich warme Tag des Frühlings, und die Königin badete in der Sonne geradezu wie eine Löwin. Sie strahlte selbst ein Glühen aus, das ihre Hofdamen und sogar die Ritter auf den Sitzen unter ihr wärmte.
Heute sah der fremde Ritter recht oft zu ihr hinüber, so wie es ihr zustand.
Wieder warf sie einen Blick auf den König. Im Vergleich zu dem Fremden wirkte er klein und ein wenig schäbig. Seine Knappen waren die besten im ganzen Lande, doch er liebte seinen alten roten Waffenrock und seine schon so oft erneuerte Rüstung, die zu einer Zeit in den Bergen weit hinter dem Meer geschmiedet worden war, als gehärteter Stahl hierzulande noch unbekannt gewesen war. Seitdem wurde sie von seinem Waffenmeister immer wieder sorgfältig hergerichtet. Er liebte seinen alten roten Sattel mit den silbernen Spangen, und auch wenn sie schwarze Striemen auf dem Leder hinterließen, war es noch immer ein guter Sattel. Während der ausländische Ritter von Kopf bis Fuß neu eingekleidet und glänzend erschien, wirkte der König deutlich älter – abgenutzter.
Auch sein Pferd war kleiner. Der König nannte es Pater Jerome, und es hatte bereits fünfzig Turniere sowie ein Dutzend wirklicher Kämpfe hinter sich. Zwar besaß der König andere, jüngere Pferde, aber in den Kampf zog er immer auf Pater Jerome.
Der Herold und der Turniermeister riefen die beiden Ritter zum Wettkampf auf. Es war ein freundschaftliches Spiel; die Speere waren entschärft. Desiderata sah, wie Gaston, der Vetter des ausländischen Ritters, ein paar Worte zu dem König sagte und mit einer Verneigung auf seinen Hals deutete.
Der König lächelte und wandte sich ab.
»Er trägt keinen Ringkragen unter dem Halsschutz«, sagte ihr Ser Driant ins Ohr. »Der junge Gaston fragt nach dem Grund dafür und bittet den König, er möge ihn anlegen.« Er nickte anerkennend. »Sehr ordentlich. Sein Mann will hart kämpfen, und er möchte nicht angeklagt werden, den König verletzt zu haben. Ich würde genauso handeln, wenn mich der König herausgefordert hätte.«
»Der König hat ihn nicht herausgefordert«, sagte Desiderata.
Ser Driant schenkte ihr einen merkwürdigen Blick. »Da habe ich allerdings anderes gehört«, erwiderte er. »Aber ich vermute, der König wird ihn auf den Kies stoßen, und dann ist es vorbei.«
»Man sagt, der Ausländer sei der beste Ritter der Welt«, erwiderte die Königin ein wenig kalt.
Ser Driant lachte. »Das sagt man über jeden hübschen Ritter«, meinte er und sah Ser Jean an, der gerade mit einem Sprung aufsaß und seine Lanze entgegennahm. »Dieser Mann ist so groß wie ein Riese.«
Die Königin verspürte ein steigendes Unbehagen, wie sie es beim Anblick kämpfender Männer nie zuvor verspürt hatte. Sie saß auf ihrem Platz und spielte ihre Rolle. Es war ihre Pflicht, unparteiisch zu sein, wenn die gerüsteten Männer gegeneinanderprallten, und danach würde sie den besseren auszeichnen müssen. Vor allem musste sie vergessen, dass der eine ihr Liebhaber und König war und der andere ein ehrgeiziger Ausländer, der sie indirekt angeklagt hatte, unfruchtbar zu sein.
Sie sollte nur die Würde der Kämpfer bewerten.
Aber als die beiden Männer ihre Pferde rechts und links der Barriere aufstellten, spürte sie, wie sich ein Band um ihr Herz legte. Der König hatte vergessen, um ihre Gunst zu bitten, und sie hätte fast den Schal gehoben, den sie in der Hand hielt.
Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal zwei Männer hatte kämpfen sehen, ohne einem von ihnen – oder vielleicht beiden – vorher ihre Gunst zu erweisen.
Ser Jean trug einen fremdartig wirkenden Helm, eine runde Kesselhaube mit tief heruntergezogener Stirnplatte und einem schweren, hundeschnauzenartigen Visier und einem Kreuz Christi, das in Gold und Messing eingelassen war.
Der König trug einen spitz zulaufenden Helm, der für die Albier typisch war und ein ebenfalls spitzes Visier besaß, das »Schweineschnauze« genannt wurde, die Königin aber immer an einen Vogel erinnerte – an einen mächtigen Falken.
Während sie ihn ansah, schloss der König sein Visier mit einem deutlich hörbaren Klicken.
Etwas regte sich im Burghof. Soldaten reckten die Hälse, andere begaben sich zu den Mauern, noch andere sammelten sich beim Tor, hinter dem Rufe und galoppierende Pferde zu hören waren.
Die Königin betete nicht oft. Aber während sie den König beobachtete, legte sie die rechte Hand an den Rosenkranz um ihren Hals, betete zur Himmelskönigin und bat sie um ihre Gnade …
Zwei Pferde blitzten hinter dem Tor auf, galoppierten über die gepflasterte Straße zum Turnierplatz vor dem Burggraben, und die Reiter riefen etwas, während die Pferdehufe Funken schlugen, die sogar im hellen Sonnenschein zu sehen waren.
Sie spürte das Zusammenballen von Macht auf dem Turnierplatz, so wie sie die erste Konzentration von Harmodius’ nicht unbeträchtlicher Macht gespürt hatte. Doch das hier war die Macht einer anderen Art – wie grellweißes Licht an einem dunklen Tag.
Der fremde Ritter berührte die Flanken seines Pferdes mit den Sporen.
Der König trieb Pater Jerome beinahe im selben Augenblick an. Zu anderen Zeiten hätte sie applaudiert.
Die beiden Boten preschten Kopf an Kopf über die Straße neben dem Burggraben, während König und Ritter aufeinander zuritten.
Und Ser Jeans Pferd bäumte sich unter ihm auf, als eine große Pferdefliege ihren Stachel tief in die ungeschützte Nase des Tieres bohrte.
Das Kriegspferd geriet aus dem Takt und drehte sich von der Barriere weg. Ser Jean kämpfte darum, im Sattel zu bleiben und versuchte, den Kopf seines Reittieres wieder auf die Barriere zuzuwenden, aber es war hoffnungslos, und er war zu langsam geworden, um die Lanze noch mit ganzer Kraft zu führen. Er hob sie auf und warf sie fort, als sich das Pferd vor Schmerzen wieder aufbäumte.
Der König ritt weiter, hielt den Rücken völlig gerade, während Pater Jerome unter ihm ganz konzentriert war, und seine Lanze zielte wie der Pfeil eines antiken Gottes. Einen Fuß vor dem bugförmigen Helm Jean de Vraillys schwang die Lanzenspitze nach oben, riss ihm den heraldischen Schwan vom Helm, und dann donnerte der König an ihm vorbei, senkte die Lanze wieder und richtete sie auf die Messingkugel auf dem letzten Pfosten des Turnierfeldes. Er traf sie so hart, dass sie aus der Verankerung gerissen wurde, durch die Luft flog und dann an Ser Gaston und den beiden herannahenden Boten vorbei in den Burggraben rollte.
Die Königin klatschte Beifall, doch sie hatte das Gefühl, dass der König besser an seinem Gegner vorbeigeritten wäre, ohne ihm sein Wappen zu nehmen. Es wäre eine großzügige Haltung gewesen, wie sie zwischen Freunden üblich war, wenn einer der Ritter offensichtlich mit seinem Pferd zu kämpfen hatte.
De Vrailly ritt zu seinem Startplatz zurück; nun hatte er sein Pferd wieder unter Kontrolle.
Ein Dutzend königliche Bogenschützen rannten herbei, um sich zwischen den König und die beiden Reiter zu stellen, die nun unmittelbar auf ihn zukamen und etwas riefen, was noch nicht verständlich war. Beide hielten Schriftrollen mit bunten Bändern daran in den Händen.
Die Bogenschützen ließen sie schließlich durch, während der König sein Visier öffnete und die Boten herbeiwinkte. Er grinste wie ein kleiner Junge über seinen Sieg.
Die Königin war sich nicht sicher, ob dies ihrem Gebet zuzuschreiben war oder nicht, und so betete sie erneut, als die Boten den König erreicht hatten, abstiegen und vor ihm niederknieten, während seine Knappen ihm die Rüstung auszogen.
Am gleichen Ende des Turnierplatzes stieg Jean de Vrailly nur wenige Fuß entfernt ab. Sein Vetter sagte ein paar scharfe Worte zu ihm, doch der große Ritter beachtete den kleineren nicht weiter und zog sein Schwert so schnell, dass es fast nicht sichtbar war.
Sein Vetter schlug ihm heftig gegen den Ellbogen des Schwertarms, und das Schwert des fremden Ritters zitterte. Es war das erste Mal, dass sie ihn eine unbeholfene Bewegung machen sah. Er wandte sich seinem Vetter zu, der nicht vor ihm zurückwich.
Die Königin erkannte seine ungezügelte Wut und hielt den Atem an. Sie war ein wenig entsetzt darüber, dass der Gallyer so sehr die Beherrschung verloren hatte. Doch noch während sie ihn beobachtete, zügelte sich der Mann wieder. Sie sah, wie er den Kopf seinem Vetter zuwandte, als gestehe er ein, dass er beim Turnier unterlegen war.
Er drehte sich um und sagte etwas zu einem seiner Knappen.
Der Mann nahm die Zügel des mächtigen Pferdes und befreite es mithilfe von zwei Pagen vom Rossharnisch.
Sie war kurz abgelenkt, während sie zu begreifen versuchte, was sie soeben gesehen hatte.
Plötzlich war der König an ihrer Seite.
»Er ist sehr wütend«, sagte er und beugte sich über ihre Hand. Er wirkte ausgesprochen zufrieden, dass sein Gegner so unzufrieden war. »Hör mir zu, mein Liebstes. Die Festung bei Lissen Carak wird von der Wildnis angegriffen. Zumindest behaupten das diese beiden Boten.«
Sie setzte sich auf. »Erzähl mir mehr!«, forderte sie.
Ser Gaston kam herbei und näherte sich dem König mit der Ehrerbietung, die sein Vetter nicht einmal zeigte, wenn er niederkniete.
»Euer Gnaden …«, begann er.
Der König hob die Hand. »Nicht jetzt. Das Turnier ist für heute beendet, Mylord, und ich danke Eurem Vetter für diese sportliche Übung. Ich werde mit allen meinen Rittern nach Norden reiten, sobald ich sie eingesammelt habe. Eine meiner Burgen – und zwar nicht die unwichtigste – wird gerade angegriffen.«
Ser Gaston verneigte sich. »Mein Vetter bittet darum, dass er noch eine weitere Runde gegen Euch reiten darf.« Er verneigte sich abermals. »Und er wünscht Eure Gnaden wissen zu lassen, dass er die Reitkünste Eurer Gnaden zu schätzen weiß. Er schenkt Euch sein Reitpferd in der Hoffnung, Eure Gnaden werden es genauso gut abrichten wie sein eigenes Tier.«
Der König grinste wie ein Junge, der von seinen Eltern gelobt wird. »Ich liebe Pferde wirklich«, sagte er. »Ich muss das Pferd und die Waffen des guten Ritters zwar nicht haben, aber wenn er es mir anbietet …« Der König leckte sich die Lippen.
Ser Gaston nickte dem Knappen zu, der das abgezäumte Pferd herbeiführte. »Es gehört Euch, Euer Gnaden. Aber er bittet Euch darum, ein anderes Pferd nehmen und noch einmal gegen Eure Gnaden antreten zu dürfen.«
Das Gesicht des Königs verschloss sich, als wäre das Visier an seinem Helm plötzlich heruntergeklappt. »Er hat einen Waffengang gehabt«, sagte er. »Wenn er eine weitere Gelegenheit bekommen will, sich selbst zu beweisen, dann mag er seine Ritter sammeln und mit mir nach Norden reiten.« Der König schien noch etwas sagen zu wollen, hielt sich aber davon ab. Doch er erlaubte sich ein kleines, königliches Lächeln und fügte hinzu: »Sagt ihm, ich werde ihm gern ein Pferd leihen.«
Gaston verneigte sich. »Wir werden mit Euch reiten, Euer Gnaden.«
Doch der König hatte sich schon von ihm abgewandt und sprach nun die Königin an.
»Es ist schlimm«, sagte er. »Wenn der Schreiber dieses Briefes sein Handwerk versteht, dann steht es wirklich sehr schlimm. Wildbuben. Dämonen. Lindwürmer. Die ganze Macht der Wildnis hat sich gegen uns verbündet.«
Als die Hofdamen dies hörten, bekreuzigten sie sich.
Die Königin erhob sich. »Wir sollten diesen edlen Herren helfen«, sagte sie zu ihren Damen und küsste dabei das Gesicht des Königs. »Du wirst Wagen, Futter, Proviant und Wasser benötigen. Ich habe die Listen zur Hand. Du rufst deine Ritter zusammen, und ich werde den Rest vor dem Mittag erledigen.« Der Wind des Krieges – des richtigen Krieges mit all seinen Heldentaten, seiner Ehre und Pracht – blies die Begeisterung für den fremden Ritter weg. Er hatte das Turnier verloren.
Und ihr Liebhaber war der König. Er würde in den Krieg gegen die Wildnis ziehen.
Mit Anbetung im Blick sah er sie an. »Gesegnet seiest du«, flüsterte er. Und ihr König drehte sich um und rief nach seinem Vogt. Und nach dem Grafen von Towbray, der neben ihm stand.
Towbray besaß den Anstand, dem König ein schiefes Lächeln zu schenken. »Wie passend, dass ich meine gesamte Armee zur Hand habe, Euer Gnaden, und dass Ihr Eure Ritter zu einem Turnier versammelt habt.«
Für gewöhnlich hatte der König keine Zeit für Towbray, doch in diesem Augenblick hatten sie etwas gemeinsam. Der König klopfte dem anderen Mann auf die Schulter. »Wenn ich es nur geplant hätte«, sagte er.
Towbray nickte. »Meine Ritter stehen zu Euren Diensten.«
Der König schüttelte den Kopf. »Das ist das Dumme an Euch, Towbray. Immer wenn ich einen guten Grund gefunden habe, Euch zu verachten, unternehmt Ihr etwas dagegen. Und unglücklicherweise werdet Ihr bald wieder etwas tun, was diesen Eindruck erneut zunichtemacht.«
Towbray verneigte sich. »Ich bin, was ich bin, Euer Gnaden. Und in diesem Fall bin ich der Diener Eurer Gnaden.«
Er warf der Königin einen raschen Blick zu.
Sie bemerkte es nicht, da sie schon mit einer Liste der großen Wagen beschäftigt war, die in der Stadt Harndon zur Verfügung standen.
Doch der König folgte Towbrays Blick und verzog die Lippen.
Towbray hatte den König beobachtet. Es war einfach, ihn außer Acht zu lassen. Er schien keine tieferen Gefühle und auch keine Ziele zu haben, die über den Turnierplatz und das Bett seiner Frau hinausgingen.
Doch nun führte die Wildnis ihren Angriff, und der König hatte zufällig seine Ritter beisammen. Diese Art von Glück schien er andauernd zu haben.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann erwachte im Krankensaal der Abtei. Sein Kopf lag auf einem Federkissen, die Hände – die linke war sorgfältig mit einem Verband umwickelt – ruhten auf einem weißen Wolllaken, das über einem feinen Leinentuch lag. Die Sonne schien durch das schmale Fenster hoch über seinem Kopf, und der Lichtschaft beleuchtete Tom Schlimm, der im Bett gegenüber schnarchte. Im nächsten Bett lag ein Junge, der das Gesicht zur Wand gedreht hatte, und ihm gegenüber befand sich ein älterer Mann, dessen ganzer Kopf bandagiert war.
Er lag einen Augenblick lang still da und war seltsam glücklich, dann kamen die Erinnerungen flutartig zurück. Er schüttelte den Kopf, verfluchte Gott, setzte sich und stellte die Füße auf den Boden.
Bei seinen Bewegungen hob die diensttuende Schwester den Kopf. Bisher hatte er sie gar nicht bemerkt. Sie lächelte.
Es war Amicia.
»Hast du keine Angst, allein mit mir zu sein?«, fragte er.
Ihre Gelassenheit wirkte so fest wie eine Rüstung. »Nein«, antwortete sie. »Ich habe keine Angst vor Euch. Sollte ich sie haben?« Sie erhob sich. »Außerdem ist Tom gerade erst eingeschlafen, und der alte Harold, der an Aussatz leidet, hat einen sehr leichten Schlaf. Ich will darauf vertrauen, dass Ihr und die anderen ihn nicht stören wollt.«
Bei dem Wort »vertrauen« zuckte der Hauptmann zusammen. Er beugte sich zu ihr vor – sie duftete nach Olivenöl, Weihrauch und Seife – und musste den Drang bekämpfen, die Hände um ihre Hüften zu legen und …
Sie hielt den Kopf ein wenig schräg. »Denkt nicht einmal daran!«, sagte sie zwar scharf, allerdings ohne die Stimme zu erheben.
Seine Wangen brannten. »Aber du magst mich doch!«, erwiderte er. Es schien ihm das Dümmste zu sein, was er je gesagt hatte. Er riss sich zusammen, bot all seine Würde auf und dachte an seine Rolle als Hauptmann. »Sag mir, warum du mich jetzt wieder zurückweist«, wollte er wissen. Seine Stimme klang beherrscht, leicht und falsch. »Letzte Nacht hast du es nicht getan.«
Sie hielt seinem Blick stand und sah ihn ernst, ja beinahe streng an. »Sagt Ihr mir, warum Ihr beim Erwachen auf Gott flucht?«, fragte sie.
Das Schweigen zwischen ihnen dauerte lange, und währenddessen erwog er tatsächlich, es ihr zu sagen.
Sie ergriff seine linke Hand und machte sich daran, die Bandage auszuwickeln. Es tat weh. Kurze Zeit später öffnete Tom ein Auge. Dem Hauptmann gefiel es nicht besonders, ihm dabei zuzusehen, wie er ihre Hüften und Brüste bewunderte, als sie sich seitlich von ihm bewegte und ihm dabei manchmal den Rücken zudrehte.
Tom zwinkerte dem Hauptmann zu.
Der Hauptmann erwiderte das Zwinkern nicht.
Nachdem sie eine Salbe aus Oregano auf seine Hand geschmiert und diese wieder mit Leinen verbunden hatte, nickte sie. »Versucht doch, in Zukunft nicht mehr diese scharfen Bisse abzubekommen, wenn Ihr gegen böse Bestien kämpft, Messire«, sagte sie.
Er lächelte, sie lächelte, ihr Schweigen war vergessen, und er fühlte sich so leicht wie Luft. Es hielt die ganze steile Wendeltreppe hinunter an, bis er die dreiundzwanzig fest eingewickelten Bündel unter einem Baldachin in dem sonst leeren Innenhof sah.
Nach der Schlacht hatte die Äbtissin all ihren Untertanen befohlen, im Innern des Konvents zu bleiben. Außerdem wollte niemand mehr unter freiem Himmel schlafen, egal wie mild und frühlingshaft die Luft auch sein mochte. Der Gottesdienst wurde jetzt in einer Nebenkapelle gehalten; die Hauptkapelle war zum Schlafquartier geworden.
Er ging zu seinem Kommandoraum, wo er Michael antraf, der zusammen mit Ser Adrian, dem Schreiber der Truppe, über einem Schriftstück saß. Michael erhob sich steif und verneigte sich. Adrian schrieb weiter.
Der Hauptmann musste unwillkürlich über seinen Knappen lächeln, der offensichtlich nicht zu den Bündeln draußen im Hof gehörte. Seine Miene drückte die Frage, die er stellen wollte, anscheinend deutlich genug aus.
»Zwei gebrochene Rippen. Schlimmer als damals, als ich versucht habe, das Schlachtross meines Vaters zu reiten«, sagte Michael wehmütig.
»Auch wenn wir bei unserer Tätigkeit Mut und Kühnheit als selbstverständlich hinnehmen, muss ich doch sagen, dass du sehr tapfer gehandelt hast«, sagte der Hauptmann, und Michael glühte. »Dumm«, fuhr der Hauptmann fort und legte dem jungen Mann die Hand auf die Schulter, »und ein wenig sinnlos, aber tapfer.«
Michael strahlte noch immer vor Glück.
Der Hauptmann seufzte und trat an seinen Tisch, auf dem sich Schriftrollen und deren röhrenförmige Behälter türmten. Er fand den erneuerten Dienstplan, der vor Beginn eines jeden Monats erstellt wurde. Morgen war der erste Mai.
Warum hatte er überhaupt darüber nachgedacht, ihr zu verraten, warum er Gott verfluchte?
Die meisten Menschen waren dumm, aber er war nicht daran gewöhnt, zu ihnen zu gehören.
Er las den Dienstplan durch. Einunddreißig Lanzen – nein, dreißig, denn Hugo war tot, und so war seine Lanze zerbrochen. Er brauchte einen guten Ersatzkämpfer, aber hier in der Beinahe-Wildnis würde er wohl kaum einen finden. Doch vielleicht gab es örtliche Ritter – jüngere Söhne, die nach Ruhm strebten oder ein wenig Geld brauchten oder die vor einer Schwangerschaft davonliefen.
Die vielen Papiere ermüdeten ihn. Aber er brauchte mehr Männer, und da war noch die Wildnis, über die er nachdenken musste.
»Ich muss mit Tom Schlimm sprechen, sobald es ihm besser geht. Und mit den Bogenschützen von der letzten Nacht auch. Wer war der Älteste?«, fragte er.
Michael holte tief Luft. Der Hauptmann wusste, dass er mit diesem Atemholen die Schmerzgrenze berühren wollte, denn er hatte selbst schon viele Rippenbrüche erlitten.
»Langpfote war der Älteste. Er ist wach – ich habe ihn essen sehen.«
Der Hauptmann hob die Hand. »Ich werde ihn zusammen mit Tom befragen – falls der schon den Krankensaal verlassen kann.« In seiner Hand pochte es. Er setzte seine Initialen unter die Dienstliste. »Hol sie her, bitte.«
Michael zögerte, und der Hauptmann schluckte einen Seufzer der Verärgerung herunter. »Ja?«
»Was … was ist in der letzten Nacht passiert?«, wollte Michael wissen. »Die Männer haben das Gefühl, dass wir einen großen Sieg errungen haben, aber ich weiß nicht einmal, was wir eigentlich getan haben. Außer dem Töten der Lindwürmer natürlich«, sagte er mit der natürlichen Herablassung der Jugend.
Am liebsten hätte ihm der Hauptmann zugeschrien: Wir haben zwei Lindwürmer getötet, du nutzloser Geck! Aber er verstand die Haltung des Jungen, auch wenn sie unausgesprochen blieb.
Der Hauptmann setzte sich vorsichtig auf einen hochlehnigen Klappstuhl, der aus einer Reihe von miteinander verbundenen Bögen bestand. Es war ein wunderschöner Stuhl mit einem roten Samtkissen, das ihn willkommen hieß, und er lehnte sich zurück. »Fragst du das als der Lehrling des Hauptmanns? Oder als mein Knappe?«
Michael hob eine Braue. »Ich bin der Lehrling des Hauptmanns.«
Der Hauptmann schenkte dem Jungen ein schwaches Lächeln. »Gut. Dann sage mir, was wir deiner Meinung nach getan haben.«
Michael schnaubte verächtlich. »Das habe ich kommen sehen. Also gut. Den ganzen Tag über haben wir Patrouillen ausgesandt, um die Bauern herbeizuholen. Zuerst ist es mir nicht klar gewesen, aber tatsächlich sind mehr Patrouillen ausgezogen als zurückgekommen.«
Der Hauptmann nickte. »Gut. Ja. Wir werden die ganze Zeit hindurch beobachtet. Aber die Kreaturen, die uns ausspähen, sind nicht besonders schlau. Besitzt du ein wenig Macht?«
Michael zuckte die Achseln. »Ich habe sie studiert, aber ich kann unmöglich all die Bilder in meinem Kopf behalten. All die Phantasmata.«
»Wenn du ein Tier einfängst und es deinem Willen unterwirfst, kannst du durch seine Augen sehen. Das ist ein mächtiges Phantasma, aber es benötigt sehr viel Kraft. Denn zuerst musst du den Willen einer anderen Kreatur überwinden – das ist äußerst anstrengend –, und dann musst du sie lenken. Und in unserem Fall musst du es über eine große Entfernung hinweg tun.«
Michael lauschte gefesselt. Sogar Ser Adrian hatte aufgehört zu schreiben.
Der Hauptmann warf ihm einen Blick zu, und der Schreiber schüttelte den Kopf und machte sich daran aufzustehen. »Entschuldigung«, murmelte er. »Nie redet jemand über solche Sachen.«
Der Hauptmann entspannte sich. »Bleibt hier. Es ist ein Teil unseres Lebens und unserer Art der Kriegsführung. Wir benutzen Späher, weil wir keinen Magus zur Hand haben, der Vögel einsetzen könnte. Selbst wenn wir einen hätten, würde ich lieber menschliche Späher nehmen. Sie können beobachten und Bericht erstatten, sie können die Stärke der feindlichen Kräfte abschätzen und mitteilen, ob sie immer dieselben Pferde sehen oder nicht. Ein Vogel kann diese Dinge nicht abschätzen, und die Wahrnehmung des Magiers durch die Augen des Vogels wird … gefiltert.« Der Hauptmann ließ die Schultern hängen. »Ich weiß nicht, was es ist, aber ich stelle es mir wie ein Rohr vor, das zu klein ist für all die Einzelheiten, die hindurchgelangen sollen – als würde man alles durch Wasser oder Nebel sehen.«
Michael nickte.
»Die Wildnis schickt keine Späher aus, also nehme ich an, dass unser Feind Tiere als Spione einsetzt. Wir haben eine Menge Vögel gefangen und sie dazu genutzt, ihn in die Irre zu führen.« Der Hauptmann verschränkte die Hände hinter dem Kopf.
»Und wir haben Herdfeuer verwendet. Das habt Ihr mir gesagt.« Michael beugte sich vor.
»Gelfred befindet sich nicht unten in der Brückenburg – zumindest nicht mehr. Er steckt draußen in den Wäldern und beobachtet ihre Lager. Das macht er schon, seit wir erkannt haben, dass uns der größte Teil der feindlichen Streitkräfte umzingelt hat. Willst du etwas Tapferes hören? Ich habe Patrouillen mit einer Waffe ausgesandt, wie sie die Moreaner anfertigen. Sie besteht aus Olivenöl, Erdnussöl oder Walöl – was immer man bekommen kann, sowie aus Pech, Schwefel und Salpeter. Dutzende verschiedener Mischungen existieren, aber jeder Feuerwerker kennt sie. Sie ergeben ein kaum zu löschendes Feuer.«
Michael nickte. Der Schreiber bekreuzigte sich.
»Sogar die Kreaturen der Wildnis schlafen. Sogar der Adversarius ist nicht mehr als eine Kreatur. Und wenn sie sich zusammentun und die Menschen angreifen, dann ist es nur verständlich, dass sie ein Lager haben. Reden sie miteinander? Versammeln sie sich um das Lagerfeuer herum? Spielen sie Karten? Kämpfen sie untereinander?« Der Hauptmann schaute aus dem Fenster. »Hast du dir je darüber Gedanken gemacht, Michael, dass wir einen gnadenlosen Krieg gegen einen Feind führen, den wir überhaupt nicht verstehen?«
»Ihr habt ihn also beobachtet und sein Lager angegriffen«, sagte Michael mit großer Befriedigung. »Und wir haben ihnen einen schweren Schlag versetzt.« Nun lächelte er.
»Ja und nein. Vielleicht haben wir sie nicht einmal berührt«, sagte der Hauptmann. »Vielleicht haben Tom Schlimm und Mutwill Mordling nur ein paar bedeutungslose Zelte in Brand gesteckt, und die anderen sind unseren Jungs bis hierher gefolgt und haben uns wesentlich schwerer getroffen. Schließlich haben sie dreiundzwanzig Menschen getötet und dabei selbst nur zwei Lindwürmer verloren.«
Michaels Lächeln erstarb. »Aber …«
»Ich will dir klarmachen, dass Sieg und Niederlage lediglich eine Frage der Betrachtung sind, es sei denn, du bist tot. Du weißt, dass jeder Mann und jede Frau in unserer Truppe – in der ganzen Festung – der Meinung ist, wir hätten einen großen Sieg errungen. Wir haben das Lager des Feindes in Brand gesteckt, und dann haben wir zwei seiner schrecklichsten Ungeheuer in unserem eigenen Lager getötet.« Der Hauptmann stand auf, als Michael nickte.
»Und wegen dieser Wahrnehmung wird jedermann härter und länger kämpfen und tapferer sein, trotz meines verdammten Fehlers, Zivilisten in den Burghof zu lassen, was uns dreiundzwanzig Leben gekostet hat. Und trotzdem gewinnen wir.« Der Hauptmann sah Michael eindringlich an. »Verstehst du?«
Michael schüttelte den Kopf. »Es war nicht Eure Schuld …«
»Doch, es war meine Schuld«, wandte der Hauptmann ein. »Ich bin nicht im moralischen Sinn der Schuldige, denn ich habe sie nicht umgebracht. Aber ich hätte sie am Leben erhalten können, wenn ich an jenem Abend nicht abgelenkt gewesen wäre. Und es ist meine Pflicht, jedermann am Leben zu erhalten.« Er richtete sich auf und nahm seinen Kommandostab in die Hand. »Das ist etwas, das du unbedingt wissen musst, wenn du einmal Hauptmann sein willst. Du musst in der Lage sein, der Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Ich habe das Leben der anderen weggeworfen. Ich darf mich deswegen nicht quälen, aber ich darf es auch nicht vergessen. Das gehört zu meinen Aufgaben. Verstanden?«
Michael nickte noch einmal und schluckte.
Der Hauptmann verzog das Gesicht. »Ausgezeichnet. Und hier endet die Lektion über den Sieg. Wenn es dir nicht zu viele Umstände bereitet, würde ich jetzt gern mit Langpfote und Tom Schlimm sprechen, bitte.«
Michael stellte sich vor ihn und salutierte. »Sofort!«
»Hm«, meinte der Hauptmann nur.
Langpfote war fünfzig Jahre alt, sein rotes Haar war ergraut und nur noch ein Kranz um den sonst kahlen Schädel, doch er trug einen gewaltigen Schnauzbart und dichte Koteletten, sodass er mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf hatte. Seine Arme waren unnatürlich lang, und obwohl er Bogenschütze war, galt er gleichzeitig als der beste Schwertkämpfer der Truppe. Den Gerüchten zufolge war er einmal ein Mönch gewesen.
Er schüttelte dem Hauptmann die Hand und grinste. »Das war ein wenig zu aufregend.«
Nach ihm kam Tom Schlimm herein. Er war einen Kopf größer als der Hauptmann und der Bogenschütze, und sein eisengraues Haar passte seltsam schlecht zu seinem schwarzen Spitzbart. Er hatte eine so massige Stirn, dass sein Kopf wie der Bug eines Schiffes wirkte. Niemand würde ihn je einen schönen Mann nennen. Sogar im hellen Tageslicht wirkte er unheimlich, obwohl er jetzt nur ein Hemd trug und sich in ein Laken aus dem Krankensaal gehüllt hatte. Er gab dem Hauptmann und dem Bogenschützen die Hand, grinste Ser Adrian an und senkte seinen gewaltigen Körper auf einen der Scherenstühle.
»Guter Plan«, sagte er zu dem Hauptmann. »Ich hatte eine Menge Spaß.«
Michael schlüpfte herein. Zwar hatte ihn niemand dazugebeten, aber seine Miene verriet, dass ihm auch niemand gesagt hatte, er solle fernbleiben.
»Hol jedem einen Becher Wein«, sagte der Hauptmann und deutete damit an, dass der Knappe nicht völlig unwillkommen war.
Als fünf Hornbecher auf fünf Armlehnen standen und Ser Adrian mit dem Schreiben aufgehört hatte, kostete Tom den Wein, lehnte sich zurück und sagte: »Wir haben ihnen hart zugesetzt. Da gibt es nicht viel zu berichten. Das Schwierigste war, dorthin zu kommen. Die Jungs waren ziemlich nervös, und jeder Schatten hatte einen Irk oder Kobold in sich, sodass ich einmal geglaubt hab, ich müsste Tippit in zwei verdammte Hälften hacken, damit er endlich das Maul hält. Also hab ich mich über ihn gebeugt …«
Langpfote grinste. »Hat sich mit diesem Riesendolch in seiner Faust über ihn gebeugt!«
»Und Tippit hat sich bepisst«, sagte Tom Schlimm mit deutlicher Zufriedenheit. »Von jetzt an nenne ich ihn Pissit.«
»Tom!«, warnte ihn Langpfote.
Tom zuckte die Achseln. »Wenn er das nicht ertragen kann, dann sollte er Laken weben oder als Taschendieb arbeiten. Er ist ein verdammt armseliger Bogenschütze, und eines Tages wird noch jemand wegen ihm sterben. Wie dem auch sei, wir sind den größten Teil der Strecke bis dorthin geritten, und wir sind schnell vorangekommen, weil Ihr gesagt habt …« Tom Schlimm hielt inne; offenbar waren ihm die Worte ausgegangen.
»Euer einziger Vorteil wird die Schnelligkeit sein.« Einer von Hywels vielen Sinnsprüchen.
»Das habt Ihr gesagt«, stimmte Tom ihm zu. »Wir haben uns nicht zu sehr geschunden, aber wir haben es ihnen gezeigt. Falls sie Wachen hatten, haben wir keine gesehen, und dann waren wir schon zwischen ihren Lagerfeuern. Ich habe eine Menge von diesen schlafenden Viechern aufgeschlitzt«, sagte er mit einem schrecklichen Grinsen. »Die dummen Dinger haben geschlafen, während ein Mörder unter ihnen war.«
Gewissensbisse gab es in Toms Welt nicht. Der Hauptmann zuckte zusammen. Der große Mann sah Langpfote an. »Ich bin sehr fleißig gewesen. Das kannst du bestätigen.«
Langpfote hob eine Braue. »Alle Bogenschützen hatten einen Beutel mit Alchemie auf dem Rücken. Ich habe den meinen in ein Feuer geworfen. Das hat das Fest sozusagen eingeläutet.« Er nickte. »Es war spektakulär. Wenn es das richtige Wort ist.« Langpfote war offenbar sehr stolz darauf.
Tom nickte. »Hat uns viel Licht gegeben«, sagte er. Diese Worte waren im Zusammenspiel mit seinem Aussehen so schrecklich, dass Langpfote den Blick von ihm abwandte.
»Wir haben keine Zelte gesehen. Aber Männer haben auf dem Boden geschlafen – und auch diese Viecher. Und Tiere – Pferde, Nutzvieh, Schafe. Und da standen Wagen. Dutzende. Entweder sie sind auf die Karawanen getroffen, die zum Jahrmarkt wollten, oder ich bin ein Gallyer.«
Der Hauptmann nickte.
»Wir haben alles niedergebrannt, die Tiere und auch alle Viecher getötet, die wir gekriegt haben.«
»Was für Viecher denn? Kobolde? Irks? Sagt es mir«, befahl der Hauptmann. Die Worte hingen in der Luft zwischen ihnen.
Tom verzog das Gesicht. »Kleine. Hauptsächlich Kobolde und Irks. Ihr wisst schon. Nachtmahre und Dämonen haben uns verfolgt. Diese verdammten Dämonen sind schnell. Ich habe gegen einen goldenen Bären gekämpft.« Er schneuzte sich in die Hand und schleuderte den Inhalt aus dem Fenster. »Aber ich hab nicht die Gelegenheit gehabt, gegen einen Dämon zu kämpfen«, sagte er bedauernd.
Der Hauptmann fragte sich, ob es auf dieser Welt noch einen anderen Menschen gab, der es bedauerte, keiner der furchtbarsten Schreckensgestalten dieser Welt gegenübergestanden zu haben.
Aber Tom Schlimm war nicht so wie die anderen Menschen.
»Wie viele sind es insgesamt gewesen? Was steht uns noch bevor?«, wollte der Hauptmann wissen.
Langpfote zuckte die Schultern. »Es war dunkel und im Feuerschein schwer zu schätzen, Hauptmann. Meine Worte sind vielleicht nichts wert, aber ich sage, wir haben etwa fünfzig Menschen und noch mehr von diesen Viechern umgebracht. Und dabei haben wir bloß mal in den Ameisenhaufen getreten – bildlich gesprochen.«
Tom sah Langpfote anerkennend an. »Wie er gesagt hat. Wir haben in den Ameisenhaufen getreten. Aber wir haben ziemlich fest zugetreten.«
»Ihr beiden habt fünfzig Wildbuben umgebracht!«, platzte Michael hervor.
Tom sah ihn an, als hätte er gerade einen schlechten Geruch bemerkt. »Wir hatten Hilfe, Jungchen. Und das waren nicht alles Wildbuben. Ich weiß nicht genau, wie viele ich getötet habe – fünf? zehn? –, bis ich bemerken musste, dass sie alle aneinander gekettet waren. Arme Kerle.«
Michael gab ein ersticktes Geräusch von sich. »Gefangene?«, brachte er mühsam hervor.
Tom zuckte die Schultern. »Ich denk schon.«
Michaels Wut war deutlich zu sehen, und so hob der Hauptmann die Hand und deutete auf die Tür. »Mehr Wein«, sagte er. »Und lass dir Zeit.«
Langpfote schüttelte den Kopf, als der junge Mann den Raum verließ. »Nicht für mich, Hauptmann. Das macht mich zu schläfrig.«
»Ich bin sowieso fertig«, sagte der Hauptmann. »Das sind bessere Ergebnisse, als ich vermutet hatte. Danke.«
Langpfote schüttelte wieder seine Hand. »Dass wir das noch erleben durften, Hauptmann!«
Der Schreiber schaute auf seinen Stift. »Ich werde es gleich aufzeichnen«, sagte er, schenkte Langpfote zum Abschied noch einen eingehenden Blick und ging ebenfalls zur Tür.
Nun war der Hauptmann mit Tom Schlimm allein, der die nackten Beine unter seinem Laken ausstreckte und einen großen Schluck Wein nahm.
»Dieser Michael ist zu weich für unser Leben«, sagte Tom. »Er versucht es, und er ist nicht wertlos, aber Ihr solltet ihn gehen lassen.«
»Er hat keinen Ort, zu dem er gehen könnte«, wandte der Hauptmann ein.
Tom nickte. »Das hatte ich schon befürchtet.« Er nahm noch einen Schluck und grinste. »Dieses Mädchen – die Nonne?«
Der Hauptmann sah ihn ausdruckslos an.
Doch Tom ließ sich nicht zum Narren halten. »Nicht mit mir. Sie fragt Euch, warum Ihr Gott verflucht. Wenn Ihr meinen Rat hören wollt …«
»Will ich aber nicht«, unterbrach ihn der Hauptmann.
»Rammt ihr das Knie zwischen die Beine, und behaltet es da, bis Ihr in ihr steckt. Ihr wollt sie – und sie will Euch. Es wäre also keine Vergewaltigung.« Tom sagte das mit einer wissenden Geschäftsmäßigkeit, die noch schlimmer als das Eingeständnis war, Gefangene umgebracht zu haben. »Ich will nur sagen, dass Ihr – wenn Ihr das schafft – stets ein warmes Bett haben werdet, solange Ihr hierbleibt.« Er zuckte die Achseln. »Ein warmes Bett und eine weiche Schulter. Gut für einen Kommandanten. Keiner der Jungs wird es Euch übelnehmen.« Etwas Unausgesprochenes klang dabei ebenfalls an. Einige der Jungs würden Euch dann in einem besseren Licht sehen.
Tom nickte dem Hauptmann zu, der das Aufwallen einer schwarzen Wut in sich spürte. Er versuchte sie zu formen und nutzbar zu machen, aber sie war wie das Gebräu, das sie gegen den Feind eingesetzt hatten. Ölig schwarz, und wenn es auf Feuer traf …
Tom Schlimm holte tief Luft und sagte: »Ich bitte um Entschuldigung, Hauptmann.« Er sagte es mit der gleichen Sicherheit, mit der er alles andere sagte. »Ich fürchte, ich bin zu weit gegangen.«
Der Hauptmann schluckte Galle. »Glühen meine Augen etwa?«, fragte er.
»Ein bisschen«, antwortete Tom. »Wisst Ihr, was mit Euch nicht stimmt, Hauptmann?«
Der Hauptmann stützte sich auf dem Tisch ab; seine Wut ebbte ab und hinterließ Erschöpfung und einen Kopfschmerz von archaischen Ausmaßen. »Vieles.«
»Ihr seid ein Verrückter, wie ich auch. Ihr seid nicht wie die anderen. Was mich angeht, so nehme ich mir das, was ich haben will, und lasse den Rest in Ruhe. Aber Ihr wollt von jedermann geliebt werden.« Tom schüttelte den Kopf. »Unsereins wird nicht geliebt, Hauptmann. Selbst wenn ich ihre Feinde töte, lieben sie mich nicht. Oder? Wisst Ihr, was ein Sündenesser ist?«
Diese Frage kam wie aus dem Nichts. »Ich habe den Begriff schon mal gehört.«
»Wir haben solche in den Bergen. Normalerweise handelt es sich um irgendeinen armen Bastard mit nur einem Auge oder ohne Hände. Oder um irgendeine andere Missgeburt. Wenn ein Mann stirbt – oder eine Frau –, legen wir ein Stück mit Wein getränktes Brot auf den Leichnam. Entweder auf den Bauch oder über das Herz. Und der arme Kerl kommt dann und isst das Brot und nimmt alle Sünden des Toten damit auf sich. So kann der Tote in den Himmel einfahren, und der arme Kerl fährt zur Hölle.« Nun war Tom in Gedanken weit entfernt. So hatte ihn der Hauptmann noch nie gesehen. Es war seltsam und ein wenig beängstigend, mit Tom näher bekannt zu sein.
»Wir sind allesamt Sündenesser – jeder Einzelne von uns«, sagte Tom. »Ihr und ich auf alle Fälle, aber auch Langpfote und Mutwill Mordling und Ser Hugo und Ser Milus und der ganze Rest. Sogar Pampe. Und dieser Junge. Wir essen die Sünden der anderen. Wir töten ihre Feinde, und dann schicken sie uns weg.«
Blitzartig sah der Hauptmann wieder den Dämon, der sein Pferd ausweidete. Wir essen ihre Sünden. Die Worte hatten ihn wie ein Donnerschlag getroffen, also lehnte er sich zurück. Als er diesen Gedanken beendet hatte, der wie ein Wasserfall auf ihn herabgeströmt war und seine anderen Gedanken in alle möglichen Richtungen gelenkt hatte, bemerkte er, dass sich die Schatten verändert hatten. Sein Weinbecher war schon lange leer, Tom Schlimm war gegangen, seine Beine waren steif, und seine Hand schmerzte.
Michael stand mit einem Becher Wein in der Tür.
Lächelnd tauchte der Hauptmann aus seinem Tagtraum auf, zuckte die Achseln und nahm den Wein entgegen.
Er trank.
»Jacques ist mit Getreide zur Brückenburg gegangen und mit einer Botschaft von Messire Gelfred für Euch zurückgekommen«, sagte Michael. »Es sagt, er muss dringend mit Euch sprechen.«
»Dann sollte ich wohl wieder mein Geschirr anlegen«, sagte der Hauptmann. Selbst in seinen Ohren klang es jämmerlich. »Bringen wir es hinter uns.«
Die Straße nach Albinkirk · Ser Gawin
Er hatte jedes Zeitgefühl verloren.
Er war sich nicht mehr sicher, was er überhaupt war.
Gawin ritt durch einen weiteren Frühlingstag, umgeben von Teppichen aus Wildblumen, die wie Morgennebel unter seinem Pferd dahinströmten, in Büscheln und Hügeln dahinrollten, tausend vollkommene Blüten bei jedem Blick, blau und purpurn, weiß und gelb. In der Ferne erschuf der Sonnenglast einen Teppich aus Gelb und Grün auf den Berghängen, die mit jedem Tag näher rückten. Ihre Gipfel waren wie ein Gobelin hinter den Bäumen des immer dichter werdenden Waldes.
Nie zuvor hatte er Blumen die geringste Beachtung geschenkt.
»Ser Ritter?«, fragte der Junge mit der Armbrust.
Er sah den Jungen an, und dieser zuckte zusammen. Gawin seufzte.
»Ihr habt Euch nicht bewegt«, sagte der Junge.
Gavin drückte seine Sporen in die Flanken des Pferdes, verlagerte sein Gewicht, und sein Schlachtross trottete davon. Das dunkle lederne Zaumzeug, das einmal sehr schön gewesen war, war inzwischen vom Tod von fünfzigtausend Blumen befleckt, denn Erzengel – so hieß sein Pferd – fraß jede Blume, an die er kommen konnte, sobald er sicher war, dass ihn die Hände an den Zügeln nicht davon abhalten würden. Das also bedeutete Gawins Elend für sein Kriegspferd – noch mehr Blumen zum Fressen.
Ich bin ein Feigling und ein schlechter Ritter. Gawin blickte auf sein Leben der Gesetzesübertretungen zurück und versuchte herauszufinden, an welchem Punkt es schiefgelaufen war. Wieder und wieder kam er zu einem besonderen Augenblick. Zur Folterung seines älteren Bruders. Sie hatten sich zu fünft gegen Gabriel zusammengeschlossen. Hatten ihn geschlagen. Das Vergnügen, das darin gelegen hatte … seine Schreie …
Hat es damals angefangen?, fragte er sich selbst.
»Ser Ritter«, fragte der Junge erneut.
Das Pferd hatte den Kopf gesenkt, und sie waren wieder stehen geblieben.
»Ja«, murmelte Gawin. In seinem Rücken rollte die Kolonne, die er nicht bewachte, nach Norden, und Gawin sah vor sich die Große Kurve, hinter der die Straße nach Westen führte.
Nach Westen, auf den Feind zu. Nach Westen, wo die Burg seines Vaters wartete – mit dem Hass seiner Mutter und der Angst seines Bruders.
Warum gehe ich nach Westen?
»Ser Ritter?«, fragte der Junge abermals. Diesmal lag Angst in seiner Stimme. »Was ist das?«
Gawin schüttelte sich aus seinem Tagtraum. Der Junge des Goldschmieds – Adrian? Allan? Henry? – wich vor einer Baumgruppe zu seiner Linken zurück.
»Da ist etwas«, sagte er.
Gawin seufzte. Die Wildnis war nicht hier. Sein Pferd stand auf Wildblumen – noch im letzten Jahr war dieses Feld gepflügt worden.
Dann sah er den krankhaft bleichen, gleichzeitig hellbraunen Arm, glänzend wie eine Küchenschabe, der einen Speer mit einer Steinspitze hielt. Er sah das Wesen, und das Wesen sah im selben Augenblick ihn. Mit der Macht der Gewohnheit, die aus langen Übungen herrührte, beugte er sich nach links und riss sein Langschwert aus der Scheide.
Der Kobold warf seine Waffe.
Gawin zerhieb den Schaft mitten in der Luft.
Der Kobold stieß einen dünnen Wutschrei aus, wich vor seiner Beute zurück, und der Goldschmiedsjunge erschoss ihn. Seine Armbrust ging mit einem knallenden Geräusch los, und der Bolzen traf die Kreatur mit einem nassen, dumpfen Laut und trat auf der anderen Seite unter aufspritzendem Blut wieder aus. Das kleine Wesen des Grauens sackte schlaff auf die Wildblumen und starb genauso schnell wie eine Forelle an Land. Mit seinem zahnlosen Mund machte es sogar die gleichen keuchenden Bewegungen, dann legte sich ein Schleier über seine Augen, und es war tot.
»Sie haben immer Gold dabei«, sagte der Junge des Goldschmieds und trat einen Schritt auf das Wesen zu.
»Bleib hier, Junge, und lade deine Waffe wieder.« Gawin war über seine eigene Stimme entsetzt. Sie klang ruhig und befehlsgewohnt. Lebendig.
Der Junge gehorchte.
Gawin lenkte Erzengel langsam zurück und beobachtete die Wälder in der Nähe.
»Lauf zu den Wagen, Junge. Schlag Alarm.«
Es gab weitere Bewegungen zwischen den Bäumen, noch mehr Speerspitzen waren zu sehen, dieses scheußliche Küchenschabenbraun blitzte auf, und der Junge drehte sich um und rannte los.
Mit einer heftigen Bewegung schloss Gawin sein Visier.
Er steckte nicht in voller Rüstung. Der größte Teil davon befand sich in zwei Körben im Wagen eines der Goldschmiede, war in Unschlitt und grobes Sackleinen eingewickelt, denn er hatte keine Knappen, die sich um die Rüstung kümmern konnten. Überdies hätte es ein falsches Bild abgeben können, wenn er sie getragen hätte.
Also trug er nur einen fleckigen Waffenrock, seine Stiefel, die schönen Panzerhandschuhe und die Kesselhaube und ritt auf einem Pferd, das mehr wert war als drei der Wagen voller feinster Wolle, die er beschützte. Er lenkte Erzengel schneller zurück und riss an den Zügeln, denn sein Schlachtross schien es nicht eilig zu haben.
Der erste Speer flog in hohem Bogen aus dem Wald heran. Gawin hielt sein Schwert in der rechten Hand, aber an seiner linken Seite, wie es ihm der Waffenmeister seines Vaters beigebracht hatte. Er konnte den Mann sagen hören: »Schlag zu, Kerl! Nicht in dein eigenes Pferd, du Trottel!«
Er hieb zu, zerteilte den Schaft der Waffe und lenkte sie ab.
Hinter ihm hörte er den Jungen rufen: »Zu den Waffen! Zu den Waffen!«
Er wagte einen langen Blick zurück zur Karawane. Es war schwer, durch die Löcher in seinem Visier einen klaren Blick zu bekommen und ferne Bewegungen wahrzunehmen. Aber er glaubte sehen zu können, wie der alte Bob die Männer in alle Richtungen aussandte.
Er drehte sich wieder um und sah die Luft voller Wurfspeere. Immer wieder hob er sein Schwert und fuhr so schnell wie möglich mit der Klinge durch die Luft. Ein Speerschaft traf ihn an der Schläfe und brachte seinen Helm wie eine Glocke zum Erklingen, obwohl er eine gepolsterte Kappe darunter trug. Er roch sein eigenes Blut.
Dann riss er den Kopf seines Pferdes herum, denn sobald sie alle ihre Speere geschleudert hatten, würde ihm ein Augenblick bleiben, das Pferd zu wenden und zu fliehen.
Zwei Kobolde rannten auf ihn zu. Sie waren schnell und bewegten sich wie Insekten – so tief am Boden, dass sie den Beinen der Pferde gefährlich werden konnten. Erzengel bäumte sich auf, drehte sich auf den Hinterbeinen und trat mit dem Vorderhuf aus wie ein Boxer.
Gawin ließ sein Schwert durch die Finger laufen, packte es wieder fester und hieb nun mit derselben Bewegung nach unten.
Der Kobold, den Erzengel getreten hatte, platzte wie eine reife Melone und versprühte seine Körperflüssigkeiten. Gawins Gegner kreischte auf, als das kalte Eisen in seine Haut drang. Eisen war für diese Wesen wie Gift, und es schrie seinen Hass heraus, als sich die winzige Seele aus dem Körper erhob, nämlich in einer unglaublich kleinen Wolke, die bei der ersten Brise zerstoben war.
Sofort waren alle anderen verschwunden, und das große Pferd galoppierte jetzt über die Wildblumen hinweg. Gawin hatte Mühe zu atmen. Sein Visier schien ihm die Luft abzuschneiden, und seine Brust wirkte wie zusammengepresst.
Während er ritt, konnte er sehen, dass es noch andere Gruppen dieser Wesen gab. Vier oder fünf von ihnen breiteten sich über die Blumen aus wie Kotflecken auf einem hübschen Kleid, und plötzlich war er von einer magischen Energie erfüllt, mit dem Willen, eine große Tat zu vollbringen und dabei zu sterben.
Ich bin ein Ritter, dachte er grimmig.
Gawin setzte sich im Sattel auf, hielt sein langes, scharfes Schwert mit neuer Kraft, wendete Erzengel und trieb ihn auf die Kobolde zu. Etwas in ihm, das bisher tot gewesen war, entzündete sich nun, als die Sonne seine Klinge wie eine Fackel zum Leuchten brachte.
Er spürte die Berührung von etwas Göttlichem und salutierte, als ritte er in ein Turnier.
»Heiliger Sankt George«, betete er, »lass mich so sterben, wie ich gern gelebt hätte.«
Er gab Erzengel die Sporen – recht sanft, es war kein Tritt, sondern eher ein Streicheln –, und das große Pferd donnerte voran.
Die Kobolde stoben auseinander. Speere flogen an ihm vorbei, und er war zwischen ihnen, lenkte Erzengel mit seinen Knien auf die nächste Gruppe zu, die bereits in Richtung der Bäume liefen.
Gawin hatte nicht geplant, diesen Kampf zu überleben, also preschte er hinter ihnen her, erschlug jeden, der stehen geblieben oder einfach nur zu langsam war, um zu fliehen. Er beugte sich weit aus dem Sattel …
Etwas rief aus dem Innern des Waldes – ein Jammern, das ihm das Blut gefrieren ließ.
Nach wenigen Augenblicken hatte es den Wald verlassen und kam auf ihn zu.
Erzengel war bereit und drehte seinen gewaltigen Körper, als Gawin sein Gewicht im Sattel verlagerte. Auf diese Weise bewegte sich das Kriegspferd im Kampf wie seine eigenen Beine, und der riesige Feind, der nach versengten Haaren, Seife und alter Asche roch, schoss an ihm vorbei. Ein krallenbewehrter Arm flog wie die Pfote einer wütenden Katze auf ihn zu, zielte auf Erzengels Hals – aber das Kriegspferd war schneller, und sein beschlagener Vorderhuf zerschmetterte die Krallenhand mit tödlicher Präzision.
Die Kreatur kreischte auf, die linke Klaue hing nun schlaff herab, die Knochen waren gebrochen. Es stellte sich auf die Hinterbeine, hob die rechte Klaue, und Feuer schoss aus seinen ausgestreckten Krallen – ein Feuerstrahl, der Gawins Körper dort traf, wo der stählerne Halsschutz an seinem Helm über dem gepolsterten Waffenrock hing. Gawin duckte den Kopf und richtete die Spitze seines Helms eher aus Instinkt als aus Absicht gegen die Flammen aus. Sein linkes Auge flammte vor Schmerz auf, und das kalte Messer der Qualen drang in seine linke Schulter. Der Körper wurde nicht mehr von seinem Geist befehligt und schlug blindlings mit dem Schwert zu.
Der Hieb war schwach und schlecht gezielt. Die Klinge drang nicht einmal in die Haut des Wesens ein, aber das Gewicht der Waffe traf es an der Stirn, und so geriet es ins Taumeln.
Erzengel rammte mit der Schulter dagegen. Beinahe wäre Gawin aus dem Sattel geschleudert worden. Er wurde gegen die hohe Rückenlehne gepresst, als sein Pferd eigene Kampfentscheidungen traf, nach vorn sprang und das Ungeheuer mit seiner Masse und seinem Schwung aus dem Gleichgewicht brachte. Die Kreatur schlingerte, und das Pferd schlug wieder mit den Vorderhufen zu und zwang die Kreatur auf alle viere. Sie brüllte vor Schmerz auf, als sie ihr Gewicht auf dem gebrochenen Glied abstützen musste.
Und dann war das Gras voller Kobolde, die ihre Speere mit den Steinspitzen nach ihm schleuderten. Einige trafen sogar. Das Hirschleder seines Waffenrocks lenkte etliche ab, und die feuchte Schafswolle der Polsterung fing andere auf. Aber mindestens ein Speer durchdrang seine Haut. Ohne nachzudenken gab er Erzengel die Sporen, und das große Pferd reagierte mit einem mächtigen Sprung nach vorn. Dann waren sie frei.
Gawin wendete das Tier in einem weiten Bogen. Mit dem linken Auge konnte er nicht mehr sehen, während die Schmerzen in seiner Seite so groß waren, dass er sie kaum noch spürte – und auch sonst nichts mehr.
Ich will dieses Wesen erledigen, dachte er. Ich will seinen Kopf nach Harndon mitnehmen und ihn dem König zeigen; dann erst bin ich zufrieden.
Er wendete Erzengel. Das Pferd hatte mindestens zwei Wunden davongetragen – beide stammten von Speeren. Aber wie sein Reiter war es dazu ausgebildet, den Schmerz zu bekämpfen, und es preschte nun mit allem Eifer, den man sich nur wünschen konnte, wieder auf den Feind zu.
Doch das Ungeheuer hatte die Flucht ergriffen. Es humpelte auf drei Beinen zum Wald hin und wurde von einem Dutzend Kobolden umringt.
Gawin zügelte sein Pferd und war von sich selbst überrascht. Der Tod wartete zwischen diesen Bäumen. Aber es war die eine Sache, unter der hellen Sonne bis zum Tod zu kämpfen, und eine ganz andere, den Kreaturen der Wildnis in den Wald zu folgen und dort allein und für nichts zu sterben. Er betrachtete die verstreuten Leichname der Kobolde, und plötzlich verengte sich sein Blickfeld. Er schmeckte Blut und Kupfer und …
Lorica · Ser Gaston
Wieder Lorica.
Gaston spuckte den ausländischen Namen aus, während er beobachtete, wie sich die grauen Steinmauern näherten. Er warf seinem Vetter, der gelassen an seiner Seite ritt, einen raschen Blick zu.
»Man wird uns verhaften«, sagte Gaston.
Jean zog eine Grimasse. »Weswegen?«, fragte er. Dann lachte er, und bei diesem silbernen Klang lächelten die Männer überall in der Kolonne. Ihr Kontingent war das dritte. Zuerst kam der Haushalt des Königs und dann der des Grafen von Towbray. Sie hatten mehr Ritter als der König und der Graf zusammen.
»Wir haben die zwei Knappen getötet. Ich habe den Schulzen in einem Schuppen eingesperrt. Und du hast die Herberge niedergebrannt.« Gaston zuckte zusammen, als er die letzten Worte aussprach. Sie waren erst zehn Tage in Albia, und schon erkannte er, wie armselig ihr Verhalten gewesen war.
Jean zuckte mit den Achseln. »Außer dem Ritter war niemand von Wert in die Sache verwickelt«, sagte er. Seine Stimme klang so, als befände er sich am Rande des Spottes. »Und er hat beschlossen, daran keinen Anstoß zu nehmen. Ich glaube, das war besonders weise.«
»Dennoch wird der König in spätestens einer Stunde erfahren, was hier vorgefallen ist«, sagte Gaston.
Jean de Vrailly schenkte seinem Vetter ein trauriges Lächeln. »Mein Freund, du musst noch vieles über die Funktionsweise der Welt lernen. Wenn wir uns auch nur in der geringsten Gefahr befänden, hätte mir mein Engel das schon gesagt. Und mir scheint, dass unsere Ritter den größten Teil dieser Kolonne ausmachen. Sie sind stattlicher und besser als der Rest, haben wunderbare Rüstungen und feine Pferde. Wir können immer noch kämpfen. Und wenn wir kämpfen, dann werden wir auch gewinnen.« De Vrailly zuckte wieder mit den Achseln. »Verstehst du? Es ist alles ganz einfach.«
Gaston dachte daran, seine eigenen Männer zu nehmen und einfach davonzureiten.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann ritt durch das Ausfalltor der Brückenburg. Niemand begleitete ihn – außer Michael, der ebenfalls gerüstet und bewaffnet war. Fast unbemerkt waren sie aus dem kleinen Nebentor der Festung geritten und hatten wie zwei Männer auf Patrouille gewirkt. Der Hauptmann hatte seinem Pferd die Sporen gegeben und sich beeilt, denn der Himmel im Westen war voller Krähen. Er bemerkte aber, dass weder über der Festung noch über der Burg ein Vogel zu sehen war.
Er stieg im Burghof ab, in dem große Handelswagen Achse an Achse geparkt waren, zwischen denen sich gerade einmal ein Ausfalltrupp sammeln konnte. Als sich der Hauptmann umsah, erkannte er, dass alle Wagen besetzt waren. Die Kaufleute wohnten darin. Kein Wunder, dass Ser Milus gesagt hatte, er habe genug Platz. Drüben beim Bergfried heulten und bellten Hunde – vier Paare guter Jagdhunde. Er ging zu ihnen und ließ sie an ihm riechen. Er mochte die stürmische Zuneigung dieser Tiere. Alle Hunde liebten ihn.
Cleg, Ser Milus’ Diener, kam herbei und führte ihn in den Bergfried, in dem die Garnison ihr Quartier im Erdgeschoss genommen hatte und sich auch etliche Kaufleute aufhielten. Hier war ausreichend frisches Stroh ausgestreut worden, und sechs Frauen aus der Umgebung sowie ein halbes Dutzend Weiber aus der Begleitung der Truppe saßen auf dem Boden und nähten. Sie stellten Matratzen her; es waren bereits zwanzig Ellen gestreiften Sackleinens abgemessen und zugeschnitten worden, wie der Hauptmann es schon in vielen Ländern gesehen hatte. Saubere Säcke gaben gute Matratzen ab, während schmutziges Leinen Krankheiten verbreitete – das wusste jeder Soldat.
Die Frauen standen auf und machten einen Knicks.
Der Hauptmann verneigte sich. »Ich möchte euch nicht stören.«
Ser Milus schüttelte ihm die Hand, und zwei Bogenschützen – ältere, kräftige Männer namens Jack Kaves und Raucher – schoben die Kaufleute beiseite. Drei von ihnen winkten mit Schriftrollen.
»Ich protestiere«, sagte ein großer Mann. »Meine Hunde …«
»Dafür bringe ich Euch vor Gericht«, sagte ein untersetzter Mann.
Der Hauptmann beachtete sie gar nicht und schritt über eine enge Treppe zum obersten Stockwerk, wo Zelte als Raumteiler für die Quartiere der Offiziere gespannt worden waren.
Ser Jehannes nickte dem Hauptmann kurz zu. Dieser erwiderte den Gruß.
»Seid Ihr bereit, Euch auf den Hügel zurückzuziehen?«, fragte der Hauptmann.
Jehannes nickte. »Sollte ich mich bei Euch entschuldigen?«
Der Hauptmann senkte die Stimme. »Ich habe Euch verärgert, und Ihr seid wütend darüber gewesen. Ich brauche Euch in der Festung, denn Ihr müsst Befehle geben, den Leuten in den Hintern treten und Namen notieren.«
Jehannes nickte. »Ich werde mit Euch gehen.« Er sah zu Gelfred hinüber und deutete mit dem Kopf auf den Jäger. »Es ist schlimm.«
»Niemand holt mich, wenn er nur gute Nachrichten für mich hat.« Der Hauptmann war erleichtert, dass er seinen wichtigsten Mann nicht für immer verloren hatte, und klopfte Jehannes auf den Rücken. Er hoffte, dass es die richtige Geste war. »Tut mir leid«, sagte er.
»Mir ebenfalls«, sagte Jehannes. »Ich bin anders als Ihr; mir fehlt Eure Sicherheit.« Er zuckte die Achseln. »Wie geht es Bent?«
»Sehr gut.« Bent war ein Bogenschütze aus Ser Jehannes’ Lanze und zugleich der erfahrenste Schütze in der Festung.
»Ich werde dir Ser Brutus schicken«, sagte der Hauptmann zu Milus, der nun grinste.
»Wollt Ihr damit sagen, dass Ihr mir für den besten Ritter in der Truppe einen unerfahrenen Jungen geben wollt?« Er lachte. »Egal. Ser Jehannes steht im Rang über mir, und er hat sowieso nichts getan.«
Der Hauptmann dachte nicht zum ersten Mal, wie empfindlich seine Söldner doch waren. Jehannes war als bloßer Kämpfer in die Burg gegangen, anstatt beim Hauptmann in der Festung zu bleiben, weil er wütend gewesen war. Und jeder wusste es, weil es keine Privatsphäre gab, weder im Lager noch in einer Garnison. Und nun, da er und der Hauptmann ihren Streit beigelegt hatten, war jeder sehr verständnisvoll. Die Sticheleien würden erst später einsetzen. Der Hauptmann hielt es für bemerkenswert, dass diese Männer ein solches Taktgefühl besaßen.
Gelfred wartete. Nach seiner Miene zu urteilen stand er kurz vor einer Explosion.
Der Hauptmann betrat sein »Zimmer« und setzte sich vor dem niedrigen Lagertisch auf einen Schemel. Gelfred bedeutete den anderen beiden Offizieren, sie mögen hereinkommen. Jehannes blieb in der Türöffnung stehen und sagte zu jemandem, der hinter der Zeltwand stand: »Räum den Boden auf.«
Brummende Männer waren zu hören, und dann sagte Marcus, Jehannes’ Knappe, in seinem gutturalen Akzent: »Alles erledigt, Sers.«
Gelfred sah sich um. »Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.«
»Wie wäre es mit dem Anfang? Und mit einem Becher Wein?« Der Hauptmann versuchte fröhlich zu klingen, aber die anderen wirkten allzu ernst.
»Die Kaufleute sind hergekommen; zwei von ihnen hatten Tiere dabei.« Gelfred zuckte die Achseln. »Es waren ein Dutzend guter Falken und einige Hunde. Ich habe mir die Freiheit genommen, sie in Sicherheit zu bringen.«
Ein Dutzend guter Falken und einige Jagdhunde waren ein Vermögen wert. Kein Wunder, dass die Kaufleute vorhin so erbost gewesen waren.
»Weiter«, sagte der Hauptmann.
»Ich bin heute den ersten Morgen hier.« Gelfred räusperte sich. »Ich war in den Wäldern.«
»Du hast gute Arbeit geleistet«, sagte der Hauptmann. »Tom hat ihr Lager verwüstet. Er hat nicht einmal Wachen gesehen.«
Gelfred lächelte über das Lob. »Danke. Wie dem auch sei, ich hab heute Morgen …« Er warf Ser Milus einen Blick zu. »Ich habe die Falken auf die anderen Vögel gehetzt – diejenigen, die die Burg beobachten. Ich weiß, dass das wie eine lahme Entschuldigung klingt …«
»Überhaupt nicht«, gab der Hauptmann zurück.
Gelfred stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Ich hatte schon befürchtet, dass Ihr mich für verrückt haltet. Würdet Ihr mir glauben, wenn ich Euch sage, dass ich sehen kann, dass einige der Tiere Diener des Feindes sind?« Die letzten Worte hatte er geflüstert.
Der Hauptmann nickte. »Ja, das glaube ich. Red weiter.«
Jehannes schüttelte den Kopf. »In meinen Ohren klingt das nach Blasphemie«, sagte er.
Verärgert stemmte Gelfred die Hände in die Hüften. »Ich habe einen Freibrief des Bischofs«, sagte er.
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern. »Red weiter, Gelfred.«
Gelfred holte eine Jagdtasche. Sie war steif von Blut, doch das waren Jagdtaschen immer.
Er zog eine Taube heraus – ein wirklich sehr großes Exemplar –, legte sie auf den Tisch und breitete ihre Flügel aus.
»Einer der Jagdfalken hat sie vor etwa zwei Stunden erlegt«, sagte er. »Kein anderer Vogel wäre dazu in der Lage gewesen.«
Der Hauptmann starrte auf die kleine Röhre am Fuß des Vogels, in der für gewöhnlich Botschaften verschickt wurden.
Gelfred nickte. »Er kam aus der Abtei, Hauptmann.«
Milus übergab ihm eine winzige Schriftrolle, die nicht größer war als sein kleiner Finger. »Niederarchaisch«, sagte er. »Das grenzt den Kreis der Verdächtigen ein.«
Die Blicke des Hauptmanns huschten über das Schreiben. Es war sauber verfasst und klang höchst gefährlich – eine Liste der Ritter, der Schwertkämpfer und Bogenschützen sowie weitere Zahlen, vor allem von Vorräten, und dann ging es um Beschreibungen der Verteidigungsmaßnahmen. Aber es stand nichts darin, was den Spion hätte verraten können.
»In einem Konvent von hundert Frauen, von denen jede Niederarchaisch lesen und schreiben kann? Und von denen jede die Macht besitzt und benutzen kann.«
Eine von ihnen war eine Hinterwallerin.
Gelfred nickte. »Der Verräter sitzt nicht hier, sondern in der Festung«, sagte er.
Der Hauptmann nickte zustimmend und schwieg, wie man es tat, wenn man schlechte Nachrichten erhalten hatte und sie noch nicht recht glauben wollte. »Jemand hat den Wildbuben getötet«, sagte er, und sein Blick begegnete dem Gelfreds. »Jemand hat Schwester Hawisia in den Rücken gestochen.«
Gelfred nickte. »Ja, Mylord. Das sind auch meine Gedanken.«
»Jemand hat mit einem Dämon zusammengearbeitet, um eine Nonne zu ermorden.« Der Hauptmann kratzte sich unter dem Bart. »Selbst nach meinen Maßstäben ist das ziemlich schlimm.«
Niemand grinste.
Der Hauptmann stand auf. »Ich will, dass du unseren Verräter zur Strecke bringst, aber gleichzeitig brauche ich dich im Wald«, sagte er. »Und da draußen wird es immer schlimmer.«
Gelfred lächelte. »Mir gefällt es dort«, sagte er und sah sich um. »Zumindest besser als hier drinnen.«
Lorica · Ser Gaston
Vor der Stadt warteten eine Abordnung aus zehn Wagen, die mit Pferdefutter gefüllt waren, sowie vier örtliche Ritter zusammen mit dem Schulzen unter der königlichen Eiche. Der König ritt herbei und umarmte den Schulzen, während der Vogt des Königs die vier jungen Ritter begrüßte und sie auf ihre Pflichten einschwor. Der Quartiermeister kümmerte sich um die Wagen.
Der Schulze hatte gerade die halbe Geschichte des Niederbrennens der Herberge Zu den zwei Löwen erzählt, als er plötzlich ganz weiß und dann rot im Gesicht wurde.
»Aber das ist ja der Mann!«, rief er. »Euer Gnaden! Das ist der Mann, der befohlen hat, die Herberge niederzubrennen!« Er zeigte auf de Vrailly.
De Vrailly zuckte mit den Achseln. »Kenne ich Euch, Ser?«, fragte er und ritt zum König hinüber, dem Schulzen und den anderen Mitgliedern des königlichen Haushalts, die sich unter der großen Eiche versammelt hatten.
Der Schulze stotterte: »Euer … Euer Gnaden, das ist der Schurke, der den Befehl zum Niederbrennen der Herberge gegeben hat. Und er hat erlaubt, dass der Wirt zusammengeschlagen wird, ein treuer Geselle und ein guter …«
De Vrailly schüttelte milde den Kopf. »Du nennst mich einen Schurken?«
Der König legte eine Hand auf de Vraillys Zaumzeug. »Haltet ein, Mylord. Ich muss seine Anklage hören.« Der König warf dem Schulzen einen bösen Blick zu. »Wie unbegründet sie auch sein mag.«
»Unbegründet?«, rief der Schulze.
De Vrailly lächelte. »Euer Gnaden, es ist nicht unbegründet. Meine Knappen haben den wertlosen Paysant getreten und seine Herberge niedergebrannt, damit er eine Lektion für seine Unverschämtheit erhält.« Er hob die linke Braue um eine Haaresbreite. Seine wunderschönen Nasenflügel bebten, während er die Lippen zusammenkniff.
Der König holte tief Luft. Gaston beobachtete ihn sehr aufmerksam. Schon hatte er sein Schwert in der Scheide gelockert. Diesmal würde nicht einmal de Vrailly so einfach davonkommen. Der König durfte vor seinem eigenen Volk, seinen Vasallen und Offizieren keineswegs als schwacher Herrscher erscheinen.
De Vrailly ist verrückt, dachte Gaston.
»Ser Ritter, Ihr müsst Euch erklären«, sagte der König.
De Vrailly hob beide Brauen. »Ich bin ein Lord und habe das Hochgericht, das mittlere Gericht und das Niedergericht hier in meiner Schwertscheide. Ich brauche nicht die Erlaubnis eines anderen Mannes, um jemandem das Leben zu nehmen. Ich habe mehr Bauernkaten niedergebrannt, als ein Junge Fliegenflügel auszupfen kann.« De Vrailly schüttelte den Kopf. »Auf mein Wort, Euer Gnaden, der Mann hat die gerechte Strafe für seine Dummheit erhalten. Ich will nichts mehr darüber hören.«
Der Schulze legte die Hände auf den Knauf seines Sattels, als müsse er sich abstützen. »So was hab ich ja noch nie zu Ohren bekommen! Hört mir zu, Euer Gnaden, dieser aufgeblasene Fremde, dieser sogenannte Ritter hat auch zwei Knappen von Ser Gawin Murien getötet und mich, als ich mich ihm entgegengestellt habe, schlagen lassen. Ich wurde in einen Schuppen geworfen und gefesselt. Als ich endlich befreit wurde, brannte die Herberge bereits.«
Gaston lenkte sein Pferd in die aufgebrachte Gruppe. »Deine Worte beweisen keineswegs die Schuld meines Herrn«, beharrte er. »Du hast nichts davon mit eigenen Augen beobachtet, und doch stellst du es als Wahrheit dar.«
»Ihr wart derjenige, der mich geschlagen hat!«, sagte der Schulze.
Gaston musste sich beherrschen, um nicht mit den Schultern zu zucken. Du bist ein nichtsnutziger, untüchtiger Mann und eine Schande für deinen König – und du hast mir im Weg gestanden. Aber er lächelte, warf dem König einen kurzen Blick zu und streckte die Hand aus. »Dafür entschuldige ich mich. Mein Vetter und ich waren gerade erst in Eurem Lande angekommen und verstanden die Gesetze in diesem Teil der Welt noch nicht.«
Der König befand sich in einer verzwickten Lage. In seinem Innern kämpften ganz unterschiedliche Gefühle, Notwendigkeiten und Ziele um die Herrschaft, und seine Unentschiedenheit zeichnete sich deutlich auf seinem Gesicht ab. Er brauchte Jean de Vraillys dreihundert Ritter, aber er musste vor den Augen der anderen Gerechtigkeit walten lassen. Gaston versuchte, den Schulzen mit seinem Willen dazu zu bringen, ihm die Hand zu geben. Der König schien es ebenfalls zu versuchen.
»Messire, mein Vetter und ich haben uns dem König angeschlossen, um gegen die Wildnis ins Feld zu ziehen.« Gastons Stimme war leise, drängend und dennoch besänftigend. »Ich bitte Euch untertänigst um Vergebung, bevor wir in die Schlacht ziehen.«
Gaston betete, dass der König in diesem Moment keinen Blick auf seinen Vetter warf, dessen Miene bei dem Wort »Vergebung« ausgereicht hätte, um Milch sauer werden zu lassen.
Der Schulze schnaubte verächtlich.
Der König entspannte sich allmählich.
Wie gegen seinen Willen ergriff der Schulze von Lorica Gastons Hand und schüttelte sie. Dabei ließ er seinen Handschuh an, was sehr grob war. Und sah Gaston nicht in die Augen.
Der König nutzte die Gelegenheit. »Ihr werdet Wiedergutmachung an die Stadt und den Wirt leisten«, sagte er. »Die Summe wird sich nach dem vollen Wert des Hauses sowie all seiner Güter bemessen. Der Schulze wird den Wert feststellen und Euch eine Nachricht schicken.« Der König drehte sich im Sattel und sprach den Captal de Ruth an. »Ihr, der Ihr Eure Bereitschaft erklärt habt, mir zu dienen, werdet mir zunächst in dieser Hinsicht gehorchen: Euer Lohn und der Eurer Ritter wird statt des Strafgeldes unmittelbar an den Herbergswirt und die Stadt bezahlt, bis der Wert, den der Schulze errechnen wird, erreicht ist.«
Jean de Vrailly saß auf seinem Pferd; sein wunderschönes Gesicht wirkte ruhig und friedlich. Nur Gaston wusste, dass er in diesem Augenblick überlegte, ob er den König töten sollte.
»Wir …«, begann er. Der König drehte sich im Sattel um und zeigte ein wenig von der Biegsamkeit, die er bereits im Turnier unter Beweis gestellt hatte.
»Lasst den Captal doch für sich selbst sprechen«, sagte der König. »Ihr seid sehr gewandt in der Verteidigung Eures Vetters, Mylord, aber ich muss sein Einverständnis von ihm persönlich hören.«
Er ist sehr geschickt darin, dachte Gaston. Er versteht meinen Vetter besser als die meisten Menschen, und er hat einen Weg gefunden, ihn zu bestrafen und ihn gleichzeitig bei sich zu behalten und seine Fähigkeiten gegen die Feinde des Königs einzusetzen. Jean und sein Engel werden diesen König nicht innerhalb eines einzigen Nachmittags erobern können. Er sagte nichts und verneigte sich.
Und sah Jean finster an.
Jean verbeugte sich ebenfalls. »Ich bin hergekommen, weil ich gegen Eure Feinde kämpfen will, Euer Gnaden«, sagte er mit seinem bezaubernden Akzent. »Auf meine eigenen Kosten. Diese ordinance macht für mich keinen Unterschied.«
Gaston zuckte zusammen.
Der König sah sich um, lenkte die Blicke auf sich, holte die Meinung seiner Männer durch ihre Körpersprache und ihre Mienen ein und beobachtete die Haltung ihrer Pferde. Er stieß mit der Zunge gegen die Zähne, was Gaston bereits als Zeichen seiner Enttäuschung erkannt hatte.
»Das reicht nicht«, sagte der König.
De Vrailly zuckte die Achseln. »Ihr wünscht, dass ich Euer Recht und Gesetz anerkenne?«, fragte er. Verachtung tropfte aus jedem seiner Worte.
Jetzt kommt es, dachte Gaston.
Der Graf von Towbray lenkte sein Pferd zwischen das des Königs und jenes des Captal. »Alles ist meine Schuld«, sagte er.
Sowohl der König als auch de Vrailly sahen ihn an, als wäre er in einem Turnier zwischen sie getreten.
»Ich habe den Captal nach Albia eingeladen, damit er mir dient, doch mir war nicht klar, wie er uns betrachten wird, auch wenn ich meine Jugend im Kampf auf dem Kontinent verbracht habe.« Der Graf zuckte mit den Schultern. »Wegen dieses Fehlers werde ich die Kosten selbst tragen.«
De Vrailly besaß wenigstens den Anstand, überrascht zu wirken. »Aber nein!«, sagte er plötzlich. »Ich bestehe darauf, dass ich sie trage.«
Gaston hätte beinahe vergessen weiterzuatmen.
Wenige Augenblicke später schwatzten die Männer vor Erleichterung, die Kolonne bildete sich neu, und Gaston konnte an die Seite seines Vetters reiten.
»Das ist nicht das, was mir der Engel vorausgesagt hat«, bemerkte dieser.
Gaston hob eine Braue.
De Vrailly zuckte die Schultern. »Aber es wird genügen. Allerdings ärgert es mich zu hören, wie du, Vetter, vor einer Kreatur wie diesem Schulzen im Staub kriechst. So etwas musst du in Zukunft vermeiden, damit es dir nicht zur Gewohnheit wird.«
Gaston saß eine Weile steif auf seinem Pferd, dann beugte er sich vor. »Und mich ärgert es zu sehen, Vetter, wie du dich vor dem König von Albia aufplusterst. Aber ich vermute, du kannst nicht anders.« Er drehte sich um, ritt zu seinem eigenen Gefolge zurück und ließ Jean allein.
Westlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn war sich seines Körpers nur noch undeutlich bewusst, als er unter der gewaltigen Steineiche saß und seine inneren Fühler nach dem Meer der Bäume ausstreckte. Er spürte noch sein Innerstes; er spürte die Angst und Wut der Wildbuben, die widerspenstige Überheblichkeit der Qwethnethogs, die Trauer der geflügelten Abnethogs und die ferne Gegenwart, die bereits die Ankunft des Sossag-Volkes aus dem Norden hinter dem Wall ankündigte. Er war sich jedes einzelnen Baumes bewusst, der sein zehntes Jahr schon hinter sich gebracht hatte, sowie der großen Irisbüschel, des wilden Spargels, der am Fluss wuchs, wo ein Mensch vor einem Jahrhundert eine Hütte gebaut hatte, und des Viehs, das seine Wilderer gestohlen hatten, um damit die Wildbuben zu ernähren, des Weiteren der büschelohrigen Luchse, die sowohl wütend als auch verängstigt waren, weil seine Armee in ihrem Territorium lagerte, und auch der tausend anderen Gegenwarten, die sich bis an die Grenze seines Begreifens erstreckten.
Er fühlte mit den Luchsen. Sie waren unergründliche, mächtige Kreaturen mit schmutzigen Gedanken und verseuchten Körpern, dreckig vor Angst und Hass, und sie waren in seine Wälder gekommen und hatten sein Lager heimgesucht, seine Verbündeten in Angst und Schrecken versetzt, seine Bäume zerstört und ihn schwach erscheinen lassen. Die größeren Qwethnethogs würden sich fragen, ob er ihrer Dienste würdig war, und die stärksten unter ihnen würden vielleicht sich selbst und ihre Kräfte darauf verwenden, ihn zu einem Kampf um die Oberherrschaft herauszufordern.
Es war schwierig für eine Macht der Wildnis, vertrauenswürdige Helfer zu finden. Aber er würde weiterhin versuchen, solche Beziehungen zu knüpfen, zum Besten der Wildnis und ihrer Angelegenheiten.
Er stand unter dem Baum auf und ging zum Lager. Dabei zerstreute er einige unwesentlichere Kreaturen und verängstigte die Wildbuben. Er ging nach Westen zu der Handvoll goldener Bären, die sich mit ihm verbündet und Hütten aus Blättern und Unterholz gebaut hatten. Er nickte Blaubeer zu, einem gewaltigen Bären mit blauen Augen.
Der Bär stellte sich auf die Hintertatzen. »Thorn«, sagte er. Die Bären hatten vor nichts Angst, nicht einmal vor ihm.
»Blaubeer«, sagte Thorn, »ich fordere, dass du weitere Kämpfer aus deinem Volk rekrutierst. Ich will das Kind haben, und dann bringe ich es zu den Eishöhlen.«
Blaubeer dachte einen Moment lang nach. »Ja«, sagte er. »Bessere Nahrung und bessere Weibchen. Gut gedacht.« Abendlicht, die größte aller Bärinnen, brachte das Junge herbei. Es war noch so klein, dass Thorn es ohne Schwierigkeiten tragen konnte, und es brummte jämmerlich, als er es nahm. Er streichelte das Fell des Jungtiers und wurde gebissen. Die kleine Bärin roch sein seltsames Fleisch und schniefte.
Er ließ die Bären ohne ein weiteres Wort zurück und machte sich auf den Weg nach Norden. Wenn er seine Beine weit ausstreckte, war er schneller als ein galoppierendes Pferd, und er konnte so lange reisen, wie es ihm beliebte. Er hielt die kleine Bärin fest und bewegte sich noch schneller.
Bevor die Sonne einen Fingerbreit gesunken war, hatte er sich schon so weit vom Lager entfernt, dass er die Gedanken seiner Verbündeten nicht mehr wahrnehmen und auch die Feuer jener Menschen nicht mehr riechen konnte, die sich entschlossen hatten, ihm zu dienen. Er überquerte eine Reihe von Wiesen, freute sich an deren Gesundheit, spürte die Forellen in den Flüssen und die Otter an den Ufern und überquerte einen breiten Strom, der von den Adnaklippen herkam und nach Süden floss. Er folgte dem Ufer nach Norden in die Berge. Die Meilen flogen vorbei. Thorn zog seine Kraft aus den Bergen, den Tälern, dem Wasser und den Bäumen. Und er zog noch mehr daraus als nur Kraft.
Er sammelte auch Inspiration.
Der Krieg war nicht seine Wahl. Es war ein Unfall gewesen. Aber wenn er jetzt Krieg führen musste, dann musste er sich an den Grund dafür erinnern. Er würde den Krieg um ihretwillen führen. Zum Nutzen der Wildnis. Um sie sauber zu halten.
Und natürlich auch für ihn selbst. Mit jeder Kreatur, die freiwillig zu ihm kam und ihm folgte, wurde er mächtiger.
Der Strom stieg an, einen Hang hinauf, immer steiler. Er befand sich jetzt im Vorgebirge, sein Dahineilen war wie ein starker Wind in den Bäumen. Wild schaute verwirrt auf. Verängstigt.
Vögel flohen.
Er kannte das Tal, zu dem er unterwegs war. Darin floss ein Strom, den die Sossag den Schwarzen nannten. Er entsprang den Eishöhlen unter den Bergen. Es war ein besonderer Ort, beinahe so mit Macht gesättigt wie der Fels.
Die Bären herrschten über ihn.
Er kletterte einen steilen Pfad hoch, beinahe eine Straße, die vom Fluss zum Gipfel der Erhebung führte, und wartete. Nun war er fünfzig Meilen von seiner Armee entfernt. Er setzte den jungen Bären auf dem Boden ab, wartete …
Die Sonne ging allmählich hinter ihm unter, während er seine Gedanken schweifen ließ. Er fragte sich, ob der Feind wieder einen Ausfall in sein Lager machen würde. Nun, da er weit entfernt davon war, kam ihm der Gedanke, dass der feindliche Hauptmann jemanden zur Beobachtung von Thorns Lager abgestellt haben musste. Natürlich. Wie sonst hätte er denn wissen sollen, wann er angreifen konnte? Er muss Tiere als Spione einsetzen.
Es war überraschend, welche Klarheit in seinem Kopf herrschte, wenn er nicht mit dem Chaos anderer Kreaturen bombardiert wurde.
»Thorn.«
Es war eine alte Stimme; sie gehörte einem Bären, der schon mehr als ein ganzes Jahrhundert erlebt hatte. Er hieß Flint und war als eine Macht anerkannt. Er war beinahe so groß wie Thorn, und obwohl seine Haare an den Ohren und um die Schnauze herum weiß waren, war sein Körper doch stark und fest wie ein frischer Apfel im Herbst.
»Flint.«
Der alte Bär streckte die Tatzen aus, und die kleine Bärin rannte auf ihn zu.
»Ihre Mutter wurde von Menschen versklavt und gefoltert«, sagte Thorn. »Um ehrlich zu sein, sie wurde von anderen Menschen gerettet und in mein Lager zu Blaubeer gebracht.«
»Menschen«, sagte Flint. Thorn spürte den Zorn und die Macht des alten Bären.
»Ich habe Albinkirk niedergebrannt«, sagte Thorn und erkannte sofort, dass dies eine sinnlose Prahlerei war. Flint wusste es sicherlich längst.
»Mit Sternen aus dem Himmel«, sagte Flint. Seine tiefe Stimme klang wie eine Säge, die in hartes Holz biss.
»Ich bin hergekommen, um dich etwas zu fragen …« Von Angesicht zu Angesicht mit Flint fiel es ihm plötzlich schwer, sich zu erklären. Bären waren gemeinhin für ihre vollkommene Verachtung jeglicher Organisation bekannt. Jeglicher Regierung. Jeglicher Regeln. Und sie hassten den Krieg. Bären töteten, wenn sie dazu angestachelt wurden, aber Krieg stieß sie ab.
»Frag nicht«, sagte Flint.
»Was ich tun will…«, begann Thorn.
»… hat nichts mit den Bären zu tun«, unterbrach ihn Flint. Er nickte. »Das ist das Junge von Sonnenstrahl aus dem Klan der Langmutter. Zweifellos wird Sonnenstrahls Bruder sie rächen.« Der alte Bär sagte dies mit offensichtlicher Traurigkeit. »Genau wie seine Freunde.« Flint hob das Junge auf. »Sie sind jung und begreifen nichts. Ich hingegen bin alt. Ich sehe dich, Thorn. Ich kenne dich.« Er drehte ihm den Rücken zu und ging davon.
Plötzlich wollte Thorn hinter dem alten Bären herlaufen und zu seinen Tatzen sitzen. Von ihm lernen. Und ihm … nein, nicht seine Unschuld, sondern seine Absichten darlegen.
Aber ein anderer Teil von ihm wollte den alten Bären in Asche verwandeln.
Es war ein langer Weg zurück zum Lager.
Lissen Carak · Schwester Miram
Schwester Miram vermisste ihre Lieblingshaube aus Leinen, und sie nutzte die kurze Zeit zwischen ihrem Studium des Hocharchaischen und der Non, um die Wäscherei aufzusuchen. Sie rannte die Treppe im Nordturm hinunter – für eine so große Frau war sie sehr schnell –, doch ein seltsames Gefühl brachte sie dazu, vor der offenen Tür zur Wäscherei stehen zu bleiben. Sechs Schwestern arbeiteten hier; ihre Hände und Gesichter waren gerötet, und sie hatten sich wegen der Hitze im Raum bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Ein Dutzend Mädchen aus der Umgebung halfen ihnen.
Lis Wainwright hatte sich ebenfalls bis auf Hemd und Hose entkleidet. Ihre vierzig Jahre hatten ihre Gestalt nicht ruiniert. Miram hätte lächeln können, aber sie tat es nicht. Hinter Lis befanden sich jüngere Mädchen. Miram kannte sie alle, denn sie hatte sie unterrichtet. Es waren die Carters und die Lanthorns. Die Lanthorn-Mädchen lächelten einfältig. Für gewöhnlich gab es in der Wäscherei kaum einen Grund zum Lächeln.
Hundert Nonnen und Novizinnen sorgten für ein großes Aufkommen an Wäsche. Da nun noch etwa vierhundert Bauern nebst ihren Familien und etwa zweihundert Soldaten hinzugekommen waren, war die Wäscherei gezwungen, Tag und Nacht zu arbeiten. Die Trockenleinen wurden jede Stunde gespannt, und sogar ältere Schwestern wie Miram erhielten ihre Wäsche ein wenig feucht und schlecht gebügelt. Manchmal fehlten auch Dinge – wie ihre Kappe.
Sie sah sich nach Schwester Mary um, die in dieser Woche die Aufsicht über die Wäscherei hatte, und hörte die Stimme eines Mannes. Eine kultivierte Stimme. Sie sang.
Miram lauschte. Es war ein gallysches Liebeslied.
Sie konnte den Sänger nicht sehen, aber sie sah die vier Lanthorn-Mädchen in ihren Unterröcken, wie sie kicherten, sich in die Brust warfen und viel Schulter und Bein zeigten.
Miram kniff die Augen zusammen. Die Lanthorn-Mädchen waren nun einmal so, wie sie waren, aber sie mussten sich nicht auch noch von einem glattzüngigen Edelherrn den Weg in die Hölle zeigen lassen. Miram schritt über den feuchten Boden, und nun sah sie ihn, wie er neben der Tür der Wäscherei lehnte. Er hatte eine Laute, und er war nicht allein.
»Euer Name, Messire?«, fragte sie. Sie war so schnell auf ihn zugetreten, dass er in seiner Unschlüssigkeit gefangen war – weiterspielen oder fliehen?
»Lyliard, ma sœur«, sagte er süßlich.
»Seid Ihr ein Ritter, Messire?«, wollte sie wissen.
Er verneigte sich.
»Keine dieser vier unverheirateten Jungfern ist von edler Abstammung, Messire. Auch wenn es Euch frommen sollte, ihnen beizuwohnen, werden ihre Schwangerschaft und ihre Ehelosigkeit schwer auf meinem Konvent, auf meinen Schwestern und auf Eurer Seele lasten.« Sie lächelte. »Ich hoffe, wir haben uns verstanden.«
Lyliard wirkte, als sei er von einem Lindwurm bedroht worden. »Ma sœur!«
»Ihr seht wie ein Knappe aus«, sagte Schwester Miram zu dem jungen Mann an seiner Seite. Er hatte ebenfalls eine Laute, und auch wenn ihm Lyliards Schneid und Gewandtheit noch fehlten, würde er sie sich nach Mirams Meinung schon bald erworben haben. Auch er war schön, aber auf eine liederliche, kräftige Art.
»John von Reigate, Schwester«, sagte er. Er schien noch so jung zu sein, dass er den Blick senkte und wie ein Schuljunge wirkte, der bei einem Streich erwischt worden war. Sie musste sich in Erinnerung rufen, dass er und seinesgleichen zwar Menschen zum Lebensunterhalt umbrachten, doch trotzdem fühlende Wesen waren.
Es war noch ein dritter Mann bei ihnen, und dieser war der schönste. Er hatte geschliffene Manieren und ein gutes Aussehen. Und er errötete.
»Und Ihr seid der Knappe des Hauptmanns«, sagte sie.
Er zuckte die Schultern. »Das ist ungerecht. Mein Ruf eilt mir voraus.«
»Äfft nicht Euren Herrn nach«, tadelte Miram. »Ihr drei hochwohlgeborenen Herren solltet Euch schämen. Geht jetzt.«
Lyliard wirkte beschämt. »Seht, Schwester, uns verlangt doch nur nach ein wenig weiblicher Gesellschaft. Wir sind keine schlechten Männer.«
Sie schnaubte verächtlich. »Wollt Ihr damit etwa sagen, dass Ihr für das bezahlt, was Ihr Euch nehmt?« Sie sah die drei hintereinander an. »Ihr verführt die Unschuldigen, anstatt sie zu vergewaltigen? Soll mich das beeindrucken?«
Der Knappe des Hauptmanns schnaubte leise. Mit der linken Hand betastete er die Bandage um seine Hüfte. »Ihr habt wirklich keine Vorstellung davon, was oder wer wir sind. Und wogegen wir kämpfen.«
Miram fing seinen Blick auf und trat so nahe an ihn heran wie an einen Geliebten. Ihre Nasenspitzen berührten sich beinahe. Seine Augen waren blau, und früher hatte sie hübsche Männer durchaus genossen.
Ihre Augen waren von einem tiefen, alten Grün.
»Ich weiß, junger Knappe«, sagte sie. »Ich weiß genau, wogegen Ihr kämpft.« Sie blinzelte nicht, und er konnte den Blick nicht von ihr abwenden. »Spart Euch Euer Posieren für die Huren, Junge. Und jetzt geht und sprecht zwanzig Vaterunser, und zwar mit dem Herzen, und denkt darüber nach, was es bedeuten könnte, ein Ritter zu sein.«
Michael hätte sich gern verteidigt, doch sobald sie ihn nicht mehr ansah, geriet er ins Taumeln.
Sie lächelte die drei Männer an, und diese wichen von der Tür zurück.
Schwester Miram ging in die Wäscherei hinein, wo die Lanthorn-Mädchen verängstigt ihre nackten Beine zu bedecken versuchten.
Schwester Mary kam mit einem großen Korb herein. »Miram!«, rief sie. »Was ist hier los?«
»Das Übliche«, antwortete Miram und machte sich daran, nach ihrer verschwundenen Haube zu suchen.
Nördlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn war von der Geringschätzung des alten Bären verletzt. Auf dem Rückweg dachte er darüber nach, wie es den Menschen auf dem Felsen hatte gelingen können, ihm gleich zwei Niederlagen zuzufügen. Er musste sich der harten Wahrheit stellen, denn für die Irks und die Kobolde und sogar für die Dämonen bedeuteten diese kleinen brennenden Nadelstiche wahre Niederlagen.
Er glaubte nicht, dass ihn einer seiner Leutnants deswegen zur Rede stellen würde, und auf seinem Weg streckte er seine inneren Fühler immer weiter nach Osten aus, bis er die starke Falschheit der Eindringlinge spürte. Sie ähnelten nicht den Bauern, den Nonnen oder den Schäfern in der Festung. Sie rochen nach Gewalt.
Er hatte ihre Art schon immer gehasst, auch als er noch als Mensch unter ihnen einhergewandelt war.
Überdies konnte er in der Festung, umgeben von all diesem kalten, von Menschenhand behauenen Stein und von einem äonenalten Zauber und Bollwerk gegen seine eigene Magie, die Äbtissin wie eine Sonne der Macht spüren, während sich ihre Nonnen gleich einem Sternenfeld hinter ihr befanden.
Er zuckte vor ihr zurück.
Und die Fühler seiner tastenden Macht erkannten eine andere, dunklere Sonne – das Leuchtfeuer, das die Dämonen gesehen hatten, das auch Thurkan, der heftigste aller Dämonen, gesehen hatte. Den Umschildeten, der – wenn auch nur für kurze Zeit – seinem Walten auf dem Schlachtfeld widerstanden hatte.
Die Bären hatten ihn nicht wirklich abgewiesen. Aber sie hatten ihm auch nicht anders geholfen als mit ein paar wütenden Kriegern, die Rache üben wollten. Er sog die klare Luft tief in sich hinein, wandte sich nach Norden, zurück in die Berge, und machte immer längere Schritte, bis er schließlich lief. Sein riesenhafter Körper bewegte sich nun schneller als das schnellste Pferd. Er konnte überall hingelangen, wenn er sich eines Phantasmas bediente, aber plötzlich scheute er davor zurück, zu viel Macht zu verwenden. Macht lockte Macht an, und in der Wildnis konnte das ein schnelles Ende bedeuten. Allzu oft erschien dann plötzlich etwas, das größer war als man selbst. Und das einen fraß.
Während er über die Waldstraßen lief, stellte sich Thorn vor, wie er Thurkan fraß.
Lissen Carak · Kaitlin
Die vier Lanthorn-Mädchen erholten sich schnell von Schwester Mirams Schelte, und am Nachmittag entkernten sie Winteräpfel hinter der Küche. Weder Schwestern noch Novizinnen waren anwesend.
Das älteste Lanthorn-Mädchen war Elissa. Sie hatte dunkle Haare, war so groß wie ein Mann, war dabei dünn, hatte lange Beine, kaum Rundungen und eine Nase wie ein Falkenschnabel. Dennoch fanden die Männer sie unwiderstehlich, vor allem weil sie sehr oft lächelte und sich nur selten der Hauptwaffe ihrer Familie bediente: einer scharfen Zunge.
Mary war die zweitälteste Tochter. Sie war das Gegenteil ihrer älteren Schwester: klein, aber nicht gedrungen, mit einer prächtigen Figur, goldenem Haar, einer schlanken Hüfte und einer Stupsnase. Sie hielt sich für eine große Schönheit und war stets verwirrt, wenn die Jungen Elissa vorzogen.
Fran hatte bräunliche Haare, volle Lippen und volle Hüften. Sie glich ihrer Mutter, hatte den wachen Verstand ihres Vaters und dessen Ehrgefühl geerbt, außerdem war es ihr meistens gleichgültig, ob die Jungen sie wahrnahmen oder nicht.
Und Kaitlin war die Jüngste; sie zählte gerade erst fünfzehn Jahre, war nicht so groß wie Elissa, nicht so üppig wie Mary und auch nicht so gewitzt und beißend wie Fran. Sie hatte hellbraune Haare, die ein herzförmiges Gesicht einrahmten, und sie schien die ruhigste und achtbarste der Lanthorn-Töchter zu sein.
»Dieses Miststück«, sagte Fran und warf einen Kern beiseite. »Sie erwartet tatsächlich, dass wir für den Rest unseres Lebens gute kleine Mädchen mit Schweinemist an den Schuhen sind.«
Elissa sah sich vorsichtig um. »Wir müssen es richtig angehen«, sagte sie nachdenklich. Mit einer heftigen Bewegung zog sie ein Messer unter ihrem Kleid hervor, schnitt ein Stück vom Apfel ab, säuberte das Messer an ihrer Schürze und steckte es so schnell wieder weg, dass man es kaum sehen konnte. Dann sah sie an ihrer langen Nase vorbei zu Fran hinüber. »Hiermit berufe ich eine Versammlung des ›Heiratet-einen-Adligen‹-Clubs ein.«
»Dummer Kinderkram«, höhnte Mary. Sie war achtzehn. »Niemand hier wird eine von uns heiraten.« Ihre Blicke kreisten. »Vielleicht Kaitlin«, gab sie zu.
Wütend warf Fran einen Apfelkern in den Schweinekoben hinter sich. »Wenn einige Leute damit aufhören würden, mit jedem Bauernjungen in jedem Heuschober das Tier mit den zwei Rücken zu machen …«
Elissa schenkte ihr nicht einmal das dünnste Lächeln. »Ah, Fran, du wirst als Jungfrau zu deiner Hochzeit gehen, nicht wahr?« Sie schnaubte verächtlich.
Frans nächster Apfelkern traf Elissa an der Nase, und sie zischte auf.
Mary zuckte die Achseln. »Bei mir macht es nichts aus, ob ich mit ihnen schlafe oder nicht«, sagte sie, »schließlich behaupten sowieso immer alle, ich hätte es getan, und die anderen glauben das auch noch.«
Die anderen nickten.
Elissa zuckte ebenfalls mit den Schultern. »Die Soldaten reden nicht mit Bauersleuten. Sie haben überhaupt keine Ahnung von unserem Leben. Und selbst die Bogenschützen …« Sie hob die Achseln. »Die Bogenschützen haben mehr Geld als jeder Bauernjunge hier. Die Soldaten …«
»… sind nicht allesamt Ehrenmänner«, meinte Mary. »Tom Schlimm würde ich nicht mal anfassen, wenn ich in einer Rüstung steckte.«
»Mir gefällt er«, meinte Fran.
»Dann bist du noch dümmer, als ich dachte. Solltest du nicht die Schlaueste und Gewandteste von uns sein? Mir ist er unheimlich.« Mary erzitterte.
Elissa hob die Hand und gebot Schweigen. »Wie auch immer. Was ich sagen will, ist …« Sie sah sich um. »Wir besitzen etwas. Etwas von großem Wert.« Sie lächelte. Dieses Lächeln hellte ihr Gesicht auf und verwandelte sie von einem grobknochigen jungen Drachen in eine anziehende Frau. Mary drehte sich um und sah, dass Elissa einen Knappen mittleren Alters anlächelte, der gerade mit einem Ascheimer an der Küche vorbeiging. Vermutlich musste er irgendwo eine Rüstung polieren.
Elissa faltete ihr Lächeln zusammen und steckte es weg. »Hier sind sechzig Soldaten«, sagte sie. »Sechzig Möglichkeiten, dass einer von ihnen eine von uns heiratet.«
Mary schnaubte verächtlich.
Aber Fran beugte sich vor; den Apfel in ihrer Hand hatte sie ganz vergessen. »Vielleicht hast du recht«, sagte sie.
Elissa und Fran waren für gewöhnlich keine Verbündeten. Elissa sah sie an, und beide lächelten.
»Also tun wir es nicht«, sagte Elissa. »Wir tun es einfach nicht. Mehr müsst ihr nicht tun, Mädchen. Nichts. Mal sehen, was wir angeboten bekommen.«
Mary war verwirrt. »Was sollen wir denn nicht tun? Mit ihnen ins Bett gehen? Und was sollen wir tun? Willst du etwa lernen, mit dem Bogen zu schießen? Oder willst du zu Meg gehen und Unterricht im Nähen nehmen?«
Elissa schüttelte den Kopf.
»Lis wird nicht einfach damit aufhören, für jeden schönen Jungen die Beine breit zu machen«, sagte Mary.
»Lis kann machen, was sie will. Sie ist alt, aber wir sind das nicht.« Fran sah sich um. »Der Hauptmann sieht nicht schlecht aus.«
Elissa gab ein unanständiges Geräusch von sich. »Er hat was mit einer der Nonnen.«
»Hat er nicht!«, sagte Kaitlin. Sie hatte bisher geschwiegen, aber gewisse Dinge konnte sie nicht unwidersprochen durchgehen lassen.
»Ah, da bist du eine Expertin, ja?«, fragte Mary.
»Ich mache in seinem Zimmer sauber«, sagte Kaitlin. »Manchmal.«
Elissa sah sie an. »Junges Mädchen, du bist ein stilles Wasser.«
»Bin ich nicht!«, wehrte sich Kaitlin.
»Du gehst wirklich in sein Zimmer?«, fragte Elissa.
»Fast jeden Tag.« Kaitlin sah ihre Schwestern nacheinander an. »Was ist?«
Elissa zuckte die Achseln. »Eine von uns könnte in seinem Bett liegen.«
Kaitlin legte die Hand vor den Mund. Mary spuckte aus. Fran sah so aus, als würde sie ernsthaft darüber nachdenken.
»Zu verzweifelt«, verkündete Fran. »Außerdem ist er ebenfalls ganz schön beängstigend.«
»Unheimlich«, sagte Mary.
»Aber sein Knappe ist bildschön«, sagte Elissa.
Kaitlin errötete. Zum Glück sahen die anderen sie in diesem Augenblick nicht an.
Nordwestlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn musste mehr in Erfahrung bringen. Er musste dafür sorgen, dass seine Vertrauensperson auf dem Felsen weniger zurückhaltend war. Während Thorn im abnehmenden Licht durch den Wald lief, rief er die Vögel aus der Luft herbei. Nun erkletterte er einen Hang nach dem anderen. Der Abstieg auf der Nordseite war nie so steil und lang wie der Anstieg, und er lief immer tiefer ins Gebirge hinein. Die Bäume wurden spärlicher, und er bewegte sich noch schneller, je freier das Gelände vor ihm wurde.
Zwei Raben stiegen auf seine Fäuste herab, als wären sie die Falken eines Ritters. Er sprach mit ihnen, pflanzte Botschaften in ihre weisen Köpfe und schickte sie zur Festung. Niemand verdächtigte Raben. Sie stiegen über ihm auf und flogen nach Südwesten, während er sich umdrehte und sah, wie hoch er bereits gelangt war.
Er schaute über die Wildnis hinaus. Zu seinen Füßen, tief unter ihm, befand sich eine Reihe von Teichen, die wie Miniaturseen in den letzten Sonnenstrahlen glitzerten. Der Fluss, der sie miteinander verband, war ein Faden aus Silber, der hier und da im Gewebe der Bäume aufleuchtete.
Er wandte sich wieder um und kletterte noch höher. Nun wurde der Pfad steiler, und er kam nicht mehr ganz so schnell voran. Er musste seine langen, mächtigen Arme benutzen, mit denen er sich von Baum zu Baum zog. Der Fluss an seiner Seite stürzte nun in einer Reihe von Wasserfällen hinab.
Er zog sich an einem glitschigen Felsen hoch und stemmte sich mit schierer Kraft hinauf, breitete die Arme weit aus und ächzte vor Anstrengung, als sie das volle Gewicht seines riesigen Körpers tragen mussten. Zu seinen Füßen befand sich ein tiefer und schwarzer Teich, und ein Wasserfall ergoss sich aus einer Höhe von hundert Fuß in ihn hinein. Die Gischt durchnässte Thorn in wenigen Augenblicken. Er bückte sich und trank in tiefen Zügen aus dem magischen Teich.
Ein Kopf durchbrach die Oberfläche nur eine Armeslänge von ihm entfernt, und er fuhr zusammen.
Wer trinkt aus meinem Teich?
Die Worte erschienen in seinem Kopf, ohne dass ein einziges Wort ausgesprochen worden wäre.
»Mein Name ist Thorn«, sagte er.
Die Kreatur stieg aus dem Teich; schwarzes Wasser floss an ihr herunter. Sie wuchs und wuchs. Ihre Haut war tintenschwarz und leuchtete wie Obsidian.
Das Wesen bewegte sich schnell, und doch schien es vollkommen reglos zu sein. Der Wandel war schwer mitzubekommen und schien beständig am Rande von Thorns Blickwinkel stattzufinden. Als das Wesen endlich vollkommen aufgetaucht war, war es um ein Viertel größer als der Zauberer.
Es war ein glänzender schwarzer Steingolem ohne Gesicht, ohne Augen, ohne Mund.
Ich kenne dich nicht.
»Ich weiß ein wenig von dir«, sagte Thorn. »Und ich weiß, dass ich Verbündete brauche. Es heißt, dass du und deinesgleichen furchterregende Krieger seid.«
Ich spüre deine Macht. Sie ist beträchtlich.
»Ich erkenne deine Schnelligkeit und Stärke. Sie sind ebenfalls beträchtlich.« Thorn nickte.
Genug des Redens. Was WILLST DU?
Dieser Gedankenschrei hätte Thorn beinahe auf die Knie gezwungen. »Ich will ein Dutzend von deiner Art zu meinen Schutzwächtern haben. Als Soldaten.«
Das glatte Ungeheuer warf den Kopf zurück und lachte. Plötzlich hatte es doch einen Mund – mit grausam spitzen Zähnen. Der Stein seines Gesichts – falls es Stein war – schien wie Wasser zu fließen. Wir dienen niemandem.
Thorn hätte gelächelt, wenn es ihm noch möglich gewesen wäre. Stattdessen webte er einfach seinen Bindezauber. Gleichzeitig schirmte er seinen Geist vor dem Schrei ab, von dem er sicher war, dass er gleich folgen würde.
Der Troll versteifte sich. Er kreischte, während seine Zähne wie Felsen in einem überfluteten Fluss gegeneinanderkrachten. Aus seinen glatten Armen wuchsen Hände und Krallen, die nach Thorn griffen.
Der Zauberer regte sich nicht. Das Netz seines Willens legte sich in glitzernden grünen Fäden über die Kreatur und zog sich zusammen. Schnell war alles vorbei.
Ich werde dich und alle deiner Art auf eine Weise töten, die so schrecklich ist, dass dein Verstand sie niemals begreifen wird.
Thorn drehte sich um. »Nein, das wirst du nicht«, sagte er. »Und jetzt gehorche! Wir müssen weitere von deiner Art finden, denn vor uns liegt eine lange Nacht.«
Der Troll tobte unter seinem Netz wie ein Wolf im Käfig. Er schrie – seine glockenartige Stimme hallte durch die Wildnis.
Thorn schüttelte ganz leicht den Kopf. »Gehorche«, sagte er abermals und ließ noch mehr von seinem Willen in das Netz fließen.
Das Ungeheuer leistete ihm Widerstand und zeigte böse schwarze Zähne in einem schwarzen Mund. Sein ganzer Körper strebte Thorn entgegen.
Für Thorn war es wie Armdrücken gegen ein Kind. Gegen ein starkes zwar, aber dennoch bloß gegen ein Kind. Er schmetterte seinen Willen gegen den des Trolls, und dieser zerfiel.
Das war die Art der Wildnis.
Die anderen Trolle waren nicht schwer zu finden, und der zweite war beträchtlich leichter zu überwinden als der erste, aber beim siebenten war es viel schwieriger als beim sechsten. Als die Sonne untergegangen war, hatte er eine lange Reihe von Trollen hinter sich und fühlte sich wie jemand, der schwere Gewichte gestemmt hat und die Arme nicht mehr heben kann.
Er saß in einer engen Schlucht und lauschte dem Wind, während seine Trolle mit leeren Gesichtern um ihn herumhockten.
Nach einiger Zeit, als die Sonne hinter den Rand der Welt gesunken war, fühlte er sich besser und streckte einen Fühler seiner Macht nach der dunklen Sonne in der fernen Festung aus.
Und er zuckte vor dem zurück, was er dort vorfand, denn …
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Der Hauptmann lehnte sich gegen die Zinnen der Ringmauer, die das äußere Tor schützte. Er war hierhergekommen, weil ihm die enge Kommandantur plötzlich zu stickig und bedrückend erschienen war.
Er hatte ihr eine Nachricht hinterlassen. Weil er keine fünfzehn Jahre mehr alt war, hatte er ihr nicht zehn, sondern nur eine einzige geschrieben und sie in die Astgabel des alten Apfelbaums gesteckt. Nachdem er sich verflucht hatte, weil er auf sie gewartet und gehofft hatte, sie könnte wie durch Magie plötzlich erscheinen, war er zu der Ringmauer gegangen, um ein wenig Luft zu schnappen.
Die Sterne leuchteten am fernen Himmel, und unter ihm sah er Feuer im Hof der Brückenburg. Die Unterstadt am Fuß der Erhebung war leer. Eine Rumpfwache hatte man dort stationiert. Kein Licht war zu sehen.
Er blickte in die Dunkelheit hinaus. Die Wildnis war so finster wie das Meer.
Etwas suchte nach ihm. Zuerst war es nur ein Prickeln in seinen Haaren, dann eine Vorahnung von Verderben, und schließlich fühlte er sich so verwundbar wie nie zuvor in seinem Leben. Er kauerte sich auf der Ringmauer zusammen und kämpfte gegen eine besonders schlimme Kindheitserinnerung an.
Als es nicht nachließ, holte er tief Luft und zwang sich, wieder eine aufrechte Haltung einzunehmen. Er drehte sich um und zwang sich, trotz der niederschmetternden Angst die Treppe hochzusteigen, die zum ersten Turm führte. Schon die zweite Stufe war schwierig, und bei der vierten und fünften musste er sich mit den Händen abstützen; bei der achten kroch er bereits auf allen vieren. Aus seinem Willen fügte er ein Schwert zusammen und stieß sich weiter hinauf. Sobald er den Steinturm betreten hatte, wich das Gefühl von ihm.
Bent sprang auf die Beine; in seiner Hand befand sich ein bunt bemaltes Kartenspiel. »Hauptmann!«, rief er, und ein Dutzend Bogenschützen sprang auf die Beine und salutierte ruckartig.
Der Hauptmann sah sich um. »Rührt euch«, sagte er. »Wer ist auf den Mauern?«
»Akrobat«, antwortete Bent. »Halbarsch auf der Hauptmauer, Ser Guillam Langschwert und Schnotz befehligen die Türme mit den Maschinen. Wachwechsel zu jeder vollen Stunde.«
»Verdoppeln«, befahl der Hauptmann. Eigentlich hätte er sich gern entschuldigt – Verzeihung, Jungs, aber ich habe ein ungutes Gefühl, deswegen raube ich euch den Schlaf. Aber er hatte gelernt, sich niemals zu entschuldigen, wenn er einen unliebsamen Befehl gab, und noch weniger durfte er ihn in allen Einzelheiten erklären. Außerdem hatte der erfolgreiche Überfall seiner Stellung als Anführer sehr gut getan. Jeder Kommandant ist nur so gut wie seine letzte Tat.
Bent zog eine Grimasse, machte sich aber sofort daran, seine bestickte Lederjacke zuzubinden. Wie viele andere Veteranen trug Bent sein ganzes Vermögen am Körper; dies bedeutete ein dezentes Prunken, eine Bestätigung seines Wertes und setzte die Bereitschaft voraus, sich all das von seinem Mörder nehmen zu lassen. Der dunkelhäutige Mann sah sich um, und wie alle wahren Soldaten vermieden es seine Mitspieler, ihm ins Auge zu blicken.
»Hetty, Spinner, Larkin, ihr kommt mit mir. Hetty, wenn dir dieser Dienst nicht gefällt, dann schleich dich nicht immer so offensichtlich zu den Latrinen.« Bent sah den jüngsten Mann im Turmzimmer finster an und wandte sich dann wieder an den Hauptmann. »Reicht das, Mylord?«
Der Hauptmann kannte Bent nicht besonders gut, denn er war Ser Jehannes’ Mann, aber er war beeindruckt, dass sein ältester Bogenschütze persönlich auf die Mauer ging. »Weitermachen«, sagte er kühl, ging quer durch den Raum und betrachtete die Münzenhaufen, die Würfel und die Karten auf dem Tisch. Er war sich ziemlich sicher, dass Ser Hugo solch offenes Spielen niemals erlaubt hätte. Er kratzte sich am Bart und winkte Bent herbei.
Der Bogenschütze näherte sich ihm wie ein Hund, der einen Tritt erwartete.
Der Hauptmann deutete auf das Geld. Und sagte nichts.
Bent hob eine Braue und öffnete den Mund.
»Spart euch das«, bemerkte der Hauptmann. »Wie heißt die Regel zum Spiel?«
Bent verzog das Gesicht. »Der Wert des ganzen Spiels darf den Tagessold des geringsten Mannes nicht übersteigen«, sagte er auswendig auf.
Zwei Rosen glitzerten den Hauptmann an, und neben ihnen lag mehr als ein Dutzend Silberleoparden sowie ein Haufen Kupferkatzen. Der Hauptmann legte die Hand auf die Münzen. »Dann müssen sie mir gehören«, sagte er. »Ich bin der einzige Mann in unserer Truppe, der jeden Tag so viel Geld verdient.«
Bent schluckte und kniff verärgert die Augen zusammen.
Der Hauptmann hob die Hand, hatte das Geld nicht angerührt. Er sah den Bogenschützen eindringlich an und lächelte. »Hast du mich verstanden, Bent?«
Der Bogenschütze hätte vor Erleichterung beinahe aufgeseufzt. »Ja, Hauptmann.«
Der Hauptmann nickte. »Gute Nacht, Bent«, sagte er und legte dem Mann kurz die Hand auf die Schulter. Vorbei ist vorbei, es sei denn, du lernst nichts daraus. Er selbst hatte von Experten gelernt, und er wollte glauben, dass er ein guter Hauptmann war.
Er ging hinaus auf die Mauer, und da war es wieder – nicht Angst, sondern ein Gefühl, beobachtet zu werden. Überwacht zu werden. Diesmal war er darauf vorbereitet. Er lenkte seinen Geist in den runden Raum und …
… da war Prudentia.
»Er sucht nach dir«, sagte sie. »Sein Name ist Thorn. Er ist eine Macht der Wildnis. Weißt du noch, wie du es vermeiden kannst, entdeckt zu werden?«
Er blieb vor ihr stehen und küsste ihre Hand.
»Woher weißt du, dass es Thorn ist?«, fragte er.
»Er hat eine Signatur, außerdem hat er heute Abend viele Male die Macht gebraucht und sich Verbündete durch sie geschaffen. Wenn du dem Ätherischen mehr Aufmerksamkeit schenken würdest, anstatt nur …«
Er lächelte. »Bin nicht daran interessiert. Zu viel harte Arbeit.«
Die Tür stand einen Spaltbreit offen. Er ließ sie oft so, damit er bei Bedarf schnell an die Macht herankam, und heute Nacht spürte er jene suchende Gegenwart durch den Spalt in der Tür – mächtiger als alles, was er auf der Mauer gefühlt hatte.
Natürlich.
Er ging an Prudentia vorbei und zog die Tür fest zu. Das schwere Eisenschloss gab ein beruhigendes Klacken von sich.
Nordwestlich von Lissen Carak · Thorn
… die dunkle Sonne erlosch wie eine Fackel, die in einen Teich geworfen wurde.
Zuerst war er orientierungslos. Die dunkle Sonne war immer wieder schwächer und stärker geworden, schwächer und stärker, und die Jahre, in denen die Macht geduldig gewachsen war, hatten ihn gelehrt, nicht zu viel in ihre Fluktuationen hineinzulesen, die durch Entfernung, Wetter, alte Phantasmata, die wie die Geister vergangener Magie zurückgeblieben waren, oder durch Tiere verursacht wurden, die die Macht genauso benutzten wie die Fledermäuse den Klang. Es gab Tausende natürlicher Ursachen, die die Macht verdeckten, so wie andere Faktoren den Klang beeinträchtigten.
Seiner Ansicht nach sollte die Benutzung der Macht zusammen mit der Bewegung des Klanges studiert werden. Dieser Gedanke gefiel ihm, und er spaltete einen Teil seiner selbst ab und dachte über die Ausbreitung des Klanges über weite Strecken hinweg als Allegorie – oder sogar als unmittelbaren Ausdruck – der Macht nach. Währenddessen setzte er sich, atmete tief die Nachtluft ein und hielt beinahe ohne Mühe die Ketten der Macht zusammen, durch welche die Trolle gebunden waren. Ein dritter Teil von ihm suchte mit wachsender Enttäuschung nach der dunklen Sonne.
Ein vierter Gedanke war für seine nächste Handlung entscheidend.
Der Konflikt am Felsen hatte eine Zusammenkunft der Verbündeten und der Helfer erzwungen, woraus sich Risiken und Herausforderungen ergaben, die er nicht vorhergesehen hatte. Wenn er mit der Rekrutierung weitermachte, würde er bald eine Ebene erreichen, auf der er zu einer Bedrohung für seinesgleichen wurde. Schon war der mächtige Wyrm der Grünen Berge auf ihn aufmerksam geworden und betrachtete argwöhnisch die rasche Zusammenballung von Macht und niederen Kreaturen, Menschen und anderen Helfern. Der alte Bär in den Bergen mochte ihn ebenfalls nicht. Und irgendwann würden die Trolle, die eher wie grausame Tiere waren, seine Ketten hassen und einen Weg finden, sich ihrer zu entledigen.
Es war wie bei einem Lehensherrn, der unruhig oder zumindest sehr neugierig wurde, wenn ein Nachbar seine Vasallen herbeirief und eine Armee aufstellte.
Dieser Vergleich kam seinem vierten Selbst in den Sinn, denn dieses war einmal ein Mensch gewesen – ein Mensch, der in der Lage gewesen war, Armeen auszuheben.
Bevor er die Wahrheit gelernt hatte.
Offensichtlich würde die Festung nicht auf sein Kommando hin zerbrechen. Albinkirks äußere Mauer war so leicht gefallen, dass er es zugelassen hatte, von diesem schnellen Sieg verführt zu werden. Aber die Zitadelle, die voller erschrockener Menschen war, befand sich noch nicht unter seinen Klauen, und die Zeit der einfachen Eroberungen war vorbei.
Und was immer die dunkle Sonne sein mochte, sie war mächtig und gefährlich, und die Männer der Gewalt, die sie umgaben, waren tödliche Feinde, die er nicht noch einmal unterschätzen durfte. Aber er konnte es nicht hinnehmen, dass sie sein Land vergifteten und sein Lager angriffen.
Und wo war sein Freund auf dem Felsen?
Genug.
Er hatte seine Wahl treffen müssen, und sie hatte ihn in den Krieg geführt. Jetzt musste er seine Mittel einsetzen, ohne seinesgleichen zu verärgern, und die Festung vom Antlitz der Welt tilgen – als Warnung für all seine Feinde. Er würde den Felsen der Wildnis zurückgeben.
Währenddessen überlegte er sich seine nächsten Schritte. Der Teil von ihm, der die Nachtluft genoss, ging dem goldenen Licht, das von der Äbtissin geworfen wurde, lieber aus dem Weg – als wenn schon das bloße Eingeständnis ihrer Existenz seine Niederlage bedeutete.
Zwanzig Meilen weiter südlich regten sich hundert seiner Kreaturen, wanden sich und schliefen wieder in der kalten Finsternis ein, und zweihundert Menschen drängten sich um ihre Feuer und stellten zu viele Wachen auf. Jenseits der Berge im Norden erwachten Hunderte von Sossag-Kriegern, entzündeten Feuer und bereiteten sich darauf vor, seiner Sache zu dienen. Im Westen und im Norden wurden Kreaturen in ihren Höhlen, Bauen, Löchern und Verstecken wach – weitere Irks, mehr Kobolde und noch mächtigere Kreaturen, ein Dämonenklan, eine Gruppe von goldenen Bären. Und weil Macht andere Macht anzog, würden sie zu ihm kommen.
Die Trolle würden sich den Rittern entgegenstellen. Die Sossag würden ihm verlässlichere Späher sein. Die Irks und Kobolde waren seine Fußtruppen. Am nächsten Morgen würde er über eine Streitmacht verfügen, die mit allem fertig wurde, was die Menschheit zu bieten hatte. Und dann würde er seine Klauen um die Festung schließen.
Natürlich lag eine gewisse Ironie darin, dass er eher den Menschen als den Kreaturen der Wildnis zutraute, gegen Menschen zu kämpfen.
Mit dieser Entscheidung brachen seine verschiedenen Identitäten zusammen und sanken in den Körper unter dem Baum zurück. Dieser Körper reckte und streckte sich, seufzte und glich schon beinahe dem eines Menschen.
Beinahe.
Lissen Carak · Kaitlin Lanthorn
Kaitlin seufzte und rollte gegen die Gestalt neben sich. Sie seufzte erneut und wunderte sich, warum ihre Schwester einen so großen Teil des Bettes für sich allein beanspruchte. Doch dann fiel ihr plötzlich ein, wo sie sich befand, und sie gab ein kehliges Geräusch von sich. Der Mann neben ihr drehte sich um und legte ihr eine Hand auf die Brust. Sie lächelte. Und stöhnte ein wenig.
Er leckte sie unter dem Kinn und küsste sie. Seine Zunge tastete an ihrem Mundwinkel herum, und sie lachte und schlang die Arme um ihn. Sie war keine Schlampe wie ihre Schwestern und hatte nie zuvor einen Mann in ihr Bett gelassen. Aber auch jetzt würde sie sich nicht von ihren schäbigen Plänen oder ihrem schlechten Geschmack beeinflussen lassen. Sie war verliebt.
Ihr Liebhaber fuhr mit der Zunge über ihr Ohrläppchen, während er mit dem Finger sanft über ihre Brustwarze strich. Sie lachte, und er lachte ebenfalls.
»Ich liebe dich«, sagte Kaitlin Lanthorn in die Dunkelheit hinein. Diese Worte hatte sie noch nie zuvor ausgesprochen, nicht einmal vorhin, als er ihr die Jungfernschaft genommen hatte.
»Ich liebe dich auch, Kaitlin«, sagte Michael und bedeckte ihren Mund mit dem seinen.