1
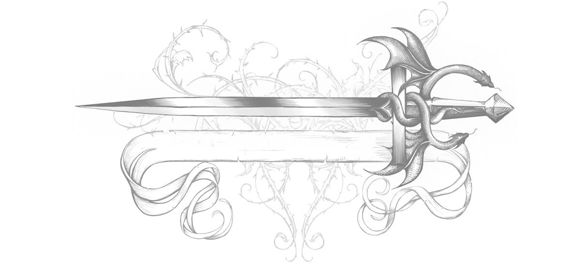
Albinkirk · Ser John Crayford
Der Hauptmann von Albinkirk zwang sich, nicht mehr aus dem schmalen, verglasten Fenster zu starren und stattdessen etwas zu tun.
Er war eifersüchtig. Eifersüchtig auf einen Jungen, der nur ein Drittel seiner Jahre hatte und doch bereits eine ansehnliche Lanzenkompanie befehligte. Der durch die Gegend reiten konnte, während er selbst in einer Stadt saß, die vor lauter Sicherheit recht langweilig geworden war. Und allmählich wurde sie auch noch alt.
Sei kein Narr, sagte er zu sich selbst. All diese Heldentaten geben zwar wundervolle Geschichten ab, aber eigentlich handeln sie doch nur von Kälte, Feuchtigkeit und Entsetzen. Hast du das etwa schon vergessen?
Er seufzte. Seine Hände erinnerten sich an alles – an die Schläge, die Nächte auf dem Boden, die Eiseskälte und die gepanzerten Handschuhe, die nicht richtig passten. Seine Hände schmerzten ständig, sowohl in wachem Zustand als auch im Schlaf.
Der Hauptmann von Albinkirk, Ser John Crayford, hatte sein Leben keineswegs als Edelmann begonnen. Seinen Rang hatte er ausschließlich durch Befähigung erworben.
Durch die Befähigung zur Gewalt.
Und als Dank saß er nun in dieser reichen Stadt mit einer Garnison, die nur zu einem Drittel so groß war, wie sie den schriftlichen Berichten zufolge sein sollte. Eine Garnison aus Söldnern, die die Schwachen umherschubsten, die Frauen missbrauchten und den Kaufleuten Geld abpressten. Eine Garnison, die einfach zu viel Geld besaß, denn ein Posten in ihr beinhaltete das Recht, in Pelzkarawanen aus dem Norden zu investieren. Pelze aus Albinkirk waren so etwas wie ein Weltwunder. Um das Rohmaterial zu bekommen, musste man bloß nach Norden oder Westen in die Wildnis reiten. Und lebend zurückkommen.
Das Fenster des Hauptmanns zeigte nach Nordwesten.
Er riss den Blick davon los. Schon wieder.
Und setzte den Stift auf das Papier. Sorgfältig und angestrengt schrieb er:
Mylord,
eine Aventiuren-Gesellschaft – wohlgeordnet und mit einem Passierschein, der vom Marschall unterzeichnet war – überquerte gestern Morgen die Brücke. Die Gruppe bestand aus fast vierzig Lanzen, und zu jeder von ihnen gehörte ein Ritter, ein Knappe, ein Diener und ein Bogenschütze. Sie waren – nach letzter östlicher Mode und Art – ausgezeichnet bewaffnet und gepanzert: allüberall Stahl. Ihr Hauptmann war höflich, aber reserviert, sehr jung – und wollte seinen Namen nicht nennen. Er bezeichnete sich jedoch als den Roten Ritter. Sein Banner zeigte drei Lac d’Amour in Gold auf einem sandfarbenen Feld. Er erklärte, sie seien überwiegend Untertanen Eurer Gnaden, die aus dem Krieg in Gallyen kämen. Da sein Passierschein in Ordnung war, sah ich keinen Grund, ihn aufzuhalten.
Ser John schnaubte verächtlich, als er sich an die Szene erinnerte. Niemand hatte daran gedacht, ihm mitzuteilen, dass eine kleine Armee aus Osten auf ihn zukam. Früh am Morgen war er zum Tor gerufen worden. Er hatte bloß ein fleckiges Wollwams und eine alte Hose getragen und dann versucht, diesen eingebildeten Welpen in seinen prächtigen scharlachroten und goldenen Farben einfach niederzustarren. Der junge Mann saß auf einem Kriegspferd von der Größe einer Scheune. Ser John hatte nicht genug fähige Soldaten gehabt, um die ganze Bande zu verhaften. Auf dem verdammten Jungen stand über und über Großer Adliger geschrieben, und der Hauptmann von Albinkirk dankte Gott, dass dieser Welpe ohne zu murren den Zoll bezahlt und gute Papiere besessen hatte, denn jeder Zwischenfall wäre gewiss böse ausgegangen. Für ihn.
Er bemerkte, dass er auf das Gebirge starrte. Dann wandte er den Blick ab. Ein weiteres Mal.
Außerdem hatte er einen Brief von der Äbtissin zu Lissen Carak dabei. Im letzten Sommer hatte sie um fünfzig gute Männer bei mir nachgefragt, doch ich hatte ihre Bitte leider ablehnen müssen – Euer Gnaden wissen, dass ich nicht genug Männer habe. Ich vermute, sie wird inzwischen Söldner angeheuert haben, da sie keine Männer aus der Gegend bekommen konnte.
Wir sind, wie Euer Gnaden wissen, zu etwa hundert Mann unterbesetzt. Ich habe nur vier gut ausgerüstete Männer, und viele meiner Bogenschützen sind nicht ganz das, was sie eigentlich sein sollten. Ich möchte respektvoll darum ersuchen, dass Euer Gnaden mich entweder ablösen oder die nötigen Mittel bereitstellen möge, um die Garnison angemessen auszustatten.
Ich verbleibe als Euer demütigster und respektvollster Diener
John Crayford
Der Meister der Kürschnergilde hatte ihn zum Abendessen eingeladen. Ser John lehnte sich zurück und beschloss, die Arbeit für diesen Tag zu beenden. Den Brief ließ er auf dem Schreibtisch liegen.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
»Süßer Jesus«, rief Michael von der anderen Seite der Mauer. Sie war schulterhoch und von Generationen von Bauern mit Steinen errichtet worden, die sie in den Feldern aufgelesen und herbeigeschafft hatten. Gegen die Mauer lehnte ein zweistöckiges Steinhaus mit einigen Nebengebäuden – ein reiches Gehöft. »Süßer Jesus«, sagte der Knappe erneut. »Sie sind alle tot, Hauptmann.«
Da er auf seinem Kriegspferd saß, konnte er über die Mauer bis zu der Stelle sehen, wo seine Männer die Leichen herumrollten und ihnen alle Wertgegenstände abnahmen, während sie nach Überlebenden suchten. Ihrer neuen Auftraggeberin würde das sicher nicht gefallen, aber der Hauptmann entschied, dass ihr diese Plünderung verdeutlichen möge, welcher Männer sie sich nun bediente. Seiner Erfahrung nach war es für gewöhnlich das Beste, wenn die Auftraggeber wussten, was sie für ihr Geld bekamen. Von Anfang an.
Der Knappe des Hauptmanns sprang über die Steinmauer, die den Garten von der Straße trennte, und nahm Toby, dem Pagen des Hauptmanns, einen Stofffetzen ab. Klebriger Schlamm, Ergebnis des endlosen Frühlingsregens, bedeckte seine schenkelhohen Schnürstiefel. Michael zog einen Lumpen aus der Tasche, um seine Erregung zu überspielen, und machte sich daran, seine Stiefel zu säubern. Er war penibel und stets nach der neuesten Mode gekleidet. Sein scharlachroter Überwurf war mit Goldsternen bestickt, und die schwere Wolle musste mehr wert sein als die Rüstung eines Bogenschützen. Er war von hoher Geburt und konnte es sich leisten, also ging es nur ihn selbst etwas an.
Was aber den Hauptmann etwas anging, war der Umstand, dass die Hand des Jungen zitterte.
»Ich hoffe, du wirst bald so weit sein, dass du dich präsentieren kannst«, sagte der Hauptmann leichthin, doch Michael erstarrte bei seinen Worten. Dann beendete er die Säuberung seiner Stiefel und warf Toby den Lumpen zu.
»Verzeihung, Mylord«, sagte er und sah sich dabei rasch über die Schulter. »Es war etwas aus der Wildnis, Mylord. Ich könnte meine Seele drauf verwetten.«
»Kein hoher Einsatz«, sagte der Hauptmann und hielt Michaels Blick stand. Er zwinkerte, sowohl zur Belustigung der Zuschauer als auch zur Beruhigung seines Knappen, der jetzt so weiß im Gesicht war, dass man auf ihm hätte schreiben können. Dann sah er sich um.
Es regnete nur leicht. Der scharlachrote Wollumhang des Hauptmanns wurde zwar immer schwerer, war aber noch nicht völlig durchnässt. Hinter dem ummauerten Gelände erstreckten sich Felder mit dunkler, frisch gepflügter und besäter Erde, die im Regen ebenso schwarz glänzten wie das Pferd des Hauptmanns. Die oberen, zu den Bergen hin gelegenen Felder waren von einem satten frischen Grün und mit Schafen gesprenkelt. Gute und fruchtbare Erde versprach eine reiche Ernte, so weit das Auge zu beiden Seiten des Flusses blicken konnte. Dieses Land war gezähmt; es war mit sauberen geometrischen Mustern aus Hecken und hohen Steinwällen bedeckt, die Ackerflächen und Weiden für Schafe und Kühe voneinander abtrennten. Und der Fluss brachte die Erzeugnisse dann in die Städte des Südens. Die Feldfrüchte und Tiere waren der Grund für den Reichtum des befestigten Nonnenklosters Lissen Carak, das auf einem hohen Felsvorsprung im Süden lag und von hier aus nur als eine gezackte Linie aus blassem Stein sichtbar war. Grau, grau, grau – vom Himmel bis zum Boden. Blassgrau, dunkelgrau, schwarz.
Hinter den Schafen im Norden erhoben sich die Adnaklippen – ein Gebirge mit einer Ausdehnung von zweihundert Wegstunden, das sich über den Feldern erhob und dessen Gipfel sich in den Wolken verloren.
Der Hauptmann lachte über seine eigenen Gedanken.
Das Soldatendutzend, das sich ihm am nächsten befand, blickte auf. Jeder einzelne Kopf drehte sich, und alle Gesichter zeigten den gleichen Ausdruck von Angst.
Der Hauptmann rieb sich den Spitzbart unter seinem Kinn und schüttelte das Regenwasser ab. »Jacques?«, fragte er seinen Diener.
Der ältere Mann saß still auf einem Kriegspferd. Er war besser bewaffnet als die meisten anderen Diener und trug seinen scharlachfarbenen Mantel mit langen, weit herunterhängenden Ärmeln über einem Brustpanzer aus dem Osten. Sein Schwert maß vier Fuß bis zur Klingenspitze. Auch er strich sich das Wasser aus dem Spitzbart, während er nachdachte.
»Mylord?«, fragte er.
»Wie konnte es die Wildnis bis hierher schaffen?«, fragte der Hauptmann. Obwohl er sich mit der gepanzerten Hand das Wasser von den Augen fernhielt, vermochte er den Rand der Wildnis nicht zu erkennen. Innerhalb von einer oder zwei Meilen gab es kein Gehölz, das groß genug gewesen wäre, auch nur ein einziges Tier zu verbergen. Weit hinten im Norden, viele Meilen hinter dem verregneten Horizont und den Bergen, befand sich der Große Wall. Und hinter dem Großen Wall erstreckte sich die Wildnis. Es traf schon zu, dass der Wall an vielen Stellen brüchig war und die Wildnis inzwischen bis ins Land hineinreichte. Die Adnaklippen waren nie urbar gemacht worden. Aber hier …
Hier dämmten Reichtum und Macht die Wildnis ein. Hätten die Wildnis eindämmen sollen.
»Das Übliche«, sagte Jacques leise. »Irgendein Narr muss sie herbeigelockt haben.«
Der Hauptmann kicherte. »Nun«, meinte er und schenkte seinem Diener ein schiefes Grinsen, »ich vermute, sie hätten uns nicht gerufen, würden sie nicht in Schwierigkeiten stecken. Und wir brauchen Arbeit.«
»Es hat die Leute auseinandergerissen«, sagte Michael.
Er war neu im Geschäft und von adligem Geblüt. Der Hauptmann freute sich, wie schnell er die Fassung wiedererlangt hatte. Doch gleichzeitig musste Michael noch vieles lernen.
»Auseinandergerissen«, wiederholte Michael und leckte sich über die Lippen. Seine Augen blickten anderswohin. »Es hat an ihnen gefressen. An allen.«
Er ist schon wieder fast ganz der Alte, dachte der Hauptmann, nickte seinem Knappen zu und ließ seinem Schlachtross Grendel ein wenig die Zügel schießen, sodass es ein paar Schritte zurückwich und sich umdrehte. Das große Pferd roch Blut und noch etwas anderes, das ihm nicht gefiel. Schon in guten Zeiten gefiel ihm zwar das meiste nicht, doch dies hier schien ihm geradezu unheimlich zu sein, und der Hauptmann spürte die Anspannung seines Reittieres. In Anbetracht der Tatsache, dass Grendel eine Maske vor dem Gesicht trug, aus der ein fußlanger Stachel herausragte, konnte die Verärgerung des Pferdes rasch zu schlimmen Verletzungen führen.
Er gab Toby ein Zeichen. Der saß nun in einiger Entfernung von dem einsamen Gehöft und aß, was er immer tat, wenn er sich selbst überlassen blieb. Der Hauptmann drehte sich um und sah seinen Standartenträger sowie seine beiden Marschalle an, die auf ihren nervösen Pferden im Regen saßen und auf seine Befehle warteten.
»Ich lasse Pampe und Tom Schlimm hier zurück. Sie werden Wache halten, bis wir ihnen eine Ablösung schicken«, sagte er. Die Entdeckung der Leichen im Gehöft hatte ihren Weg durch den Schlamm zu dem befestigten Kloster hinüber unterbrochen. Seit der zweiten Stunde nach Mitternacht waren sie geritten, nachdem sie von einem kalten Lager und einem ebenso kalten Essen aufgebrochen waren. Niemand sah glücklich aus.
»Geh und hol mir den Jagdmeister«, fügte er hinzu und drehte sich nach seinem Knappen um. Als er jedoch keine Antwort erhielt, sah er sich um. »Michael?«, fragte er leise.
»Mylord?« Der junge Mann betrachtete gerade die Tür des Gehöfts. Sie bestand aus eisenbeschlagener Eiche und war in zwei Teile zerbrochen. Die eisernen Angeln waren zur Seite gebogen worden. Je drei parallele Einkerbungen durchzogen die Maserung des Holzes. An einer Stelle hatten die Krallen sogar eine Schmuckscheibe aus Eisen sauber durchtrennt.
»Brauchst du noch etwas Zeit, Junge?«, fragte der Hauptmann. Jacques hatte sich zunächst um sein eigenes Reittier gekümmert und stand nun neben Grendels großem Kopf, wobei er den Stachel argwöhnisch beobachtete.
»Nein … nein, Mylord.« Noch immer starrte der Knappe voller Verblüffung auf die Tür und das, was sich hinter ihr befand.
»Dann steh hier bitte nicht herum.« Der Hauptmann stieg ab und fand, dass ihm die Bezeichnung »Junge« wie von selbst über die Lippen gekommen war. Dabei trennten ihn und Michael kaum fünf Jahre.
»Mylord?«, fragte Michael, dem offensichtlich nicht klar war, welchen Befehl er soeben erhalten hatte.
»Beweg deinen Hintern, Junge. Hol mir den Jäger. Sofort.« Der Hauptmann übergab dem Diener die Zügel seines Pferdes. Eigentlich war Jacques gar kein Diener, sondern die rechte Hand des Hauptmanns und hatte als solche einen eigenen Diener: Toby. Er war erst kürzlich zu dem Trupp gestoßen – ein dürres Ding mit großen Augen und flinken Händen, das sich ganz und gar in seinen roten Wollmantel eingehüllt hatte, der ihm viel zu groß war.
Toby nahm das Pferd und sah den Hauptmann voller Heldenverehrung an; ein großer Winterapfel steckte vergessen in seiner Hand.
Der Hauptmann ließ sich ein wenig Heldenverehrung gern gefallen. »Er hat Angst. Lass ihm nicht die Zügel schießen, dann gibt es Schwierigkeiten«, sagte er brummig und hielt inne. »Allerdings könntest du ihm deinen Apfelkern geben«, meinte er, und der Junge lächelte.
Der Hauptmann betrat das Gehöft durch die zersplitterte Tür. Aus der Nähe erkannte er, dass das Dunkelbraun keine Farbe war. Es war Blut.
Hinter ihm gab sein Schlachtross ein Schnauben von sich, das einem menschlichen Spottgelächter verblüffend ähnlich klang. Ob es dem Knappen oder seinem Herrn galt, war hingegen unmöglich zu sagen.
Die Frau hinter der Schwelle war eine Nonne gewesen, bevor sie vom Hals bis zur Gebärmutter aufgeschlitzt worden war. Langes, dunkles Haar, das sich aus ihrem Schleier befreit hatte, rahmte das Grauen ihres fehlenden Gesichts ein. Sie lag in einer großen Lache ihres eigenen Blutes, das zum Teil schon zwischen den Spalten der Bodendielen versickert sein musste. An ihrem Schädel befanden sich noch Spuren von Zähnen. Die Haut in der Nähe des einen Ohres war zerrissen, als hätte etwas für längere Zeit an ihr genagt und sie vom Knochen gefetzt. Der eine Arm war sauber abgetrennt worden; Haut und Muskeln waren so abgefressen, dass nur kleine Stücke übrig geblieben waren; die Knochen und Sehnen hingen noch zusammen. Die andere, weiße Hand mit dem silbernen Ring und der Gravur »IHS« sowie dem Kreuz waren hingegen unberührt geblieben; der Arm war quer über den verwüsteten Körper gelegt worden.
Der Hauptmann sah sie lange an.
Knapp hinter dem roten Kadaver der Nonne befand sich ein einzelner deutlicher Fußabdruck im Blut und Kot, die in der feuchten, kühlen Luft braun und zähklebrig geworden waren. Die Bodendielen aus Kiefernholz, zwischen denen einiges davon eingesickert sein musste, waren von den vielen Füßen, die über sie gelaufen waren, ganz glatt geworden. Das getrocknete Blut verschleierte zwar die Ränder des Abdrucks, doch seine Umrisse waren klar – er hatte mindestens die Größe eines Pferdehufes und wies drei Zehen auf.
Der Hauptmann hörte, wie sein Jagdmeister näher kam und draußen abstieg. Er drehte sich nicht um, war ganz damit beschäftigt, sich nicht zu erbrechen und sich gleichzeitig das Bild dessen einzuprägen, was vor ihm lag. Es gab einen zweiten, verwischten Abdruck tiefer im Raum, wo die Kreatur ihr Gewicht verlagert und sich gebückt hatte, damit sie unter einem niedrigen gewölbten Türsturz in den Hauptraum dahinter gelangen konnte. Mit ihren Klauen hatte sie eine Kerbe ins Holz geschlagen. Eine weitere, dazu passende Kerbe befand sich in dem Balken, der das Fachwerk stützte. Eine Tauklaue.
»Warum ist diese Frau hier gestorben, während es den Rest im Garten erwischt hat?«, fragte er.
Gelfred trat vorsichtig über den Leichnam. Wie die meisten Edelleute trug auch er einen Kurzstab – eigentlich war es nur ein mit Silber überzogener Stecken, ähnlich wie der Stab eines Quacksalbers oder eines Zauberers. Er zeigte damit auf etwas und grub mit der Spitze einen schimmernden Gegenstand aus den Bodendielen.
»Sehr gut«, sagte der Hauptmann.
»Sie ist für die anderen gestorben«, meinte Gelfred. Ein silbernes, mit Perlen besetztes Kreuz baumelte von seinem Stab. »Sie hat versucht, das Wesen aufzuhalten. Sie hat den anderen Zeit zur Flucht gegeben.«
»Wenn es bloß geglückt wäre«, sagte der Hauptmann und deutete auf die Abdrücke.
Gelfred hockte sich neben den ersten, legte seinen Stab ab und schnalzte mit der Zunge.
»Ja, ja«, sagte er. Seine Gelassenheit wirkte aufgesetzt. Sein Gesicht war ganz bleich.
Der Hauptmann konnte es ihm nicht verübeln. In seinem bisherigen kurzen, mit Leichen angefüllten Leben hatte er selten etwas so Schreckliches gesehen. Ein Teil seines Bewusstseins trieb umher, und er fragte sich, ob die betonte Weiblichkeit des Opfers und ihre wunderschönen Haare zum Schrecken ihres Anblicks noch beitrugen. Es mochte so etwas wie eine Entweihung sein. Ein absichtliches Sakrileg.
Doch ein härterer Teil in ihm schlug einen anderen Weg ein. Das Ungeheuer hatte den Arm absichtlich über den Körper gelegt. Und die Bissspuren um die blutigen Augenhöhlen … Er konnte es sich nur allzu gut vorstellen.
Es sollte Entsetzen hervorrufen. Es war beinahe künstlerisch.
Er verspürte den Geschmack von Salz auf der Zunge und wandte sich ab. »Vor mir brauchst du den starken Mann nicht zu spielen, Gelfred«, sagte er, spuckte auf den Boden und versuchte den Geschmack loszuwerden, bevor er sich zum Narren machte.
»In der Tat habe ich noch nie etwas so Schlimmes gesehen«, erklärte Gelfred und holte tief und langsam Luft. »Gott sollte das nicht zulassen«, fügte er verbittert hinzu.
»Gelfred«, sagte der Hauptmann und lächelte gequält, »Gott ist das hier völlig egal.«
Ihre Blicke trafen sich. Gelfred sah weg. »Ich werde alles herausfinden, was es herauszufinden gibt«, sagte er grimmig. Ihm gefielen die Blasphemien des Hauptmanns nicht – das war seiner Miene deutlich abzulesen. Besonders dann nicht, wenn er mit Gottes Macht arbeiten wollte.
Gelfred hielt seinen Stab in die Mitte des Abdrucks, und so entstand ein Augenblick des Wechsels, als ob sich ihre Augen an eine neue Lichtquelle oder an stärkeren Sonnenschein gewöhnt hätten.
»Pater noster qui es in caelus«, intonierte Gelfred.
Der Hauptmann ließ ihn allein.
Im Garten hatten Ser Thomas’ Knappe und ein halbes Dutzend Bogenschützen die Leichen von ihren Wertgegenständen befreit und alle Körperteile eingesammelt, die im ummauerten Garten verstreut gewesen waren. Sie hatten alles so weit wie möglich wieder zusammengefügt und in Umhänge eingewickelt. Zwei der Männer waren ganz grün im Gesicht, und der Geruch von Erbrochenem überdeckte beinahe noch den Gestank von Blut und Kot. Ein dritter Bogenschütze wischte sich gerade die Hände an einem Leinenhemd ab.
Ser Thomas – für jeden in der Gruppe einfach nur »Tom Schlimm« – war sechs Fuß und sechs Zoll groß, hatte dunkles Haar, eine gewölbte Stirn und schlimme Angewohnheiten. Er war launisch, und man ging ihm besser aus dem Weg, wenn er verärgert schien. Nun beobachtete er seine Männer aufmerksam, holte dabei ein Amulett hervor und hielt es fest in der Hand. Er drehte sich um, als er die Eisenstiefel des Hauptmanns auf dem steinernen Pfad klappern hörte, und salutierte knapp vor ihm. »Die Jungs haben sich ihr Geld heute hart verdient, Hauptmann.«
Das hieß nicht viel, denn sie bekamen ihr Geld erst, wenn der Vertrag unterzeichnet war.
Der Hauptmann grunzte bloß. Sechs Leichen lagen im Garten.
Tom Schlimm hob eine Braue und reichte ihm etwas.
Der Hauptmann betrachtete es und schürzte die Lippen. Er steckte die kleine Kette in den Beutel an seiner Hüfte und klopfte Tom Schlimm auf die ausgepolsterte Schulter. »Bleib hier und schlaf nicht ein«, sagte er. »Du kannst auch Pampe und Wallach haben.«
Tom Schlimm zuckte mit den Schultern und leckte sich die Lippen. »Pampe und ich kommen nicht besonders gut miteinander aus.«
Der Hauptmann musste innerlich grinsen, als dieser Riese von einem Mann, der in der ganzen Gruppe gefürchtet war, zugab, dass er Schwierigkeiten mit einer Frau hatte.
Gerade eben kletterte sie über die Mauer und gesellte sich zu ihnen.
Pampe hatte sich ihren Namen als Hure erworben, weil sie einigen Kunden gegenüber allzu pampig geworden war. Sie war groß, und im Regen hatte ihr rotes Haar eine dunkelbraune Färbung angenommen. Sommersprossen verliehen ihr ein so unschuldiges Aussehen, dass es einer Lüge gleichkam. Sie hatte sich einen Namen gemacht, und dieser Umstand sagte bereits alles.
»Hat Tom es schon versaut?«, fragte sie.
Tom sah sie finster an.
Der Hauptmann holte tief Luft. »Seid nett zueinander, Kinder. Ich brauche hier meine besten Wächter; sie müssen hellwach sein und einen klaren Kopf behalten.«
»Es wird nicht zurückkommen«, sagte sie.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Bleibt trotzdem hellwach. Tut es für mich.«
Tom Schlimm warf Pampe einen Kuss zu. »Für dich«, sagte er.
Sie griff nach ihrem Reiterschwert, und im nächsten Augenblick lag es in ihrer Hand.
Der Hauptmann räusperte sich.
»Er behandelt mich wie eine Hure. Ich bin aber keine.« Sie hielt ihm das Schwert vor das Gesicht. Tom Schlimm bewegte sich nicht.
»Sag ihr, dass es dir leidtut, Tom.« Der Hauptmann klang, als wäre das alles bloß ein großer Spaß.
»Ich hab doch gar nichts gesagt. Überhaupt nicht! Ich hab sie bloß ein bisschen geneckt«, meinte Tom. Speichel flog von seinen Lippen.
»Du wolltest sie beleidigen. Und sie hat es als Beleidigung aufgefasst. Du kennst die Regeln, Tom.« Nun klang die Stimme des Hauptmanns verändert. Er sprach so leise, dass Tom sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen.
»Entschuldigung«, murmelte Tom wie ein Schuljunge. »Hexe.«
Pampe grinste. Schon lag die Spitze ihres Reiterschwertes auf der breiten Stirn des Mannes, knapp oberhalb des Auges.
»Miststück«, knurrte Tom.
Der Hauptmann beugte sich zu ihm vor. »Keiner von euch beiden will das hier. Ist doch klar, dass ihr beiden bloß so tut. Regt euch ab oder tragt die Konsequenzen. Tom, Pampe will wie deinesgleichen behandelt werden. Pampe, Tom ist ein harter Kerl, aber du reizt ihn bei jeder Gelegenheit. Wenn du zu dieser Gruppe gehören willst, musst du deinen Patz in ihr auch annehmen.«
Er hob die gepanzerte Hand. »Wenn ich bis drei gezählt habe, lasst ihr voneinander ab. Pampe wird ihr Schwert wieder in die Scheide stecken, und Tom wird sich noch einmal entschuldigen. Dann wird Pampe diese Entschuldigung annehmen. Andernfalls könnt ihr eure Sachen nehmen, abhauen und euch gegenseitig umbringen – aber nicht, solange ihr zu meinen Leuten gehört. Ist das klar? Drei. Zwei. Eins.«
Pampe trat zurück, salutierte mit ihrer Klinge und steckte sie weg, ohne hinzusehen oder nach der Scheide zu tasten.
Tom ließ einen Augenblick verstreichen. Es war reine Anmaßung. Doch dann geschah etwas mit seinem Gesicht, und er verneigte sich – es war eine anständige Verbeugung, bei der sein rechtes Knie den Schlamm berührte. »Ich bitte demütig um deine Vergebung«, sagte er mit lauter, klarer Stimme.
Pampe lächelte. Zwar war es kein hübsches Lächeln, aber es verwandelte ihr Gesicht, auch wenn ihre Schneidezähne fehlten. »Und ich bitte um die deine, Herr Ritter«, erwiderte sie. »Ich bedauere meine … Haltung.«
Offensichtlich hatte sie Tom damit verblüfft. Die Welt des großen Mannes bestand aus Herrschen und Unterwerfen, und Pampe stand darin weit unter ihm. Der Hauptmann konnte wie in einem Buch in ihm lesen. Und er dachte: Dafür hat Pampe etwas verdient. Sie ist ein guter Kerl.
Gelfred erschien neben seinem Ellbogen. Vermutlich hatte er auf das Ende dieses Dramas gewartet.
Der Hauptmann spürte das Verkehrte bereits, noch bevor er sah, was sein Jäger in den Händen trug – wie eine gute Hausfrau, die von einer Pilgerreise zurückkehrte und etwas Totes unter ihren Bodendielen roch. Es war genauso, bloß stärker und noch verkehrter.
»Ich habe sie auf den Bauch gerollt. Das hier hat unter ihrem Rücken gelegen«, sagte Gelfred. Er hatte das Ding mit seinem Rosenkranz umwickelt.
Der Hauptmann schluckte wieder einmal seine Galle herunter. Ich liebe diese Arbeit, rief er sich in Erinnerung.
Auf den ersten Blick sah es wie ein Stab aus – am Schaft zwei Finger dick und nadelspitz am anderen Ende, das nun dunkel und blutverkrustet war. Dornen sprossten aus dem Stängel hervor, aber das Ganze war gefiedert. Ein Pfeil. Oder eher die obszöne Parodie eines Pfeils, geschnitzt aus …
»Hexenholz«, sagte Gelfred.
Der Hauptmann zwang sich dazu, es entgegenzunehmen, ohne dabei zusammenzuzucken. Es gab einige Geheimnisse, für deren Bewahrung er einen hohen Preis zahlen musste. Er dachte an den letzten Pfeil aus Hexenholz, den er gesehen hatte – und schob den Gedanken sofort wieder beiseite.
Den Stab hielt er eine Weile in der Hand. »Und?«, fragte er mit gespielter Unbekümmertheit.
»Sie wurde im Rücken getroffen – von diesem Hexenstab –, als sie noch lebte.« Gelfred kniff die Augen zusammen. »Und dann hat ihr das Ungeheuer das Gesicht abgerissen.«
Der Hauptmann nickte und gab den Schaft seinem Jäger zurück. Als sich seine Finger davon lösten, fühlte er sich sogleich leichter, und dort, wo die Dornen durch seine ledernen Handschuhe gedrungen waren, hatte er den Eindruck, als wäre er mit Giftsumach in Berührung gekommen. Finger und Daumen juckten und fühlten sich taub und vergiftet an.
»Bemerkenswert«, sagte der Hauptmann.
Pampe beobachtete ihn.
Diese verdammten Frauen und ihre Gabe der Beobachtung, dachte er.
Ihr Lächeln zwang ihn dazu, es zu erwidern. Die Knappen und Diener im Garten atmeten wieder leichter, und der Hauptmann war sich nun sicher, dass sie wach bleiben würden. Schließlich lief ein Mörder frei herum, der sich verbündeter Ungeheuer der Wildnis bediente.
Er ging zu seinem Pferd zurück. Jehannes, sein Marschall, trat neben ihn und räusperte sich. »Diese Frau macht nur Schwierigkeiten«, sagte er.
»Genau wie Tom«, erwiderte der Hauptmann.
»Keine andere Gruppe wollte sie aufnehmen.« Jehannes spuckte aus.
Der Hauptmann sah seinen Marschall an. »Sei ehrlich, Jehannes«, sagte er, »wer würde denn Tom aufnehmen? Er hat mehr von seinen eigenen Kameraden getötet als Judas Ischariot.«
Jehannes wandte den Blick ab. »Ich trau ihr nicht«, sagte er.
Der Hauptmann nickte. »Ich weiß. Wir sollten uns auf den Weg machen.« Er überlegte, in den Sattel zu springen, doch dann entschied er, dass er zu müde dafür war, und außerdem wäre diese Zurschaustellung seiner Kraft bei Jehannes ohnehin verschwendet. »Du magst sie nicht, weil sie eine Frau ist«, sagte er und stellte den linken Fuß in den Steigbügel.
Grendel war so groß, dass er das linke Knie so tief beugen musste, wie es sein Beinschutz erlaubte. Das Pferd schnaubte erneut. Toby hielt die Zügel fest.
Der Hauptmann sprang auf; mit dem rechten Bein katapultierte er seine sechs Fuß Körpergröße und die zusätzlichen fünfzig Pfund aus Kettenhemd und Panzer in den Sattel. Er hob das Knie über den hohen Knauf des Kriegssattels und setzte sich zurecht.
»Ja«, sagte Jehannes und lenkte das eigene Pferd zurück an seinen Platz in der Reihe.
Der Hauptmann bemerkte, dass Michael hinter Jehannes hersah. Der jüngere Mann drehte sich um und schaute den Hauptmann mit erhobener Braue an.
»Willst du etwas sagen, junger Michael?«, fragte der Hauptmann.
»Was war das für ein Stab, Mylord?« Michael war ganz anders als der Rest – vornehm. Eher ein Lehrling als ein Mietling. Als Knappe des Hauptmanns besaß er besondere Vorrechte. Er durfte Fragen stellen, und der Rest der Gruppe musste sehr still dasitzen und den Antworten lauschen.
Der Hauptmann sah ihn eine Weile an und dachte nach. Dann zuckte er die Achseln – was für einen Mann in einer Rüstung nicht so einfach war.
»Hexenholz«, sagte er. »Ein Pfeil aus Hexenholz. Die Nonne hatte große Macht.« Er zog eine Grimasse. »Bis ihr jemand einen Hexenholzpfeil in den Rücken geschossen hat.«
»Eine Nonne?«, fragte Michael. »Eine Nonne, die Macht hatte?« Er hielt inne. »Wer hat sie erschossen? Heiliger Jesus, Mylord, soll das etwa heißen, dass die Wildnis Verbündete hat?«
»Das ist nichts Besonderes, mein Junge. Gar nichts Besonderes.« Sein Bildgedächtnis, das nur allzu gut ausgebildet war, betrachtete die Dinge wie die Räume in seinem Palast der Erinnerung. Die gesplitterte Tür, der gesichtslose Leichnam, der Arm, der Pfeil aus Hexenholz. Dann blickte er auf den Pfad, der vom Gartentor bis zur Haustür führte.
»Warte auf mich«, sagte er.
Er drehte Grendel, lenkte ihn durch den Hof und folgte der Steinmauer bis zum Garten. Er stellte sich in die Steigbügel, spähte über die Mauer und verband durch seine Blicke das offene Gartentor mit der gesplitterten Haustür. Mehrfach sah er sich über die Schulter.
»Mutwill!«, rief er.
Sein Bogenschütze erschien. »Was ist los?«, murmelte er.
Der Hauptmann deutete auf die beiden Türen. »Wie weit entfernt könntest du stehen, um noch immer jemanden zu treffen, der sich hinter der Haustür befindet?«
»Was? Wenn ich in das Haus hineinschießen wollte?«, fragte Mutwill Mordling.
Der Hauptmann nickte.
Mutwill schüttelte den Kopf. »Nicht so weit«, gab er zu. »Man hat schnell zu hoch gezielt, und dann trifft der Pfeil den Türrahmen.« Er erwischte eine Laus an seinem Kragen und zerquetschte sie zwischen den Fingernägeln. Dann sah er den Hauptmann an. »Er hätte näher dran stehen müssen.«
Der Hauptmann nickte. »Gelfred?«, rief er.
Der Jäger stand vor der Haustür und fuhr gerade mit seinem Stab über einen reptilienartigen Abdruck auf dem Weg. »Mylord?«
»Sieh zu, ob ihr, du und Mutwill, Spuren hinter dem Haus findet. Mutwill wird dir zeigen, wo der Bogenschütze gestanden haben könnte.«
»Das macht mich immer so fertig. Nehmt doch Langpfote dafür«, murmelte Mutwill.
Der milde Blick des Hauptmanns lag eine Weile auf ihm, dann zuckte der Bogenschütze zusammen.
Nun wendete der Hauptmann sein Pferd und seufzte. »Folgt uns, sobald ihr die Spuren gefunden habt«, sagte er und winkte Jehannes zu. »Wir gehen zur Festung und besuchen die Äbtissin.« Er setzte Grendel ganz sanft die Sporen in die Flanken. Der Hengst schnaubte und ließ sich dazu herab, in den Regen hinauszureiten.
Der Rest des Ritts am Ufer des Cohocton entlang war ereignislos. Die Truppe hielt bei der befestigten Brücke an, die von dem Felsen und den grauen Mauern der Klosterfestung darauf überragt wurde. Leinenzelte erhoben sich wie schmutzige weiße Blumen aus dem schlammigen Feld, und die Baldachine für die Offiziere wurden soeben ausgeladen. Gruppen von Bogenschützen hoben Feuerstellen und Latrinen aus, und Knappen und Diener sowie das zahlreiche Gefolge – Handwerker und Marketender, entlaufene Leibeigene, Huren, Knechte sowie freie Männer und Frauen, die sich einen Platz erwerben wollten – richteten die riesigen hölzernen Wände auf, die dem Lager als zeitweilige Bollwerke und Türme dienten. Die Viehtreiber, wesentlicher Bestandteil einer jeden derartigen Truppe, füllten die Zwischenräume mit ihren schweren Wagen auf. Pferde wurden angebunden, und Wachen wurden aufgestellt.
Die Türwächterin der Äbtissin hatte den Söldnern ausdrücklich verboten, durch ihr Tor zu schreiten. Die Söldner hatten nichts anderes erwartet, und einige Altgediente unter ihnen schätzten die Höhe der Mauern und die Möglichkeit ab, sie zu erklettern. Zwei Bogenschützenveteranen – Kanny, der zugleich der Winkeladvokat der Truppe war, und Scrant, der unablässig aß – standen vor dem frisch errichteten Holztor des Lagers und dachten darüber nach, wie sie ins Dormitorium der Nonnen eindringen konnten.
Der Hauptmann musste grinsen, als er an ihnen vorbeiritt, ihre Salute entgegennahm und weiter der steilen Kiesstraße folgte, die von der befestigten Ortschaft am Fuß der Erhebung über etliche Serpentinen hoch zum Torhaus der Festung und hindurch in den Hof führte. Hinter ihm stiegen sein Bannerträger, die Marschalle und sechs seiner besten Lanzenwerfer nach seinem leisen Befehl ab und stellten sich neben ihre Pferde. Sein Knappe hielt seinen verzierten Helm, während sein Diener das Kriegsschwert trug. Es war ein beeindruckender Aufzug und warb erfolgreich für sie, wie der Hauptmann an den vielen Köpfen hinter jedem Fenster und jeder Tür ablesen konnte, die sich zum Hof hin öffneten.
Eine große Nonne in schiefergrauem Habit – der Hauptmann unterdrückte die blitzartig aufsteigende Erinnerung an den Leichnam hinter der Schwelle des Gehöfts – streckte die Hände nach den Zügeln seines Pferdes aus. Eine zweite Nonne machte ein Zeichen mit der Hand. Beide sprachen kein Wort.
Zufrieden bemerkte der Hauptmann, dass Michael trotz des Regens mit großer Anmut abstieg und Grendels Haupt ergriff, ohne dabei die Nonne mit Gewalt zur Seite zu drängen.
Er lächelte die Nonnen an und folgte ihnen durch den Hof auf die am üppigsten verzierte Tür zu, deren eiserne Beschläge und hölzerne Bohlen verschlungene Muster trugen. Im Norden erhob sich ein Dormitorium hinter drei niedrigen Hütten, die vermutlich als Werkstätten dienten – Schmiede, Färberei und Wollkämmerei, wie ihm seine Nase verriet. Im Süden stand eine Kapelle, die viel zu schön und zerbrechlich für diese kriegerische Umgebung wirkte. Gleich daneben erstreckte sich wie in kosmischer Ironie ein langer, niedriger und mit Schieferplatten gedeckter Stall.
Vor der mit reichem Schnitzwerk versehenen Kapellentür stand ein Mann. Er trug ein schwarzes Habit mit einer Seidenkordel um die Hüfte, war groß und dabei so dünn, dass es fast grotesk wirkte. Seine Hände waren mit alten Narben übersät.
Dem Hauptmann gefielen seine blauen, ausdruckslosen Augen gar nicht. Der Mann war nervös und weigerte sich, ihn anzublicken – und er war ohne jeden Zweifel wütend.
Der Hauptmann wandte den Blick von dem Priester ab und betrachtete die Reichtümer der Abtei mit dem Auge eines Geldverleihers, der einen möglichen Kunden abschätzt. Das beträchtliche Einkommen der Abtei zeigte sich deutlich an dem gepflasterten Hof, dem sauberen Feuerstein und Granit der Ställe sowie an dem dekorativen Streifen aus glasierten Ziegeln, aber auch am Kupfer der Dächer und den Bleirohren, durch die das Regenwasser in eine Zisterne floss. Der Hof hatte einen Durchmesser von dreißig Schritten und war damit so groß wie die Höfe der Burgen, in denen er als Kind gelebt hatte. Die Mauern waren hoch; hinter ihm lag der äußere Befestigungsring, vor ihm befand sich das eigentliche Kloster mit Türmen an jeder Ecke, alle aus nassem Stein und nassem Blei sowie regenglatten Pflastersteinen. Er betrachtete die schwarze, ausgebleichte Robe des Priesters und den ungefärbten Umhang der Nonne.
Nur Grauschattierungen, dachte er und lächelte, während er die Stufen zur massiven Klosterpforte hochschritt, die von einer weiteren schweigenden Nonne geöffnet wurde. Sie führte ihn die Halle entlang – eine große Halle, die durch Bleiglasfenster hoch oben in den Wänden erhellt wurde. Die Äbtissin thronte wie eine Königin in einem gewaltigen Sessel, der am Nordende der Halle auf einem Podest stand. Sie trug ein Gewand, dessen Grau gerade genug Färbung aufwies, um im vielfarbigen Licht die Erinnerung an einen äußerst blassen Lavendel zu wecken. Sie schien einmal sehr schön gewesen zu sein; selbst in ihren mittleren Jahren zeigte sich diese Schönheit noch, und nicht nur in ihrem Gesicht. Der hohe Kragen des Gewandes enthüllte kaum etwas von ihr, doch ihre Haltung wirkte mehr als nur vornehm oder gar überheblich. Sie schien sich ihrer selbst auf eine Art bewusst zu sein, wie es nur die Großen im Lande waren. Der Hauptmann bemerkte, dass ihre Nonnen ihr mit einem Eifer gehorchten, der entweder einer Angst oder der Dienstfreude entsprang.
Der Hauptmann fragte sich, was von beidem wohl zutraf.
»Ihr habt lange gebraucht, bis hierher«, sagte sie zur Begrüßung. Dann schnippte sie mit den Fingern und befahl zwei ihrer Nonnen, ein Tablett herbeizubringen. »Wir sind Dienerinnen Gottes. Glaubt Ihr nicht, dass es besser gewesen wäre, wenn Ihr vor dem Betreten meiner Halle Eure Rüstung ausgezogen hättet?«, fragte die Äbtissin. Sie sah sich um, fing den Blick einer Novizin auf und hob eine Braue. »Hol dem Hauptmann einen Stuhl«, sagte sie. »Aber keinen gepolsterten, sondern einen stabilen.«
»Ich trage meine Rüstung jeden Tag«, erwiderte der Hauptmann. »Sie gehört zu meinem Beruf.« Die große Halle war genauso ausgedehnt wie der Hof draußen und hatte hohe Fenster mit einer bunten Bleiverglasung knapp unterhalb des Daches. Die massiven Deckenbalken waren vor Alter und Ruß schwarz geworden. Die Wände waren verputzt und weiß gekalkt, und in den Nischen befanden sich die Bilder von Heiligen sowie zwei wertvolle Bücher, die offensichtlich die Besucher beeindrucken sollten. Die Stimme der Äbtissin hallte im Raum wider, in dem es kälter war als auf dem feuchten Hof draußen. Im zentralen Kamin brannte kein Feuer.
Die Dienerinnen der Äbtissin brachten ihr Wein, an dem sie nippte, während neben dem Ellbogen des Hauptmanns, der sich drei Fuß unter ihr befand, ein kleiner Tisch aufgestellt wurde. »Vielleicht ist Eure Rüstung in einem Nonnenkloster unnötig?«, fragte sie.
Er hob eine Braue. »Ich sehe hier eine Festung«, antwortete er. »Es scheint lediglich, dass sich Nonnen darin befinden.«
Sie nickte. »Würde Eure Rüstung Euch retten, wenn ich meinen Männern befehlen würde, Euch zu ergreifen?«, fragte sie.
Die Novizin, die ihm den Stuhl brachte, war sehr hübsch und bewegte sich mit der umsichtigen Leichtigkeit eines Schwertkämpfers oder einer Tänzerin. Er drehte ihr den Kopf zu, wollte ihren Blick auffangen und spürte das Ziehen ihrer Macht. Nun erkannte er, dass sie nicht nur hübsch war. Sie stellte den schweren Stuhl ab und schob ihn von hinten sanft gegen seine Kniekehlen. Wie zufällig berührte sie der Hauptmann am Arm, sodass sie sich zu ihm umdrehte. Er sah sie an und wandte der Äbtissin dabei den Rücken zu.
»Danke«, sagte er und schenkte ihr ein wohlberechnetes Lächeln. Sie war groß und jung und äußerst anmutig, hatte weit auseinanderstehende mandelförmige Augen und eine lange Nase. Sie war nicht hübsch, sondern faszinierend.
Sie errötete; die Farbe erstreckte sich wie ein Feuer über ihren Hals und unter die schwere Wollrobe.
Er wandte sich wieder der Äbtissin zu: Er hatte sein Ziel erreicht. Der Hauptmann fragte sich, warum sie eine solch begehrenswerte Novizin in seine Reichweite geschickt hatte. War das Absicht gewesen? »Wenn ich beschließen sollte, Eure Abtei zu erstürmen, würde Eure Frömmigkeit Euch dann retten?«, fragte er.
Sie glühte vor Wut. »Wie könnt Ihr es wagen, mir den Rücken zuzukehren?«, wollte sie wissen. »Verlass den Raum, Amicia. Der Hauptmann hat dich mit seinen Augen gebissen.«
Er lächelte. Ihre Wut hielt er für vorgespielt.
Sie begegnete seinem Blick und kniff die Augen zusammen, dann faltete sie die Hände, als wollte sie beten.
»Ehrlich, Hauptmann, ich habe immer wieder um die richtige Entscheidung gebetet. Euch zum Kampf gegen die Wildnis aufzufordern ist wie einen Wolf zum Schutz einer Schafsherde zu kaufen.« Sie sah ihm fest in die Augen. »Ich weiß, was Ihr seid«, meinte sie.
»Wirklich?«, fragte er. »Umso besser, Äbtissin. Können wir dann zum Geschäft kommen, nachdem wir die Höflichkeiten ausgetauscht haben?«
»Wie soll ich Euch nennen?«, wollte sie wissen. »Ihr seid trotz Eures abfälligen Verhaltens ein Mann von edlem Geblüt. Mein Kammerherr …«
»Hatte keinen passenden Namen für mich bereit, nicht wahr, Äbtissin?« Er nickte. »Ihr könnt mich Hauptmann nennen. Einen anderen Namen brauch ich nicht.« Er nickte höflich. »Mir missfällt der Name, den Euer Kammerherr benutzt hat. Bourc. Ich nenne mich selbst den Roten Ritter.«
»Viele Männer heißen Bourc«, sagte sie. »Außerehelich geboren zu sein bedeutet …«
»… schon vor der Geburt von Gott verflucht zu sein, nicht wahr, Äbtissin?« Er versuchte die Wut zu zügeln, die sich wie ein Erröten über seine Wangen legte. »Das ist so hübsch. So gerecht.«
Sie sah ihn finster an und war wütend auf sich, so wie ältere Menschen oft wütend auf die Jungen sind, wenn sie sich zu sehr in den Vordergrund stellen.
Mit einem Blick hatte er sie verstanden.
»Zu düster? Sollte ich etwas Heldentum hinzufügen?«, fragte er mit einer gewissen Theatralik.
Sie sah ihn fest an. »Wenn Ihr Euch in Dunkelheit hüllt«, sagte sie, »riskiert Ihr lediglich, langweilig zu wirken. Aber Ihr seid gewitzt genug, um das zu wissen. Es gibt also noch Hoffnung für Euch. Nun aber zum Geschäft. Ich bin nicht reich …«
»Ich bin noch nie jemandem begegnet, der zugegeben hätte, reich zu sein«, stimmte er ihr zu. »Oder genug Schlaf zu bekommen.«
»Mehr Wein für den Hauptmann«, fuhr die Äbtissin die Schwester an, die die Tür bewacht hatte. »Aber ich kann Euch bezahlen. Wir werden von etwas heimgesucht, das aus der Wildnis kommt. Es hat in diesem Jahr bereits zwei meiner Gehöfte zerstört und im letzten Jahr eines. Zuerst … zuerst hatten wir alle gehofft, dass es nur vereinzelte Zwischenfälle seien.« Sie sah ihn offen an. »Aber das können wir nun nicht mehr glauben.«
»Es waren drei Gehöfte in diesem Jahr«, sagte der Hauptmann und fischte in seinem Beutel herum. Dann zögerte er eine Weile, die Kette mit dem Amulett herauszuholen, und zog stattdessen schließlich ein mit Perlen versehenes Kreuz hervor.
»Oh, bei den Wunden Christi!«, fluchte die Äbtissin. »Die heilige Jungfrau möge sie beschützen und erhalten. Schwester Hawisia! Ist sie …«
»Sie ist tot«, sagte der Hauptmann. »Und im Garten lagen noch sechs weitere Leichen. Eure gute Schwester ist bei dem Versuch gestorben, die anderen Nonnen zu beschützen.«
»Sie hatte einen sehr starken Glauben«, meinte die Äbtissin. Ihre Augen waren trocken, aber ihre Stimme zitterte. »Ihr dürft sie nicht verspotten.«
Der Hauptmann runzelte die Stirn. »Die Mutigen verspotte ich nie, Äbtissin. Sich einem solchen Wesen ohne Waffen entgegenzustellen …«
»Der Glaube war ihre Waffe gegen das Böse, Hauptmann.« Die Äbtissin beugte sich vor.
»Stark genug, um eine Kreatur aus der Wildnis aufzuhalten? Nein, das war er nicht«, sagte der Hauptmann gelassen. »Über das Böse möchte ich hingegen keine Worte verlieren.«
Die Äbtissin erhob sich ruckartig. »Ihr seid so etwas wie ein Atheist, nicht wahr, Hauptmann?«
Abermals zog der Hauptmann die Stirn kraus. »Ein theologisches Streitgespräch bringt uns nicht weiter, Äbtissin. Eure Ländereien haben ein bösartiges Wesen angelockt – einen Feind der Menschen. Sie jagen selten allein, insbesondere nicht so weit entfernt von der Wildnis. Ihr wollt, dass ich Euch von diesem Wesen befreie. Das kann ich tun. Und ich werde es tun. Aber dafür werdet Ihr mich bezahlen müssen. Das ist alles, was zwischen uns von Bedeutung ist.«
Die Äbtissin setzte sich wieder; ihre Bewegungen waren heftig und voller Wut. Der Hauptmann spürte, dass sie das seelische Gleichgewicht verloren hatte – dass der Tod der Nonne sie persönlich getroffen hatte. Schließlich war sie im Grunde nichts anderes als die Oberbefehlshaberin einer Truppe von Nonnen.
»Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung ist, Euch anzuheuern«, sagte sie.
Der Hauptmann nickte. »Vielleicht ist sie es auch nicht, Äbtissin. Aber Ihr habt nach mir gerufen, und hier bin ich.« Ohne es zu wollen, hatte er die Stimme gesenkt.
»Ist das eine Drohung?«, fragte sie.
Statt einer Antwort griff der Hauptmann wieder in seinen Beutel und holte die zerbrochene Kette mit dem kleinen Blatt aus grüner Emaille auf Bronzegrund hervor.
Die Äbtissin zuckte zurück, als hätte sie eine Schlange erblickt.
»Meine Männer haben dies hier gefunden«, sagte er.
Die Äbtissin wandte den Kopf zur Seite.
»Ihr habt einen Verräter in den eigenen Reihen«, erklärte er und stand auf. »Schwester Hawisia hatte einen Pfeil im Rücken. Sie wurde getroffen, während sie etwas Schrecklichem gegenüberstand – etwas sehr, sehr Schrecklichem.« Er nickte. »Ich werde jetzt einen Spaziergang innerhalb der Mauern machen. Sicherlich möchtet Ihr in aller Ruhe darüber nachdenken, ob Ihr uns beauftragen wollt oder nicht.«
»Ihr werdet uns vergiften«, sagte sie. »Ihr und Euresgleichen bringen keinen Frieden.«
Er nickte erneut. »Wir bringen Euch keinen Frieden, sondern Schwerter.« Er grinste über dieses fehlerhafte Zitat aus der Heiligen Schrift. »Aber wir sind es nicht, die die Gewalt erschaffen. Wir stellen uns ihr nur entgegen, wenn sie zu uns getragen wird.«
»Auch der Teufel kann aus der Schrift zitieren«, sagte sie.
»Zweifellos hatte er seinen Anteil an ihrer Abfassung«, erwiderte der Hauptmann.
Sie hielt eine Entgegnung zurück – er beobachtete, wie sich ihre Miene veränderte, als sie beschloss, ihn nicht weiter zu reizen. Und dann verspürte er ein schwaches Gefühl der Reue, weil er sie angestachelt hatte. Es war ein dumpfer Schmerz von der Art, wie er in sein Handgelenk fuhr, wenn er an einem vorherigen Tag zu viele Schwertübungen gemacht hatte. Doch er hatte keine Übung im Umgang mit Reue.
»Ich würde sagen, es ist jetzt ein wenig spät, um an Frieden zu denken.« Er setzte ein höhnisches Grinsen auf und ließ es gleich wieder verschwinden. »Meine Männer sind hier, und sie haben schon seit Wochen kein gutes Mahl und keine bezahlte Arbeit mehr gehabt. Ich sage dies nicht als Drohung, sondern lediglich als eine nützliche Mitteilung, die Eurer Entscheidungsfindung dienen könnte. Ich glaube auch, dass die Kreatur, mit der Ihr es zu tun habt, weitaus schlimmer ist, als Ihr es Euch vorstellen könnt. Ich würde sogar sagen, dass sie schlimmer ist, als ich es mir selbst vorgestellt hatte. Sie ist groß, mächtig, wütend und klug. Und sehr wahrscheinlich ist sie nicht allein.«
Sie zuckte zusammen.
»Erlaubt mir einige Minuten des Nachdenkens«, sagte sie.
Er nickte, verneigte sich, richtete sein Reitschwert an der Hüfte und ging hinaus in den Hof.
Seine Männer standen wie Statuen da; ihre scharlachroten Mäntel stachen deutlich von der grauen Umgebung ab. Die Pferde waren ein wenig beunruhigt, die Männer nicht.
»Steht bequem«, sagte er.
Sie alle holten gleichzeitig Luft, streckten die Arme, die von den schweren Rüstungen müde geworden waren, und regten die Hüften, an denen Kettenhemden und Panzer scheuerten.
Michael war der Keckste von ihnen. »Sind wir im Geschäft?«, fragte er.
Der Hauptmann sah ihn nicht an, weil er ein offenes Fenster auf der anderen Seite des Hofes bemerkt hatte, das ein Gesicht einrahmte. »Noch nicht, mein Süßer. Wir sind noch nicht im Geschäft.« Dann warf er eine Kusshand in die Richtung des Fensters.
Das Gesicht verschwand.
Ser Milus, sein Primus Pilus und Standartenträger, grunzte. »Schlecht fürs Geschäft«, sagte er und fügte gerade noch rechtzeitig hinzu: »Mylord.«
Der Hauptmann warf ihm einen raschen Blick zu und warf wieder einen Blick zu den Fenstern des Dormitoriums hinüber.
»Uns beobachten in diesem Augenblick noch mehr Jungfrauen«, erklärte Michael. »Für mich haben sie schon immer die Beine breit gemacht.«
Jehannes, der älteste Marschall, nickte ernsthaft. »Heißt das, dass es eine war, junger Michael? Oder sogar zwei?«
Guillaume Langschwert, der jüngere Marschall, bellte sein seltsames Lachen heraus, das nach den Seehunden in den Buchten des Nordens klang. »Die Zweite hat gesagt, sie sei noch Jungfrau«, jammerte er spöttisch. »Zumindest hat sie das mir gegenüber behauptet!«
Seine Stimme hatte durch den Helm, hinter dem sie hervordrang, eine geradezu ätherische Anmutung bekommen und hing nun für einen Augenblick in der Luft. Die Männer konnten das Grauen, das sie gesehen hatten, nicht einfach vergessen. Sie schoben es lediglich beiseite. Die Erinnerungen an das Gehöft waren noch zu frisch, und die Stimme des jüngeren Marschalls musste sie irgendwie wieder heraufbeschworen haben.
Niemand lachte. Das heißt, eigentlich lachten alle, aber es klang gezwungen.
Der Hauptmann zuckte die Achseln. »Ich habe beschlossen, unserer zukünftigen Auftraggeberin einige Zeit zum Nachdenken über ihre Lage zu geben«, sagte er.
Milus stieß ein abgehacktes Lachen aus. »Sie soll also in ihrem eigenen Saft schmoren, damit wir den Preis erhöhen können?«, fragte er und deutete mit dem Kopf auf die Kapellentür. »Der da drüben mag uns jedenfalls nicht.«
Der Priester stand noch immer in der Kapellentür.
»Ist er etwa schwachsinnig? Oder ist er hier der Zuhälter?«, fragte Ser Milus und starrte den Priester an. »Glotz uns einfach weiter so an, wenn es dir gefällt, Kumpel.«
Die Soldaten kicherten, und der Priester verschwand endlich in der Kapelle.
Michael zuckte unter der Grausamkeit in der Stimme des Standartenträgers zusammen und trat vor. »Was wollt Ihr tun, Mylord?«
»Oh«, meinte der Hauptmann, »ich gehe auf die Jagd.« Er entfernte sich mit einem schrägen Grinsen, ging einige Schritte auf die Schmiede zu, spannte sich an … und verschwand.
Michael sah verwirrt drein. »Wo ist er?«, fragte er.
Milus zuckte mit den Schultern und verlagerte dadurch das Gewicht seines Kettenhemdes. »Wie macht er das eigentlich?«, fragte er Jehannes.
Zwanzig Schritte entfernt betrat der Hauptmann den Dormitoriumsflügel, als hätte er jedes Recht dazu. Michael beugte sich vor, als wolle er ihm etwas zurufen, doch Jehannes legte ihm die gepanzerte Hand über den Mund.
»Da geht unser schöner Vertrag dahin«, sagte Hugo. Er sah den Standartenträger mit seinen dunklen Augen an und zuckte trotz seines Kettenpanzers mit den Achseln. »Ich hab dir doch gesagt, er ist zu jung.«
Jehannes nahm die Hand vom Gesicht des Knappen. »Der Bourc geht seine eigenen Wege.« Er gab den anderen Männern Zeit, die Köpfe zu schütteln. »Lasst ihn in Ruhe. Wenn er uns diesen Vertrag verschafft …«
Hugo schnaubte verächtlich und blickte zu dem Fenster hinauf.
Der Hauptmann betrat den Palast in seinem Kopf.
Ein gewölbter, zwölfseitiger Raum mit hohen, ebenfalls gewölbten Bleiglasfenstern, von denen jedes ein anderes Bild zeigte. In gleichen Abständen waren sie zwischen Säulen aus altem Marmor eingelassen, die eine Decke mit einem Kreuzgewölbe trugen. Unter jedem Fenster befand sich das Zeichen eines Sternbildes, in strahlendem Blau auf ein Goldblatt gemalt, sowie ein Band aus armbreiter gehämmerter Bronze, und schließlich auf Augenhöhe eine Reihe von Nischen zwischen den Säulen, in denen Statuen standen – es waren insgesamt elf aus weißem Marmor, und unter dem Sternzeichen des Widders war eine eisenbeschlagene Tür in die Wand eingelassen.
Genau in der Mitte des Raumes stand eine zwölfte Statue – Prudentia, die Lehrerin seiner Kindheit. Trotz ihrer festen weißen Marmorhaut lächelte sie ihn warmherzig an, als er sich ihr näherte.
»Clementia, Pisces, Eustachios«, sagte er im Palast seiner Erinnerung, und die geäderten weißen Hände seiner Lehrerin zeigten auf ein Bild nach dem anderen.
Und der Raum bewegte sich.
Die Fenster über den Sternkreiszeichen drehten sich still, und die Statuen unter dem Bronzeband rotierten in der anderen Richtung, bis die drei ausgewählten Zeichen unmittelbar gegenüber der eisenbeschlagenen Tür lagen. Er lächelte Prudentia an, trat über die Fliesen des zwölfseitigen Raumes und drückte die Klinke der Tür herunter.
Er öffnete sie, und sie wies hinaus auf einen Garten in üppigem Sommergrün – die Traumerinnerung an einen vollkommenen Sommertag. Es war nicht immer so auf der anderen Seite der Tür. Eine kühle Brise wehte herbei. Nicht zu allen Zeiten war sie so stark – seine grüne Macht –, und er lenkte ein wenig davon mit seinem Willen ab, bog sie zu einer Kugel zusammen und steckte sie wie eine Handvoll Sommerblätter in den Hanfsack, den er sich an Prudentias ausgestrecktem Arm vorstellte. Ein Mittel gegen Regentage. Die beharrliche grüne Brise fuhr ihm durch die Haare, erreichte die Zeichen auf der gegenüberliegenden Wand und …
Ohne Hast ging er von den Pferden weg und wusste genau, dass Michael abgelenkt sein würde – ebenso wie die Beobachterin hinter dem Fenster.
Die bevorzugten Phantasmata des Hauptmannes rührten eher von einer Irreführung als von ätherischer Macht her. Er verstärkte ihre Wirksamkeit durch seine Körperbeherrschung – ging ganz leise und sorgte dafür, dass sein Umhang nicht flatterte.
An der Tür zum Dormitorium betrat er wieder seinen Erinnerungspalast und …
… beugte sich in den gewölbten Raum. »Noch einmal dasselbe, Pru«, sagte er.
Abermals bewegten sich die Zeichen, als die Marmorstatue auf sie zeigte, und reihten sich über der Tür auf. Er öffnete sie erneut, erlaubte der grünen Brise, ihn mit Kraft aufzuladen, und schloss die Tür wieder.
Er betrat das Dormitorium. Hier saßen ein Dutzend Nonnen, allesamt große, befähigte Frauen, im guten Licht der Fenster des Obergadens; die meisten waren mit Handarbeiten beschäftigt.
Ohne das leiseste Rascheln seines scharlachroten Mantels ging er an ihnen vorbei; sein ganzer Wille war auf seinen Glauben konzentriert, dass seine Gegenwart hier überhaupt nicht ungewöhnlich war. Er stieg die Treppe hoch. Niemand drehte den Kopf, nur eine ältere Nonne starrte nicht mehr auf ihr Stickwerk, sondern sah zur Treppe, hob eine Braue, wandte sich dann aber wieder ihrer Arbeit zu. Hinter sich hörte er ein Murmeln.
Ich habe sie nicht vollständig täuschen können, dachte er. Wer sind diese Frauen?
Seine Eisenstiefel machten zu viel Lärm, und er musste vorsichtig gehen, denn die Macht – zumindest die Art von Macht, der er sich gern bediente – war nur von begrenztem Nutzen. Die Wendeltreppe schraubte sich mit einer Rechtsdrehung in die Höhe – wie in jeder anderen Festung auch – und hätte seinen Schwertarm behindert, wäre er ein Angreifer gewesen.
Was ich in gewisser Weise ja auch bin, dachte er. Die Galerie befand sich unmittelbar oberhalb der Halle. Sogar an diesem grauen Tag war sie voller Licht. Drei grau gekleidete Novizinnen lehnten sich in die tiefen Fensteröffnungen und beobachteten die Männer im Hof. Sie kicherten.
Er war überrascht, als er am Rande seiner eigenen Macht Spuren der ihren entdeckte.
Dann betrat er die Galerie, und seine eisernen Absätze kratzten metallisch über den Holzboden – es war wie eine Fanfare in dieser Welt der barfüßigen Frauen. Er versuchte gar nicht erst, die Frauen durch seinen Willen glauben zu machen, er gehöre einfach zu diesem Ort.
Ruckartig fuhren drei Köpfe herum. Zwei der Mädchen drehten sich sofort um und rannten davon. Die dritte Novizin zögerte einen verhängnisvollen Augenblick lang und sah ihn an. Wunderte sich.
Er ergriff ihre Hand. »Amicia?«, fragte er und sah ihr dabei in die Augen, dann drückte er seinen Mund auf den ihren. Er stieß ihr das gepanzerte Bein zwischen die Schenkel, hielt sie fest, hob sie so mühelos an, als wäre sie ein Kind. Und nun lag sie in seinen Armen. Mit dem Rückenpanzer stützte er sich an der Brüstung ab und hielt sie in festem, gleichzeitig aber sanftem Griff.
Sie wand sich, und ihr Ärmel rutschte gegen den Gurt, der seinen Ellbogen schützte. Doch ihr Blick hatte sich in ihn hineingebohrt, und ihre Augen waren riesig. Sie öffnete die Lippen. Es war mehr an ihr als nur einfache Angst oder Ablehnung. Mit der Zunge leckte er über ihre Zähne. Und fuhr mit dem Finger an ihrem Kinn entlang.
Ihr Mund öffnete sich unter dem seinen – köstlich!
Er küsste sie, oder vielleicht küsste auch sie ihn. Es ging nicht schnell vorüber. Sie entspannte sich in seinem Griff; er spürte ihre angenehme Wärme durch den gehärteten Stahl seiner Armpanzerung und Brustplatte.
Doch jeder Kuss endet einmal.
»Leg nur nicht das Gelübde ab«, sagte er. »Du gehörst nicht hierher.« Er wollte aufrichtig klingen, aber sogar in seinen eigenen Ohren klang seine Stimme unbeabsichtigt spöttisch.
Er richtete sich auf und stellte sie auf den Boden, denn er wollte ihr beweisen, dass er kein Vergewaltiger war. Sie errötete wieder vom Kinn bis zur Stirn. Sogar ihre Handrücken waren rot. Sie senkte den Blick, verlagerte ihr Gewicht – er beobachtete sie ganz genau. Sie beugte sich vor …
Und schlug ihm mit aller Kraft gegen das rechte Ohr. Das überraschte ihn vollkommen. Er geriet ins Taumeln; sein Rücken stieß mit einem metallischen Laut gegen die Wand, er fing sich wieder …
… und drehte sich um, wollte sie sich schnappen.
Sie rannte nicht einmal vor ihm weg. »Wie könnt Ihr es wagen, ein Urteil über mich abzugeben?«, meinte sie.
Er rieb sich das Ohr. »Du missverstehst mich«, antwortete er. »Ich wollte nicht über dich richten. Du wolltest doch geküsst werden. Es war in deinen Augen zu sehen.«
Früher hatten diese Worte stets gewirkt, auch wenn sie unaufrichtig gewesen waren. Doch in diesem Fall schienen sie der Wahrheit zu entsprechen, auch wenn er noch den scharfen Schmerz im Ohr spürte.
Sie schürzte die Lippen – es waren volle, wunderschöne Lippen. »Wir alle sind Sünder, Messire. Ich kämpfe jeden Tag mit meinem Körper. Aber das gibt Euch nicht das Recht, dasselbe zu tun.«
Ein heimliches Lächeln spielte um ihre Mundwinkel – eigentlich war es kein Lächeln, sondern etwas …
Sie drehte sich um, ging die Galerie entlang und ließ ihn allein zurück.
Er stieg die Treppe hinunter, rieb sich das Ohr und fragte sich, wie viel seine Männer wohl von diesem Geplänkel mitbekommen haben mochten. Ein Ruf baute sich in vielen Monaten auf und konnte in wenigen Augenblicken wieder zerstört werden. Und der seine war noch zu frisch, um einen Respektverlust ertragen zu können. Doch er vermutete, dass ihn der graue Himmel und die hohen Galeriefenster geschützt hatten.
»Das ging aber schnell«, sagte Michael bewundernd, als er nach draußen trat. Der Hauptmann hielt sich davon ab, etwas so Grobes zu tun, wie die Hose festzuzurren. Denn wenn er die Frau wirklich gegen die Klosterwand gedrückt und genommen hätte, dann hätte er sich sorgfältig wieder angezogen, bevor er nach draußen trat.
Warum habe ich es nicht getan?, fragte er sich selbst. Sie war doch willig.
Sie mag mich.
Sie hat mich heftig geschlagen.
Er lächelte Michael an. »Es braucht halt nur so lange, wie es braucht«, sagte er. Während er sprach, öffnete sich die schwere eisenbeschlagene Tür, und eine ältere Nonne winkte den Hauptmann herbei.
»Der Teufel möge über Euch wachen«, murmelte Hugo.
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Dem Teufel bin ich gleichgültig«, sagte er und ging zur geschäftlichen Unterredung mit der Äbtissin.
Sobald er die Schwelle überschritt, wusste er bereits, dass sie sich entschieden hatte, ihn und seine Männer zu beauftragen. Wenn sie nämlich beschlossen hätte, es nicht zu tun, hätte sie ihn nicht mehr sprechen wollen. Dann wäre es im Innenhof zu Mord und Totschlag gekommen.
Doch all ihre Soldaten wären nicht in der Lage gewesen, diese acht Männer zu töten. Und das wusste sie. Außerdem hätte sie niemals nach ihm gerufen, wenn sie selbst acht wirklich gute Männer zur Verfügung hätte.
Es war wie bei der euklidischen Geometrie. Der Hauptmann konnte einfach nicht begreifen, warum die anderen Menschen nicht imstande waren, eine Sache aus allen Winkeln zu betrachten.
Er rieb sich das stechende Ohr, verneigte sich tief vor der Äbtissin und zwang sich zu einem Lächeln.
Sie nickte. »Ich muss Euch so nehmen, wie Ihr seid«, sagte sie. »Also werde ich Euch auf Abstand halten. Wie hoch sind Eure Forderungen?«
Er nickte ebenfalls. »Darf ich mich setzen?«, fragte er. Als sie die recht anmutige Hand ausstreckte, hob er den Weinbecher aus Horn an, der offensichtlich schon für ihn bereitstand. »Ich trinke auf Eure Augen, ma belle.«
Sie hielt seinem Blick stand und lächelte. »Schmeichler.«
»Ja«, sagte er, nahm einen kleinen Schluck Wein und sah sie dabei wie ein wohlerzogener Höfling weiterhin über den Becherrand hinweg an. »Ja und nein.«
»Meine Schönheit ist zusammen mit den Jahren vergangen«, sagte sie.
»Euer Körper erinnert sich aber so gut an Eure Schönheit, dass ich sie noch zu sehen vermag«, sagte er.
Sie nickte. »Das war ein schönes Kompliment«, gab sie zu. Dann lachte sie. »Wer hat Euch eine Ohrfeige versetzt?«, fragte sie.
Er versteifte sich. »Das ist eine alte …«
»Unsinn! Ich erziehe Kinder. Ich erkenne eine Ohrfeige.« Sie kniff die Augen zusammen. »Eine Nonne.«
»Ich enthülle keine zarten Geheimnisse«, sagte er.
»Ihr seid nicht so schlecht, wie Ihr mich glauben machen wolltet, Messire«, erwiderte sie.
Einige Atemzüge lang starrten sie einander an.
»Sechzehn Doppelleoparden im Monat für jede Lanze. Ich habe gegenwärtig einunddreißig Lanzen – Ihr könnte selbst nachzählen. Jede Lanze besteht aus mindestens einem Ritter, seinem Knappen und einem Diener, und dazu kommen für gewöhnlich noch zwei Bogenschützen. Alle sind beritten, und ihre Pferde müssen gefüttert werden. Meine Korporäle erhalten doppelten Lohn – es gibt drei davon –, und ich selbst bekomme hundert Pfund. Jeden Monat.« Er lächelte träge. »Meine Männer sind äußerst diszipliniert. Und sie sind jeden Heller wert.«
»Und was ist, wenn Ihr mein Ungeheuer schon heute Nacht tötet?«, fragte sie.
»Dann habt Ihr ein Schnäppchen gemacht, Äbtissin. In diesem Fall müsstet Ihr bloß für einen Monat bezahlen.« Er nippte an seinem Wein.
»Wie berechnet Ihr einen Monat?«, wollte sie wissen.
»Ah! Sogar auf den Straßen von Harndon gibt es niemanden, der einen schärferen Verstand hätte als Ihr, Mylady. Volle Monate nach dem Mondkalender.« Er grinste. »Der nächste beginnt also in zwei Wochen. Es ist der Wonnemonat Mai.«
»Jesu, Herr des Himmels und Retter der Menschheit! Ihr seid nicht gerade billig.« Sie schüttelte den Kopf.
»Meine Männer sind sehr, sehr gut. Wir haben viele Jahre auf dem Kontinent gearbeitet und sind erst vor Kurzem nach Albia zurückgekehrt. Und jetzt braucht Ihr uns. Ihr hättet uns schon vor einem Jahr gebraucht. Ich mag ein harter Mann sein, Mylady, aber sollten wir nicht darin übereinstimmen, dass keine Schwester mehr so wie Hawisia sterben darf? Ja?« Er beugte sich vor, um den Vertrag zu besiegeln, hielt den Weinbecher zwischen seinen Händen, und plötzlich ermüdete ihn das Gewicht seiner Rüstung, während sein Rücken schmerzte.
»Ich bin sicher, Ihr werdet den Satan recht anziehend finden, wenn Ihr ihn kennenlernt«, sagte sie leise. »Und ich bin sicher, dass Euer Interesse an den Hawisias dieser Welt wie Schnee unter dem Sonnenschein schmelzen wird, wenn Ihr keine Bezahlung erhaltet.« Sie schenkte ihm ein dünnlippiges Lächeln. »Es sei denn, Ihr könnt sie küssen. Doch selbst dann bezweifle ich, dass Ihr lange bei ihnen bleiben würdet – oder sie bei Euch.«
Er runzelte die Stirn.
»Für jedes Gehöft, das von Euren Männern beschädigt wird, ziehe ich den Preis für eine Lanze ab«, sagte sie. »Für jeden meiner Männer, der bei einem Tumult verletzt wird, und für jede Frau, die sich bei mir über Eure Männer beschwert, ziehe ich den Preis für einen Korporal ab. Wenn auch nur eine einzige meiner Schwestern von Eurer Satansbrut verletzt oder beleidigt wird, wenn auch nur eine lüsterne Hand auf sie gelegt oder eine unschickliche Bemerkung über sie gemacht wird, werde ich Euren Lohn abziehen. Abgemacht? Schließlich sind Eure Männer angeblich ja so diszipliniert«, sagte sie mit eisiger Verachtung in der Stimme.
Sie mag mich wirklich, dachte er. Trotz allem. Er war eher an Menschen gewöhnt, die ihn nicht mochten. Und er fragte sich, ob sie ihm vielleicht Amicia geben würde. Schließlich hatte sie die wunderschöne Novizin dorthin befohlen, wo er sie hatte sehen können. Wie berechnend war diese alte Hexe wohl? Sie schien von der Art zu sein, die ihn mit mehr als nur mit Münzen lockte – aber er hatte sie bereits mit seiner Bemerkung über Schwester Hawisia pikiert.
»Was ist Euch der Verräter wert?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht an Euren Verräter«, sagte sie und deutete auf das Emailleblatt, das auf einem hölzernen Tablett neben ihr lag. »Ihr tragt dieses schändliche Ding mit Euch herum, um Narren zu hintergehen. Aber ich bin kein Narr.«
Er zuckte die Achseln. »Mylady, Euch sei unbenommen, dass Eure Abneigung gegen meinesgleichen Euer Urteil beeinträchtigt. Aber denkt einmal nach: Warum sollte ich Euch in dieser Hinsicht belügen? Wie viele Leute hätten sich auf diesem Gehöft befinden sollen?«, fragte er.
Sie begegnete seinem Blick – es machte ihr nichts aus, und das freute ihn. »Sieben Konventualinnen hätten auf dem Feld arbeiten sollen«, gab sie zu.
»Wir haben Eure Schwester und sechs weitere Leichen gefunden«, entgegnete der Hauptmann. »Das ist doch eindeutig, Äbtissin.« Er trank noch ein wenig Wein. »Einer fehlt, aber niemand hätte entkommen können. Niemand.« Er machte eine Pause. »Einigen Eurer Schafe sind Zähne gewachsen. Und sie wollen nicht länger zu Eurer Herde gehören.« Plötzlich kam ihm ein Gedanke. »Was hat eigentlich Schwester Hawisia dort gemacht? Sie war doch eine Nonne des Konvents und keine Arbeiterin, oder?«
Sie holte tief Luft. »Also gut. Wenn Ihr beweisen könnt, dass es einen – oder mehrere – Verräter gibt, werdet Ihr eine Belohnung erhalten. Ihr müsst darauf vertrauen, dass ich Euch gerecht behandeln werde.«
»Und Ihr müsst wissen, dass sich meine Männer schlecht benehmen werden. Es ist Monate her, seit sie bezahlt wurden, und es ist noch länger her, dass sie an einem Ort waren, wo sie das hätten ausgeben können, was sie nicht eingenommen haben. Meine Anweisung zur Disziplin bezieht sich nicht auf Schlägereien in Tavernen oder lüsterne Bemerkungen.« Er versuchte ernst zu wirken, aber sein Herz sang vor Freude über die Arbeit und das Gold, das die Truppe erhalten würde. »Doch Ihr könnt darauf vertrauen, dass ich mein Bestes tun werde, damit Zucht und Ordnung aufrechterhalten bleiben.«
»Vielleicht solltet Ihr mit gutem Beispiel vorangehen?«, meinte sie. »Oder Ihr erledigt Euren Auftrag schnell und zieht zu grüneren Weiden weiter«, fügte sie mit süßlicher Stimme hinzu. »Wie ich gehört habe, sollen die Huren südlich des Flusses sehr hübsch sein.«
Er dachte an den Wert dieses Vertrags – sie hatte nicht einmal versucht, seine überhöhten Preise zu drücken.
»Ich werde entscheiden, was uns besser frommt, sobald ich die Farbe Eures Geldes sehe.«
»Meines Geldes?«, fragte sie.
»Ich verlange Vorauskasse für einen Monat, Äbtissin. Wir kämpfen niemals umsonst.«
Lorica · Ein Goldener Bär
Der Bär war gewaltig. Alle Leute auf dem Markt sagten das.
Der Bär saß in Ketten da, hatte die Beine ausgestreckt wie ein erschöpfter Tänzer und hielt den Kopf gesenkt. An jedem Bein hatte er eine Fessel, und die Ketten dazwischen waren so kunstvoll geschmiedet, dass sich die Bestie nur sehr eingeschränkt bewegen konnte.
Beide Hinterpfoten waren mit Blut überzogen – in den Fesseln steckten zusätzlich kleine Stacheln, die nach innen wiesen.
»Seht den Bären! Seht doch den Bären!«
Der Bärenhalter war ein großer Mann, so fett wie ein Lord, und er hatte Beine wie Baumstämme und Arme wie Schinken. Seine beiden Jungen waren klein und schnell und sahen so aus, als sei ihr zweiter Beruf der eines Verbrechers.
»Ein Goldener Bär aus der Wildnis! Nur heute!«, brüllte er, während seine Jungen durch den Markt streiften und riefen: »Kommt, und seht den Bären an! Den Goldenen Bären!«
Der Markt war so voll, wie ein Markt beim ersten Hauch des Frühlings nur sein konnte, nachdem jeder Bauer und Krämer den ganzen Winter hindurch auf seinem Hof oder im Stadthaus eingepfercht gewesen war. Jede Frau hatte neue Körbe zum Verkauf geflochten. Gute Bauersleute boten gesunde Winteräpfel und sorgfältig gehortetes Getreide an. Es gab neue Leinenwaren – Hemden und Kappen. Der Messerschleifer machte gute Geschäfte, und ein Dutzend weiterer Händler und Frauen priesen ihre Waren lauthals an: frische Austern von der Küste, Lämmer, gegerbtes Leder.
Fast fünfhundert Menschen befanden sich auf dem Markt, und jede Stunde strömten weitere hinzu.
Ein Schankjunge aus der Taverne rollte hintereinander zwei kleine Fässer herbei, legte ein Brett über sie und schenkte Bier und Apfelwein ein. Er hatte sich unter der alten Eiche niedergelassen, die den Mittelpunkt des Marktfeldes bezeichnete, und war nur einen Steinwurf von dem Bärenmeister entfernt.
Die Männer tranken.
Ein Fuhrmann brachte seine kleine Tochter herbei, damit sie den Bären bestaunen konnte. Es handelte sich um ein Weibchen, das zwei Junge hatte. Mit ihrem hellen, leicht ins Goldene spielenden Fell waren sie wunderschön, doch ihre Mutter roch nach Verwesung und Dung. Ihre Augen waren wild, und als die Tochter des Fuhrmanns eines der Jungen berührte, öffnete das furchterregende Tier das Maul. Das Mädchen betrachtete furchtsam die vielen gefährlichen Zähne. Die stetig anwachsende Menge erstarrte, und dann wichen die Leute langsam zurück.
Die Bärin hob eine Tatze, zerrte an den Ketten …
Das Mädchen blieb stehen. »Armer Bär«, sagte es zu seinem Vater.
Die Tatze hätte das Mädchen beinahe erreicht. Doch die Schmerzen, die von den Stacheln in den Fesseln ausgingen, überlagerten offenbar die Wut des Tieres. Es fiel auf alle viere, setzte sich wieder und sah in seiner Verzweiflung beinahe menschlich aus.
»Psst, Mädchen«, sagte der Vater. »Das ist eine Kreatur aus der Wildnis. Ein Diener des bösen Feindes.«
Allerdings klangen seine Worte nicht besonders überzeugend.
»Die Kleinen sind wunderbar.« Die Tochter ließ sich auf die Hacken nieder.
Sie waren von Seilen umschlungen, trugen aber keine Fesseln.
Ein Priester – ein sehr weltlicher Priester in kostbarer blauer Wolle, der einen großartigen und schweren Dolch umgebunden hatte – beugte sich herunter. Er hielt einem der Bärenjungen die Faust vor die Nase, und das kleine Tier biss ihn. Er riss die Hand aber nicht zurück, sondern wandte sich dem Mädchen zu. »Die Wildnis ist oftmals schön, Tochter. Aber diese Schönheit ist eben die Falle, die der Teufel für die Unachtsamen aufgestellt hat. Sieh ihn an. Sieh ihn doch nur an!«
Der kleine Bär kämpfte gegen sein Seil und wollte den Priester erneut beißen, der sich nun langsam erhob und dem jungen Tier einen Fußtritt gab. Dann drehte er sich zum Bärenmeister um.
»Es bedeutet so etwas wie Häresie, eine Kreatur aus der Wildnis für Geld zu zeigen«, sagte er.
»Ich habe eine Erlaubnis vom Bischof von Lorica!«, stieß der Bärenmeister aus.
»Der Bischof von Lorica würde sogar dem Satan eine Erlaubnis zur Eröffnung eines Bordells verkaufen«, entgegnete der Priester und fuhr mit der Hand an den Dolch, der in seinem Gürtel steckte.
Der Fuhrmann packte seine Tochter, aber sie entwand sich seinem Griff. »Vater, der Bär hat Schmerzen«, sagte sie.
»Ja«, meinte er. Er war ein rücksichtsvoller Mann. Aber er hielt den Blick weiter auf den Priester gerichtet.
Und der Priester sah ihn an.
»Dürfen wir einem Lebewesen wehtun?«, fragte seine Tochter. »Hat Gott die Wildnis nicht genauso erschaffen wie uns?«
Das Lächeln des Priesters wirkte genauso schrecklich wie das vor Zähnen starrende Maul des Bären. »Deine Tochter hegt sehr bemerkenswerte Gedanken«, sagte er. »Ich frage mich, woher sie diese hat.«
»Ich will keinen Ärger bekommen«, entgegnete der Fuhrmann. »Sie ist doch bloß ein Kind.«
Der Priester trat näher, doch nun wollte der Bärenmeister endlich mit seiner Zurschaustellung fortfahren. Darum rief er etwas. Er hatte eine ziemlich große Menschenmenge angezogen – es waren mindestens hundert Leute, und in jeder Minute kamen weitere hinzu. Auch ein halbes Dutzend Soldaten des Grafen waren zu sehen. Sie hatten ihre Röcke in der frühen Hitze aufgeknüpft und schäkerten nun mit den Bauernmägden herum. Dabei drängten sie sich eifrig nach vorn, weil sie Blut zu sehen hofften.
Der Fuhrmann zog seine Tochter zurück, sodass die Soldaten zwischen ihm und dem Priester hindurch marschieren konnten.
Der Bärenmeister trat das Tier und zerrte an dessen Kette. Einer seiner Jungen spielte auf einer dünnen Flöte eine schnelle, abgehackte Melodie.
Die Menge sang: »Tanz! Tanz! Tanz, Bär, tanz!«
Die Bärin saß einfach nur da. Als ihr das Zerren des Meisters Schmerzen verursachte, hob sie den Kopf und brüllte ihren Trotz heraus.
Die Menge wich ein wenig zurück und murmelte enttäuscht; nur der Priester schien zufrieden zu sein.
Einer der Soldaten schüttelte den Kopf. »Das ist doch Mist«, ärgerte er sich. »Sollen sich doch die Hunde mit diesem Biest vergnügen!«
Zwar wurde diese Idee sofort von seinen Gefährten aufgegriffen, aber der Bärenmeister war damit gar nicht einverstanden. »Das ist mein Bär«, beharrte er.
»Ich will deinen Marktpass sehen«, forderte der Sergeant. »Gib ihn mir.«
Der Mann blickte zu Boden und wirkte trotz seiner Größe eingeschüchtert. »Hab keinen.«
»Dann kann ich dir deinen Bären wegnehmen, Kumpel. Ich kann dir deinen Bären und deine Jungen wegnehmen.« Der Sergeant lächelte. »Aber ich bin kein grausamer Mann«, fuhr er mit einer Stimme fort, die seinen Worten Hohn sprach. »Wir hetzen einfach ein paar Hunde auf deinen Bären, und du kannst das Silber dafür einsammeln. Lass uns wetten.«
»Das ist ein Goldener Bär«, sagte der Bärenmeister. Sogar seine rote Weinnase wurde bleich. »Ein Goldener Bär!«
»Du willst wohl sagen, du hast ein bisschen Silber ausgegeben, damit du etwas Gold in seinen Pelz schmieren konntest«, meinte einer der anderen Soldaten. »Das ist für die Leute hübscher anzusehen.«
Der Bärenmeister zuckte die Achseln. »Holt eure Hunde«, sagte er.
Der Fuhrmann wollte noch einen Schritt zurückweichen, aber der Priester packte ihn am Arm. »Du bleibst hier«, sagte er. »Und deine kleine Hexe von Tochter auch.«
Der Griff des Mannes war wie Stahl, und in seinen Augen brannte ein fanatisches Feuer. Der Fuhrmann erlaubte es nur widerwillig, zurück in den Kreis um die Bärin gezogen zu werden.
Die Hunde wurden herbeigeschafft. Es waren Mastiffs – so groß wie Ponys – und ein paar andere Mischlinge, deren Wildheit ihre Größe noch übertraf. Einige ließen sich still nieder, während die anderen die Bärin unerbittlich anknurrten.
Die Bärin hob den Kopf und knurrte ebenfalls – ein einziges Mal.
Alle Hunde wichen einen Schritt zurück.
Die Männer machten ihre Wetten.
Der Bärenmeister und seine Jungen gingen in der Menge umher. Zwar wollte er seinen Bären nicht in einem Kampf sehen, aber gegen die schiere Menge an Silber, die sich nun auf seine Handflächen ergoss, hatte er auch nichts einzuwenden. Sogar der kleinste Bauer wettete mit. Und da der Bär als eine Kreatur der Wildnis gelten musste …
Es war beinahe eine religiöse Pflicht zu wetten.
Der Bär erzielte eine immer schlechtere Quote.
Und es kamen immer mehr Hunde herbei, die umso ungebärdiger wurden, je mehr das Rudel anwuchs. Dreißig wütende Hunde können einander genauso sehr hassen wie einen Bären.
Der Priester trat aus dem Kreis heraus. »Seht euch diese Kreatur des Bösen an!«, rief er. »Sie ist die Verkörperung unseres Feindes. Seht euch doch nur ihre Fangzähne an, die vom bösen Feind dazu gemacht wurden, Menschen zu töten. Und seht euch diese Hunde an, die von den Menschen gezüchtet wurden – es sind Tiere, die seit geduldigen Generationen von Menschen zu Gehorsamkeit erzogen wurden. Kein Hund kann dieses Ungeheuer allein zur Strecke bringen, aber will etwa jemand bezweifeln, dass es allen gemeinsam möglich sein wird? Gibt es hier jemanden, der diese Lektion nicht verstanden hat? Der Bär – seht ihn euch nur an – ist mächtig. Aber der Mensch ist noch weitaus mächtiger.«
Diesmal hob die Bärin den Kopf nicht.
Der Priester trat sie.
Das Tier starrte zu Boden.
»Das Biest will nicht kämpfen!«, sagte einer der Soldaten.
»Ich will mein Geld zurück!«, rief ein Stellmacher.
Der Priester zeigte sein schreckliches Lächeln. Er packte das Seil, an das eines der Bärenjungen gebunden war, riss die Kreatur in die Luft und warf sie den Hunden vor.
Nun sprang die Bärin auf.
Der Priester lachte. »Jetzt wird das Ungeheuer kämpfen«, sagte er.
Die Bärin stemmte sich gegen die Fesseln, als die Mastiffs das schreiende Junge in Stücke rissen. Es klang wie ein Menschenkind, entsetzt und verängstigt, und dann war es fort – zerfetzt und gefressen von einem Dutzend Hunden. Bei lebendigem Leibe.
Der Fuhrmann hielt seiner Tochter die Augen zu.
Der Priester drehte sich ihm zu; in seinen Augen loderte es. »Zeig es ihr!«, kreischte er. »Zeig ihr, was passiert, wenn das Böse besiegt wird!« Er machte einen Schritt auf den Fuhrmann zu …
Und die Bärin bewegte sich. Sie bewegte sich weitaus schneller, als man es hätte erwarten können.
Sie hielt den abgerissenen Kopf des Priesters in der einen Tatze und seinen Dolch in der anderen; dann erst fiel der Körper in den Dreck und pumpte sein Blut in die Menge. Nun wirbelte die Bärin herum – sie schien plötzlich nur noch aus Zähnen und Klauen zu bestehen – und rammte den schweren Stahldolch durch die Glieder ihrer Kette in den Boden.
Die Glieder zerbrachen.
Eine Frau schrie auf.
Die Bärin tötete so viele, wie sie erwischen konnte, bis ihre Tatzen mit Blut überzogen waren und ihre Glieder schmerzten. Die Menschen kreischten, behinderten sich gegenseitig, und die Tatzen schlugen wie Rammböcke bei einer Belagerung gegen sie, sodass jeder Mann und jede Frau, die sie traf, starben.
Wenn es ihr möglich gewesen wäre, hätte sie jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt umgebracht. Ihr Junges war tot. Ihr Junges war tot.
Sie tötete und tötete, aber die Menschen rannten in alle Richtungen davon.
Als sie niemanden mehr erwischen konnte, ging sie zurück und zerriss die am Boden liegenden Körper – ein paar hatten noch gelebt, aber sie sorgte nun dafür, dass sie in schrecklicher Angst starben.
Ihr Junges war tot.
Sie hatte keine Zeit zur Trauer. Bevor die tödlichen, stahlgekleideten Soldaten mit ihren mächtigen Bögen herkommen konnten, nahm sie ihr verbliebenes Junges, beachtete weder Schmerz noch Müdigkeit noch Angst und Panik, die sie verspürte, weil sie so tief im gezähmten Grauen des Menschenlandes steckte, und floh. Hinter ihr läuteten die Alarmglocken des Ortes.
Sie rannte.
Lorica · Ser Mark Wishart
Nur ein einziger Ritter und sein Knappe erschienen. Von der Komturei aus waren sie im Galopp zu den Toren geritten, fanden diese geschlossen und die Türme bemannt. Die Soldaten auf den Mauern waren mit Armbrüsten bewaffnet.
»Eine Kreatur der Wildnis!«, riefen die angsterfüllten Männer auf der Mauer und weigerten sich, dem Ritter die Tore zu öffnen – obwohl sie ihn doch gerufen hatten. Und obwohl er der Prior des Ordens vom heiligen Thomas war. Und überdies ein Paladin.
Der Ritter umrundete langsam die kleine Stadt, bis er zum Marktfeld kam.
Er stieg ab. Sein Knappe betrachtete das Feld so argwöhnisch, als könnte jeden Augenblick eine Horde Kobolde darauf erscheinen.
Der Ritter öffnete das Visier und schritt gemächlich über das Feld. Ganz am Rand lagen bei dem ausgetrockneten Graben, der die Grenze des Marktes bezeichnete, einige Leichen, und etliche weitere fanden sich unter der Markteiche. Er konnte die Fliegen hören. Und er roch die Gedärme aus den aufgerissenen Bäuchen, die warm in der Sonne lagen.
Es stank wie auf einem Schlachtfeld.
Er kniete kurz nieder und betete. Schließlich war er nicht nur Ritter, sondern auch Priester. Dann stand er langsam wieder auf und ging zu seinem Knappen zurück. Hin und wieder blieben seine Sporen dabei in den Kleidungsstücken der Toten hängen.
»Was … was war das?«, fragte sein Knappe. Der Junge war ganz grün im Gesicht.
»Ich weiß es nicht«, antwortete der Ritter. Er nahm seinen Helm ab und gab ihn dem Knappen.
Dann begab er sich auf das Feld des Todes zurück.
Er zählte rasch nach und atmete dabei so flach wie möglich.
Die Hunde lagen fast alle am selben Ort. Er zog sein Schwert, vier Fuß spiegelblanken Stahl, und benutzte es als Hebel, mit dem er den Leichnam eines Mannes von dem Hundehaufen rollte, der Beine wie Baumstämme und Arme wie Schinken gehabt hatte.
Er kniete sich hin, zog einen Panzerhandschuh aus und hob etwas auf, das wie ein Stück Wolle aussah.
Heftig stieß er die Luft aus.
Dann streckte er sein Schwert vor, rief Gott um Hilfe an, sammelte die göttliche goldene Macht und wirkte einen kleinen raschen Zauber.
»Narren«, sagte er laut.
Seine Magie zeigte ihm, wo der Priester gestorben war. Er fand den Kopf des Mannes, ließ ihn jedoch an Ort und Stelle liegen. Dann fand er seinen Dolch und legte ein Phantasma darüber.
»Du anmaßender Idiot«, sagte er zu dem Kopf.
Er zog den Leichnam des Fuhrmannes von dem zerfetzten Körper seiner Tochter, drehte sich zur Seite und musste sich übergeben. Danach kniete er nieder und betete. Und weinte.
Und schließlich kam er taumelnd wieder auf die Beine und ging zu der Stelle zurück, wo sein Knappe auf ihn wartete. Die Sorge stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Es war eine Goldene Bärin«, sagte er.
»Gütiger Gott«, erwiderte der Knappe. »Hier? Dreihundert Meilen vom Wall entfernt?«
»Lästere nicht Gott, Junge. Sie haben das Tier gefangen genommen und hierhergebracht. Sie haben es gegen Hunde kämpfen lassen. Es hatte Junge, und eines von ihnen haben sie den Hunden vorgeworfen.« Er zuckte die Achseln.
Sein Knappe bekreuzigte sich.
»Du musst nach Harndon reiten und dem König Bericht erstatten«, sagte der Ritter. »Ich werde die Bärin aufspüren.«
Der Knappe nickte. »Ich kann bei Einbruch der Nacht in der Stadt sein, Mylord.«
»Ich weiß. Geh jetzt. Es ist eine einzelne Bärin, und die Menschen haben sie hierhergebracht. Ich werde diesen Narren die Angst nehmen, auch wenn sie eigentlich weiter in ihr schmoren sollten. Sag dem König, dass der Bischof von Jarsay einen neuen Vikar braucht. Sein kopfloser Leichnam liegt hier. Da ich den Mann gekannt habe, nehme ich an, dass es seine eigene Schuld war, und das Freundlichste, das ich über ihn sagen kann, ist, dass er das bekommen hat, was er verdiente.«
Sein Knappe erbleichte. »Nun seid Ihr es aber, der gotteslästerlich spricht.«
Ser Mark spuckte aus. Noch immer schmeckte er sein Erbrochenes. Also nahm er eine Weinflasche aus dem Lederbeutel hinter seinem Sattel und trank sie zu einem Drittteil leer.
»Wie lange bist du schon mein Knappe?«, fragte er.
Der junge Mann lächelte. »Zwei Jahre, Mylord.«
»Wie oft sind wir schon gemeinsam der Wildnis gegenübergetreten?«, fragte er.
Der junge Mann hob die Brauen. »Ein Dutzend Mal.«
»Wie oft hat die Wildnis Menschen aus reiner Bösartigkeit angegriffen?«, wollte der Ritter wissen. »Wenn ein Mensch mit einer Mistgabel in einem Hornissennest herumstochert, wird er gestochen. Macht das die Hornissen etwa böse?«
Sein Knappe seufzte. »In der Schule wird aber etwas anderes gelehrt«, sagte er.
Der Ritter nahm noch einen tiefen Schluck aus der Weinflasche. »Die Bärin war eine Mutter und hat noch immer ein Junges. Da sind die Spuren. Ich werde ihr folgen.«
»Einer Goldenen Bärin?«, fragte der Knappe. »Allein?«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich auf dem Turnierplatz gegen sie kämpfen will, Junge. Ich folge ihr bloß. Und du sagst es dem König.« Der Ritter sprang mit akrobatischem Geschick in den Sattel. Das war eine der Fähigkeiten, aufgrund derer ihn sein Knappe wie einen Helden verehrte. »Ich schicke ein Phantasma zur Komturei, falls ich Zeit und Kraft dazu habe. Geh jetzt.«
»Ja, Mylord.« Der Knappe wendete sein Pferd und trieb es sogleich zu einem Galopp an, wie man es ihm im Orden beigebracht hatte.
Ser Mark beugte sich von seinem großen Pferd herab und betrachtete die Spuren auf dem Boden, dann legte er die Hand auf den Hals seines Kriegsrosses. »Du musst dich nicht beeilen, Bess«, sagte er.
Es war leicht, den Spuren zu folgen. Die Goldene Bärin hatte auf den nächsten Wald zugehalten, so wie jedes Geschöpf der Wildnis es tun würde. Er machte sich nicht die Mühe, der Spur haargenau zu folgen, sondern ritt einfach dahin und untersuchte von Zeit zu Zeit den Boden. Es war ihm zu warm in seiner vollen Rüstung, doch der Alarmruf hatte ihn im Übungshof erreicht, und er hatte sich nicht mehr umkleiden können.
Der Wein sang in seinen Adern. Er wollte auch den Rest trinken.
Das tote Kind …
Die Fetzen des toten Bärenjungen …
Als er selbst noch den Katechismus gelernt und als Knappe im Gefolge seines Ritters gedient hatte, hatte der immer gesagt: Zuerst tötet der Krieg die Unschuldigen.
Dort, wo die Stoppeln des Weizens vom letzten Jahr in verfilztes Gebüsch übergingen, sah er das Loch, das die Bärin in die Hecke gebrochen hatte. Er hielt an.
Er hatte keine Lanze dabei; eine Lanze war die beste Waffe im Umgang mit einem Bären.
Er zog sein Kriegsschwert, doch trieb er Bess nicht durch das Loch in der Hecke.
Er ritt an ihr entlang, bis er einen Durchgang fand, und preschte im Galopp auf der anderen Seite zurück.
Spuren.
Aber kein Bär.
Mit dem gezogenen Schwert kam er sich etwas lächerlich vor, doch er verspürte keine Lust, es wieder wegzustecken. Die frischen Spuren mochten kaum eine Stunde alt sein, und der Tatzenabdruck der Bärin hatte die Größe eines Zinntellers aus der Küche der Komturei.
Plötzlich ertönten laut knackende Geräusche links von ihm.
Er fasste die Zügel fester und wendete sein Pferd. Es war hervorragend ausgebildet, drehte sich auf den Vorderpfoten um und hielt den Kopf auf die Bedrohung ausgerichtet.
Dann lenkte er die Stute Schritt für Schritt zurück.
Knack.
Raschel.
Er bemerkte eine blitzartige Bewegung, drehte den Kopf und sah, wie ein Häher in die Luft stieg, dann blickte er wieder nach unten …
Nichts.
»Gesegnete Jungfrau, steh mir bei«, sagte er laut. Dann hob er sich im Sattel ein wenig an und berührte mit den Sporen ganz leicht Bess’ Flanken. Sofort ging sie weiter.
Er drehte ihren Kopf und machte sich daran, den Wald zu umreiten. Er konnte nicht sehr groß sein.
Raschel.
Raschel.
Knack.
Knirsch.
Es war genau hier.
Er gab dem Pferd etwas heftiger die Sporen, und es fiel in einen Trab. Die Erde erzitterte unter dem großen Tier.
In der Nähe von Lorica · Eine Goldene Bärin
Sie wurde gejagt. Sie konnte das Pferd riechen, hörte die beschlagenen Hufe auf der Frühlingserde und spürte seinen Stolz und sein Vertrauen auf den Mörder, der es ritt.
Nach Monaten der Erniedrigung, der Sklaverei, Folter und Demütigung wäre sie gern umgekehrt und hätte gegen den stahlummantelten Kriegsmann gekämpft. Aber ihr Junges jammerte sie an. Ihr Junges – es ging nur noch um ihr Junges. Sie war eingefangen worden, weil die Kleinen nicht hatten weglaufen können, und sie hatte sie nicht zurücklassen wollen; also hatte sie um ihretwillen gelitten.
Und nun war nur noch eines übrig.
Es war das Kleinere der beiden, dasjenige, dessen Gold im Pelz heller war. Es befand sich am Rande der Erschöpfung, litt unter Austrocknung und Panik. Es hatte die Gabe der Sprache verloren und konnte nur noch jammern wie ein dummes Tier. Seine Mutter befürchtete schon, es auf immer verloren zu haben.
Aber sie musste es versuchen. Das Blut in ihren Adern schrie ihr zu, dass sie versuchen musste, ihr Junges zu retten.
Sie nahm das Kleine zwischen die Zähne, so wie eine Katze ihr Junges trägt, und rannte weiter, wobei sie die Schmerzen in ihren Tatzen kaum beachtete.
Lorica · Ser Mark Wishart
Der Ritter galoppierte um den westlichen Rand des Waldes herum und sah den Fluss, der einen weiten Bogen beschrieb. Er sah die torkelnde goldene Kreatur im Licht der untergehenden Sonne wie ein Wappentier auf einem Stadtschild glitzern. Die Bärin rannte geradeaus. Sie war so wunderschön. Wild. Und höchst gefährlich.
»O Bess«, sagte er. Einen Augenblick lang überlegte er, ob er die Bärin nicht einfach ziehen lassen sollte.
Doch das entsprach nicht dem Eid, den er geleistet hatte.
Sein Reittier stellte die Ohren auf. Der Ritter hob das Schwert, Bess brach in einen Galopp aus, und er schloss das Visier vor seinem Helm.
Bess war schneller als die Bärin. Nicht viel schneller zwar, aber das große Muttertier wurde durch ihr Kleines behindert, und er sah, dass ihre Hintertatzen blutig und zerfetzt waren.
Er hatte sie eingeholt, als sich der Boden allmählich zum Fluss hin absenkte. Hier, in der Nähe des Meeres, war er sehr breit und roch nach Salzwasser. Der Ritter hob sich aus dem Sattel und hielt das Schwert vor sich …
Plötzlich ließ die Bärin ihr Kleines los, das in ein niedriges Gebüsch fiel, und drehte sich wie eine große Katze um. Innerhalb eines Herzschlages war sie von der Gejagten zur Jägerin geworden.
Sie stellte sich auf die Hinterbeine, als er nach ihr ausschlug – und sie war schneller als jedes Geschöpf, dem er jemals begegnet war. Sie wirbelte mit ihrem ganzen Gewicht herum und führte einen mächtigen Schlag gegen sein Pferd, während sein Schwert durch das Fleisch ihrer rechten Vordertatze in die Brust eindrang.
Bess war längst schon unter ihm gestorben.
Er setzte rückwärts über die hohe Kruppe, so wie es ihm beigebracht worden war. Hart traf er auf den Boden, rollte herum und sprang wieder auf die Beine. Er hatte sein Schwert verloren – und sah die Bärin nicht mehr. Er zog den Dolch aus seinem Gürtel und drehte sich blitzartig um. Es war trotzdem zu langsam.
Sie traf ihn. Der Schlag fuhr in seine Seite, warf ihn von den Beinen, aber sein Brustpanzer hielt stand, und so drangen die Krallen nicht in ihn ein. Durch reines Glück rollte er nun über sein Schwert und kam mit ihm in der Hand wieder auf die Beine. Etwas an seinem rechten Bein tat schrecklich weh – vermutlich war es gebrochen.
Die Bärin blutete.
Das Kleine jammerte.
Seine Mutter sah es an. Sah ihn an. Dann rannte sie los, nahm das Kleine mit dem Mund auf und preschte zum Fluss. Er sah ihr nach, bis sie verschwunden war – sie sprang in das eiskalte Wasser und schwamm rasch davon.
Mit hängenden Schultern stand er da, bis sein Atem wieder gleichmäßiger ging. Dann trat er hinüber zu seinem toten Pferd, fand die unzerbrochene Weinflasche und trank sie leer.
Er sagte ein Gebet für das Pferd, das er geliebt hatte.
Und wartete darauf, gefunden zu werden.
Westlich von Lissen Carak · Thorn
Zweihundert Meilen weiter nordwestlich saß Thorn unter einer großen Steineiche, die schon ein ganzes Jahrtausend gesehen hatte. Der Baum war sowohl groß als auch breit, und seine Nachkommenschaft füllte den Raum zwischen den Bergen im Norden und dem tiefer liegenden Cohocton, der im Süden floss.
Thorn saß mit überkreuzten Beinen auf der Erde. Er glich nicht mehr dem Mann, der er früher einmal gewesen war. Wenn er sich zu voller Größe aufrichtete, war er so gewaltig wie eine Scheune, und seine Haut wirkte dort, wo sie durch die Schichten aus Moos und Leder hindurchschimmerte, als bestünde sie aus glattem, grauem Stein. Ein Stab – geschnitzt aus einem geraden Eschenstamm, der in seinem zwanzigsten Lebensjahr von einem Blitz getroffen worden war – lag quer über seinem Schoß. Seine verkrümmten Finger, die so lang waren wie die Zinken einer Heugabel, beschrieben unheimliche Zeichen aus blassgrünem Feuer, als er sie in die Wildnis nach seinem Späherkreis ausstreckte.
Er fand den jüngsten und angriffslustigsten der Qwethnethogs – das war jenes starke Volk der tiefen Wildnis, das die Menschen Dämonen nannten. Tunxis. Jung, wütend und leicht zu beherrschen.
Er spannte seinen Willen an, und Tunxis kam. Er war vorsichtig, was die Art seiner Zitationen betraf; Tunxis hatte mächtige Verwandte, die es Thorn verübelten, wenn er den jüngeren Dämon für seine eigenen Zwecke gebrauchte.
Tunxis rannte zwischen den Eichen an der Ostseite hervor. Seine langen, muskulösen Beine wirkten im vollen Lauf wunderschön. Er beugte den Körper weit vor und hielt das Gleichgewicht mit dem schweren, gepanzerten Schwanz, der so typisch für seine Art war. Seine Brust wirkte täuschend menschenähnlich, hatte allerdings eine blaugrüne Färbung, und Arme und Schultern glichen ebenfalls denen eines Menschen. Sein Gesicht war von engelsgleicher Schönheit. Er hatte große, tiefe und leicht schräg stehende Augen, die offen und unschuldig dreinblickten und zwischen denen ein Knochengrat verlief, der zu dem anmutigen Helm anstieg, der die männlichen Wesen von den weiblichen unterschied. Sein Schnabel war auf Hochglanz poliert und mit Lapislazuli sowie mit Gold eingelegt, was seinen gesellschaftlichen Rang ausdrückte. Außerdem trug er ein Schwert, das nur wenige Menschen hätten heben können.
Er war wütend – aber Tunxis befand sich in einem Alter, in dem junge Männer stets wütend waren.
»Warum hast du mich gerufen?«, kreischte er.
Thorn nickte. »Weil ich dich brauche«, gab er zur Antwort.
Tunxis klackte verächtlich mit dem Schnabel. »Aber vielleicht brauche ich dich doch nicht. Und auch deine Spielchen nicht.«
»Es waren meine Spielchen, die es dir erlaubt haben, die Hexe zu töten.« Thron lächelte nicht. Er hatte die Fähigkeit dazu verloren, aber innerlich musste er grinsen, denn Tunxis war noch so jung.
Der Schnabel klackte erneut. »Sie war gar nichts.« Ein weiteres Klacken, diesmal aus tiefer Befriedigung. »Du wolltest sie tot sehen. Außerdem war sie zu jung. Du hast mir einen Festschmaus versprochen und nur Abfall gegeben. Ein Nichts.«
Thorn betastete seinen Stab. »Jetzt ist sie allerdings ein Nichts.« Sein Freund hatte um ihren Tod gebeten. Verrat über Verrat. Gefallen, um die gebeten wurde und die geschuldet wurden. Eben die Wildnis. Seine Aufmerksamkeit drohte von dem Dämon abgelenkt zu werden. Vermutlich war es ein Fehler gewesen, Tunxis die Erlaubnis zu geben, in jenem Tal zu töten.
»Meine Base sagt, dass bewaffnete Männer durch das Tal reiten. Durch unser Tal.« Tunxis sprach undeutlich, wie es bei seinesgleichen stets vorkam, wenn man von großer Leidenschaft bewegt war.
Thorn beugte sich vor und war plötzlich sehr interessiert. »Mogan hat sie gesehen?«, fragte er.
»Sie hat sie gerochen. Beobachtet. Und ihre Pferde gezählt.« Tunxis bewegte seine Augenbrauen auf Dämonenart. Es wirkte wie ein Lächeln, aber sein Schnabel schloss sich dabei – wie in Freude über eine gute Mahlzeit.
Thorn hatte die Dämonen seit vielen Jahren studieren können. Sie waren seine engsten Verbündeten, seine Leutnants, denen aber nicht zu trauen war. »Wie viele?«, fragte Thorn geduldig.
»Viele«, erwiderte Tunxis, der schon wieder gelangweilt wirkte. »Ich werde sie finden und töten.«
Thorn seufzte. »Nein. Du wirst sie aufspüren und beobachten. Und zwar aus der Ferne. Wir werden alles über ihre Stärken und Schwächen in Erfahrung bringen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie nach Süden über die Brücke ziehen oder sich der Garnison der Lady anschließen. Für uns ist das nicht von Bedeutung.«
»Es ist vielleicht für dich nicht von Bedeutung, Wendehals. Aber es ist unser Land. Unser Tal. Unser Gebirge. Unsere Festung. Unsere Macht. Nur weil du schwach bist …« Tunxis klackte mit seinem Schnabel dreimal laut und deutlich.
Thorn machte eine rollende Bewegung mit seiner Hand, zuckte mit den langen Fingern, und der Dämon fiel so plötzlich zu Boden, als wären ihm alle Sehnen durchtrennt worden.
Thorns Stimme wurde zum Zischen einer Schlange.
»Ich bin schwach? Es sind viele Soldaten? Sie kommen aus dem Osten? Du bist ein Narr und ein Kind, Tunxis. Ich könnte dir die Seele aus dem Körper reißen und sie verspeisen, und du könntest nicht einmal eine Klaue heben, um mich daran zu hindern. Selbst jetzt kannst du dich nicht mehr bewegen, bist nicht in der Lage, eine Macht herbeizurufen. Du bist wie ein Küken im rauschenden Wasser, während der Hecht kommt und es fressen will. Verstanden? Und du sagst mir, dass es ›viele‹ sind – wie ein Lord, der seinen Bauern ein paar Krumen vor die Füße wirft. Viele?« Er beugte sich über den flach am Boden liegenden Dämon und stieß ihm seinen schweren Stab in den Bauch. »Wie viele genau, du kleiner Dummkopf?«
»Ich weiß es nicht«, gelang es Tunxis zu sagen.
»Aus Osten oder aus Südosten? Aus Harndon, vom König? Oder aus dem Gebiet jenseits der Berge? Weißt du es?«, zischte er.
»Nein«, gab Tunxis zu und krümmte sich.
»Tunxis, mir gefällt es, höflich zu sein. Ich handle gern wie …« Er suchte nach einem Weg, sich der fremdartigen Gedankenwelt mitzuteilen. »Ich verhalte mich gern so, als wären wir Verbündete, die ein gemeinsames Ziel teilen.«
»Du behandelst uns wie Diener. Aber wir dienen niemandem!«, spuckte der Dämon aus. »Wir sind nicht so wie deine Menschen, die immer nur lügen und all diese hübschen Dinge sagen. Wir sind Qwethnethogs!«
Thorn stieß seinen Stab noch fester gegen die Eingeweide des jungen Dämons. »Manchmal habe ich die Wildnis und ihren endlosen Kampf einfach satt. Ich versuche dir und deinem Volk dabei zu helfen, dass ihr euer Tal zurückbekommt. Euer Ziel ist auch mein Ziel. Und deshalb werde ich dich nicht verspeisen, so gern ich es in diesem Augenblick auch täte.« Er zog seinen Stab zurück.
»Meine Vettern sagen, dass ich dir nicht trauen darf. Dass du bloß noch so ein Mensch bist, welchen Körper du auch tragen magst.« Tunxis setzte sich und rollte mit fließender und reiner Anmut auf die Beine.
»Was auch immer ich sein mag, ohne mich habt ihr keine Aussichten auf einen Sieg gegen die Mächte des Felsens. Allein werdet ihr niemals euren Platz zurückerobern.«
»Die Menschen sind schwach«, spuckte Tunxis aus.
»Die Menschen haben deine Art immer wieder besiegt. Sie verbrennen die Wälder. Sie bauen Gehöfte und Brücken und heben Armeen aus, und deine Art verliert andauernd.« Er erkannte, dass er gerade versuchte, mit einem Kind zu verhandeln. »Tunxis«, sagte er und ergriff damit die Essenz der jungen Kreatur. »Tu, was ich dir gesagt habe. Geh, beobachte die Menschen, komm danach zu mir zurück, und erstatte mir Bericht.«
Aber Tunxis hatte eigene Macht, und Thorn beobachtete, wie ein großer Teil des Zwangs, den er ausübte, von dem Wesen abprallte. Als er seinen Griff lockerte, drehte sich der Dämon um und rannte auf die Bäume zu.
Erst jetzt erinnerte sich Thorn daran, dass er den Jungen aus einem ganz anderen Grund gerufen hatte. Plötzlich fühlte er sich müde und alt. Aber er strengte sich noch einmal an, rief diesmal einen der Abethnog, die von den Menschen Lindwürmer genannt wurden.
Die Abethnog waren fügsamer. Sie waren weniger widerspenstig, allerdings genauso aggressiv. Aber da sie nicht die Fähigkeit besaßen, die Macht unmittelbar für sich einzusetzen, vermieden sie für gewöhnlich einen offenen Streit mit dem Magi.
Sidhi landete sanft auf der Lichtung vor der Steineiche, auch wenn die dazu nötigen Bewegungen große Anforderungen an seine Geschicklichkeit stellten.
»Ich komme«, sagte er.
Thorn nickte. »Ich danke dir. Du musst den unteren Teil des Tales im Osten beobachten«, sagte er. »Im Augenblick befinden sich dort Menschen. Sie sind bewaffnet und vermutlich sehr gefährlich.«
»Welcher Mensch sollte mir gefährlich werden?«, fragte der Lindwurm. Tatsächlich war Sidhi genauso groß wie Thorn, und die Spannweite seiner Flügel war beträchtlich. Sogar Thorn verspürte wahre Angst, wenn ein Abethnog wütend wurde.
Thorn nickte. »Sie haben Bögen und noch andere Waffen, die dich schwer verletzen könnten.«
Sidhi ließ ein seltsames Geräusch in seiner Kehle entstehen. »Warum sollte ich dann deinen Befehl ausführen?«
»Ich habe die Augen deiner Brut geklärt, als sie im Winter umwölkt waren. Ich habe dir den Wärmestein für das Nest deiner Gefährtin gegeben.« Thorn machte eine Handbewegung, die andeuten sollte, dass er auch weiterhin bereit war, kranke Lindwürmer zu heilen.
Sidhi faltete seine Flügel auseinander. »Ich wollte eigentlich auf die Jagd gehen«, sagte er. »Ich bin hungrig. Wenn ich von dir gerufen werde, komme ich mir immer wie ein Hund vor.« Die Schwingen wurden breiter und breiter. »Aber vielleicht entscheide ich mich dazu, im Osten zu jagen, und möglicherweise bekomme ich dann deine Feinde zu Gesicht.«
»Sie sind auch deine Feinde«, sagte Thorn müde. Warum sind sie nur allesamt so kindisch?
Der Lindwurm warf den Kopf zurück, kreischte und schlug mit den Schwingen. Nach einem Augenblick des Aufruhrs befand er sich in der Luft, und die Bäume um ihn herum verloren in dem gewaltigen Luftsog etliche Blätter. Eine ganze Nacht heftigsten Regens hätte die Bäume nicht derartig entlauben können.
Dann streckte Thorn seine Macht noch einmal aus – sanft, zögernd, ein wenig wie ein Mann, der in einer dunkeln Nacht aus seinem Bett steigt und eine unvertraute Treppe hinuntergeht. Er wandte sich nach Osten – weiter, noch etwas weiter, bis er das gefunden hatte, was er immer fand.
Sie. Die Herrin des Felsens.
Er betastete die Mauern wie ein Mann, der mit der Zunge über einen schlimmen Zahn fährt. Sie war da, eingehüllt in ihre Macht. Und bei ihr war noch etwas vollkommen anderes. Er konnte es nicht erkennen; die Festung besaß ihre eigene Macht und ihre eigenen uralten Sigille, die gegen ihn arbeiteten.
Er seufzte. Es regnete. Er saß im Regen und versuchte, das Sprossen des Frühlings überall um sich herum zu genießen.
Tunxis hat die Nonne getötet, und nun verfügt die Äbtissin über noch mehr Soldaten. Er hatte etwas in Gang gesetzt, und er wusste nicht recht, warum er das eigentlich getan hatte.
Und er fragte sich, ob er einen Fehler begangen hatte.