6
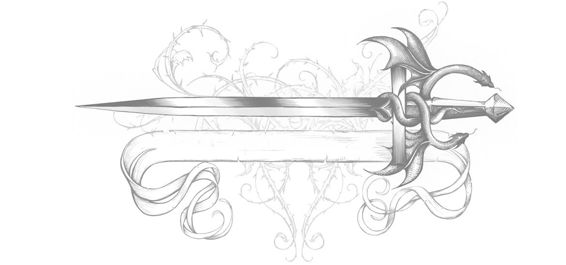
Prynwrithe · Ser Mark Wishart
Mehr als zweihundert Meilen südlich des Cohocton und westlich von Harndon erhob sich die Priorei von Prynwrithe. Es war eine wunderbare, hundert Jahre alte Burg, die auf einem massiven Felssporn errichtet war und hohe Zinnen, vier schlanke Türme mit Bogenfenstern und kupfernen Dächern sowie ein großes gewölbtes Tor besaß, sodass manchem Besucher bei diesem Anblick die Bemerkung entfuhr, dies alles müsse von den Feen erbaut worden sein.
Aber Ser Mark Wishart, der Prior, wusste es besser. Dieses Bauwerk war einmal von einem reichen Dieb errichtet worden, der es zur Rettung seines Seelenheils der Kirche übereignet hatte.
Es war sehr bequem, an diesem Ort zu wohnen – ein Traum für jeden Soldaten, der die meiste Zeit seines Lebens auf der harten, kalten Erde hatte schlafen müssen. Der Prior stand im Hemd vor einem lodernden Feuer und hielt ein Stück Rinde in der Hand – ein kleines Stück Birkenrinde, das beinahe vollkommen schwarz geworden war. Er drehte es hin und her und zuckte dabei unter den Schmerzen in seiner Schulter zusammen. Die Bärin hatte ihn stark verwundet.
Es war ein kalter Morgen, und durch das verglaste Fenster sah er, dass es Frost gegeben hatte. Doch es war nur harmlos; denn der Frühling lag schon in der Luft und mit ihm das Versprechen auf Blumen, Feldfrüchte und frisches Leben.
Er seufzte.
Dean, sein neuer Diener, erschien mit einem Becher Dünnbier und seinem gereinigten Mantel. »Mylord?« Obwohl diese Frage nur aus einem Wort bestand, war sie aufrüttelnd und bedeutungsschwer.
Der Junge war viel zu klug, um sein Leben damit zu verbringen, alten Männern Hypocras einzuschenken.
»Unterhose, Hose, Wams und Rock, mein Junge«, sagte der Prior. »Und ruf den Marschall sowie meinen Knappen.«
Thomas Clapton, der Marschall des Ordens vom heiligen Thomas von Acon, traf in seinen Privatgemächern ein, bevor der Prior seine Hose an das Wams geknöpft hatte – dies war etwas, das er keinem Diener erlauben wollte.
»Mylord«, sagte der Marschall förmlich.
»Wie groß ist unsere Kampfkraft in diesem Augenblick?«, wollte der Prior wissen.
»In der Priorei?«, fragte der Marschall zurück. »Ich kann sechzehn Ritter für Euch auftreiben, die in der Lage sind, noch heute Morgen auszureiten. Und im gesamten Herrschaftsgebiet? Vielleicht fünfzig, wenn ich Euch auch die alten Männer und die Jungen dazu gebe.«
Der Prior hob das Stück Birkenrinde, und sein Marschall erbleichte.
»Und wenn wir all unsere Knappen, die schon dazu bereit sind, zu Rittern schlagen?«, fragte Ser Mark.
Der Marschall nickte. »Dann sind es vielleicht siebzig.« Er rieb sich den Bart.
»So sei es«, sagte Ser Mark. »Hier geht es nicht um einen kleineren feindlichen Einfall. Sie würde uns niemals rufen, wenn das kein Krieg wäre.«
Der Palast von Harndon · Harmodius
Harmodius verfluchte sein Alter und suchte in dem silbernen Spiegel nach beruhigenden Anblicken. Doch er fand keine. Die buschigen schwarz-weißen Brauen empfahlen ihn genauso wenig als Liebhaber, wie es sein Kopf tat, der oben kahl war, während die weißen Haare an den Seiten bis auf die Schultern herabhingen, die Haut vom Alter gezeichnet und die Schultern gebeugt waren.
Er schüttelte den Kopf, eher über die Dummheit, die Königin zu begehren, als über sein Spiegelbild. Er gestand sich ein, dass er mit seinem Spiegelbild und dessen Ursprung grundsätzlich zufrieden war.
»Ha!«, sagte er zu dem Spiegel.
Miltiades rieb sich gegen ihn, und Harmodius schaute auf die alte Katze hinunter.
»Die Alten sagen uns, dass sich die Erinnerung zur Wirklichkeit verhält wie das Wachssiegel zum Stempel«, sagte er.
Die Katze sah mit altersmüder Gleichgültigkeit zu ihm hoch.
»Nun?«, fragte er Miltiades. »Gilt die Erinnerung an mein eigenes Spiegelbild etwa als eine neue Ebene der Entfernung von der Wirklichkeit? Ist sie das Bild eines Abbildes derselben?« Er kicherte, war zufrieden mit diesem seltsamen Einfall, und da kam ihm noch ein anderer.
»Wie wäre es, wenn du einen Zauber wirken könntest, der das, was wir sehen, zwischen Auge und Hirn verändert?«, fragte er die Katze. »Was würde das Hirn dann wahrnehmen? Wäre es die Wirklichkeit, oder ein Abbild derselben, oder nur das Bild eines Bildes?«
Wieder warf er einen Blick in den Spiegel. Dann schürzte er die Lippen und machte sich daran, die Treppe hinaufzusteigen. Die Katze folgte ihm; ihr schwerer, vierpfotiger Gang war zugleich eine stumme Beschwerde und Anklage gegen ihr Übergewicht.
»Also gut«, sagte Harmodius, nahm Miltiades auf den Arm und streichelte dem Tier über den schmerzenden Rücken. »Vielleicht sollte ich mich etwas mehr bewegen«, sagte er. »In meiner Jugend war ich ein annehmbarer Schwertkämpfer.«
Die Schurrhaare der Katze zuckten vor Tadel.
»Ja, meine Jugend liegt schon einige Zeit zurück«, gab er zu.
Die Schwerter hatten seitdem ihre Form verändert. Und ihr Gewicht.
Er seufzte.
Am oberen Ende der Treppe schloss er die Tür zu seinem Allerheiligsten auf und stellte die Schutzmechanismen neu ein, die er hier zurückgelassen hatte. Es gab nur wenig zu bewachen. Zwar waren seine Bücher und Artefakte überaus wertvoll, aber sie wurden nicht durch das Schloss und die magischen Wächter geschützt, sondern durch den König persönlich. Wenn er je das Vertrauen des Königs verlieren sollte …
Er wollte gar nicht darüber nachdenken.
Das Verlangen nach Desiderata war vermutlich der kleinste gemeinsame Nenner des gesamten Hofes, dachte er und lachte. Dann begab er sich zur Nordwand, an der das Regal mit den archaischen Schriftrollen stand. Die meisten hatte er auf Raubzügen in die Nekropolen der fernen Südländer an sich gebracht, und sie warteten auf ihn wie die Tauben in einem Schlag. Früher bin ich ein sehr wagemutiger Mann gewesen.
Er setzte Miltiades auf dem Boden ab, und die Katze tappte schwer in die Zimmermitte und legte sich in die Sonne.
Er las Texte über die Ursprünge der menschlichen Erinnerung. Dabei trank er immer wieder ein wenig aus einem Glas mit Wasser, das bereits einen Tag alt war. Dadurch schmeckte er noch ein wenig von den Flammen des vergangenen Tages, vermischt mit etwas Kreide, und mindestens ein Dutzend Mal sagte er während des Lesens »Hm.«
»Hm«, sagte er erneut und rollte das Schriftstück sorgfältig zusammen, bevor er es wieder in die Knochenröhre schob, die es schützte. Die Schriftrolle war unsagbar wertvoll – es war eine von vielleicht drei noch existierenden Rollen des Archaikers Aristoteles. Er hatte sie schon immer kopieren wollen, es bisher aber nicht getan. Manchmal war er versucht, die Vernichtung der beiden anderen anzuordnen, die sich in der Bibliothek des Königs befanden.
Er seufzte über seinen kindlichen Stolz.
Die Katze streckte sich im Sonnenpfuhl aus und schlief ein.
Nun erschienen die anderen beiden Katzen. Er wusste nicht, wo sie gewesen waren – und plötzlich war er sich gar nicht mehr sicher, wann er sie bei sich aufgenommen hatte und woher sie überhaupt gekommen sein mochten.
Aber er hatte die Stelle gefunden, an die er sich erinnert hatte. Darin ging es um ein Organ im Gewebe des Hirns, das die Bilder vom Auge zum Verstand übertrug.
»Hm«, sagte er lächelnd zu sich selbst und streckte die Hand nach der alten Katze aus, weil er sie streicheln wollte. Sie biss ihn heftig.
Seine blutende Hand zuckte zurück, und er fluchte.
Miltiades stand auf, ging ein paar Schritte, legte sich wieder hin. Und starrte ihn böse an.
»Ich benötige eine Leiche. Vielleicht sogar ein Dutzend«, sagte er, bog die Finger und stellte sich die Obduktion vor. Sein Meister hatte Obduktionen immer geliebt … und es hatte kein gutes Ende genommen.
Es hatte ihn dazu geführt, auf dem Feld von Chevin auf der Seite der Wildnis zu kämpfen. Diese alte Erinnerung schmerzte, und Harmodius kam ein seltsamer Gedanke. Wann habe ich zuletzt an die Schlacht von Chevin gedacht?
Wie eine Lawine polterte es in seinen Kopf hinein. Er geriet ins Taumeln und setzte sich unter dem Ansturm der Erinnerungen an die merkwürdige Aufstellung des Feindes. Da waren die Wildbuben an den Flanken und all die Ungeheuer in der Mitte, während die Ritterschaft des Königreiches mit Pfeilen übersät wurde, als sie durch die Wellen des Grauens ritt und sich den Kreaturen der Wildnis gegenüberstellte.
Seine Hände zitterten.
Und sein Meister war bei ihnen gewesen. Er hatte sorgfältige Zaubereien gewirkt, die die Ritter getäuscht und verwirrt hatten. Er hatte die königlichen Bogenschützen dazu gebracht, ihre Pfeile auf die eigenen Ritter abzuschießen und gegeneinander zu kämpfen …
Und so habe ich ihn angegriffen. Harmodius schätzte diese Erinnerungen nicht sehr. Der König hatte ihn angefleht, irgendetwas zu unternehmen. Die Barone waren misstrauisch gegen ihn gewesen, denn sie hatten befürchtet, er könnte sie verraten und sich ebenfalls auf die Seite der Wildnis schlagen.
Der Gedanke an die Augen seines Meisters, als sie sich gegenübergestanden hatten …
Er hat Zauber gewirkt, und ich habe ebenfalls Zauber gewirkt. Harmodius schüttelte den Kopf. Warum ist er zu unserem Feind übergelaufen? Warum? Warum? Warum? Was hat er erfahren, als er diese alten Leichen sezierte?
Warum habe ich noch nie darüber nachgedacht?
Wieder zuckte er mit den Achseln. »Meine Überheblichkeit hat sich von der seinen unterschieden«, sagte er zu seinen Katzen. »Aber ich bete zu Gott, dass er das Licht sehen wird.« Zumindest so viel davon, dass es ihn zu einem kleinen Aschehaufen zusammenfallen lässt, fuhr er in Gedanken fort. Es sollte ein wahrhaft mächtiges Licht sein. Hell wie ein Blitz.
Einige Dinge wurden am besten nicht laut ausgesprochen, damit sie nicht herbeigerufen werden konnten. Er hatte seinen Meister besiegt, aber dessen Leichnam war nie gefunden worden. Und tief in seinem Innern wusste Harmodius, dass sein Lehrer noch irgendwo da draußen war. Dass er noch immer ein Teil der Wildnis war.
Es reicht, dachte er und griff nach einer weiteren Schriftrolle, die sich mit dem Erinnerungsvermögen beschäftigte. Er überflog sie schnell, nahm ein schweres Lexikon von einem hohen Regal, schlug etwas nach und schrieb eilig ein paar Worte nieder.
Er hielt inne, klopfte mit den Fingern in schneller Folge gegen einen alten gläsernen Trinkbecher und dachte darüber nach, wer ihn mit frischen Leichen für seine Arbeit versorgen könnte. In der Hauptstadt kam niemand infrage. Sie war zu klein, und am Hof herrschten Intrige und Geschwätz.
»Wer würde euch füttern, wenn ich eine Reise machte?«, fragte er die Katzen. Aber schon raste sein Puls. Er hatte seinen Turm nicht mehr verlassen, seit … er konnte sich nicht erinnern.
»Grundgütiger Gott, bin ich etwa seit der Schlacht ununterbrochen hier gewesen?«, fragte er Miltiades.
Die Katze sah ihn böse an.
Plötzlich kniff der Magier die Augen zusammen. Er konnte sich nicht an die Zeit erinnern, als diese Katze noch ein Kätzchen gewesen oder woher sie gekommen war. Irgendetwas stimmte nicht mit seinen Erinnerungen.
Christus, dachte er und setzte sich auf einen Stuhl. Er konnte sich daran erinnern, wie er die Katze aus dem Misthaufen neben den Stallungen geholt und vorgehabt hatte, sie zu sezieren. Aber er hatte es nicht getan.
Warum hatte er das vergessen?
War es überhaupt eine wahre Erinnerung?
Ein Speer aus reiner Angst stach durch seine Seele. Das Trinkglas fiel zu Boden, und alle Katzen sprangen auf.
Ich wurde verzaubert.
Rasch zog er die Macht mit einem geflüsterten Gebet in sich zusammen und vollführte einen kleinen und feinen Zauber. Tatsächlich war er so zart gewebt, dass er nur sehr wenig Macht dazu benötigte.
Die Spitze seines Stabes erglühte in einem satten Violett, und Harmodius bewegte ihn langsam durch das Zimmer.
Für eine Weile veränderte sich die violette Farbe nicht, doch als er eine Pause einlegte und den Stab aufrecht hielt, während er seine eigenen Kreidezeichen an der einen Wand betrachtete, glühte die Spitze zuerst rosafarben und dann in einem wütenden Rot auf.
Er schwenkte den Stab.
Rot.
Er ging näher an die Wand heran, bewegte die Spitze seines Stabes in immer kleineren Kreisen, murmelte einen zweiten Zauberspruch und redete dabei so steif wie ein Mann, der befürchtet, seine Zeilen in einem Schauspiel vergessen zu haben.
Plötzlich erschien eine ganze Reihe von Runen in heftigem Feuerrot. Es waren wilde Runen, verborgen unter der Wandfarbe.
In der Mitte befand sich ein Brandmal, das ein Drittel der Zeichen getilgt hatte.
»Beim heiligen Christus und bei Hermes, dem Heiligen der Magister«, sagte er, taumelte zurück und setzte sich etwas zu plötzlich. Eine Katze schrie auf und zog ihren Schwanz unter ihm hervor.
Jemand hatte einen Bindezauber an den Wänden seines Allerheiligsten hinterlassen. Jemand musste einen Bindezauber über ihn gelegt haben.
Auf eine bloße Ahnung hin legte er seinen Stab zur Anreicherung der Macht dorthin, wo er sich gestern befunden hatte. Er warf einen Blick von seinem Kristall zur Spitze des Stabes …
»Reines Glück«, sagte er. »Oder es ist der Wille Gottes.«
Nachdenklich stand er da. Dann holte er tief Luft und schnüffelte.
Langsam und vorsichtig sammelte er die Macht und benutzte dazu eine Gerätschaft, die in der Zimmerecke stand, sowie einen uralten Spiegel auf einem kleinen Tisch und eine Phiole mit einer leuchtend weißen Flüssigkeit darin.
Im Palast seines Geistes bewegten sich auf einem schwarz und weiß gemusterten Boden, der wie ein riesiges Schachbrett wirkte, die Figuren – Schachfiguren, die aber doch ganz anders aussahen. Es waren Bauern und Türme und Springer, aber auch Nonnen und Bäume und Pflüge, Katapulte und Lindwürmer. Langsam ordnete er sie zu einem Muster; jede Figur erhielt ein eigenes Feld.
Er ließ seine gesammelte Macht langsam auf dem Altar in der Mitte des Bodens ausfließen.
Während der Zauber voller Willenskraft in seinem Geist schwebte, kletterte Harmodius die zwanzig Stufen von seinem Studierzimmer zur Turmspitze hoch. Er öffnete die Tür und trat auf die hölzerne Brüstung hinaus, die wie ein gewaltiger Balkon wirkte und die Spitze an allen vier Seiten umgab. Die Frühlingssonne schien hell, und die Luft wirkte klar, doch der Wind war kalt.
Im Südosten sah er das Meer. Unmittelbar im Süden breitete sich Jarsey mit seinen Gehöften und Burgen meilenweit aus; es war ein Anblick wie aus einem Bilderbuch. Er hob die Arme und sandte sein Phantasma aus.
Sofort spürte er die Macht hinter sich – im Norden.
Das überraschte ihn kaum.
Langsam schritt er die Brüstung ab, wobei sein Stab dumpf auf die hölzernen Planken pochte. Den Blick hielt er auf den Horizont gerichtet. Nun sah er in westliche Richtung, und mit seiner verstärkten Sehkraft bemerkte er einen schwachen grünen Dunst tief im Westen. So war es richtig; dort herrschte die Wildnis. Aber die Grenze war weiter entfernt, als ein Mann mit einem guten Pferd in fünf Tagen zurücklegen konnte. Der grüne Hauch rührte von den riesigen Wäldern hinter den Bergen her. Sie bedeuteten eine Bedrohung – aber eine, die stets da war.
Er ging um den Turm herum.
Lange bevor er die nördlichste Stelle erreicht hatte, sah er das hellgrüne Schimmern. Sein Zauber war mächtig, also benutzte er ihn vorsichtig und saugte jede einzelne Erkenntnis auf, die ihm sein verändertes Sehvermögen gewährte.
Da war es.
Er wirkte den Zauber noch feiner, sodass das Licht, das durch ein kompliziertes System von Linsen gespiegelt wurde, zu einem einzigen leuchtenden grünen Faden wurde, der dünner als eine Spinnwebe war, die aus dem Norden unmittelbar auf den Turm zulief. Er hegte nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie genau auf die Runen an seiner Wand zeigte.
Verdammt.
»Habe ich vorhin wirklich über die Königin fantasiert?«, fragte er den Wind. »Was für ein Narr ich doch gewesen bin.«
Er durchtrennte den Faden nicht. Aber er löste den größten Teil der Äthersicht auf, die es ihm erlaubt hatte, die verschiedenen Lichtfäden zu erkennen, bis er nur noch das Glimmern seines Fadens sah. Nun benötigte sein großes Phantasma beinahe kein goldenes Licht mehr zur Verstärkung.
Zielstrebig schritt er in das Innere des Turms hinunter und schloss hinter sich sorgfältig die Tür.
Dann nahm er seinen Stab sowie die ersten beiden kleinen Zauberstäbe, die ihm in die Hände fielen, steckte überdies einen schweren Dolch und seine Börse ein, trat aus seiner Bibliothek und ließ die Tür weit offen stehen. Er kletterte die hundertzweiundzwanzig Stufen bis zum nächst tieferen Stockwerk hinunter, holte sich einen dicken Umhang sowie einen Hut und bekämpfte den Drang hierzubleiben. Er schritt durch die offene Tür und schloss sie hinter sich, wobei er sich durchaus darüber bewusst war, dass alle drei Katzen ihn vom oberen Ende der Treppe aus beobachteten. Dann ging er in seine Bibliothek zurück.
Er sehnte sich nach einem Verbündeten, doch gleichzeitig misstraute er allen und allem.
Aber er musste sich jemandem anvertrauen. Er entschied sich für seine Königin, blieb am Schreibtisch stehen und verfasste eine kleine Nachricht.
Dringende Geschäfte rufen mich in den Norden. Bitte teilt dem König mit, dass ich befürchte, von einem alten Feind zu meinem Nachteil beeinflusst worden zu sein. Seid wachsam.
Ich verbleibe der demütigste Diener Eurer Majestät
Harmodius
Rasch ging er wieder zur Wendeltreppe, schritt sie hinunter, verfluchte dabei seinen langen Stab und bewegte sich so schnell wie möglich. Er versuchte sich zu erinnern, wann er die Treppe zum letzten Mal hinuntergeklettert war. War das gestern gewesen?
Er warf einen kleinen Zauber voraus, denn nun befürchtete er, dass ihn feindliche Magie an der Abreise hindern könnte. Doch er bemerkte keine. Aber das bedeutete nichts. Wenn seine Ängste berechtigt waren, konnten ihn seine Augen trügen oder gar ein Werkzeug des Feindes sein. Funktionierte sein Blick im Äther genauso wie sein natürlicher Blick?
Richard Plangere pflegte uns zu fragen: »Was ist das Natürliche, von dem ihr sprecht?« Und wir alle verstummten.
Richard Plangere, der Zauber an meiner Wand riecht nach dir.
Harmodius hatte sich so sehr in seinen Gedanken verloren, dass er beinahe eine Stufe übersehen hätte. Sein Fuß schwebte über der Leere, und einen Moment lang befürchtete er, vierzig Fuß tief auf die Pflastersteine zu fallen. Seine einzigen Feinde waren dabei das Alter und die Erinnerung. Er fing sich wieder, und auf dem Weg nach unten stieß ihm nichts Schlimmeres als ein Schmerz in der Seite zu, der von zu schnellen Bewegungen herrührte.
Sein Turm stand am Haupthof, dessen Seiten fünfzig Schritte lang waren und der von den Regierungsgebäuden des Königs begrenzt wurde, von denen es jedoch auch noch einige an der Westmauer gab, wo hohe Fenster auf den mächtigen Fluss hinabblickten.
Er ging zum Stall. Männer und Frauen verneigten sich tief vor ihm, während er an ihnen vorüberging. Kurz fragte er sich, ob er vielleicht lieber im Schutz der Nacht aufgebrochen wäre. Jeder konnte ein Informant sein. Doch er fürchtete sich genauso sehr davor, zurück zu seinen Gemächern zu gehen.
Wovor habe ich eigentlich Angst?
Hab ich den Verstand verloren?
Er errichtete eine geistige Abtrennung um seine Zimmer und alle damit verbundenen Gedanken und Ängste und schloss die Tür hinter ihnen zu. Entweder ich befinde mich am Rande des Wahnsinns, oder ich habe soeben ein schreckliches Geheimnis entdeckt, dachte er.
Zwei Stallburschen waren in den Boxen gerade dabei, etwa zwei Dutzend königlicher Pferde in Jagdausrüstung rasch und geübt abzusatteln. Als sie den Magier sahen, hielten sie inne.
Er versuchte zu lächeln. »Ich brauche ein Pferd«, sagte er. »Ein gutes für eine längere Reise.«
Beide sahen ihn an, als sei er wahnsinnig geworden.
Und dann sahen sie einander an.
Schließlich nickte der Ältere. »Was immer Ihr wünscht, Mylord«, sagte er. »Kann Euch ’nen Renner geben – eine feine Stute namens Ginger. Wär das in Ordnung?«
Harmodius nickte, und bevor er noch mehr in Angst geraten konnte, wurde bereits ein großes kastanienbraunes Pferd mit einem leichten Sattel auf dem Rücken in den Hof geführt. Harmodius blickte mit der Verzweiflung eines alten Mannes zu dem Sattel hinauf, doch der jüngere Stallbursche hatte seine Bedenken bereits vorausgeahnt und brachte einen Schemel herbei.
Harmodius stieg auf den Schemel und zwang sich, das Bein über den Rücken des Pferdes zu schwingen.
Der Boden schien plötzlich sehr weit entfernt zu sein.
»Danke, mein Junge«, sagte Harmodius. Die Jungen reichten ihm seinen Stab, die beiden Zauberstäbe sowie seine Börse, seine Dolche und seinen Umhang hoch. Dann zeigte ihm der Ältere, wie er dies alles hinter dem Sattel verstauen konnte.
»Sorgt dafür, dass diese Botschaft zur Königin gelangt. Gebt sie persönlich ab. Das hier ist mein Ring. Damit werdet ihr vorgelassen werden, denn jeder Wächter im Palast sollte ihn kennen. Habt ihr mich verstanden?«, fragte er und begriff nun erst, dass diese beiden Jungen schreckliche Angst vor ihm hatten. Er versuchte zu lächeln. »Ihr werdet eine Belohnung erhalten.«
Der Jüngere lächelte tapfer zurück. »Wir werden uns darum kümmern, Meister.«
»Das ist gut.« Er nickte.
Sie machten sich gemeinsam auf den Weg, und er ritt davon.
Als er das Tor passierte, nickten ihm die beiden königlichen Wachen nicht einmal zu. Vielleicht sahen sie ihn aufmerksam an, vielleicht schliefen sie aber auch nur. Es war unmöglich zu sagen, denn die Ränder ihrer reich verzierten Helme verbargen ihre Augen.
Das Hufgetrappel klang auf der Zugbrücke dumpf. Der Palast und die umgebenden Gebäude waren nur ein Teil der gesamten ausgedehnten Anlage – zu der drei Verteidigungsmauern und zwei andere große Burgen gehörten –, die über der alten Stadt Harndon thronte. Zweimal in der Geschichte von Albia war die Bevölkerung des gesamten Reiches derart vermindert worden, dass sie innerhalb dieser Mauern Platz gefunden hätte.
Als die Wildnis gekommen war.
Er ritt den Burghügel hinunter zur Hauptstraße der Stadt, die vom Tor ausging, bis sie hinter der Stadtmauer zur Landstraße wurde und bei Brückstadt den mächtigen Fluss überquerte, der wie eine große Schlange von Norden nach Süden durch Albia floss.
Doch zunächst war die Straße nur eine steile Gasse zwischen schönen, weiß getünchten Häusern, die wegen ihrer Größe und den Türmchen wie kleine Burgen wirkten. Sie waren mit goldfarbenen oder schwarzen Eisenteilen geschmückt, mit roten oder blauen Türen, besaßen Dächer aus Ziegeln oder Kupfer und bemalte sowie unbemalte Marmorstatuen; die hohen und breiten Fenster waren bisweilen mit Buntglas, bisweilen auch mit Klarglas versehen. Jedes einzelne Haus war ein Palast und hatte seinen eigenen Charakter.
Hier habe ich schon einmal gespeist. Und hier auch. Wie lange bin ich weg gewesen?
Der Druck in seiner Brust ließ nach, als Harmodius den Hügel hinunterritt, die Paläste der Höflinge und berühmten Ritter betrachtete und sich dabei fragte, aus welchem Grund er sich nicht daran erinnern konnte, je einen von ihnen besucht zu haben.
Er ritt durch das innere Tor, ohne den Wachen einen Blick zu schenken. Der Wind war kalt, und er kämpfte mit seinem Umhang, während er weiter durch die Mittelstadt ritt und auf den Hauptmarkt der Stadt schaute. Der Platz war doppelt oder gar dreimal so groß wie der Burghof und voller Buden und kaufmännischer Geschäftigkeit. Bevor er es sich versah, war er bereits in der Unterstadt angelangt, überquerte die Flutstraße beim Brückentor. Sein Herz schlug schneller. Er sah keinerlei Bedrohung – aber er erwartete sie.
Die Männer am Brückentor hatten ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen großartigen Zug aus Rittern und Bewaffneten gerichtet, die gerade die Stadt betraten. Harmodius betrachtete sie unter seiner Kapuze, versuchte die Wappen zu erkennen und herauszufinden, wer der Lord sein mochte. Er hatte ihn noch nie zuvor am Hof gesehen; es war ein großer und sehr muskulöser Mann.
Die Wachen hatten offensichtlich nicht den Wunsch, sich diesem Riesen und seinen Männern in den Weg zu stellen. Erst recht schenkten sie dem einsamen alten Mann auf dem Weg hinaus keine Aufmerksamkeit.
Doch der Ritter, der den Zug befehligte, tat es und beobachtete Harmodius, während dieser vorüberritt. Sein Blick wurde schärfer – und dann erschien der Leutnant des Tores, der von Kopf bis Fuß gerüstet war und nicht etwa eine Wachstafel und einen Stylus in den Händen hielt, sondern eine Streitaxt. Hinter ihm folgten vier weitere Ritter. Der Fremde versteifte sich, und Harmodius ritt schnell an ihm vorbei, solange er abgelenkt war.
Er passierte das Tor und preschte den Hang an den unbedeutenderen Händlern vorbei, denen es nur erlaubt war, ihre Waren außerhalb der Mauern anzubieten – im Graben, wie sie es nannten. Er ritt an den Quacksalbern vorbei, an den Schauspielern und den Arbeitern, die Bühnen und Absperrungen für das Pfingstsonntagsspiel errichteten.
Er schürzte die Lippen und gab dem Pferd die Sporen. Die Stute schien sich zu freuen, dass sie an diesem Frühlingstag draußen sein durfte. Bei der geringen Geschwindigkeit war ihr wohl langweilig gewesen, denn nun preschte sie freudig los.
Harmodius ritt an dem Markt und dem äußeren Ring der Wohnhäuser vorbei, die den Ärmsten in der Stadt gehörten, und kam zu den ersten Feldern, die von Mauern aus aufgeschichteten Steinen und alten Baumstümpfen begrenzt wurden. Der Boden hier war nicht besonders gut. Harmodius ritt noch eine halbe Meile die Straße entlang. Mit seinem Pferd war er sehr zufrieden, verspürte aber noch immer Angst. Schließlich kam er zur Brücke.
Bisher hatte ihn niemand aufgehalten.
Er überquerte den ersten weiten Brückenbogen, hielt an, spuckte in den Fluss und warf zwei mächtige Zauber aus, während er auf der Brücke im hellen Sonnenlicht in Sicherheit war. Die Hermetik wirkte am besten im Sonnenschein, und die am häufigsten auftretende Magie der Wildnis vermochte fließendes Wasser nicht ohne äußerst große Anstrengungen zu überqueren, es sei denn, sie hatte die hermetische Erlaubnis des Wassers erhalten. Keine Macht der Welt konnte ihm im hellen Sonnenschein mitten auf einer Brücke über fließendem frischem Wasser etwas anhaben.
Und wenn es doch eine solche Macht geben sollte, dann hätte er ihr ohnehin nichts entgegenzusetzen.
Daraufhin überquerte er den Rest der Brücke und nahm die Straße nach Norden.
Die Behnburg-Straße, östlich von Albinkirk · Robert Guissarme
Robert Guissarme war groß und leichenhaft dünn, obwohl er gewaltige Mengen Lamm zu essen und Bier zu trinken pflegte. Es hieß, sein Appetit auf Nahrungsmittel werde nur noch durch seinen Hunger nach Gold übertroffen. Er nannte die Gruppe seiner Männer eine Gesellschaft des Abenteuers, wie es auch die bedeutendsten östlichen Kaufleute taten, und er kleidete sich in Leder und gute Wolle oder in eine strahlende Rüstung, die von den besten Schmieden des Ostens hergestellt worden war.
Niemand wusste viel über seine Herkunft. Er behauptete, der Bastardsohn eines großen Adligen zu sein, dessen Namen er niemals aussprach – doch von Zeit zu Zeit war zu beobachten, wie er einen Finger an die Nase legte, wenn ihm ein großer Mann auf der Straße begegnete.
Seine Sergeanten fürchteten ihn. Er geriet rasch in Wut, bestrafte ebenso rasch, und da er der beste Kämpfer seiner Gesellschaft war, wollte ihn niemand erzürnen – besonders jetzt nicht. Voll bewaffnet saß er in dichtem Nebel auf seinem Schlachtross und beobachtete zwei fliegende Händler, an denen sie am vergangenen Abend vorbeigekommen waren und die nun mitten auf der Straße standen. Sie waren mit aller Sorgfalt abgeschlachtet, abgebalgt und so an Pfähle gebunden worden, die auf der Straße standen, dass ihre Köpfe in endlosen Schreien elendiglichen Schmerzes zu verharren schienen.
Seit gestern hatte er seine Gesellschaft in nordwestlicher Richtung über die schlechte Straße getrieben, die Albinkirk mit dem Osten verband – mit den Bergen und Morea, dem Land des Kaisers. Er war in Theva, der Stadt der Sklavenhändler, aufgebrochen und hatte seine Männer so hart angetrieben, dass die Pferde allmählich versagten. Und was die lange Kette von Sklaven betraf, aus denen ihre hauptsächliche Fracht bestand, so war ihm inzwischen gleichgültig, ob sie lebten oder starben. Sie waren ihm in Theva anvertraut worden – eine endlose Reihe gebrochener Männer und Frauen, einige hässlich, andere hübsch, aber alle mit der stillen Verzweiflung eines geschlagenen menschlichen Wesens. Man hatte ihm gesagt, es handle sich um wertvolle Ware, da es ausgebildete Sklaven seien – Köche, Diener, Mägde und Huren.
Seine Gesellschaft hatte sie auf der langen Reise nach Westen gut behandelt – gut genug jedenfalls, trotz der dunklen Blicke des kaiserlichen Ritters, eines prahlerischen Bastards, der zu stolz war, seine Mahlzeiten zusammen mit einem bloßen Söldner einzunehmen. Hinter Albinkirk würde der Mann keine Schwierigkeit mehr für ihn darstellen.
Doch als sie an Behnburg vorbeikamen, der letzten Stadt vor Albinkirk, und die Soldaten und Einwohner voller Angst vor unnennbaren Schrecken hinter den Mauern verschanzt vorfanden, war er noch schneller nach Westen geeilt und hatte die Springflut der Händler hinter sich zurückgelassen. Ein Dutzend von ihnen – mit Wagen und guten Pferden – hatten ihn in Gold bezahlt, um in seiner Karawane bleiben zu dürfen.
Er hatte den Transport der Sklaven nur übernommen, damit seine Reise bezahlt wurde. Der Festungskonvent von Lissen Carak bot den Gerüchten zufolge pures Gold für die Jagd auf Ungeheuer, und Guissarme brauchte diese Arbeit. Genau wie seine Männer.
Doch vielleicht konnten sie noch ein wenig warten. Er saß auf seinem Kriegspferd auf Augenhöhe mit den Leichen, die, wie er nun erst bemerkte, durch Pfählung getötet worden waren.
Er hatte schon von Pfählungen gehört, aber noch nie eine gesehen. Er konnte den Blick nicht abwenden.
Noch immer starrte er sie verzückt an, als die Pfeile niederregneten.
Der erste traf sein Pferd. Der zweite schlug so heftig gegen seinen Brustpanzer, dass er aus dem Sattel geworfen wurde, und prallte ab, während Guissarme zu Boden fiel. Um ihn herum schrien die Männer, und er hörte, wie seine Korporäle Befehle brüllten. Etwas traf ihn in die Lenden, und er spürte eine heiße Feuchtigkeit, die sich rasch ausbreitete. Er hörte Hufgetrappel – es waren schwere Pferde, die sich schnell und in einem seltsamen Rhythmus bewegten. Er konnte nicht gut sehen.
Er hob den Kopf, und etwas hockte sich über ihn, kam auf sein Gesicht zu …
Die Behnburg-Straße, östlich von Albinkirk · Peter
Peter sah mit hoffnungsloser und hilfloser Wut zu, wie die Pfeile von dem Waldstück, das die Straße säumte, herbeiflogen.
Es war ein so offensichtlicher Hinterhalt. Er wollte einfach nicht glauben, dass dort tatsächlich jemand in ihn hatte hineinlaufen können.
Er konnte nicht weglaufen, denn er war durch eine Halskette mit den Frauen vor und hinter sich verbunden.
Ihm fielen nicht die richtigen Worte ein, dann rief er aber: »Runter! Runter!«
Schon setzte Panik ein. Das Grauen – noch nie hatte er ein solches Grauen verspürt. Es folgte dicht hinter den Pfeilen, überspülte ihn wie Schmutzwasser und ließ Angst zurück. Die beiden Frauen, an die er gekettet war, liefen in unterschiedliche Richtungen, stolperten, stürzten und rissen ihn mit sich zu Boden.
Die Pfeile regneten weiterhin auf die Soldaten nieder; die meisten von ihnen starben. Nur eine kleine Gruppe kämpfte noch.
Etwas – er konnte es in dem spätmorgendlichen Nebel nicht deutlich erkennen – kam aus dem Dunst hervor, bewegte sich so schnell wie ein Ritter auf einem Pferd und fuhr mitten in die Kolonne. Männer kreischten und Pferde wieherten. Das Grauen nahm so sehr zu, dass sich seine beiden Gefährtinnen einfach zu Bällen zusammenrollten.
Peter lag still da und versuchte seinen Verstand in Gang zu bringen. Er beobachtete die Kreaturen, die auf die Kolonne zuströmten. Es waren Dämonen. Er hatte in seiner Heimat von ihnen gehört, und hier waren sie nun und ernährten sich von den Leichen. Und vielleicht auch von den Lebenden.
Ein Lindwurm fiel vom Himmel auf die blonde Frau vor ihm; mit seinem gehörnten Schnabel riss er ihr die Eingeweide heraus. Die Frau hinter ihm kreischte und kämpfte sich auf die Knie, streckte die Arme aus, und ein Schwall aus reinem Grün flog eine Handbreit über Peters Kopf auf die Kreatur zu und traf sie. Ein überwältigender Gestank nach brennender Seife erhob sich.
Das Wesen drehte sich um die Hüfte wie ein Tänzer, wodurch die schreiende Frau unter seinen Krallen vollends entzweigerissen wurde und die Kette zwischen den Sklaven zerbrach. Das eine Ende wickelte sich um das Bein der Kreatur.
Der Lindwurm befreite sich mithilfe seiner Krallen von ihr, und die Frau hinter Peter schleuderte erneut zwei Handvoll grober Magie, wobei sie einen gellenden Schrei ausstieß. Der Lindwurm nahm, als er getroffen wurde, den Schrei auf und warf ihn hundertfach verstärkt zurück, riss die Schwingen auseinander und warf sich auf die Frau.
Peter rollte unter ihm zur Seite. Die Kette, die durch sein Joch lief, riss auch am anderen Ende, weil sie sich in einer Baumwurzel verfangen hatte. Nun war er frei, sprang auf die Beine und rannte in den Nebel hinein.
Ein Blitz – und er lag wieder am Boden. Stille – er sprang auf und rannte weiter, und erst nach hundert Schritten voller Panik bemerkte er, dass er ertaubt war. Am Rücken wies sein Hemd Brandspuren auf.
Er rannte weiter.
Sein Mund war so trocken, dass er nicht mehr schlucken konnte, und Schenkel und Waden brannten, als ob auch sie versengt worden wären. Doch er lief weiter, bis er an einen tiefen Strom kam, diesen durchschwamm, aus ihm trank und keuchend am anderen Ufer liegen blieb. Dann verlor er das Bewusstsein.
Albinkirk · Ser Alcaeus
Ser Alcaeus ritt auf dem Packpferd nach Albinkirk, während sein eigenes Schlachtross hinter ihm her trottete. Zwar hatte er seinen Pagen und seinen Knappen im Kampf verloren, aber sein Diener, der so jung war, dass er noch kein Schwert schwingen konnte, hatte irgendwie zusammen mit dem Packpferd überlebt.
Mit dem Schwertknauf hämmerte Alcaeus gegen das Westtor der Stadt. Zwei verängstigt aussehende Wächter öffneten es gerade so weit, dass er auf seinem Pferd hindurchgelangen konnte.
»Da draußen steht eine Armee der Wildnis«, keuchte Alcaeus. »Bringt mich zu eurem Hauptmann.«
Der Hauptmann der Stadt war ein alter Mann, zumindest für einen Kämpfer war er alt; er hatte einen grauen Bart und neigte zur Fettleibigkeit. Aber er war gestiefelt und gespornt, trug ein Kettenhemd aus guten Stahlringen und einen Gürtel, der seinen Bauch unvorteilhaft hervorhob.
»Ser John Crayford«, stellte er sich vor und streckte die Hand aus.
Ser Alcaeus empfand es als unglaublich, dass dieser Mann je zum Ritter geschlagen worden war. Und er fragte sich, wie ein solch hässlicher Rüpel in eine so wichtige Stellung gelangt sein konnte.
»Ich bin in einer Karawane von fünfzig Wagen auf der Behnburg-Straße gewesen«, erklärte Alcaeus. Plötzlich musste er sich setzen. Er hatte es nicht vorgehabt, doch seine Beine gaben nach.
»Die Wildnis«, sagte er und versuchte dabei so klar und verständig zu klingen wie ein Mann, auf dessen Wort man etwas geben konnte. »Dämonen haben uns angegriffen. Zusammen mit Irks. Es waren mindestens hundert.« Er stellte fest, dass ihm das Atmen Schwierigkeiten bereitete.
Sogar das Reden fiel ihm schwer.
»O mein Gott«, sagte er.
Ser John legte ihm die Hand auf die Schulter. Irgendwie schien der Mann jetzt größer zu sein als vorhin. »Wie weit entfernt, Messire?«, wollte er wissen.
»Fünf Meilen.« Alcaeus holte tief Luft. »Vielleicht auch weniger. Östlich von hier.«
»Bei der Jungfrau!«, fluchte der Hauptmann von Albinkirk. »Östlich, sagt Ihr?«
»Glaubt Ihr mir etwa nicht?«, fragte Alcaeus.
»O doch«, beschwichtigte ihn der Hauptmann. »Aber war es wirklich im Osten? Sie haben einen Bogen um die Stadt geschlagen?« Er schüttelte den Kopf.
Alcaeus hörte schwere Stiefelschritte auf der Treppe draußen. Er hob den Kopf und erkannte denselben Mann, der ihn in die Stadt eingelassen hatte, zusammen mit zwei Männern aus den unteren Schichten.
»Es heißt, auf den Feldern seien Kobolde, Ser John.« Der Sergeant hob die Schultern. »Das sagt man jedenfalls.«
»Meine Tochter!«, rief der Jüngere der beiden anderen. Aber es war eher ein Schrei. »Ihr müsst sie retten.«
Ser John schüttelte den Kopf. »Ich schicke in dieser Lage keinen Mann vor das Tor. Beruhige dich, Kerl.« Er schenkte dem Mann einen Becher Wein ein.
»Meine Tochter!«, rief er noch einmal voller Qualen.
»Es tut mir leid um deinen Verlust«, sagte Ser John nicht unhöflich und wandte sich dann an den Sergeanten. »Schlagt Alarm. Verriegelt die Tore. Und holt mir den Bürgermeister. Sagt ihm, ich verhänge das Kriegsrecht. Niemand darf die Stadt mehr verlassen.«
Östlich von Albinkirk · Peter
Peter erwachte, als etwas an seinem schweren Joch zerrte. Es handelte sich um einen hölzernen Kragen mit zwei Ketten daran, die zu seinen Händen liefen und ihm nur geringe Bewegungsfreiheit ließen. Weiterhin befand sich eine schwere Klammer daran, durch die er an andere Sklaven gekettet werden konnte.
Zwei Moreaner aus dem Osten, die mit Taschen und schweren Rucksäcken bepackt waren, standen über ihm. Sie trugen Kapuzen und zeigten die Haltung von Männern, die erst vor Kurzem aus großer Angst entlassen worden waren.
»Also hat einer überlebt«, sagte der Größere und spuckte aus.
Der Kleinere schüttelte den Kopf. »Kaum eine gerechte Entschädigung für den Verlust unseres Karrens«, meinte er. »Aber ein Sklave ist ein Sklave. Steh auf, Junge.«
Peter blieb noch einen Augenblick lang in kläglichem Elend liegen. Also war es unausweichlich, dass sie ihn durch Tritte zum Aufstehen zwangen.
Dann musste er ihr Gepäck tragen, und die drei machten sich auf den Weg nach Westen und benutzten dabei einen Pfad, der geradewegs durch den Wald führte.
Seine Verzweiflung hielt nicht lange an. Vielleicht hatte er Pech gehabt, vielleicht aber auch nicht. Sie gaben ihm zu essen; er bereitete die mageren Mahlzeiten zu und erhielt dafür etwas Brot und ein wenig von der Erbsensuppe, die er für sie gekocht hatte. Die Männer waren weder groß noch stark, weshalb er vermutete, dass er sie beide töten könnte, wenn er nur endlich von dem Joch auf seinen Schultern befreit wäre.
Aber er konnte es nicht abnehmen. Es war sein ständiger Begleiter seit einem Monat, in dem er über Eis und Schnee marschiert war. Er hatte mit diesem kalten und höllischen Ding schlafen müssen, während die Soldaten die Frauen vor und hinter ihm vergewaltigten und er sich fragte, ob sie ihn wohl ebenfalls missbrauchen würden.
Immer wieder hatte er sich die Handgelenke bei dem Versuch blutig gescheuert, dieses Ding loszuwerden. In seinen Tagträumen benutzte er es, um diese beiden mickrigen Männer zu zerschmettern.
»Du bist ein guter Koch, Junge«, sagte der Größere und wischte sich über den Mund.
Der Dünne runzelte die Stirn. »Ich will wissen, was da passiert ist«, sagte er, nachdem er ein wenig gewässerten Wein aus seiner Feldflasche getrunken hatte.
Der Dickere zuckte die Achseln. »Banditen? Zweifellos grausame Bastarde. Ich hab nichts gesehen. Hab nur das Kämpfen gehört und … na ja, dann bist du weggelaufen.«
Der Dünnere schüttelte den Kopf. »Die Schreie«, sagte er mit bebender Stimme.
Sie saßen da und sahen einander finster an. Peter beobachtete sie und fragte sich, wie es ihnen überhaupt gelungen war zu überleben.
»Wir sollten zu unserem Karren zurückgehen«, sagte der Dünnere.
»Offenbar hast du einen Schlag auf den Kopf bekommen«, meinte der Fettere. »Willst du etwa zum Sklaven werden? Wie er?« Damit deutete er auf Peter.
Peter hockte vor dem Feuer und fragte sich, ob es eine gute Idee gewesen war, es zu entzünden, und warum diese beiden Kerle wohl so dumm waren. Die Dämonen waren ihm aus seiner Heimat bekannt. Diese zwei Idioten mussten doch ebenfalls etwas über sie wissen.
Aber die Nacht verging ruhig. Die beiden Narren schliefen, nachdem sie sein Joch an einem Baum festgebunden hatten, während er wach blieb. Sie schnarchten, während Peter auf einen scheußlichen Tod wartete, der jedoch nicht kam.
Am Morgen erhoben sich die Ostmänner, schlugen ihr Wasser ab, tranken den Tee, den er ihnen gekocht hatte, aßen sein Fladenbrot und machten sich wieder auf den Weg nach Westen.
»Wo hast du kochen gelernt, Junge?«, fragte der Dickere.
Er zuckte nur mit den Achseln.
»Das ist zumindest eine Fähigkeit, für die man gutes Geld bekommen kann«, meinte der Mann.
Beim Zolltor · Hector Lachlan
Viehtreiber hassten den Zoll. Es war einfach unmöglich, ihn zu mögen. Wenn man eine große Tierherde – hauptsächlich Kühe, aber ärmere Bauern gaben auch Schafe und manchmal sogar Ziegen mit –, die das gesamte Vermögen anderer Menschen darstellte, durch Moore und Gebirge und über Ebenen sowie durch Krieg und Pest treiben musste, stellte der Zoll stets die wahre Verkörperung des Bösen dar.
Hector Lachlan hatte eine einfache Regel.
Er bezahlte niemals Zoll.
Seine Herde bestand aus Hunderten von Tieren, und er hatte so viele Männer dabei wie ein südländischer Lord in seiner Armee – Männer, die Kettenhemden aus leuchtenden Ringen und schwere Schwerter trugen. Dabei hatten sie große Äxte über ihre Schultern gelegt. Sie sahen eher wie die besten Kämpfer eines Söldnertrupps aus, und weniger wie das, was sie eigentlich waren: Viehtreiber.
»Ich wollte Euch nicht verärgern, Lachlan!«, jammerte der örtliche kleine Lord. Er hatte diesen Ton am Leib, den Hector am meisten hasste – er nannte es Bettelprahlen, wenn ein Mann, der eben noch so getan hatte, als wäre er der Leitwolf des Nordens, plötzlich um sein Leben winselte.
Hector hatte noch nicht einmal das große Schwert gezogen, das an seiner Hüfte hing. Er stützte lediglich den Unterarm auf dem Griff ab. Mit der anderen Hand strich er sich nachlässig über den Bart und fuhr sich dann durch die Haare, während er einen Blick zurück auf den langen, dreckigen Zug aus Rindern und Schafen warf, der sich hinter ihm auf dem Bergpfad erstreckte, so weit das Auge blicken konnte.
»Zahlt mir nur den Zoll. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr die Münzen so schnell wie möglich zurückbekommt.« Der Mann war groß, kräftig und trug ein Kettenhemd, das ein Vermögen wert sein mochte. Jedes einzelne Glied war fest vernietet und so stark wie Stein.
Er hatte Angst vor Hector Lachlan.
Aber er hatte keine so große Angst, dass er die Viehkarawane einfach hätte weiterziehen lassen. Es war wichtig, dass er dabei beobachtet wurde, wie er den Zoll kassierte. So war es nun einmal in den Bergen, und offenbar ließ ihn seine eigene Angst allmählich wütend werden.
Hector sah, wie sich die Miene des Mannes veränderte.
»Verdammt seid Ihr! Zahlt den verdammten Zoll, oder …«
Hector zog sein Schwert. Er ließ sich nicht von der Wut oder Angst eines Gegners und auch nicht von den fünfzig bewaffneten Männern hinter ihm aus der Ruhe bringen. Ganz gemächlich holte er das Schwert hervor und drehte es so lange, bis die Spitze reglos auf das Gesicht des anderen Mannes zeigte.
Dann trieb er die nadelspitze Klinge mit aller Kraft durch dessen Stirn, so wie ein Schuhmacher ein Loch ins Leder stanzt. Der Mann in der Rüstung sackte zusammen, seine Augen rollten nach oben. Er war längst tot.
Hector seufzte.
Das Gefolge des Toten stand stocksteif hinter ihm. Ihr Schock würde noch einige Herzschläge lang anhalten.
»Halt!«, rief Hector. Es war eine feine Kunst, die anderen zu kommandieren, ohne sie zu bedrohen und dadurch möglicherweise genau die Reaktion hervorzurufen, die er verhindern wollte.
Der Leichnam fiel zu Boden; die Beine des Toten zuckten noch einmal kurz.
»Keiner von euch muss sterben«, sagte er. Auf der Spitze seines Schwertes klebte ein Faden, der von dem Blut des Toten herrührte. »Er war ein Narr, weil er von mir Zoll gefordert hat, und jedermann hier weiß das. Sein Stellvertreter soll das Kommando übernehmen, und dann wollen wir die ganze Sache vergessen.« Nachdem Lachlan gesprochen hatte, befanden sich die Männer ihm gegenüber eine Weile im Schwebezustand des Zweifels, der Angst, Gier und Loyalität – nicht dem Toten gegenüber, sondern dem Gesetz, das von ihnen verlangte, ihn zu rächen.
Das Gesetz war stärker.
Lachlan hörte das Grunzen, das ihren Widerstand anzeigte. Er legte beide Hände an sein Schwert, hob es hoch über seinen Kopf und hieb auf den Mann ein, der ihm am nächsten stand. Jener hatte sein Schwert zwar ebenfalls schon in der Hand, war aber zu langsam, um sein Leben noch retten zu können. Der heftige Schlag hieb ihm die Waffe aus der Hand und spaltete ihm den Schädel von der linken Braue bis zum rechten Kiefer, sodass der obere Teil des Kopfes sauber abgetrennt wurde und zur Seite flog.
Nun verließen Hectors Männer ihren Platz bei den Tieren und drangen vor. Wenn all dies einmal vorüber sein würde – all der Lärm, die Gewalt, das Blut, die Körperausscheidungen –, wäre ein ganzer Tag verloren, und überdies würden sie noch alle Tiere einsammeln müssen, die in der Zwischenzeit in die Täler und Schluchten entwischt waren.
Jemand – irgendein alter Philosoph, an dessen Namen sich Lachlan nicht erinnern konnte, von dem er aber gehört hatte, als ein Priester ihm das Lesen und Schreiben beigebracht hatte –, dieser Jemand hatte einmal gesagt, dass die Hochländer die ganze Welt erobern könnten, wenn sie damit aufhören würden, gegen sich selbst zu kämpfen.
Darüber dachte er nach, als er seinen dritten Mann an diesem Tag tötete, sein Gefolge ohne das geringste Gebrüll angriff und die dem Untergang geweihten Männer vom Zolltor niedergemetzelt wurden.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Das Lager unter der Abtei verschwand so schnell, wie es entstanden war. Die Zelte wurden abgeschlagen und in den Wagen verstaut, und diese wurden den steilen Hang hinauf und in die Festung gezogen.
Die erste Arbeit bestand darin, die ganze Truppe einzuquartieren. Der Hauptmann und die Äbtissin schritten rasch durch das Dormitorium, die große Halle, die Kapelle, die Stallungen und die Lagerhäuser; sie stellten Berechnungen an und teilten Plätze zu.
»Ich werde natürlich auch mein ganzes Volk in den Schutz der Mauern holen müssen«, sagte die Äbtissin.
Der Hauptmann biss sich auf die Lippe und sah auf den Innenhof hinaus. »Vielleicht sollten wir unsere Zelte hier wieder aufstellen«, sagte er. »Wollt Ihr die Große Halle belegen?«
»Natürlich. Sie wird gerade ausgeräumt«, sagte sie. »Es ist Fastenzeit; alle Wertgegenstände sind ohnehin bereits weggeschafft.«
Einer der großen Wagen überfuhr gerade die Schwelle des Haupttores. Er passte nur knapp unter den Torsturz hindurch.
»Zeigt mir Eure Lagerräume«, bat er.
Sie führte ihn von einem Keller in den nächsten und schließlich zu einer langen, gewundenen Treppe, die bis tief hinein in das Herz des lebendigen Felsens unter ihren Füßen führte, wo eine Quelle sprudelte und sich in einen Teich von der Ausdehnung eines kleinen Sees ergoss. Als sie von dort wieder heraufkletterten, war die Äbtissin langsamer als beim Abstieg.
Der Hauptmann wartete, während sie sich ausruhen musste.
»Gibt es dort unten einen weiteren Zugang?«, wollte er wissen.
Sie nickte. »Natürlich. Wer würde einen solchen Berg aushöhlen und keinen weiteren Eingang anlegen? Aber ich habe nicht mehr die Kraft, ihn Euch zu zeigen.« Sie traten wieder durch die Geheimtür hinter dem Altar der Kapelle, und sofort war die Äbtissin von grau gekleideten Mitschwestern umringt, die allesamt ihre Aufmerksamkeit beanspruchten. Es ging um den Altar, um die Blumen für den nächsten Gottesdienst, um Beschwerden über den Regen blasphemischer Flüche, die von den Wänden widerhallten, da nun die Söldner Einzug gehalten hatten.
»Ihr verdammten Schwanzlutscher schiebt eure Ärsche sofort in die Rüstungen, oder ich beiße euch die verlausten Schädeldecken ab und rammle euch ins Hirn«, stutzte Tom Schlimm gerade ein ganzes Dutzend Kämpfer zusammen. Der Tonfall erinnerte an harmloses Geplauder, das jedoch in einen Augenblick der Stille fiel und durch den Widerhall in alle Winkel der Abtei getragen wurde.
Eine ältere Nonne starrte ihre Äbtissin in stummer Bitte an.
»Eure Schwestern schweigen«, sagte der Hauptmann.
Die Äbtissin nickte. »Sie dürfen nur sonntags sprechen. Den Novizinnen und Älteren ist es zwar erlaubt zu reden, wenn es unbedingt nötig sein sollte – was bei den Älteren sehr selten und bei den Novizinnen recht oft der Fall ist.« Sie hob die Hände. »Ich bin ihre Botschafterin in der Welt.« Sie deutete auf die Gestalt, die ihr folgte; ihr Kopf war durch die Kapuze verhüllt. »Das ist Schwester Miram, meine Vikarin und Cellerarin. Sie darf ebenfalls sprechen.«
Der Hauptmann verneigte sich vor Schwester Miram, die den Kopf leicht schräg hielt.
»Aber sie zieht es vor zu schweigen«, erklärte die Äbtissin.
Wohingegen du … Der Hauptmann vermutete, dass ihr das Sprechen mehr Spaß machte, als sie zugab, und dass sie sich gern mit ihm unterhielt, da sie in ihm einen Erwachsenen vor sich hatte, mit dem sie sich messen konnte. Doch er bezweifelte keineswegs ihre Frömmigkeit. Nach Ansicht des Hauptmanns gab es drei Arten von Frömmigkeit – falsche, heuchlerische und hart erarbeitete, tiefe und echte. Er war der Meinung, dass er diese Arten gut auseinanderhalten konnte.
Am anderen Ende der Kapelle stand Pater Henry. Er wirkte gehetzt und schien sich weder gebadet noch rasiert zu haben. Der Hauptmann sah die Äbtissin an. »Euer Priester befindet sich nicht gerade in einem guten Zustand«, sagte er.
Er wusste, dass sie in der letzten Nacht ein Phantasma über ihn gelegt hatte. Sie hatte es mit großem Geschick gewirkt und dadurch enthüllt, dass sie mehr als eine rein mathematische Astrologin war. Sie war eine Zauberin. Vermutlich hatte sie genau bemerkt, wie er seinen Zauber über ihren Hof und ihre Schwestern gelegt hatte.
Und sie war nicht die einzige Zauberin hier. Es gab viele ineinandergreifende Räder, die zur Macht dieses Ortes beitrugen. Er sah Schwester Miram an und tastete vorsichtig mit seiner Macht nach ihr – wie mit einer dritten Hand.
Aha. Es war, als hätte Schwester Miram dieser dritten Hand gerade einen Klaps versetzt.
Die Äbtissin betrachtete den Priester eingehend. »Er ist verliebt in mich«, sagte sie herablassend. »Mein letzter Liebhaber. Heiliger Jesus, hätte man mir nicht einen schönen und sanften Mann schicken können?« Sie schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Ich vermute, er wurde mir zur Buße gesandt … zur Erinnerung an das, was ich einmal gewesen bin.« Sie zuckte mit den Achseln. »Die Ritter unseres Ordens haben uns im letzten Winter keinen Priester geschickt, also habe ich diesen hier aus der örtlichen Gemeinde geholt. Er schien mir interessant zu sein. Doch stattdessen ist er …« Sie hielt inne. »Warum erzähle ich Euch das eigentlich, Messire?«
»Als Euer Hauptmann ist es meine Pflicht, alles zu wissen«, sagte er.
Sie sah ihn nachdenklich an. »Er ist ein typischer unwissender kleiner Ortsgeistlicher. Er kann kaum Archaisch lesen, kennt die Bibel nur aus der Erinnerung und glaubt, dass Frauen weniger wert sind als der Dreck an seinen nackten Füßen.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber er ist hierhergekommen und fühlt sich von mir angezogen.«
»Vielleicht bin ich Euer letzter Liebhaber«, sagte der Hauptmann. Dabei lächelte er sie an, ergriff ihre rechte Hand und küsste sie.
Als er dies tat, sah er, wie der Priester zusammenzuckte. Was für ein Spaß. Dieser Mann war zwar abscheulich, aber seine Frömmigkeit war vermutlich echt.
»Sollte ich Euch dafür nicht eine Ohrfeige geben? Wie ich hörte, ist das heutzutage die richtige Erwiderung«, meinte die Äbtissin. »Bitte tut so etwas niemals wieder, Hauptmann.«
Er wich von ihr zurück, als hätte sie ihn geschlagen. Schwester Miram runzelte die Stirn.
Er erlangte die Fassung wieder, indem er Jehannes und Milus zu sich rief. »Die Kutscher sollen die Wagen abspannen. Bringt die Ausrüstung in die Keller. Äbtissin, wir brauchen einige Führer.«
Die Äbtissin ließ ihre Garnison antreten – acht alte, nichtadlige Männer, die sie vor einem Dutzend Jahren auf dem Großen Jahrmarkt angeworben hatte. Sie wurden von Michael Ranulfson angeführt, einem grauhaarigen Riesen mit sanftem Benehmen. Er war der Sergeant, dem der Hauptmann am vergangenen Abend kurz begegnet war.
»Ihr wisst, dass ich dem Hauptmann unsere Verteidigung übertragen habe«, sagte sie. »Seine Männer brauchen beim Einzug etwas Hilfe und Führer durch die Lagerräume. Michael, ich vertraue ihnen.«
Michael neigte respektvoll den Kopf, aber seine Augen sagten: auf Eure eigene Verantwortung.
»Wie sieht es mit Schutzwänden aus?«, fragte der Hauptmann. »Habt ihr vorgefertigtes Holz dafür?«
Der alte Sergeant nickte. »Ja. Wir haben inzwischen Schutzwände, bewegliche Türme, zwei Schleudern und ein paar kleinere Maschinen.« Er rollte den Kopf, wie um sich von einer Steifheit zu befreien. »Wir hatten genug Zeit, um all das herzustellen.«
Der Hauptmann nickte anerkennend. »Danke, Ser Michael.«
»Ich bin kein Ritter«, erwiderte Michael. »Mein Vater war Gerber.«
Der Hauptmann schenkte dieser Bemerkung keine weitere Beachtung und sah stattdessen Jehannes an. »Sobald die Jungs ausgepackt haben, gibst du diesem Mann fünfzig Bogenschützen und unseren ganzen Pöbel, damit sie ihm beim Aufstellen der Schutzwände helfen, während sich die Schwertkämpfer in Stellung bringen.«
Jehannes nickte. Offensichtlich stimmte er mit seinem Hauptmann ganz und gar überein.
»Bringt die Wagen dorthin, wo sich jetzt die Schutzwände befinden«, befahl der Hauptmann. »Dann werden wir Patrouillen losschicken, die die Bauern herbeiholen. Meine Herren, an diesem Ort wird es so eng werden wie in einem Fass mit frisch eingelegten Makrelen. Ich sage dies absichtlich in Anwesenheit der Äbtissin. Unsere Männer werden weder vergewaltigen noch stehlen. Auf beides steht von jetzt an die Todesstrafe. Mylady, gegen gelegentliche Blasphemien kann ich zwar nichts tun, aber wir werden uns zusammenreißen. Habt ihr mich verstanden, meine Herren? Wir werden uns bemühen.«
Sie nickte. »Es herrscht Fastenzeit«, gab sie zu bedenken.
Jehannes nickte. »Ich habe den Wein bereits aufgegeben«, sagte er und senkte den Blick.
»Jesus kümmert sich nicht um das, was Ihr aufgebt, sondern um das, was Ihr ihm gebt«, entgegnete Schwester Miram, und Jehannes lächelte ihr scheu zu.
Sie erwiderte sein Lächeln.
Der Hauptmann stieß einen schweren Seufzer aus. »Meine Damen, Ihr werdet vielleicht noch die Gelegenheit erhalten, unser aller Seelen zu retten, aber das muss warten, bis wir unsere Verteidigungsanlagen errichtet haben und unsere Leute in Sicherheit sind. Michael, du sorgst dafür. Ich schlage vor, dass meine Männer in den Türmen und auf den Galerien wohnen. Falls uns die Zeit bleibt, werden wir Betten für sie bauen.«
»Meine Untertanen werden zu viert in einem Zimmer schlafen«, sagte die Äbtissin. »Ich kann die älteren Mädchen und die einzelnen Frauen aus den Gehöften im Dormitorium unterbringen. Die Männer sowie ihre Familien werden in der Halle übernachten. Der Rest kommt in die Ställe.«
Michael nickte. »Ja, Mylady«, sagte er und wandte sich an den Hauptmann. »Ich stehe Euch zu Diensten.« Er sah sich um. »Werden wir die Unterstadt verteidigen?«
Der Hauptmann stieg auf die Tormauer und betrachtete die vier Straßen des Ortes, der hundert Fuß unter ihm lag.
»Für eine Weile«, sagte er schließlich.
Albinkirk · Ser Alcaeus
Ser Alcaeus verbrachte eine schlechte Nacht und trank am Morgen zu viel Wein. Der Mann, dessen Tochter entführt worden war, saß in der Garnisonsbaracke und weinte und verlangte, die ganze Garnison solle zu ihrer Rettung ausschwärmen.
Der Bürgermeister stimmte ihm zu, und hitzige Worte wurden gewechselt.
An einem solchen Streit wollte Alcaeus nicht teilnehmen. Diese Menschen waren ihm allzu fremd. Die einfachen Leute waren zu unterwürfig und zu frei, und Ser John war kein Ritter. Sogar die Kirche war hier falsch. Die Messe wurde auf Niederarchaisch gefeiert.
Es war verwirrend. Schlimmer noch als die Karawane aus Sklaven, denn diese hatte er wenigstens ignorieren können.
Als er mitten am Morgen seine Waschungen beendet hatte – er, der Vetter des Kaisers, hatte sich ohne die Hilfe eines Dieners oder wenigstens eines Sklaven säubern müssen –, hörte er die schrille Stimme des Bürgermeisters im Wächterraum, der verlangte, dass Ser John herauskam.
Alcaeus kleidete sich an. Ihm standen genügend saubere Hemden zur Verfügung, weil der Junge sein Packpferd gerettet hatte. Und er hatte dafür gesorgt, dass der Page dafür reichlich entlohnt wurde.
»Kommt aus Eurem Loch heraus, Ihr tatteriger alter Feigling!«, kreischte der Bürgermeister.
Alcaeus versuchte, sich die Manschetten anzulegen. So etwas hatte er in der Vergangenheit durchaus schon getan, allerdings nicht mehr, seit er zum Mann geworden war. Er drückte die rechte Hand gegen den Stein der Burgmauer und hielt dadurch den Knoten fest.
»Bürgermeister?«, hörte er Ser Johns Stimme, die recht ruhig klang.
»Ich verlange, dass Ihr all die nutzlosen Mäuler sammelt, die Ihr als Eure Garnison bezeichnet, und die Tochter dieses Mannes sucht. Und öffnet das Tor! Die Getreidewagen sind auf dem Weg hierher. Dieser Ort braucht Geld, aber ich bin sicher, dass Ihr zu betrunken seid, um dies zu begreifen.« Er klang wie ein Fischweib – wie ein besonders unangenehmes.
»Nein«, entgegnete der Hauptmann. »War das alles?«
In diesem Augenblick wusste Alcaeus nicht recht, was er von dem Ritter halten sollte. War er übervorsichtig? Doch die Erinnerung an den Hinterhalt des gestrigen Tages brannte noch immer in ihm.
Er griff nach seinen Stiefeln, die natürlich nicht gesäubert worden waren. Er zog sie an, kämpfte mit all den Schnallen, und sein Kopf war plötzlich voller Irks, Kobolde und noch schlimmerer Dinge. Die Straße. Die Verwirrung.
Er war für den Kampf gegen die Wildnis ausgebildet worden. Doch bis gestern hatte er bloß gegen andere Menschen gekämpft – üblicherweise immer nur gegen einen Einzelnen, mit dem Messer, bei Hofe.
Die Bilder in seinem Kopf brachten ihn zum Erbeben.
»Ich befehle es Euch!«, brüllte der Bürgermeister.
»Ihr könnt mir gar nichts befehlen, Bürgermeister. Ich habe das Kriegsrecht verhängt, und nicht Ihr, sondern ich bin hier die herrschende Macht.« Ser John klang nicht herablassend, sondern eher entschuldigend.
»Ich repräsentiere die Einwohner dieser Stadt – die Bürger, die Kaufleute und die Handwerker!« Die Stimme des Bürgermeisters wurde zu einem Zischen. »Ihr scheint nicht zu wissen …«
»Ich weiß, dass ich den König repräsentiere – im Gegensatz zu Euch.« Ser Johns Stimme blieb gelassen.
Alcaeus traf eine Entscheidung. Er würde diesen Ritter von niederer Herkunft unterstützen. Es war gleichgültig, worüber die beiden Männer stritten – es ging um ihre Haltung. Die von Ser John war ritterlich. Vielleicht könnte er sogar am Hof überleben.
Vorsichtig bewegte Alcaeus seine Füße in den Stiefeln. Dann nahm er seinen schweren Dolch und steckte ihn in den Gürtel. Er verließ seine Gemächer niemals ohne Dolch. Nun ging er hinaus in die Halle. Sie war voller Soldaten, die dem Streit lauschten, der in dem Raum dahinter entstanden war. Leichtfüßig lief er die Stufen hinunter.
Er hatte den Rest des Wortwechsels nicht mitbekommen. Als er eintrat, schwieg der Bürgermeister gerade. Er war ganz rot im Gesicht – dünn und groß, so blond wie ein Engel – und bewegte stumm den Mund.
Ser Alcaeus stellte sich hinter den alten Ritter. Er bemerkte, dass der Bürgermeister ein kostbares Wams aus dunkelblauem Samt mit Zobelbesatz trug und dazu eine passende Kappe, die mit Irks und Hasen bestickt war. Er lächelte. Sein eigenes Seidenwams war etwa fünfzigmal so viel wert.
Die Irks auf der Kappe des Bürgermeisters entbehrten nicht einer gewissen Ironie.
»Das ist Ser Alcaeus«, sagte Ser John, »der Botschafter des Kaisers bei unserem König. Gestern wurde sein Zug von Hunderten Kreaturen der Wildnis angegriffen.«
Der Bürgermeister warf ihm einen giftigen Blick zu. »Wie schön. Macht endlich Eure Arbeit, verfluchter Söldner! Stört es Euch denn gar nicht, dass sich die Tochter dieses Mannes in der Gewalt von Ungeheuern befindet, während Ihr hier sitzt und Wein sauft?«
Der Mann, der zusammen mit einem Dutzend anderer Männer hinter dem Bürgermeister stand, schluchzte, sank auf eine Holzbank und steckte sich vor Verzweiflung die Faust in den Mund.
»Seine Tochter ist schon seit gestern tot, und ich will das Leben meiner Männer nicht für die Bergung ihres Leichnams riskieren«, gab Ser John mit nachlässiger Brutalität zurück. »Ich will, dass alle Frauen und Kinder sofort in die Burg verbracht und mit genügend Nahrungsmitteln ausgestattet werden.«
»Das verbiete ich«, spuckte der Bürgermeister aus. »Wollt Ihr in der Stadt eine Panik auslösen?«
Ser John zuckte mit den Achseln. »Ja«, sagte er dann. »Meiner maßgeblichen Meinung nach …«
»Ihr habt keine maßgebliche Meinung! Vor vierzig Jahren seid Ihr nichts anderes als ein billiger Söldner gewesen. Und dann wurdet Ihr zum Saufkumpan des Königs. Da steht Euch eine Meinung überhaupt nicht zu!« Der Bürgermeister war außer sich vor Wut.
Alcaeus begriff, dass der Mann Angst hatte. Er war entsetzt. Und dieses Entsetzen machte ihn streitlustig. Für Alcaeus war das eine Offenbarung. Mit seinen neunundzwanzig Jahren war er eigentlich kein junger Mann mehr, und er hatte geglaubt, er wisse, wie die Welt funktioniere.
Der gestrige Tag war ein Schock für ihn gewesen. Und der heutige war es ebenfalls. Er betrachtete den närrischen Bürgermeister und beobachtete Ser John, und plötzlich begriff er sie beide.
»Messire Bürgermeister?«, fragte er in seinem gestelzten Gotisch. »Bitte. Ich bin hier ein Fremder. Aber die Wildnis ist wirklich. Was ich gesehen habe, ist wirklich.«
Der Bürgermeister drehte sich um und sah ihn an. »Wer in Gottes Namen seid Ihr?«, fragte er.
»Alcaeus Comnena, Vetter des Kaisers Manual, möge sein Name gepriesen sein, des gezogenen Schwertes Christi, des Kriegers der Morgendämmerung.« Alcaeus verbeugte sich. Sein Vetter war schon zu alt, um noch ein Schwert ziehen zu können, doch seine Titel kamen Alcaeus mit großer Leichtigkeit über die Lippen, und er ärgerte sich sehr über den Bürgermeister.
Trotz seiner Streitlust und seines Entsetzens war der Bürgermeister ein gebildeter Kaufmann. »Aus Morea?«, fragte er.
Alcaeus überlegte, ob er diesem Barbaren sagen sollte, was er von dem nachlässigen Gebrauch des Namens Morea für das Kaiserreich hielt. Aber er machte sich nicht die Mühe. »Ja«, antwortete er nur knapp.
Der Bürgermeister holte tief Luft. »Wenn Ihr ein wahrer Ritter seid, werdet Ihr ausziehen und die Tochter dieses Mannes retten.«
Alcaeus schüttelte den Kopf. »Nein. Ser John hat recht. Ihr müsst die Bauern von den weiter entfernten Gehöften herbeirufen und die Leute auf die Burg bringen.«
Der Bürgermeister schüttelte die Faust. »Die Karawanen kommen! Wenn wir jetzt die Tore schließen, wird diese Stadt sterben!« Er hielt kurz inne. »Bei der Liebe Gottes, hier geht es um sehr viel Geld!«
Ser John zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe, das Geld wird Euch helfen, wenn die Kobolde kommen.«
Wie auf ein Stichwort hin ertönte plötzlich die Alarmglocke.
Nachdem der Bürgermeister ins Freie gestürmt war, stieg Alcaeus auf die Mauer und sah, dass bereits zwei weiter entfernt liegende Gehöfte brannten. Ser John gesellte sich zu ihm. »Ich habe ihm schon gestern Abend gesagt, er soll die Leute von dort draußen herbringen«, murmelte er. »Verdammter Idiot. Aber vielen Dank für den Versuch.«
Alcaeus sah zu, wie die Rauchwolken aufstiegen, während es in seinem Magen flatterte. Plötzlich sah er wieder diese Irks unter seinem Pferd. Er hatte einmal ganz allein vier Attentäter besiegt, die es auf seine Mutter abgesehen hatten. Doch Irks waren viel, viel schlimmer. Er schmeckte Galle.
Und dachte daran, sich einfach zu Bett zu legen.
Doch stattdessen trank er Wein. Nach einem Becher fühlte er sich stark genug, seinen Pagen zu besuchen, der sich von den vergangenen Schrecken auf die Art erholte, wie sie für widerstandsfähige junge Menschen üblich war. Also ließ er den Pagen in der Umarmung eines Dienstmädchens zurück und ging müde zum Wächterraum weiter, wo ein angestochenes Weinfass stand.
Er war gerade beim vierten Becher angekommen, als sich Ser Johns Faust um sein Handgelenk schloss. »Ich nehme an, Ihr seid ein ausgewiesener Ritter«, sagte er. »Ich habe Euer Schwert gesehen und nehme an, Ihr wisst es zu gebrauchen, nicht wahr?«
Ser Alcaeus erhob sich von seinem Stuhl. »Ihr habt es gewagt, mein Schwert zu ziehen?«, fragte er. Am Hof des Kaisers war es eine grobe Beleidigung, das Schwert eines anderen Mannes zu berühren.
Der alte Mann grinste freudlos. »Hört mir zu, Messire. Diese Stadt wird bald angegriffen. Ich hatte nie geglaubt, so etwas noch zu meinen Lebzeiten zu erleben. Ich verstehe ja, dass Ihr gestern einen sehr schlechten Tag hattet. Gut. Aber jetzt müsst Ihr aufhören, meinen Weinvorrat leerzutrinken. Legt Eure Rüstung an. Wenn ich mich nicht sehr irre, werden sie in etwa einer Stunde die Stadtmauern angreifen.« Er sah sich in dem leeren Wächterraum um. »Wenn wir wie verdammte Helden kämpfen und jeder Mann sein Bestes gibt, könnten wir es schaffen. Ich werde versuchen, diesen Narren doch noch dazu zu bringen, alle Frauen in die Burg zu schaffen. Das da draußen ist die Wildnis, Ser Ritter. Ich nehme an, Ihr habt gestern einen Vorgeschmack von ihr bekommen. Nun – hier ist sie wieder.«
Dabei wollte Ser Alcaeus doch bloß ein nützlicher Würdenträger am Hofe seines Onkels sein. Er fragte sich, ob er angesichts der Botschaft in seiner Tasche nicht die Pflicht hatte, seinen Pagen zu nehmen und nach Süden zu reiten, bevor die Straßen geschlossen wurden.
Aber an diesem alten Mann war etwas Besonderes. Außerdem war Alcaeus schon am Tag zuvor wie ein Feigling weggelaufen, auch wenn das Blut von dreien dieser Wesen an seinem Schwert klebte.
»Ich werde mich bewaffnen«, sagte er.
»Gut«, freute sich Ser John. »Ich werde Euch dabei helfen, und dann gebe ich Euch das Kommando über einen Abschnitt der Mauer.«
Abbington am Carak · Die Näherin Meg
Die alte Näherin Meg saß im guten, warmen Sonnenschein auf ihrer Türschwelle und hatte den Rücken gegen das Eichenholz des Rahmens gelehnt, wie sie es schon seit fast vierzig Jahren an solchen Morgen tat. Sie saß bloß da und nähte.
Meg war keine stolze Frau, aber sie hatte eine gewisse Stellung inne, und dies wusste sie auch. Frauen kamen zu ihr und fragten sie wegen Geburten und Geldangelegenheiten um Rat, beklagten sich bei ihr über ihre trinkenden Ehemänner und wollten manchmal wissen, ob sie in gewissen Nächten einen bestimmten Mann hereinlassen sollten – oder lieber doch nicht. Meg wusste vieles.
Vor allem aber wusste sie, wie man zu nähen hatte.
Sie arbeitete gern in der Frühe, wenn das erste volle Licht der Sonne auf ihre Handarbeiten fiel. Die beste Zeit war kurz nach der Morgenmesse, falls es ihr gelang, sich sofort an die Arbeit zu machen. Seit vierzig Jahren war sie eine Laienschwester, half beim Gottesdienst in ihrer Dorfkirche und hatte sich in dieser Zeit auch um ihren Mann und ihre beiden Kinder kümmern müssen, und so hatte sie die guten frühen Morgenstunden oft verpasst.
Aber wenn sie in dieser Zeit arbeiten konnte – wenn das Kochen, der Altardienst, die kranken Kinder, die Schmerzen und der Wille des Allmächtigen es zuließen –, konnte sie das Werk eines ganzen Tages bereits vollendet haben, wenn die Glocken im Festungskonvent zwei Meilen weiter westlich zur Non riefen.
Und heute war einer dieser wunderbaren Morgen. Sie hatte bei der Messe in der Kirche gedient, was ihr immer ein besonderes Gefühl verschaffte. Sie hatte Blumen auf das Grab ihres Mannes gelegt, hatte ihrer Tochter vor deren eigener Tür einen Kuss gegeben und saß nun im ersten warmen Licht vor ihrem Haus, während ihr Korb neben ihr stand.
Gerade nähte sie eine feine Leinenkappe von der Art, wie sie ein Edelmann trug, damit seine Haare ordentlich blieben. Es war keine schwierige Aufgabe und würde sie nur einen oder zwei Tage in Anspruch nehmen, doch es befanden sich etliche Ritter oben auf der Feste, die viele solcher Kappen brauchten, wie sie wohl wusste. Eine gut gearbeitete Kappe, die hervorragend saß, war einen halben Silberpfennig wert. Und Silberpfennige waren für eine dreiundfünfzigjährige Witwe keineswegs zu verachten.
Meg hatte gute Augen und durchstach das feine Leinen – das Leinen ihrer Tochter – mit großer Präzision. Ihre feinen Stiche waren so gerade wie eine Schwertklinge, sechzehn auf das Zoll, und die Arbeit war genauso gut wie die eines Schneiders aus Harndon – oder sogar besser.
Sie senkte die Nadel in das feine Tuch und zog den Faden vorsichtig hindurch. Dabei spürte sie das zarte Wachs daran; sie spürte die Spannung des kostbaren Stoffes und war sich der Tatsache bewusst, dass sie mit jedem Stich mehr als nur einen Faden zog. Jeder nahm ein wenig Sonne in sich auf. Nach einiger Zeit glitzerte die Reihe ihrer Stiche, wenn sie in einem bestimmten Winkel darauf schaute.
Gute Arbeit machte sie glücklich. Mag betrachtete gern die feinen Kleider, die von der Wäscherin Lis herbeigebracht wurden. Die Ritter in der Festung hatten einige prächtige Stücke, die zwar gut gefertigt, aber schlecht gepflegt waren. Und sie besaßen zahlreiche weniger gut gearbeitete Kleidungsstücke. Meg beabsichtigte, ihnen Kleider, Stopfgarn und andere Hilfsmittel für Ausbesserungen zu verkaufen …
Während der Arbeit lächelte sie über die Welt. Die Ordensschwestern waren im Großen und Ganzen gute Vorgesetzte und viel besser als die meisten Edelleute. Aber die Ritter und ihre Männer brachten nun doch ein wenig Farbe ins Leben. Meg störte es nicht, wenn sie einen Fluch hörte, solange er ein wenig von der Außenwelt nach Abbington am Carak hereinbrachte.
Sie hörte die Pferde und hob den Blick von ihrer Arbeit. Im Westen sah sie Staub aufsteigen. Zu dieser Stunde konnte das nichts Gutes bedeuten.
Sie schnaubte, legte ihre Arbeit in den Korb und verstaute ihre beste Nadel – die aus Harndon stammte, da am Ort niemand so etwas herstellen konnte – sorgfältig in einem Nähkästchen aus Horn. Keine Gefahr war so groß, dass Meg ihretwegen eine Nadel verlieren musste. Sie waren immer schwieriger zu bekommen.
Noch mehr Staub. Meg kannte die Straße. Sie vermutete, dass es zehn Pferde oder mehr sein mussten.
»Johne! Mein Johne!«, rief sie. Der Vogt war ihr Plaudergenosse … und manchmal auch mehr. Er war ebenfalls ein Frühaufsteher, und Meg beobachtete ihn dabei, wie er gerade seine Apfelbäume beschnitt.
Sie stand auf und zeigte nach Westen. Endlich hob er den Arm und sprang von dem Baum herunter.
Er wischte sich die Hände ab und sagte etwas zu einem Jungen, und nur wenige Augenblicke später rannte dieser zur Kirche. Johne hingegen kletterte auf die niedrige Steinmauer, die sein Land von Megs trennte, und verneigte sich.
»Du hast gute Augen.« Er grinste nicht und machte auch keine anzügliche Geste, was sie sehr schätzte. Die Witwenschaft brachte viele unwillkommene Angebote mit sich – doch auch einige willkommene. Er war sauber und höflich und erfüllte damit die Grundbedingungen, die sie an männliche Annäherungsversuche stellte.
Es gefiel ihr, einem Mann ihres eigenen Alters dabei zuzusehen, wie er auf eine Steinmauer sprang.
»Es scheint dir keine großen Sorgen zu machen«, murmelte sie.
»Im Gegenteil«, sagte er gelassen. »Wenn ich eine verwitwete Näherin wäre, würde ich jetzt meine wertvollsten Sachen zusammenpacken und mich darauf vorbereiten, in die Festung zu ziehen.« Er schenkte ihr ein schwaches Lächeln, verneigte sich und sprang wieder von der Mauer herunter. »Schwierigkeiten kommen auf uns zu«, meinte er.
Meg stellte ihm keine dummen Fragen. Noch bevor die Pferde auf den kleinen, von einer uralten Eiche überschatteten Dorfplatz ritten, hatte sie zwei Körbe gepackt – den einen mit Arbeit und den anderen mit solchen Dingen, die sie verkaufen konnte. Sie stopfte den Reisesack ihres Mannes mit Unter- und Überkleidung voll und nahm auch ihren dicksten sowie einen leichteren Mantel mit, die sowohl als Kleidungsstücke wie auch als Schlafdecken dienen konnten. Sie zog das Bett ab, rollte die Laken und Leinenbahnen fest um das Kopfkissen und schnürte ein Bündel daraus.
»Hört her!«, rief eine laute Stimme – eine sehr laute Stimme – auf dem Dorfplatz.
Wie ihre Nachbarn öffnete auch sie nun die obere Hälfte ihrer Vordertür und beugte sich vor.
Auf dem Platz befand sich ein halbes Dutzend bewaffneter Männer, die auf mächtigen Pferden saßen und glänzend polierte Rüstungen sowie scharlachrote Waffenröcke trugen. Bei ihnen befanden sich noch einmal genauso viele Bogenschützen, die aber nicht so gut gerüstet waren und ihre Bögen über dem Rücken trugen. Diese Männer wurden von Dienern in gleicher Anzahl begleitet.
»Die Äbtissin hat angeordnet, dass die guten Leute von Abbington sofort in die Festung verbracht werden!«, brüllte der Mann. Er war groß – riesig sogar, und seine Arme hatten den Umfang von Männerbeinen. Das Pferd, auf dem er saß, war so groß wie ein kleines Haus.
Johne le Bailli ging quer über den Platz zu dem großen Ritter hinüber, der sich zu ihm herabbeugte, und die beiden redeten miteinander und vollführten dabei rasche Gesten. Meg machte sich daran, noch einige Sachen einzupacken. Aus der Hintertür warf sie ihren Hühnern ein wenig Futter hin. Wenn sie nur eine Woche weg sein sollte, würden die Tiere es schaffen. Falls es aber länger dauerte, würden sie auf die eine oder andere Weise geholt werden. Sie besaß zwar keine Kuh – ihre Milch erhielt sie von Johne –, aber sie hatte noch immer die Esel ihres Mannes.
Meine Esel, rief sie sich in Erinnerung.
Sie hatte noch nie einen Esel bepackt.
Jemand hämmerte gegen ihre offene Vordertür. Sie schüttelte den Kopf und sah ihre Esel an, die ihren Blick mit müder Ergebenheit erwiderten.
Der große Ritter stand auf ihrer Schwelle und nickte ihr zu. »Le Bailli hat gesagt, dass du als Erste abreisebereit bist«, sagte er. »Ich bin Thomas.« Seine Verbeugung war nur sehr knapp, aber sie war da.
Sein Anblick verhieß nichts Gutes.
Sie grinste ihn an, denn auch der Anblick ihres Mannes hatte stets nichts Gutes verheißen. »Ich würde noch schneller fertig werden, wenn ich wüsste, wie man einen Esel bepackt«, sagte sie.
Er kratzte sich unterhalb des Bartes. »Ich könnte dir einen der Diener geben. In einer Stunde müssen alle abreisebereit sein. Le Bailli hat gesagt, dass sich die anderen schneller bewegen werden, wenn sie sehen, dass du schon fertig bist.« Er zuckte die Achseln.
Rechts von ihr kreischte eine Frau auf.
Thomas spuckte aus. »Verdammte Bogenschützen«, knurrte er und trat aus der Tür.
»Schickt mir einen Diener!«, rief sie hinter ihm her.
Sie holte einen Weidenkorb aus dem Schuppen, füllte ihn erst mit verderblichen Lebensmitteln und dann mit Eingemachtem. Sie hatte Würste, Marmelade, Eingelegtes … All das war bereits für sich genommen wertvoll.
»Gute Frau?«, fragte eine höfliche Stimme von der Tür her. Der Mann war mittleren Alters und sah so hart wie ein Fels und so robust wie ein alter Apfel aus. Hinter ihm stand ein dürrer Junge von etwa zwölf Jahren.
»Ich bin Jacques, der Diener des Hauptmanns. Und das hier ist mein Knappe Toby. Er ist geschickt darin, Mulis zu bepacken – ich vermute, Esel werden kaum anders sein.« Der Mann nahm seinen Hut ab und verbeugte sich.
Meg erwiderte diese Höflichkeitsbezeugung. »Möge die Sonne auf Euch scheinen, Ser.«
Jacques hob eine Braue. »Es ist so, dass wir auch all deine Nahrungsmittel mitnehmen müssen.«
Sie lachte. »Ich habe schon versucht, sie zusammenzupacken …« Dann begriff sie die Bedeutung seiner Worte. »Ihr meint, Ihr braucht sie für die Garnison.«
Er nickte. »Ja, für alle.« Dann zuckte er die Achseln. »Ich will es dir so leicht wie möglich machen, aber wir werden sie mitnehmen müssen.«
Johne erschien bei der Tür. Er hatte sich einen Brust- und Rückenpanzer umgeschnallt und nickte Jacques zu. Zu Meg sagte er: »Gib ihnen alles. Sie kommen von der Äbtissin; also dürfen wir davon ausgehen, dass sie uns entschädigen wird. Hast du noch Bens Armbrust? Und seine anderen Waffen?«
»Sein Schwert und seinen Dolch«, sagte Meg. Sie öffnete den Schrank, in dem sie ihre wertvollsten Besitztümer aufbewahrte: die Zinnteller, den silbernen Becher, den Goldring ihrer Mutter und auch den Dolch sowie das Schwert ihres verstorbenen Mannes.
Toby sah sich scheu um und sagte dann zu Jacques: »Das hier ist ein reiches Haus, was, Meister?«
Jacques grinste grimmig und versetzte dem Jungen einen Tritt. »Verzeihung, wir haben vielleicht ein paar schlechte Angewohnheiten vom Kontinent mitgebracht, aber diese Sachen werden wir dir nicht wegnehmen.«
Unter anderen Umständen würdet ihr es durchaus tun, und ebenso alles andere, was euch gefällt, dachte sie.
Johne legte ihr die Hände auf die Schultern. Es war eine vertrauliche, beruhigende Geste, für ihren Geschmack aber etwas zu besitzergreifend, selbst in dieser kritischen Lage.
»Ich besitze eine verschließbare Truhe«, sagte er. »Darin ist noch Platz für deinen Becher und den Ring. Und für das Silber, das du sonst noch hast.« Er sah ihr in die Augen. »Meg, vielleicht kommen wir nicht mehr zurück. Wir befinden uns hier im Krieg – im Krieg mit der Wildnis. Wenn er vorbei ist, haben wir vielleicht kein Zuhause mehr, in das wir zurückkehren können.«
»Heiliger Jesus!«, entfuhr es ihr. Sie holte zitternd Luft und nickte. »Also gut.« Sie nahm den Becher und den Ring, entfernte einen Ziegel im Kamin, holte all ihr Silber heraus – einundvierzig Pfennige – und gab es Johne. Einen Pfennig aber schenkte sie Jacques.
»Ihr erhaltet noch einmal so viel, wenn meine Esel es bis zur Festung schaffen«, sagte sie geziert.
Er sah den Pfennig an. Biss darauf. Und warf ihn dem Jungen zu. »Du hast die Dame gehört«, sagte er und nickte ihr zu. »Ich bin der Diener des Hauptmanns. Ein Stück Gold wäre eher mein Preis. Aber Tom hat mich gebeten, mich um dich zu kümmern, und so gehorche ich.« Knapp salutierte er vor ihr, dann ging er durch die Tür und machte sich auf den Weg nach Simon Carters Haus.
Sie sah den Jungen an. Er schien sich in nichts von den anderen Jungen zu unterscheiden, die sie kannte. »Bist du in der Lage, einen Esel zu bepacken?«, fragte sie.
Er nickte sehr ernsthaft. »Habt Ihr …« Er sah sich verstohlen um. Er war dürr wie eine Vogelscheuche und so schlaksig, wie es nur heranwachsende Jungen sein können. »Habt Ihr vielleicht etwas zu essen?«, fragte er.
Sie lachte. »Ihr nehmt es mir ja doch weg, nicht wahr, mein Lieber?«, fragte sie. »Nimm dir ruhig ein Stück von meiner Pastete.«
Toby aß die Pastete mit einer Hingabe, die ihr ein Lächeln entlockte. Während sie ihn beobachtete und ihren Korb dabei weiter füllte, vertilgte er das Stück, das er bekommen hatte, und stibitzte ein zweites, als er auf ihren Esel zuschritt.
Danach erschienen zwei Bogenschützen. Ihnen fehlte das, was sowohl Ser Thomas als auch der Diener Jacques hatte. Sie wirkten gefährlich.
»Was haben wir denn hier?«, fragte der Erste durch die Tür hindurch. »Wo ist dein Mann, meine Schöne?« Seine Stimme klang matt, genauso wie sein Blick wirkte.
Der zweite Mann hatte keine Zähne mehr und grinste allzu breit. Sein kurzes Kettenhemd war nicht gepflegt, außerdem schien er ein Schwachkopf zu sein.
»Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten«, sagte sie mit einer Stimme, die so scharf wie Stahl war.
Der Mann mit den toten Augen hielt nicht einmal inne. Er streckte die Hände aus, packte sie am Arm, und als sie sich wehrte, riss er ihr die Beine weg und stieß sie auf den Boden. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich dabei nicht.
»Dieses Haus steht unter Schutz«, rief der dürre Junge von der Küche her. »Das solltest du nicht vergessen, Mutwill.«
Der Bogenschütze mit den toten Augen spuckte aus. »Verpiss dich«, sagte er. »Ich will zurück auf den Kontinent. Ich habe keine Lust mehr, bloß das Dienstmädchen abzugeben …«
Meg war so verblüfft, dass sie zunächst nichts tun konnte.
Der Bogenschütze beugte sich herunter und steckte ihr die Hand unter das Mieder. Und drückte ihre Brust. »Später«, sagte er.
Sie kreischte auf und schlug ihm in den Schritt.
Er taumelte zurück und sackte zusammen, doch der andere Schütze packte sie an den Haaren, als wäre dies eine oft geübte Routine …
Ein scharfes Knacken ertönte, und sie fiel nach hinten, denn der Schütze hatte sie plötzlich losgelassen. Er kniete auf dem Boden, Blut quoll aus seinem Gesicht. Thomas stand über ihm und hielt einen Stock in der Hand.
»Ich hab ihnen gesagt, dass das Haus unter Schutz steht«, rief der dünne Junge.
»Wirklich?«, fragte der große Mann und sah die beiden Bogenschützen an.
»Wir waren so sanft wie Lämmer«, sagte der mit den toten Augen.
»Verdammte Bogenschützen. Verzieht euch, und macht euch wieder an die Arbeit«, sagte der große Mann und half Meg beim Aufstehen.
Die beiden Schützen kämpften sich auf die Beine, gingen hinaus und sammelten Megs Hühner sowie ihre Schafe und alles Getreide aus ihrem Schuppen ein. Auch die Wurzeln im Keller vergaßen sie nicht. Dabei gingen sie sehr methodisch vor, und als sie den beiden in den Schuppen folgte, schenkte der mit den toten Augen ihr einen Blick, der ihr Angst einjagte. Offensichtlich wollte er ihr etwas antun.
Aber bald hatte der Junge ihre Esel gepackt und gezäumt. Sie warf sich den Beutel ihres Mannes über die Schulter, nahm die beiden Körbe und ging auf den Dorfplatz hinaus.
Von dort aus, wo sie nun stand, wirkte ihr Haus äußerst gewöhnlich.
Sie versuchte sich vorzustellen, wie es aussah, wenn es brannte. Das leere Erdgeschoss gähnte in die Sonne. Sie sah die Stelle, gegen die sie den Rücken lehnte, wenn sie nähte. Dort war das Holz glatt poliert, und sie fragte sich, ob sie jemals wieder einen so gut beleuchteten Ort finden würde.
Die Carters waren die Nächsten, die zur Abreise bereit waren. Sie waren eine Familie von Kutschern mit zwei schweren eigenen Karren und Zugtieren, und sechs Männer und Jungen hatten das Packen besorgt. Le Bailli und seine Haushälterin waren die Nächsten und hatten auch die Teppiche eingepackt. Auf einem von ihnen hatte Meg einmal gelegen – bei diesem Gedanken errötete sie. Und grübelte darüber nach, dass sie instinktiv immer nur seinen Vornamen benutzte …
Die Lanthorns waren die Letzten. Ihre vier schlampigen Töchter wirkten mürrisch, und Mutter Lanthorn wanderte in ihrer üblichen Verzweiflung an der Reihe der Tiere entlang, die im Dorf zusammengetrieben worden waren, und bettelte um Platz für ihren Beutel und einen Korb mit Leinen. Die Wäscherin Lis war von Soldaten umgeben, die darum wetteiferten, ihre Sachen zu tragen. Sie kannte viele der Männer beim Namen, da sie schon oft deren Leinen gewaschen hatte, außerdem war sie sowohl mittleren Alters als auch hübsch, was in den Augen der Soldaten als eine ideale Kombination galt.
Endlich waren auch die Langthorns abreisebereit – alle vier Töchter warfen den Soldaten schmachtende Blicke zu –, und die Kolonne setzte sich in Bewegung.
Drei Stunden nach dem Eintreffen der Soldaten war Abbington leer.
Albinkirk · Ser Alcaeus
Ser John gab ihm einen Trupp Armbrustschützen; es waren Mitglieder der städtischen Gilden, und sie alle wirkten in ihren Zunftfarben ein wenig zu glänzend. Das Blau und Rot der Pelzmacher, der führenden Gilde von Albinkirk, war vorherrschend. Er hätte darüber lachen mögen, dass er, der Vetter des Kaisers, eine Gruppe niedrig geborener Armbrustschützen befehligen musste. Es hätte ihn belustigt, wenn nicht …
Sie kamen bei Sonnenuntergang – geradewegs aus der untergehenden Sonne heraus.
Die Felder wirkten, als krabbelten ungezählte Insekten auf ihnen, und dann, ohne einen Ruf oder ein Signal, änderten die Irks ihre Laufrichtung und kamen auf die Mauern zu. Ser Alcaeus hatte so etwas noch nie gesehen, und es verursachte ihm eine Gänsehaut.
Unter ihnen befanden sich Dämonen, ein Dutzend oder mehr. Sie waren schnell, geschmeidig, geradezu anmutig und hochgefährlich. Und sie rannten einfach die Mauern hoch.
Seine Armbrustschützen schossen immer wieder in die herbeiströmende Horde, während er sich bemühte, hinter ihnen auf dem Wehrgang auf und ab zu schreiten, Ermunterungen zu murmeln und ihre Standhaftigkeit zu loben. Er wusste genau, wie man richtig kommandierte, auch wenn er es nie zuvor getan hatte.
Die erste Welle hätte die Mauer beinahe eingenommen. Ein Dämon sprang hinauf und tötete etliche Gildenmänner. Es war nichts als Glück, dass das große Schwert des Ungeheuers an der Brustplatte eines Gesellen abprallte und seine Gefährten ihre Pfeile in das tödliche Wesen hineinschießen konnten. Es fällte zwar noch vier weitere Männer, während es starb, aber der Anblick des toten Dämons stärkte den Gildenmännern das Rückgrat.
Sie wehrten die zweite Welle ab. Die Dämonen waren nun vorsichtiger geworden und führten den Angriff aus der hinteren Reihe. Alcaeus wollte seine Schützen dazu bringen, auf diese Bestien zu zielen, aber sie waren voll und ganz damit beschäftigt, die Gefahren abzuwehren, die ihnen am schlimmsten zu sein schienen.
Ein Gildenhauptmann trat neben ihn, stützte sich mit der einen Hand schwer auf seine Streitaxt und salutierte mit der anderen.
»Mylord«, sagte er, »wir haben fast keine Pfeile mehr. Jeder Junge hatte zwanzig.«
Ser Alcaeus blinzelte. »Wo können wir weitere herbekommen?«
»Ich hatte gehofft, dass Ihr das wisst«, sagte der Offizier.
Ser Alcaeus schickte einen Läufer los, aber er kannte die Antwort bereits.
Die dritte Welle schwappte über die Mauer hinter ihnen, und sie hörten, wie sie auf die Steinplatten der Brustwehr fiel. Der Kampflärm veränderte sich, ein plötzliches Kreischen ertönte, und seine Männer warfen verängstigte Blicke über die Schultern.
Er wünschte, er hätte seinen Knappen hiergehabt, denn dieser war ein Veteran, der schon fünfzig Schlachten geschlagen hatte. Doch der Mann war bei dem Hinterhalt gestorben, und so hatte Ser Alcaeus niemanden, den er um Rat fragen konnte.
Er streckte das Kinn vor und schickte sich an, in Würde zu sterben.
Dabei lief er wieder auf der Mauer hin und her, während die Schatten immer länger wurden. Sein Abschnitt maß vom einen Ende zum anderen etwa hundert Schritte. Selbst für Ser Alcaeus, der aus der größten Stadt der Welt stammte, war Albinkirk eine große Stadt.
Er blieb stehen, als er sah, wie drei seiner Männer zurück auf die Stadt schauten.
»Augen nach vorn!«, fuhr er sie an.
»Ein Haus brennt«, sagte irgendein Dummkopf.
Weitere Männer drehten sich um, und nun hatte er die Herrschaft über sie verloren. Sofort sprang ein Dämon auf die Mauer und tötete sie. Das Wesen bewegte sich wie eine Flüssigkeit zwischen den Männern hindurch, da blitzten zwei Äxte in ihren klauenbewehrten Händen auf. Während Alcaeus zusah, stieß der eine Krallenfuß des Dämons vor und weidete einen fünfzehnjährigen Jungen aus, der keinen Brustpanzer trug.
Alcaeus griff an. Er spürte die Angst, aber in Morea wurden die Ritter nur zu diesem einen Zweck ausgebildet, und er kannte diese Angst. Er rannte durch sie hindurch, hob die Waffe …
Es erwischte ihn. Es war viel schneller als er, und eine Axt traf seinen Arm. Er war gut ausgebildet und konnte den größten Teil der Schlagkraft abwehren. Seine höchst kostbare Panzerung schluckte den Rest, und dann schwang er seine eigene Waffe.
Das Wesen musste sich umdrehen, damit es ihm gegenüberstand. Im nächsten Augenblick hatte es die Hüften herumgedreht, und Alcaeus schwang seine Axt, so ähnlich wie ein Junge seine Heugabel wirft, aber mit doppelter Geschwindigkeit.
Ser Alcaeus war genauso schockiert wie der Dämon, als seine Axt die Hand der Kreatur traf und sie zerschmetterte. Blut und Eiter spritzten heraus, die Axt fiel zu Boden. Der Dämon schlug mit der anderen Klaue nach ihm aus, dann stieß er mit dem krallenbewehrten Fuß nach ihm. Alle vier Krallen drangen durch seine Brustplatte und warfen ihn zu Boden, aber keine durchstach sein Kettenhemd.
Eine Armbrust traf den Dämon. Es war kein Pfeil, sondern die Waffe selbst, die von einem verängstigten Gildenmann geschwungen wurde.
Der Dämon prallte gegen die Mauer. Die Verteidiger sprangen vor ihm davon, während er über die Zinnen hüpfte.
Alcaeus stand wieder auf. Er hielt noch seine Streitaxt in der Hand.
Zwei Atemzüge lang war er stolz auf sich, dann erkannte er, dass die Stadt hinter ihm in Flammen stand und sich zwei weitere Dämonen mit ihm zusammen auf der Brustwehr befanden. Plötzlich schwirrte die Luft vor Irkpfeilen. Schlimmer noch, sie drangen aus der Stadt heran.
Er hatte ein Dutzend Männer bei sich, einschließlich des verblüfften Kämpfers, der den Dämon mit seiner Armbrust getroffen hatte. Der Rest floh gerade von der Mauer und rannte auf die eigenen Häuser zu.
Er schüttelte den Kopf und fluchte. Sie waren umzingelt, die Hälfte seiner Männer war verschwunden, und rasch wurde es dunkel.
Er traf eine Entscheidung. »Folgt mir!«, rief er und rannte die Brustwehr entlang. Er war auf dem Weg zur Burg, die sich über dem westlichen Ende der Mauer beim Flusstor erhob. Sie besaß ihre eigenen Verteidigungsanlagen.
Die Stadt fiel. Die Burg war der einzige Ort, an dem Widerstand noch sinnvoll war.
Als er stehen blieb und Luft holte, sah er, dass Albinkirk von Süden bis Norden brannte. Ein Meer aus Kreaturen der Wildnis wogte durch die Straßen. Er kannte den Unterschied zwischen den Irks – in dem Feuerschein wirkten sie elfenhaft, knorrig und satanisch – und den Kobolden mit ihren ledernen Bäuchen und den seltsam eingehängten Gliedern. Er hatte die Bilder studiert. Er war auf dies hier vorbereitet worden, und es war doch wie ein Albtraum. Er rannte wieder los, begleitet von dem halben Dutzend seiner Armbrustschützen, das bei ihm geblieben war. Der Rest hastete trotz seines Verbotes in die Stadt hinein. Einer starb gerade zu ihren Füßen, wurde von Kobolden in Stücke gerissen und von etwas noch Furchtbarerem verschlungen.
Er sah den Fluss und die Burg schon dicht vor sich, aber der nächste Abschnitt der Brustwehr war nur so mit Feinden übersät. Auf den Straßen unter ihm machte es einen noch schlimmeren Eindruck.
Aber am Rande des Feuerscheins bemerkte er eine Gruppe Soldaten mit Speeren, die noch immer eine Straße hielten. Hinter ihnen drängte eine Masse verschreckter Flüchtlinge auf die Burgtore zu.
Ein Gedanke drang ungebeten in seinen Kopf.
Zeit, dir deine Sporen zu verdienen.
»Lasst mich vor«, sagte er zu seinen Armbrustschützen. »Ich greife an. Ihr folgt mir und tötet alles, was an mir vorbeikommen will. Klar?«
Eine Sekunde lang sehnte er sich nach Wein, nach seiner Leier und nach dem Gefühl einer Frauenbrust unter seiner Hand.
Er hob seine Streitaxt.
»Kyrie eleison!«, brüllte er und griff an.
Ungefähr sechzig Kobolde befanden sich auf der Mauer. Es war zu dunkel, um sie zu zählen, und es interessierte ihn auch nicht.
Er rannte in sie hinein, überraschte sie. Der erste starb, doch danach lief nichts mehr gut für ihn. Seine Axt steckte in dem Kobold fest. Er hatte das Geschöpf in der Armbeuge getroffen, es stürzte von der Mauer und nahm dabei seine wertvolle Waffe mit.
Sofort war er umzingelt.
Mit einer geübten Bewegung riss er seinen Dolch heraus – ein Bastardvetter des Kaisers überlebte am Hof nicht lange, wenn er nicht geschickt mit dem Dolch umzugehen verstand –, und dann stürzten sie sich auf ihn, und er wurde unter ihnen begraben.
Sein rechter Arm stach wie aus eigenem Willen zu.
Ein gewaltiger Schlag trieb ihn vorwärts, und er taumelte einige Schritte voran, wobei er Körperteile von Kobolden unter sich zertrat. Plötzlich hatte er eine schreckliche Angst davor, von der Mauer zu stürzen. Doch die Panik kräftigte seine Glieder; er wirbelte herum und spürte, wie sein gepanzerter Rücken gegen die Zinnen prallte. Plötzlich waren seine Arme wieder frei, und das Wesen, das gerade versuchte, ihm das Visier zu öffnen, wurde wichtiger als alles andere. Nun war es abgeschüttelt, und er stand da – frei.
Sein rechter Arm war von grün-braunem Blut klebrig geworden. Er bückte sich mit dem Dolch in der Hand, hielt ihn dicht über die rechte Hüfte, stützte die linke Faust in die linke Hüfte und warf einen Blick über die linke Schulter.
Ein Kobold warf einen Speer nach ihm.
Er fing ihn mit der linken Hand ab und taumelte in die Gruppe der Kobolde hinein. Sein Atem ging stoßweise, aber seine Gedanken waren völlig klar, er rammte dem Ersten seinen Dolch mitten in den Kopf und riss die Waffe wieder heraus. Seine gepanzerte Faust zerschmetterte das nasenlose Gesicht eines zweiten Kobolds.
Die nächsten beiden krümmten sich zusammen, waren von Pfeilen getroffen. Er trat an ihnen vorbei, warf den Dolch mit einer Geschicklichkeit, die dem Waffenmeister seines Onkels gefallen hätte, in die andere Hand und zog mit der rechten Hand sein Schwert, während er vorwärts drang.
Die Kobolde wichen vor ihm zurück.
Er griff sie an.
Sie besaßen ihre eigene Art von Edelmut. Eine der Kreaturen gab ihr Leben hin, um ihn zum Stolpern zu bringen. Sie starb auf seinem Dolch, als er fiel. Er rollte über die Schulter, doch dann befand sich nichts mehr unter seinen Füßen …
Er traf auf ein Ziegeldach, glitt daran herunter, stieß mit der gepanzerten Schulter gegen einen steinernen Sims, wurde herumgeworfen …
Und landete auf der Straße. Er hatte aber noch sein Schwert und auch den Dolch und nahm sich die Zeit, Gott dafür zu danken.
Über ihm starrten die Kobolde von der Mauer auf ihn herab. »Folgt mir!«, rief er seinen Männern zu. Er hatte nicht vorgehabt, auf die Straße zu gelangen, aber von hier aus erkannte er, dass die Irks hinter seinen Bogenschützen die Mauer entlangrannten.
Zwei Männer wagten den Sprung, die übrigen erstarrten und starben dort, wo sie gerade standen.
Die drei rannten nun auf die Burg zu, die ebenso erhellt war wie ein königlicher Palast vor einem großen Empfang. Ganz Albinkirk stand in Flammen, und die Straßen waren mit toten Bürgern sowie ihren Dienern und Sklaven gepflastert.
Es war ein Massaker.
Er rannte, so schnell er es in seinen stählernen Beinschienen konnte. Seine überlebenden Schützen folgten ihm dicht auf den Fersen und töteten die beiden einzigen Feinde, denen sie begegneten. Dann erreichten sie die offene Straße vor dem Haupttor der Burg.
Die Speerwerfer hielten die Straße noch immer.
Und das Tor war nach wie vor geschlossen.
Die drei befanden sich auf der falschen Seite des Kampfes.
Alcaeus schob sein Visier hoch. Es war ihm inzwischen egal, ob er starb; er musste Luft holen. Er stand so lange da, bis sich sein Atmen verlangsamt hatte. Dann beugte er den Oberkörper vor. In dieser Zeit war er ein leichtes Ziel für jeden Irk oder Kobold.
»Messire!«, riefen die entsetzten Armbrustschützen.
Er beachtete sie nicht.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, doch dann richtete er sich wieder auf, nachdem er sich auf die Pflastersteine erbrochen hatte. Zu seinen Füßen lag ein halb aufgefressener Junge, dessen Torso beiseitegeworfen worden sein musste, nachdem die Beine bis auf die Knochen abgenagt worden waren.
Die Speerkämpfer konnten die Straße kaum mehr halten. Es waren fünfzehn oder vielleicht auch weniger, und sie verteidigten sich gegen mindestens hundert Irks und Kobolde. Die Kreaturen der Wildnis waren nicht besonders einsatzfreudig; sie wollten nicht kämpfen, sondern plündern. Aber sie drängten weiter vor.
Alcaeus deutete auf die andere Seite des kleinen Platzes. »Ich gehe dorthin«, sagte er zu den Armbrustschützen. »Ich will mich bis zu den Speerkämpfern durchschlagen. Entweder ihr sterbt hier, oder ihr sterbt bei mir – das ist mir gleichgültig.« Er sah die beiden verängstigten Jungen an. »Wie heißt ihr?«, fragte er.
»James«, sagte er Dünne.
»Mat«, sagte der besser Ausgerüstete, der einen Brustpanzer besaß.
»Also los, bringen wir es hinter uns«, sagte er.
Er wusste, dass er es nicht hinter sich bringen wollte, aber er wusste genauso gut, dass er hier andernfalls vermutlich sterben würde, während er noch immer nach Luft rang.
»Heiliger Mauritius, steh mir und diesen beiden jungen Männern bei«, sagte er und befahl dann den Jungen: »Bleibt dicht hinter mir. Wenn ich euch zu schießen befehle, dann feuert ihr auf die Kreaturen, die mir am nächsten gekommen sind.« Er ging am Rande des Platzes entlang.
Rechts von ihnen kämpfte ein Rudel Irks um einige Pelzballen. Er beachtete sie nicht.
Ein Dämon sprang in eine Gasse hinein und jagte hinter einem kreischenden nackten Mann her. Auch diese beiden beachtete er nicht. Er ging weiter, sammelte seine Kraft, während seine Beinschienen ein grimmiges metallisches Klappern auf den blutigen Steinen verursachten.
Er sah nicht zurück, sondern ging einfach weiter, unter einem Baum her, dessen Zweige sich über eine Hauswand neigten, und dann an einer Steinbank vorbei, auf der zu glücklicheren Zeiten die Betrunkenen wohl ihren Rausch ausgeschlafen hatten.
Als er noch zehn Schritte von der Rückseite der feindlichen Kämpfer entfernt war, zuckte er mit den Schultern. Er wollte beten, aber ihm kam nichts anderes in den Sinn als das Bild einer wunderschönen Kurtisane in Thrake.
»Feuer!«, rief er.
Zwei Pfeile fuhren mitten in die Masse des Wildnisfleisches, und er folgte ihnen; sein Schwert und sein Dolch blitzten auf.
Die unterste Kaste der Kobolde verfügte über keine Rüstungen und wurde nur durch ihre Lederschalen geschützt. Er schlitzte sie auf, warf sie zu Boden und zerschmetterte sie mit seinen Fäusten. Einen.
Zwei.
Drei.
Vier.
Fünf.
Er konnte nicht mehr atmen. Er konnte überhaupt nichts mehr sehen. Er konnte auch nichts mehr tun …
… aber er schlug weiterhin blindlings zu. Dann packte etwas die Hand, in der er den Dolch hielt, und schleuderte ihn zu Boden.
Er rollte sofort wieder auf die Beine, denn schließlich war er ein Ritter. Ein Irk – einer von den tödlichen – rammte ihm einen Speer in die Magengrube. Er taumelte zurück, und plötzlich war er von Männern umzingelt …
Von Männern!
Er befand sich inmitten der Speerkämpfer. Das trieb ihm die Kraft zurück in die Glieder, er riss sich zusammen, und nun fuhr sein Schwert auf und nieder.
Er sah, dass James, der dünne Armbrustschütze, noch stand. Der Junge hatte einige Kreaturen mit seiner Waffe niedergestreckt und reckte nun sein Schwert in die Luft.
Die Wesen waren durch den unbedeutenden Angriff in ihrem Rücken in Panik geraten und wichen vor ihm und Alcaeus zurück.
Ser Alcaeus sammelte sich. Noch einmal.
Er stolperte vorwärts und schwang sein Schwert. Einmal.
Zweimal.
Ein drittes Mal. Dabei gingen zwei Kobolde zu Boden. Der große Irk zuckte zusammen, drehte sich um und hüpfte davon.
Die zwei Höllenwesen, die sich von dem älteren Jungen nährten, starben unter James’ Schwert, und nun leerte sich der Platz plötzlich.
Hinter ihnen drängten sich zweihundert entsetzte Überlebende.
Die Männer auf der Burgmauer öffneten endlich das Tor. Vielleicht war ihnen das befohlen worden, da es nun sicherer war, und die Menschen strömten in vollendeter Panik hindurch. Weitere starben – nicht unter der Hand der Wildnis, sondern sie wurden von den anderen totgetrampelt. Vor allem die Frauen waren so außer sich, dass sie sich wie eine durchgehende Tierherde verhielten.
Die Speerkämpfer bildeten die Nachhut und zogen sich Schritt für Schritt hinter ihnen zurück.
Schritt.
Für.
Schritt.
In den schattigen Straßen hinter dem Platz sammelten zwei Dämonen ihre eigenen, panisch gewordenen Streitkräfte und holten sich gute Irk-Bogenschützen. Im Licht der brennenden Stadt schossen sie quer über den Platz. Ihre Elfenbögen waren zwar leicht, aber tödlich.
Ser Alcaeus konnte nicht allen Fliehenden Schutz gewähren. Er war fast unempfindlich gegen die Einschläge, aber die Schäfte verursachten ihm Schmerzen, wenn sie den Helm oder die Beinschienen trafen. Und doch war er über das gewöhnliche Schmerzempfinden genauso hinaus wie über die gewöhnliche Erschöpfung. Er sah nach links und rechts und stellte fest, dass er inzwischen das Tor erreicht hatte. Die Wächter versuchten es zu schließen, doch er wollte noch hindurchschlüpfen. Die zertrampelten Körper und jene der Verwundeten unter ihm hielten das Tor auf, während der Feind nun angriff.
Es gelang ihm gerade noch rechtzeitig, seinen Schwertarm zu heben und sich gegen die schwere Klinge eines Dämonen zu verteidigen. Dann war Ser John an seiner Seite. Er hatte einen Streitkolben. Allein der Griff war fünf Fuß lang.
Er schwang ihn mit großem Geschick.
Er trat neben Ser Alcaeus, balancierte auf den Absätzen, als ob er dem Kampf entgegenfiebere, und sein Streitkolben bewegte sich wie eine Maschine. Die Dämonen wichen vor ihm zurück. Ein Kobold starb. Ein Dämon erhielt einen Schlag gegen den Torso, geriet ins Taumeln, während der Kolben seinen Fuß traf und den Knochen zerschmetterte. Er schrie auf, als er zu Boden ging.
Es war eine ruhmvolle Arbeit, aber Alcaeus bückte sich, packte den Leichnam einer zertrampelten Frau und warf ihn in die Dunkelheit hinaus.
Das Tor bewegte sich.
Er legte die Hände unter den Schädel eines toten Kobolds und warf die Leiche ihren Gefährten zu.
Das Tor bewegte sich wieder um eine Handbreit.
»Ser John!«, schrie er. Seine Stimme klang heiser und überschlug sich.
Der alte Ritter machte einen Ausfall, hieb zu und wich plötzlich zurück.
Alcaeus folgte ihm taumelnd.
Hinter ihnen wurden die Tore zugeworfen. Entsetzte Sergeanten rammten die Latten in die Halterungen, und Schläge regneten von außen auf das Tor nieder. Ein Irk, der tapferer oder geschickter als die anderen war, rannte das Tor hoch und konnte gerade noch ein Bein über die Brüstung werfen, bevor einer von Ser Johns Bogenschützen ihn mit einem Pfeil an das Holz zu nageln vermochte. Die Soldaten auf der Mauer hielten stand. Die Angriffswelle geriet ins Stocken und wurde zurückgeworfen.
Ser John fiel auf die Knie. »Gottverdammt, ich bin zu alt für so was«, sagte er und starrte auf den Hof voller Flüchtlinge.
Aber das Tor hielt. Auch die Mauer hielt.
Alcaeus taumelte auf eine Säule des Arkadengangs zu und versuchte sein Visier zu öffnen, aber er vermochte die Arme nicht mehr zu heben. Er schlug sich den Kopf an der Säule an, dann konnte er nicht mehr atmen.
Fremde Hände lösten die Verschlüsse seines Visiers und hoben es. Luft floss hinein. Süße, wunderbare Luft, die nur von den harschen Schreien der Leute befleckt wurde, die so verängstigt waren, dass sie zu nichts anderem mehr in der Lage waren.
Es war der Armbrustschütze James, der ihm soeben geholfen hatte. »Ich hab’s gleich«, sagte er. »Bewegt Euch nicht.« Jetzt zog ihm der Junge den ganzen Helm über den Kopf.
Ser Alcaeus entledigte sich seiner Panzerhandschuhe. Dann sackte er zu Boden und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Säule.
Ser John trat vor ihn. »Ich brauche Euch auf den Mauern.«
Alcaeus ächzte.
Der Junge stellte sich verteidigend vor ihn. »Lasst ihn doch erst mal Luft holen! Er hat alle gerettet!«
Ser John schnaubte verächtlich. »Sie sind erst dann gerettet, wenn das hier vorbei ist, Junge. Ser Ritter? Auf zu den Mauern!«
Alcaeus streckte die Hand aus.
Ser John ergriff sie und zog ihn auf die Beine.
Harndon · Edward
Meister Pyles erster Auftrag war für ihn das Langweiligste, das er sich vorstellen konnte. Es war etwas, das er auch schon im Alter von vierzehn Jahren hätte tun können.
Er sollte zwanzig Eisenstäbe nehmen und daraus eine Säule schmieden, die durch Bänder zusammengehalten wurde. Jede Handspanne ein Band. Innerer Durchmesser ein Zoll.
Langweilig.
Aber er war klug genug zu wissen, dass Meister Pyle ihm diese Arbeit nicht gegeben hätte, wenn sie unwichtig gewesen wäre. Also maß er sorgfältig ab und beschloss, einen Prüfring zu verfertigen, damit sich die Innenseiten der Stäbe stets in gleichem Abstand voneinander befanden, während er sie zusammenfügte. Das dauerte einige Zeit. Er planierte den Prüfring und polierte ihn endlos.
Schließlich verspürte er einen Augenblick tiefer Befriedigung, als Lionel, ein anderer Geselle, ihn angrinste. »Weißt du«, sagte er langgezogen, da er seine Worte offensichtlich sehr genoss, »das könntest du auch einen Lehrling machen lassen.«
Ich bin ein Narr, dachte er glücklich. Schließlich überließ er es Ben, dem Sohn des Schuhmachers, seinen Prüfring mit Bimsstein zu bearbeiten, während er selbst in den Abend hinausging, um mit seinen Genossen zu fechten und Anne seinen Ring zu zeigen. Nein, er sollte ihn besser Annes Eltern zeigen. Gesellen durften nicht heiraten, aber ein Geselle war eine viel wichtigere Person als ein Lehrling. Nun war er ein Mann.
Am nächsten Morgen war der Prüfring fertig. Er dankte dem Lehrling wie ein guter Meister, dann glättete er die Schweißnähte innen wie außen. Das stellte sich als schwieriger heraus, als er angenommen hatte. Er brauchte den ganzen Tag dazu.
Meister Pyle sah sich das Ergebnis an und schleuderte es gegen die Eiche im Hof. Die Nähte hielten. Er lächelte. »Du hast einen Verstärkungsring gefertigt«, sagte er.
»Das musste ich«, erwiderte Edward.
Meister Pyle zog eine Grimasse. »Jetzt ist mein Entwurf nicht mehr so schön«, sagte er. »Bist du im Gießen geschickt?«
Edward zuckte mit den Schultern. »Nicht besonders gut, Meister«, gab er zu.
Am nächsten Morgen befand er sich bei Sonnenaufgang am Fluss und goss zusammen mit den Foible-Jungen Glocken. Sie waren zwar Rivalen, aber trotzdem miteinander befreundet.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Hunderte von Meilen weiter nordwärts schien dieselbe Morgensonne auf eine Festung, die sich in jeder Hinsicht kriegsbereit gemacht hatte. Hohe hölzerne Palisaden krönten die Mauern und Türme, auf denen je eine große Kriegsmaschine stand. Der Bergfried trug das Gewicht einer Blide, während kleinere Schleuderwerkzeuge und Geschossmaschinen die niedrigeren Türme schmückten.
Abgesehen von einem Dutzend diensthabender Männer lag die ganze Garnison, die zwei Tage und Nächte – bei Fackelschein – durchgearbeitet hatte, schlafend im Stroh. Das Dormitorium war voller Menschen aus der Umgegend, ebenso wie die Halle und der Stall.
Pampe weckte den Hauptmann, weil es unten am Fluss eine Bewegung gab. Der Hauptmann hatte am Abend zuvor zehn Bogenschützen, drei Schwertkämpfer und zwei Ritter im Turm an der Brücke postiert und unter Ser Milus’ Kommando gestellt. Sie hatten ihre eigenen Mahlzeiten und einen Spiegel, mit dem sie Signale geben konnten, und heute Morgen blitzten sie offenbar fröhlich durch die Gegend.
Ser Jehannes hatte sie als Schwertkämpfer begleitet. Er war ohne ein Wort gegangen und hatte keine Nachricht hinterlassen. Der Hauptmann erwachte mit dem Gedanken an ihn.
»Verdammter Kerl«, sagte er und starrte auf die frisch gekalkte Decke über seinem Kopf. Jehannes hatte ihn nie gemocht, weil er jung und von edler Abstammung war.
Soweit es den Hauptmann betraf, könnte Messire Jehannes ruhig seinen Stammbaum und seine Jugend haben. Er lag auf dem Bett, sein Atem trieb dampfend durch die Luft, während er bemerkte, dass er wütender und wütender wurde.
»Wer ist verdammt?«, fragte Pampe. Sie schenkte ihm ein Lächeln, das vermutlich einnehmend sein sollte. Sie war eine anziehende Frau, aber die fehlenden Schneidezähne und die Narbe auf ihrem Gesicht führten dazu, dass ihr einnehmendes Lächeln stets ein wenig wild wirkte.
Pampe und der Hauptmann hatten ein besonderes Verhältnis zueinander. Er überlegte, ob er ihr vertrauen sollte – aber er war jetzt der Hauptmann sehr vieler Menschen.
Stattdessen stellte er die Füße auf den kalten Steinboden. »Egal. Hol mir Toby, ja?«
Sie grinste anzüglich. »Ich bin sicher, ich könnte Euch ebenfalls ankleiden.«
»Vielleicht könntest du es, vielleicht auch nicht, aber beides geht mir nicht schnell genug.« Er stand auf, war völlig nackt, da machte sie eine abwehrende Handbewegung und verließ den Raum, um nach Toby zu suchen.
Toby und Michael trafen gleichzeitig ein. Toby hatte Kleidung dabei und Michael einen Becher mit dampfend warmem Wein; er war noch so schläfrig, dass es ihn ungeschickt machte.
Der Hauptmann rüstete sich im rötlichen Licht der Morgensonne. Michael hatte Mühe mit den vielen Schlaufen und Bändern, sodass das Anlegen der Rüstung doppelt so lang wie gewöhnlich zu dauern schien, und der Hauptmann bedauerte bereits, Pampe weggeschickt zu haben. Doch schließlich lief er leichtfüßig die Treppe zum großen Hof hinunter, und als das Pferd herausgeholt wurde, tätschelte er Grendels Schnauze. Er setzte dem Tier den großen Kopfschutz auf, zog sich selbst die Panzerhandschuhe an und sprang in Grendels Kriegssattel. Er gab seinen Männern ein gutes Beispiel und ritt aus der Festung heraus und ins Unbekannte.
Als er den Kopf unter dem niedrigen Sturz des Ausfalltores hinwegduckte – auf seine Anordnung blieb das Haupttor geschlossen – kam ihm der Gedanke, dass er wie ein vollkommener Narr dastehen würde, falls sie nicht angegriffen werden sollten. Doch dieser Gedanke wurde sofort von dem Bild eines krallenbewehrten Fußes gefolgt, das die Eingeweide aus seinem Reitpferd riss. Sein Magen drehte sich um, und ihm wurde kalt.
Er ritt den steilen Weg hinunter und lehnte sich dabei gegen den hohen Rücken seines Kriegssattels, während ihm Mutwill Mordling, Pampe, Michael Rankin und Gelfred voll gerüstet folgten. Am Fuß des Hügels wandte er sich von der Brücke ab und ritt nach Westen – nicht auf den schmalen Pfad, auf dem er dem Dämon gefolgt war, sondern er umrundete die Fundamente der Festung.
Langsam ritt er um sie herum und spähte so aufmerksam aus der Feindesperspektive hoch zu den Palisaden, dass ihm bald der Nacken wehtat. Die Festung erhob sich hundert Fuß über ihm; sie war gewaltig, beeindruckend und sehr, sehr hoch.
Nachdem er den Bergfried passiert hatte, wurde die erste Geschossmaschine abgefeuert. Er hörte das Knirschen des Gegengewichtes, als es abgebremst wurde, und sah den Felsbrocken, der auf dem Scheitelpunkt seiner Flugbahn stehen zu bleiben schien. Dann flog er weiter nach Westen.
Der Hauptmann wandte sich an Mutwill Mordling. »Geh und stell einen orangefarbenen Pfahl dort auf, wo der Brocken niedergegangen ist.«
»Immer ich«, brummte Mutwill, tat aber, was ihm befohlen worden war.
Der Rest setzte die Umrundung der Fundamente fort. Zwei weitere Schleudern wurden probehalber in Gang gesetzt, und beide Male schickte der Hauptmann Mutwill los, um den Einschlag zu kennzeichnen.
»Das wird eine harte Nuss für unsere Feinde«, sagte Pampe plötzlich.
»Einige von ihnen haben Flügel«, erwiderte der Hauptmann und nickte heftig, denn in seiner Rüstung konnte er nicht mit den Schultern zucken. »Aber mit unseren Kämpfern auf den Mauern und all unseren Verteidigungsanlagen sollten wir in der Lage sein, die Festung so lange zu halten, bis wir verhungern.« Er sah an ihr vorbei. »Wir werden zuerst die Unterstadt und dann die Brückenburg verlieren. Aber … vorher wird uns der König zu Hilfe kommen.«
Mit diesen Worten beugte er sich im Sattel nach vorn und führte die anderen in langsamem Tritt über die Felder zur Brückenburg.
Milus begrüßte sie in voller Rüstung am Turmtor. Hinter ihm auf der Brücke befanden sich ein Dutzend schwer mit Waren beladene Wagen und fünfzig oder mehr Männer und Frauen, die allesamt so bleich wie Pergament waren. Kaufleute.
»Sie wollen zum Jahrmarkt«, sagte Milus und schnitt eine Grimasse. »Sie sagen, hinter ihnen kämen noch fünf Wagenzüge.«
Der Hauptmann drehte sich um und sah Michael an, der das Gesicht verzog. »Wir haben noch nicht einmal alle Bauern in Sicherheit gebracht. Fünfzig, sagt Ihr? Und ihre Wagen auch?«
»Und ich wette, sie haben nichts zu essen«, meinte der Hauptmann. »Sicherlich sind ihre Karren mit Kleidung und kostbaren Gütern beladen, weil sie hergekommen sind, um Getreide zu kaufen.« Er sah sich um. »Wie viele Mäuler kannst du noch stopfen, Milus?«
Der alte Ritter kniff die Augen zusammen. »Sie alle«, gab er zu, »und vielleicht noch weitere dreißig. Aber ich brauche mehr Getreide, mehr Pökelfleisch und noch etliches andere. Außer Wasser. Davon haben wir genug, da wir es aus dem Fluss schöpfen können.«
Der Hauptmann begab sich wieder den Hügel hinauf und erstattete der Äbtissin Bericht. Ein schwerer Kriegswagen wurde in Einzelteilen aus dem Keller hochgeholt, zusammengesetzt und mit Proviant beladen, dann an einer Seilwinde Zoll für Zoll heruntergelassen. Inzwischen legte der Hauptmann seine Rüstung ab und übergab sie seinem Knappen. Seine Hüften schmerzten, und sobald er sich von dem Metall ganz befreit hatte, fühlte er sich so leicht, als könnte er wegfliegen.
Noch während sie die Vorräte für die untere Burg aufstockten, trafen weitere Kaufleute ein. Manche waren über die Behinderung des Handels wütend, andere hatten ohne Zweifel Angst. Der Hauptmann begab sich wieder den Hügel hinunter und verschwendete den Morgen damit, die Neuankömmlinge zu beruhigen. Er riet ihnen, eine Abordnung hoch zur Äbtissin zu schicken.
Dann kletterte er selbst wieder zur Festung hinauf und vergrub sich in der Kommandantur, einer kleinen Zelle mit einer Tür, die auf den Hof hinausführte, sowie mit zwei Bogenfenstern, die durch eine kannelierte Säule getrennt waren. Die offenen Fenster ließen die Frühlingsluft herein, in der der Duft von Wildblumen und Jasmin lag. Über die niedrigeren Hügel konnte er fünfzehn Meilen weit nach Osten sehen.
Heute wandte er sich nicht den Pergamentrollen voller Berechnungen zu, die auf ihn warteten, sondern schnallte sein Schwert ab, hängte es an einen mannshohen Kerzenleuchter und stützte sich mit den Ellbogen auf dem linken Fenstersims ab.
Stiefelschritte kündigten das Kommen Michaels an. »Eure Rüstung«, sagte der junge Mann leise.
Der Hauptmann drehte sich um und sah zwei Bogenschützen mit einem schweren Weidenkorb, während sein Diener den Arm voller zurechtgeschnittener Hölzer hatte. Die Bogenschützen stritten sich darum, welcher Zapfen in welche Bohrung gehörte, und der Diener gab ihnen lässig und mit unbeteiligter Miene stets das richtige Holz, auch wenn die Schützen um das falsche baten. Bevor die Sonne einen Fingerbreit weitergewandert war, hatten sie einen Ständer für die Rüstung des Hauptmanns aufgestellt. Das Gestell war ein wenig größer als er selbst, und Michael hängte nun die Rüstungsteile vorsichtig an das hölzerne Gebilde. Ein gutes Gestell konnte einem Kämpfer wertvolle Minuten beim schnellen Anlegen der Rüstung verschaffen. Und da jeder Zoll der Festung inzwischen mit Soldaten und Flüchtlingen belegt war, diente das Kommandozimmer des Hauptmanns gleichzeitig auch als sein Schlafzimmer.
Als die Bogenschützen und der Diener das Zimmer verließen und der Aufruhr ein Ende gefunden hatte, kehrte der Hauptmann zu seinem Fenster zurück.
»Ist das alles, Ser?«, fragte Michael.
»Gut gemacht, Michael«, meinte der Hauptmann.
Der junge Mann zuckte zusammen, als ob er gebissen worden wäre. »Ich … das heißt.« Er lachte. »Euer Diener Jacques hat das meiste getan.«
»Es ehrt dich noch mehr, dass du ihm die Ehre lässt«, bemerkte der Hauptmann.
Kühner geworden, trat Michael sehr langsam vor und beugte sich aus dem rechten Fenster. Sein schleichender Gang war dem der Konventskatze, die der Hauptmann am Morgen beim Stibitzen eines Stücks Käse beobachtet hatte, nicht unähnlich. Er lächelte. Michael brauchte genauso lange, sich im Fenster niederzulassen, wie die drei Männer zum Aufstellen des Ständers benötigt hatten. »Wir sind jetzt ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt«, sagte Michael vorsichtig.
»Hm. Kein Kommandant, dem eine Belagerung bevorsteht, hält sich für ›ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt‹«, meinte der Hauptmann.
»Und jetzt warten wir ab?«, fragte Michael.
»Bist du ein Knappe oder ein Hauptmannslehrling?«, fragte der Hauptmann.
Michael richtete sich auf. »Ich verstehe nicht, Ser.«
Der Hauptmann grinste schelmisch. »Ich habe nichts gegen eine kluge Frage, vor allem dann nicht, wenn sie mir beim Nachdenken hilft. Und ich muss nachdenken, junger Michael. Die Pläne kommen mir nicht voll entwickelt in den Sinn. Als Nächstes werden wir eine mächtige Magie benutzen – etwas Schweres, Ernstes und Gewaltiges. Die Archaiker haben sie oft eingesetzt. Alle Geschichtsschreiber erzählen von ihr, aber in den Romanen und Ritterepen wird sie nie erwähnt.«
Michael zog ein Gesicht, das dem Hauptmann deutlich machte, dass das Interesse seines Knappen nicht so leicht zu ködern war.
»Was soll das für ein Zauberspruch sein?«, fragte Michael.
»Kein Zauberspruch«, entgegnete der Hauptmann. »Aber es ist trotzdem eine Art Magie. Wir haben Nahrungsmittel und Waffen, wir haben die Befestigungsanlagen verstärkt, und der Feind steht noch nicht vor den Toren. Was also sollen wir jetzt tun?«
»Den Rest der Bauern in die Festung holen?«, meinte Michael.
»Nein, das ist schon geschehen.«
»Wälle vor der Festung errichten?«
»Dazu haben wir nicht genügend Männer.« Der Hauptmann hielt inne. »Aber eigentlich ist das keine schlechte Idee.«
Michaels Ungeduld war deutlich zu bemerken. »Sollten wir vielleicht einen zahmen Dämon beschwören?«, fragte er.
Der Hauptmann kratzte seinen Spitzbart. »Nein«, antwortete er, »aber wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich es möglicherweise tun.«
Michael zuckte mit den Achseln.
»Zwei Worte«, half ihm der Hauptmann.
Michael schüttelte den Kopf. »Höhere Mauern?«, fragte er und klang dabei gereizt, denn er wusste, dass es eine dumme Antwort war.
»Nein.«
»Mehr Pfeile?«
»Nicht schlecht, aber nein.«
»Verbündete suchen?«, fragte Michael.
Darauf schwieg der Hauptmann eine Weile und wandte den Blick nach Osten. »Wir haben unsere Verbündeten schon gerufen, aber auch das ist keine schlechte Idee«, sagte er. »Vielleicht sollte ich ihr nachgehen.« Er sah den in modisches Grün gekleideten Adelsspross an und fügte hinzu: »Nein.«
»Verdammt«, sagte Michael. »Darf ich aufgeben?«
»In deiner Eigenschaft als Knappe oder als Hauptmannslehrling?«, fragte der Rote Ritter. »Nicht ich habe damit angefangen, sondern du warst es.« Der Hauptmann nahm das kleine Abzeichen seines Amtes auf, das er fast nie trug. Es hatte dem vorherigen Hauptmann gehört und besaß eine gewisse Geschichte und Amtsgewalt – sogar so viel davon, dass der Hauptmann vermutete, es könnte mit einem Phantasma belegt sein. »Du verfügst über ungefähr einunddreißig Lanzen, sechzehn ältere, aber fähige Sergeanten und eine gut gebaute, aber auch ältere Festung auf gutem Boden. Du musst eine Furt, eine Brücke, einen beständigen Strom von entsetzten Kaufleuten und eine verwundbare Unterstadt mit unzureichenden Mauern verteidigen. Eröffne mir deinen Plan. Wenn er gut genug ist, werde ich ihn als den meinen ausgeben und in die Tat umsetzen. Es gibt viele dumme Antworten, aber es gibt nicht die eine und einzig richtige Antwort. Wenn deine Antwort gut ist, wirst du weiterleben und ein wenig Geld machen. Wenn deine Antwort aber schlecht ist, wirst du versagen und sterben, und mit dir werden etliche unschuldige Nonnen und Bauersleute sterben.« Der Hauptmann schenkte ihm einen seltsamen Blick. »Ich möchte deine Antwort jetzt hören.«
Michael wuchsen bereits so viele Haare am Kinn, dass man es einen Bart nennen konnte, und damit spielte er eine Weile, bevor er sagte: »Bezogen auf unsere augenblickliche Situation? Mit guter Versorgungslage und so weiter?«
Der Hauptmann nickte.
»Schickt Boten um Hilfe aus. Schafft Euch Verbündete unter den örtlichen Herrschern. Versiegelt die Festung, sagt den Kaufleuten vor dem Tor, sie sollen sich aufhängen, und bereitet Euch auf den Feind vor.« Michael betrachtete die Wälder im Osten und dachte weiter nach.
»Boten sind bereits ausgeschickt. Verbündete kosten Geld, und unser Gewinn aus diesem Unternehmen ist sehr gering. Bevor wir diese Anstellung erhalten haben, ging es uns äußerst schlecht. Die moralische Seite möchte ich erst gar nicht behandeln. Wir können die Kaufleute für ihren Schutz zahlen lassen und das Geld mit der Äbtissin teilen. Das wäre nur gerecht, denn es ist ihre Festung, und es sind unsere Waffen.« Der Hauptmann blickte aus dem Fenster auf die fernen Wälder.
Die Sonne zog über den Himmel.
»Ich gebe auf«, gestand Michael ein. »Es sei denn, es handelt sich um etwas so Einfaches wie mehr Felsbrocken für die Belagerungsmaschinen oder mehr Wasser.«
»Ich glaube, ich muss froh sein, dass du es nicht herausgefunden hast, mein Junge, denn du bist sehr klug, und deine Familie hat eine Menge Kriegserfahrung. Wenn du es nicht siehst, dann werden sie es vielleicht auch nicht sehen.« Der Hauptmann deutete aus dem Fenster.
»Sie? Die Kreaturen der Wildnis?«, fragte Michael leise.
Der Hauptmann kratzte sich wieder am Bart. »Unentwegtes Patrouillieren, Michael. Unentwegtes Patrouillieren. Damit beginnen wir in sechs Stunden. Ich schicke unsere Lanzen los, die sich so schnell wie möglich bewegen – in alle Richtungen, aber hauptsächlich nach Osten. Ich will mich mit dem Gelände vertraut machen, will herausfinden, wo unser Feind steckt und ihn dann aus dem Hinterhalt überfallen, bedrängen, ärgern und reizen, bis er anderswohin geht und sich eine leichtere Beute sucht. Wenn er aber beschließen sollte, hierherzukommen und uns zu belagern, dann soll er eine Spur aus Blut – oder was auch immer seine Kreaturen anstelle von Blut in sich haben – durch den Wald ziehen.«
Michael betrachtete seine Hände, die zitterten. »Ihr habt vor, in die Wildnis hinauszuziehen?«, fragte er ungläubig? »Schon wieder?«
»Wenn sich unsere Gelegenheit in den Wäldern befindet, dann werde ich sie dort ergreifen«, erwiderte der Hauptmann. »Du glaubst, der Feind ist zehn Fuß groß und besteht aus Diamant. Ich hingegen glaube, dass er eine Gruppe von Menschen als Diener, Bogenschützen und Waldläufer hat, die so wenig Ahnung vom Kriegshandwerk besitzen, dass ich ihre Herdfeuer von hier aus sehen kann.« Der Hauptmann legte die Hand auf die Schulter seines Knappen. »Was glaubst du wohl, warum sich der Hauptteil unserer Feinde im Osten aufhält?« Er blickte wieder hinaus.
Michael stieß einen Pfiff aus. »Heiliger Georg. Haben sie sich an uns vorbeigeschlichen?«
Der Hauptmann lächelte. »Gut geraten, junger Michael. Unser Feind hat uns umgangen – das verdanken wir unseren Vorbereitungen und unserem kleinen Ausfall. Aber eine Festung darf man nicht umgehen, und genau das werde ich ihm noch beibringen.« Er lächelte und offenbarte für einen Augenblick seine Jugend. »Es sei denn, es ist eine verdammte Falle.«
Michael schluckte.
»Zumindest sind dort auch seine menschlichen Verbündeten – im Osten. Zeig nicht dorthin. Ich vermute, dass auch einige der Vögel Spione sind.« Der Hauptmann wandte sich vom Fenster ab.
»Dann sehen sie alles, was wir tun!«, entsetzte sich Michael.
»Alles«, sagte der Hauptmann mit deutlicher Befriedigung. »Geh zum Refektorium, hol ein wenig Pergament und schreib mir eine Liste mit all deinen Gedanken im Zusammenhang mit der Verteidigung dieses Ortes. Und danach wirst du ein wenig polieren.« Er lächelte. »Aber zuerst holst du mir Wein.«
»Ich hatte Angst«, platzte Michael hervor. »Beim Kampf gegen den Lindwurm. Ich hatte so große Angst, dass ich mich kaum bewegen konnte.« Er atmete schwer. »Ich kann es einfach nicht vergessen.«
Der Hauptmann nickte. »Ich weiß«, sagte er.
»Aber das wird besser werden, nicht wahr? Ich meine … ich werde mich an so was doch bestimmt gewöhnen, oder?«, fragte er.
»Nein.« Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Niemals. Daran wirst du dich nie gewöhnen. Du wirst zittern, dich übergeben, dir in die Hose machen, und zwar jedes einzelne Mal. Allerdings wirst du dich an die Macht der Angst und an das Einsetzen des Schreckens gewöhnen. Du wirst lernen, dass du ihm entgegentreten kannst. Und jetzt hol mir Wein, trink selbst ein paar Becher und mach dich wieder an die Arbeit.«
»Ja, Mylord.«
Es gab einen beständigen Fluss von Menschen und Material, der über den Berghang von der Festung zur Brückenburg und zurück verlief. Die Kriegsmaschinen auf den Türmen schossen probeweise auf die Felder, und vertrauenswürdige Korporäle unternahmen Patrouillen in die Umgebung – vorsichtige Patrouillen auf schnellen Pferden. Die am nächsten wohnenden Bauern hatten auf die Alarmglocken und den gestrigen Ruf schnell reagiert, und Abbington, der größte Ort in der Nähe, war geräumt worden. Aber die Entfernteren hatten bloß Kinder hergesandt, die kundschaften sollten, und niemand hatte sein wertvolles Getreide abgegeben, es sei denn, die Soldaten hatten es selbst geholt. Die Patrouillen mussten den Bauern immer wieder erklären, dass es sich nicht nur um eine Übung handelte.
Und die reicheren Freisassen hatten noch ganz andere Fragen.
»Wer wird uns das Getreide bezahlen?«, wollte ein starker Mann mittleren Alters mit kräftigen Bogenschützenarmen und braunen Haaren wissen. »Das hier ist mein ganzer Besitz, Ser Ritter – mein Schatz. Was wir uns über den Winter vom Munde absparen, wird zu Silber, wenn im Frühjahr die Kaufleute kommen. Wer wird jetzt dafür bezahlen?«
Der Hauptmann verwies in all solchen Fragen fest und gelassen auf die Äbtissin.
Als die Sonne am dritten Tag unterging, quollen die Keller vor Getreide über. Weitere Zentner lagen am Fuß des steil den Hügel hinaufführenden Weges, wo ein Karren zusammengebrochen war. Deshalb wurde nun jeder Wagen, der hinauf- oder hinunterfuhr, an der Seilwinde festgebunden – und das Haupttor hatte aus diesem Grund andauernd offen gestanden.
Das heruntergefallene Getreide hatte die seltsame Nebenwirkung, Vögel aus dem Himmel zu locken, die diese kostenlose Wohltat aufpickten. Einige Bogenschützen, die von Gelfred angeführt wurden, warfen Netze über sie.
Die Festung war so voller Menschen, dass einige Männer und Frauen trotz der Kälte des Abends auf den strohbedeckten Steinfliesen schlafen mussten. Fackeln brannten überall im Hof, in dessen Mitte ein Scheiterhaufen entzündet worden war. Sein flackerndes orangefarbenes Licht wurde von den Türmen, dem Bergfried und den glitzernden Fenstern des Dormitoriums widergespiegelt. Hühner – Hunderte von ihnen – rannten durch den Hof und über die Felsen des Vorsprungs hinter dem Tor. Schweine wühlten im Abfall des Konvents am Fuß des Hügels; es waren beinahe zweihundert. Der Schafspferch an der Ostmauer war ebenfalls brechend voll, und im letzten Licht des Tages sah der Mann, der am Fenster des Äbtissinnengemachs stand, das Glitzern eines Dutzends bewaffneter Männer und genauso viele Bogenschützen, die weitere tausend Schafe von den Gehöften im Osten herbeibrachten.
Der Hauptmann beobachtete vom Fenster der Äbtissin aus die Patrouillen, die Schafe und das endgültige Schließen des Tores. Seine Blicke folgten Bents markanter Gestalt, als der große Bogenschütze die Wache auf dem Bergfried auswechselte und die abtretenden Soldaten um die runden Mauern herumführte, während ausgeruhte Männer an ihre Stelle traten. Es war eine bestechende und wirksame Zeremonie, die großen Eindruck auf die Bewohner des Ortes machte, die in ihrem ganzen Leben wohl noch nie zuvor so viele bewaffnete Männer gesehen hatten.
Der Hauptmann seufzte. »Innerhalb der nächsten Stunde wird die erste Jungfrau ihre Unschuld und der erste Bauer sein Gehöft beim Würfelspiel verloren haben«, sagte er.
»In dieser Lage denkt Ihr an Jungfrauen?«, fragte die Äbtissin.
»Oh, ich selbst befinde mich weit außerhalb solch irdischer Belange.« Der Hauptmann sah weiter zu und lächelte.
»Ihr macht Euch Sorgen, weil wir noch nicht angegriffen wurden«, bemerkte die Äbtissin.
Der Hauptmann schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Ich würde mich lieber zum Narren machen, sodass jeder Soldat Albias über mich lacht, als von den Geschöpfen der Wildnis belagert zu werden«, erwiderte er. »Ich weiß nicht, wo sie sich in diesem Augenblick befinden, und es ist mir auch nicht klar, warum sie es zugelassen haben, dass wir die Menschen in Sicherheit bringen konnten. In meinen dunkelsten Momenten befürchte ich, dass unsere Mauern schon untergraben wurden oder wir eine Legion von Verrätern innerhalb unserer Mauern beherbergen.« Er hob die Hand und machte eine abwehrende Geste. »Aber um die Wahrheit zu sagen, ich kann nur hoffen, dass sie genauso wenig über uns wissen wie wir über sie. Vorgestern waren wir noch ein leichter Gegner. Aber heute könnten wir ein ganzes Jahr durchhalten, falls uns nicht die schiere Angst überwältigt.« Er betrachtete ihr sorgenvolles Gesicht.
Sie zuckte die Achseln. »Wie alt seid Ihr, Hauptmann?«
Diese Frage war ihm offenbar unbehaglich.
»Wie viele Belagerungen habt Ihr bereits mitgemacht?«, wollte sie wissen. »Wie vielen Kreaturen der Wildnis habt Ihr im Kampf schon gegenübergestanden?« Sie wandte sich ihm zu, machte einen Schritt nach vorn und ließ nicht locker. »Ich bin die Tochter eines Ritters, Hauptmann. Ich weiß, dass das keine höflichen Fragen sind, aber bei Gott, ich habe das Gefühl, ein Recht auf die Antwort zu haben.«
Er lehnte sich gegen die Wand, kratzte sich kurz unter dem Kinn und starrte ins Nichts. »Ich habe mehr Menschen als Ungeheuer getötet. Ich habe eine einzige Belagerung erlebt, und wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass wir sie im zweiten Monat abgebrochen haben. Ich bin …« – er sah ihr tief in die Augen – »… zwanzig Jahre alt.«
Der Laut, den sie nun von sich gab, lag irgendwo zwischen einem zufriedenen »Hm« und einem verächtlichen Schnauben.
»Aber das wisst Ihr doch bereits durch Eure Gabe der Weissagung.« Er drückte sich von der Wand ab und richtete sich auf. »Ich mag zwar noch jung sein, aber ich habe schon fünf endlose Jahre des Krieges hinter mir. Und mein Vater …« Er hielt inne. Nun kam es zu einem langen Schweigen.
»Euer Vater?«, fragte sie leise.
»Er ist ein berühmter Soldat«, sagte er mit noch leiserer Stimme.
»Ich habe meine Verteidigung einem Kind anvertraut«, sagte die Äbtissin und schürzte die Lippen in Selbstironie.
»Einem Kind mit einer ausgezeichneten Lanzentruppe. Um ehrlich zu sein, gibt es in ganz Albia keinen besseren Söldnerhauptmann. Ich weiß, was ich tue. Ich habe es schon früher getan und beobachtet. Außerdem habe ich im Gegensatz zu meinesgleichen die Kriegskunst eingehend studiert. Ich habe mich mit ihnen allen beschäftigt – mit Maurikos und Leo und Nikephoros Phokas, sogar mit Vegetius. Und wenn ich so sagen darf: Es ist inzwischen zu spät, Euch noch anders zu entscheiden.«
»Ich weiß«, sagte sie. »Ich habe Angst.« Sie trank ihren Wein und ergriff plötzlich seine Hand. »Ich bin fünfzig Jahre alt«, gestand sie. »Und habe noch nie eine Belagerung mitgemacht.« Sie ließ seine Hand los und biss sich auf die Lippe. »Habt Ihr auch Angst?«
Er ergriff ihre Hand wieder und küsste sie. »Immer. Vor allem und jedem. Meine Mutter hat mich zum Feigling erzogen. Sie hat mir sehr sorgsam beigebracht, alles zu fürchten. Einschließlich ihrer eigenen Person. Seht Ihr, nun werdet Ihr zu meiner Beichtigerin. Meiner Meinung nach ist Feigheit die beste Schule des Mutes.«
Sie musste lächeln. »Ihr seid ein kluger Kopf. Vade retro.«
Er nickte. »Aber ich bin zu müde dafür.«
Ihr Lachen und ihre Unterhaltung setzten sich fort, bis er und sie den Rest ihres Weins getrunken hatten. Schließlich sagte sie, nachdem sie aus dem Fenster geblickt hatte: »Und was fürchtet Ihr am meisten?«
»Das Versagen«, antwortete er und lachte über seine eigenen Worte. »Aber von allen Menschen in dieser Festung bin ich vermutlich der Einzige, der keine Angst vor der Wildnis hat.«
»Ist das ernst gemeint?«, fragte sie.
Er starrte eine Weile ins Kaminfeuer. »Ja«, sagte er dann mit einem Seufzer. »Ich muss einen Blick auf die Wachen werfen. Heute Abend habe ich einen kühnen Versuch gewagt. Ich muss dafür sorgen, dass meine Leute nicht unvorbereitet sind. Ihr wisst, dass der Feind zu unserer Beobachtung Tiere einsetzt?«
»Ja«, sagte sie sehr leise.
»Was wisst Ihr sonst noch, Mylady? Etwas, das Eurem sehr jungen Hauptmann dabei helfen könnte, Eure Festung zu schützen?« Er beugte sich zu ihr.
Sie wandte den Blick ab. »Nein«, sagte sie nur.
Er stellte seinen Weinbecher mit einem klackenden Geräusch auf dem Eichentisch ab. »Ich habe Euch die Wahrheit gesagt.«
»Dann sollten wir jetzt unsere Kräfte aufstellen«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln. »Geht und schaut nach Euren Wachen. Meine wenigen und schäbigen Geheimnisse sind für unsere Belagerung nicht von Belang.«
Er verneigte sich, und sie entließ ihn mit einer knappen Handbewegung. Er begab sich nach draußen zur Treppe. Es war dunkel.
Ihre Tür schloss sich, und nun tastete er sich die Stufen hinunter, als sich plötzlich eine fremde Hand um die seine legte.
Er hatte sie sofort erkannt und hob die Hand an seine Lippen – so schnell, dass sie nicht mehr weggezogen werden konnte. Er hörte den Seufzer des Mädchens.
In diesem Augenblick dachte er daran, sie einfach gegen die Steinwand zu drücken. Aber es kam ihm in den Sinn, dass sie möglicherweise auf Anordnung der Äbtissin hier war, und es wäre mehr als grob, die Novizin vor der Tür der Äbtissin zu attackieren. Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, bevor sich ihre Lippen auf die seinen legten und ihre Hände gegen seine Schultern drückten.
Sein Herz klopfte heftig, sein Hirn schien leer geworden zu sein.
Nun spürte er ihre Macht. Als sich ihre Körper gegeneinanderdrückten und ihre Zunge die seine liebkoste, erschufen sie beide diese Macht.
Sie beendete den Kuss, trat von ihm zurück – die plötzliche Abwesenheit von Wärme in der Finsternis – und sagte: »Jetzt sind wir quitt.« Dann ergriff sie seine Hand. »Kommt mit.«
Sie führte ihn die dunklen Steinstufen hinunter und durch die Halle. Die Scheiterhaufen im Hof ließen die Bleiglasfiguren in den Fenstern zucken und flackern, als wären sie lebendig, und launische Regenbögen spielten über den Boden. Nach der vollkommenen Finsternis auf der Treppe schien die Halle hell erleuchtet zu sein.
Die Novizin führte ihn zu den Büchern. Auf halbem Weg durch die Halle küssten sie sich erneut. Niemand hätte zu sagen vermocht, von wem dieser Kuss ausgegangen war. Aber als seine Hand über ihr Leibchen fuhr, trat sie einen Schritt zurück.
»Nein«, sagte sie. »Ich will Euch nur etwas zeigen. Ich bin nicht Eure Hure.«
Aber sie hielt seine Hand fest und führte ihn zu dem Buch. »Habt Ihr es schon gesehen?«, fragte sie.
»Ja.«
»Habt Ihr es auch verstanden?«, wollte sie wissen und durchblätterte es.
»Nein«, gab er zu. Es gibt für einen jungen Mann nichts Schlimmeres, als dem Objekt seiner Zuneigung eingestehen zu müssen, wie wenig er weiß.
Die Andeutung eines Lächelns spielte um ihre Mundwinkel. »Ihr seid einer von uns, nicht wahr? Ich kann es spüren.«
Sein Blick ruhte zunächst auf ihr, doch als sie das Buch eingehender ansah, tat er es ihr gleich. Er betrachtete den Schmelztiegel in der Hand des heiligen Pancreas. Und folgte dem ausgestreckten Finger des Heiligen bis zu einem Diagramm weiter unten auf der Seite – einem Baum.
Er blätterte zu einer anderen Seite um, auf der ein weiterer Heiliger auf etwas deutete – diesmal war es eine Wolke.
»Ist das eine Probe?«, fragte er.
Sie lächelte. »Ja.«
»Dann vermute ich, dass das Buch ein Rätsel ist. Die Dinge, auf die die Heiligen deuten, sind nichts anderes als die Umrisse einer Schablone, die, wenn man sie über die Schrift legt, die Stellen hervorheben, die sich der Leser vergegenwärtigen soll.« Er fuhr mit dem Finger über die Buchstaben, die neben dem heiligen Eustachius standen. »Es ist ein Grimoire.«
»Ein fantastisch gründliches, verschlüsseltes, auf sich selbst verweisendes Grimoire«, sagte sie und biss sich auf die Zunge, was er in diesem Augenblick als ungeheuer erotisch empfand. Er streckte die Arme nach ihr aus und wollte sie wieder küssen, doch jetzt machte sie eine abwehrende Bewegung, wie Frauen es tun, wenn ein Kind ermüdend wird. »Kommt«, sagte sie.
Er folgte ihr zurück durch die Halle. Ihm war durchaus bewusst, dass er seine Wachen beaufsichtigen musste und das Kommando bei dieser Belagerung innehatte. Doch in ihrer Hand lag ein so großes Versprechen. Die Haut war zart und rau zugleich – die Hand einer Frau, die hart arbeitete. Und doch war sie so glatt wie die Oberfläche einer guten Rüstung.
Sie ließ seine Hand in dem Augenblick los, in dem sie die Tür zum Hof öffnete, und schon standen sie wieder im Licht.
Er wollte etwas zu ihr sagen, hatte aber keine Ahnung, was er ihr sagen sollte.
Sie drehte sich um und sah ihn an. »Ich will Euch noch etwas zeigen«, sagte sie.
Während sie sprach, zog sie eine Kutte aus Nicht-Sehen um sich.
Nun wurde er in anderer Weise auf die Probe gestellt.
Er begab sich in den Palast seiner Erinnerung und tat das Gleiche. Er verweilte dort lange genug, um zu bemerken, dass ihn Prudentia mit heftigem Missfallen ansah und sich der grüne Frühling draußen vor seiner Eisentür zu einem Sturm epischen Ausmaßes zusammenballte.
Und dann huschten sie quer durch den Hof. Sie waren fast unsichtbar; nur eines der Lanthorn-Mädchen, das sich zusammen mit einem jungen Bogenschützen drehte, sah den Hauptmann offenbar deutlich, denn sie vermied es in ihrem Tanz geschickt, ihm zu nahe zu kommen.
Aber er wurde nicht aufgehalten.
Die Novizin blieb vor der eisenbeschlagenen Tür des Dormitoriums stehen, während er sein Phantasma veränderte, sodass es sich mit dem ihren verband. Das war eine sehr vertrauliche Geste. So etwas hatte er außer mit Prudentia noch mit niemandem gemacht; ihr Anblick hatte ihn auf diesen Gedanken gebracht.
Sie hat immer gesagt, dass der Geist ein Tempel, eine Herberge, ein Garten und ein Klohäuschen ist und die magische Verbindung zu einem anderen Zauberer oder einer Zauberin mit Verehrung, Vertraulichkeit, Geschlechtlichem und Ausscheidungen zu tun hat.
Als seine Macht die ihre berührte, nahm diese die seine in sich auf, und sie waren miteinander verbunden.
Er zuckte zusammen.
Sie zuckte ebenfalls zusammen.
Und dann befanden sie sich im Dormitorium und standen in einer kleinen Diele, in der die älteren Nonnen bei seinen früheren Besuchen gesessen und Handarbeiten gemacht oder gelesen hatten. Hier war es hell. Die meisten der Nonnen befanden sich draußen im Hof, nur zwei saßen in aller Stille hier.
»Seht sie Euch an«, sagte Amicia. »Seht nur.«
Er musste nicht allzu angestrengt hinschauen. Ranken aus Macht umspielten sie.
»Habt ihr alle die Macht?«, fragte er.
»Jede einzelne«, antwortete sie. »Kommt.«
»Wann werde ich dich wiedersehen?«, gelang es ihm zu fragen, als sie ihn nach draußen und an die nördliche niedrige Ringmauer hinter den Stallungen führte. Hier wuchs ein Apfelbaum in einem steinernen Trog, der in die Mauer eingebaut war. Eine Bank umgab das Ganze.
Amicia setzte sich darauf.
Er war so verwirrt, dass er gar nicht erst versuchte, sie wieder zu küssen; also nahm er einfach neben ihr Platz.
»Seid ihr allesamt Hexen?«, fragte er.
»Das ist ein hässliches Wort aus Eurem Munde, Hexer«, sagte sie. »Magier. Zauberer.« Sie schaute über die niedrige Mauer.
Tief im Osten sah er einen schwachen orangefarbenen Fleck, der ihn sofort an seine Pflichten erinnerte. »Ich muss gehen«, sagte er. Er wollte sie beeindrucken – und er wollte gleichzeitig nicht so wirken, als ob er sie beeindrucken wollte. »Ich habe einige Leute mit einer besonderen Aufgabe losgeschickt, die ich eigentlich selbst hätte übernehmen sollen«, platzte es aus ihm heraus.
Sie schien ihm nicht zugehört zu haben. »Ich dachte, Ihr müsst wissen, worum es eigentlich geht«, sagte sie. »Und ich glaube nicht, dass sie es Euch sagen wird. Dies hier ist ein Ort der Macht. Die Meister unseres Ordens haben ihn mit mächtigen Frauen und Gegenständen besetzt. Und nun strahlt er wie ein Leuchtturm.«
Bei ihren Worten fühlte er sich blind und dumm. Prudentias Regeln für die Macht und deren Anwendung, die in einer Welt, die den Magiern misstraute, große Weisheit darstellte, hatte ihm diese Erkenntnis verwehrt.
»Entweder das, oder sie wollte, dass ich es Euch sage«, fügte Amicia hinzu. Zum ersten Mal an diesem Abend ließ sie den Kopf hängen.
»Oder sie hat erwartet, dass ich es selbst herausfinde«, sagte er bitter. Er fühlte das Verstreichen der Zeit, als hielte er ein Stundenglas in der Hand. Er spürte die Reiter, die nach Westen in den Wald huschten, er spürte auch die mangelnde Wachsamkeit seiner Wachen, er spürte tausend vergessene Einzelheiten wie ein Gerank aus Macht, das um seine Soldaten lag und ihn von Amicias Seite fortzerrte. Und das Glimmen tief im Osten – was war das?
Dann spürte er sie wieder, und er war wie mit einer Kette an die Bank gefesselt.
»Ich muss gehen«, sagte er abermals. Doch seine Jugend und seine eigene Hand verrieten ihn, und wieder lag er in ihren Armen – oder sie in den seinen.
»Ich will das nicht«, sagte sie, als sie ihn erneut küsste.
Er machte sich frei von ihr, brach das Band zwischen ihnen mit einem einzigen Gedanken und wich vor ihr zurück. »Kommst du oft hierher?«, fragte er mit heiserer Stimme. »Zu diesem Baum?«
Sie nickte; es war in dem Zwielicht kaum zu sehen.
»Ich könnte dir schreiben«, sagte er. »Ich will dich wiedersehen.«
Sie lächelte. »Ihr könnt mich jeden Tag sehen«, sagte sie. »Ich will das aber nicht. Ich brauche es nicht. Ihr kennt mich nicht. Wir sollten voneinander lassen.«
»Wir können es genauso beenden, wie wir es begonnen haben«, sagte er. »Mit einem Kuss und einem Schlag. Aber du willst mich ebenso sehr, wie ich dich will. Wir sind miteinander verbunden.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist etwas für Kinder. Hört mir zu, Hauptmann. Ich bin früher einmal eine Ehefrau gewesen. Ich weiß, wie sich ein Mann zwischen meinen Beinen anfühlt. Ah. Ihr zuckt zusammen. Die Novizin ist keine Jungfrau mehr. Soll ich weitersprechen? Ich habe auf der anderen Seite des Walls gelebt. Ich war eine Hinterwallerin. Nein, seht mich an!« Sie zog den Kragen ihres Gewandes herunter. Ihre Schulter war mit Tätowierungen übersät.
Sie glühte im Schein der fernen Feuer, und alles, was er verspürte, war Verlangen.
»Ich wurde jung entführt und wuchs unter ihnen zur Frau heran. Ich hatte einen Gemahl – einen Krieger, und vielleicht wären wir sogar miteinander alt geworden, er als Häuptling und ich als Schamanin. Doch dann kamen die Ordensritter. Sie haben ihn umgebracht und mich mitgenommen, und jetzt bin ich hier. Ich brauche keinen Schutz. Ich lebe in der geistigen Welt. Ich habe gelernt, Jesus zu lieben. Aber jedes Mal, wenn ich Euch küsse, eile ich in meinem Leben zurück und zu einem anderen Ort. Ich kann nicht mit Euch zusammen sein. Ich werde niemals zur Hure eines Söldners werden. Ich habe mich heute Abend geopfert, damit Ihr das sehen konntet, wovor Ihr die Augen verschlossen hattet – weil Ihr Angst vor Eurer eigenen Macht habt.« Sie drehte den Kopf. »Geht jetzt.«
Die Machtlinien zu seinen Soldaten waren so fest wie Kabel. Er missachtete seine Pflicht. Es war wie ein gebrochener Knochen – ein Schmerzensschrei. Aber er konnte das, was zwischen ihnen entstanden war, nicht einfach auf sich beruhen lassen.
»Von dem Moment an, als sich unsere Blicke trafen, begehrtest du mich genauso sehr wie ich dich. Sei keine Heuchlerin. Du willst dich heute Abend geopfert haben? Eher hast du diesen Abend herbeigesehnt und dir einen Grund verschafft, ihn zu erleben.« Schon als er diese Worte aussprach, schalt er sich einen Narren. Es war nicht das, was er hatte sagen wollen.
»Ihr habt keine Vorstellung von dem, was ich will und was nicht«, entgegnete sie. »Ihr habt keine Vorstellung von dem Leben, das ich geführt habe.«
Er machte einen halben Schritt von ihr zurück – so wie ein Schwertkämpfer zurückweicht, wenn er von der Verteidigung zum Angriff übergeht. »Ich bin mit fünf Brüdern aufgewachsen, die mich gehasst haben, mit einem Vater, der mich verachtet hat, und mit einer vernarrten Mutter, die mich zum Werkzeug ihrer Rache machen wollte«, zischte er. »Ich bin an dem Fluss aufgewachsen, hinter dem eure Hinterwaller-Siedlungen liegen. Als ich aus meinem Turm geblickt habe, habe ich euch Hinterwaller im Land der Freiheit gesehen. Du hattest einen Mann, der dich geliebt hat? Ich hatte eine lange Abfolge von Liebchen, die mir meine Mutter ins Bett gelegt hat, damit sie mich aushorchen. Du willst eine Schamanin der Hinterwaller gewesen sein? Ich wurde ausgebildet, Armeen der Wildnis anzuführen, Albia zu vernichten und den König vom Antlitz der Erde zu tilgen, damit meine Mutter ihre Rache fand. Ordensritter haben dich mitgenommen? Meine Brüder haben sich zusammengetan und mich verprügelt, um meinem angeblichen Vater eine Freude zu machen. Das war ein herrlicher Spaß.« Er stellte fest, dass er immer lauter geworden war und Speichel aus seinem Mund spritzte.
So viel zur Selbstbeherrschung. Er hatte schon zu viel gesagt. Viel zu viel. Ihm war übel.
Aber er war noch nicht fertig. »Trotz allem bin ich nicht der Antichrist, selbst wenn Gott mich dazu bestimmen sollte. Ich bin, was ich bin, und nicht das, was jemand anders will. Und du kannst das auch. Sei das, was du sein willst. Du liebst Jesus?«, fragte er, und etwas Schwarzes fuhr in seinen Geist. »Was hat er denn für dich getan? Liebe mich statt seiner.«
»Das werde ich nicht tun«, sagte sie recht gelassen.
Er konnte sich einfach nicht dazu bringen, von ihr wegzugehen. Dabei spürte er nichts mehr – nicht einmal den Drang, etwas zu erwidern. Es war, als sei er mit einem sehr scharfen Schwert geschlagen worden und sähe nun zu, wie sein Arm zu Boden fiel.
Das Nächste, woran er sich erinnern konnte, war, dass er sich in der Wächterstube über dem Tor befand.
Bent, der diensthabende Bogenschütze, stand mit vor der Brust verschränkten Armen da. Als er den Hauptmann sah, zwirbelte er seinen Schnauzbart. »Ihr habt einen Ausfall angeordnet«, sagte er. »Oder etwas Ähnliches. Ich kann Tom Schlimm und die Hälfte seiner Männer nicht finden. Sie sollten jetzt eigentlich Dienst haben.«
»Bald wird etwas passieren«, sagte der Hauptmann und riss sich zusammen. »Sag den Wachen, dass sie besonders gut aufpassen sollen. Sag ihnen …«
Er hob den Blick. Die Sterne glitzerten kalt und stumm.
»Befehl ihnen, wachsam zu sein«, meinte er. Ihm fehlten die richtigen Worte. »Ich muss mich jetzt um die Äbtissin kümmern.«
Nun lief er zur Latrine und übergab sich. Dann wischte er sich das Kinn an einem alten Taschentuch ab und warf es hinter dem Erbrochenen her. Er richtete sich auf, nickte einem unsichtbaren Gefährten zu und ging in die Halle zurück.
Die Äbtissin wartete schon auf ihn.
»Ihr seid meiner Magd begegnet«, sagte sie.
Er war so hart und kalt wie seine Rüstung. Er lächelte. »Ein nettes, zufälliges Zusammentreffen«, sagte er.
»Und Ihr habt nach Euren Wachen gesehen«, meinte sie.
»Nur kurz«, erwiderte er. »Mylady, es gibt hier zu viele Geheimnisse. Ich weiß nicht, worum es geht. Vielleicht bin ich einfach nur zu jung für all dies.« Er zuckte die Achseln. »Aber wir haben zwei Feinde – den Feind draußen und den Feind drinnen. Ich wünschte, Ihr würdet mir alles sagen, was Ihr wisst.«
»Wenn ich Euch alles sagte, dann würdet Ihr mich mit Peitschen aus reinem Feuer geißeln«, sagte die Äbtissin. »Das stammt aus einem Bibelvers, über den ich oft nachdenke.« Sie erhob sich von ihrem Thron und ging quer durch die Halle zu dem Buch hinüber. »Habt Ihr dieses Rätsel inzwischen gelöst?«, fragte sie.
»Unter Benutzung der gewaltigen Hinweise, die Ihr mir gegeben habt«, antwortete er.
»Es war mir nicht möglich, es Euch zu sagen«, gab sie zurück. »Wenn unsereins einen Eid schwört, dann bindet dieser unsere Macht.«
Er nickte.
»Ihr seid so angespannt wie eine Bogensehne«, sagte sie. »Ist das Amicia zuzuschreiben?«
»Ich habe heute Abend eine Trumpfkarte gespielt«, gab er zu. »Und ich habe es zugelassen, dass mein Stelldichein meine Pflichten behindert hat. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich es mir an einem Abend wünschen würde, an dem ich ein gewagtes Spiel treibe.« Er hielt inne und berichtete dann, was in ihm umging. »Ich mag es nicht, wenn man mit mir spielt.«
Die Äbtissin nahm ihren Rosenkranz aus Onyx auf und richtete ihr Brusttuch. »Das mag niemand«, meinte sie herablassend. »Der Ausdruck Spiel gefällt mir in diesem Zusammenhang nicht«, sagte sie. »Aber vielleicht können wir ein wenig Gutes bewirken und durch unsere Gegenwart das Würfelspiel und die Entjungferung verhindern, um die Ihr Euch so große Sorgen gemacht habt. Kommt, Hauptmann, wir begeben uns mitten unter die uns Anvertrauten.«
Sie gingen hinaus, und wie eine Lady legte ihm die Äbtissin die Hand auf den Arm. Eine verschleierte Schwester kam herbei und trug ihr die Schleppe, die länger und kostbarer verziert war als die der anderen Schwestern in diesem Konvent. Der Hauptmann vermutete, dass ihr Habit weit entfernt war von den Vorschriften, denen sich die Schwestern des Ordens vom heiligen Thomas unterwerfen mussten. Sie war eine reiche und mächtige Frau, und irgendwie war sie in sein Leben getreten.
Als sie den Hof betraten, verstummten alle Gespräche. Ein Kreis aus Tänzern bewegte sich zu der Musik von zwei Flöten und einem Psalter, der von niemand anderem als dem Knappen des Hauptmanns gespielt wurde. Die Musikanten spielten weiter, aber die Tänzer blieben stehen. Die Äbtissin nickte ihnen aufmunternd zu, und der Tanz wurde fortgesetzt.
»Wann werden sie uns angreifen?«, fragte die Äbtissin leise.
»Nie, wenn es nach meinem Willen geht«, antwortete der Hauptmann freundlich.
»Verdient Ihr Euer Geld lieber ohne Kampf?«, fragte sie.
»Immer«, antwortete er und verneigte sich tief vor Amicia, die den Tänzern zusah. Sie antwortete mit einem kühlen Nicken. Doch er hatte sich gegen sie gewappnet und sprach nun ohne Pause weiter. »Aber ich gewinne auch gern. Und Gewinnen erfordert meist gewisse Anstrengungen.«
»Die Ihr natürlich unternehmen werdet?«, fragte sie und lächelte. »Wir unterhalten uns so ungezwungen, dass ich für diese kleine Tändelei wohl Buße leisten muss.«
»Ihr habt eine Gabe dafür, die Euch viele Bewunderer eingebracht haben muss«, sagte er galant.
Sie schlug ihm mit ihrem Fächer gegen die Hand. »In den alten Zeiten, als ich noch jung war, meint Ihr?«
»Wie alle schönen Frauen versucht Ihr, meine Schmeichelei wie eine Beleidigung klingen zu lassen«, gab er zurück.
»Haltet ein. Jedermann kann uns hier sehen.« Sie nickte Pater Henry zu, der zögernd zwischen der Kapelle und der Treppe zur Großen Halle stand.
Der Hauptmann hatte den Eindruck, dass der Mann vor Feindseligkeit geradezu kochte. Vor einem Jahr hatte der Hauptmann in einer seiner ersten Amtshandlungen nach dem Ergreifen des Kommandos einen Mörder in seiner Truppe hinrichten lassen – einen Bogenschützen, der seine Kameraden für deren Sold umgebracht hatte. Torn war ein unscheinbarer Mann gewesen, ein Gesetzloser. Der Hauptmann betrachtete den Priester eingehend. Er zeigte denselben Blick wie Torn damals. Eigentlich war es gar kein Blick, sondern eher ein Gefühl. Ein Geruch.
»Pater Henry, ich glaube, Ihr seid dem Hauptmann noch nicht förmlich vorgestellt worden.« Sie lächelte, und in ihren Augen blitzte es. Es war eine Erinnerung an die Frau, die sie einst gewesen war und die genau wusste, dass ein Blitzen ihrer Augen jeden ihrer Bewunderer zum Gehorsam brachte. Es war das Bild einer Jägerin, der es gefiel, mit ihrer Beute zu spielen.
Pater Henry streckte ihm seine lange Hand entgegen. Sie war feucht und kalt. »Seine Männer nennen ihn den Bourc. Habt Ihr einen anderen Namen, den Ihr bevorzugt?«
Der Hauptmann war so sehr an unbedeutende Feindseligkeiten gewöhnt, dass es einen Moment dauerte, bis er diese hier überhaupt wahrgenommen hatte. Nun richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf den Priester.
Die Äbtissin schüttelte den Kopf und drückte gegen den Ellbogen des Priesters. »Wie dem auch sei, ich werde später mit Euch sprechen. Jetzt dürft Ihr gehen, Ser. Ihr habt meine Erlaubnis.«
»Ich bin ein Priester Gottes«, sagte er. »Ich gehe, wann und wohin ich will, und ich bin hier niemandes Diener.«
»Ihr seid Tom Schlimm noch nicht begegnet«, bemerkte der Hauptmann.
»Irgendwie kommt Ihr mir bekannt vor«, fügte Pater Henry hinzu. »Kenne ich vielleicht Eure Eltern?«
»Ich bin ein Bastard, wie Ihr schon bemerktet, Mann Gottes«, gab der Hauptmann zurück. »Zweimal sogar.«
Der Priester hielt seinem durchdringenden Blick stand. Aber seine Augen waren in andauernder Bewegung – wie bei jemandem, der auf glühenden Kohlen tanzte. Nach einer zu langen Pause drehte sich der Priester auf dem Absatz um und ging davon.
»Ihr unternehmt große Anstrengungen, um Eure Abstammung zu verbergen«, bemerkte die Äbtissin.
»Kennt Ihr den Grund dafür?«, fragte der Hauptmann.
Die Äbtissin schüttelte den Kopf.
»Gut«, meinte der Hauptmann. Sein Blick war auf den Rücken des Priesters gerichtet. »Woher stammt er? Was wisst Ihr über ihn?«
Der Tanz war beendet, die Männer verneigten sich, die Frauen machten tiefe Knickse. Nun hatte Michael bemerkt, dass seinem Herrn seine Fähigkeiten als Troubadour aufgefallen waren, und sein Gesicht lief im Fackelschein tiefrot an. Die Äbtissin räusperte sich.
»Ich hatte es Euch doch schon gesagt. Ich habe ihn aus der örtlichen Pfarrei genommen«, murmelte die Äbtissin. »Er ist von unbedeutender Abstammung.«
Der Himmel im Osten wurde plötzlich heller, als ob es dort geblitzt hätte, doch dafür war das Licht zu rot und zu beständig; es dauerte die Spanne eines Vaterunsers.
»Alarm!«, brüllte der Hauptmann. »Tor öffnen, alle Armbrüste laden, Maschinen bereit machen! Bewegung!«
Pampe hatte die Tänzer beobachtet. Sie hielt inne; die Verwirrung stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Das Tor öffnen?«, fragte sie.
»Ja. Ein Ausfallkommando soll sich zum Ausritt bereitmachen. Du wirst es anführen.« Der Hauptmann stieß sie in Richtung ihres Helms.
Die meisten seiner Männer machten sich sofort an die Arbeit, doch wenn ihn die Enthüllungen des Abends nicht so verzaubert hätten, dann würden sie bereits alle in ihren Rüstungen stecken.
Nun aber stand ein Dutzend Krieger neben ihren Schlachtrössern in dem von Fackelschein erhellten Torbogen, und ihre Diener und Knappen beeilten sich, ihnen die Waffen anzureichen. Bogenschützen liefen vom Hof hoch zu den Wehrgängen auf der Ringmauer. Einige hatten noch nicht einmal ihre Hose festgezurrt; ihre Hemdspitzen baumelten herab.
Im Osten flackerte ein zweiter Lichtblitz auf, der nur halb so lang war wie der erste.
Der Hauptmann grinste. »Ich hoffe, Ihr habt das Olivenöl nicht für etwas sehr Wichtiges gebraucht«, meinte er und drückte ihren Arm auf äußerst vertrauliche Art. »Darf ich mich jetzt zurückziehen? Vor der nächsten Glocke sollte ich wieder bei Euch sein.«
Sie betrachtete ihn in der Dunkelheit, die nur vom Feuerschein erhellt wurde. »Ist das nicht das Werk des Feindes, sondern vielmehr das Eure?«, fragte sie.
Er zuckte die Achseln. »Ich hoffe es«, meinte er und beugte sich vor. »Griechisches Feuer. In ihrem Lager. Zumindest hoffe ich das.«
Nördlich von Harndon · Harmodius
Eine Obduktion war eine der Tätigkeiten, die man niemals vergaß. Harmodius hatte den Leichnam persönlich ausgegraben, was kein großes Risiko gewesen war, denn er war in großer Hast beerdigt worden.
Harmodius war nur am Hirn interessiert. Das war auch gut so, denn der Brustkorb war schwer beschädigt, und die Bauchhöhle war fast leer. Irgendetwas musste die Eingeweide herausgefressen haben.
Harmodius kannte keine Empfindungen wie Ekel mehr. Zumindest sagte er sich das. Stetiger, leichter Frühlingsregen fiel ihm auf den Rücken, die Dunkelheit setzte ein, während er sich mitten in der nördlichen Wildnis befand. Aber der Leichnam war bereit, und der war es schließlich, der Harmodius auf diese völlig verrückte Jagd geschickt hatte. Dieser Leichnam – und das feste, magnetische Ziehen der Macht. Einer Macht, die wie ein Leuchtfeuer wirkte.
Er holte eine Jagdausrüstung hervor – zwei sehr schwere Messer und ein halbes Dutzend kleinerer, aber besonders scharfer Klingen – und schälte schnell und sorgfältig die Haut vom Schädel des Mannes, schob die Lappen zurück, nahm einen Trepanierer aus seinem Gepäck und entfernte ein Stück Schädel von der Größe eines Dreifachleoparden aus massivem Silber.
Das Licht nahm ab, doch es war trotzdem noch deutlich zu sehen, dass das Hirngewebe bereits in den Zustand der Verwesung übergegangen war.
Harmodius nahm ein Tafelmesser aus seinem Beutel und legte die offene Stelle vorsichtig frei. Mit der Messerspitze schnitt er kleine Teile des verwesenden Materials ab …
Dabei spuckte er salzigen Speichel aus. »Ich werde mich nicht übergeben«, verkündete er laut. Und grub das Messer wieder ins Hirn.
Es war so verdammt finster. Er zog eine Kerze aus dem Sack, der an seinem stetig unruhiger werdenden Pferd hing, und entzündete sie mithilfe von Zauberei. Es war vollkommen windstill, die Kerze zischte im leichten Regen. Er entzündete noch zwei weitere und verschwendete dabei kostbares Bienenwachs.
Nun bohrte er ein weiteres Loch ins Hirn, aber es hatte keinen Sinn. Es war schon zu stark verwest. Oder seine Theorie war vollkommen falsch. Oder die Theorie des Aristoteles war vollkommen falsch.
Der Magus ließ den Körper halb ausgegraben im Regen liegen. Er wusch sich die Hände im Bach am Fuß des Hügels, packte die Messer wieder ein, löschte die Kerzen und belud sein Pferd, das nun bei jedem Laut scheute. Er streckte die Arme aus und spürte, wie sich die Macht im Norden zusammenzog.
Jesu Christe.
Der Magus hielt inne, als er den einen Fuß schon in den Steigbügel gestellt hatte. Da war etwas …
Die Kreatur verriet sich durch ein Knurren, und die Stute bäumte sich auf. Harmodius gelang es, die Hand um den Sattelknauf zu legen und hielt sich daran fest, während sich das verängstigte Tier umdrehte. Harmodius nutzte den Schwung, um das Bein über den Sattel zu werfen und aufzusitzen. Der Mond war kaum mehr als eine schwache, ferne Sichel, der Regen verdeckte die Sterne, und die Nacht war finster. Er betete schnell und wirr darum, dass sein Pferd auf der Straße bliebe.
Endlich bekam er auch den rechten Fuß in den Steigbügel und zerrte an den Zügeln. Doch sein Pferd Ginger gehorchte nicht.
Er zog noch heftiger und tastete nach dem Stock, den er als Reitpeitsche verwendete. Es schien Stunden zu dauern, bis er ihn an seinem Gürtel gefunden hatte, und weitere Stunden, bis Harmodius ihn fest gegen den Hals des Tieres gepresst hatte; diesen Kniff hatte er von einem Ritter gelernt.
Er wirkte einen einfachen Gedanken, ein Phantasma, das es ihm erlaubte, in der Finsternis zu sehen.
Was er da sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Das Pferd bäumte sich wieder auf, und beinahe wäre er nach hinten abgeworfen worden.
»Süßer Jesus!«, rief er.
Etwas stand mitten auf der Straße und erwartete ihn.
Irgendwo links von ihm, tief im Nordwesten, explodierte der Himmel in einem langen, orangefarbenen Blitz. Sein schwaches Licht erhellte den vertrauten – den allzu vertrauten – Umriss der Kreatur, die sich auf der Straße befand.
Sie warf den Leichnam beiseite und sprang ihn an. Doch er konnte noch das Zucken der Kraft aus dem Norden spüren. Und er vermochte noch darüber nachzudenken, dass ihn der lang anhaltende orangefarbene Lichtblitz hinter dem Horizont weit vor dem Zusammenziehen der Macht erreicht hatte, was für einen Hermetiker von großer Bedeutung war. Er hatte die Auswirkungen von Entfernung auf die Macht noch nie richtig erforscht …
Diese Gedanken bildeten eine Art von Panik; keiner von ihnen stand in einer Verbindung mit dem Ungeheuer auf der Straße vor ihm oder mit der Welle des Schreckens, die es aussandte und die ihn wie eine Faust aus Angst traf.
»Adveniat regnum tuum«, spuckte der Magus aus.
Eine Feuerlanze zuckte aus seiner Reitgerte und badete den Kopf der Kreatur einen Atemzug lang in Flammen. Die flüssigen Teile des Ungeheuerkopfes verdampften, und sein Schädel barst, während Lohen aus ihm schlugen.
Das Feuer ging aus; nur einige blassblaue Zungen blieben zurück, die über den Hals des Geschöpfes leckten, bevor auch sie verlöschten.
Stille setzte ein, in der der Schwanz der Kreatur noch einige Male über den Boden peitschte, um dann vollends zu erstarren.
Die Stille setzte sich fort, immer weiter. Die Nacht roch nach versengten Haaren und verbrannter Seife.
Der Magier holte tief Luft. Er hob seine Reitgerte und blies sanft auf die silberne Rune, die im Knauf steckte. Er lächelte in sich hinein, obwohl ihm die Erschöpfung wie ein Kettenhemd auf die Schultern drückte, und erlaubte sich ein kurzes meckerndes Lachen.
Er beobachtete den nördlichen Horizont, wo das Feuer wieder aufflackerte, dann stieg er ab, ging durch die Dunkelheit zum Kopf des Geschöpfs und murmelte: »Fiat lux.« Sein Licht war blau und blass, aber es reichte aus.
Er schnalzte mit der Zunge, streckte seine Sinne in die Nacht aus, zuckte vor dem zurück, was sie entdeckten, und rannte zu seinem Pferd.
Östlich von Lissen Carak · Peter
Peter lag im Zustand wütender Erschöpfung da und beobachtete das Flackern des blassen Lichtes im fernen Westen. Er musste den Blick davon losreißen und in die Dunkelheit schauen, um sich vergewissern zu können, dass das Ganze nicht bloß Einbildung war. Aber es entsprach der Wirklichkeit – über den endlosen Bäumen, irgendwo im Westen, loderte ein großes Feuer. Es war so gewaltig, dass es von den Felsen über ihm in langen Lichtblitzen zurückgeworfen wurde.
Seine beiden »Meister« verschliefen dieses Schauspiel.
Er kämpfte abermals gegen sein Joch an, gab abermals auf und schlief endlich ein.
Als er erwachte, kniete der kleinere der beiden Männer neben ihm.
»Koch«, sagte er, »wach auf. Irgendetwas ist hier draußen bei uns.« In seiner Stimme schwang Angst mit.
»Was zum Teufel tust du da?«, fragte der andere Moreaner.
»Ich nehme ihm das Joch ab«, erklärte der kleinere Mann. »Ich will nicht weglaufen und ihn zum Sterben hierlassen. Bei Jesus, so ein schlimmer Mensch bin ich nicht.«
»Er ist ein Heide oder ein Häretiker, oder irgendein anderer Abschaum. Lass ihn.« Der erste Mann war damit beschäftigt, so schnell wie möglich den Maulesel zu beladen. Es war zwar schon dunkel, aber nicht ganz; das erste blasse Licht des Morgens war schon zu sehen. Und etwas Schweres bewegte sich durchs Unterholz.
»Ich bin ein Christenmensch«, sagte Peter.
»Siehst du?«, meinte der Kleinere und fingerte an den Ketten herum. Und ächzte.
»Komm schon!«, rief sein Freund.
Der Kleinere zerrte noch einmal an dem Joch, schlug es gegen einen Felsen und kämpfte sich auf die Beine. »Tut mir leid«, sagte er. »Wir haben keinen Schlüssel.« Er folgte seinem Gefährten in den Wald hinein und ließ Peter allein auf dem Boden zurück.
Dort lag er nun und wartete auf den Tod.
Aber nichts geschah, und jedes Entsetzen verblasst doch irgendwann.
Er stand auf und stolperte über etwas. Diese Dummköpfe hatten ihre Axt vergessen. Der Griff prallte ihm gegen das Schienbein.
Er hob sie auf und schritt durch das Lager. Eigentlich war es noch ein zu großes Wort für den niedergetretenen Ort, an dem die drei Männer ein Feuer von der Größe eines Hasen errichtet und auf dem bloßen Erdboden geschlafen hatten. Doch neben dem Feuer fand er einen unzerbrochenen Steingutbecher und eine Zunderbüchse mit Flint, Stahl und Tuch.
Peter kniete sich auf den Boden und betete zu Gott. Ihm gelang ein bittersüßer Dank, dann steckte er Becher und die Büchse vorn in sein Hemd, zurrte sie fest und ging zur Straße, die nur wenige Pferdelängen nördlich von ihm lag. Es war die Hauptstraße, die von den östlichen Häfen zu den Albin-Ebenen führte. Das zumindest wusste er.
Im Osten lagen Zivilisation und Sicherheit – und Sklaverei.
Im Westen lagen der Fluss Albin und die Wildnis. Peter hatte die Wildnis schon gesehen, ganz rot und mit Zähnen und Klauen bewehrt. Doch sie hatte ihn nicht versklavt. So schulterte er die Axt und begab sich nach Westen.
Der Palast von Harndon · Desiderata
Sie las die Botschaft mit kaum verhohlener Verärgerung. »Wann hat er dir das gegeben?«, fragte sie den entsetzten Jungen.
»Gestern, Euer Gnaden«, murmelte er. »Als mich der Koch zum Markt geschickt hat und meine Mama krank war …«
Sie sah ihn an. Sie war wütend. Sie liebte diesen nutzlosen alten Magier, so wie sie ihr prächtiges Reitpferd aus dem Osten auch liebte, und sein jüngster Beweis wahrer Macht ließ ihn in ihren Augen sogar noch erregender erscheinen.
»Und er hat ein Pferd mitgenommen – ein gutes Pferd, Euer Gnaden. Und Ledertaschen. Und seinen Stab.« Es war deutlich zu sehen, dass der Junge ihr gefallen wollte. Sie hatte Mitleid mit ihm.
Sie drehte sich zu Lady Almspend um und zeigte auf deren Hüfte. »Gebt dem Jungen einen Leoparden für seine Mühen, und schickt Mastiff zu den Räumen des Zauberers im Turm. Ich wünsche einen vollständigen Bericht.« Sie zog eine Grimasse. »Ser Richard?«
Ser Richard Fitzroy war der Bastardsohn des alten Königs, ein schöner Mann, ein feiner Ritter und ein verlässlicher Bote. Er war ganz vernarrt in die Königin, und die Königin schätzte seine Beständigkeit.
Sie befahl ihn zu sich heran. »Ser Richard – ich muss unter vier Augen mit dem König reden«, sagte sie.
»Erachtet es als geschehen«, erwiderte er, verneigte sich und ging davon.
Östlich von Albinkirk · Gerald Random
Als Gerald Random erwachte, hörte er, wie Guilbert Blackhead mit seinem Schwertgriff gegen den Zeltpfosten klopfte und Eintritt begehrte. Sofort war Random auf den Beinen, hatte den Dolch in der Hand – und dann erst war er vollständig wach.
»Was ist los?«, fragte er und tastete nach den Schnüren, mit denen er die Zeltklappe hochbinden konnte.
»Keine Ahnung, aber Ihr solltet es mit eigenen Augen sehen.« Guilberts Drängen war deutlich zu spüren.
Sofort sprang Random aus dem Zelt.
Sie kampierten auf einer schmalen Wiese am Ufer des Albin. Der große Fluss war stark angeschwollen und strömte schnell, tief und fast lautlos dahin. Das Wasser wirkte in der feuchten Nachtluft beinahe schwarz. Den ganzen Tag hindurch waren sie immer wieder von Regengüssen überschüttet worden, und die Menschen und Tiere waren nun genauso nass wie das Wasser.
Fern im Nordosten sollten die ersten Berggipfel eigentlich schon sichtbar sein, doch niedrig hängende Wolken trieben über sie hinweg, verbargen sie, enthüllten sie aber nach wenigen Minuten ganz plötzlich wieder. Immer wieder regnete es aus ihnen auf das Gras und die Bäume herab.
Als die nächste Wolke vorbeigezogen war, erhoben sich die Adnaklippen in der Dunkelheit. Random hoffte, dass sie es in vier weiteren Tagen bis zur befestigten Stadt Albinkirk schaffen würden. Es war nicht die Entfernung, sondern der Zustand der Straße zu dieser Jahreszeit, der für die Verspätung verantwortlich war. Die Flussstraße mit ihren steinernen Brücken und dem Steinbett, das noch von den Archaikern gelegt worden war, stellte den einzigen Weg dar, den ein verständiger Mensch mit schweren Wagen befahren konnte. Auf jeder anderen Straße steckte man bald knietief im Schlamm. Trotzdem schien es auch hier nicht einfach zu werden.
Im Norden war ein orangefarbenes Glimmen zu sehen.
»Schaut Euch das an«, sagte Guilbert.
Nach sechs Tagen auf der Straße hatte Random gelernt, vorsichtig, sorgfältig und gründlich zu sein. Er war vielleicht kein Mann der Heldentaten, dafür aber einer, der eine Karawane führen konnte. Die Wächter waren stets auf dem Posten und wurden andauernd überprüft.
Was immer Guilbert dem Kaufmann zeigen wollte, es musste wichtig sein.
Random beobachtete ein Flackern – oder war es mehr? Es kam aus Nordosten, aus der Richtung des Jahrmarktes. Vielleicht – aber sie waren zu weit vom Markt entfernt, als dass er schon in Sichtweite sein konnte. Bis dorthin mussten es noch fünfzig Meilen oder mehr sein; schließlich hatten sie noch nicht mal Albinkirk erreicht.
»Da«, sagte der Söldner.
Einen Augenblick lang war eine Nadelspitze aus Licht zu erkennen, die wie ein Stern über dem Glanz Albinkirks brannte.
Random zuckte die Achseln. »Das ist alles?«, fragte er.
Guilbert nickte und war ohne Zweifel unglücklich.
»Dann gehe ich wieder zu Bett«, sagte Random. »Weck mich, wenn wir angegriffen werden«, fügte er hinzu. Später wünschte er sich, er wäre nicht so barsch gewesen.
Lissen Carak · Die Näherin Meg
Die Näherin Meg saß auf einem Fass, um niemandem im Weg zu stehen. Der Tag war gut verlaufen. Sie hatte Lis beim Waschen ihrer Hemden geholfen und war dafür mit harter Münze bezahlt worden. Sie hatte sich daran erinnert, wie man Taschendiebstählen vorbeugte und hatte hier und da einen Klaps verteilt, wenn es unausweichlich geworden war. Die Söldner waren anders als alle Menschen, denen sie bisher begegnet war; sie waren so streitsüchtig wie niemand sonst in einer Stadt, die fast nur von Bauern bewohnt wurde.
Unter anderen Umständen hätten sie Megs Schafe getötet, ihr die Hühner und das Silber gestohlen und sie selbst vergewaltigt und vielleicht auch getötet. Es waren harte Männer – schlimme Männer.
Aber sie hatten ihren Wein geteilt und am Abend getanzt, und es fiel Meg immer schwerer, sie als das zu betrachten, was sie vermutlich waren. Diebe und Mörder. Die Äbtissin sagte, die Wildnis würde sie angreifen, und diese Männer seien alles, was sie zu ihrer Verteidigung hatten. Meg dachte …
Was immer sie dachte, sie hatte es nach den Blitzen am Himmel vergessen. Und plötzlich kamen sie aus der Finsternis in ihren geschwärzten Rüstungen, angeführt von Thomas, den sie inzwischen als Ser Thomas kannte. Er ritt auf einem schweißbedeckten Schlachtross, und sechs Kämpfer, zwanzig Bogenschützen und einige bewaffnete Diener galoppierten hinter ihm die gewundene Straße hoch und durch das Tor hindurch, das fast unmittelbar unter Meg lag.
Tom Schlimm sprang als Erster vom Pferd und beugte die Knie vor dem Hauptmann. »Genau wie Ihr gesagt habt«, keuchte er. »Wir haben ihnen eins auf den Sack gegeben.« Steif erhob er sich wieder.
Der Hauptmann umarmte den großen Kerl. »Zieh deine Rüstung aus, und hol dir was zu trinken«, sagte er. »Ich danke dir sehr, Tom. Gut gemacht.«
»Und wer wischt mir den Ruß von meinem Panzer?«, beschwerte sich einer der Bogenschützen – der mit den toten Augen. Er sah auf, und seine schrecklichen Augen fanden Meg. In ihnen lag das Versprechen von Gewalt.
Er grinste sie an. Die anderen Männer nannten ihn Will, und sie hatte erfahren, dass dies für »Mutwill Mordling« stand. Offenbar war er ein überführter Mörder.
Sie zuckte zusammen.
»Wie war es?«, fragte der Hauptmann.
Thomas stieß sein gewaltiges Lachen aus. »Großartig, Hauptmann!«, sagte er und saß ebenfalls ab.
Die anderen Männer lachten – ein wenig zu wild, was Meg verriet, dass sie etwas Schreckliches und Gefährliches erfahren haben mussten, während das Lachen von Ser Thomas echt wirkte.
Sie hatten überlebt und triumphierten nun.
Der Hauptmann umarmte den großen Mann erneut und schüttelte ihm die Hand. Dann begab er sich zwischen die Bogenschützen, half ihnen beim Absteigen, reichte jedem die Hand, und Meg sah nun, dass sich die Äbtissin unmittelbar neben ihm befand und die Männer segnete.
Sie klatschte in die Hände und konnte sich gerade noch davon abbringen, laut zu lachen.
Der Palast von Harndon · Desiderata
Als der Abend hereinbrach, betrachtete Desiderata den ausländischen Ritter mit dem Vergnügen, das nur ein wahrer Künstler der Kennerin zu bereiten vermag. Er war groß – einen Kopf größer als jeder andere Mann in der großen Halle – und bewegte sich mit einer Anmut, die Gott für gewöhnlich nur Frauen und außergewöhnlichen Athleten schenkte. Sein Gesicht erinnerte an das eines Heiligen; er hatte hellgoldenes Haar und Züge, die beinahe zu fein für einen Mann schienen. Sein roter Wappenrock saß vollkommen, seine weiße Hose war nicht aus Wolle, sondern aus Seide, und der breite Gürtel mit den Goldplaketten an der schlanken Hüfte gab ein stummes Zeugnis von Reichtum, Privilegien und körperlicher Kraft ab.
Er verneigte sich tief vor dem König, sank mit anmutiger Höflichkeit auf das Knie.
»Mein König, darf ich Euch den edlen Jean de Vrailly, Captal de Ruth, und seinen Vetter Gaston d’Albret, Sieur d’Eu vorstellen?« Der Herold fuhr damit fort, ihre Wappen und Leistungen aufzuzählen.
Desiderata kannte diese Leistungen schon.
Sie beobachtete seine Augen, und er beobachtete den König.
Der König kratzte sich am Bart. »Es ist ein langer Weg vom Grand Pays bis hierher«, sagte er. »Ist ganz Gallyen etwa befriedet, dass Ihr so viele Ritter in mein Land führen könnt?« Er hatte die Worte leichthin gesprochen, doch seine Augen waren hart und seine Miene ausdruckslos.
De Vrailly verharrte in kniender Stellung. »Ein Engel befahl mir, herzukommen und Euch zu dienen«, sagte er.
Sein Unterstützer, der Graf von Towbray, drehte sich abrupt um.
Desiderata streckte ihren Sinn – ihre Wärme, wie sie es nannte – nach ihm aus und stellte fest, dass der ausländische Ritter wie die Sonne brannte.
Sie sog die Luft tief ein, als wollte sie seine Wärme einatmen. Der König warf ihr einen kurzen Blick zu.
»Ein Engel Gottes?«, fragte er und beugte sich vor.
»Gibt es noch andere Engel?«, fragte de Vrailly.
Desiderata hatte nie zuvor einen Mann mit so selbstverständlicher Anmaßung sprechen gehört. Es tat ihr weh; es war wie ein Makel an einer wunderschönen Blume. Doch wie so viele Makel übte auch dieser seinen ganz eigenen Zauber aus.
Der König nickte. »Auf welche Weise wollt Ihr mir dienen, Ser Ritter?«, fragte er.
»Durch Kampf«, antwortete de Vrailly. »Indem ich Eure Feinde unbarmherzig mit Krieg überziehe, sei es die Wildnis oder sonst jemand, der sich Euch entgegenstellt.«
Der König kratzte sich weiter am Bart.
»Ein Engel Gottes hat Euch gesagt, Ihr sollt herkommen und meine Feinde töten?«, fragte er. Desiderata glaubte, der Ritter habe seine Worte ironisch gemeint, aber sie war sich nicht sicher. De Vrailly blendete sie auf seltsame Weise. Er füllte den ganzen Raum aus.
Sie schloss die Augen und spürte ihn noch immer.
»Ja«, sagte er.
Der König schüttelte den Kopf. »Dann kann ich Euch das nicht verwehren«, sagte er. »Aber ich fühle, dass Ihr im Gegenzug etwas von mir haben wollt.«
De Vrailly lachte; der musikalisch süße Laut erfüllte den ganzen Raum. »Natürlich! Ich wäre gern Euer Erbe, damit dieses Königreich nach Eurem Tod mir zufällt.«
Der Graf taumelte, als wäre er geschlagen worden.
Der König schüttelte den Kopf. »Dann wäre es wohl das Beste, wenn Ihr nach Gallyen zurückgeht, egal ob Euch ein Engel herbefohlen hat oder nicht«, sagte er. »Meine Frau wird mir einen Erben von meinem eigenen Fleisch und Blut schenken, oder ich werde selbst einen benennen.«
»Natürlich!«, erwiderte de Vrailly. »Aber natürlich, mein König.« Er nickte, und in seinen Augen leuchtete es. »Aber ich werde mich beweisen und Euer Ausgewählter werden. Ich werde Euch dienen, und Ihr werdet sehen, dass es niemanden gibt wie mich.«
»Und das wisst Ihr, weil ein Engel es Euch gesagt hat.«
»Ja«, meinte Jean de Vrailly. »Und ich will es an dem Körper eines jeden Mannes beweisen, den Ihr gegen mich schickt, zu Pferd oder zu Fuß, mit jeder Waffe, die Ihr benennt.«
Seine Aufforderung, dargebracht mit süßer, engelsgleicher Stimme und auf den Knien eines Büßers, besaß die ganze Autorität eines Dekrets. Die Männer zuckten unter seinen Worten zusammen.
Der König hingegen nickte, als wäre er zufrieden.
»Dann freue ich mich darauf, meine Lanze mit der Euren zu messen«, sagte er. »Es ist aber keine Herausforderung Eures Engels, sondern soll nur um des Vergnügens willen geschehen.«
Desiderata sah, wie der vollendete Ritter einen raschen Blick mit seinem Vetter tauschte. Sie hatte keine Ahnung, welchen Gedanken die beiden gerade teilten, aber sie schienen zufrieden zu sein. Zufrieden mit sich selbst und vielleicht auch zufrieden mit dem König. Es wärmte sie, und so lächelte sie.
Gaston, der Sieur d’Eu, fing ihr Lächeln auf und erwiderte es, aber der goldene de Vrailly wandte seinen Blick nicht vom König ab. »Mir würde es gefallen, die Lanzen mit Euch zu kreuzen, Sire«, sagte er.
»Aber nicht heute Abend. Es ist schon zu dunkel. Morgen vielleicht.« Der König sah den Grafen von Towbray an und nickte. »Ich danke Euch, dass Ihr mir diesen großartigen Mann gebracht habt. Ich hoffe, ich verfüge über die Geldmittel, ihn und seine Armee zu unterhalten!«
Der Graf kaute kurz auf seinem Schnauzbart herum und zuckte die Achseln. »Es war mir ein Vergnügen, Euer Majestät«, erwiderte er.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
»Gott sei mit dir«, sagte die Äbtissin leise und legte die Hände auf Mutwill Mordlings Kopf. Er zuckte zusammen.
Sie erhaschte den Blick des Hauptmanns, als sich der schmale Tordurchgang allmählich leerte.
»Seid ihr verfolgt worden?«, fragte er Ser George Brewes, den Anführer der Nachhut. Dieser Mann hatte das Zeug zum Korporal. Er war nicht einer von Toms Männern, sondern einer von Jehannes’ Kumpanen. Er wartete im offenen Tor und hielt den Blick in die Dunkelheit vor sich gerichtet.
Brewes zuckte die Schultern. »Woher soll ich das wissen?«, meinte er, lenkte dann aber ein. »Ich glaube nicht.« Er schüttelte den Kopf. »Wir haben zehn Gehöfte angezündet und das Feuer mit dem Wind in Richtung ihres Lagers geschickt.«
»Wie viele Waldbuben?«, fragte der Hauptmann.
»Mindestens hundert. Vielleicht auch dreimal so viel. Man kann im Dunkeln nicht gut zählen, Ser.« Brewes zuckte noch einmal mit den Schultern, dann fügte er hinzu, als sei es ihm gerade erst eingefallen: »Mylord.«
Zwei Diener und ein Bogenschütze kamen herbei und machten sich daran, das Haupttor zu schließen.
»Achtung!«, rief eine Stimme vom höchsten Turm – dem über dem Nonnendormitorium –, und der Hauptmann hörte den unmissverständlichen Laut einer Armbrust, die einen Pfeil abschoss.
Vor dem Mond glitt etwas dahin.
Zum Glück war jeder Mann wach und auf den Mauern, denn sonst hätte es schlimm ausgehen können, als der Lindwurm auf Schwingen, die ein Dutzend Ellen lang waren, in den Innenhof flog. Seine Klauen richteten unter den ungeschützten Tänzern, Sängern und Feiernden ein Blutbad an, doch noch bevor die Schreie einsetzten, sprossen ein Dutzend Pfeile aus seinem Leib. Er hob den Kopf und stieß einen langgezogenen Schrei der Wut und des Schmerzes aus, dann erhob er sich wieder in die Luft.
Der Hauptmann sah, wie der ungerüstete Michael über einige Leichen hinwegsprang, seinen schweren Dolch zog und sich noch gegen den Rücken des Lindwurms warf, als dieser sich bereits wieder in die Luft erhob. Sein Schweif zuckte hin und her – und stieß gegen die Hüfte des Knappen. Michael kreischte vor Schmerz auf und wurde auf die Steine geschleudert.
Der Rote Ritter vergeudete nicht die Zeit, die ihm sein Knappe verschafft hatte. Er rannte von der Mauer des Torhauses herunter und hatte das Schwert schon in der gepanzerten Hand, bevor Michaels Schrei zwischen den Stallwänden und der Kapelle ganz verhallt war.
Der Lindwurm wirbelte herum und wollte den Knappen töten, doch da trat Tom Schlimm zwischen das Ungeheuer und seine Beute. Der große Mann hielt einen langen und schweren Speer in der Hand. Er griff an und stach nach dem Kopf des Ungetüms. Zwar war es schnell, aber als es den sehnigen Hals zur Seite beugte, damit sein Haupt dem Stoß entging, konnte es sich nicht gleichzeitig in die Luft erheben und auch nicht angreifen, bis es sein Gleichgewicht wiedererlangt hatte.
Tom Schlimm trat näher an es heran, packte den Speer fester und rammte ihn dem Untier mit aller Gewalt in die Brust.
Und nun fiederten lange Pfeile die Schwingen und den Bauch der Kreatur.
Sie kreischte, sprang in die Luft und schlug schwer mit den Flügeln. Ihr Schweif peitschte auf Tom zu, aber der große Mann sprang hoch und entkam um Haaresbreite. Doch ihm entging in der Dunkelheit das Zucken einer Schwinge, und die Flügelspitze kratzte über seinen Brustpanzer und schleuderte ihn zu Boden.
Die Bogenschützen auf den Mauern schossen einen Pfeil nach dem anderen ab. Mutwill Mordling stand eine Pferdelänge entfernt, zog unablässig Pfeile aus dem Köcher an seiner Hüfte und schoss, wobei er sorgfältig auf die verwundbarsten Teile des Ungetüms zielte.
Der brennende Scheiterhaufen im Hof beleuchtete das Ziel recht gut, und die spitzen Pfeilköpfe drangen in die Haut der Bestie ein wie ein Meißel in das Holz, während die Funken aus dem Feuer wie Glühwürmchen über den immer schwächer schlagenden Flügeln tanzten.
Der Hauptmann war hinter und über dem Geschöpf, als es in die Luft sprang, und er sprang ebenfalls. Er traf es am Hals, und sein Schwert fuhr ihm über die Kehle. Mit der linken gepanzerten Hand packte er das andere Ende des Schwertes und ließ sich auf den Boden hinunter. Sein Schwert zwang den Kopf des Lindwurms ebenfalls nach unten. Das Ungeheuer verlor an Höhe, schlug auf die Treppe zur Kapelle, während das Schwert des Hauptmanns nun tief in seinem Hals steckte. Mit den Zähnen konnte es den Hauptmann nicht erreichen. Es verletzte sich selbst, als es den Kopf immer wieder in Wut und Panik auf die Stufen schlug.
Ein einsamer Armbrustschütze lief über die Mauer, sprang in den Hof hinunter, stolperte, richtete sich wieder auf und schoss seine schwere Waffe in einer Entfernung von wenigen Fuß auf den Kopf des Lindwurms ab. Unter der Macht des Bolzens flog der Kopf der Bestie zurück. Der Hauptmann rollte auf die linke Seite, ließ die linke Hand los, sprang auf die Beine und hieb mit seiner schweren Waffe auf den Hals ein – immer wieder, und dann, als das Ungetüm den Kopf hob, drang die Klinge zwischen die Schuppen in weicheres Fleisch ein. Der Hauptmann machte zehn Ausfälle in genauso vielen Herzschlägen, und plötzlich peitschte der Kopf des Lindwurms zurück, das ganze Ungeheuer rollte sich wie ein Mann auf die Seite, und der tapfere Armbrustschütze starb, als sich die mächtigen Klauen um seine Hüfte legten und ihn entzweirissen.
»Da ist noch einer!«, brüllte Tom, als er sich links von dem Hauptmann befand.
Die Spitze des peitschenden Schwanzes erwischte ihn am rechten Fußknöchel und riss ihn von den Beinen. Der Hauptmann verfluchte sich dafür, dass er nicht in seiner Rüstung steckte.
Er schlug mit dem Kopf gegen die Treppe zur Kapelle und verlor damit einen kostbaren Augenblick.
Der Lindwurm bäumte sich über ihm auf.
Eine Frau – die Näherin – erschien aus der Dunkelheit rechts von ihm und schleuderte ein Fass gegen das Ungeheuer. Es wurde am Kopf getroffen und verlor das Gleichgewicht, und einer seiner Maschinenmeister feuerte einen Bolzen auf es ab.
Der Bolzen durchdrang den Hals der Kreatur und warf sie mit so großer Gewalt durch die Kapellentür, dass das Steinwerk des Sturzes zersplitterte, als der Kopf des Lindwurms dagegen prallte. Der Hauptmann hörte, wie das Genick brach. Der Bolzen verursachte schon großen Schaden an der Kapelle, doch der Todeskampf des Lindwurms verursachte einen noch größeren, als sich ein Fluss aus seinem Blut über den heiligen Teppich auf dem Marmorboden ergoss.
Der Hauptmann sprang auf die Beine und stellte fest, das er sein Schwert noch in der Hand hielt. Seine ledernen Handschuhe waren ruiniert, und seine linke Hand blutete, weil er die Klinge zu hoch gepackt hatte, dort wo sie nicht mehr stumpf war. Außerdem hatte er sich den Knöchel verdreht und musste mehrfach blinzeln, damit er die Welt, die sich um ihn herum drehte, wieder klar sehen konnte.
Die Kreatur zuckte noch immer, also rammte er ihm die Spitze seines Schwertes in das Auge, das er am leichtesten erreichen konnte.
Der Schein des Feuers im Hof wurde von dem Bauch des zweiten Lindwurms zurückgeworfen.
Vierzig Bogenschützen feuerten Pfeil nach Pfeil auf ihn ab, sodass es wirkte, als würden neue Funken zu dem vom Feuerschein erhellten Ungeheuer aufsteigen. Und dann geschah etwas – nicht so plötzlich wie der Stoß eines Bolzens, sondern langsam. Die Flügel des Lindwurms rissen auseinander, bekamen Löcher, er verlor an Höhe und kreischte vor Angst, als ihn die Männer herunterholten. Die Bestie erkannte, dass es von dem tödlichen, von unten aufsteigenden Stahlregen kein Entkommen gab. Sie sackte tiefer und tiefer, schlug noch heftiger mit den Flügeln, drehte sich ruckartig um, und plötzlich versagte die eine mächtige Schwinge. Das Ungetüm schlug mit solcher Gewalt gegen die Hügelflanke, dass der Hauptmann spürte, wie die Stufen unter seinen Stiefeln erzitterten.
»Ausfall!«, brüllte der Hauptmann – das heißt, er wollte es brüllen, aber er brachte kaum mehr als ein Krächzen heraus. Doch er wurde verstanden, und seine acht gerüsteten Ritter öffneten das Tor und preschten bereits die Straße hinunter, angeführt von Pampe.
Als es im Hof still wurde, wurde offenbar, dass zwanzig Menschen gestorben waren, und viele waren schrecklich verstümmelt worden. Ein Mädchen von ungefähr fünfzehn Jahren schrie entsetzlich, und die Frau, die das Fass geworfen hatte, bückte sich und nahm es in den Arm.
Ein anderes Kind versuchte sich mit den Armen über den Boden zu ziehen, denn es hatte keine Beine mehr.
Plötzlich strömten die Nonnen aus ihrem Dormitorium – zehn, zwanzig, fünfzig Frauen, die sich in einem Aufruhr aus grauer Wolle und hellem Leinen ausbreiteten, um die Toten, die Verwundeten und die Traumatisierten zu zählen. Der Hauptmann sackte gegen eine Wand; sein rechtes Bein war ein stetiger Schmerzstrom, und er wünschte sich, er könnte einfach bewusstlos werden.
Das Mädchen schrie noch immer. Er richtete den Blick kurz auf sie und bemerkte erst jetzt, dass der größte Teil ihres oberen Torsos verschwunden war. Er konnte einfach nicht glauben, dass es noch lebte und in der Lage war zu schreien. Die Frau, die ihm das Leben gerettet hatte, war ganz bedeckt mit dem Blut des Mädchens – sie glänzte regelrecht. Da war nichts mehr zu machen.
Er wünschte sich, das schreiende Mädchen würde einfach sterben.
Zwei Nonnen wickelten es nun in ein Laken, das sie gar nicht so schnell um es herumwinden konnten, wie der Stoff rot wurde. Das Mädchen hörte nicht auf zu schreien und wurde eins mit dem Chor der Qualen, der die Nacht erfüllte.
Er kämpfte sich auf die Beine und stolperte zu Michael hinüber, der zusammengekrümmt neben der Kapelle lag.
Der Junge lebte.
Er sah sich nach Amicia um. Vorhin hatte sie genau dort gestanden, wo jetzt die junge Frau schrie. Aber sie war verschwunden. Er rief nach einer Schwester – nach irgendjemandem –, und dann kamen gleich vier herbeigelaufen. Vorsichtig fuhren sie mit den Händen über ihn und hoben ihn von Michael weg.
Nun hörte er auch die Stimmen von Männern. Ihre Rufe klangen triumphierend durch die Schmerzensschreie, aber er beachtete sie nicht und schleppte sich zu Tom hinüber.
Der saß gegen die Stallwand gelehnt. »Mein Rückenpanzer hat den Schlag abbekommen«, sagte er mit einem Grinsen. »Bei Christus, ich hab schon gedacht, jetzt ist es aus mit mir.« Er deutete auf das Schwert. »Netter Einfall, das.«
»Halbschwert gegen Lindwurm«, sagte der Hauptmann. »Eine Standardübung. Aber nur die besten Lehrer unterrichten sie.« Er zog sich die Reste seines linken Handschuhs aus und wickelte sie fest um seine Verletzung. »Ich brauche aber noch mehr Übung.«
Tom kicherte. »Ich nehme an, Pampe hat den anderen umgebracht«, sagte er und deutete auf die jubelnden Bogenschützen.
Im nächsten Augenblick ritt der Ausfalltrupp durch das Tor und schleifte den toten Lindwurm am Kopf hinter sich her. Er war von etwa fünfzig Pfeilen zu Fall gebracht worden und unter den Lanzenspitzen gestorben, ohne einen einzigen Menschen verletzt zu haben.
Tom nickte. »Das war gute Arbeit, Hauptmann.«
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern. »Wir waren bereit, wir haben unsere Falle gestellt, ihr habt das feindliche Lager niedergebrannt und sie überrascht, und sie bringen unsere Leute noch immer um.« Er schüttelte den Kopf. »Ich war nicht gut genug vorbereitet. Habe meine Zeit verschwendet.«
Tom zuckte ebenfalls mit den Achseln. »Sie haben eine Menge Menschen umgebracht.« Er hob eine Braue. »Aber nicht viele von unseren Leuten.«
»Du bist ein harter Hund, Tom MacLachlan.«
Tom Schlimm zuckte noch einmal die Schultern. Offenbar nahm er es als Kompliment auf. Dann erregte etwas in der Kapelle seine Aufmerksamkeit. Er rümpfte die Nase, als hätte er etwas Schlechtes gerochen.
»Was ist los?«, fragte der Hauptmann.
»Habt Ihr je bemerkt, dass sie kleiner werden, wenn sie tot sind?«, fragte Tom. »Es ist nur die Angst, die sie so groß macht.«
Der Hauptmann nickte. Er betrachtete ebenfalls den Lindwurm und musste zugestehen, dass er jetzt wirklich kleiner schien, als er im Kampf gewirkt hatte. Und er sah anders aus. Blasser. Eine Masse aus Wunden und Schnitten und Widerhaken.
Beinahe bemitleidenswert.
Tom lächelte und mühte sich auf die Beine, und nun war auch die Äbtissin hier.
Der Hauptmann erwartete, wütende Schuldzuweisungen von ihr zu hören, aber sie streckte nur die Hand aus und ergriff die seine.
»Wir sollten unsere Leute heilen«, sagte sie.
Der Hauptmann nickte und drückte noch immer den Handschuh gegen seine Hand. Viel Blut klebte daran. Er bemerkte gerade noch ihren seltsamen Blick, dann wurde er in ihren Armen ohnmächtig.
Albinkirk · Ser Alcaeus
Mitten in der nächsten Nacht griff der Feind die Burg von Albinkirk an.
Ser Alcaeus befand sich jenseits aller Erschöpfung. Er steckte in einer Welt, die nur von einem Herzschlag zum nächsten bestand, und die Ereignisse folgten wie eine Reihe heller Lichtblitze aufeinander, als befänden sie sich allesamt in einem gewaltigen Gewitter.
Es gab einige Angriffe auf die Mauern der Burg, aber im Gegensatz zu den niedrigen Ringmauern der Stadt waren die der Burg so hoch und so gut gepflegt, dass die Flut der Kreaturen, die aus der Wildnis kamen, sie nicht erklettern konnte. Die Handvoll Bestien, die es tatsächlich bis nach oben schaffte, wurde sofort getötet.
Aber jeder Angriff kostete mehr Kraft.
Ein blitzartiger Kampf mit einem Irk – eine große, schmale, schöne Kreatur mit einer gebogenen Nase wie dem Schnabel eines Raubvogels und einem Kettenhemd, das so fein wie Fischschuppen gewirkt war und sein Schwert immer wieder ablenkte. Mit der Kraft der Verzweiflung schleuderte er das Wesen auf die Steine. Der Helm des Irks flog davon, seine Augen bettelten um Gnade. Wie die eines Menschen.
Alcaeus würde sich immer daran erinnern. Als sein Dolch der Kreatur ein Ende bereitete, stellte er fest, dass auch sie etwas Menschliches an sich gehabt hatte.
Was nun folgte, war noch viel schlimmer.
Denn es drang etwas anderes herbei.
Das war gewaltig und unheilverkündend und kam aus den Ruinen der Stadt, die vom Feuerschein erhellt wurden. Es schritt mit einem scheußlich watschelnden Gang voran und war so hoch wie die Stadtmauer oder sogar noch höher.
Und es lebte.
Nun hob es seinen Stab – der so lang war wie die Lanze eines Turnierritters oder sogar noch länger –, und eine Linie aus weiß-grünem Feuer traf die Burgmauer. Der Stein lenkte es eine Weile ab.
Und dann knirschte es, und die Mauer brach etwa zehn Schritte links vom Tor durch. Die gesamte Mauer bewegte sich. Männer fielen von ihr herab, und Steine folgten ihnen und zerschmetterten alle Kreaturen unter ihr.
Dann hob das Ungeheuer die Arme, als würde es die Sterne aus dem Himmel herabrufen. Als sie tatsächlich zu stürzen schienen, musste sich Alcaeus davon abhalten, sich auf den Boden zu werfen und das Gesicht zu verbergen.
Die Sterne kreischten aus dem klaren Himmel herunter, fielen mit einem schrecklichen, unirdischen Jammern zur Erde und trafen sie. Einer schlug draußen auf den Feldern ein und tötete eine Welle von Kobolden. Einer ging mitten im Ort nieder, und die Feuerwolke stieg bis in den Himmel hinauf. Die ganze Burg erzitterte, dann erhob sich eine Staubwolke wie eine Faust, die dem Himmel drohte.
Der dritte traf die Burgmauer nur wenige Fuß von dem klaffenden Spalt entfernt, und ein gewaltiges Mauerstück brach unter großem Krachen ab.
Alcaeus lief zu der Bresche; ein weiterer Mann in einer Rüstung kam ihm zu Hilfe. Es war vermutlich Cartwright oder der Gallyer Benois. Der Spalt in der Mauer war recht schmal, höchstens zwei Mann breit.
Sie füllten ihn mit ihren Körpern.
Und der Feind kam auf sie zu.
Irgendwann fiel Benois. Er war starr vor Verblüffung, und Alcaeus versuchte ihn zu schützen, doch der Feind streckte hundert Hände und Klauen nach seinen Füßen aus, bohrte die Krallen in sein Fleisch und zerrte ihn Zoll für Zoll zum Rand der Mauer. Er kreischte, war außer sich vor Grauen und versuchte sich festzuhalten. Koboldwaffen schnitten in die weichen Körperstellen, die nicht von der Rüstung bedeckt waren, und schälten die Panzerung von ihm ab.
Sie fraßen ihn bei lebendigem Leibe.
Alcaeus schlug immer wieder zu, wurde von Angst und Verzweiflung angetrieben, hockte sich auf den Körper des kreischenden Mannes und hieb auf die Feinde ein.
Es reichte aber nicht. Und dann griff Benois nach Alcaeus’ Fußknöcheln.
Er riss sich los, sprang auf die lockeren Steine neben dem Spalt, und Benois verschwand. Ein Haufen der Höllenbrut nährte sich von ihm, seine Rüstung war aufgerissen …
Alcaeus zwang sich zum Atmen.
Plötzlich war Ser John mit seinem Streitkolben neben ihm. Die fünf Fuß lange Waffe bewegte sich wie der Besen einer Hausmutter an einem frischen Frühlingsmorgen und zerschmetterte zuerst die Kobolde in ihrer Nähe und dann Benois’ Schädel.
Im Osten blitzte Licht auf, während der ferne Knall von verdrängter Luft zu hören war. Eine Flammensäule sprang in einer Entfernung von einer, vielleicht auch von zwei Meilen auf.
Dann noch eine, diese sogar noch größer.
Die Kreaturen der Wildnis hielten inne, warfen Blicke über die Schulter, und die Wut ihres Angriffs ließ schlagartig nach.
Albinkirk · Thorn
Sofort wusste Thorn, dass etwas schiefgegangen war.
Er hatte sich ausgetrocknet, indem er sogar die kleinsten Steine vom Himmel geholt hatte. Es war eine ungenaue, nicht sehr wirksame und prahlerische Arbeit, aber manchmal zeitigte sie ungeheure Ergebnisse. Er liebte es, dies zu tun, ebenso wie ein Mann es liebte, seine Stärke zu zeigen.
Die Dämonen waren beeindruckt, und das allein war die erschöpfende Mühe wert. Die Stadt war nun völlig zerstört. Es war viel einfacher gewesen, als er gehofft hatte.
Ich bin so stark, dachte er. Was er als bloße Ablenkung geplant hatte, war zu einem Triumph geworden. Sie würde davon hören und sich vor Angst niederkauern.
Vielleicht ist es doch gut, den Felsen einzunehmen. Vielleicht werde ich in Zukunft den Kriegsherrn spielen.
Doch dann stiegen die beiden Feuersäulen hinter ihm auf – aus seinem eigenen Lager, wo seine besten Verbündeten, die Irks und die Kobolde, ihre Nahrungsmittel und Habseligkeiten sowie Sklaven und Beute untergebracht hatten. Und dieses Lager stand nun in Flammen.
Er hatte seine besten Truppen zur Verteidigung dort gelassen.
Nun ließ er seine Armee umdrehen und dorthin eilen.
Der größte Teil der Kreaturen der Wildnis folgte ihm, ohne dass er sie dazu zwingen musste. Sie hatten keine Disziplin, aber jetzt bewegten sie sich wie ein Fischschwarm …
Albinkirk · Ser Alcaeus
Alcaeus war gegen die Mauer gesackt und sah ihnen nach. Benois sah wie ein geschlachtetes Tier aus; seine Knochen waren abgeschält. Die Kobolde hatten sich an ihm gütlich getan.
Die Sonne ging auf, und die Unterstadt war ein einziges Schlachthaus des Grauens. Auf dem Hauptplatz hatten sich einige Irks die Zeit genommen, einen Mann sorgfältig abzubalgen und ihn an ein Kreuz zu hängen. Er lebte noch.
James, der Armbrustschütze, trat in den Spalt. Er sah den Gekreuzigten lange an, hob dann seine Waffe und erschoss ihn. In Anbetracht der Entfernung war es ein guter Schuss. Der kreischende, hautlose Schädel des Mannes sank nach vorn, und er war still.
Ser John sackte gegen die andere Mauer. James half dem alten Mann, das Visier hochzuklappen. Er zwinkerte.
Er zwinkerte.
In diesem Augenblick wurde der alte Mann für Ser Alcaeus zum Helden.
Alcaeus lächelte ihn an, auch wenn ihm nicht danach war. Der Verlust von Benois schmerzte. Und er spürte noch die Hände des Mannes an seinem Knöchel …
»Ich will, dass Ihr zum König reitet«, sagte Ser John. »Sofort, solange dieses Wunder, das uns den Aufschub verschafft hat, anhält.«
Alcaeus war derselben Meinung, denn eine Stunde später saß er ohne Rüstung auf seinem besten Pferd und galoppierte nach Süden. Es war ein verzweifelter Versuch.
Doch er war zu müde, um sich Sorgen zu machen.