12
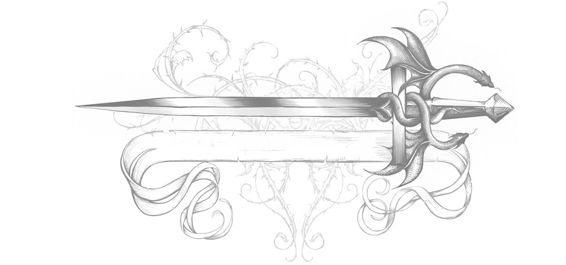
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Die Belagerung von Lissen Carak. Sechster Tag.
Die Wälder um uns herum sind still. Trauern denn auch Ungeheuer?
Vorgestern hat der Hauptmann einen beachtlichen Sieg über den Feind errungen. Er hat den größten Teil unserer Truppe durch den Cohocton nach Süden geführt, wo Meister Gelfred eine Karawane entdeckt hatte, die in unserer Richtung unterwegs war. Sie wurde schwer getroffen, doch der Ausfall des Hauptmanns hat den Gegner von hinten erwischt und vernichtet. Der Hauptmann schätzt, dass wir mehr als fünfhundert Feinde getötet haben – einschließlich vier großer Ungeheuer, nämlich drei gewaltige Steintrolle und ein Behemoth.
Die Männer sagen, der Hauptmann habe den Behemoth selbst getötet, und es sei die größte Heldentat gewesen, die sie je gesehen hatten.
Gestern stand die Kompanie den ganzen Tag hindurch still und wartete auf einen Angriff, der jedoch nicht erfolgt ist. Die Männer haben in voller Rüstung und Bewaffnung auf dem Posten geschlafen.
Viele Bauern und genauso viele Nonnen behaupten, das sei das Ende der Belagerung; der Feind werde sich nun hinfortstehlen. Die Äbtissin hat einen Rat aller Offiziere einberufen.
Die Äbtissin hatte einen großen Tisch hereintragen lassen. Es war der längste, den der Hauptmann je gesehen hatte. Er füllte die Große Halle vom Kamin bis zum Podest aus, und dreißig Männer konnten zu beiden Seiten nebeneinander an ihm Platz nehmen.
Doch sie waren nur zu sechst. Und die Äbtissin war dabei.
Die sechs waren der Hauptmann selbst, der die Füße auf den Stuhl neben sich gelegt hatte, sowie Ser Jehannes, der aufrecht auf dem Stuhl daneben saß, und Meister Gerald Random, der dadurch, dass fast sein halber Konvoi hatte gerettet werden können, plötzlich zum Sprecher aller Kaufleute geworden war und ebenfalls zwei Stühle einnahm, und Ser Milus als Kommandant der Brückenburg, der die Ellbogen auf die Tischplatte gestellt und den Kopf in die Hände gestützt hatte. Meister Gelfred saß abseits von den anderen, mit denen er sich offenbar nicht gemein machen wollte. Pater Henry, der Priester, saß mit einem Stylus und einigen Wachstafeln da und war bereit, die getroffenen Entscheidungen aufzuschreiben.
Die Äbtissin saß zur Rechten des Hauptmanns und wurde von zwei Schwestern flankiert, die neben ihr standen. Der Hauptmann hatte in Erfahrung gebracht, dass diese beiden die Cellerarin und die Novizenmeisterin waren und damit die beiden wichtigsten Ämter im Kloster innehatten. Es handelte sich um Schwester Miram und Schwester Ann.
Als sich alle Männer niedergelassen hatten, räusperte sich die Äbtissin. »Hauptmann?«, fragte sie.
Er nahm die Stiefel vom Stuhl und setzte sich auf. »Also gut«, sagte er. »Nun werden wir endlich belagert. Unser Feind hat in Erfahrung gebracht, wie wenige wir sind, außerdem hat er die Straßen gesperrt.« Er zuckte mit den Schultern. »Das ist eine schlimmere Niederlage, als wir sie je im Feld erdulden mussten. Nach dem gestrigen ungeheuren Glücksfall für uns hätte der Feind eigentlich glauben müssen, dass …«
»Das Werk Gottes!«, warf Meister Random ein.
»Der Feind hätte eigentlich annehmen sollen«, fuhr der Hauptmann fort, »dass wir eine große Garnison und eine Menge mächtiger Phantasmata zur Verfügung haben, wenn es uns möglich ist, einen solchen Angriff zu führen. Stattdessen hat er die Nacht dazu benutzt, in alle meine Außenposten einzurücken. Ich habe in der letzten Nacht drei sehr gute Männer verloren, meine Damen und Herren.« Er sah sich um. Die sorgsam versteckten Armbrustschützen im Boden hatten nicht ausgereicht, und nun waren Guillaume Langschwert, einer seiner Offiziere sowie dessen Page und Bogenschütze tot, und der junge Will, sein Knappe, weinte sich im Krankensaal die Gedärme aus dem Leib. »Das sind mehr Männer, als wir im gestrigen Kampf verloren haben«, fügte er hinzu.
Die übrigen Söldner nickten.
»Allerdings ist positiv anzumerken, dass uns Meister Random ein Dutzend Soldaten und sechzig Bogenschützen verschafft hat.« Von sehr unterschiedlicher Güte, und jeder von ihnen ist gestern irgendwann im Verlauf des Kampfes weggelaufen. Jeder außer einem, dachte er verbittert. Ser Gawin hatte sich noch nicht dazu herabgelassen, die Augen zu öffnen.
»Meine Gildenmänner sind keine richtigen Bogenschützen«, wandte Meister Random ein.
Der Hauptmann lehnte sich zurück und betrachtete den Mann. »Ich weiß, dass sie das nicht sind«, sagte er. »Aber für die Dauer der Belagerung werden sie wie Soldaten behandelt, Meister.«
Random nickte. »Ich kann ebenfalls ein Schwert schwingen.«
Der Hauptmann hatte bereits bemerkt, dass er eines trug, und den Berichten zufolge hatte sich der Kaufmann auch recht gut geschlagen.
»Wir haben also vierzig Männer, die eine Rüstung zu tragen imstande sind«, fuhr er fort, »und dazu unsere Knappen, insgesamt immerhin eine Streitkraft, die mit der von sechzig Rittern vergleichbar ist. Wir verfügen etwa über die dreifache Zahl von Bogenschützen, dank den besseren Bauern und den Gildenmännern.« Er sah sich um. »Unser Feind besitzt hingegen mindestens fünftausend Kämpfer – Kobolde, Irks, Verbündete und Menschen zusammengenommen.«
»Gütiger Gott im Himmel!« Ser Milus richtete sich auf.
Ser Jehannes sah aus, als hätte er etwas Verfaultes gegessen.
Meister Gelfred nickte, als der Hauptmann den Blick auf ihn richtete. »Angesichts dessen, was ich heute Morgen beobachten musste, können es nicht weniger sein«, sagte er. »Der Feind kann jede Straße und jeden Pfad gleichzeitig blockieren, und sie wechseln ihre Kämpfer alle paar Stunden aus.« Er zuckte die Schultern. »Man kann den Kobolden dabei zusehen, wie sie hinter der Reichweite unserer Schleudern Gräben ausheben. Es ist, als würde man Termiten bei der Arbeit zuschauen. Allerdings sind es ziemlich große und ziemlich viele Termiten.«
Der Hauptmann sah sich weiter um. »Dazu haben wir noch hundert Kaufleute und ihren Tross sowie vierhundert Frauen und Kinder.« Er lächelte. »Wenn wir im Osten wären, würde ich sie jetzt sofort nach draußen schicken, damit sie die Reihen der Belagerer mit nutzlosen Mäulern anfüllen. Aber hier würden sie stattdessen nur deren Bäuche füllen.« Niemand schien seinen Humor zu schätzen.
»Das könnt Ihr nicht ernsthaft in Erwägung ziehen!«, sagte die Äbtissin.
»Selbstverständlich nicht. Ich werde niemanden hinaus in den Tod treiben. Aber die Kaufleute und deren Tross müssen sich nützlich machen. Ich werde ein Dutzend Bogenschützen und zwei Soldaten zu ihrer Ausbildung abstellen. Wenn wir diese nutzlosen Mäuler nicht loswerden können, dann müssen wir sie uns halt nutzbar machen. Wir haben etwa vierzig Tagesrationen für ungefähr tausend Personen und kommen doppelt so lange aus, wenn wir die Rationen halbieren.«
»Und wir haben all dieses Getreide!«, rief ihm die Äbtissin in Erinnerung.
»Getreide für zweihundertachtzig Tage«, sagte er.
»Der König wird viel früher hier eintreffen«, meinte die Äbtissin überzeugt.
»Ich wünsche einen guten Tag«, sagte eine Stimme von der Tür aus, und der Magier Harmodius trat ein. Er lächelte in die Runde und schien sich ein wenig unsicher zu sein, ob er hier willkommen war. »Ich habe Eure Einladung erhalten, aber ich befand mich gerade mitten in einer Obduktion. Ihr, Mylords, sorgt für ausreichend Material zum Obduzieren.« Er lächelte. »Ich habe einige neue und sehr aufregende Dinge gelernt.«
Sie alle starrten ihn wie einen Leprakranken an, der gerade auf einem Fest erschienen war. Er zog einen Stuhl hervor und setzte sich.
»Übrigens waren Ratten im Korn«, sagte Harmodius. »Ich habe sie beseitigt. Wisst Ihr eigentlich, wer der Hauptmann der Feinde ist?«, fragte er und sah dabei die Äbtissin an.
Sie zuckte zusammen.
»Aha, ich sehe, Ihr wisst es. Hm.« Der alte Magus wirkte heute gar nicht so alt – eher wie vierzig als wie siebzig. »Natürlich erinnere ich mich an Euch, Mylady.«
Die Äbtissin zitterte einen Augenblick lang, dann zwang sie sich, den Magus anzusehen. Der Hauptmann erkannte, wie viel Mühe ihr das bereitete.
»Und ich kenne Euch ebenfalls«, sagte die Äbtissin.
»Wie schön, dass es so viele Geheimnisse gibt«, meinte der Hauptmann. »Ich zumindest freue mich aufrichtig, dass Ihr beide keine Fremden füreinander seid.«
Der Magus sah ihn an. »Das aus Eurem Munde?« Er beugte sich vor. »Ich weiß auch, wer Ihr seid, mein Junge.«
Jeder Kopf im Raum fuhr ruckartig herum. Zuerst sahen die Männer den Hauptmann und dann den Magus an.
»Ach?«, fragte die Äbtissin und griff nach dem Rosenkranz, der ihr um den Hals hing. »Wirklich?«
Harmodius genoss diesen theatralischen Augenblick, wie der Hauptmann deutlich bemerkte. Er wünschte, er wüsste, wer dieser alte Scharlatan war, und tastete nach seinem Dolch.
»Wenn Ihr mich bloßstellt, dann schwöre ich vor dem Altar Eures Gottes, dass ich Euch hier und jetzt die Kehle durchschneiden werde«, zischte der Hauptmann.
Harmodius lachte und schaukelte auf seinem Stuhl zurück. »Weder Ihr noch die anderen Anwesenden können mir auch nur ein Haar krümmen«, sagte er und hob die Hand.
Die Söldner sprangen auf die Beine und hatten schon ihre Waffen in den Händen.
Doch dann schüttelte der Magier den Kopf. »Meine Herren«, sagte er. »Ich bitte Euch um Entschuldigung, Hauptmann. Wirklich. Ich mag Überraschungen. Ich dachte, vielleicht … aber bitte gebt nicht allzu viel auf das Gerede eines alten Mannes.«
»Wer zum Teufel seid Ihr?«, fragte der Hauptmann über seine gezogene Klinge hinweg.
Die Äbtissin schüttelte den Kopf. »Das ist Harmodius Silva, der Magus des Königs. Er hat den Feind bei Chevin besiegt. Und er hat den vorherigen Magus des Königs unschädlich gemacht, als dieser uns betrogen hat.«
»Und Euer Liebhaber«, murmelte Harmodius. »Nun ja, einer Eurer Liebhaber.«
»Damals seid Ihr ein närrischer junger Mann gewesen, und tief in Eurem Herzen seid Ihr das noch immer.« Die Äbtissin lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück.
»Mylady, wenn ich das sein sollte, dann nur, weil er mich jahrelang geblendet hat«, sagte Harmodius. »Ich war nicht so siegreich, wie ich geglaubt hatte. Und er ist noch unter uns.« Harmodius sah sich am Tisch um. »Der Hauptmann des Feindes, Mylords, ist der frühere Magus des Königs – der mächtigste, den mein Orden in den letzten zwanzig Generationen hervorgebracht hat.« Er zuckte die Achseln. »Das vermute ich zumindest, aber meine Vermutung ist auf meine eigene Beobachtung gegründet.«
»Ihr seid zu bescheiden«, erwiderte die Äbtissin verbittert.
»Ich habe ihm damals eine Falle gestellt, wie Ihr genau wisst«, sagte Harmodius. »Ich hätte nicht einmal hoffen dürfen, seinen Phantasmata mit den meinen entgegentreten zu können. Und jetzt vermag ich es noch weniger, da er sich an die Wildnis verkauft hat und ich mindestens ein Jahrzehnt in dem Gefängnis verbracht habe, das er für mich eingerichtet hat.«
Die Soldaten und der Kaufmann beobachteten diesen Wortwechsel wie Zuschauer in einem Turnier. Sogar der Hauptmann, dessen kostbare Anonymität sich am Rande der Entdeckung befunden hatte, schien ganz gefangen davon.
»Nur damit ich es richtig verstehe«, sagte er, »unser Feind ist tatsächlich ein Mensch?«
»Nicht mehr«, antwortete Harmodius. »Inzwischen ist er eine Wesenheit, die sich Thorn nennt. Ihre Macht verhält sich zu der meinen wie meine zu jener der Äbtissin.«
Der Priester am Ende des Tisches schrieb nicht mehr mit. Nun sah er sie alle mit großem Entsetzen an. Dem Hauptmann tat er beinahe leid. Seine Abneigung gegen alle, die die Macht hatten – sei sie hermetisch oder natürlich –, war wie die Abneigung der meisten Menschen gegen die Berührung mit einer Krankheit.
Der Hauptmann beugte sich vor. »Könnten wir vielleicht die Flut der Erinnerungen und Enthüllungen eindämmen und versuchen, uns auf die Belagerung zu beschränken?«, fragte er.
»Er hat Euch unterschätzt, und Ihr habt ihm wehgetan, doch das ist jetzt vorbei«, erklärte Harmodius. »Jetzt wird er uns wehtun.«
»Vielen Dank für diese Information«, meinte der Hauptmann.
»Da er nun unsere Zugänge zur Außenwelt versperrt hat, wird es keine Überraschungsangriffe und keine Siege mehr für uns geben.« Der Magus setzte sich zurück. »Und kommt nicht auf den Gedanken, dass ich mich ihm entgegenstellen könnte, denn dazu bin ich nicht in der Lage. Meine Gegenwart hier wird ihn nur noch mehr dazu anstacheln, diesen Ort einzunehmen.«
»Wir können noch immer Ausfälle mit der Aussicht auf Erfolg unternehmen«, beharrte der Hauptmann. »Mit Messire Randoms Karawane verfügen wir jetzt über mehr Soldaten und Bogenschützen als zu Beginn.«
Harmodius schüttelte den Kopf. »Das bezweifle ich nicht. Ich will nicht respektlos vor Euch erscheinen, denn Ihr habt Euch edelmütig verhalten. Aber die Schliche mit den Falken und Hunden wird nicht noch einmal glücken, und seine Klugheit – pardon, Hauptmann – ist mehr als beeindruckend. Innerhalb dieser Mauern wird er Verräter haben, und er wird daran arbeiten, Verräter auch innerhalb Eurer Truppen und der der Kaufmannschaft anzuwerben. Außerdem besitzt er die Möglichkeit, seine Fühler nach jeder Person unter uns auszustrecken, die die Macht besitzt. Wie stark ist Euer Wille, Mylady?«, fragte er.
»Er war noch nie sehr stark«, antwortete sie gleichmütig, »aber wenn es um ihn geht, werde ich stahlhart sein.«
Harmodius lächelte. »Das kann ich mir vorstellen, Mylady«, gab er zu.
»Selbst wenn er uns hier eingesperrt hat und seine Verbündeten jeden Tag gegen unsere Mauern schleudert, können wir es überstehen«, beharrte der Hauptmann.
»Das wird er nicht tun«, sagte Harmodius. Er lehnte sich vor, und es wirkte, als werde die Luft aus ihm herausgelassen; so plötzlich war die Veränderung, die er durchmachte. »Er wird versuchen, uns zu untergraben und zu zersetzen, denn nur so wird er ans Ziel gelangen. Er wird Tücke und Irreführung anwenden, denn er bevorzugt es, einen Verräter zur Öffnung des Tores einzusetzen, weil dies seinen eigenen Verrat entschuldigt. Und weil ihm der Gedanke gefällt, dass sein Verstand dem aller anderen überlegen ist.«
Dem Hauptmann gelang ein schwaches Lächeln. »Mein alter Schwertmeister pflegte zu sagen, dass ein guter Schwertkämpfer nicht nur siegen, sondern es auf seine ganz eigene Art und Weise schaffen will.«
»Sehr wahr«, meinte der Magus. »Hochmütig zwar, aber wahr.«
Der Hauptmann nickte. »Hochmut ist gewiss auch in Eurer Profession ein häufig auftretender Zug?«
Harmodius lächelte bitter.
Der Hauptmann lehnte sich vor. »Ich habe zwei Fragen, die Ihr mir sicherlich beantworten könnt. Ist er in der Lage, die Mauern unmittelbar anzugreifen? Mit einem Phantasma?«
»Niemals« antwortete die Äbtissin. »Diese Mauern haben ein halbes Jahrtausend von Gebeten und Phantasmata in sich, und keine Macht auf der Erde …«
»Doch«, unterbrach Harmodius sie und zuckte die Achseln. »Er ist nicht mehr Richard Plangere, der Edelmann und Magus, Mylady, der sich nun lediglich in Federn kleidet und ein wenig böse geworden ist. Er ist Thorn. Er ist eine Macht der Wildnis. Wenn er will, kann er die Mauern dieser alten Festung mit seiner Macht angreifen, und am Ende wird er sie brechen.« Er wandte sich an den Hauptmann. »Aber wenn ich mich nicht schrecklich irre, wird er diese Möglichkeit erst dann ergreifen, wenn alles andere gescheitert ist, denn der Preis, den er dafür bezahlen müsste, wäre ungeheuerlich.«
Der Hauptmann nickte. »Eine solche Antwort hatte ich erwartet. Zweite Frage: Ihr seid der Magus des Königs. Hättet Ihr die Macht, Thorn abzulenken? Oder gar die, ihn zu besiegen?«
Harmodius nickte. »Ich glaube, ich könnte ihn durchaus ablenken – vielleicht ohne große Gefahr für mich, vielleicht aber auch unter großen Gefahren.« Er lachte. »Ich spüre ihn überall um uns herum, Mylords. Er will unsere Gedanken ausforschen, aber bisher hat ihn die Macht in diesem Konvent und in den Festungsmauern aufgehalten. Er weiß, dass ich hier bin, doch ich glaube nicht, dass er auch schon weiß, wer ich bin.« Harmodius schüttelte den Kopf und schien wieder einmal zu schrumpfen. »Aber bis vor ein paar Tagen habe ich nicht einmal selbst gewusst, wer ich in Wirklichkeit bin. Bei Gott, wie er mich in die Irre geführt hat!«
Der Hauptmann lehnte sich zurück und dachte angestrengt nach. »Könnt Ihr Euch einen Umstand vorstellen, der dazu führen würde, dass er die Belagerung aufgibt?«, fragte er. »Würde er sich zum Beispiel einfach zurückziehen, wenn der König kommt?«
Harmodius sah die anderen lange an. »Ihr habt wirklich keine Ahnung, womit Ihr es zu tun habt«, meinte er. »Glaubt Ihr denn wirklich, dass es der König bis hierher schaffen wird?«
Der Hauptmann verzog das Gesicht. »Ihr seid der allwissende Magus, und ich bin bloß ein junger Spund, der ein paar Söldner befehligt, aber mir scheint es …«
»Erspart uns Eure falsche Demut«, fuhr Harmodius ihn an.
»Und Ihr solltet uns Eure ungeheure Anmaßung ersparen! Für mich hat es den Anschein, dass der Feind keinen sorgfältig ausgearbeiteten Plan hat, und bei allem gebotenen Respekt, Magus, mir scheint dieser Thorn nicht so ungeheuer schlau zu sein, wie Ihr behauptet.« Der Hauptmann sah sich um.
Ser Milus nickte. »Ich stimme Euch zu. Er macht Anfängerfehler. Hat keine Ahnung von Kriegsführung.« Er zuckte mit den Achseln. »Zumindest nicht von der menschlichen Kriegsführung.«
Harmodius wollte etwas entgegnen, doch dann zupfte er nur an seinem langen Bart. Eine drückende Stille setzte ein. Die Männer am Tisch begriffen, dass sie auf die Erwiderung des Magus vorbereitet wurden.
Doch er schüttelte den Kopf. »Das ist … ein interessanter Gesichtspunkt. Und möglicherweise auch ein sehr treffender.«
Pater Henry ging mit hängenden Schultern aus der großen Halle. Meg beobachtete ihn, wie er die Kapelle betrat, sich auf einen geschnitzten Stuhl in der Nähe der Tür setzte und den Kopf auf die Hände stützte.
Er war kein schlechter Priester. Er hatte ihr die Beichte abgenommen und sie mit einer erträglichen Buße Gott anvertraut. Gern hätte sie ihn deswegen gemocht, wäre nicht in seinen Augen etwas gewesen, das sie nicht mögen konnte. Außerdem war seine feuchte Hand auf ihrer Stirn unangenehm gewesen.
Über all dies dachte sie nach, als die Bogenschützen herbeikamen. Es waren zwei jüngere Schützen, die sie nicht gut kannte. Der Größere trug sein Haar hellrot und zeigte ein leeres Lächeln. Sie hatten ihre Panzerhemden ausgezogen und sahen sich im Hof um.
Sie wirkten, als würden sie gleich Schwierigkeiten machen.
Der Große mit einem Bart wie eine Judasziege hatte die Wäscherin Lis erspäht, doch sie gab sich nicht mit Männern seines Alters ab und drehte ihm den Rücken zu, sodass seine Aufmerksamkeit zu Amie hinüberwanderte, der Ältesten des Kutschers. Sie war eine Blonde mit mehr Oberweite als Hirn, wie ihre Mutter selbst gesagt hatte, während ihre jüngere Schwester Kitty nicht nur klug war, sondern auch wunderschöne dunkle Locken und leicht mandelförmige Augen hatte.
Die Bogenschützen gingen auf die beiden Mädchen zu, die auf Schemeln neben der Klosterküche saßen und in Handmühlen die Gerste für das Brot mahlten. Es war eine langweilige und doch wichtige Tätigkeit, die die Nonnen allerdings für begehrenswerte junge Frauen als bestens geeignet hielten.
Sie hatten bereits einen ganzen Hof von Bewunderern, und die jungen Männer – Bauernsöhne und Lehrlinge – machten natürlich die Arbeit für sie. Das fanden die Nonnen vermutlich nicht so schlimm, dachte Meg, aber wenn sie nichts dagegen unternahmen, würden diese Mädchen und auch alle anderen Frauen in der Festung bald verdorben sein und ihre Arbeit von anderen erledigen lassen. Und bei einigen Nonnen wäre es vielleicht genauso, dachte Meg.
Inzwischen hatte sie einige der älteren Schwestern kennengelernt …
Sie hatte nicht hören können, was der eine Bogenschütze gesagt hatte, aber jeder Bauernjunge und Lehrling war innerhalb eines Herzschlages auf den Beinen.
Die Bogenschützen lachten, setzten sich und polierten ihre Helme und Ellbogenschützer mit Asche und Werg, bis sie jenen einheitlichen dunklen Glanz erhielten, der die Männer der Söldnerkompanie hervorhob.
Meg ging auf sie zu. Sie spürte, dass es Schwierigkeiten geben würde, auch wenn die Bogenschützen sie nicht zu provozieren schienen.
»Jeder Trampel kann einem Pflug folgen«, sagte Judasbart. »Das hab ich auch mal gemacht.«
»Wer bist du denn?«, fragte einer der Lehrlinge.
»Ein Soldat«, antwortete Judasbart. Aus seinem Tonfall konnte Meg, die etliche junge Männer kennengelernt hatte, deutlich heraushören, dass diese Worte auf die Mädchen zielten.
Amie schaute von ihrer Mühle auf. Sie hatte dem Jungen des Schmieds den Stößel wieder abgenommen, weil sie wohl befürchtete, dass Meg sie verraten könnte. »Habt ihr – gekämpft? Gestern?«
»Ich habe ein Dutzend Kobolde getötet«, sagte Judasbart. »Das ist ganz leicht, wenn man weiß, wie es geht.«
»Wenn man weiß, wie es geht«, wiederholte der andere Bogenschütze, der bisher geschwiegen hatte. Er polierte nicht sonderlich hingebungsvoll.
»Dann ist es nicht anders als bei anderen Handwerken«, meinte der Schuhmacherlehrling.
»Mit der Ausnahme, dass ich reich sterben werde, während du noch bis zur Halskrause in der Pisse deines Meisters stehst«, sagte Judasbart.
Kitty stemmte die Hände in die Hüften. »Achte auf das, was du sagst«, riet sie.
Die Bogenschützen tauschten einen raschen Blick aus. »Wir tun doch alles für ein hübsches Mädchen«, sagte der Stille mit einem Lächeln, stand auf und machte eine höfliche Verbeugung – viel besser, als jeder Bauernjunge es konnte. »Ich bin sicher, davon hörst du schon genug, nicht wahr, Kleines?«
»Nenn mich nicht Kleines!«, beschwerte sich Kitty.
Amie lächelte den rotbärtigen Bogenschützen an.
Meg wusste nicht, was hier nicht stimmte. War es der Tonfall? Der Zorn der einheimischen Jungen schien die Bogenschützen nur noch anzustacheln.
»Wenn du etwas Talg drunter tust, geht’s besser«, sagte ein anderer Junge, eigentlich schon ein junger Mann. »Es sei denn du machst das nur als Schau.« Der Knabe grinste. Er war groß, breitschultrig und genauso wenig von hier wie die Bogenschützen.
Der Schweigsame schenkte ihm einen spöttischen Blick. »Wenn ich einen Schwachkopf brauche, der mir sagt, wie ich meine Rüstung polieren muss, dann frage ich dich.«
Der große Knabe grinste erneut. »Bist selbst ’n Schwachkopf, Bauernjunge. Ich komm aus Harndon, und ich kann die Kuhscheiße an deinen Schuhen bis hierher riechen.«
Kitty kicherte.
Das war das falsche Geräusch zur falschen Zeit – weiblicher Spott in einem kritischen Augenblick. Der Schweigsame wandte sich ihr zu. »Halt’s Maul, Schlampe.«
Plötzlich veränderte sich alles; es war wie in dem Augenblick, da die Sahne im Fass zu Butter wird.
Kitty lief rot an, aber sie legte dem Bauernjungen neben sich die Hand auf die Schulter. »Kein Grund zum Handeln«, sagte sie. »Kein Grund, mich zu verteidigen.«
Meg war stolz auf das Mädchen.
Aber Judasbart stand auf und schüttelte die Wergreste aus seinem Schoß. »Das ist richtig«, sagte er. »Sei vernünftig.« Er lächelte. »Du solltest lernen, die Beine breit zu machen, wenn ein Mann in der Nähe ist, so wie die andere es auch immer tut.«
Und wieder sprang jeder Bauernsohn auf die Beine, und plötzlich hatten beide Bogenschützen Messer in den Händen – lange Messer. Dann nahmen sie ihre eingeübten Kampfhaltungen ein. »Hat hier jemand Schneid?«, fragte Judasbart. »Pah. Ihr seid doch bloß Schafe, die uns dafür bezahlen, dass wir euch hüten. Und wenn mir danach ist, eines euer Lämmer zu bumsen, dann mach ich das einfach.«
Der große Junge aus Harndon trat aus der Gruppe der hiesigen Knaben hervor. »Ich nehm es mit euch beiden auf«, sagte er. »Und ich werde dafür sorgen, dass ihr zur Verantwortung gezogen werdet.« Er spuckte in die Hände, schien keine Eile zu haben – aber als er in die linke Hand spuckte, schoss auch sein linkes Bein vor. Er stand nahe vor dem Schweigsamen, rammte ihm das Knie in die Kniekehle, und plötzlich rotierte das Messer in der Hand des Bogenschützen. Er lag mit dem Gesicht im Staub, während ihm seine Messerhand gegen den Rücken gedrückt wurde.
»Christ!«, schrie er.
Der Junge aus Harndon stieß dem Bogenschützen das Knie in den Rücken und wandte sich dem anderen zu. »Lass dein Messer fallen, oder ich breche ihm die Schulter. Und dann werde ich dir den Schädel knacken.«
Judasbart brummte etwas, und daraufhin traf ihn ein schwerer Stock am Hinterkopf – traf ihn so hart, dass er wie ein Sack Steine zusammenfiel.
Meg stand ganz nahe vor dem Kommandanten der Söldner, der wie aus dem Nichts erschienen war und den rothaarigen Bogenschützen mit seinem Hauptmannsstab getroffen hatte. Sie quiekte auf.
Er stand über dem großen Jungen aus Harndon und dem kleineren Bogenschützen, der noch immer im Würgegriff des Größeren am Boden lag. »Lass ihn los«, sagte der Hauptmann ruhig. »Ich werde dafür sorgen, dass er bestraft wird, aber ich brauche seinen unversehrten Bogenarm.«
Der große Junge sah auf und nickte. Mit einer fließenden Bewegung erhob er sich dann und ließ den Bogenschützen auf dem Boden liegen. »Ich hätte auch Euren anderen Mann nehmen können«, sagte er.
»Das weiß ich«, erwiderte der Hauptmann. »Du bist ein Fuhrmann, nicht wahr?«
»Daniel Favor aus Harndon. Mein Vater ist Dick Favor und hat zehn Wagen auf der Straße.« Er nickte.
»Wie alt bist du, Daniel?«, fragte der Hauptmann. Dann beugte er sich hinunter und packte den Schweigsamen beim Ohr.
»Fünfzehn«, sagte der Harndoner.
Der Hauptmann nickte. »Kannst du einen Bogen spannen, Junge?«
Der große Knabe grinste. »Und auch mit dem Schwert kämpfen. Was den Bogen angeht – ja. Jede Größe, jedes Gewicht.«
»Hast du je über ein Leben als Soldat nachgedacht?«, fragte der Hauptmann.
Daniel nickte feierlich.
»Du könntest dabei helfen, dass dieser Übeltäter bestraft wird«, sagte der Hauptmann. »In den nächsten Wochen wirst du zwar kaum dazu kommen, einen Wagen zu lenken, aber ein Junge, der mit einem Bogen umgehen kann, wäre auch in der Lage, seine Freunde zu beschützen. Und auch ein paar schöne Frauen«, fügte der Hauptmann hinzu und verneigte sich zuerst vor den beiden Mädchen und dann vor Meg.
Will Carter trat vor. »Ich kann auch mit dem Bogen umgehen, Hauptmann«, sagte er mit zitternder Stimme.
Der Hauptmann lächelte. »Ja, wirklich?«, fragte er und sah dabei Meg an. »Auf ein Wort, gute Frau?«
Sie nickte. Der Hauptmann nahm sie beiseite, während er den schweigsamen Bogenschützen noch immer am Ohr festhielt und zwang, hinter ihm her zu taumeln.
»Wie schlimm war es?«, fragte er.
Sie sah ihm in die Augen. Es waren sehr hübsche Augen. Er war jünger, als es aus der Entfernung den Anschein hatte. Seine Leinenkleidung machte einen schrecklichen Eindruck; der Hemdkragen schien ruiniert und fadenscheinig, die Manschetten waren braun-schwarz vor Dreck, und ein langer Leinenfaden hing von seinem Wappenrock herunter. »Schlimm«, sagte sie und stellte fest, dass sie zitterte und ihre Knie nachzugeben drohten. Seine Augen waren nicht normal.
»Der Krieg bringt keine angenehmen Jungen hervor«, sagte er und zog noch einmal heftig am Ohr des Bogenschützen.
»Aber Ihr werdet es diesen jungen Kerlen schon zeigen«, sagte sie und dachte dabei: Was ist denn in dich gefahren, Mädchen? Rasch fügte sie hinzu: »Mylord.«
Er dachte über das nach, was sie gesagt hatte. Der Bogenschütze versuchte sich zu bewegen, und der Hauptmann drehte ihm heftig das Ohr um. »Ich verstehe. Aber die Alternative besteht darin, lebendig von der Wildnis gefressen zu werden«, sagte er reumütig, als verstünde er Meg nur allzu gut.
»Was wird mit ihm geschehen?«, fragte sie.
»Mit Sym?«, fragte der Hauptmann zurück und drehte den schweigsamen Bogenschützen so am Ohr herum, dass dieser aufschrie. »Sym wird vierzig Peitschenhiebe auf den Rücken erhalten – zehn täglich mit je zwei Tagen dazwischen, damit er sich auf etwas freuen kann. Es sei denn, mein Marschall ist der Ansicht, dass wir ein Exempel an ihm statuieren sollen.«
Sym schrie auf.
»In diesem Fall binden wir ihn auf ein Wagenrad und schneiden ihm den Rücken auf«, fuhr der Hauptmann fort. Sym schluchzte.
Meg wurde es schwindlig.
Der Hauptmann grinste sie an. »Es mag schrecklich klingen, aber das ist besser als eine Vergewaltigung. Wenn die Männer einmal damit angefangen haben, hören sie nicht mehr auf. Es tut mir leid, sollte ich allzu offen sein.« Er betrachtete sie, als würde sie jetzt zum ersten Mal wirklich sehen. »Du bist die Näherin, ja?«, fragte er.
Sie machte einen Knicks. »Das bin ich, Mylord.«
»Wärest du so freundlich, mich einmal aufzusuchen? Ich brauche … alles.« Er lächelte.
Sie nickte. »Das sehe ich«, sagte sie. Nun, da es um ihre Arbeit ging, richtete sie sich auf. »Hemden? Hosen? Kappen?«
»Vielleicht drei von jedem?«, fragte er und klang dabei sehnsuchtsvoll.
»Ich werde Euch heute Nachmittag aufsuchen, Mylord«, sagte sie und beugte rasch wieder das Knie.
»Also gut«, erwiderte er und zog den Bogenschützen am Ohr hinter sich her. Er ging zurück zu den Jungen aus dem Ort, die darin wetteiferten, die Carter-Mädchen zu trösten. Seltsamerweise stand der Junge aus Harndon unsicher daneben und nahm nicht an den Bemühungen teil. Meg warf ihm ein Lächeln zu und machte sich wieder an ihre Arbeit.
Lissen Carak · Tom Schlimm
Tom Lachlan saß an seinem Tisch im Turm der Festung. Er war zu seinem Büro geworden – zu seinem und dem von Bent, denn Bent wiederum war zu seiner rechten Hand geworden.
Er betrachtete gerade seine Karten, als er den unmissverständlichen Klang von hastenden Stiefeln auf der Treppe hörte.
Er war bereits auf den Beinen, hatte die Karten in einen Beutel geworfen und schaute durch eine der Schießscharten auf einige Kobolde, die im Licht der Sonne einen Graben aushoben, als der Hauptmann hereinkam.
Sym wurde von ihm auf den Tisch geworfen. Der Bogenschütze gab ein langgezogenes Quieken von sich, als der Hauptmann endlich sein Ohr losließ.
Tom seufzte. »Was hat dieser nutzlose Mistkerl denn jetzt schon wieder verbrochen?« Sym war eines der hellsten Lichter der ganzen Truppe – was Verbrechen anging.
Hinter dem Hauptmann kamen ein Dutzend Jungen die Treppe herauf.
Der Hauptmann deutete mit seinem Blick auf sie. »Neue Rekruten, Bogenschützen.«
Tom nickte. Es waren kräftig aussehende Jungen – er hatte selbst schon ein Auge auf sie geworfen: Bauernsöhne, allesamt große, gut genährte Knaben mit breiten Schultern und kräftigen Muskeln. An ihrer Spitze befand sich ein Junge, der so wirkte, als könnte er bald genauso groß werden wie Tom selbst.
Tom nickte noch einmal, und als er den Tisch umrundete, rammte er die Faust gegen Syms Kopf. »Nicht bewegen«, sagte er.
»Ich gehe jetzt in die Kommandantur«, sagte der Hauptmann.
Tom verneigte sich und wandte sich an die Jungen. »Wer von euch ist in der Lage, mit dem Bogen zu schießen?«, fragte er.
»Da ist noch ein anderer«, sagte der Hauptmann. »Red Beve liegt zusammengeschlagen im Hof. Morgen halte ich über beide Gericht. Korrekt und öffentlich, Tom.«
Das Hauptmannsgericht war eine offizielle Angelegenheit; dabei ging es nicht um zehn Peitschenhiebe, ohne dass Fragen gestellt würden, sondern um Verbrechen, für die der Hauptmann durchaus die Todesstrafe aussprechen konnte.
Er nickte den Jungen zu. »Sagt die Wahrheit, und gebt euer Bestes. Wir nehmen nicht jeden, und außerdem müssen eure Eltern einverstanden sein.«
Beinahe wäre Tom an seinem unterdrückten Lachen erstickt, aber der Rote Ritter machte es sehr gut – er war ein ausgezeichneter Rekrutierer, während es Tom noch nie gelungen war, jemanden zur Truppe einzuziehen – es sei denn, er hatte eine Keule in der einen Hand und eine Peitsche in der anderen. Wir nehmen nicht jeden. Nun ließ er es zu, dass das Lachen aus ihm herausbrach.
»Kommt, wir gehen nach unten zu den Strohpuppen. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid«, sagte er mit dem, was er für seinen freundlichsten Tonfall hielt. Dann beugte er sich zu Sym herunter. »Du bleibst am besten ganz still liegen, Junge. Der Hauptmann will deine Eingeweide auf einem Spieß drehen.«
Dann folgte er den Jungen hinunter in den Hof.
Der Hauptmann lehnte sich an das Geländer des Balkons, der vor seiner Kommandantur gezimmert worden war und etwa vierhundert Fuß über dem Boden aus der Festungsmauer hervorragte. Er beobachtete eine Gruppe von Männern – Gefangene? Es mussten Gefangene sein, die unter der Aufsicht von etwas Schrecklichem standen. Sie hoben Gräben aus.
So weit das Auge blicken konnte, gruben Menschen und Monstren Gräben. Es war ein Labyrinth – ein Muster, von dem er annahm, dass es planvoll war. Der Umfang dieses Unternehmens war unmenschlich, grotesk und gleichzeitig ehrfurchtgebietend. Die Gräben verliefen nicht in konzentrischen Kreisen, wie ausgebildete Soldaten sie angelegt hätten, sondern orientierten sich an der Bodenbeschaffenheit und umschmiegten jede Erhöhung so eng wie das Unterkleid den Körper einer kurvenreichen Frau.
Jemand musste all dies geplant haben, und nun wurde es ausgeführt. An einem einzigen Tag.
Er wollte bei Amicia sein. Er wollte mit ihr reden, aber er war zu müde, und die Festung war so übervölkert, dass kaum eine Chance bestand, sie zu finden. Aber er kannte einen anderen Weg – sofern sie auf ihrer Brücke war. Dazu musste er nur die Tür einen Spaltbreit öffnen. Er streckte seine inneren Fühler aus und …
… betrat den Raum. Er winkte seiner Lehrerin Prudentia zu und ging zu der eisenbeschlagenen Tür.
»Nicht«, sagte sie.
Sein ganzes Leben hindurch hatte sie ihm immer wieder gesagt, dies und das nicht zu tun, und meistens hatte er nicht auf sie gehört.
»Du kannst ihr nicht vertrauen«, sagte Prudentia. »Thorn befindet sich unmittelbar hinter dieser Tür. Er wartet auf dich.«
»Irgendwann muss er auch einmal schlafen.«
»Bleib stehen!«
Er drückte mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür – mit seinem ganzen Traumgewicht – und drehte den Knauf, bis es im Schloss klickte …
Und die Tür wurde aufgeworfen. Ein fester, grüner Nebel floss in die Kammer, hatte genug Macht, eine ganze Stadt zu erleuchten … zehn Städte …
Nördlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn grinste, als er die dunkle Sonne spürte – er fühlte, wie er in der Welt der Macht auftauchte, und er sandte all seine Macht an den Kontaktlinien entlang, um ihn zu fesseln. Nun gab es kein Zögern mehr. Menschen der Macht bemühten sich stets um eine unmittelbare Herausforderung. Thorn war bereit.
Lissen Carak · Die Äbtissin
Die Äbtissin spürte die anschwellende Woge der Macht der Wildnis und hielt inne. Sie verfütterte gerade Hühnchenstücke an ihren Raubvogel, und der Teller mit dem rohen Fleisch fiel klappernd auf den Marmorfußboden. Es konnte sich doch nicht so viel Macht in ihrer Festung befinden … Sie streckte ihre inneren Fühler aus und spürte ihn …
Nördlich von Lissen Carak · Thorn
Thorn spürte ihr goldenes Leuchten und hielt inne. Er leckte daran, schmeckte sie und war erstaunt über ihre Kraft. Erfreut, traurig, wütend, schuldbeladen …
Und vollkommen verwirrt.
Palast der Erinnerung · Der Rote Ritter
Er lag auf dem Boden, und Prudentia versuchte ihn zu erreichen. Ihre Marmorhand befand sich nur wenige Zoll von seiner eigenen entfernt. Ihre Hand sowie die schwarzen und weißen Fliesen waren das Einzige, was er in der brodelnden, alles andere erstickenden Wolke aus Grün erkennen konnte – es war das Grün der Bäume im Hochsommer. Er wurde gegen den Boden gedrückt … Er sah, wie sich der Umriss eines Käfigs über ihm schloss, eines Phantasmas, das so mächtig war, dass er seine Verwunderung nur durch ein Stöhnen ausdrücken konnte, als es ihn zerschmetterte … doch dann schwankte es. Er reckte sich, aber es war noch immer zu mächtig, auch wenn es an Konzentration zu verlieren schien. Er drückte sich dagegen, während es in seinem Kopf schrie: »Narr, Narr, Narr …«
Die Tür wurde zugeschlagen, er lag zusammengesackt in der Ecke seines befestigten Balkons.
Der alte Magus stand über ihm. Sein Stab glühte noch, und Zungen eines Elfenfeuers spielten an seiner gesamten Länge entlang. »Ich vermute, das ist das Erbteil Eurer Mutter«, sagte der alte Mann.
Der Hauptmann versuchte aufzustehen, doch es war, als besäße er keine Knochen mehr. Außerdem konnte er die Arme kaum bewegen. »Ihr seid mir überlegen«, sagte er.
Der alte Magus reichte ihm die Hand. »Das stimmt. Ich bin Harmodius, und Ihr seid Lord Gabriel Moderatus Murien – Annas Sohn.« Er lächelte verbittert. »Der Viscount Murien. Versucht nicht, es zu leugnen, Ihr kleiner Teufel. Eure Mutter glaubt, Ihr seid tot, aber seit dem Augenblick, in dem ich Euch zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, wer Ihr seid.« Er zog den Hauptmann auf die Beine und führte ihn zu einem Stuhl.
Jacques kam mit einer gespannten und geladenen Armbrust herein. Es geschah ganz leise; Harmodius hatte keine Gelegenheit zu reagieren.
»Sagt nur ein Wort, Mylord, und er ist tot«, versprach Jacques.
»Du hast es gehört«, sagte der Hauptmann zu Jacques. Er fühlte sich, als hätte er den schlimmsten Kater seines Lebens.
»Ich habe es gehört«, bestätigte Jacques. Die Spitze des Pfeils in der Führung der Armbrust zitterte nicht.
Mühsam holte der Hauptmann Luft. »Warum sollte ich Euch nicht umbringen lassen?«, fragte er den Magus.
»Ist Euer kleines Geheimnis wirklich das Leben aller in der Burg wert?«, fragte der Magus. »Niemand wird dies hier ohne mich durchstehen. Und selbst mit mir wird es nicht leicht sein. Gütiger Gott, Junge, Ihr habt soeben seine Macht gespürt.«
Der Hauptmann wünschte, er könnte klar denken. Dass der Magus seinen Namen – Gabriel – ausgesprochen hatte, hatte ihn genauso heftig getroffen wie jener grüne Käfig. Er selbst erlaubte es sich nicht einmal, den Namen Gabriel auch nur zu denken. »Ich habe getötet und zugelassen, dass andere getötet werden, nur um mein Geheimnis zu schützen«, sagte er.
»Dann ist es an der Zeit, damit aufzuhören«, sagte der Magus.
Jacques bewegte sich nicht, seine Stimme klang völlig beherrscht. »Warum haltet Ihr nicht einfach das Maul?« Er zuckte die Achseln, aber diese Bewegung erreichte nicht die Spitze des Pfeils in seiner Armbrust. »Ihr seid doch schließlich der mächtige Magus des Königs. Vielleicht können wir alle einfach weitermachen, wenn Ihr nicht mehr den Namen irgendeines toten Jungen in den Mund nehmt.«
»Drei in einem Geheimnis«, murmelte der Hauptmann.
Der Magus schürzte die Lippen. »Ich gebe Euch mein Wort, dass ich mein Wissen nicht preisgebe – wenn Ihr mir Euer Wort gebt, dass Ihr mit mir darüber sprecht, sobald das hier vorbei ist.«
Der Hauptmann fühlte sich, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Er wollte nur noch in das entstandene Loch springen und sich verstecken. »Na gut«, sagte er und erinnerte sich daran, dass Gawin Murien im Krankensaal fast unmittelbar über ihm lag. Vier in das Geheimnis Eingeweihte, und einer davon ist mein Feind, dachte er. Mein liebreizender Bruder.
»Ich schwöre bei meiner Macht«, sagte der Magus.
Der Hauptmann zwang sich, den Kopf zu heben. »Rühr dich, Jacques«, sagte er. »Er hat gerade einen Eid geschworen, der ihn bindet. Wenn er ihn bricht, wird auch seine Macht zerbrechen.« Dann wandte er sich wieder dem Magus zu. »Ihr habt mir das Leben gerettet«, sagte er.
»Ah, ein Fetzen Höflichkeit hat in Euch überlebt. Ja, mein Junge, ich habe Euch vor einem schrecklichen Tod bewahrt. Er wollte Eure Macht für sich haben.« Der furchtbare alte Mann grinste. »Er wollte Eure Seele essen.«
Der Hauptmann nickte. »Ich fühle mich, als hätte er es getan. Oder hat ihm der Geschmack missfallen?« Er versuchte zu grinsen, gab es jedoch wieder auf. »Einen Becher Wasser, Jacques.«
Jacques wich einen Schritt zurück, nahm den Pfeil aus der Waffe und entspannte die Sehne ganz langsam mithilfe des Geißfußes an seinem Gürtel. »Verrückte«, murmelte er und verließ den Raum.
Das Herz des Hauptmanns schlug schneller, als ihm das Wort »Mutter« in den Sinn kam, und dann dachte er an seine Mutter – an seine wunderschöne, betrunkene und gewalttätige Mutter, wie sie ihn schlug …
»Erwähnt meine Mutter nie wieder.« Sogar in seinen eigenen Ohren klang es kindisch.
Mit seinem Stab zog sich Harmodius einen Stuhl herbei und setzte sich. »In Ordnung, Junge, wir wollen Eure Mutter lieber vergessen. Sie ist niemals meine Freundin gewesen. Wie mächtig seid Ihr?«
Der Hauptmann lehnte sich zurück und versuchte, sein … sein Gefühl für sich selbst zurückzugewinnen. Seine Haltung. Seine Hauptmännlichkeit.
»Ich habe eine große Menge rauer, ungeschliffener Macht, und ich hatte eine gute Lehrerin, bis …« Er hielt inne.
»Bis Ihr weggelaufen seid und Euren Tod vorgespiegelt habt«, beendete der Magus den Satz für ihn. »Was Ihr unter Zuhilfenahme eines Phantasmas getan habt. Natürlich.« Er schüttelte den Kopf.
»Ich wollte nichts vorspiegeln«, sagte der Hauptmann.
Der Magus lächelte. »Auch ich bin einmal jung und wütend und verletzt gewesen, mein Junge«, sagte er. »Auch wenn es nicht so erscheinen mag. Egal – das ist nur ein schwacher Trost. Ich habe einen Blick in Euren Palast der Erinnerung geworfen – großartig. Das Wesen darin – wer ist sie?«
»Meine Lehrerin«, sagte der Hauptmann.
Ein langes Schweigen setzte ein. Schließlich räusperte sich Harmodius. »Ihr …?«
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern. »Nein, ich habe sie nicht umgebracht. Sie lag im Sterben. Meine Mutter und meine Brüder, sie … Es ist gleichgültig. Ich habe gerettet, was noch zu retten war.«
Der Magus kniff die Augen zusammen. »Eine menschliche Frau ist an eine Statue in einem Palast der Erinnerung gekettet?«, fragte er. »In Eurem Kopf.«
Der Hauptmann seufzte. »Ja.«
»Das ist Häresie, Thaumaturgie, Nekromantie, große Pietätlosigkeit und vielleicht auch Entführung«, sagte Harmodius. »Ich weiß nicht, ob ich Euch dafür bestrafen oder nur fragen soll, wie Ihr das geschafft habt.«
»Sie hat mir geholfen. Sie tut es noch immer«, sagte der Hauptmann.
»Wie viele der hundert Werke kennt Ihr?«, wollte der Magus wissen.
»Von den hundert Werken, deren es mindestens hundertvierundvierzig und vielleicht sogar vierhundert gibt?«, fragte der Hauptmann zurück.
Jacques kam mit einem Tablett zurück, auf dem sich Apfelcidre, Wasser und Wein befanden.
»Niemand betritt diesen Raum«, befahl der Hauptmann.
Jacques’ Miene deutete an, dass er kein Narr war – auch wenn sein Meister vielleicht einer war. Dann ging er nach draußen.
Der Magus betastete seinen Bart. »Hm«, meinte er nichtssagend.
»Ich kenne mehr als hundertfünfzig«, sagte der Hauptmann und zuckte die Achseln.
»Es war eine großartige Erinnerungsmaschinerie«, meinte der Magus. »Darf ich fragen, warum Ihr nicht die große Leuchte der Hermetik seid?«
Der Hauptmann nahm einen Becher mit Wasser und trank ihn in einem Zug leer. »Ich will es nicht.«
Der Magus schockierte ihn, indem er nickte.
Der Hauptmann beugte sich vor. »Das ist alles? Ihr nickt?«
Der Magus spreizte die Hände. »Ich kann nur immer wieder sagen, dass ich kein Narr bin, Junge. Ich vermute, Eure Mutter hat Euch Euer ganzes junges Leben hindurch zum Magus ausgebildet. Sie ist eine brillante Lehrerin gewesen und besaß besondere Kräfte. Aber das alles perlt an Euch ab. Wisst Ihr das?«
Der Hauptmann lachte. Es war ein Lachen voller Wut, Selbstmitleid und grausamem Schmerz. Ein sehr junges, schreckliches Lachen, von dem er eigentlich gehofft hatte, es hinter sich gelassen zu haben. »Sie …«, begann er. »Verdammt, ich bin nicht in der Stimmung für Enthüllungen, alter Mann.«
Reglos saß der Magus da. Dann nahm er eine Weinkaraffe, goss sich einen Becher ein und trank ihn. »Es ist so«, begann er vorsichtig. »Die Sache ist so, dass Ihr wie ein Keller voller Getreide seid, oder voller Rüstungen oder voller Steinöl. Ihr wartet darauf, zur Verteidigung dieser Festung eingesetzt zu werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das zulassen darf.« Er zuckte die Achseln. »Ich habe etwas entdeckt. Etwas so Wichtiges, dass ich mich leider nicht mehr um das bekümmern kann, was die Menschen Moral nennen. Es tut mir zwar leid, dass Eure Schlampe von Mutter Euch so verletzt hat, aber Euer Suhlen im Selbstmitleid wird kein Leben retten – insbesondere nicht meines.«
Ihre Blicke begegneten sich.
»Ein Keller voller Steinöl«, sagte der Hauptmann träumerisch. »Ich habe einen Keller voller Steinöl.«
»Eure Lehrerin hat Euch viel beigebracht«, sagte Harmodius. »Aber jetzt müsst Ihr mir zuhören, Hauptmann. Der Verstand, der gegen uns arbeitet, ist nicht der irgendeines Koboldhäuptlings aus den Bergen – nicht einmal der eines Adversarius oder eines Draconis Singularis. Es handelt sich um die Hülle eines Mannes, der einmal der größte unseres Ordens gewesen ist und sich selbst der Wildnis übergeben hat, um eine Macht zu erlangen, die offen gesagt beinahe gottgleich ist. Ich weiß nicht, warum er diesen Ort hier einnehmen will – das heißt, ich habe zwar eine Ahnung, um was es gehen könnte, aber ich weiß nicht, was er wirklich vorhat. Versteht Ihr mich, Junge?«
Der Hauptmann nickte. »Ich habe da einen oder zwei Gedanken. Ich werde Euch wohl helfen müssen, wenn wir es schaffen sollen.«
»Selbst im Augenblick seines Verrats war er zu gerissen für mich«, sagte Harmodius, »auch wenn ich um meiner eigenen Sünden willen mein Versagen erst in der vergangenen Woche begriffen habe.« Er zuckte mit den Schultern und lehnte sich zurück. Plötzlich schien er kleiner geworden zu sein.
Der Hauptmann trank den sanften Cidre mit vier langen Schlucken. »Ich würde das hier auch gern überleben«, sagte er und seufzte. »Ich bin nicht gegen den Gebrauch der Macht. Schließlich gebrauche ich sie ja selbst.«
Harmodius blickte auf. »Könnt Ihr sie kanalisieren?«, fragte er.
Der Hauptmann runzelte die Stirn. »Ich weiß, was Ihr damit meint«, sagte er. »Aber ich habe es noch nie getan. Außerdem ist meine Kraft äußerst begrenzt. Prudentia hat mir beigebracht, dass unsere Muskeln durch unablässige Beanspruchung wachsen, und mit der Macht verhalte es sich nicht anders.«
Der Magus nickte. »Das stimmt – im Grundsatz jedenfalls. Ihr habt einen einzigartigen Zugang zur Macht der Wildnis.« Er zuckte die Achseln.
»Mutter hat mich aufgezogen, als wäre ich der Antichrist«, erwiderte der Hauptmann bitter. »Was erwartet Ihr?«
»Entweder suhlt Ihr Euch in Eurem Selbstmitleid, oder Ihr wachst. Ich bezweifle, dass Ihr beides gleichzeitig könnt.« Er beugte sich vor. »Hört mir zu. Bisher war alles, was er getan hat, nichts als ein Vorspiel. Er besitzt Tausende frischer Kobolde. Ihm steht das gesamte Spektrum an beängstigenden Kreaturen der nördlichen Wildnis zur Verfügung: Trolle, Lindwürmer, Dämonen, Hinterwaller, Irks. Er hat die Macht, einen Käfig über Euch zu stülpen – über Euch, der die Macht der Wildnis unmittelbar anzapfen kann. Wenn er mit ganzer Kraft auf uns losmarschiert, wird er uns vollkommen vernichten.«
Der Hauptmann zuckte die Achseln und trank noch etwas Wein. »Dann sollten wir aufgeben«, sagte er höhnisch.
»Wacht auf, Junge! Das ist eine ernste Sache!« Der alte Mann haute auf den Tisch.
Sie sahen einander böse an.
»Es ist wichtig, dass Ihr Eure Kräfte für uns einsetzt«, sagte Harmodius. »Seid Ihr in der Lage, Anweisungen entgegenzunehmen und zu befolgen?«
Der Hauptmann wandte den Blick ab. »Ja«, murmelte er, dann lehnte er sich zurück und wurde plötzlich ganz ernst. Er hob den Blick. »Ja, Harmodius. Ich werde Eure Anweisungen entgegennehmen und nicht mehr gegen Eure offensichtliche Autorität aufbegehren – weil Ihr mich an meinen Nicht-Vater erinnert.«
Harmodius zuckte mit den Schultern. »Ich trinke nicht genug, um Euch an Euren abstoßenden Nicht-Vater zu erinnern«, sagte er.
»Ihr habt die Wildbuben vergessen«, warf der Hauptmann ein, »als Ihr seine überwältigende Streitmacht aufgezählt habt. Wir haben einige von ihnen bei unserem ersten Ausfall im Lager erwischt. Jetzt hat er sie an einen anderen Ort verbracht, und ich habe sie verloren.«
»Wildbuben?«, fragte Harmodius. »Rebellen?«
»Vermutlich«, meinte der Hauptmann. »Mehr als Rebellen. Männer, die die Veränderung wollen.«
»Ihr klingt verständnisvoll«, erwiderte Harmodius.
»Wenn ich in einer Kleinbauernkate aufgewachsen wäre, wäre ich ebenfalls ein Wildbube geworden.« Der Hauptmann warf einen Blick auf seine Rüstung am Gestell, als dächte er über soziale Abgrenzungen nach.
Harmodius zuckte die Achseln. »Wie archaisch von Euch.« Er kicherte.
»Die einfachen Leute haben es heute schlechter als zu meiner Kindheit«, versicherte ihm der Hauptmann.
Harmodius strich über seinen Bart und goss sich noch einen Becher Wein ein. »Ihr habt doch sicherlich bemerkt, dass alle es heute schlechter haben? Die Welt fällt auseinander. Die Wildnis gewinnt – nicht durch große Siege, sondern durch einfache Entropie. Es gibt immer weniger Gehöfte und immer weniger Menschen. Ich habe es auf meinem Ritt hierher gesehen. Albia geht unter. Und dieser Kampf – dieser kleine Kampf um eine unwesentliche Burg, die eine Brücke bewacht, welche für den bäuerlichen Markt sehr wichtig ist – wird zum Kampf Eurer ganzen Generation. Die Aussichten sind schlecht für uns, sind es schon immer gewesen. Wir sind niemals klug. Wenn wir reich sind, verprassen wir unseren Reichtum, indem wir gegeneinander kämpfen und Kirchen bauen. Wenn wir arm sind, kämpfen wir gegeneinander um die Reste – und immer ist die Wildnis da, um die ungepflügten Felder zu besetzen.«
»Ich werde hier nicht versagen«, erklärte der Hauptmann.
»Weil Ihr dem Schicksal, das für Euch bestimmt war, endlich den Rücken zuwenden könnt, falls Ihr siegreich seid?«, fragte der Magus.
»Jeder muss etwas erstreben«, erwiderte der Hauptmann.
Albinkirk · Gaston
Es gab keine Schlacht bei Albinkirk.
Die königliche Armee formierte sich zum Kampf südlich der Stadt am Westufer des großen Flusses, während der kleinere Cohocton die nördliche Flanke schützte. Königliche Jäger töteten schon seit zwei Tagen Kobolde, und die Knappen und Bogenschützen der Armee lernten allmählich, ihre Wächterpflichten ernst zu nehmen, nachdem irgendetwas beinahe hundert Pferde im Dunkel der Nacht geholt hatte. Sechs Knappen und ein Ritter starben im Dunkel, als sie sich plötzlich etwas Schnellem und gut Bewaffnetem gegenübersahen – größer als ein Pony und schneller als eine Katze. Am Ende war es ihnen gelungen, es in die Flucht zu schlagen.
Die Armee hatte sich vier Stunden vor Tagesanbruch aufgestellt und ihre Formationen in der Dunkelheit gebildet; dann war sie vorsichtig auf die rauchende Stadt zumarschiert. Und trotzdem war die Maus der Katze entkommen.
Oder der Löwe war der Katze entkommen. Gaston wusste nicht, was von beidem zutraf.
Der König verfügte über fast dreitausend Ritter und Soldaten und noch einmal über die Hälfte dieser Zahl an Infanteristen, abgesehen von denjenigen, die zur Bewachung des Lagers zurückgeblieben waren. Diese Streitmacht war die größte und am besten bewaffnete, die Gaston je gesehen hatte. Die Albier hatten Rüstungen für jeden Bauern, und während die Ritter auf ihren Schlachtrössern ein wenig altertümlich anmuten mochten, weil sie zu viel gesottenes Leder und scheußliche Farben, dafür aber zu wenige Panzer trugen, war die Armee des albischen Königs jetzt doch größer als die eines jeden gallyschen Feldherrn und sehr gut mit Pferden ausgestattet. Sein Vetter sagte inzwischen nichts mehr darüber. So nahe am Feind war der königliche Gastgeber wendiger, schlanker und fähiger geworden und hatte überall Wachtposten und Späher aufgestellt. Nun ritten die jungen Männer nicht länger ohne Rüstung umher.
Aber sein Vater, König Hawthor, hatte allen Berichten zufolge mindestens fünfmal so viele Männer gehabt, als er gegen die Wildnis geritten war – vielleicht sogar zehnmal so viele. Und die Zeichen waren überall um sie herum zu erkennen – der Mangel an Panzerungen ließ sich nicht nur mit einer Vorliebe für das Altertümliche erklären. Überall entlang der Straße hatte er verlassene Gehöfte und Geschäfte gesehen – und einmal sogar eine ganze kleine Stadt mit eingefallenen Dächern.
Das gab ihm zu denken.
Als die Sonne aber heute hinter ihnen aufstieg und ihre Lanzenspitzen und Wimpel vergoldete, wich der Feind vor ihnen zurück und gab seine Belagerung auf – als ob Albinkirk nach dem Angriff nie wirklich belagert worden wäre.
Die Armee hielt am Rande des großen Flusses an, und die königlichen Jäger erledigten alle Kobolde, die zu langsam gewesen waren, über die hohe Klippe auf das darunter liegende Ufer zu klettern. Herolde zählten die Toten und stritten darüber, ob die Vernichtung der kleinen feindlichen Streitmacht als Schlacht anzusehen sei oder nicht.
Gaston folgte dem Ruf seines Vetters und salutierte mit offenem Visier und lose in der Scheide hängendem Schwert vor ihm. Wahrscheinlich würde es eine sofortige Verfolgungsjagd durch den Fluss geben, obwohl seltsam schien, dass sich der Feind nach Osten zurückzog.
Jean de Vrailly übergab seine große Armbrust dem Knappen und schüttelte den Kopf. »Eine königliche Ratsversammlung!«, brauste er auf. Er war sehr wütend. Es hatte den Anschein, dass sein verrückter Vetter in der letzten Zeit andauernd sehr wütend war.
Gefolgt nur von einer Handvoll Ritter, preschten sie quer über die Wiese, die von Sommerblumen bedeckt war, und hielten auf den König zu.
»Wir lassen den Feind entkommen«, sagte de Vrailly zu seinem Vetter. »Es sollte eine große Schlacht stattfinden. Heute.« Er spuckte aus. »Meine Seele ist in Gefahr, weil ich allmählich an meinem Engel zweifle. Wann werden wir endlich kämpfen? Bei den fünf Wunden Christi, ich hasse diesen Ort. Zu heiß, zu viele Bäume, dazu hässliche Menschen, bestialische Bauern …« Plötzlich zügelte er sein Pferd, stieg ab und kniete zum Gebet nieder.
Ausnahmsweise gesellte sich Gaston zu ihm. Diesmal konnte er allen Verkündigungen seines Vetters nur beipflichten. Auch er wollte nach Hause gehen.
Ein Herold ritt herbei – ein königlicher Bote, wie Gaston erkannte. Er kehrte zu seinen Gebeten zurück. Erst als seine Gelenke schmerzten und seine Knie die Qualen nicht länger ertragen konnten, hob Gaston den Blick und sah den Boten des Königs an, der geduldig gewartet hatte.
»Der König wünscht Eure Gegenwart«, sagte er.
Gaston seufzte, und er und sein Vetter ritten den Rest des Weges bis zu dem Ort, an dem die königliche Ratsversammlung stattfand.
Sie wurde zu Pferde abgehalten. Alle wichtigen Befehlshaber waren anwesend – jeder Offizier oder Lord, der über fünfzig oder mehr Ritter gebot: der Graf von Towbray, der Graf der Grenzmarken, der Prior von Harndon, der die Ritterorden befehligte, sowie ein weiteres Dutzend Lords, die Gaston nicht kannte. Edward, der Bischof von Lorica, war ebenfalls da und steckte von Kopf bis Fuß in einer Rüstung, ebenso wie der Hauptmann der königlichen Leibgarde, Ser Richard Fitzroy, der Bastard des alten Königs, wie die Männer behaupteten.
Der König sagte gerade etwas zu einem kleinen, graubärtigen Mann, der auf einem schmächtigen Zelter hockte und wie ein Zwerg wirkte, während alle anderen Anwesenden auf mächtigen Schlachtrössern saßen. Er war etwa sechzig Jahre alt und trug ein einfaches Kettenhemd, wie die Waffenschmiede sie für ihre ärmeren Kunden herstellten.
Er hatte dunkle Ringe unter den Augen, in denen jedoch noch ein starkes Feuer loderte.
»Sie waren nach drei Angriffswellen über die Außenmauern hinweg und schon in den Vorstädten angekommen«, sagte er. »Sie konnten die Mauern hochlaufen.« Er sah Ser Alcaeus an. »Aber Ihr kennt die Geschichte sicher bereits von diesem guten Ritter.«
»Ich möchte sie aber aus Eurem Munde hören«, sagte der König.
»Der Bürgermeister wollte die Frauen nicht auf die Burg schicken. Also habe ich meine besten Männer ausgesandt, um sie unter Zwang dorthin zu treiben.« Er zuckte die Achseln. »Und so ist es geschehen. Bei der Güte Gottes, ich habe mit zwanzig Soldaten das Tor zur Burg gehalten.« Er schüttelte den Kopf. »Wir haben es etwa eine Stunde lang verteidigt.« Dann sah er wieder Ser Alcaeus an. »Oder?«
Der moreanische Ritter nickte. »Das haben wir getan, Ser John.«
»Wie viele sind gestorben?«, fragte der König sanft.
»Von den Einwohnern? Oder von meinen eigenen Leuten?«, fragte der alte Mann zurück. »Die ganze Stadt ist gestorben, Mylord. Wir haben hauptsächlich die Frauen und Kinder gerettet – ein paar Hundert. Die Männer sind entweder im Kampf umgekommen, oder sie wurden gefangen genommen.« Bei diesen Worten verzog er das Gesicht. »In der nächsten Nacht haben wir zwei kleine Ausfalltore offen gehalten und je ein Dutzend Streitäxte bei ihnen postiert. Es kamen fünfzig Flüchtlinge zurück, aber die Stadt wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt, Mylord.« Er neigte den Kopf, rutschte aus seinem Sattel und kniete sich vor den König. »Ich bitte um Vergebung, Mylord. Ich habe meine Burg gehalten, Eure Stadt aber habe ich verloren. Verfahrt mit mir, wie Ihr es wollt.«
Gaston sah sich um. Die Albier waren entsetzt.
Sein Vetter drängte sich nach vorn. »Umso mehr Grund, die Feinde jetzt sofort zu verfolgen«, sagte er mit großer Bestimmtheit.
Der alte Hauptmann schüttelte den Kopf. »Nein, Mylord. Das ist eine Falle. Heute Morgen haben wir eine riesige Streitmacht gesehen: Hinterwaller zusammen mit Sossags oder Abonacki, die allesamt in die Wälder im Osten gezogen sind. Es ist ein Hinterhalt. Sie wollen doch, dass wir sie verfolgen.«
De Vrailly hüstelte. »Soll ich etwa Angst vor ein paar besiegten Männern haben?«, fragte er.
Niemand antwortete ihm.
»Wo steht die Hauptarmee des Feindes?«, fragte der König.
Der alte Mann zuckte die Schultern. »Wir haben Botschaften von Karawanen, die nach Westen unterwegs waren, sowie von der Äbtissin«, sagte er. »Wenn ich eine Vermutung äußern darf, dann würde ich sagen, dass Lissen Carak belagert wird.« Er ergriff den Steigbügel des Königs. »Sie sagen, es sei der gefallene Magus«, meinte er plötzlich. »Die Männer behaupten, sie hätten beim Ansturm auf die Mauern gesehen, wie er mit Blitzen Breschen hineingeschlagen hat.«
Die Albier murmelten untereinander, während ihre Reittiere allmählich ungeduldig wurden.
Der König machte ein schnalzendes Geräusch, als würde er laut denken.
Der Prior von Harndon trieb sein Pferd voran. Er war kein großer Mann und etwa so alt wie der Hauptmann von Albinkirk, aber etwas strahlte von ihm aus – eine Art von Macht, gegründet in Frömmigkeit und Demut. Sein schwarzer Mantel bildete einen scharfen Kontrast zu dem leuchtenden Gold und den anderen Farben der Krieger und sogar zur Kleidung des Bischofs.
»Ich würde meine Ritter und Soldaten gern nach Westen führen, Mylord, und nach Lissen Carak sehen«, sagte er. »Das ist unsere Verantwortung.«
Der Graf der Grenzmarken trieb sein Pferd an, bis es sich neben Gaston befand, und beugte sich trotz der Kälte, die bei ihrer letzten Begegnung geherrscht hatte, zu ihm vor. »Die Schwestern vom heiligen Thomas gehören zu ihm«, flüsterte er.
Der Captal de Ruth stellte sich in die Steigbügel. »Ich würde ihn gern begleiten«, verkündete er.
Der Prior bedachte ihn mit einem Lächeln. Es war ein müdes Lächeln und sollte vermutlich keine Beleidigung sein. »Das ist eine Angelegenheit für die Ritter meines Ordens«, sagte er. »Wir sind dafür ausgebildet.«
Der Captal berührte den Knauf seines Schwertes. »Niemand sagt mir, dass meine Männer nicht ausgebildet sind«, meinte er.
Der Prior zuckte die Achseln. »Ich werde Euch nicht mitnehmen, wie schlecht Eure Manieren auch sein mögen.«
Gaston legte die Hand auf den stahlbekleideten Unterarm seines Vetters. Weder in Albia noch in Gallyen forderte man ungestraft einen Ritter Gottes heraus. Das tat man einfach nicht.
Vielleicht glaubte sein verrückter Vetter auch, er stünde über dem Gesetz.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Ein Kommandant ist selten allein.
Der Hauptmann musste Papiere durchsehen, was er oft zusammen mit Ser Adrian tat. Er musste die Übungen überwachen, allgemeine Inspektionen vornehmen, besondere Inspektionen vornehmen und hatte eine Unmenge kleinerer sozialer Verpflichtungen. Er musste die Erwartungen von Menschen erfüllen, deren gemeinsame Bande im Feuer geschmiedet worden waren. Es waren Menschen, die in vielen Fällen aus anderen Gemeinschaften ausgeschlossen worden waren, weil ihnen sogar die einfachsten Umgangsformen fehlten.
Der Hauptmann musste mit sich allein sein. Üblicherweise behalf er sich damit, über die Wiesen und Felder des Landes zu reiten, in dem sich seine kleine Armee gerade befand; dann suchte er sich für gewöhnlich ein Wäldchen und setzte sich unter einen Baum. Doch der Feind hatte die Wiesen und Felder besetzt, und die Festung war mit Menschen überfüllt – sie waren überall.
Harmodius hatte ihm etliche schwierige Anweisungen hinterlassen. Es handelte sich um neue Phantasmata, deren Wirken er erlernen musste und die ihn gegen die Kniffe ihres gegenwärtigen Feindes schützen sollten. Und da war ein Plan – ein sorgfältiger Plan, kühn und risikoreich, aber auch gewitzt und in seinen Ausmaßen beachtlich.
Er brauchte Zeit und Zurückgezogenheit zum Üben. Doch er war nie allein.
Michael kam, brachte ihm ein Hühnchengericht und wurde wieder entlassen.
Bent kam und übermittelte ihm die Bitte einiger Bauern, die ihre Schafe unbedingt in den Pferchen vor den Mauern der Unterstadt aufsuchen wollten. Der Hauptmann rieb sich die Augen. »Ja«, sagte er.
Pampe kam mit dem Vorschlag eines weiteren Ausfalls.
»Nein«, sagte er.
Und ging fort, damit er ein wenig Abgeschiedenheit haben und Thaumaturgie üben konnte.
Der Krankensaal schien der beste Ort dafür zu sein.
Er stieg die Treppe hoch, ohne jemandem zu begegnen. Draußen brach der Abend herein, und er fühlte sich, als hätte er eine Schlacht geschlagen. Er musste seine Beine dazu zwingen, ihn die Wendeltreppe hochzutragen.
Mit einem gemurmelten Gruß ging er an der Schwester vorbei, die am oberen Absatz wachte; sie sollte annehmen, dass er die Verwundeten besuchen wollte.
Wirklich tat er dies als Erstes. John Daleman, ein Bogenschütze, lag auf dem Bett an der Wand, und eine ganze Reihe von Nähten erstreckte sich von seinem Schlüsselbein bis zur Hüfte. Es war ein Wunder – oder beruhte auf der Kunst der Schwestern –, dass sich die Wunden nicht entzündet hatten und er wohl überleben würde. Er lag in tiefem, von Arzneien erwirktem Schlaf, und der Hauptmann saß eine Weile an seinem Bett.
Seth Pennyman, ein Diener, war gerade aus dem Operationsraum gekommen, wo man seinen gebrochenen Arm und auch das gebrochene Bein gerichtet hatte. Er war vor einiger Zeit durch den Schwanz eines Lindwurms von der Mauer gefegt worden. Die Knochen waren schief angewachsen und hatten von den Schwestern wieder gebrochen werden müssen. Nun war er mit irgendeiner Droge angefüllt und murmelte Flüche im Schlaf.
Walter La Tour, der adlige Soldat, saß aufrecht und las in einem wunderschön illuminierten Psalter. Er war siebenundfünfzig Jahre alt und trug eine neumodische Glasbrille auf der Nase. Im Kampf am Fluss hatte er einen schweren Schlag von dem Behemoth abbekommen.
Der Hauptmann setzte sich zu ihm und ergriff seine rechte Hand. »Ich hatte schon befürchtet, dich verloren zu haben, als dieses Wesen dich zu Fall gebracht hat.«
Walter grinste. »Das hatte ich ebenfalls befürchtet«, sagte er. »Bringt mich bitte nicht zum Lachen, Mylord. Das schmerzt zu sehr.«
Der Hauptmann betrachtete ihn eingehender. »Ist dieses Ding da neu?«, fragte er und griff nach der Glasbrille.
»Von der hiesigen Apothekerin geschliffen«, sagte Walter. »Es tut der Nase ziemlich weh, aber verdammt, so gut habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr lesen können.«
Der Hauptmann setzte sich die Brille auf die eigene Nase. Sie wollte nicht halten; der schwere Hornrahmen zwickte ihn. Ein feiner Stahlbogen hielt die beiden Linsen zusammen. Der Hauptmann kannte das Prinzip, aber er hatte noch nie ein solches Gerät im Einsatz gesehen.
»Ich … das heißt, wir …« La Tour wirkte reumütig. »Ich möchte hierbleiben, Hauptmann.«
Der Hauptmann nickte. »Das würde zu dir passen«, sagte er. »Aber ich befürchte, du bist noch nicht zu alt, um Nonnen zu jagen.«
»Was das angeht«, meinte Walter und wurde rot, »so denke ich darüber nach, die Gelübde abzulegen.«
Du weißt nicht, was du tust. Der Hauptmann lächelte und drückte die freie Hand des Mannes. »Freut mich, dass es dir besser geht«, sagte er.
»Das verdanke ich Gott«, sagte Walter, um seine Absichten zu erklären. »Hier bin ich gerettet worden. Ich war schon tot. Dieser Behemoth hat mich wie ein Insekt unter sich zerquetscht, und diese heiligen Frauen haben mich ins Leben zurückgebracht. Aus einem bestimmten Grund.«
Das Lächeln wurde aus dem Gesicht des Hauptmanns gewischt. »Ja«, sagte er, »auch ich schulde Gott etwas.«
Er trat zu der Reihe der Feldbetten. Sym lag mit dem Gesicht zur Wand; sein Rücken war sorgfältig bandagiert. In dieser Gesellschaft wurden Urteile unverzüglich vollstreckt. Er ächzte.
»Du bist ein Idiot«, sagte der Hauptmann mit geschäftsmäßiger Zuneigung.
Sym rollte nicht herüber. Er ächzte weiter.
Der Hauptmann hatte kein Mitleid, denn im Vergleich mit La Tour und den anderen waren Syms Schmerzen kaum mehr als der Stich einer Mücke. »Du hast dich in den Kampf gestürzt, weil du das Mädchen haben wolltest. Aber das Mädchen wollte dich nicht, und indem du seine Brüder und Freunde zusammengeschlagen hast, hast du dich bei ihm nicht unbedingt beliebter gemacht, oder?«
Ächzen.
»Aber das war dir gleich, weil du nichts gegen erzwungene Liebe einzuwenden hast, nicht wahr, Sym? Das hier ist nicht Gallyen. Schon in Gallyen hat mir deine Haltung nicht gefallen, aber dies hier ist unser eigenes Land, und wir sind alle miteinander in dieser Festung eingesperrt. Wenn du ein Bauernmädchen mit deinem Knoblauchatem auch nur anhauchen solltest, ob ohne ihre Einwilligung oder mit ihr, so werde ich dich mit meinen eigenen Händen aufknüpfen. Sym, ich will es ganz klarmachen. Du bist der nutzloseste Kerl unter meinem ganzen Kommando, und ich würde dich sehr gern aufhängen, denn diese Botschaft an die anderen, dass ich es ernst meine, würde mich nichts kosten. Hast du mich verstanden?« Er beugte sich vor.
Sym ächzte erneut. Nun weinte er.
Der Hauptmann hatte nicht gewusst, dass Sym überhaupt zum Weinen in der Lage war. Dies eröffnete völlig neue Perspektiven.
»Willst du der Held und nicht der Schurke sein, Sym?«, fragte er sehr ruhig.
Sym wandte seinen Kopf noch weiter ab.
»Dann hör mir zu. Das Böse ist eine freie Wahl. Es ist eine Wahl. Etwas Böses zu tun, ist zumeist der einfachere Ausweg, und irgendwann wird es zur Gewohnheit. Ich habe es auch getan. Jeder Verbrecher kann Gewalt anwenden. Jeder böse Mensch kann stehlen. Manche Menschen stehlen nur deshalb nicht, weil sie Angst haben, erwischt zu werden. Andere stehlen nicht, weil es falsch ist. Stehlen ist die Zerstörung der Arbeit eines anderen. Vergewaltigung ist Gewalt gegen eine andere Person. Gewaltanwendung zur Beendigung eines Streits …« Der Hauptmann hielt in seiner Morallektion inne, denn natürlich wurde in seiner Söldnertruppe ein Streit oder eine Meinungsverschiedenheit oft mit Gewalt beendet, ganz so wie es in allen anderen auch der Fall war. Er lachte laut auf. »Das ist zwar typisch für unsere Arbeit, aber sie muss uns schließlich nicht vollständig beherrschen.«
Sym jammerte.
Der Hauptmann beugte sich zu ihm hinunter. »Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt für die Entscheidung, der Held und nicht der Bösewicht zu sein, Sym. Wenn du so weitermachst wie bisher, wird dich das an den Galgen bringen. Man endet aber besser in einer Heldenerzählung als am Strang.« Er dachte an Tom. Der Mann war ein Hochländer – leicht zu vergessen, aber sein Ruhm würde in den Worten bleiben. »Ende lieber in einem Lied.«
Der kleine Mann wollte ihn nicht ansehen. Der Hauptmann schüttelte den Kopf; er war müde und mit dem, was er geleistet hatte, nicht sehr zufrieden.
Er erhob sich von dem Schemel, der neben dem Feldbett des Bogenschützen stand, und reckte und streckte sich.
Amicia befand sich unmittelbar hinter ihm. Natürlich. Da stand er nun, der Fürst der Heuchler.
Sie schaute auf Sym hinunter und dann wieder auf den Hauptmann.
Er zuckte die Achseln.
Sie runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf und winkte ihn weg.
Er gab einen Laut der Verzweiflung von sich, trat nach draußen auf den Korridor und lief von den Betten der Rekonvaleszenten zum Saal der ernsten Fälle. Er ging einige Schritte, umrundete eine Ecke und stand plötzlich vor Gawin Muriens Bett. Das Bein des jungen Mannes war vom Schritt bis zum Knie bandagiert.
Er setzte sich neben Ser Gawins Bett. »Hier wird niemand nach mir suchen«, sagte er in bitterem Spott.
Gawin öffnete die Augen.
Das ist nicht mein Tag, dachte der Hauptmann.
Das folgende Schweigen hätte für ausgedehnte Gespräche gereicht. Für Streit, Wut, Aufbrausen. Stattdessen sahen sie einander wie Liebende an.
»Du scheinst noch zu leben, Bruder«, sagte Gawin.
Der Hauptmann zwang sich zu atmen. »Ja«, sagte er sehr, sehr leise.
»Und niemand weiß, wer du bist«, meinte Gawin.
»Du weißt es«, entgegnete der Hauptmann. »Und dieser alte Zauberer Harmodius.«
Gawin nickte. »Ich habe einen weiten Bogen um ihn gemacht«, sagte er. »Würdest du mir bitte helfen, mich aufzurichten?«
Der Hauptmann gehorchte und setzte seinen Bruder gegen die Kissen – er schüttelte sogar eines für ihn auf. Für seinen Bruder, der Prudentia auf den Befehl seiner Mutter hin ermordet hatte.
»Mutter hat gesagt, dass sie dich verdirbt«, sagte Gawin plötzlich, als ob er die Gedanken seines Bruders lesen könnte. Doch bei den letzten Worten versagte ihm die Stimme. »Sie hat es nicht getan, oder? Wir haben sie umsonst umgebracht.«
Der Hauptmann setzte sich, bevor seine Knie unter ihm nachgaben. Er wollte fliehen. Er wollte dieses Gespräch an einem anderen Tag führen. In einem anderen Jahr.
Die Wahrheit war, dass die Wahrheit zu entsetzlich zum Mitteilen war. Sie war beschämend und furchtbar und verletzte jeden zutiefst, der mit ihr in Berührung kam. Der Hauptmann sah Gawin an, der noch immer glaubte, dass sie Brüder seien. Wenigstens diese Lüge hielt noch.
»Prudentia wusste etwas, das sie nicht hätte wissen dürfen«, hörte sich der Hauptmann sagen. Er klang bemerkenswert ruhig. Dabei war er ziemlich stolz auf sich, zumindest einen Augenblick lang.
Gawin gab ein ersticktes Geräusch von sich. »Und so hat Mutter uns dazu gebracht, sie zu töten«, sagte er nach einer weiteren langen Pause.
»So wie sie dich jeden Tag angestachelt hat, mich zu quälen«, sagte der Hauptmann bitter.
Gawin zuckte die Achseln. »Das war mir schon vor deinem Verschwinden klar geworden. Richard hatte es nicht begriffen, ich aber schon.« Er schaute aus der Schießscharte neben seinem Kopf. »Ich habe etwas Schreckliches getan, unten in Lorica. Ich habe dafür gesorgt, dass einige gute Männer gestorben sind, und dann habe ich etwas Verachtenswertes getan.«
Plötzlich bemerkte der Hauptmann, dass Gawin ihn anstarrte. »Als ich im Matsch gekniet und den Feigling abgegeben habe, habe ich begriffen, dass ich mich rächen muss oder verrückt werden würde. Ich muss es sagen, Bruder. Verdammt, blitzartig habe ich erkannt, dass ich das Instrument deiner Vernichtung war. Es war so, als hätte ich dich eigenhändig getötet. Glaubst du, das hätte mich nicht berührt? Als wir deinen Leichnam gefunden hatten – wie hast du das eigentlich gemacht? –, nachdem wir also deinen Leichnam gefunden hatten, bin ich in die Wildnis geritten. Ich war wie von Sinnen. Ich wusste, wer Lord Gabriel getötet hatte. O ja. Dickon und ich wussten es, wir beide. Wir haben dich zu Tode gehasst, nicht wahr?« Er schüttelte den Kopf. »Aber du bist nicht tot, und ich bin mir nicht einmal sicher, was das bedeutet. Bist du ein Magus?«, fragte er.
Der Hauptmann seufzte. »Mutter hat mich zum Magus ausbilden lassen«, sagte er. »Durch Prudentia. Und dabei hat sie dir gesagt, wie verweichlicht ich sei und was für einen armseligen Ritter ich abgebe. Ich hatte mir geschworen, meine Studien niemals vor ihr zu enthüllen – und auch nicht vor Gott oder den Heiligen.« Er lachte verbittert.
»O mein Gott«, stöhnte Gawin. »Prudentia war ein Magus. Also … o mein Gott. Mutter hat den Pfeil besorgt.«
»Der aus Hexenholz bestand«, ergänzte der Hauptmann.
Nun war Gawin bleicher als zu dem Zeitpunkt, da der Hauptmann ihn zuerst gesehen hatte. »Es tut mir leid«, sagte er. »Wir beide wissen, dass du sie geliebt hast.«
Der Hauptmann zuckte mit den Achseln.
»Gabriel …«
»Gabriel, Viscount Murien ist tot«, unterbrach ihn der Hauptmann. »Ich bin der Hauptmann. Einige meiner Männer nennen mich den Roten Ritter.«
»Den Roten Ritter? Das klingt ja wie ein namenloser Bastard«, erwiderte Gawin. »Du bist mein Bruder, Gabriel Moderatus Murien, der Erbe des Herzogs vom Norden und Sohn der Schwester des Königs.«
»O ja, ich bin wirklich der Sohn der königlichen Schwester«, meinte der Hauptmann und unterbrach sich, bevor er noch mehr sagen konnte.
Gawin hustete, setzte sich auf und fluchte. Ein Faden aus Scharlachrot kroch langsam über seine Lende. »Nein!«, murmelte er.
Der Hauptmann nickte. »Doch. Vielleicht fühlst du dich besser, wenn ich dir verrate, dass wir nur Halbbrüder sind.«
»Beim süßen Christus und seinen fünf Wunden«, sagte Gawin.
Der Hauptmann gelangte zu einer Entscheidung, indem er eine Reihe von Möglichkeiten opferte und eine andere Reihe vorschickte – wie Soldaten auf dem Schlachtfeld. Dann rückte er den Stuhl näher an seinen Halbbruder heran. »Berichte mir von dem Schrecklichen, das du in Lorica getan hast«, sagte er und ergriff Gawins Hand. »Sag es mir, und ich vergebe dir, dass du Prudentia umgebracht hast. Sie selbst hat dir bereits vergeben. Ich werde es dir eines Tages erklären. Sag mir, was in Lorica geschehen ist, und lass uns von Neuem beginnen – wie damals, im Alter von neun Jahren, als wir noch Freunde waren.«
Gawin legte sich zurück, und ihr Blickkontakt riss ab. »Der Preis für deine Vergebung ist hoch, Bruder.« Plötzlich war sein Gesicht blutrot. Dann ließ er den Kopf hängen. »Ich schäme mich so sehr. Ich würde es nicht einmal einem Priester beichten.«
»Ich bin kein Priester, und es gibt eine Menge, dessen ich mich ebenfalls schäme. Eines Tages werde ich es dir berichten. Also rede.«
»Warum?«, fragte Gawin. »Warum? Dann wirst du mich nur noch mehr hassen, und du wirst mich überdies verachten. Ich habe einen verabscheuenswerten Feigling abgegeben und bin unter dem Schwert eines anderen Mannes … gekrochen.« Tränen strömten an seinen Wagen herunter. »Ich habe versagt und verloren. Ich war gar nichts mehr. Für meine Sünden hat Satan mir das hier geschickt.« Er zog sein Hemd herunter und enthüllte die Schuppen, die an der rechten Körperseite von der Hüfte bis zum Hals gewachsen waren.
Der Hauptmann sah seinen Bruder an, der nach alldem noch immer so stolz war und seinen eigenen Stolz nicht einmal bemerkte. Es ist so leicht, andere zu verstehen, dachte der Hauptmann mit schwacher Belustigung. Und mit erstaunlichem Kummer. Er konnte einfach keinen gefühlsmäßigen Abstand zu Gawin halten.
»Eine Niederlage ist an und für sich keine Sünde.« Der Hauptmann rieb sich den Bart. »Ich habe Jahre gebraucht, um das zu lernen, aber am Ende habe ich es dann doch begriffen. Und Versagen ist auch keine Sünde. Sich in seinem eigenen Versagen zu suhlen …« – er ließ den Kopf hängen – »… ist etwas, das ich ausgezeichnet kann, wenn ich es zulasse, und das ist schon eher eine Sünde.«
»Du klingst wie ein Mann Gottes«, sagte Gawin.
»Verdammt sei Gott«, meinte der Hauptmann.
»Gabriel!«
»Ehrlich, Gawin, was hat Gott denn je für mich getan?«, wetterte der Hauptmann. »Wenn ich nach einem Schwerthieb aufwache und die ewigen Flammen in meinem armen Hintern lodern, dann spucke ich dem Schöpfer ins Gesicht, denn mehr habe ich in diesem abgekarteten Spiel nicht gewonnen.«
Diese Blasphemie beendete das Gespräch erst einmal. Allmählich ging die Sonne unter.
Schließlich rollte Gawin die Hüften ein wenig herum. »Meine Lenden bluten wieder. Könntest du sie neu verbinden? Ich kann es nicht ertragen, wenn die Schwestern das tun.«
»Mist«, meinte der Hauptmann. Was vorhin nur ein scharlachroter Faden gewesen war, das wurde nun zu einem Blutfleck, der sich rasch ausbreitete. »Bei Christi Tränen! Ich hole lieber fachkundige Hilfe.« Dann lachte er. »Vermutlich werden wir beide am Familienfluch sterben – übertriebener Stolz –, aber ich muss dir schließlich nicht aktiv dabei helfen.« Er schob seinen Stuhl zurück. »Amicia?«, rief er. »Amicia?«
Sie erschien so schnell, dass sie in der Nähe gewesen sein und jedes Wort mitgehört haben musste – das erkannte er auch an ihrem Gesicht.
Und sie hielt ein ausgekochtes Leinentuch in der einen Hand und eine scharfe Schere in der anderen. »Halt ihn fest, dann geht es schneller«, sagte sie ganz geschäftsmäßig.
Gawin wandte das Gesicht ab.
»Also wirklich«, meinte der Hauptmann, als der Verband abgenommen war, »du solltest es genießen, dass sich eine solche Schönheit an deinen Lenden zu schaffen macht.«
Amicia hielt inne. Zum ersten Mal seit vielen Tagen sah er ihr in die Augen und kam sich sogleich wie ein Narr vor. »Entschuldigung«, murmelte er schwächlich.
Aber sie hielt seinem Blick stand. Und dann sah er, wie sie Gawin zuzwinkerte. »Ein Geheimnis für ein Geheimnis«, sagte sie mit ganz leicht hochgezogenen Mundwinkeln. Sie beugte sich über die lange Wunde am Bein des jungen Ritters, und als ihre Lippen nur noch eine Fingerbreite von seinem Schenkel entfernt waren, atmete sie aus – lange –, und dabei schloss sich die Wunde. Der Hauptmann sah, wie die Macht durch sie hindurchfloss; er bemerkte ein starkes Pulsieren, das so gewaltig war wie nichts anderes.
In seinen Augen war diese Macht hellgrün.
Amicia sah auf und zwinkerte ihm zu. In ihrem Blick lagen Herausforderung und Versprechen, und es dauerte nur einen einzigen Herzschlag, bis er beides angenommen hatte.
»Was hat sie getan?«, fragte Gawin. Der breite Oberkörper des Hauptmanns nahm ihm die Sicht. »Es ist alles taub.«
»Einen Umschlag«, meinte der Hauptmann fröhlich. Plötzlich duftete es im Raum nach Sommerblumen. Amicia wickelte frisches Leinen um die Wunde, wischte das neu ausgetretene Blut ab, und dann auch das ältere.
Gawin versuchte sich aufzurichten, aber der Hauptmann drückte ihn auf das Bett zurück. Unter seiner rechten Hand fühlte sich die Schulter seines Halbbruders gar nicht richtig an. Er rollte den Kragen des Hemdes herunter.
Gawins Schulter war so fein geschuppt wie ein Fisch – oder ein Lindwurm. Der Hauptmann fuhr mit den Fingerspitzen darüber, und hinter ihm keuchte Amicia scharf auf.
Gawin ächzte. »Und du glaubst, du seiest von Gott verflucht?«
Amicia betastete ebenfalls die Schuppen des jungen Ritters, und der Hauptmann stellte fest, dass er sofort eifersüchtig wurde.
»So etwas habe ich früher schon einmal gesehen«, sagte sie.
Gawins Miene hellte sich sofort auf. »Wirklich?«, fragte er.
»Ja«, erwiderte sie.
»Kann es geheilt werden?«, wollte er wissen.
Sie biss sich auf die Lippe. »Ich weiß es wirklich nicht, aber es war nicht ungewöhnlich bei … bei …«, stammelte sie.
Der Hauptmann dachte, dass ein Astrologe nun erklären werde, dies sei der Tag der Geheimnisse und ihrer Enthüllung.
»Ich will mich darum kümmern«, sagte sie mit der Sicherheit eines Arztes und schwirrte aus dem Raum; das blasse Grau ihres Überwurfs flatterte hinter ihr her.
Gawin sah ihr nach, ebenso wie der Hauptmann. »Sie hat die Macht genutzt«, meinte Gawin leise.
»Ja«, bestätigte der Hauptmann.
»Sie ist …« Gawins Kopf sank zurück. »Ich war auf dem Weg nach Norden«, begann er. »Der König hat mich vom Hof verbannt, weil ich den Mund zu voll genommen hatte. Ich hatte mich verliebt … nein, ich erzähle es nicht richtig. Ich hatte versucht, die Kammerzofe der Königin zu beeindrucken. Sie … ach, es ist gleich. Ich habe etwas zum König gesagt, das ich besser nicht gesagt hätte, und er hat mich in die Wildnis geschickt, damit ich mir Ruhm und Ehre erwerbe.« Gawin schüttelte den Kopf. »Ich habe einen großen Namen als angeblicher Schrecken der Wildnis. Weißt du auch warum? Nachdem wir dich getötet hatten – nun ja, nachdem wir es geglaubt hatten –, bin ich in die Wildnis geritten, weil ich dort sterben wollte. Allein.« Er lachte wieder. »Ein Dämon hat mich angegriffen, und ich habe ihn getötet.« Sein Lachen klang ein wenig zu wild. »Es war ein Handgemenge. Ich hatte meinen Dolch im Kampf verloren und habe das Wesen erwürgt, und deshalb nennen mich die anderen Harthand.«
»Vater muss sehr stolz auf dich gewesen sein«, murmelte der Hauptmann.
»Oh, das war er«, bestätigte Gawin. »So stolz, dass er mich an den Hof geschickt hat, sodass mich der König wiederum wegschicken konnte. Ich bin nordwärts nach Lorica geritten und in einer Herberge eingekehrt.« Er wandte den Kopf ab. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das erzählen kann, während ich dich ansehe. Ich habe einige Zimmer bezogen. Ein ausländischer Ritter kam mit seinem Gefolge – ich weiß nicht, wie viele es genau waren, aber es müssen mindestens hundert Ritter gewesen sein. Jean de Vrailly, verflucht sei sein Name vor Gott. Er hat mich hinaus in den Hof gerufen, zum Zweikampf herausgefordert und sofort angegriffen.« Gawin verstummte.
»Ach ja? Du warst schon immer ein besserer Schwertkämpfer als ich«, sagte der Hauptmann.
Gawin schüttelte den Kopf. »Nein. Nein, du bist der bessere gewesen. Ser Hywel hat es mir nach deinem angeblichen Tod eröffnet. Du hattest nur so getan, als wärest du unfähig.«
Der Hauptmann zuckte die Achseln. »Gut. Aber du warst und bist ein guter Soldat.«
»Ser Jean hält sich selbst für den besten Ritter der Welt«, sagte Gawin.
»Wirklich?«, meinte der Hauptmann. »Das ist aber sehr gefährlich.«
Gawin schnaubte verächtlich. »Du hast dich wirklich nicht verändert.«
»Doch, das habe ich«, wandte der Hauptmann ein.
»Ich hätte nie geglaubt, dass ich kichern kann, während ich das erzähle. Er steckte in seiner Rüstung – ich nicht.«
Der Hauptmann nickte. »Das ist klar, denn schließlich ist er ein Gallyer. Ich habe vor Kurzem dort gekämpft. Sie nehmen sich alle ungemein ernst.«
»Ich hatte nur ein Reitschwert – beim heiligen Georg, ich versuche mich zu sehr zu entschuldigen. Ich habe ihm standgehalten, habe eine Wunde davongetragen, und dann hat er mich gepackt, sodass ich aus Versehen mein eigenes Schwert in einen meiner Knappen gerammt habe. Mein eigenes Schwert hat einen meiner Männer getötet!« Nun war aller Humor verflogen, und Gawins Stimme befand sich irgendwo zwischen Schluchzen und völliger Ausdruckslosigkeit. »Ich hatte jedes Gefühl für den Kampf verloren, da hat er mich besiegt und in den Dreck gestoßen. Ich musste zugeben, dass ich unterlegen war.«
Wie das wohl geschmeckt haben mag?, dachte der Hauptmann. Er hatte sich tausendmal vorgestellt, dasselbe mit diesem Mann, der da vor ihm stand, zu machen. Und nun saß er an seinem Bett und versuchte zu begreifen, was sich in den letzten Minuten alles verändert hatte. Inzwischen erschien es ihm unmöglich, dass er sich diese Demütigung seines Halbbruders je vorgestellt hatte. Dass er sie ersehnt hatte. Dass er sie in seiner Vorstellung genossen hatte – noch vor zwei Tagen.
»Dann ist er in die Herberge gegangen und hat meinen anderen Knappen getötet«, fuhr Gawin fort und zuckte die Schultern. »Ich habe geschworen, ihn umzubringen.«
Nun verspürte der Hauptmann den unbezwingbaren Drang, Amicia zu folgen. Er empfand die Notwendigkeit, sie an ihr Schweigegelübde zu erinnern. Oder war das nur ein Vorwand? Der Schmerz in Gawins Stimme, rau, wie ein deutlich sichtbarer Bluterguss … Er hatte sich erst kurz zuvor gezwungen, den jüngeren Mann anzuhören, und nun war er zu dessen Beichtvater geworden.
So war es nun einmal, wenn man Hauptmann war.
»Dein Feind ist mein Feind«, sagte er einfach, beugte sich hinunter und legte die Arme um den Hals seines Bruders. Bei der Familie Murien galt eine gute Hassbezeugung als Möglichkeit, seine Liebe zu zeigen. Manchmal war es sogar die einzige.
»O Gabriel!«, sagte Gawin und brach in Tränen aus.
»Gabriel ist gestorben, Gawin«, sagte der Hauptmann.
Gawin rieb sich die Augen trocken. »Du hast sicherlich schon genug eigene Schwierigkeiten.« Er mühte sich an einem Lächeln ab.
»Wo soll ich anfangen?«, fragte der Hauptmann. »Ich werde von einem Feind belagert, der jede Art von Kreatur für seine Zwecke einsetzen kann, der mir im Verhältnis von zehn oder gar zwanzig zu eins überlegen ist und von einem gnadenlosen Genius angeführt wird.«
Gawin gelang ein weiteres Lächeln. »Mein Bruder ist doch auch ein gnadenloser Genius.«
Der Hauptmann grinste.
Gawin nickte. »Du willst etwas Verrücktes tun. Ich spüre es. Erinnerst du dich an die Sache mit den Hühnchen? Oder an dein alchemistisches Experiment?«
Der Hauptmann sah sich um, als fürchte er, belauscht zu werden. »Heute Nacht wird er uns hart treffen. Er muss es tun. Bisher sieht es trotz all seiner Bemühungen nämlich so aus, als ob die Belagerung nicht erfolgreich wäre. Einige der Seinen werden ihn als schwach ansehen und über ihn herfallen. So ist das in der Wildnis nun einmal.«
Gawin zuckte die Achseln. »Sie sind der Feind. Wer kann schon sagen, was sie denken?«
Der Hauptmann schenkte ihm ein grimmiges Lächeln. »Ich. Nur zu gut.«
»Ach ja?«, fragte Gawin nach einem kurzen Augenblick. »Woher weißt du das? Was denken sie denn?«
Der Hauptmann holte tief Luft.
Warum verfluchst du Gott an jedem Morgen?
Weil …
»Vielleicht werde ich es dir eines Tages sagen«, gab der Hauptmann zurück.
Gawin nahm dies in sich auf. »Der Mann der Geheimnisse. Also gut. Was willst du unternehmen?«
Der Hauptmann zuckte die Achseln. »Ich werde ihn auf die Probe stellen. Ich werde versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Der alte Magus arbeitet schon daran.«
Gawin setzte sich auf. »Du willst es doch wohl nicht wagen, Tho…«
»Sprich seinen Namen nicht aus«, sagte der Hauptmann. »Das bringt Unglück.«
Gawin biss sich auf die Lippe. »Ich wünschte, ich könnte bereits wieder reiten.«
»Dazu wirst du sehr bald imstande sein.« Der Hauptmann umarmte seinen Halbbruder noch einmal. »Ich möchte lieber dein Freund als dein Feind sein. Dein Feind bin ich nur aus Gewohnheit gewesen.«
Gawin klopfte dem Hauptmann sanft auf den Rücken. »Gabriel! Es tut mir so leid!«
Der Hauptmann hielt den jungen Ritter in den Armen, bis dieser eingeschlafen war. Es dauerte nicht lange.
»Ich bin nicht Gabriel«, sagte er zu seinem schlafenden Halbbruder. Dann machte er sich auf die Suche nach der Frau. Er musste nicht weit gehen. Sie saß auf einem Stuhl im Korridor.
Ihre Blicke trafen sich. Ihrer sagte: Komm mir nicht zu nahe – ich bin gerade sehr verwundbar.
Er war sich nicht sicher, was sein eigener Blick aussagte, doch er blieb eine Armeslänge auf Abstand. »Du hast es gehört«, sagte er viel barscher, als er gewollt hatte.
»Alles«, gab sie zu. »Beleidige mich nicht damit, dass du mein Schweigen forderst. Ich höre den Beichten der Sterbenden zu. Die Geheimnisse der Großen sind mir gleich.«
Er wusste, dass ihre Wut eine Art von Rüstung war, die ihn von ihr fernhalten sollte. Aber es tat trotzdem weh. »Manchmal haben Geheimnisse einen bestimmten Grund«, sagte er.
»Du verfluchst Gott, weil deine Mutter deinem Vater untreu war und du unter den Peinigungen deiner Brüder aufwachsen musstest?«, spuckte sie aus. »Ich hatte dich für tapferer gehalten.« Nun zuckte sie die Achseln. »Oder hast du etwa vor, einen Ausfall in die Nacht zu machen und draußen zu sterben?«
Er holte tief Luft. Sorgfältig zählte er auf Hocharchaisch bis fünfzig, dann stieß er die Luft wieder aus. »Du bist in der Wildnis gewesen«, sagte er leise.
Sie wandte den Blick ab. »Geh bitte.«
»Amicia …«, sagte er. Beinahe hätte er sie Liebste genannt. »Ich war in deinem Palast. Auf deiner Brücke. Ich verurteile dich nicht.«
»Das weiß ich, du Idiot«, fuhr sie ihn an.
Er war erstaunt von ihrer Giftigkeit. »Ich will dich beschützen!«, sagte er.
»Ich brauche deinen Schutz aber nicht!«, erwiderte sie. Die Wut legte Frost auf ihre Lippen. »Ich bin keine leidende Prinzessin in einem Turm! Ich bin eine Frau Gottes, und mein Gott ist der einzige Schutz, den ich benötige. Ich weiß nicht, warum meine Macht nicht von der Sonne kommt! Ich habe schon genug Sünden, die auf mich niederdrücken, sodass ich nicht auch noch dich brauche!« Sie sprang auf die Beine und versetzte ihm einen heftigen Stoß. »Ich bin ein Hinterwaller-Mädchen, eine Schlampe, eine Frau, niedriger als ein Leibeigener. Und du bist, wie sich herausgestellt hat, irgendein verlorengegangener Prinz, der mit seinem Aussehen, seinem Geld und seiner Macht zweifellos jede Frau betören kann.« Sie stieß ihn noch einmal an. »ICH BIN NICHTS FÜR DICH!«
Er war kein errötender Jüngling von sechzehn Jahren mehr. Also packte er ihren Arm und zog sie zu sich heran. Er hatte geglaubt, sie würde in seine Arme sinken.
Fast hätte sie es getan. Doch sie fing sich, und sein Kuss wurde abgewehrt. Seine Arme jedoch hielten sie fest, und sie sagte mit aller Frostigkeit, die eine Frau aufbringen konnte: »Soll ich Sym sagen, dass du mir Gewalt angetan hast? Hauptmann?«
Da ließ er sie los. In diesem Augenblick hasste er sie.
Und in diesem Augenblick beruhte das Gefühl vermutlich auf Gegenseitigkeit.
Sie ging zum Hauptkrankensaal, während er außer der Apotheke hinter ihm keinen Ort hatte, zu dem er sich zurückziehen konnte.
Diese aber war leer, und was er jetzt brauchte – möglicherweise mehr als je zuvor in seinem Leben –, war allein zu sein.
Er brach auf dem schweren hölzernen Stuhl in dem verdunkelten Raum zusammen, und bevor er es bemerkte, weinte er bereits.
Lissen Carak · Pampe
Pampe hatte Wachdienst. Ihre Beförderung war noch so frisch, dass sie die Verantwortung genoss, die damit einherging. Sie hatte sich bemüht, besonders sauber zu sein. Ihre Rüstung war poliert. Und ihre Kappe war so rein wie ein frisches Kissen. Sie wusste, dass viele ältere Männer es hassten, Befehle von einer Frau entgegenzunehmen, und sie wusste ebenso, dass ein glänzendes Äußeres sehr hilfreich war.
Sie postierte Wachen am Haupttor und kommandierte die vorherige Wache zu den Ausfalltoren. Befehl, Passwort, Salut – sie liebte die Zeremonien. Und sie liebte es, deren Auswirkungen auf die Bauern und ihre Familien zu beobachten. Die Bauern säuberten ihre Werkzeuge, kümmerten sich um ihr Vieh, Tag und Nacht. Bauern erkannten einen geschickten Handwerker, wenn sie einen sahen, auch wenn sein Handwerk der Krieg war.
Sie löste den letzten Posten ab und marschierte mit den Männern durch den Hof zum Eingang des Westturmes, wo Pampe sie entließ. Zwei langsame Bogenschützen waren dazu abkommandiert, den schweren Holzpfahl abzuwaschen, der für die Schwertübungen in den Boden gerammt worden war. Sym war bei seiner Bestrafung daran festgebunden worden, und nun klebten verschiedene Substanzen an ihm, die entfernt werden mussten.
Dann stieg sie die Stufen zum Turm hinauf und lauschte dabei den Soldaten, die wegmarschierten. Sie horchte auf Kritik, die sie erwartete. Sie war nicht gut genug, um einen fähigen Korporal abzugeben. Sie wollte es gern sein, aber es gab noch so vieles zu lernen.
Und sie wusste, dass es eine harte Nacht werden würde. Überall um den Festungsturm herum polierten und schärften die Männer ihre Waffen, überprüften die Polster an ihren Armen und zogen ihre Gürtel zurecht. Es gab tausend Rituale, die Sicherheit und Glück in der Schlacht verschaffen sollten. Und sie waren alle müde.
Oben auf der Treppe stand Tom Schlimm, ihre Nemesis, mit seinen Spießgesellen. Sie drückte den Rücken durch und bemerkte, dass er, obwohl er nicht im Dienst war, fast seine ganze Rüstung trug; es fehlten nur die Panzerhandschuhe und die Armbrust. Beides lag zusammen auf dem Tisch. Pampe sah, dass seine Rüstung genauso sorgfältig poliert war wie ihre eigene.
Er redete gerade mit Bent, und sie grinsten.
Pampe sah die beiden finster an. »Was ist los?«
»Für die königliche Garde sehen deine Leute gut genug aus«, meinte Tom unter lautem Kichern.
»Was zum Teufel soll das heißen?«, fuhr sie ihn an und sah dabei an ihm vorbei auf den ummauerten Balkon, durch den Luft und Licht in den Turm fielen. Sie bemerkte den Priester, der vom Turm auf die Mauer stieg, und fragte sich, was er dort zu suchen hatte.
Bent schlug sich auf die Schenkel und brüllte vor Lachen. »Hab’s dir doch gesagt«, rief er und ging zu seinem Spiel zurück. Rasch vergaß sie Pater Henry wieder. »Verträgt nicht mal ’n verdammtes Lob.«
Sie sah die beiden böse an und stieg den Turm hoch, wo sie nach dem Posten sah. »Wo sind all die Soldaten? Der Hauptmann hat eine Anweisung gegeben …«
Tom nickte ihr zu. »Hab sie bekommen. Ich bereite einen Ausfall vor.«
Pampe verspürte eine herbe Enttäuschung, vermischt mit Wut. »Einen Ausfall? Aber …«
»Du bist die Wachhabende«, meinte Tom. »Jetzt bin ich dran.«
»Immer bist du dran«, gab sie zurück.
Er nickte unbußfertig. »Ich bin Primus Pilus, Pampe. Ich kann einen Ausfall anführen, der so lange dauert, bis Christus wieder auf die Erde kommt – und sogar noch länger. Wart ab, bis du wieder dran bist, Süße.«
Sie riss sich zusammen und warf sich in die Brust, aber Tom Schlimm schüttelte den Kopf. »Gib da nichts drauf, Pampe, das war schlecht gesagt. Aber ich brauche diesen Ausfall. Die Jungs müssen mich mal kämpfen sehen.«
»Und du genießt es«, sagte Pampe und trat so dicht vor ihn hin, dass ihre Nasenspitzen sich beinahe berührten. »Ich genieße es ebenfalls, du Bastard.«
Tom lachte. »Hab’s verstanden, Korporal.«
Sie machte einen Schritt zurück. »Ich will endlich wieder an der Reihe sein. Wo sind eigentlich die anderen?«
»Die Jungs beichten beim Priester. Mach dir keine Sorgen, Pampe. Vermutlich werden wir gar nicht ausrücken. Aber jede Nacht muss ein Trupp für einen möglichen Ausfall bereitstehen.«
Pampe schüttelte den Kopf und ging zur Turmspitze hinauf. Sie fühlte sich übergangen.
Inzwischen war es vollkommen dunkel, und die Laute, die die verschiedenen Arten von Belagerern von sich gaben, wären unheimlich gewesen, wenn sie eingehender darüber nachgedacht hätte. Aber das tat sie nicht. Stattdessen gesellte sie sich zu der Mannschaft einer der großen Schleudern, die auf einem komplizierten System von Aufhängungen stand, die von dem alten Magus entworfen worden waren. Sie probierte. Die Waffe bewegte sich so leicht wie ein lebendiges Tier. Ohnekopf, der für die Maschine verantwortlich war, streichelte diese zärtlich. »Der alte Kerl hat sie magisiert, genau das hat er getan. Sie lebt nämlich. Wenn der nächste Lindwurm kommt, wird sie ihn für uns aus der Luft holen.«
Pampe schwang die Maschine vor und zurück. Es war ein angenehmes Gefühl, sie zu bewegen – als wäre es ein Spiel.
»Manchmal ist eine Maschine bloß eine Maschine«, sagte eine feste Stimme, und der alte Mann trat persönlich aus der Dunkelheit hervor. Noch nie war sie einem echten Magus so nahe gewesen, und sie zuckte zusammen.
»Es ist unser Glück, dass wir plötzlich fünfzig fähige Handwerker unter uns haben – einen Stuckmeister, der exakt zeichnen kann, Waffenschmiede, die Federn herstellen können, und einen Tischler, der ausgezeichnet mit Holz umzugehen weiß.« Er zuckte mit den Schultern. »Es ist ein archaischer Mechanismus, den ich in einem Buch gefunden habe. Es waren die Handwerker, die ihn hergestellt haben.« Dennoch schien der alte Mann sehr zufrieden zu sein und klopfte voller Zuneigung auf den Apparat. »Allerdings muss ich gestehen, dass ich ihm ein wenig Geist verliehen habe.«
»Er hat’s magisiert, und jetzt ist es lebendig«, sagte Ohnekopf glücklich. »Wird uns ’n Lindwurm schnappen.«
Harmodius zuckte die Schultern, als wollte er sich für die Unwissenheit dieser Männer entschuldigen, während er ihr Lob aber gern entgegennahm.
Sein Blick ruhte auf ihr.
Christ – fand dieser alte Magus sie etwa anziehend? Ein unheimlicher Gedanke. Unwillkürlich wand sie sich.
Er bemerkte ihre Bewegung und lachte, dann verstummte er. »Etwas bewegt sich dort unten«, sagte er.
Sie beugte sich über die Brüstung. »Wartet mal«, sagte sie. Dann: »Woher wisst Ihr das?«
Seine Augen glimmerten in der Dunkelheit. »Ich weiß es eben«, sagte er. »Ich kann den Himmel für einen Augenblick hell machen.«
»Nicht nötig«, erwiderte sie.
Von unten drang tatsächlich ein leises Klirren wie von Zimbeln herauf. Es ertönte noch einmal.
»Der Hauptmann hat Zinnringe an Drähten über die Wiesen spannen lassen«, sagte sie, als die Schleuder plötzlich gespannt wurde. Ohnekopf zog an einem Hebel, und ein dicker Bolzen schoss in die Dunkelheit.
Auf dem nächsten Turm schleuderte eine Wurfmaschine einen Kübel mit Kies, und plötzlich war die Nacht von Schreien erfüllt.
Ein Vergeltungspfeil aus purpur-grünem Licht schoss aus der Finsternis heran und traf den Turm mit der Wurfmaschine. Funken stoben, als schlüge ein Schmied auf glühendes Metall.
»Christus, was war denn das?«, fragte Pampe in die Dunkelheit hinein. Der grüne Lichtpfeil hatte sie geblendet; so sah sie nur ein Nachbild vor den Augen.
Der alte Harmodius lehnte sich über die Turmbrüstung, und ein Feuerbolzen flog aus seinen Händen und fuhr fast genau die Flugbahn des anderen Blitzes nach, soweit sie es zwischen den tanzenden Bildern vor ihren Augen erkennen konnte.
»Verdammt, verdammt, verdammt«, sagte er. Immer wieder.
In der Ferne fing sein Ziel Feuer – es war ein Riese von einem Mann oder ein seltsam missgestalteter Baum. Oder vielleicht waren es auch zwei Bäume.
»Gütiger Gott«, murmelte Harmodius. »Noch einmal!«, rief er dann.
Ohnekopf benötigte keinen weiteren Ansporn. Pampe beobachtete seine Mannschaft, wie sie seinen Anordnungen gehorchte. Zwei Männer zogen die Schleuder mit einer Kurbel auf, spannten den Zugmechanismus, entfernten die Kurbel wieder, und ein dritter trug einen zwanzigpfündigen Bolzen herbei, als wäre er aus Stroh, legte ihn in die Führung und schob ihn zurück, bis der gewaltige Haken gegen die große Sehne stieß. Ohnekopf spannte die Maschine mit einer Hand weiter, zielte auf den brennenden Baummann und betätigte den Abzug.
Ein weiterer blitzheller Lichtpfeil schlug in den Nordturm ein, und der Fels explodierte. Männer schrien. Ihre Männer.
Sie drehte sich um und rannte auf die Treppe zu. Und hielt inne. Sie konnte nicht auf beiden Türmen gleichzeitig sein.
Hinter ihr mühten sich die beiden Gehilfen damit ab, den Bogen so schnell wie möglich wieder zu spannen, aber Ohnekopf achtete weder auf sie noch auf Simkin, den Riesen, der genau rechtzeitig den nächsten Bolzen in die Führung legte, sodass der Bogen auf der Feder gespannt wurde und Ohnekopf zielen konnte.
Harmodius grunzte ein paar Worte und warf Feuer auf die Erde. Es wurde von etwas, das wie ein Korb aus grünem Licht wirkte, aufgefangen und auf sie zurückgeschleudert – schneller als ein Gedanke fing sein eigener Korb aus blauem Licht es ein und warf es zurück …
Ohnekopf zog den Hebel.
Der Bolzen traf den Baummann mitten in den Torso-Stamm. Ein Brüllen ertönte, und ein Feuerball erhellte die Nacht, während der Turm erbebte. Der Feuerball hatte die Brustwehr über dem Haupttor getroffen, sodass eine gewaltige Explosion entstand. Es war, als gieße man Wasser auf einen heißen Felsen, nur tausendmal stärker. Die Mauer ächzte, bog sich und brach nach außen zusammen. Der neue, überdachte Weg hinter dem Tor wurde getroffen.
Offenbar befand sich noch jemand auf dem Turm mit der Wurfmaschine, denn ein Korb mit rot glühenden Steinen – eine weitere Erfindung des Magus – flog in die Luft, und die Kiesel schwirrten wie Meteoriten durch den Himmel.
Alle Lichter gingen gleichzeitig aus, und eine Stille setzte ein, die nur durch Schreie aus der Ebene tief unter ihnen durchbrochen wurde. Und durch Stöhnen.
»Noch einmal!«, rief Harmodius. »Selbes Ziel. Trefft ihn wieder! Bevor er …«
Dann zog sich eine Mauer aus grünem Licht über den Himmel, und der Turm mit der Wurfmaschine explodierte in einem Funkenschauer. Ein langgezogener Schrei drang in die Nacht hinaus, dann neigte sich die Turmspitze vor, immer weiter, und stürzte in die Nacht. Sie riss die Wurfmaschine und vier Männer mit sich, schlug vierhundert Fuß unter ihnen auf den Talboden – ein dumpfes Grollen wie von einer Lawine war zu hören.
Und dann war da nur noch Stille.
Pampe hatte es bis in den Festungshof geschafft, als das grüne Feuer die Mauern traf. Sie stand so nahe bei dem Tor, dass sie von Splittern aus der Mauer getroffen wurde. Ein Stein des zusammengestürzten Turms traf sie an der Schulter. Auf dem Bergfried sah sie, wie sich Harmodius über die Brüstung beugte, während unheimliches blaues Feuer aus seinen Händen strömte.
Das Tor hatte einen halben Treffer abbekommen. Stücke aus dem Gesims waren auf den überdeckten Weg gefallen und hatten Teile des Daches zerschmettert. Darunter waren die Männer und Pferde von Tom Schlimms Ausfallkommando in finsterster Schwärze gefangen; die Pferde kreischten vor Pein, und die Männer riefen.
»Holt Fackeln! Laternen! Zu mir!«, brüllte Pampe.
Am hinteren Ende des überdachten Ganges lag Ser John Poultney mit gebrochenem Bein unter dem Kadaver seines Schlachtrosses. Pampe machte sich mit zwei Bogenschützen – Einohr und Quetscher – daran, das Pferd von ihm herunterzuheben. Die Bogenschützen verwendeten Speere als Hebel, und Ser John bemühte sich angestrengt, nicht zu schreien.
Das Dach des Ganges hatte den größten Teil des zusammengefallenen Tores aufgefangen, und die Balken knirschten unheilverkündend. Hier unten war es pechfinster, und endlich erschienen Männer mit Laternen, während der erste Soldat mit einem scheuenden Kriegspferd herauskam, das mit seinen Hufen den soeben erst geretteten Ser John beinahe getötet hätte. Das Pferd war ungeheuer wild, und weitere Bogenschützen griffen nach seinen Zügeln und hielten es fest. Nun strömten Diener, die nicht im Dienst waren, aus dem Turm heraus.
»Wo ist Tom?«, fragte Pampe und stürzte sich tiefer in die Finsternis. Quetscher, der sonst eigentlich keinerlei Mut zeigte, folgte ihr. Die Laterne beleuchtete ein Dutzend Reiter, die sich bemühten, ihre Tiere in dem engen Gang unter Kontrolle zu bringen. Alle waren abgestiegen und zerrten an den Köpfen ihrer Pferde, die sich stets nur kurz beruhigten und dann wieder in der Dunkelheit und dem Lärm in Panik gerieten. Ser Johns totes Pferd war auch nicht gerade hilfreich, da es nach Blut und Angst stank.
»Holt sie heraus!«, brüllte Tom.
Hufe droschen umher. Die Männer waren in voller Rüstung, aber die Pferde ließen sich einfach nicht beruhigen und würden ihre Reiter bald getötet haben, ob sie nun in einer Rüstung steckten oder nicht.
Mit einem lauten Zischen explodierte das Tor hinter Tom und brach in Flammen aus. Es erhellte den engen Raum, die tobenden Pferde und die Rüstungen der Männer – ein Vorgeschmack der Hölle.
Fast gleichzeitig drehten sich alle Pferde um und rannten vor dem Feuer davon. Die meisten Soldaten wurden von den Beinen gerissen.
Quetscher drückte sich platt gegen die hölzerne Wand, und Pampe, die noch in ihrer Rüstung steckte, stellte sich vor ihn und versuchte ihn zu schützen, als die großen Tiere vorbeipreschten und über den Leib des toten Pferdes hinwegsetzten.
Draußen im Hof hielten sich die Diener bereit, sprangen nach den Zügeln, stülpten den Pferden Säcke über die Köpfe und sprachen ruhig und gleichzeitig gebieterisch auf sie ein – wie Lords, die mit ihren Leibeigenen redeten. Rasch, freundlich und gleichzeitig unbarmherzig hatten sie die Kontrolle über die Pferde erlangt.
Die Soldaten kämpften sich wieder auf die Beine.
Pampe erkannte, dass das Feuer keinerlei Hitze verbreitete, und in diesem Augenblick trat der Hauptmann aus der Finsternis und hob die Hände.
Die Flammen erloschen wie Kerzen im Wind.
»Tom? Wir müssen die Männer zählen. Wird jemand vermisst?«, rief er und ging an ihr vorbei. Es war wieder dunkel, doch er schien zu wissen, dass sie da war, denn er wandte sich ihr zu. »Wir haben ein Dutzend Männer auf dem Turm mit der Wurfmaschine verloren. Geh und sieh nach, ob jemand gerettet werden kann.«
Ihre Augen glühten in der Dunkelheit.
»Ja, Mylord.« Sie nickte in die Schwärze hinein und ging zum schwachen Licht des Festungshofes zurück, vorbei an einem Dutzend wütender Kriegspferde und den Männern, die sie allmählich beruhigten. Bauern standen mit ihren Frauen und Töchtern an den Türen und Fenstern.
Der Turm, auf dem sich die Wurfmaschine befunden hatte, wirkte wie ein abgebrochener Zahn. Etwa ein Drittel des oberen Bereiches war verschwunden, und Pampe war dankbar dafür, dass er nach außen und nicht in den Hof gefallen war.
Das Dach des zweiten Stockwerks war allerdings nach innen durchgebrochen und hatte Steine und Balken auf die darunter schlafenden Soldaten geworfen. Geslin, der jüngste Bogenschütze der Truppe, war tot, zerschmettert von einem Balken. Sein verzerrter Leichnam wurde vom flackernden Feuerschein in ein schreckliches Licht getaucht. Dook, ein nutzloser Kerl, versuchte gerade, den Balken von ihm zu heben und weinte dabei.
Pampe setzte ihre beste Kommandostimme ein, bezwang ihre Panik und rief: »Ich brauche hier oben jemanden!«
Bogenschützen kletterten über die Leitern zu ihr hinauf. Es waren Männer, die sie kannte: Flarch, ihr eigener Bogenschütze, und Cuddy, vielleicht der beste Schütze der ganzen Truppe, sowie Rost, der wohl schlechteste. Auch Langpfote war da, der sich wie ein Tänzer bewegte, und Duggin, der so groß wie ein Haus war. Sie hoben den Balken von dem Leichnam und entdeckten darunter noch Kanny, der bewusstlos war und eine Menge Blut verloren hatte. Hinter ihm, in einem Zwischenraum, der von einem Fenstersims gebildet wurde, fanden sie Kessin, den fettesten Mann der Truppe.
Mehr und mehr Männer kamen herbei: die Lanthorn-Männer, die Carters aus dem Hof und die anderen Bauern. Mit unglaublicher Schnelligkeit räumten sie die schweren Balken weg und säuberten den Boden. Einer von Meister Randoms Männern, der mit dem Magus zusammengearbeitet hatte, errichtete eine Hebemaschine, und bevor die Sonne aufgegangen war, waren alle schweren Steine, die man noch verwenden konnte, über den eingestürzten Turm hinweggehoben und in den Hof gelegt worden.
Dort stand der Hauptmann; er wirkte müde, hatte die Hände über seinem goldenen Gürtel in die Hüften gestemmt und sah den Arbeiten zu. Dabei schaute er starr geradeaus. »Gut gemacht, Pampe. Geh zu Bett.«
Sie zuckte die Achseln. »Es ist noch eine Menge zu tun«, sagte sie müde.
Nun wandte er sich ihr zu und lächelte sie an. Sehr langsam, wie ein Liebhaber, beugte er sich zu ihrem Ohr. »Das ist die erste schlimme Nacht, der noch Hunderte folgen werden«, flüsterte er. »Spar dir deine Kräfte auf. Geh zu Bett.«
Sie seufzte, sah ihn an und bemühte sich, ihre Bewunderung für ihn zu verbergen. »Ich schaffe das«, sagte sie wild entschlossen.
»Ich weiß, dass du das schaffst«, sagte er und rollte mit den Augen. »Aber du wirst es dann nicht mehr schaffen, wenn wir dich dringend brauchen. Ich selbst gehe jetzt zu Bett, und du auch, ja?«
Sie zuckte mit den Schultern, wich seinem Blick aus. Und ging davon …
… und begriff endlich, dass ihr Bett im Turm mit der Wurfmaschine gestanden hatte. Sie seufzte.
Lissen Carak · Michael
Die Belagerung von Lissen Carak. Achter Tag.
In der letzten Nacht hat uns der abtrünnige Magus höchstpersönlich angegriffen. Der Hauptmann hat gesagt, seine Kräfte seien größer als jene, durch die unsere Mauern zusammengehalten werden, und trotz all unserer Anstrengungen hat er den Südwestturm zum Einsturz gebracht, auf dem die Wurfmaschine stand. Dadurch hat er vier Männer und einige Jungen getötet.
Ohnekopf, einer der Bogenschützen, hat den abtrünnigen Magus mit einem Bolzen getroffen. Viele Männer haben gesehen, wie er sein Ziel fand.
Jetzt haben wir Hilfe durch Harmodius, den Magus des Königs, der sich mit dem abtrünnigen Magus duelliert hat; als Waffe dienten ihnen Feuerblitze. Der abtrünnige Magus hat die Mauer beim Ausfalltor zerstört, aber Pampe hat durch ihr schnelles Handeln viele Männer und Pferde gerettet.
In dem Manuskript waren Ohnekopf und Pampe durchgestrichen und durch die Namen Thomas Harding und Alison Grave ersetzt worden.
Lissen Carak · Der Rote Ritter
Am Ende hatten sie sechs Bogenschützen und einen Soldaten verloren. Es war ein harter Schlag. Der Hauptmann las ihre Namen, strich sie von der Liste und grunzte.
Doch nun verfügten sie zusätzlich über die Lanthorn-Jungen, die Carter-Jungen und Daniel Favor. Und sie hatten einen Goldschmiedelehrling namens Adrian, der ein begnadeter Maler war, sowie einen schlaksigen Jungen namens Allan.
Er gab Tom die Liste. »Stell die Leute für den Wachtdienst zusammen. Messire Thomas Durrem …«
»Mausetot«, sagte Tom und zuckte die Achseln. »Ist mit dem Turm untergegangen. Wir haben nicht mal seine Leiche gefunden.«
Der Hauptmann verzerrte das Gesicht. »Also haben wir noch einen Soldaten verloren.«
Tom nickte und kaute auf seinem Bleistift herum. »Ich werde Euch einen neuen besorgen«, sagte er.
Die Brückenburg · Ser Milus
Ser Milus stand bei den sieben neuen Soldaten. Seiner Meinung nach waren es gute Männer, die aber einen raschen Tritt in den Allerwertesten brauchten.
Im Burghof hatte er einen Pfahl aufstellen lassen. Meister Randoms Lehrlinge hatten einen großen Stein aus der Pflasterung gehoben und darunter ein Loch gegraben, das eine Manneslänge tief war. Dort hinein hatten sie den Pfahl gesetzt. Es war wirklich angenehm, so viele willige Hände zur Verfügung zu haben.
Er ging um den Pfahl herum und hielt dabei seine Lieblingswaffe in der Hand – einen Kriegshammer. Der Kopf war wie eine Burgmauer gezackt, und vier kleine Stacheln ragten daraus hervor. Auf der anderen Seite gab es einen langen, leicht gebogenen Dorn, und auf der Klingenspitze saß ein kleiner, schrecklich scharfer Speerkopf. Ein ganzer Fuß soliden Stahls ragte aus dem Schaft hervor und war angespitzt wie ein Meißel.
Ser Milus wirbelte die Waffe zwischen seinen Händen herum. »Ich erwarte nicht, dass wir vom Pferd herunter kämpfen werden«, sagte er im Plauderton.
Gwillam, der Sergeant, nickte.
»Dann wollen wir mal sehen«, sagte Ser Milus. Er nickte Gwillam zu, der vortrat. Nach den Maßstäben der Truppe war seine Rüstung armselig. Er trug einen alten Panzer, Beinschienen und ein gutes Kettenhemd sowie schwere Lederhandschuhe, die mit kleinen Stahlplatten versehen waren. Auf Ser Milus wirkte das alles äußerst altmodisch.
Gwillam hatte einen schweren Speer. Er trat an den Pfahl heran, wählte seine Distanz und schleuderte die Waffe. Die Speerspitze bohrte sich einen Zoll tief in das Eichenholz. Er zuckte die Achseln und zog den Speer mit einer heftigen Bewegung wieder heraus.
Dirk Kehlenschneider, der Nächste in der Reihe der Soldaten, trat vor und schwang lässig seine gewaltige Axt mit der Doppelklinge. Der Stahl fraß sich tief in den Pfosten hinein.
Bogenschützen sammelten sich in den Türmen, und die Kaufleute waren aus ihren Wagen getreten und sahen zu.
John Lee, ein früherer Schiffer, besaß ebenfalls eine Axt mit einer Doppelklinge. Er schwang sie heftig und präzise und hieb ein großes Stück Holz aus dem Pfosten.