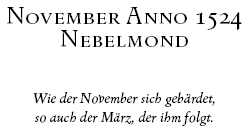
Durch den dichten Nebel, der die ganze Welt wie mit einem Leichentuch verhüllt hatte, schimmerte bleigrau der Spiegel des Mühlenteiches. Anna Elisabeth, die am Fenster stand und hinausschaute, fand es unmöglich, ihre Tränen zurückzuhalten. Drei Wochen lag das Erntefest jetzt schon zurück, und noch immer schmerzte unsäglich, was damals mit ihr geschehen war.
Alles stand noch so frisch in ihrer Erinnerung, als sei es gestern gewesen. Sie hatte mit ihm getanzt – zuerst einen wilden, danach einen zahmeren Tanz. Dass ihm die Schritte des Reigens nicht geläufig gewesen waren, hatte sie verwundert, aber als er mit ihr an den Rand des Tanzbodens ausgewichen war, hatte sie das wunderbare Gefühl gehabt, in seinen Armen zu schweben ... ja, es war ein Schweben gewesen, wahrhaftig.
Dann hatte sie ihn gefragt, ob er gebunden sei – warum eigentlich? –, und er hatte ihr von seiner Geliebten erzählt. Mit einem schrecklichen Donnerschlag war die Erde wieder unter ihren Füßen spürbar gewesen. Und dann ...
Anna Elisabeth wischte sich über die nassen Wangen. Die ganze Welt war eingestürzt, auf dem Tanz beim Erntefest. Sie war beleidigt worden, gedemütigt, auf übelste Weise geschmäht. Doch das Schlimmste war die Tatsache, dass er sich als einer vom Adel entpuppt hatte. Er hatte sie getäuscht. Er hieß nicht Albrecht Hund und kam auch nicht aus Schwarzental. Sein Name war Albrecht Wolf von Weißenstein. Und sie liebte ihn.
Hannes ahnte nichts davon. Er hatte neulich den Auftritt bei der Tanzfläche nicht einmal mitbekommen. Viel zu sehr war er mit Trinken und Reden beschäftigt gewesen. Erst ihre Tränen später am Tag hatten ihn bewogen, nach ihrem Kummer zu fragen. Da hatte sie ihm lediglich von den Beleidigungen durch den Junker Hinzheim erzählt und den wahren Grund ihres Schmerzes nicht erwähnt. Wie konnte sie auch?
Anna Elisabeth unterdrückte einen Schluchzer. Wie oft hatte sie jetzt die ganze entsetzliche Geschichte in der Erinnerung noch einmal ablaufen lassen – hundertmal? Tausendmal? Das Herz hatte ihr bis zum Hals geschlagen, als sie Albrecht in der Menschenmenge auf dem Fest erkannt hatte, und ihr war klar geworden, dass sie sich ein Wiedersehen erhofft hatte. Als er Hannes um Erlaubnis gebeten hatte, mit ihr zu tanzen, da war sie beinahe in die Luft gesprungen vor Freude. Auch auf dem Tanzboden dann hatte sie immer noch nicht begriffen, warum sie so unangemessen glücklich war – da hatte sie noch geglaubt, es sei nur die Festesstimmung. Erst als der andere Junker ihn angesprochen und er sie weggestoßen hatte, war es ihr bewusst geworden. Sie liebte ihn. Und sie hatte ihn verloren.
Nein – sie hätte ihn nie gewinnen können. Er war ein Schuft – so viel stand fest. Dass er sich ihr genähert hatte, konnte nur einen einzigen Grund haben. Er war auf ein Abenteuer aus gewesen. Herren von Stand machten sich einen Spaß daraus, Bauernmädchen zu entehren ... der andere Junker, sein Vetter, hatte ja keinen Zweifel darüber gelassen.
Anna Elisabeth schloss die Augen. Tränen rollten heiß über ihre Wangen und tropften auf das Fensterbrett. Er war ein Schuft – aber sein Kuss war so süß gewesen ...
Hinter ihr trat jemand in die Stube. Sie wischte sich schnell über die Augen und drehte sich um. Hannes war hereingekommen; seine groben Stiefel hinterließen nasse Spuren auf den Pflastersteinen beim Herd.
Sein Gesicht war von der rauen Luft gerötet. Wie er so dastand in seiner braunen, mit zotteligem Schaffell gefütterten Jacke, die topfartige Wollmütze tief in die Stirn gezogen, erinnerte er an einen vierschrötigen Waldgeist – einen Schrat oder Wurzelmann. Er hielt einen Feldhasen an den Ohren, ein großes, ausgewachsenes Tier, dem die Schlinge noch um den Hals baumelte. »Annelies«, sagte er munter, »hier bringe ich dir einen Braten fürs Nachtessen. Ich hoff, du lädst mich dazu auch an deinen Tisch!«
»Bist du des Teufels?«, gab Anna Elisabeth erschrocken zurück. »Wenn dich einer gesehen hat ... !«
»Hat aber keiner«, sagte Hannes und grinste. Dann musterte er betroffen ihr Gesicht. »Schätzle – was ist dir?«
»Nichts«, erwiderte Anna Elisabeth. »Hab Zwiebeln geschält.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß schon, was dir immer noch nachgeht«, sagte er, und in seiner Stimme lag ein Grollen. »Aber fürchte nicht, dass das ungestraft bleibt. Es kommt die Zeit, Annelies – da beleidigt keiner mehr die Meinige!«
Er hatte wütend die Faust geballt. »Dagegen kommst du doch nicht an«, wies sie ihn zurecht. »Außerdem – es ist ja längst vergessen.«
»Das meinst du.« Hannes schob das Kinn vor. »Ich hab’s nit vergessen!« Er runzelte die Brauen und starrte einen Augenblick finster vor sich hin. Dann hielt er ihr den Hasen entgegen. »Machst du’s selbst – oder soll ich ihn für dich abziehen und ausnehmen?«
»Ja, tu das nur«, sagte Anna Elisabeth. »Und vergrab den Abfall auf dem Mist.«
»Auch das Fell?« Er streichelte dem Hasen sacht über die Flanke. »Es ist ganz dicht und weich ... gäb einen schönen, warmen Muff für dich.«
»Auch das Fell«, erwiderte Anna Elisabeth, »so schade es drum ist.« Man durfte nicht riskieren, mit einem solchen Pelz erwischt zu werden. Die Knechte des Klostervogtes hatten scharfe Augen. »Wenn du fertig bist, bring mir das Fleisch wieder herein. Ich koch uns einen Hasenpfeffer. Hab gestern erst frisch gebacken – so was schmeckt gut mit neuem Brot.«
Hannes war schon wieder ganz der Alte. »Ich bring zum Essen noch den Quirin und den Simon mit«, sagte er augenzwinkernd im Hinausgehen, »wir haben was zu besprechen – unter Männern.«
Albrecht hatte einheizen lassen. Aber heute stand der Wind nicht günstig. Die ganze Wärme, die das mächtig ziehende Feuer entwickelte, wurde brausend durch den Kamin weggesaugt, ohne der Kemenate auch nur ein Minimum an kalter Feuchte zu nehmen.
Fröstelnd zog Albrecht seinen mit Wolfsfell gefütterten Mantel enger um den Hals und starrte den Funken nach, die aus den lodernden, krachenden Scheiten in dem Kamin hinaufwirbelten. So, wie dieses Feuer völlig nutzlos Holz verzehrte, so verzehrte ihn seine Sehnsucht – ganz ohne Sinn und Verstand. Denn auf dem Heimweg von dem unglückseligen Erntefest war ihm aufgegangen, dass er das Ziel seiner Sehnsucht niemals erreichen würde. Er verlangte ja nicht nur nach Annas Körper. Er liebte sie.
Was hatte er doch Christoph als Grund für die Fahrt zum Fest angegeben? Wir sind auf der Jagd, hatte er dem Jungen gesagt – auf der Jagd nach einem hübschen Mädchen. Genau das hatte er selbst auch geglaubt. Nicht einmal im Traum wäre er an jenem Tag darauf gekommen, dass er auf etwas anderes aus war als nur auf ein schnelles Liebesstündchen in irgendeinem Heuschober ...
Wie sie ihn angesehen hatte, nachdem sein wahrer Name durch Hinzheim verraten worden war – welche Verachtung aus ihrem Blick gesprochen hatte! Für alle Zeit hatte er in dieser Sekunde jede Glaubhaftigkeit verloren, durch bloßes Spiel des Zufalls. Er stand als Lügner und Betrüger vor ihr da – als adliger Schürzenjäger, der sich auf übelste Weise bei einem unbescholtenen Mädchen hatte einschmeicheln wollen und der ihr auch noch eine unverzeihliche Demütigung angetan hatte.
Wolf von Weißenstein. Wolf im Schafspelz. Dass er sie mit seinem beleidigenden Verhalten vor den dreisten Annäherungsversuchen des Junkers von Hinzheim bewahrt hatte, konnte nicht zu seinen Gunsten ausgelegt werden. Anna ahnte ja nicht, warum er sie mit einer so unverschämten Begründung von sich weggestoßen hatte. Dass Hinzheim ein notorischer Jungfernschänder war, konnte ihr kaum bekannt sein, denn ihr Dorf gehörte zur Abtei Kaltenbrunn, wo Hinzheim nichts verloren hatte.
Hinzheim. Albrecht knirschte mit den Zähnen. Morgen würde er mit diesem eitlen, überheblichen Raufbold, der weder Skrupel noch Gewissen kannte, auf die Jagd reiten. Hinzheim hatte sich selbst dazu eingeladen; Ablehnung wäre Beleidigung gewesen, und die zog unweigerlich eine Fehde nach sich.
Wenigstens würde die Jagdgesellschaft nicht nur aus solchen wie Hinzheim bestehen. Berlichingen hatte zugesagt, weil er sich just in der Gegend aufhielt, und der Götz sorgte immer für Spaß. Er und seine Männer würden schon keine schlechte Laune aufkommen lassen. Es würde eine lustige Hatz geben, und abends einen guten Braten, hinuntergespült mit reichlich Wein und Bier – der Keller war voll von Fässern aus dem Transportgut der Kaufleute, das sein guter Bernhard neulich erbeutet hatte. Sogar Gaukler würden ihre Kunststückchen zum Besten geben – Fahrende, die Christoph an der Straße aufgegabelt hatte.
Albrecht drückte sich tiefer in die Polsterkissen des klobigen Lehnstuhls, in dem er saß, streckte die Beine noch näher an die glühenden Scheite und richtete den Blick zur Decke. Dieses Zimmer – einer der wenigen heizbaren Räume der Burg – hatte einmal seiner Mutter als Schlafkammer gedient. Die Farben, mit denen die dicht beieinander liegenden Deckenbalken samt ihren Konsolen bemalt waren, zeugten bis heute von ihr, denn sie selbst hatte zu ihren Lebzeiten die zierlichen Ranken, Blüten und Fabelwesen in Auftrag gegeben. Noch heute prangten sie in Ochsenblutrot, stumpfem Grün und strahlendem Gelb, als habe sie der Maler eben erst auf das schwärzliche Eichenholz übertragen. Außer der prächtigen hölzernen Decke wies der weiß getünchte Raum keinerlei Schmuck auf, aber Albrecht hatte sich hier immer am liebsten aufgehalten.
Er seufzte. Es war müßig, sich vorzustellen, wie Anna diese Kemenate wohl gefallen hätte. Anna würde das Zimmer seiner Mutter nie zu Gesicht bekommen. Die Möglichkeit, sie zu gewinnen, war unwiederbringlich vertan. Nie würde es ihm gelingen, sie davon zu überzeugen, dass er mit einem Junker Hinzheim nicht zu vergleichen war. Diese Tatsache hatte er zu akzeptieren.
Mit steifen Muskeln erhob er sich aus dem Sessel. Anstatt hier weiter zu frieren, würde er hinunter in die Küche gehen und sich dort am Herdfeuer wärmen. Das Gesinde hielt sich um diese Tageszeit sicher beinahe vollzählig dort auf – im Gespräch mit Mägden und Knechten der Burg konnte er sich von seinen schmerzenden Erinnerungen ablenken und vielleicht auf andere Gedanken kommen.
Unter dem riesigen Rauchfang in der Küche der Burg flammte ein Feuer, an dem man einen Ochsen hätte rösten können. Aber hier lieferte es mehr Wärme als oben in der Kemenate, denn das tief hängende Kreuzrippengewölbe des weitläufigen Küchenraumes verhinderte den Abzug der temperierten Luft weit besser als die hohen Balkendecken der oberen Geschosse.
Vier Mägde wirkten zusammen mit der alten Magdalene an den beiden Herden, die mit ihren separaten Kaminen eine Seitenwand einnahmen. Auf dem einen kochte in einem eisernen Kessel, bewacht von der jungen Hedwig, die Hafergrütze für das Nachtmahl. Der zweite wurde eben angeheizt. Ein kleiner Berg weißer Rüben lag da auf dem Tisch neben dem Herd; Christoph war mit seinem Jagdmesser dabei, das Gemüse in Stücke zu schneiden.
Der Junge errötete, als er Albrecht eintreten sah, und wollte schnell das Messer aus der Hand legen. Doch die alte Magdalene hob den Finger. »Nichts da, Faulpelz«, schalt sie ihn, »du hast es Hedwig versprochen!«
Albrecht sah seine Amme fragend an. »Wieso ist Christoph nicht auf Wache am Tor?«
Magdalene musterte ihren jungen Herrn mit schief gelegtem Kopf. »Er treibt sich in letzter Zeit mehr hier herum«, sagte sie, indem sie ihr weißes Kopftuch zurechtrückte, »und da sehe ich es nicht gern, wenn er müßig zuschaut, wie wir arbeiten.«
»Schon recht.« Albrecht warf Christoph einen strafenden Blick zu. »Aber sollte er nicht vielmehr Männerarbeit verrichten, als hier in der Küche Rüben zu schneiden?«
»O – er hat schon Holz und Wasser getragen«, versuchte die kleine Hedwig Christophs Verhalten zu rechtfertigen. »Und die Rüben schneidet er nur, weil –«
Albrecht unterbrach ihren Redeschwall mit einem Lachen. »Ich weiß«, sagte er, »weil du ihm das Versprechen abgeluchst hast. Du bist ein schlaues Mädchen.«
»Das ist sie«, bestätigte Christoph und errötete noch tiefer. »Doch mein Versprechen hab ich ihr freiwillig gegeben ...«
»Sonst hätte ich dich auch aus der Küche hinausgewiesen, Müßiggänger«, mischte sich die alte Magdalene ein. »Seit deiner Ausfahrt mit dem Herrn tust du gar zu hochnäsig!«
Christophs Verlegenheit wuchs. »Wie kannst du das behaupten, Magdalene«, sagte er zornig, »wo ich doch nicht anders bin als früher!«
»Dir mag das nicht aufgefallen sein«, widersprach die Amme, »aber wir andern, wir merken es schon. Du hast dich verändert – und nicht zu deinem Vorteil!«
Albrecht hob eine Augenbraue. »Inwiefern?«, fragte er.
»Dem Jungen mangelt es heutzutage an der Demut, die ihm ziemen würde«, sagte Magdalene. »Schließlich ist er nur –«
»Genug«, schnitt Albrecht ihr die Rede ab. Er wandte sich an Christoph. »Wo sind die Gaukler, von denen mir berichtet wurde?«
Christoph atmete sichtlich auf. »In den Pferdeställen, Herr«, antwortete er. »Ich habe ihnen einen Platz auf dem Heuboden gezeigt, wo sie übernachten können.«
»Sie sollen herkommen – damit sie uns nicht möglicherweise die Scheune niederbrennen«, sagte Albrecht. »Es würde mich nämlich nicht wundern, wenn sie sich ein Feuerchen anzünden – bei dem eisigen Wind.«
Der Junge war schon an der Tür. »Sofort, Herr«, beeilte er sich zu sagen. »Da werden sie sich aber freuen. Können sie auch etwas zu essen bekommen ... wie das früher auf Weißenstein üblich war?«
Die alte Magdalene tat erbost. »Hergelaufenes Gesindel durchzufüttern – das war noch nie der Brauch in diesem Haus«, murrte sie halblaut. »Wir haben ja kaum genug für uns selbst!«
»Soll ich ein paar Rüben mehr schneiden?«, fragte Albrecht lächelnd.
Magdalene machte ein entsetztes Gesicht. »Herr«, grollte sie, »auch Ihr habt Euch verändert, wenn ich das bemerken darf. Wie könnt Ihr ein solches Ansinnen nur erwähnen?«
»Und was wäre daran so ungeheuerlich?«, lächelte Albrecht.
»Herr ... ein Edelmann, der niedere Arbeiten verrichtet ... !« Die Amme schlug die Hände zusammen.
»Lauf, Christoph«, sagte Albrecht. Für den Augenblick war seine trübe Stimmung verflogen. »Du brauchst keine Rüben mehr zu schneiden, hörst du? Hol mir die Gaukler her. Ich möchte sehen, was es für Leute sind und womit sie morgen unsere Gäste unterhalten werden!«
Der Junge huschte hinaus. Magdalene stand ganz still und sah ihren Herrn an. Sie erforschte sein Gesicht; der Blick ihrer lebendigen grauen Augen stellte Fragen über Fragen. »Herr«, murmelte sie, »habt Ihr etwa ...«
»Noch nicht«, gab Albrecht zurück, »doch ich werde es tun – über kurz oder lang.«
Sie hatten es sich auf der Bank hinter dem Tisch bequem gemacht, Anna Elisabeths Vater, der Hannes, der Simon und der Quirin. Michel, der aus dem Stall dazugeholt worden war, hatte den dreibeinigen Melkschemel mitgebracht und nahm nun eine Schmalseite des Tisches ein. Allesamt schauten sie erwartungsvoll zum Herd herüber, wo Anna Elisabeth dem Hasenpfeffer die letzte Würze gab.
Das verbotene Festessen duftete herrlich. Bierkrug und Becher standen bereit. Frisches Brot, in dicke Scheiben geschnitten, wartete aufgestapelt auf einem Holzteller. Niemand sagte ein Wort; dazu wässerte ihnen der Mund zu sehr, vermutete Anna Elisabeth.
Jetzt war das Gericht so gut wie fertig. Für einen Wolf von Weißenstein war Hasenbraten sicher keine Seltenheit, geschweige denn gänzlich verboten. Der sah solche Köstlichkeiten wohl alle Tage auf seiner Tafel, und in seiner Küche würde man das Fleisch auch nicht in winzige Stückchen schneiden müssen, damit jeder etwas abbekam. Anna Elisabeth streute noch ein wenig getrockneten Quendel über der brodelnden Soße aus, füllte den Hasenpfeffer in eine große Steinzeugschüssel und trug ihn auf. Ein Wolf von Weißenstein würde sich kaum so gierig über sein Essen hermachen wie die Männer am Tisch ihres Vaters, die derart heißhungrig darauf gewartet hatten.
Sie fielen regelrecht darüber her. Hastig tunkten sie ihre Brotbrocken in die Schüssel, häuften sich die Löffel so voll, dass sie sie kaum noch in den Mund bekamen, kauten mit vollen Backen. Der Michel, der doch gewöhnlich ein bescheidener Kerl war, hielt sich heute keineswegs zurück. Er aß so schnell, dass ihm der Hannes einen bitterbösen Blick zuwarf und mit vollem Mund zischte: »Lass der Annelies auch was, Rüpel!«
Im Handumdrehen war die ganze Riesenkumme so gut wie leer. Der Vater rülpste laut, wischte sich mit dem Handrücken den soßenverschmierten Mund ab, bedeutete seiner Tochter, dass sie jetzt an der Reihe sei. Ob das am Tisch eines Herrn von Stand auch so ging, dass die Frauen bekamen, was die Männer übrig ließen?
Anna Elisabeth holte sich die Schüssel und setzte sich damit auf den Herdrand. Wenige kleine Bröckchen von dem Hasenfleisch und ein Pfützchen Soße hatten sie ihr gelassen, die Kerle ... nun ja, sie hatten ja auch den ganzen lieben langen Tag über schwer gearbeitet – schwerer jedenfalls als sie. Bauholz fürs Kloster zu schlagen, das war kein Kinderspiel. Morgen würden die Stämme mit Ochsen und Pferden aus dem Wald gerückt werden müssen. Und nächste Woche stand der Transport zum Lagerplatz des Klosters an ...
Anna Elisabeth aß ihren Rest mit wenig Genuss. Warum drehten sich ihre Gedanken nur immer wieder um den Wolf von Weißenstein? Warum konnte sie nicht einfach vergessen, dass er je hier gewesen war? Schon brannten wieder Tränen in ihren Augen, und der Hannes hatte es auch bereits bemerkt.
Seine Augen verdunkelten sich. »So geht das schon seit dem Michaelifest«, sagte er zu Quirin, der links neben ihm saß. »Dauernd muss sie weinen, meine Annelies. Sie kann’s einfach nicht verwinden, dass der gottverfluchte Junker –«
Es klopfte an der Haustür. »Wer mag das jetzt noch sein?«, fragte der Vater.
Der Hannes schien es zu wissen. »Mach auf, Schätzle«, sagte er zu Anna Elisabeth. »Ich wusste, er kommt heute noch.«
Die Männer sahen ihn fragend an. Anna Elisabeth stellte ihre Schüssel ab, ging gehorsam zur Tür und öffnete. Draußen stand ein Mann in einem dunklen Umhang, der seine ganze Gestalt verhüllte.
»Ist dies das Haus vom Müllerhans?«, fragte der Unbekannte. »Nein«, gab Anna Elisabeth zögernd Auskunft, »aber der Müllerhannes ist hier. Kommt nur herein ...«
»Ich danke Euch«, erwiderte der Mann knapp. Er trat in die Stube und sah sich um. »Ihr denkt wohl, ich komme zur Unzeit«, fügte er hinzu, »aber jetzt ist die Zeit – glaubt mir, Brüder.«
Anna Elisabeths Vater meldete sich. »Wer seid Ihr denn?«, wollte er wissen. »Und wie kommt Ihr dazu, uns Eure Brüder zu nennen? Ich habe Euch noch nie gesehen.«
»Das ist Joos Fritz«, beeilte sich Hannes zu erklären. »Ich selbst habe ihn zu mir gebeten, damit er uns erzählt, in welcher Sache er unterwegs ist!«
»Joos Fritz?« Dem Vater war dieser Name unbekannt, genau wie auch den beiden anderen Nachbarn. »Woher kommt Ihr?«, fragte er den Fremden und musterte ihn scharf. »Was wollt Ihr hier?«
»Habt Ihr nicht schon einmal vom Bundschuh gehört?«, antwortete Hannes anstelle des Fremden, der immer noch bewegungslos in der Mitte des Raumes stand.
»Was soll das?«, brummte Anna Elisabeths Vater. »Bundschuhe tragen wir Bauern. Jedes Kind weiß, was damit gemeint ist.« Er runzelte die Stirn. »Halte mich nicht zum Narren, Hannes – sonst ändere ich meine Meinung, was dich als meinen zukünftigen Eidam betrifft.«
Der fremde Mann zog sich mit einer langsamen, müde wirkenden Bewegung die Kapuze seines Mantels vom Kopf, so dass sein Gesicht deutlich zu erkennen war. »Verzeiht, Hausvater«, sagte er, »dass ich so lange brauche, den Grund meines Kommens zu offenbaren. Aber ich habe einen weiten Weg hinter mir, und jetzt versagt der Körper mir beinahe den Dienst. Darf ich den Mantel ablegen und mich an deinem Herd wärmen? Danach stehe ich Euch Rede und Antwort.«
Der Vater nickte. Joos Fritz ließ den Mantel von den knochigen Schultern gleiten, faltete ihn sorgfältig und legte ihn auf den Holzstapel neben dem Herd. Dann hielt er die rot gefrorenen Hände über die Glut und bewegte langsam seine Finger. »Wie gut das ist«, murmelte er, »einmal wieder die Wärme eines Hauses zu spüren ...«
Anna Elisabeth betrachtete ihn. Sein Alter war nur schwer zu schätzen; nach der Anzahl der Falten auf seinem verwitterten Gesicht konnte er die fünfzig bereits überschritten haben. Aber seine Augen hatten einen lebendigen Glanz, sein Blick ein Leuchten, das tief aus seinem Innern zu kommen schien, und das gab ihm etwas Junges, Unverbrauchtes. Auch seine Bewegungen, so müde sie sein mochten, ließen nicht auf einen alten Mann schließen. Denn sie verrieten eine Spannkraft und Energie, wie man sie eigentlich nur bei den ganz Jungen antrifft.
Seine Kleidung war zerschlissen, ja beinahe zerlumpt. Nur der Mantel, den er so pfleglich behandelt hatte, musste verhältnismäßig neu sein. Das dicke Friesgewebe, aus dem er gemacht war, wies noch den Glanz des beinahe Unbenutzten auf. Dafür hatten die Stiefel an seinen Füßen viele abgewetzte Stellen und sicher auch durchgelaufene Sohlen.
»Nun?«, fragte Anna Elisabeths Vater ungeduldig. »Seid Ihr bereit, uns Euer Woher und Wohin zu schildern?«
Joos Fritz richtete sich auf und wirkte plötzlich, wie er da in der Stube stand, überlebensgroß. Seine Augen sprühten von einer Leidenschaft, die etwas Unwirkliches hatte. Er richtete den Blick auf die Männer am Tisch und sagte: »Liebe Brüder – ich komme, um Euch zu den Waffen zu rufen. Denn es ist an der Zeit, den Feind aufs Haupt zu schlagen!«
Hannes schien zu wissen, wovon der Fremde sprach. Er lehnte sich an die Wand zurück und lächelte. Quirin und Simon sahen sich fragend an. »Welche Waffen«, fragte Anna Elisabeths Vater verständnislos, »und welcher Feind? Ihr redet irre, Joos Fritz!«
»Das tut er nicht«, sagte Hannes. Aus ihm sprach mit einem Mal die gleiche Begeisterung, die auch der Fremde ausstrahlte. »Joos Fritz hat vor Jahren an der Spitze des Bundschuhs gestanden, und auch, wenn die Bewegung damals niedergeschlagen wurde – diesmal wird es anders auslaufen. Im ganzen Neckartal haben sich schon –«
»Ach, jetzt verstehe ich!« Der Vater schlug sich an die Stirn. »Als ich noch jünger war, haben Landfahrer davon berichtet ...«, er legte den Kopf nachdenklich auf die Seite. »Sagt – nannte sich die Rebellion nicht Armer Konrad?«
Joos Fritz nickte. »Recht«, erwiderte er ernst, »und man hat dem Armen Konrad übel mitgespielt. Die Brüder hatten den Bundschuh zur Fahne erwählt, dazumal ..., und der Bundschuh wurde verraten.« Er hob die Hand und ballte die Faust zu einer herrischen Geste. »Doch das wird diesmal nicht geschehen«, fuhr er leidenschaftlich fort. »Herr Martinus streitet an unserer Seite. Die Freiheit eines Christenmenschen ist gottgegeben und darf nicht angetastet werden, sagt er!«
»Was soll das für eine Freiheit sein?«, wollte der Vater wissen. Er hatte sich vorgebeugt und betrachtete den Fremden mit vorsichtiger Skepsis. »In unserem Ort kennt man die Schriften dieses Herrn Martinus nicht – weil wir alle nicht lesen können.«
Joos Fritz heftete den flammenden Blick auf den alten Mann. »Um Euch allen die Wahrheit zu bringen«, sagte er eindringlich, »dazu bin ich hier. Ihr müsst unsere Ziele kennen. Die evangelische Bruderschaft darf nicht blind in die Irre tappen ... diesmal nicht!«
»Setzt Euch zu uns, Joos«, forderte Hannes den Fremden auf. »Wenn Ihr gestattet, Vater ...«, er sah den Hausherrn bittend an, »dann wollen wir hören, was er uns zu berichten hat.«
»Gut.« Anna Elisabeths Vater stimmte zögernd zu. »Ihr könnt einen Becher Bier mit uns trinken. Zum Essen kann ich Euch leider nicht mehr einladen – dazu kommt Ihr zu spät.«
»Wie wäre es mit Brot und Speck?«, mischte sich Anna Elisabeth ein. Sie hatte bereits eine dicke Scheibe vom Laib heruntergeschnitten.
Der Fremde lächelte dankbar, und der Hausvater nickte erleichtert. »Ja, natürlich«, sagte er, »Ihr werdet hungrig sein ...«
»Sind wir nicht alle hungrig?«, gab Joos Fritz zurück. »Verlangt uns nicht alle nach Gerechtigkeit?«
Er nahm den Teller mit Brot und Speck entgegen. Die Männer auf der Bank machten ihm bereitwillig Platz, so dass er sich setzen konnte. Schweigend verzehrte er die karge Mahlzeit. Doch sobald der letzte Krümel in seinem Mund verschwunden war, begann er zu reden. »Schon bei der Heuernte hat es begonnen«, erzählte er, »als die Stühlinger Bauern von ihrer Herrschaft aufgefordert wurden, Schneckenhäuslein zu suchen ...«
»Schneckenhäuser...? Wozu das?«, wollte der Vater ungläubig wissen.
»Die Gräfin stickte gerade an einem seidenen Zaumzeug für ihren Gemahl«, erklärte Joos Fritz. »Sie brauchte die Schneckenhäuslein, um Garn darauf zu winden.«
Anna Elisabeth verstand nichts. »Mitten in der Heuernte hat sie dafür die Bauern ausgeschickt?«, fragte sie nach. »Hätte sie denn nicht warten können, bis die wichtige Arbeit getan ist?«
»Sie wollte nicht warten«, sagte Joos Fritz. »Aber die Stühlinger Bauern weigerten sich.«
»Und was dann?« Anna Elisabeths Vater machte große Augen. »Sie wurden doch sicherlich zum Gehorsam gebracht?«
Joos Fritz reckte sich. »Der Graf hat es weidlich versucht, aber sie gehorchten nicht«, erwiderte er und hob die Stimme. »Sie ließen ihren Herrn wissen, dass sie solche Narreteien fortan nicht mehr dulden wollen!«
»Und der Ungehorsam ging weiter«, warf Hannes mit leuchtenden Augen ein. »Erzählt uns, was dann geschah, Joos !«
»Nun«, sagte Joos Fritz und zeigte ein triumphierendes Lächeln, »die Kunde verbreitete sich. Andere Bauern fingen auch an, gegen Ungerechtigkeiten aufzubegehren. Mittlerweile sind viele Dörfer im Aufruhr ... die Herren verhandeln bereits mit der Bauernschaft um Änderung der Gesetze. Aber das allein ist nicht genug. Auch Odenwald und Neckartal muss sich zur Bewegung bekennen – damit die zwölf Artikel überall angenommen werden!«
»Was meint Ihr damit?«, fragten Simon und Quirin wie aus einem Mund. »Artikel ... was ist das?«
»Es sind zwölf Forderungen, die wir an die Herren stellen«, erklärte Joos Fritz mit wachsender Leidenschaft. »Erstens – wir wollen unsere Pfarrer selbst wählen ... Zweitens, wir wollen den Kleinen Zehnt nicht mehr zahlen, desgleichen auch den Todfall nicht mehr. Denn das sind Gesetze, die nicht von Gott, sondern von Menschen gemacht sind. Drittens ...«
Der Vater, der die ganze Zeit sprachlos zugehört hatte, unterbrach den Fremden jetzt mit einer heftigen Handbewegung.
»Hat Gott nicht selbst die Herren über uns gesetzt, damit sie uns lenken und leiten?«, stellte er seine Frage in den Raum.
Joos Fritz atmete tief ein. »Die reine Lehre lautet anders«, widersprach er ungerührt. »Vor Gott sind alle gleich. Ein Christenmensch aber ist nur dem Allmächtigen und seinem Gewissen verpflichtet.«
»Dann soll man dem Kaiser nicht geben, was des Kaisers ist?«
»Doch«, sagte Joos Fritz. »Aber wenn die Herren ihre Untertanen bedrücken und beschweren, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh werden, dann ist es recht und billig, wenn sie aufbegehren. Dann ist es an der Zeit, das Joch abzuschütteln und –«
»Was Ihr da sagt, ist vermessen«, fuhr ihm Anna Elisabeths Vater ein zweites Mal in die Rede. »Wie könnt Ihr gegen Gottes Obrigkeit streiten wollen? Dieses Dorf zum Beispiel untersteht einem Kloster – wie könnt Ihr es wagen, die Diener Gottes, denen wir verpflichtet sind, so übel anzugehen?«
»Aber die so genannten Hirten hüten ihre Herde ja nicht«, mischte sich Hannes zornig ein. »Vater – habt Ihr etwa den armen Matthias vergessen, dem der feiste, voll gefressene Abt von Kaltental neulich das letzte bisschen Habe abgenommen hat? Habt Ihr vergessen, dass wir alle immer wieder von ihm ausgeplündert werden und so gut wie jeden Winter hungern müssen?«
»An dem, was Joos Fritz sagt, ist viel Wahres dran«, knurrte der Quirin. »Dieser Doktor Luther hat Recht – es kann Gott nicht gefallen, dass so viele seiner Kinder derart gepresst und ausgebeutet werden!«
»Und überhaupt«, meldete sich jetzt auch Simon zu Wort, »wenn wir vor Gott alle gleich sind – vor dem Gesetz sind wir’s nicht. Wir werden doch nicht höher geachtet als das liebe Vieh! Ist das Gottes Gerechtigkeit – oder die der Menschen?«
»Wir müssen das Menschengesetz ändern«, sagte Joos Fritz. »Wir müssen die Herren zwingen, unsere gerechte Sache anzuerkennen – denn freiwillig sind sie nicht bereit dazu!«
»Warum sollten sie auch?«, warf Hannes ein. »Denen geht es doch gut – sie leben von unserem sauren Schweiß, und das in Saus und Braus!«
»Wenn ich daran denke, dass der fette Abt und seine liederlichen Pfaffenbrüder dem Matthias das Schwein weggefressen haben«, knurrte Simon, »dann kommt mich das Kotzen an!«
Quirin grinste. »Ich hätte nicht übel Lust, den Klostervogt auch mal –«
»Du versündigst dich«, fuhr ihm Anna Elisabeths Vater dazwischen, bevor er sagen konnte, was er dem Klostervogt gerne angetan hätte. »Hüte deine Zunge!«
»Es geht ein großes Aufbegehren durch die Bauernschaft von Odenwald und Neckartal«, sagte Joos Fritz, ohne sich durch den erregten Einwurf des alten Mannes beeindrucken zu lassen. »Schon haben sich Truppen zusammengeschlossen – der Jakob Rohrbach, Wirt zu Böckingen bei Heilbronn, ist zum Hauptmann ausgerufen, genau wie der Georg Metzler, Wirt zu Ballenberg bei Krautheim. Täglich kommen mehr Männer dazu – mutige, aufrechte Männer, die es wagen wollen, den Herren die Stirn zu bieten.« Er fixierte die drei jungen Bauern mit wildem Blick. »Seid auch ihr dabei, Brüder? Wollt auch ihr für die gerechte Sache Leib und Leben wagen?«
»Aber wie soll das gehen?«, fragte der Simon in einer plötzlichen Anwandlung von Bedenken. »Wer wird uns denn anhören? Den Herren ist es doch einerlei, wenn ein Bauer sich beschwert – keiner von denen wird die zwölf Artikel auch nur lesen, geschweige denn sich danach richten!«
»Sie werden schon zuhören, wenn ein bewaffnetes Bauernheer ihre Burgen und Schlösser und Klöster belagert«, sagte Joos Fritz trocken. »Aber wir müssen unserer viele sein – das allein wird sie zum Nachdenken bringen.«
»Ihrer sind auch viele«, murmelte der Vater. »Und sie sind es gewohnt, zu streiten ...«
»Trotzdem«, konterte Joos Fritz, »wenn wir Bauern uns in allem einig sind, dann sind wir ihnen überlegen.« Er warf den drei jungen Männern am Tisch einen glühenden, schwärmerischen Blick zu. »Vergesst nicht, Brüder – Gott selbst ist auf unserer Seite, das ist gewiss. Er will nicht, dass seine unterdrückten Kinder noch länger leiden – denn er liebt sie!«
Der alte Mann schüttelte resignierend den Kopf. Hannes, Quirin und Simon dagegen hatten Feuer gefangen. »Wir können gar nicht verlieren«, bestätigte Hannes mit Überzeugung. »Wir sind viel stärker, als wir denken ...«
»Ich meine sogar, zwei von uns wiegen leicht zehn Pfaffen auf«, sagte Simon, »oder zwanzig zimperliche Herrensöhnchen!«
Quirin lachte. Anna Elisabeth, die auf dem Herdrand saß und still zugehört hatte, überkam ein ungemütliches Gefühl. Der Fremde, der sich Joos Fritz nannte, hatte zwar auch ihr irgendwie aus der Seele gesprochen. Aber die Art, wie er seine Ziele zu verwirklichen suchte, bereitete ihr Unbehagen. Zu den Waffen wollte er die Bauern rufen. Hieß das, einen Krieg zu führen – oder sollten die Herren nur eingeschüchtert werden? Und wenn das Letztere beabsichtigt war – wer sollte mit den Herren verhandeln?
Joos Fritz lieferte ihr unverzüglich die Antwort. »Der Kanzler Wendelin Hipler aus Hohenlohe hat unsere Forderungen in Worte gefasst«, sagte er. »Er wird die Bauernschaft auch vor Gericht vertreten, wenn es so weit ist. Wendelin Hipler ist auf dem Gebiet beider Rechte bewandert. Er wird für uns verhandeln, Brüder.«
»Und wenn er keinen Erfolg hat, bringen wir die Herren von Adel und Geistlichkeit zum Schlottern«, fügte Quirin hinzu. Er stieß seinen Nachbarn derb in die Rippen. »Was Simon? Wir werden sie das Fürchten lehren. Bist du auch dabei, Hannes?«
Johannes Rebmann schoss ihm einen ärgerlichen Blick zu. »Da fragst du noch? Warten wir ab. Bald wissen wir mehr ...«
»Boten sind überall unterwegs«, bestätigte Joos Fritz, indem er seinen Becher leerte und sich erhob. »Ich selbst trage das Feuer weiter, Brüder – behaltet frohen Mut und vergesst nicht: unsere Sache ist gerecht. Diesmal werden wir siegen!«
»Wollt Ihr etwa in der Nacht noch weiter?«, fragte Anna Elisabeths Vater. »Es wird ja schon dunkel, Mann – noch eine halbe Stunde, und Ihr seht die Hand vor Augen nicht mehr!«
»Einer, der alles sieht, leitet mich«, entgegnete Joos Fritz mit einem sonderbaren Lächeln. »Für ihn und sein Gesetz kämpfe ich ... er wird mich nicht im Stich lassen. Gehabt euch wohl!«
Damit ging er zum Holzstapel, nahm seinen Mantel auf und hängte ihn sich um die Schultern. Ohne ein weiteres Wort war er aus der Tür. Die sinkende Dämmerung verschluckte ihn, als sei er nie da gewesen. Doch die Aufbruchsstimmung, die er erzeugt hatte, blieb wie etwas Greifbares in der Stube zurück.
»Alle Menschen sind gleich«, murmelte Hannes Rebmann nach einem Augenblick des Schweigens. »So hat Gott es gewollt – und so werden wir es durchsetzen.«
»Wenn’s sein muss, mit Gewalt«, sagte Quirin. Simon ballte die Fäuste. »Sie sollen uns kennen lernen«, fügte er grimmig hinzu.
Die Männer schienen so zornig und so entschlossen, sich an dem Aufstand zu beteiligen. Anna Elisabeth, die angefangen hatte, die große Schüssel abzuwaschen, verstand mit einem Mal, was Hannes ihr am Nachmittag hatte sagen wollen. Er hatte den Besuch des Joos Fritz erwartet und dessen Botschaft bereits gekannt.
Den Herren vom Adel sollte die Macht genommen werden, willkürlich über ihre Untertanen zu verfügen ... Albrecht Wolf von Weißenstein war ein Herr. Wenn die Wut der Bauern sich über ihm entlud – dann war auch er seines Lebens nicht mehr sicher. Bei diesem Gedanken begann Anna Elisabeths Herz angstvoll zu hämmern, und sie musste sich abwenden, damit Hannes die neuen Tränen nicht bemerkte, die ihr über die Wangen liefen.
Der Burghof hatte sich mit gesattelten Pferden, kläffenden Hundemeuten, Treibern und aufgeregt hin und her laufenden Knechten bevölkert. Albrecht, der zusammen mit seinen Gästen ein reichliches Frühstück aus frisch gebackenem Brot, Speck, Käse und Bier eingenommen hatte, trat nun auch ins Freie. Hinzheim war bereits aufgesessen; sein Ross, ein mächtiger Grauer, prunkte in rotem Riemenzeug, das unter dem trüben Himmel besonders intensiv leuchtete. Der Götz, ein kurz gewachsener, breitschultriger und etwas beleibter kleiner Herr mit einem viereckig gestutzten Bart, hievte sich gerade in den Sattel seines hochbeinigen Fuchshengstes. Die beiden Junker aus der Nachbarschaft, Hermann und Ortwin Starkenberg, prüften vor dem Aufsitzen noch einmal die Schnallen an den Bauchgurten ihrer Pferde, und der Gast, der mit dem Berlichingen gekommen war, ein drahtiger, aber deutlich jüngerer Herr, stand neben seinem Rappen und schaute gedankenverloren ins Tal hinab.
Albrecht kannte den Mann nicht. Dem Götz dagegen schien er recht vertraut zu sein, obwohl offenbar keine Freundschaft zwischen den beiden bestand. Denn sie hatten schon am Abend zuvor, nach dem Eintreffen auf Weißenstein, kaum ein Wort miteinander gewechselt, obwohl sie doch miteinander angekommen waren. Selbst als der Berlichingen bei Tisch seine eiserne Hand vorgeführt hatte, dieses mechanische Wunderwerk, das ihm von einem kunstfertigen Schmied als Ersatz für seine verlorene Schwerthand angefertigt worden war, hatte er kaum einen Blick dafür übrig gehabt, geschweige denn eine Bemerkung.
Auch jetzt kehrte der Mann, der Albrecht als Florian Geyer vorgestellt worden war, dem Götz den Rücken zu. Vielleicht hatten sich die Herren auf dem Weg nach Weißenstein gestritten – worüber, das mochte der Himmel wissen. Albrecht ging langsam auf sein Reittier zu, das von einem Knecht in den Hof geführt worden war, und streichelte dem Falben einmal zärtlich über die Nüstern. Wenn nach der Jagd erst der frische Braten am Spieß röstete, würden sie sich sicherlich bei einem Humpen Roten wieder vertragen. Die Gaukler würden schon für gute Stimmung sorgen.
Der Falbe schnaubte sacht. Sein Atem stand wie eine weiße Wolke in der stillen Luft. Die Hunde jieperten und zerrten an den Leinen; die Hundeführer konnten sie kaum noch halten. Christoph, der die sechs großen Saupacker führte, lächelte Albrecht zu. »Sie wollen ins Feld, Herr«, rief er fröhlich herüber, »können’s gar nicht erwarten!«
Der Tyras war auch wieder gesund und dabei. Albrecht betrachtete seinen Lieblingshund für einen Augenblick, dann stieg er in den Sattel. Auf sein Handzeichen hob der Knecht an der Spitze der Gesellschaft das Hifthorn. Sein Signal brachte den Zug in Bewegung. Die Treiber mit ihren langen Stöcken waren schon vor einer ganzen Weile losgezogen. Nun folgte, gemächlich Schritt reitend, die kleine Gruppe adliger Herren. Mit ihnen liefen die Meuteführer, ihre Bracken an langen Leinen mühsam zurückhaltend. Nur Christoph hatte es leichter; seine Saupacker folgten auch ohne Leine. Lässig trabten die kraftvollen Tiere ihm zur Seite und ließen sich vom Jagdfieber der viel kleineren Stöberhunde nicht aus der Ruhe bringen.
Albrecht lenkte seinen Falben neben Florian Geyers Ross. »Ihr schaut so nachdenklich drein, Herr Vetter«, sprach er ihn an, »ist etwas nicht nach Eurem Wunsch?«
»O – gar vieles, mein Lieber«, antwortete Florian Geyer langsam, »aber nicht durch Euer Zutun ...«
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte Albrecht nach.
Florian Geyer hob den Kopf und sah Albrecht an. Einen Augenblick betrachtete er forschend sein Gesicht. Dann erwiderte er: »Die Welt steht Kopf, und es ist an der Zeit, dass sie zurechtgerückt wird.«
»Ihr redet in Rätseln«, sagte Albrecht. »Wie darf ich Euch verstehen?«
Florian Geyer antwortete nicht gleich. »Ich bin mir sicher«, meinte er schließlich, »auch Ihr werdet über kurz oder lang erfahren, dass wir am Scheideweg stehen. Nun gilt’s, das Rechte zu tun ... ob Ritter oder Bauer ...«
Albrecht hatte noch immer keine Vorstellung, wovon der Mann sprach. »Was sollte getan werden?«, forschte er weiter. »Wie passen Ritter und Bauer zusammen?«
Florian Geyer lachte leise. »Gar nicht«, sagte er, »aber sie werden Seite an Seite kämpfen müssen, wenn’s drauf und dran geht.«
»Zu welchem Zweck?«, fragte Albrecht. War dieser Geyer ein Wirrkopf, dass er so unverständliches Zeug von sich gab? »Ritter und Bauer können doch keine gemeinsame Sache verfolgen!«
Florian Geyer drehte den Kopf weg und schaute zum Himmel hinauf. »Mein Lieber«, sagte er mit einem Lächeln in der Stimme, »es geht um die Freiheit vom Joch der Mächtigen. Sowohl für den Bauern als auch für den Ritter.«
»Wie das?« Albrecht begann zu verstehen. »Für die Ritterschaft hat es der Sickingen damals versucht, doch ein Erfolg war ihm nicht beschieden, und ich meine –«
»Der Sickingen war allein«, unterbrach ihn Florian Geyer mit plötzlicher Leidenschaft. »Heute sieht alles anders aus. Der Übermacht der Bauern müssen sich die großen Hansen beugen!«
»Aber ein Bauer ist doch nicht mit einem Söldner oder Reisigen zu vergleichen«, hielt Albrecht kopfschüttelnd dagegen. »Die meisten von ihnen sind grobe Tölpel ohne Kampferfahrung.«
Florian Geyer erwiderte seinen Blick mit Nüchternheit. »Der Zorn ist eine scharfe Waffe«, gab er zurück, »und die Gewissheit, im Recht zu sein, eine noch viel schärfere. Der Bauer aber ist im Recht.«
Eines begriff Albrecht immer noch nicht. »Und warum sollte der Ritter gemeinsame Sache mit ihm machen? Wir, die wir von Stand sind, leben doch unter ganz anderen Bedingungen.«
»Wirklich?« Florian Geyer kniff ein Auge zusammen, während er Albrecht aufmerksam ansah. »Wenn Ihr das glaubt, Lieber, dann seid Ihr blind.«
»Aber ...«, begann Albrecht.
»Seid Ihr denn nicht auf Gedeih und Verderb den Fürsten ausgeliefert?«, fragte der Geyer, und in seiner Stimme lag ein Anflug von Hohn. »Habt Ihr nicht zu folgen, wenn Euch Euer Lehnsherr zu den Waffen ruft – ungeachtet der Tatsache, dass Ihr Euch einen Feldzug nicht leisten könnt? Und ist es nicht so, dass Ihr jeden Fürsten, der sich bei Euch ansagt, beherbergen und verköstigen müsst, auch wenn Eure Kammern und Keller leer sind? Veranstaltet Ihr diese Jagd nicht nur, weil es Euer Stand so verlangt – und wäre es Euch nicht nützlicher, die Wintersaaten Eurer Bauern zu schonen, anstatt sie mit Hunden und Pferden zu verwüsten?«
Albrecht ließ seinen Blick über das freie Feld wandern, an dessen Rain sie entlangritten, und konnte nicht anders als zustimmen. Er nickte, doch bevor er etwas erwidern konnte, fuhr Florian Geyer fort. »Seit Menschengedenken geht das so«, sagte er, »dass die Fürsten uns befehlen, wie wir unser Leben zu führen haben. Ländereien, Wälder, Dörfer – alles, was uns einst gehörte und uns Nahrung bot, musste hingegeben werden für Waffen, prächtige Kleidung, hoffähige Lebensart. Wir hatten teure Feldzüge zu bezahlen – Kriege, die uns nichts angingen, verschlangen unser Hab und Gut. Nun ist den meisten der freien Ritter nichts geblieben als ihr Haus und ihr guter Name. Und davon kann niemand leben ... Ihr etwa?«
»Ich hätte mir den Unterhalt auf Turnieren verdienen können«, murmelte Albrecht. »Ein Hofamt anzunehmen – auch dieser Weg würde mir offen stehen, wenn ich mich nur genug darum bemühte.«
»Und warum tut Ihr’s nicht?«, fragte Florian Geyer. Albrecht schwieg.
»Ich will’s Euch sagen«, antwortete Geyer für ihn. »Ihr sehnt Euch nach Freiheit – nicht anders als der Bauer. Ihr wollt Euch nicht in ein Leben zwingen lassen, das Euch zuwidergeht. Und darum ...«
Die Hifthörner gellten. Der Zug der Reiter verhielt, und die Hundeführer ließen die Bracken von den Leinen. Mit wildem Gekläff stürzten sich die Hunde in das Dickicht am Waldrand. Augenblicke später brach, aufgestört von den Treibern, eine Rotte Wildschweine aus dem Gebüsch. Die Tiere suchten zuerst ihr Heil in der Flucht. In wildem Galopp stürmten sie über das Feld; Albrecht zählte siebzehn von ihnen, darunter mehrere große Bachen und einen riesigen Keiler mit einem wahrhaft beeindruckenden Gebrech.
Die leichten Jagdhunde verfolgten das flüchtende Schwarzwild, umkreisten die Rotte, griffen mutwillig an. Jetzt endlich stellten sich die Wildschweine zum Kampf. Christoph schickte seine starken Rüden auf den Keiler, der sich schäumend zur Wehr setzte.
Albrecht saß ab, warf die Zügel seines Pferdes dem Knecht zu, der seine Jagdwaffen getragen hatte, und nahm seine Saufeder von ihm entgegen. Florian Geyer, der ebenfalls abgesessen war, lächelte dünn. »Wenn Ihr Eure schönen Hunde nicht verlieren wollt, müsst Ihr Euch beeilen«, sagte er. »Mir scheint, der Alte da vorn, der hat schon so manchen Strauß gewonnen.«
Albrecht packte den Spieß, dessen Schaft dicht mit Lederriemen umwickelt war. »Wir werden sehen«, gab er zurück, »wer diesmal gewinnt.« Der Keiler trug wirklich die Narben vieler Kämpfe auf seiner borstigen Schwarte. Doch all diese Spuren waren ihm mit Sicherheit von Kämpfern seiner eigenen Art zugefügt worden. Heute musste er sich einem stellen, gegen den seine Chancen auf den Sieg weitaus schlechter standen.
Die großen Hunde hatten ihn eingekreist und hinderten ihn daran, seitwärts auszubrechen. Albrecht näherte sich vorsichtig, die Saufeder stoßbereit. Er wusste: wenn er den Keiler nicht gleich beim ersten Treffen tödlich verwundete, würde der Alte, wie Geyer das Tier genannt hatte, beim Gegenangriff seine ganze geballte Kraft darauf verwenden, sein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen.
Aber das tat er ohnehin. Schon flog, von einem mächtigen Schädelschwung des Keilers beiseite geschleudert, einer der großen Rüden aufheulend durch die Luft. Ein zweiter humpelte auf drei Beinen vom Schlachtfeld und brachte sich in Sicherheit. Nur Tyras und weitere drei Saupacker bedrängten den alten Kämpfer jetzt noch, suchten ihn auf dem Platz zu halten und seine Aufmerksamkeit an sich zu fesseln.
Albrecht hob die Saufeder und zielte. Zwei, drei Schritte näher – dann warf er den Spieß. Die lange Klinge fuhr durch das dicke Fell, glitt tief in die linke Schulter des Keilers. Der Schaft der Jagdwaffe zitterte, während der Keiler den Kopf hochwarf und einen wilden Schrei ausstieß. Der Schaum an seinem Maul begann sich blutig zu färben ... seine Lunge war getroffen, vielleicht aber auch sein Herz. Denn das Tier knickte in den Hinterbeinem ein, brach zusammen, legte sich langsam auf die Seite ...
»Brav getroffen«, rief der Hinzheimer herüber. Er hatte eines der jüngeren Tiere erlegt und war dabei, seinen blutigen Spieß in der jungen Wintersaat abzuwischen. Der Götz hatte sich ebenfalls einen Frischling ausgesucht und abgestochen. Während er jetzt den sterbenden Keiler beobachtete, zeigte sich ein wenig Neid in seinem Blick. »Mutig, mutig, Herr Vetter«, spöttelte er. »Aber ob uns der Braten schmecken wird?«
Die übrigen Jagdgenossen lachten. Albrecht würdigte sie keiner Antwort. Er hielt den Blick auf den alten Kämpen gerichtet, der vor seinen Augen sein Leben verröchelte, und schämte sich plötzlich dafür, dass er nicht noch genauer getroffen hatte. Mit einem schnellen Schritt war er an der Seite des Keilers, zog den Dolch und beendete durch einen sicheren Stich in den Nacken das Leiden des Tieres.
Um die Mittagszeit, als die Jagd abgeblasen wurde, bestand die Strecke aus vier Stück Schwarzwild, sechs Feldhasen und fünf Rehen, die bis zum Schuss mit der Armbrust gehetzt worden waren – eine reiche Beute, geeignet für ein üppiges Festessen.
In bester Laune zog die Jagdgesellschaft heimwärts auf die Burg. Doch Albrecht warf beim Wegreiten einen langen Blick auf die verwüstete Wintersaat der Felder, über die Jäger und Hundemeute gestürmt waren. Wie würden sich die Bauern, deren harte Arbeit umsonst gewesen war, wohl bei diesem Anblick fühlen? Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass Florian Geyer sich an der Hetze nicht beteiligt und auch keine Beute gemacht hatte. Ein sonderbarer Kauz. Was mochte ihn dazu bewogen haben, die Einladung zur Jagd anzunehmen, wenn ihm nichts an dieser Herrenkurzweil lag? Warum suchte er die Gesellschaft von Standesgenossen, wenn er sich insgeheim mit den Bauern gleichsetzte?
Albrecht sprach ihn darauf an, als sie gegen Abend zu Tisch saßen.
»Ihr habt mich nicht recht verstanden, Lieber«, erwiderte der Geyer gelassen, »ich setze mich nicht mit ihnen gleich – denn ich bin’s ja nicht. Aber Kampfgefährten werden wir sein müssen, die Bauern und ich. Daran führt kein Weg vorbei, wenn wir siegen wollen.«
Der Braten wurde aufgetragen. Angesichts der mit Appetit erwarteten Speise ruhte das Gespräch erst einmal, und die Jagdgäste waren für kurze Zeit vollauf mit Essen beschäftigt. Doch Albrechts Gedanken wanderten. Schon längst war er nicht mehr bei dem, was Florian Geyer gesagt hatte. Er musste etwas tun gegen den Schmerz, der seit der Michaeli-Kirmes sein Herz bedrückte. Anna Elisabeth war tödlich beleidigt worden – nicht nur vom Junker Hinzheim. Wenigstens eine Entschuldigung musste ihr zuteil werden, und sie sollte sie bekommen, gleich an Martini, wenn das Bauernjahr zu Ende ging und die Winterruhe begann.
Für den Rest des Abends, während die Gaukler ihre Kunststückchen zum Besten gaben und alle ihren Spaß hatten, feilte Albrecht an seinem Plan. Später, als es auf Weißenstein still geworden war und seine Gäste bier- und weinselig auf den für sie ausgelegten Polstern schnarchten, wusste er endlich, wie er es anstellen wollte.