Die Geisel
ODER:
»Wo zai wai guo ju zhu de shi jian bi zai de guo chang« – »Ich war in der Fremde länger zu Hause als in Deutschland«
Auch der Weg zur Deutschen Schule führt am fast vollständig ausgetrockneten, von Baggern und Picken aufgewühlten Flussbett des Liangma He vorbei. Einige Arbeiter hocken um ein Feuer neben der Eisrinne, die sich in Kurven wie eine Bobbahn schlängelt. Vier Jungen ziehen einen Schlittenkasten, der mit Betonplatten beladen ist. Am Ufer steht ein handgemaltes Schild. Auf ihm wird unter einer Telefonnummer für 50 Yuan auf Chinesisch, Englisch, Russisch und Deutsch »Hilfe bei der Suche nach dem Namen, der das künftige Glück des neugeborenen Kindes garantiert« angeboten.
Ich kann mir die Nummer nicht aufschreiben. Die Tinte ist bei minus 15 Grad eingefroren.
Am Morgen hatten Klaus und ich Bücher für die Lesung in der Deutschen Schule aus dem Regal gesucht. Und ich bewunderte die fast vollständige Sammlung der Werke seiner Lieblingsautorin Christa Wolf.
»Sie drückt aus, was ich empfinde, aber selber nicht in Worte fassen kann. Zum Beispiel führte sie mich mit ›Kassandra‹ zu einer manchmal gefährlich werden könnenden selbstkritischen Ehrlichkeit …
Irgendwann fand ich ein Tagebuch, das meine Mutter als Junglehrerin noch in der Nazizeit geschrieben hat. Und darin steht, dass sie stolz ist, die deutsche Jugend im Geiste des Deutschtums erziehen zu können. Sie war jung, und wer jung ist, unterliegt der Gläubigkeit sehr schnell. Wie Millionen halbwüchsiger Chinesen, die, von Mao aufgerufen, in der Kulturrevolution die Überbleibsel des ›bürgerlichen parasitären Lebens‹ vernichten wollten. Und die, das hatten nicht einmal Hitler und Stalin geschafft, in Kampagnen zur ›Umerziehung der Eltern‹ Vater und Mutter in Lager sperren ließen.«
Ich weiß nicht, wer von uns die Frage unserer Gläubigkeit zuerst gestellt hatte. Einig waren wir uns nur, dass weder er noch ich in der DDR der Karriere wegen in die Partei eingetreten waren, sondern weil wir an die sozialistische Idee glaubten. Gläubig waren …
»Ich hatte mich freiwillig für drei Jahre zur Armee gemeldet«, sagt Klaus. »Das war eine logische Fortsetzung: Du warst in der Schule gut, und du weißt, wie dein Leben weitergehen wird. Da gehörte das einfach dazu. Ich war immer einer von denen, die davon geträumt haben, dass sie in dieser Welt etwas bewegen werden. Also wie Einstein und andere berühmte Leute. Oder ein bisschen kleiner … Ich bin schon bei der Armee in die Partei gegangen. Das war für mich ein normaler Schritt und nicht, wie man das heute oft von Wessis hört, ein unvermeidlicher Tribut an die eigene Karriere. Ich hätte, auch ohne in der Partei zu sein, im Außenministerium oder irgendwo anders arbeiten können. Aber das wäre für mich dann weder Fisch noch Fleisch gewesen. Wenn man dazugehört, dann gehört man eben auch richtig dazu. Und wir haben als Genossen ja nicht nur Blödsinn gemacht. Wie gesagt, man hat geglaubt. Es gab da eine Episode, die würdest du heute nicht mehr verstehen. 1980 haben wir Studenten in Berlin Kabelgräben für Straßenbahnen geschachtet. Ich war der Brigadier. Am Tag mussten wir soundso viel Meter schaffen. Es war ein heißer Sommer und eine ganz schöne Knochenarbeit, so ohne Schatten in der Sonne zu schindern. Wir machten das freiwillig, bekamen es nicht einmal bezahlt. Aber weil es für alles einen Plan gab, musste es auch ordentlich abgerechnet werden. Und eines Tages kam da einer vom verantwortlichen VEB Tiefbau und sagte: ›Na ja, wir machen das Pi mal Daumen!‹ Und wollte uns 15 Meter mehr anschreiben, als wir wirklich gegraben hatten. Da haben wir uns aufgeregt. ›Wir erzählen überall, dass wir ehrlich sind und dass wir im Sozialismus nicht bescheißen und so, da können wir nicht 15 Meter mehr abrechnen.‹ Wenige Jahre später hätten wir gesagt: ›Mensch, wir müssen damals eine Meise gehabt haben.‹ Wir wollten uns einfach nicht mit etwas schmücken, was wir nicht geleistet hatten.«
Dann die Jahre in der Sowjetunion, das Praktikum in China und die Diplomarbeit. In ihr hatte Klaus sich mit der Entwicklung der Landwirtschaft in China beschäftigt. »Damals begann man in China die großen Volkskommunen auseinanderzunehmen und den Bauern auf kleinen Parzellen zu erlauben, alle Produkte, die sie über das Soll hinaus erwirtschafteten, zu einem von ihnen selbst bestimmten Preis zu verkaufen. Dadurch wurde das Ernährungsproblem in China innerhalb weniger Monate gelöst. Denn die Chinesen sind von Grund auf alle kleine Geschäftsleute. Auch wenn man sich nur einen geringen Gewinn erhofft, gibt es immer einen, der die Sache beginnt. Drücke ihnen etwas in die Hand, und sie machen was draus. Und das war einer der ersten wichtigen Schritte zur chinesischen Marktwirtschaft. In einem solch großen Land wie China konnte man pragmatisch mit marktwirtschaftlichen Strukturen experimentierten, während man in der kleinen DDR selbst mit kleinen privaten Handwerksbetrieben den Unmut der ›sowjetischen Freunde‹ über ›bürgerliche Abweichungen‹ riskierte. Was in der DDR sofort furchtbare politische Auswirkungen gehabt hätte, das verlief in China sehr ruhig.«
Aber dann das Jahr 1989.
»Ich weiß noch, als der DDR-Gewerkschaftsboss Harry Tisch sagte: ›Wir weinen den DDR-Bürgern, die nach Ungarn gehen, keine Träne nach!‹ Wir, die wir auf jeden Einzelnen angewiesen waren. Wir sagten so etwas und hatten damals eine Mauer gebaut, damit wir nicht ausbluteten. Zum 40. Jahrestag der DDR hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Ich musste eine chinesische Delegation betreuen. Sie war im Schloss Niederschönhausen im Norden Berlins untergebracht, und da kam einer der Mitarbeiter der Internationalen Abteilung vom ZK der SED aus der Stadt zu ihnen. Ich weiß noch, es war ziemlich warm, und er hatte trotzdem einen Mantel übergezogen: Es sollte niemand sein Parteiabzeichen sehen!
Und einige Monate zuvor das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Damals hatte ich eine Freundin beim Berliner Rundfunk. Und die knallte mir an den Kopf: ›Klaus, jetzt musst du eigentlich beim Ministerium aussteigen. Wie kannst du mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die so etwas wie in China zu verantworten haben.‹ Sie sagte es, als ob ich mit den Chinesen befreundet wäre, die dieses Massaker angerichtet hatten. Ich habe ihr geantwortet: ›Wie das? Warum soll ich deshalb hier aufhören?‹ Egal wie die Entwicklung in der Welt läuft, die Arbeit im Ministerium ist mein Beruf: beobachten, analysieren, auswerten, weitergeben.
Wir haben nach dem Oktober 1989 immer noch gearbeitet, als wäre alles wie früher. Wir waren für die Außenpolitik verantwortlich, und Krenz und andere fuhren noch nach China. Es gab Handels- und andere Beziehungen zu China. Also habe ich weiter Informationen gesammelt und Berichte geschrieben. Nach der Volkskammerwahl wurde Meckel neuer Außenminister. Mit ihm kamen neue Abteilungsleiter aus der Bürgerbewegung oder aus dem Umfeld von Meckel. Wir kleinen Leute arbeiteten weiter. Noch existierte die DDR, und wenn es einen Staat gibt, muss es auch ein Außenministerium geben. Allerdings wollten die Leute der Bürgerbewegung in der Ministeretage nichts mit uns zu tun haben. Sie hielten uns offenbar durchweg für Betonköpfe wie Axen und Co. Ich war dann plötzlich der letzte der Mohikaner in meiner Abteilung. Noch kurz vor der Auflösung des Ministeriums waren viele Kollegen wegen Stasi-Verstrickungen entlassen worden. Ich habe das Licht ausgemacht. Ich weiß noch, am 23. August 1990 habe ich den Schlüssel abgegeben. Und am Tag der Einheit, am 3. Oktober 1990 – es war zufällig, aber vielleicht auch symbolisch –, verkaufte ich meine über alles geliebte rote 250er MZ.
Mit dem politischem System verschwanden auch mein Wertesystem und meine Lebenseinstellung, und dafür habe ich noch keinen wirklichen Ersatz gefunden. Denn wenn du nicht an Gott und ein Leben danach, sondern an die Würmer glaubst, die dich fressen, wo willst du dann die neuen Werte hernehmen? Es gibt nur noch eines: die Existenz sichern.
Jugendträume, wie wir die Welt verändern, die waren mit der Wende zerstoben. Die Chinesen machen jetzt dieselben Erfahrungen, aber sie lassen nicht auf einmal, sondern nach und nach die Luft heraus.«
Er schlägt vor, dass ich in der Deutschen Schule auch aus dem »Grenz-Gänger« lese. »Denn wir Deutsche sind in China alle eine Art Grenzgänger.«
Als ich mein rotes Paperback-Buch »Mitleid ist umsonst …« aus dem Regal nehme, sagt Klaus: »Bitte sei vorsichtig damit! Und lass es nicht liegen!«
Auf den inneren Umschlagseiten sind Strichmännchen gemalt. Und daneben die Erklärungen: »Arme seitlich anheben, den Rumpf beugen …« 27 Übungen.
»Mein Mitgefangener Ero hat sie mir in der Geiselhaft in Tschetschenien beigebracht. Und weil die Geiselnehmer mir alles Papier weggenommen hatten und ich nur dieses Buch, das ich dort wohl ein Dutzend Mal gelesen habe, besaß, malte ich die Übungen in das Buch. Bis sie uns auch die verboten, habe ich sie täglich gemacht. ›Ihr seid hier nicht zur Kur‹, schrie ›Hakennase‹, der Anführer, und stieß Ero zur Strafe hinunter in das enge Kellerloch. Ero war schon 70 und litt an einer akuten Prostataerkrankung. Im Kellerloch – draußen waren es minus 30 Grad – pinkelte er sich in die Hose. Immer wieder dieses furchtbare Spiel.«
Nach 195 Tagen, an einem Freitag, dem 13.: Am 13. Februar 1998 kam Klaus Schmuck gegen ein Lösegeld von 1 000 000 Dollar und 63 000 DM frei. Sein Portemonnaie, das nach dem Schimmel des Verstecks riecht, besitzt er noch. Außerdem einen Ledergürtel, ein Hemd und das Buch. Klaus erzählt über seine Geiselhaft, als müsste ich alle Einzelheiten schon kennen. Nach vielen Gesprächen, oft waren es nur bruchstückhafte, versuche ich das Puzzle der 195 Tage zusammenzusetzen.
Wegen seiner perfekten Russisch-Kenntnisse erhielt er 1990 eine Anstellung bei einer Westberliner Arzneihandelsfirma. Bald vermittelte er Geschäfte mit Russland. Das Unternehmen gründete in Moskau zwei Joint-Venture-Firmen. In einer wurde Klaus Schmuck 1991 Geschäftsführer.
Als Gegenleistung für den Transit von russischem Erdgas durch die abtrünnige russische Republik Tschetschenien erlaubte es Russland, Medikamente und Lebensmittel nach Tschetschenien einzuführen. In Berlin bedrängten Tschetschenen den Chef der Arzeneimittelfirma persönlich in die tschetschenische Hauptstadt Grosny zu kommen, um dort Verträge über die Lieferung von Arzneimitteln abzuschließen. Wieder und wieder vertröstete der Firmenchef die Tschetschenen, die darauf bestanden, dass er, der »bolschoi natschalnik« – der »Big Boss« –, selbst verhandelte. Weil er sich weigerte, stimmten sie schließlich zu, dass statt seiner der 7 Jahre in der Firma arbeitende Klaus Schmuck und der Serbe Ero Petrovic die Verhandlungen in Tschetschenien führen sollten. Beide starteten am 3. August 1997 in Moskau und landeten auf dem Flughafen Inguschetia, benannt nach der Republik Inguschetien, von wo aus sie mit dem Auto nach Grosny gebracht werden sollten.
Klaus zeigt mir eine der vielen Veröffentlichungen in deutschen Medien.
Berliner Zeitung, 12. August 1997:
»Berliner in Rußland entführt
Ein 34-jähriger Geschäftsmann aus Berlin« (Klaus Schmuck war zu dieser Zeit 41) »ist vermutlich von Mitgliedern einer tschetschenischen Bande im Nordkaukasus entführt worden.
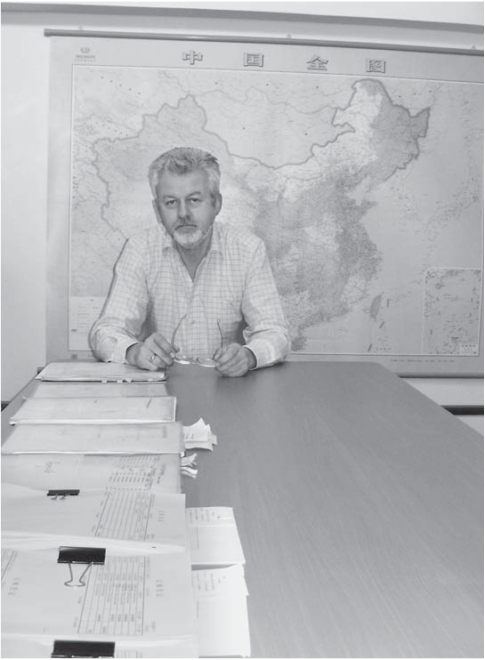
Klaus Schmuck an seinem langen Konferenztisch
Die Täter fordern für seine Freilassung 3,5 Millionen Dollar Lösegeld. […] Auf dem Flughafen der inguschetischen Hauptstadt Nasran, von wo aus die Männer weiterreisen wollten, wurden die Geschäftsleute entführt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Schmuck und sein Begleiter bereits am Flughafen von den Tätern mit hochgehaltenen Namensschildern erwartet worden. Seitdem fehlt von den Männern jede Spur. […] In dem Berliner Unternehmen wollte man sich gestern nicht zum Verschwinden von Klaus Schmuck äußern. ›Dazu geben wir keine Auskunft‹, sagte eine Mitarbeiterin der Firma. Die Deutsche Botschaft in Moskau, die am Freitag nachmittag von der Verschleppung erfahren hat, steht in Kontakt mit den zuständigen russischen Stellen. ›Nicht aber mit den Entführern‹, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Bonn. Auch in Berlin laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Inzwischen sind Beamte der 5. Mordkommission mit dem Entführungsfall betraut worden. Justizsprecherin Michaela Blume: ›Die Ermittlungen dauern an. Um das Opfer zu schützen, können wir jedoch keine Einzelheiten über die Entführung bekanntgeben.‹«
Klaus: »Die Tschetschenen hatten uns freundlich empfangen. Aber irgendwann nach langer Fahrt zog der auf dem Beifahrersitz plötzlich eine Pistole und schoss aus dem Fenster des Jeeps. Ich dachte noch: Was soll das? Wir fuhren zwar angeblich in Richtung Grosny, aber die Straßen wurden nicht breiter, sondern immer schmaler. Dann hielten wir außerhalb eines Dorfes vor einem sehr alten Bauernhaus. Ein Teil des Daches war wohl durch Raketenbeschuss zerstört worden. Und vor dem Gehöft saß einer mit einer Maschinenpistole. Das war’s dann. Du realisierst nicht sofort, was passiert ist, dass du jetzt Geisel sein sollst. Da denkst du als Geschäftsmann erst einmal an die Geschäfte, und mein erster Gedanke war: Was soll der Blödsinn? Nächste Woche habe ich einen wichtigen Termin.
In den ersten Tagen und Wochen haben die Geiselnehmer uns noch nicht drangsaliert. Wir waren wertvolles Gut für sie. In dem Raum, in dem wir uns ständig aufhielten, standen ein Sofa, ein Sessel, ein Klappbett. Dann gab es zwei Fenster, aber die waren bis zur Hälfte verhängt. Im Vorraum waren da noch ein Ausguss, eine Badewanne und ein Herd. Nachts rollte man eine dünne Matratze auf dem Fußboden aus, dort schliefen ›Hakennase‹ und ich nebeneinander. Außerdem gab es einen Nebenraum, in dem nur ein Schrank stand. In diesen Raum sperrte man Ero und mich, wenn Leute von außerhalb kamen und sie sich zu beraten hatten. Und schließlich gab es noch diese Falltür zum Kellerloch, in dem man nicht stehen konnte. Da wurden wir hinuntergesteckt, wenn irgendwelche Verwandten der Bewacher kamen. Und dann feierten sie oben, und wir hockten unten. In dem verwilderten Garten hinter dem Haus war eine Latrine. Da brachten sie uns nur nachts hin.
Einen Tag nach der Entführung fuhren sie mich nach Eintritt der Dunkelheit im Auto mit einer Decke über dem Kopf zu einem öffentlichen Telefonamt. Von dort aus musste ich in Berlin anrufen und die erste Forderung der Geiselnehmer, 3,5 Millionen Dollar, übermitteln. Der Chef unserer Firma sagte: ›Ja, wir holen Sie da raus, und tralalalala.‹ Natürlich hat sich damals die deutsche Polizei eingeschaltet, und andererseits war natürlich der Chef nicht wirklich geneigt, irgendetwas zu zahlen. Auch wenn er zehnmal gesagt hat: ›Wir holen Sie da raus.‹ Gedacht hat er sicherlich, dieser Schmuck, so ein Heini, so ein Ossi, der sitzt da irgendwo in Tschetschenien. Das ging dem Chef doch 100 Meter am Selbigen vorbei. (Im alltäglichen Sprachgebrauch des Unternehmens gehörte ich zu den UDOs: Unsere dummen Ossis.) Dann zog sich das hin, und je länger es dauerte, umso gemeiner wurden die Geiselnehmer gegen uns.«
Zwei aus der Gruppe der Entführer bewachten die Geiseln Tag und Nacht: »Hakennase«, ein etwa 40-jähriger ehemaliger Knastologe, und der »Kleine«, der noch keine 20 Jahre alt war.
»Für den ›Kleinen‹ waren im Leben angeblich nur zwei Dinge wichtig: Mercedes fahren und Menschen umbringen. Schon mit 16 hatte er den ersten Menschen, eine osetische Scharfschützin, getötet. Auf meinem Laptop, den sie mir in der Befürchtung, ich könnte mich damit in irgendeiner Form mit der Außenwelt in Verbindung setzen, weggenommen hatten, probierte er verschiedene Spiele aus. Er beschäftigte sich mit ›SimCity‹, baute eine Stadt auf, legte Wasser- und Stromleitungen, errichtete Wohnhäuser, konstruierte Bürogebäude, Krankenhäuser und Feuerwehrdepots. Immer größer und immer schneller wuchs seine Stadt, sie war in ihrer Infrastruktur vollkommener, als ich es je zustande gebracht hätte. Außerdem benutzte er das Computer-Zeichenprogramm und malte sehr oft die Flagge der tschetschenischen Separatisten: zwei dicke grüne – grün ist die Farbe des Islam – Streifen, die von zwei dünnen weißen und einem roten getrennt werden. In der oberen grünen Hälfte befindet sich das schwer zu zeichnende Wappen: ein goldener Schild, auf dessen blauem Rund ein silberner Wolf auf einem goldenen Podest liegt. Bestrahlt von einem silbernen Mond und begrenzt von silbernen Sternen.
Als die Verhandlungen über das Lösegeld nicht vorankamen, wurden Schläge die alltägliche Normalität. ›Hakennase‹, der am Tag immer links von mir auf dem Sessel hockte, traf bei jeder Antwort, die ihm nicht gefiel, mein linkes Ohr. Nach Wochen begann es zu eitern, ich hatte Angst, taub zu werden, und noch heute spüre ich den Schmerz. Auch die Drohungen, dass wir am Morgen nicht mehr leben würden, versuchte ich wegzustecken. Ich hatte eine Abmachung mit mir selbst getroffen: Erst wenn ich einen Pistolenlauf am Kopf spüre, glaube ich, dass ich jetzt und hier sterben muss. Und selbst die Demütigungen, bei denen ich hilflos zusehen musste, wie Ero von ›Hakennase‹ gequält wurde, waren noch nicht das Schrecklichste: Ein alter Mann mit einem Tischtuch um die Schultern gewickelt, der möglichst lautlos seinen Urin in einer Ecke des grob ausgehobenen Kellerloches lassen muss, weil seine Blase die Kälte nicht aushält. Als er herauskriecht, ist er total erstarrt, schlottert am ganzen Leib, kniet am Ölradiator nieder, hebt sich den noch warmen Teekessel auf den Kopf …
Die größte Angst hatte ich vor ihrer Drohung, dass sie von den Kämpfern in den Bergen eine dort schon seit Monaten gefangen gehaltene russische Geisel holen. ›Hakennase‹ schrie: ›Nicht wir, sondern ihr werdet diese Geisel erschießen! Entweder ihr tötet den Russen, oder wir töten euch!‹ Und höhnisch setzte er hinzu: ›Das könnt ihr euch doch nicht entgehen lassen. Einen Menschen töten zu dürfen, das ist eine große Sache.‹«
In solchen Situationen hatte Klaus daran gedacht zu fliehen.
»Unsere Bewacher, eine Mischung aus Knastologen und streng gläubigen Islamisten, wussten nicht, dass ich ihre Kalaschnikow-MPis und ihre Makarow-Pistolen, die sie im Schlaf und manchmal tagsüber herumliegen ließen, in meiner Armeezeit täglich auseinandergenommen und zusammengesetzt und damit auch häufig geschossen hatte. Doch um uns zu befreien, hätte ich zwei Menschen erschießen müssen. Zwar schwand nach all den Quälereien die moralische Hemmschwelle, einen Menschen zu töten. Doch was dann? Die Chancen, sich in der eisigen Kälte in einer fremden Gegend durchzuschlagen, standen fast bei Null. Man hätte uns als Ausländer sofort erkannt und dem nächsten Kommando übergeben. Wir wussten auch nicht exakt, wo wir uns befanden.«
Klaus sucht lange in einem Papierstapel und gibt mir dann ein Blatt.
»Ich habe später versucht, meine Gedanken von damals aufzuschreiben. Aber es ist wahrscheinlich unmöglich, das Geschehene unverfälscht und für Außenstehende verständlich wiederzugeben.
›In den ersten Wochen kann ich abends durch die geöffnete oberste Fensterklappe einen Baumwipfel sehen. Tag für Tag beobachte ich von der Sofaecke aus, wie die Farben verblassen, die Zweige dann die Form des Gesichtsprofils eines Bärtigen mit Barett anzunehmen scheinen und schließlich ganz in der Dunkelheit verschwinden. Als der Baum seine Blätter abwirft, sind die Fenster längst schon bis in die letzte Ecke zugehängt. Auch der Blick auf ein paar Zweige der Weinranken vor dem Fenster wurde versperrt. Durch die kleine Fensterklappe in der Küchennische sehe ich noch immer die Weintrauben, die bei unserer Ankunft grün waren, reif und schließlich verdorrten – und wir waren noch immer gefangen, ohne Aussicht auf Freiheit. Ich hatte am Anfang öfter versucht, wenigstens ab und zu die Augen in die Ferne zu richten. Die wenigen Meter Sicht im düsteren Raum und das an die weiße Wand Starren ließen mich befürchten, dass die Augen Schaden nehmen könnten … Als der erste Schnee gefallen ist, sagt ›Hakennase‹: ›Jetzt hat es euch erwischt, jetzt überwintert ihr mit Sicherheit hier‹, und ich erspähe während des Füllens der Wasservorratsbehälter eine braunweiße Kuh, die vor der Hütte vorbeigetrieben wird. Draußen riecht es ab und an nach Pferden …‹«
Klaus wehrt sich, als ich sage, dass er, um sich von dem Erlebten freizuschreiben, auch heute, 12 Jahre später, alles in den Computer tippen könnte.
»Nein, wie sollte ich schildern, was im Kopf vorgegangen ist, wenn ›Hakennase‹ plötzlich fragte: ›Urod – Missgeburt –, glaubst du an Allah?‹ Und ich weiß, dass jede Antwort, sowohl ein leises Nein als auch ein lautes Ja falsch und nur ein Grund für noch mehr Schläge sein wird.
Immer öfter glaubte ich, bald sterben zu müssen. Die Angst davor ließ mich über Menschen nachdenken, von denen ich mich nun verabschieden sollte, ohne mich wirklich verabschieden zu können. Und bei manchen habe ich mich damals im Kellerloch hockend für meine Nachlässigkeit, Grobheit, Unaufmerksamkeit oder Undankbarkeit entschuldigt. Auch bei meinem Klassenlehrer. Wir verbrachten mit ihm in der 10. Klasse einige Tage in einer Jugendherberge auf dem ehemaligen Gelände des Konzentrationslagers Buchenwald. Am ersten Tag bedrängten wir ihn mit dem Vorschlag, abends eine Fete zu machen. Aber er sagte: ›Nein, hier ist nicht der rechte Ort für eine Party!‹ Wir ließen nicht locker und hatten unseren Spaß daran, ihn mit dieser Forderung und unseren Protesten immer mehr in die Enge zu treiben. Bis er, entgegen seinen moralischen Ansichten, aufgab und sagte: ›Gut, dann macht eure Party, ich erlaube es.‹ Aber wir entgegneten darauf triumphierend: ›Jetzt wollen wir nicht mehr! Wir brauchen keine Party.‹ Da war der Mann völlig kaputt …
An so etwas dachte ich damals nachts, wenn sie uns Videos gezeigt hatten, wie tschetschenische Kämpfer russischen Soldaten und Geiseln die Kehle durchschnitten. Nie werde ich das dabei entstehende röchelnde Geräusch vergessen … Und ›Hakennase‹ drohte: ›Wenn das Geld nächste Woche nicht kommt, werden wir euch genauso schlachten!‹«
Wie das Lösegeld für ihn (der Serbe Ero Petrovic kam auf den Tag genau erst ein Jahr später frei) aufgebracht werden konnte, erfuhr Klaus Schmuck erst nach der Geldübergabe am 13. Februar 1998 in Grosny.
1000000 Dollar und 63 000 DM in einer Tasche mitten auf der Straße. Seine Eltern und der »Freundeskreis Klaus Schmuck« hatten 63 000 DM gesammelt. Die Firma gab 300 000 Dollar, und 700 000 Dollar spendete ein unbekannter Mann, der in Kolumbien in Geiselhaft gesessen hatte und in Deutschland später eine Stiftung gründete, um Geiselopfern zu helfen.
»Danach war ich, an was ich 195 Tage fast nicht mehr geglaubt hatte, wieder in Freiheit. Aber trotzdem nicht frei!«
Mit diesem Satz im Ohr und meinem wertvollen erinnerungsträchtigen »Mitleid ist umsonst, Neid musst du dir erarbeiten«-Buch im Rucksack gehe ich hinaus in die Kälte. Noch als mich ein Lehrer im Eingang zur Deutschen Schule bittet, meine Adresse aufzuschreiben, ist die Tinte gefroren.
Die Schüler im Auditorium, in dem auch Anja Obst ihr Buch vorgestellt hat, sind sehr viel ruhiger und aufmerksamer als ich es von Schulen in Deutschland kenne. Ich lese über die Erben der Firma Topf in Erfurt, die während der Nazizeit Verbrennungsöfen für die Konzentrationslager, unter anderem für das in Buchenwald, hergestellt hat. Ich lese über das Zusammenwachsen und Auseinanderdriften der Menschen, die in Ost und West entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wohnen. Ich erzähle von meiner Arbeit als Hochseefischer vor Kanada und als Maurer in Afrika und sage, dass ich die Schüler hier darum beneide, dass sie viel mehr über China wissen als ich. Nach den Standardfragen, weshalb man Schriftsteller geworden ist, wie lange man an einem Buch schreibt und was man damit verdient, wollen die Mädchen und Jungen wissen, wie mir Peking gefällt. Und was ich über die Chinesen denke, die, um sich »innerlich zu säubern«, wo sie gehen und stehen auf den Boden spucken. Sie fragen, ob ich glaube, dass es gut für Chinas Zukunft ist, dass nur eine Partei regiert, und ob ich mir vorstellen könnte, für immer in China zu arbeiten, vielleicht eine Chinesin zu heiraten …
Wir reden, obwohl schon Schulschluss ist, noch eine gute halbe Stunde über China und schließen am Ende einen Pakt: Wenn das Buch erscheint, werde ich mindestens acht (»Das ist eine gute chinesische Zahl«, erklärt einer der schon 5 Jahre in Peking lebt) Exemplare an die Deutsche Schule schicken. Und die Schüler der 9., 10. und 11. Klassen beantworten mir dafür (»Wenn wir Zeit haben«, sagt eine, die erst ein Jahr in Peking lebt) meine Fragen über China schriftlich. Und der Stellvertretende Schuldirektor bedankt sich (das hat er, ganz im Stil eines Direktors in Deutschland, schon zu Beginn der Lesung getan und sich wegen dringender Termine wieder verabschiedet) für die Lesung mit einer Flasche chinesischem Wein … Als ich gehe, ist auch die Tinte wieder aufgetaut.
Am frühen Abend fahren Klaus und ich ins »Schillers«. Friederike hat mir versprochen, dort beim Bier über den zweiten Teil ihres Lebens, den Aufenthalt in China, zu berichten. Im Auto frage ich Klaus, wie er sich gefühlt hat, nachdem er am 14. Februar 1998 in Berlin gelandet war. Er brabbelt unwirsch, dass er mir darauf schon am Vormittag mit dem Satz »Ich war wieder in Freiheit, aber nicht frei« geantwortet hat.
Der Firmenchef entließ ihn sofort »wegen Geschäftsschädigung« mit der Bemerkung: »An Ihrer Stelle wäre ich in Tschetschenien geblieben.«
Danach lebte Klaus auf sich gestellt monatelang mit der Angst, denn »Hakennase« hatte ihm gesagt, dass die »tschetschenischen Kämpfer« überall Stützpunkte besitzen. Auch in Berlin, wo sie vor der Entführung mit der Geschäftsleitung über Medikamentenlieferungen und den Besuch des Chefs in Tschetschenien verhandelt hatten. Und wenn er, der Urod Klaus Schmuck, ein Wort bei der Polizei sagen würde, das sie verraten oder ihnen schaden könnte, sollte er sich schon sein Grab schaufeln lassen. »Wir finden dich Missgeburt überall.«
Er schlief keine Nacht mehr ruhig, schaute beim Autofahren ständig in den Rückspiegel, verkaufte sein Haus und zog einstweilen unter seinem früheren Namen Müller (er hatte bei der Heirat den Namen der Frau angenommen) in eine andere Wohnung. Die Behörden schützten seine Wohnadresse, indem sie die Absender finanzieller Forderungen überprüften, bevor sie ihm die Post weiterleiteten.
Ein Jahr nach seiner Freilassung »floh« er 1999 nach China.
»Ich war in der Fremde länger zu Hause als in Deutschland.« Von seinem 18. Lebensjahr bis zu seinem 50. hatte er nicht einmal 15 Jahre in Deutschland gelebt.
In Peking arbeitete er zuerst bei der Firma »German Perfect Windows«. Er kannte Chinas Realität von seinem letzten Aufenthalt im Jahr 1985 und aus der Theorie seiner Diplomarbeit, in der er die Zeit um 1970 beschrieben hatte. Damals sollte China auf Befehl von Mao Zedong Großbritannien in der Stahlproduktion überholen. In jedem Dorf wurden kleine Öfen errichtet, in denen die Bauern alle verfügbaren eisernen Gegenstände einschmelzen mussten. Millionen Bauern verhungerten danach, weil es kaum noch Pflüge und Eggen gab, mit denen sie die Felder bestellen konnten.
Als er 1999 wiederkam, erlebte er den Wirtschaftsaufschwung in kaum vorstellbarer chinesischer Dimension. Klaus Schmuck glaubte, sich als chinesisch sprechender Ausländer mit seiner Fensterbaufirma gewinnbringend in das boomende reformierte Wirtschaftssystem einzupassen. Er glaubte es bis zum Februar 2001, als sein Mitarbeiter Weng, der ihm zuvor schon die Polizei auf den Hals gehetzt hatte, mit 45 000 DM verschwand.
Das Leben in China war für ihn, der kein ausgesprochener Individualist ist, sondern eher einer, der den vorgezeichneten, notwendigen Weg geht, in den letzten 12 Jahren nicht einfach. »In China hat ein Chinese seine Funktion als Rädchen im großen Getriebe. Mehr nicht. Es geht um die Befriedigung der Masse, des Großen und Ganzen, und nicht um die Befriedigung des einzelnen Individuums, des Persönlichen.«
Dem gegenüber steht die chinesische Verordnung zur Ein-Kind-Ehe. »Die chinesischen Einzelkinder werden heute von den Eltern und Großeltern von klein auf verhätschelt und verwöhnt. Alle springen um die verzogenen Persönchen herum. Die Kinder fühlen sich deshalb schon wie kleine Kaiser. Aber später fällt es den kleinen Kaisern schwer, sich als Erwachsene in die Masse einzuordnen.«
Solch ein Problem hatte Klaus, das Einzelkind zweier Lehrer, niemals. »Ich vermisste lediglich den Austausch mit anderen Kindern. Und die Bodenständigkeit fehlte mir.
Die Eltern meines Freundes Bernd waren Bauern. Und der sagte immer: ›Klaus, du mit deinen ungeschickten Intelligenzfingern.‹«
Die Intelligenz hat ihm bis zur Auflösung des DDR-Außenministeriums 1990 nicht geschadet. »Doch Intelligenz ist in der Welt nicht gleich Intelligenz. Sonst hätte auch ich mit meinen China-Erfahrungen hier in der Deutschen Botschaft anfangen können. So komplikationslos und geradewegs wie Friederike.«
Friederike sitzt ohne ihren Freund Robert mit anderen Deutschen dicht gedrängt am Tresen und trinkt ein Feierabendbier. Die dicke wattierte Hose und die Motorradjacke – die zierliche Person fährt auch in der Pekinger Dezemberkälte noch mit dem Motorrad – stehen, gekrönt vom Helm und über den Rucksack gelehnt, in der Ecke. Klaus umarmt sie von hinten, sie rückt für uns zur Seite. Es bleibt trotzdem so eng, dass wir nur seitlich mit einem Bein auf den hohen Barstühlen hocken können. Weil auch alle Tische besetzt sind, müssen wir wohl oder übel Kopf an Kopf miteinander reden.
Neben Friederike steht eine schwarzhaarige junge Frau in einem langen, weiten, bunten indischen Kleid. Sie unterhält sich mit einem kleingewachsenen Europäer sehr laut auf Englisch. Doch anscheinend versteht sie Deutsch oder ist eine Deutsche, denn während sie schnell und laut spricht, lauscht sie, den Kopf drehend, später auch unserem Gespräch. Dabei erkenne ich an dem Scheitel ihres Haares, dass sie von Natur aus Rotblond ist.
Ich bitte Friederike, zu erzählen, wie sie, eine von 6 Pfarrerstöchtern aus einem lippischen Dorf, nach Peking gekommen ist.
»Im Gymnasium hatte ich Musik und Französisch als Leistungsfächer gewählt, ich war von Frankreich begeistert und wollte nach dem Abi zunächst Französisch studieren. Für den Diplomübersetzer-Studiengang musste ich mich für eine zweite Sprache entscheiden und nahm mir damals den Ratschlag eines Lehrers zu Herzen, der in Taiwan gewesen und überzeugt war, dass Chinesisch zu lernen zweifellos eine gute Zukunftsinvestition ist. Heute kann ich dem nur voller Überzeugung zustimmen! Nach zwei Jahren Studium erhielt ich ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und konnte somit ein Jahr in China studieren.
Im August 1999 kam ich – mit fast 21 Jahren – das erste Mal nach China. Alles war aufregend und fremd. Zum Eingewöhnen blieb die Gruppe zwei Tage in Peking. Wenn wir im Bus zu irgendwelchen touristischen Zielen fuhren, schliefen die meisten. Bei mir war die Aufregung hingegen so groß, dass ich – trotz Jetlag – meine Augen und Sinne weit öffnete, um – vollkommen fasziniert – alles bewusst zu erleben.
Im Wohnheim meiner Studienstadt angekommen, wagte ich die ersten Schritte allein in ungewohnter Umgebung und versuchte mich, so gut wie es ging, häuslich einzurichten. Zuerst kaufte ich bunte Bettwäsche, Grünpflanzen, einen Wasserkocher und Putzzeug. Ich hatte eine Koreanerin als Zimmergenossin. Und das war gut, weil ich gezwungen war, mit ihr Chinesisch zu sprechen, und dadurch ganz automatisch vieles dazulernte und außerdem nach Hause telefonieren konnte, ohne dass sie etwas verstand. So blieb mir immerhin ein wenig Privates und ein kleiner Rückzugsort in der doch immer noch fremden neuen Welt.
Gestört hat mich in China damals vor allem, dass es immer laut ist und dass man nie allein ist. Ständig hat man unendlich viele Menschen um einen herum. Obwohl vieles durchaus gewöhnungsbedürftig war, habe ich ein sehr spannendes Jahr mit wertvollen Erfahrungen in China verbracht, was mich in dem Wunsch bestärkte, noch mehr über dieses Land erfahren zu wollen.«
Heute liest sie die wichtigsten chinesischen Zeitungen und sammelt Themen, die das Auswärtige Amt der Bundesrepublik interessieren: Chinas Position bei globalen Fragen und im internationalen Staatengefüge, Chinas politische und wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftspolitische und juristische Fragen, Artikel über verfassungsgemäße und individuelle Rechte und Freiheiten der Chinesen, Themen zu sozialen Problemen wie beispielsweise der mangelhaften Sozialversicherung, der unvollkommenen Gesundheitsfürsorge, der Privilegien der Kader, der Korruption und der Zwangsumsiedlung.
Robert kommt, schält sich aus den Lederklamotten und streichelt Friederike über das Haar.
Ich lasse die beiden ihre Tagesneuigkeiten austauschen und frage die schwarz gefärbte Rotblonde, deren Gesprächspartner inzwischen gegangen ist, ob sie oft im »Schillers« sitzt.
»Nur ein, zwei Mal im Jahr.«
Sie betreut in einer großen deutschen Firma in Peking »Neueinstellungen« – Ausländer, die noch nie zuvor in China waren.
»Mit ihnen übe ich die wichtigsten chinesischen Wörter, zeige ihnen die nahegelegenen U-Bahn-Stationen, die Deutsche Botschaft, die deutschen Läden und chinesische Behörden. Und abends gehe ich mit ihnen chinesisch essen.«
»Informieren Sie die ›Neueinstellungen‹ auch über Probleme und die politische Situation in China?«
Sie versteht nicht, was ich damit meine.
»Den Abriss der Hutongs, die Billiglöhne für Wanderarbeiter, die Einschränkung der Meinungsfreiheit …«
Das mit der Meinungsfreiheit müsste man relativ betrachten, sagt die Rotblondschwarze.«Inzwischen schreiben chinesische Zeitungen auch über Themen wie Korruption und Zwangsumsiedlung. Es gibt in China ein Computerspiel zu kaufen, in dem ein Hausbesitzer in einem Hutong um 6 Uhr geweckt wird und mit seiner einzigen Waffe, den Hauslatschen, gegen das angerückte, mit schwerem Gerät ausgerüstete professionelle Abrisskommando kämpft. Auch Minenunglücke werden in den staatlichen Medien nicht mehr verschwiegen. Für Menschenrechtsfragen gilt aber immer noch die Parteipropaganda: Das wichtigste Menschenrecht ist das Recht, dass ein Land sich zum Wohle seines Volkes weiterentwickelt. Punkt und Schluss. Und was dem Wohl des Volkes nutzt, bestimmt allein die immer noch Marx im Mund führende Kommunistische Partei.«
»Haben Sie Marx gelesen?«
Die Frau bestellt ein Bier und sagt, dass sie zwar in Trier, der Geburtsstadt von Marx studiert hat, doch weder das »Kommunistische Manifest« noch das »Kapital« kennt. Aber sie weiß, dass Marx die Arbeiterklasse als führende Kraft der Gesellschaft bezeichnet hat. »Weil China jedoch zu Maos Zeiten ein Land der Bauern war, in dem die Arbeiter noch Seltenheitswert hatten, schrieben die kommunistischen Führer in China den Marxismus einfach um: die führende Rolle erhielt die Bauernschaft.«
Ich entgegne mehr fragend als behauptend: »Doch dass inzwischen die führende Rolle in der Partei die neuen chinesischen Kapitalisten erhalten haben, um, wie die Partei sagt, den Sozialismus zum Wohle des Volkes in China durchzusetzen, das kann der alte Marx doch so nicht gemeint haben? Ist die KP Chinas inzwischen auch nur ein Fake, eine gute chinesische Fälschung?«
Sie zuckt mit den Schultern, und ich frage, was sie China für die Zukunft wünscht?
»Dass sich die Gesellschaft ohne gewalttätige Auseinandersetzung harmonisch weiterentwickelt. Die Partei wird ihre Führung nur durch soziale Fortschritte behaupten können. Auch deshalb hat sie für den beginnenden 12. Fünfjahrplan die Losung von der ›Gesellschaft des bescheidenen Wohlstandes‹ entwickelt. Alle sollen das Wirtschaftswachstum spüren. Doch das wird schwerer zu schaffen sein, als 10 000 neue Fabriken zu bauen.«
Ich frage, ob sie auch »Neueinstellungen« der Deutschen Botschaft oder anderer deutscher Institutionen betreut?
Sie schüttelt den Kopf. Und meint, dass die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft ein besonderes Völkchen sind. »Sie arbeiten mit Deutschen. Sie wohnen mit Deutschen im gelben Würfel gegenüber vom Hotel ›Kempinski‹. Sie können deutsche Lebensmittel vom Brandt-Zwieback bis Gurken aus dem Spreewald kaufen. Sie bleiben immer unter sich. Man kann auch in Peking sehr deutsch leben, ohne tiefer in die chinesische Welt eintauchen zu müssen. Nach zwei oder drei Arbeitsjahren ziehen sie weiter in die nächste Botschaft. Vielleicht nach Helsinki oder Tokio. Intellektuell sind sie gut drauf, diese Diplomaten. Aber ob sie auch wissen, wie die Chinesen in China wirklich leben und was sie wirklich denken?«
Außerdem meint sie, dass die Deutschen, die aus dem Westen nach Peking gekommen sind, sich von den Deutschen aus der DDR unterscheiden.
»Wir aus dem Westen funktionieren auch in China wie in jedem anderen Land. Wir machen unseren Job. Egal, ob in Peking oder Helsinki oder Tokio, und gleich, ob als Diplomat, Fensterbauer, Manager, Betreuer oder als Autohändler. Und deshalb haben wir es hier in China mit unseren gradlinigen Karrieren leichter als die Leute aus der DDR. Die kommen oft als im oder am Sozialismus Gestrauchelte nach China und beginnen hier ihre frühere Gesellschaft mit der heutigen chinesischen zu vergleichen und versuchen sich dann wie gewohnt dem System anzupassen. Für sie ist China selten die gradlinige Fortsetzung ihres Berufslebens, sondern das Abenteuer eines unfreiwilligen Neuanfangs.«
Robert hat sein erstes Bier ausgetrunken. Ich frage ihn, ob er wirklich die 13 000 Kilometer von Deutschland bis nach Peking mit seinem Motorrad in 75 Tagen geschafft hat.
»Ja. Aber hätte ich gewusst, dass ich Friederike hier treffe, wäre ich schon in 45 Tagen in Peking gewesen. Ich konnte mich damals unterwegs nicht verständlich machen, sprach kein einziges Wort Chinesisch. Wenn ich die Chinesen nach einer Tankstelle fragte, sagten sie mir, wo das nächste Restaurant ist, und wenn ich etwas zu essen haben wollte, wiesen sie mir den Weg zur nächsten Tankstelle. Sie konnten einfach nicht glauben, dass sie mich, ohne dass ich ein Wort Chinesisch sprach, trotzdem richtig verstanden hatten.«
Inzwischen kann er sich mit ein paar chinesischen Worten erstaunlich gut verständigen. Und bei seinen Fahrten durch China hat er neue Rekorde aufgestellt. Ein Amerikaner aus Shanghai war auf einer Schotterstrecke durch China an einem Tag 1020 Kilometer gefahren. Da sagte ein Freund zu Robert: »Das können wir auch.« Doch in den Bergen lag Schnee. Das Essen, das sie mitgenommen hatten, gefror unterwegs. Schon nach zwei Stunden klagten die Nackenmuskeln: »Es reicht.« Doch sie hielten durch und fuhren an einem Tag 1080 Kilometer. »Meiner Bestimmung nach hätte ich vor 200 Jahren im Wilden Westen als Cowboy geboren werden sollen. Aber nun hat mein Pferd eben einen Motor im Leib.«
Er entschuldigt sich, dass er mein Gespräch mit Friederike gestört hat. Ich bestelle ihm noch ein Bier und frage Friederike, was sie sich für ihre Zukunft wünscht?
»Nichts. Nichts, was mir sofort einfällt. Nein, wirklich: Ich wünsche mir nichts.« (Vielleicht hatte sie doch einen Wunsch, denn inzwischen wechselte sie von der Presseabteilung in der Botschaft zu einer großen deutschen Autofirma in Peking.)
Bevor ich in der Wohnung das »Mitleid ist umsonst …«-Buch wieder in das Regal stelle, fotografiere ich die Zeichnungen und Übungsanweisungen auf den Innenseiten des Umschlages. Das immer noch nach Schimmel riechende Portemonnaie von Klaus liegt auf dem Schreibtisch. Darin sammelt er die restlichen Geldscheine aus den Ländern, in die er nun als Manager fährt: Indische Rupien, Patacas aus Macao, Baht aus Thailand und … auch Rubel.