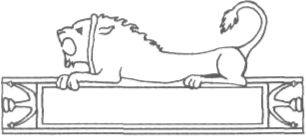RaEm wachte von einem leisen Rascheln vor ihrer Zelttür auf. Schlagartig war sie hellwach und schlich hin.
Der wachhabende Soldat seufzte leise, als seine Kehle durchgeschnitten wurde. Einen Moment lang geriet sie in Panik, doch dann hörte sie die Stimme des Mörders: »Ich komme von Horetaton, Meine Majestät.«
»Musstest du ihn deshalb umbringen?« Sie schlug die Zeltklappe zurück und deutete auf den am Boden liegenden Leichnam.
»Ja. Es war unvermeidlich.« Erst als der Bote ins Zelt trat, erkannte RaEm, dass er eine Sie war. Eine junge, flachbrüstige Frau, geschoren und geschmückt wie ein Priester, doch eindeutig weiblich.
»Was hat das zu bedeuten?«, herrschte RaEm sie an.
»Horetamun, ich meine -« Sie verhaspelte sich. »Er war mein Herr, Meine Majestät.«
RaEms Augen wurden schmal. »Weiter.«
»Er war -« Das Mädchen schöpfte angestrengt Luft. »Sie haben ihn umgebracht, Meine Majestät.«
RaEm war entsetzt. Er war ihr einziger Verbündeter! Ihr einziges Werkzeug! »Umgebracht?«
»Die Priester Amun-Res erheben sich, Meine Majestät. Sie wollen den Aton und Pharao auslöschen.«
»Erzähl mir alles.« Sie bedeutete dem Mädchen, sich zu setzen.
»Die Überschwemmung war schwach.«
»Das ist mir bekannt.«
»Das von dir gesandte Gold hat nicht gereicht.«
Bei diesem Gedanken zuckte RaEm zusammen.
Die Stammesbrüder hatten sich für besonders schlau gehalten, weil sie das Gold zusammen mit den verwesenden Leichen vergraben hatten. Doch RaEm hatte jeden Soldaten, der sich geweigert hatte zu graben, persönlich ausgepeitscht. Sie hatten eine Menge Gold zu Tage gefördert - Rüstungen und Waffen mit Hatschepsuts Kartusche, einem Pharao, von dem keiner der Soldaten je etwas gehört hatte. Zur Strafe für ihre Unwissenheit hatte RaEm sie ein zweites Mal ausgepeitscht.
Doch das Gold hatte nicht ausgereicht.
Dann hatte sie Daduas Tributzahlungen nach Ägypten geschickt, ein willkommenes Scherflein, doch längst nicht genug, um die gierigen Pfoten der bestechlichen Adligen und Priester zu füllen.
»Was ist passiert?«
»Er hat in Gottes Kammer zu Amun gebetet. Alle anderen Priester hatte er hinausgeschickt, darum hat er während des Gebets die Steine, das Gold und die Schätze ausgegraben, die niemand außer ihm vermissen würden.«
Es war ein Akt der Verzweiflung. Hoffentlich würde der Gott verstehen, dass er nur aus Liebe zu Ägypten gehandelt hatte.
»Der, der andere Priester« - das Mädchen wischte sich mit dem Handrücken die Nase ab - »er war schon immer neidisch auf Horetamun. Er ist mit den Wachen in den Raum eingedrungen und hat Horetamun auf frischer Tat ertappt.«
RaEm schloss die Augen. Sie konnte sich die Szene, die Eifersüchteleien, die Rivalitäten ausmalen. In den Tempeln sammelten sich die Menschen, die es nach Macht gelüstete. Bestimmt hatte er gekniet und wahrscheinlich im Boden gewühlt, als die Tür aufgeflogen war.
»Haben sie ihn gleich dort getötet?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Er wurde hingerichtet.«
»Aii, Isis, nein!«, hauchte RaEm. Das bedeutete, dass er eine Woche lang gefoltert worden war, dass er zehn volle Tage die verschiedenen »Höllen« durchleben musste, die dem Glauben nach seine Seele nach dem Tod durchwandern würde.
Man hatte ihn mit Honig überzogen und den Ameisen überlassen.
Seine Finger abgeschnitten und sie vor seinen Augen an So-beks Krokodile verfüttert.
Ihn gnadenlos ausgepeitscht, bis er am ganzen Leib blutete, und dann in der Sonne liegen gelassen.
Seine Zunge abgeschnitten und ihm alle Zähne gezogen.
Ihn chirurgisch bei vollem Bewusstsein ausgeweidet, aber so, dass er dabei nicht starb.
Ihm das Geschlecht abgehackt und in den Mund gestopft.
Dann ihn geblendet.
Und schließlich seinen Leib in Pech getaucht und angezündet.
Nichts würde von ihm übrig bleiben; sein Name würde aus allen Papyri gelöscht, seine Siegel eingeschmolzen, seine Asche im Wüstenwind verstreut und sein gesamter Haushalt an Ausländer und in die elendeste Sklaverei verkauft.
RaEm weinte um ihn. Sie zerriss ihre Kleider, schlug sich an die Brust, beschmierte Gesicht und Kopf mit Asche und verharrte drei Tage lang im Dunklen, wo sie um ihn trauerte. Doch zuvor sorgte sie dafür, dass das Mädchen Gold und neue Kleider erhielt, und schickte sie nach Yaffo, von wo aus sie auf eine weit entlegene Insel reisen sollte.
Unterwegs würden RaEms Agenten, als Priester Amun-Res verkleidet, sie überwältigen, umbringen und den Leichnam liegen lassen. Natürlich hatte der richtige Priester das Mädchen verfolgen lassen. RaEm durfte nicht zulassen, dass man eine Verbindung zwischen dem beseitigten Hohe Priester und dem herrschenden Ko-Regenten Ägyptens zog.
Allerdings würde das Mädchen einen schnellen, schmerzlosen Tod sterben. RaEm würde persönlich dafür sorgen, dass sie betrauert und ihr Name in vielen Schriftrollen verzeichnet würde, damit sie für alle Zeit weiterlebte.
Nach Ablauf der drei Tage verwandelte sich RaEm zurück in Semenchkare, ließ ihren Tragsessel rufen und brach auf zu Da-duas Audienzsaal.
Sie hatte ihren Verbündeten verloren; sie brauchte einen neuen.
Es war Zeit zu handeln. In einem Monat würde das goldene Totem in die Stadt einziehen. RaEm wusste nicht, ob Echnaton noch so viel Zeit blieb. Wenn er ermordet wurde, ohne dass sie selbst den Mord in Auftrag gegeben hatte, dann würde man sie ebenfalls zum Feind erklären. Eigentlich hätte ihr Priester Horetamun diesen Mord ausführen und dann ihr, dem über Ägypten herrschenden Pharao, zuschreiben sollen. So wie Hat-schepsut mit ihrem Neffen Thutmosis verfahren war, hätte RaEm den kleinen Tuti unter Hausarrest gestellt und seine Regentschaft an sich gerissen.
Doch man hatte ihr Werkzeug entdeckt. Jetzt musste sie bald nach Ägypten zurückkehren, sie musste mit Gold beladen zurückkehren und mit einer triumphierenden, Kriegsbeute heimführenden Armee, dem Symbol eines längst untergegangenen Ägyptens.
Es war höchste Zeit; Horetamun war seit beinahe einem Monat tot.
Als die Regenfälle endgültig einsetzten, stand ich auf meinem Balkon und mahlte mein Getreide, da ich keine Sklavin hatte. Das Wetter hatte uns schon länger geneckt, mit etwas Nieselregen oder einem kurzen Schauer hie und da. Und fast jeden Nachmittag mit einer kleinen, vom Wind geschobenen Wolkenfront. Die ganze Woche hindurch war es stetig abgekühlt. Die Felder waren umgepflügt und bepflanzt; die Trauben zu
Wein zerstampft; die Oliven eingelegt; die Granatäpfel gepflückt; und das Getreide geerntet.
Jetzt begann die Regenzeit.
Es war meine Zeit »auf dem Stroh«. Ich sah dem Regen zu und hätte am liebsten geweint. Was lächerlich war, da alles gut, sehr gut lief. Besser als in jedem anderen Zeitalter, in dem ich bisher gelebt hatte.
»Du brauchst ein Hobby«, sagte ich mir laut. »Eines, das dich davon abhält, Selbstgespräche zu führen.«
Mir fehlte meine Kunst, das Staunen über etwas Selbsterschaffenes. Brot zählte nicht als kreatives Werk, auch wenn ich ziemlich gut im Backen geworden war. Ich hörte ein Klopfen an der Tür, darum legte ich den Stein ab und lief hin. Draußen im Regen stand die Transuse, tanzend und mit einem Lächeln auf den Lippen.
Richtig, sie tanzte gern im Regen. Fußabdrücke Gottes oder so.
»Avgay’el lädt dich zum ersten Krempeln ein«, sagte sie. »Heute Nachmittag.«
Ich starrte sie an; das Mädchen wandelte sich immer mehr zur Frau. Nicht nur das, sie war ausgesprochen liebreizend, wenn sie sich bewegte. Hatte sie überhaupt Knochen im Leib?
»Wann?«
»Heute Nachmittag.«
»B’seder, aber wann?«
»Jetzt.«
»Äh, also, soll ich irgendwas mitbringen?«
»Wir krempeln«, sagte sie. »Kommst du?«
Warum nicht. Ich zog die Tür hinter mir zu und folgte ihr hinaus in den Regen.
Ich stapfte vor mich hin, sie tanzte. Selbst im Gehen tanzte sie. Sie bemerkte nicht die Blicke der Männer, die sich nach ihr umdrehten und ihre Freunde auf diese Frau aufmerksam machten.
Vor uns sah ich eine Gruppe von Giborim. Sie war noch ein Kind, selbst wenn sie sich wie flüssiges Öl bewegte. »Geh lieber ein Stück weit normal«, flüsterte ich ihr zu. Sie tanzte. Die Soldaten hatten sie noch nicht bemerkt. Unter ihnen war auch der Klingone. Vielleicht konnten wir ihnen irgendwie ausweichen?
Donner.
Mit einem Schlag steigerte sich der Regen von einem normalen, mittelmäßigen Schauer zu einem monumentalen Wolkenbruch. Ich sah mich nach einer Möglichkeit zum Unterstellen um, doch die Transuse jubilierte verzückt. Sie begann im schwächer werdenden Nachmittagslicht über die Straße zu kreiseln, zu wirbeln und zu tänzeln.
Uri’a, der Klingone, wurde auf sie aufmerksam; ich sah, wie sein Gesicht vor Geilheit erschlaffte. Ein anderer Gibori trat vor, doch Uri’a hielt ihn mit dem Schwert zurück - einem Schwert aus pelestischem Eisen. Sie wechselten ein paar Worte miteinander, vermutlich etwas wie: »Ich habe sie zuerst gesehen.«
Und die Transuse tanzte immer weiter, das Gesicht dem Regen entgegengestreckt. Deine Kindheit ist vorbei, dachte ich. Uri’a schaute ihr zu. Wütend auf sie und auf mich selbst hastete ich durch die Sintflut, riss mir das Kopftuch von den Haaren und warf es ihr über. Dann packte ich sie an der Schulter und marschierte mit ihr durch den Regen davon. Sie protestierte, doch Uri’as Miene wollte mir einfach nicht aus dem Sinn.
Avgay’el und Shana mussten davon erfahren.
Triefnass, mit laufenden Nasen und völlig aus der Fasson kamen wir im Palast an.
Im Hof stand ein Ägypter, ein Ägypter, den ich noch nie gesehen hatte. Er war zwar wie ein Priester gekleidet, trug aber ein Schwert wie ein Soldat. Der Bleiglanz war über sein Gesicht verlaufen; er war völlig durchnässt. Niemand war in seiner Nähe. Ich befahl der Transuse knapp, in den Frauenflügel voranzugehen. ‘Sheva warf mir einen finsteren Blick zu und zog ab.
»Hat sich schon jemand deiner angenommen, Herr?«, fragte ich auf Ägyptisch.
Mein Anblick schien ihn zu verblüffen; seine Finger flogen durch die Luft und machten das Zeichen gegen den bösen Blick, denn schließlich hatte ich rotes Haar und grüne Augen.
»Nein, äh, Herrin«, antwortete er.
»Wen möchtest du sprechen? Pharao Semenchkare hat sein Lager auf dem Hügel gegenüber aufgeschlagen.« Ich gab mir alle Mühe, mich nützlich zu machen. Seine Augen wurden schmal. Allmählich bekam ich das Gefühl, alles falsch zu machen. »Oder bist du hier, weil du haNasi Dadua sprechen möchtest?«
»Ich bringe Kunde von einem neuen Pharao«, sagte er.
»Echnaton ist zu Osiris heimgeflogen?«
»Echnaton hat Osiris’ Existenz geleugnet«, erwiderte er eisig.
Na prima, ich leistete ja erstklassige Arbeit. Ich beschloss, den Mund zu halten, solange es noch möglich war.
»Der Junge, Tuti, ist er bei Pharao?«
Bildete ich mir das nur ein, oder lastete auf dem Wort Pharao dicker Sarkasmus? Ich zuckte mit den Achseln. Das wusste ich nicht. Ich bot ihm Wasser an und zog dann ab in den Frauenflügel. Sobald ich dort und damit bei Daduas kreischenden, herumrennenden Kindern angekommen war, suchte ich Shana auf und berichtete ihr von dem Boten. Dann erzählte ich ihr von der Transuse und Uri’a. Sie tch’te und schickte mich aufs Stroh.
Die Kinder wurden zum Mittagsschlaf hingelegt und an uns Frauen Wollballen sowie jeweils zwei Holzplatten ausgeteilt: eine mit zwei Zinkenreihen, die andere mit einer. Bei all dem Wollekrempeln und Teigkneten würde ich mir in Zukunft jedes Fitnesstraining sparen können. Als Frau im Altertum zu leben,
war harte Arbeit und ein ebenso hartes Workout.
Würde ich immer eine Frau im Altertum bleiben? Ich legte die Hand auf meinen Bauch und kämpfte gegen die Tränen an. Wollte ich das denn?
»Erzähl uns eine Geschichte, Avgay’el!«, forderten die Frauen. Avgay’el war schwanger, auch wenn man ihr das nicht ansah. Andererseits war Daduas neueste Frau, eine ausländische Prinzessin, unübersehbar schwanger. In einer Hinsicht war das eigenartig; in anderer auch wieder nicht. Theoretisch hatte ich mich mittlerweile mit der Polygamie abgefunden; verwandelte ich mich allmählich wirklich in eine Frau des Altertums?
Die Himmel hatten sich über Tziyon geöffnet und durchtränkte uns. Wir hörten die Tropfen auf das Dach trommeln; das Gewitter hatte es drinnen dunkel werden lassen.
Anhino’am bat die Transuse, Lampen anzuzünden. Dann merkte ich, wie ‘ Sheva hinausschlüpfte. Um wieder im Regen zu tanzen, dachte ich. Wenigstens befand sie sich jetzt im Palast, wo es sicher war.
Avgay’el nahm ihr Arbeitszeug auf und fing an, ihren Woll-ballen zu entfilzen, wobei sie im Rhythmus ihrer Bewegungen mit kräftiger, melodiöser Stimme sprach: »Angesichts des Wetters«, sagte sie, »weiß ich schon, welche Geschichte heute passt.«
Die Frauen lachten. Ich konzentrierte mich darauf, meinen Wollballen auseinander zu ziehen, damit ich anfangen konnte, ihn zu krempeln.
»Die Geschichte hat ihren Anfang, nachdem die erste Familie sich vermehrt hatte«, begann Avgay’el. »Sie besiedelte das Antlitz der Erde. Nun gab es auch eine Rasse von Riesen, Ana-kim: Himmelssöhne, die sich Menschentöchter erkoren. Ein Heldengeschlecht zog durch die Welt, Männer und Frauen von sagenhaftem Ruhm.«
Ich wand mich auf meinem Strohhaufen und zerrte mein Wollknäuel auseinander. Bedeutete dies, dass die Bibel Raum für diese mythologischen Wesen ließ? War es überhaupt dieselbe Bibel, die ich besessen hatte? Irgendwie war ich sicher, dass ich damals besser aufgepasst hätte, wenn darin etwas über ein Picknick mit Gott oder über Riesen und Zaubergestalten gestanden hätte.
Stattdessen war mir die Bibel vorgekommen wie eine Ansammlung von Moralvorschriften und Zeugungslisten.
Ich sah mich um, von der stillenden Frau auf die zwei Ehefrauen in anderen Umständen und die vier Konkubinen, die sich sämtlich in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft befanden: das mit den Zeugungslisten traf allerdings schon zu.
Avgay’el drehte ihre Krempelhölzer um, hielt inne und sah uns der Reihe nach an. »So höret: Yahwe blickte auf den Erd-ling, der zu einem Monster herangewachsen war. Denn in seinem Dichten erschuf er immer nur Böses, aus dem sich böses Trachten ergab. Da wurde Yahwe das Herz schwer wie einem Vater, dessen Sohn ein fruchtloses Leben führt. >Ich will die Erdlinge vom Angesicht des Landes tilgenc, sprach er. >Mensch und Tier, Gewürm und Vögel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.<«
Die Frauen sahen sie voller Trauer über Gottes Pein an. Ich versuchte angestrengt, ihre Worte nicht in irgendeine mir bekannte Geschichte zu pressen. Ich wollte ihr einfach nur zuhören und die Situation genießen: einen Regentag im Harem, die Kameradschaft gemeinsam arbeitender und in Bann geschlagener Frauen.
»Doch Noach der Fromme erwärmte Yahwes Herz.«
Natürlich Noah. Wieso sollte mich das überraschen? Bei Regen lag der Gedanke an eine Arche nahe. Ich hörte sie sagen, dass Gott Noach befahl, die Arche zu besteigen, weil er ein Gerechter unter den Völkern sei. »Nimm dir sieben mal sieben
- das Männchen und sein Weibchen - von jedem reinen Tier.«
Sieben mal sieben? Und was war mit zwei mal zwei?
»Von den unreinen Tieren nimm dir je ein Männchen und sein Weibchen. Sieben mal sieben Vögel, das Männchen und sein Weibchen. Sie verteilen den Samen des Lebens über das Angesicht der Erde.«
»Ich wünschte, er hätte die Schlangen weggelassen«, meinte Hag’it. »Sie hätten ruhig zusammen mit den unreinen Menschen ertrinken können. Mir hätten sie nicht gefehlt.« Die übrigen Frauen lachten. Avgay’el lächelte und schaute gleich wieder auf ihre Krempelhölzer.
»Nun höret: Yahwe sagte, dass er in sieben Tagen Wasser auf die Erde regnen lassen würde, vierzig Tage und vierzig Nächte lang ohne Unterlass. Auf diese Weise würde er alles Lebendige, das er aus Lehm gemacht hatte, vom Erdboden tilgen. Noach, sein Weib, seine Söhne und ihre Weiber gingen in die Arche, so wie Yahwe es ihnen gebot.
Nun sehet: Sieben Tage vergingen, dann regnete das Wasser vierzig Tage und Nächte lang. Yahwe verschloss die Tür hinter Noach. Das Wasser hob die Arche an und ließ sie vierzig Tage über dem Land schwimmen. Das Wasser nahm überhand und wusch das Angesicht der Erde rein. Die Arche schwamm über das Angesicht der Erde hinweg. Alle hohen Berge waren von Wasser bedeckt.«
Ich musste an meine Flüge über die Schweizer Alpen denken, deren schneebedeckte Gipfel alle Wolken durchstießen und selbst aus zehntausend Meter Höhe zu erkennen waren. Und diese Höhen waren angeblich von Wasser bedeckt gewesen? Das erschien lachhaft, doch mein skeptischer Ansatzhebel wurde allmählich rostig. Ich hatte miterlebt, dass Gottes Taten meine Fähigkeit zu verstehen und zu glauben mit Leichtigkeit übersteigen konnten. Und änderte letztendlich mein Glaube oder Unglaube irgendetwas?
Avgay’el fuhr fort: »Die Wasser stiegen fünfzehn Ellen über die bedeckten Berge. Alles, was Nefesh hatte, verschwand vom Land. Alles, was gelaufen oder geflogen oder gekreucht war; alles war ausgelöscht. Nur Noach und was mit ihm in der Arche war, blieb übrig.
Nun wurde dem Regen vom Himmel gewehrt. Da verliefen sich die Wasser auf der Erde. Nun sehet: Das Fenster, das Noach gemacht hatte, wird geöffnet. Er lässt eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf dem Land.«
Wie viele Kunstwerke mit diesem Motiv hatte ich schon gesehen? Von der Renaissance angefangen bis in die Moderne: Tierköpfe, die aus den Fenstern der Arche ragen, Noah, der die Taube fliegen lässt und auf ihre Rückkehr wartet.
Doch diesmal sah ich noch etwas, das mir nie zuvor aufgefallen war. Die grauenvolle Einsamkeit, die einzigen Menschen auf dem Planeten zu sein; die alles überwältigende Angst vor einem Gott, der - in gewisser Weise - selbstkritisch und flexibel genug war, seine Schöpfung zu zerstören, weil sie seinen eigenen Maßstäben nicht genügte. Als wären all diese Menschen und Tiere nichts weiter als Tonschüsseln; getöpfert, glasiert und gebrannt, doch so missgestaltet, dass sie weder zu retten noch zu gebrauchen waren. Und deshalb kaputtgemacht werden mussten.
Doch zum ersten Mal verstand ich Gott. Ich konnte seinen Blickwinkel verstehen. Gott als Schöpfer - der keinerlei Gefallen an seinem Werk fand. Wie oft hatte ich eine Leinwand übermalt? Eine Skulptur weggeschmissen? Etwas Getöpfertes wieder eingestampft?
Durch mein Grübeln verpasste ich die Stelle, an der die Taube ausbleibt, doch diesen Teil der Geschichte kannte ich bereits. Avgay’el nahm einen Schluck Wein, um ihre Stimme zu glätten, bevor sie fortfuhr: »Nun baute Noach Yahwe einen Altar und nahm von allen reinen Tieren, den reinen Vögeln und opferte sie: als Brandopfer auf dem Altar.
Und Yahwes Herz wurde besänftigt; denn seine Nase roch den lieblichen Duft. Er dachte: >lch will hinfort nicht mehr über die Erde richten um der Taten der Erdlinge willen. Wenn sie die Gabe meiner Schöpfungskraft zu schändlichen Gedanken missbrauchen, werden böse Taten entspringen. Dennoch will ich hinfort nie wieder schlagen, alles was da liebt, nur um ihn zu treffen.«
Ich hörte die erste Kinderstimme nach der Mutter rufen. Avgay’el kam eilig zum Schluss. »Dies waren die Söhne Noachs, die aus der Arche gingen. Shem, Harn und Yafat. Von diesen drei Söhnen her kommen alle Menschen auf Erden.«
Wir hatten unsere Wollfilze in lange Matten gekrempelt, aus denen dann Fäden gesponnen würden. Gerade als wir die Krempelhölzer zurückgaben, sah ich die Transuse hereintaumeln. Sie blutete, und ihr Gesicht war mit blauen Flecken übersät.
Mir wurde schlecht, denn mir schwante Böses. »‘Sheva!« Ich lief zu ihr hin. »‘Sheva, was ist passiert?«
Sie antwortete nicht, sondern starrte in die Ferne. Shana packte sie am Arm und rüttelte sie: »Du! ‘Sheva«, doch auch das führte zu nichts. Avgay’el strich ihr über das Haar und bemerkte dabei einen Biss auf ihrem Hals.
Einen großen Biss. O nein, nein, nein, dachte ich.
»Hebt ihren Rock hoch«, befahl Shana.
Auch ich half dabei. Das Mädchen war geschändet worden. Im Schlamm überwältigt. Die Mienen der Frauen blieben ernst, doch keine weinte. Avgay’el und Shana sahen sich an.
»Trag sie ins Stroh, Klo-ee«, sagte Avgay’el. »Shana wird sie untersuchen.«
Ich hob sie hoch und schob meinen Arm unter ihre Knie. Sie war so zerbrechlich und wie im Koma. Sie war vergewaltigt worden? Das erschien mir unvorstellbar. Diese Menschen vergewaltigten nicht einmal die Frauen, wenn sie eine Stadt plünderten! Ich legte sie auf dem Stroh ab, während die anderen Frauen ihr erst Wein und dann ein paar Lampen brachten, damit Shana besser sehen konnte. Hag’it diente der Transuse als Kopfkissen, sie bettete den Kopf des Mädchens in ihrem Schoß und strich ihr das mondstrahlfarbene Haar aus dem Gesicht. Ahino’am brachte erwärmte Lumpen, mit denen wir ganz vorsichtig den Schlamm und das Blut abtupften.
Wir zogen der bibbernden und zähneklappernden ‘ Sheva das Kleid aus und wickelten sie dann in Tierfelle. Shana untersuchte das Mädchen, während Avgay’el eine Lampe über ihre Schulter hielt, um ihr zu leuchten. Ich schaute nicht zu, dennoch fiel mir auf, dass ihr eben erst die Schamhaare wuchsen. Sie war noch ein Kind, ganz gleich, was ihr Körper verkündete.
Ihre Haut war von blauen Flecken gezeichnet; es war leicht nachzuvollziehen, was passiert war. Er hatte sie mit dem Unterarm knapp über der Kehle auf den Boden gepresst. Sobald sie sich bewegte, drückte er ihr die Luft ab. Ein dickes Knie hatte sich in ihren weichen Bauch gedrückt. Was für ein Monster war das gewesen? Ihre Schenkel waren auseinander gezerrt und festgehalten worden. Wir hätten praktisch Fingerabdrücke von ihrem Vergewaltiger nehmen können!
Shanas kleine Hände huschten über den Leib. Daduas Schwester schüttelte traurig den Kopf, und in ihren Augen glänzten Tränen. »Ihre Jungfernschaft ist dahin«, sagte sie. »Ich werde es Dadua sagen.«
»Was für eine Strafe steht darauf?«, fragte ich. Ich glaubte zu wissen, wer der Täter war, wer dieses arme Kind so missbraucht hatte.
Alle sahen mich fassungslos an.
»Das war Uri’a, das würde ich beschwören. Ich habe euch doch erzählt, wie er sie vorhin angesehen hat.« Ich sah mich um. »Gibt es hier ein Gefängnis? Wird er ausgepeitscht?«
Avgay’el sah mich stirnrunzelnd an. »Manchmal vergesse ich, dass du eine Pelesti bist, Klo-ee. Er wird nicht bestraft werden. Sie werden heiraten.«
»Aber er hat sie vergewaltigt! Und jetzt soll er sie heiraten, damit er sie nach Lust und Laune wieder vergewaltigen kann?«
Daduas Gemahlin zuckte mit den Achseln. »Es ist die am wenigsten elegante Methode, zu einer Braut zu kommen, na-chon -«
»Was für Methoden gibt es denn sonst?«, fragte ich zornig.
»Verführung oder Kauf«, antwortete sie. »Wie hat dein Mann denn dich bekommen?«
»Er hat mich gefragt.«
Sie schnappten nach Luft. »Er hat nicht für dich bezahlt? Er hat dich nicht verführt, sodass du fortan an ihn gebunden warst?«
»Lo. Und er hat mich ganz gewiss nicht vergewaltigt!« Ich blickte auf die schlafende Transuse hinab. »Sie ist doch noch ein Kind! Jetzt wird sie ihr Leben lang diese Gewalt erdulden müssen!«
»Das ist gut für sie«, erklärte Shana stoisch. »Die Erfahrung natürlich nicht - es wäre besser gewesen, wenn er sie durch betörende Worte und sanfte Berührungen verführt hätte -, doch sie ist eine Sklavin. Er hat sie wie eine freie Frau behandelt. Jetzt wird sie die Gemahlin eines Gibori. Sie wird selbst Sklaven haben, außerdem ein Heim, Kleider, Kinder. Ach, es ist ein Segen!«
Ich würde mich gleich übergeben. »Eine Vergewaltigung ist ein Segen?«, brach es aus mir heraus.
»Bisher war Batsheva ein Niemand«, sagte Shana.
Ich wusste, dass in diesem Alef-bet »t« und »th« austauschbar waren. Genau wie »b« und »v«. Abrakadabra und - o Gott, ich hatte mit Bathseba Getreide gemahlen? Doch gewiss nicht der Bathseba? Dieses dürre, pferdezähnige Mädel konnte doch unmöglich die aus der Bibel berühmte Bathseba sein?
Die Mutter Salomons, des weisesten Mannes der Welt?
»Jetzt wird sie Mutter und gute, starke Söhne bekommen.«
Und warum nicht, Chloe? Ich sah auf die Transuse - Bathse-ba - hinab und begriff, dass ihre Tage als Niemand sich in rasendem Tempo dem Ende näherten. Würde David nicht ihren Mann umbringen, um an sie heranzukommen? Plötzlich kam mir dieser Mord nicht mehr ganz so schändlich vor.
Laut Gesetz war der Gesetzesbrecher bereits mit ihr verheiratet; jetzt waren nur noch die Formalitäten abzuwickeln. Da ‘Sheva eine Sklavin war, sprang Dadua als ihr Vater ein. Shana legte ein Kopftuch um und würde als ‘Shevas Fürsprecherin vor den König treten.
Wir deckten die Schlafende zu und verzogen uns.
Ich stolperte durch den Regen und musste die ganze Zeit an Gottes Verkündigung denken, dass missbrauchte Schöpfungskraft die Wurzel böser Taten und letztendlich der Grund war, weswegen die »Erdlinge« ausgelöscht worden waren. Und doch war es ohne eine derartige Vorstellung einem Menschen nicht möglich, die Idee eines Gottes, vor allem eines unsichtbaren Gottes, zu erfassen.
Ich würde ganz bestimmt Hindu werden.
Cheftu öffnete die Tür und spürte sofort, dass etwas passiert war. Kein wärmendes Wasser brannte, es duftete nicht nach Gebratenem, es gab keine überschwängliche Begrüßung. Es war kalt und dunkel und so still, dass er ihre Tränen hörte.
Er lief durch das Haus auf den Balkon. Chloe saß mit dem Rücken zur Wand und schluchzte. Er ging vor ihr in die Hocke. »Chloe? Geliebte?«
Abrupt zuckte sie hoch und wischte sich über das Gesicht. »Ist es schon so spät? Es tut mir Leid, ich -«
Sie wollte schon aufspringen, doch sie sprach Englisch, daher wusste er, dass sie extrem aufgeregt war. Er legte eine Hand auf ihre Schulter, um sie am Aufstehen zu hindern. Ihr Gesicht war fleckig, die Nase lief, die Augen waren gerötet. Er ließ sich neben ihr nieder und zischte kurz, als der kalte Regen auf seinen Körper traf. Wenn er den Jerusalemer Winter überleben wollte, würde er seine Leinentuniken gegen welche aus Wolle umtauschen müssen.
Er küsste ihren Handrücken und wartete ab. Sie starrte aus dem Fenster auf die braunen Hügel. »Wieso sind wir hier?«
Cheftu zuckte mit den Achseln. »Weil die Portale uns hergebracht haben?«
Schniefend rieb sie sich mit der Hand über die Nase. »Mein Gott, was würde ich für ein Tempo geben!«
Er wusste nicht, was sie mit »Tempo« meinte, doch er besaß ein provisorisches Taschentuch. Sie dankte ihm und schnäuzte sich.
»Wir sind hier, doch verändert hat sich dadurch nichts.
Wahrscheinlich haben wir die Menschheitsgeschichte total durcheinander gebracht, weil wir die Menschen, die andernfalls den ganzen Kram erledigt hätten, daran gehindert haben.«
»Kram?«, wiederholt er verwirrt. »Geliebte, du musst deutlich sprechen, wenn du Englisch redest. Was für einen Kram?«
»Jerusalem. Die Lade. Bathseba.«
Sie hatte es also schon gehört. Uri’a der Hethiter würde Bathseba heiraten. Irgendwann würde, so stand es in der Bibel, David sie beim Baden beobachten und sie in einer Nacht der Leidenschaft schwängern. Daraufhin würde er alles versuchen, um Uri’a zu seinem eigenen Weib ins Bett zu locken, doch vergeblich.
Schließlich würde David dafür sorgen, dass Yoav Uri’a in der Schlacht umkommen ließ.
Der König würde seine heimliche Geliebte heiraten.
N’tan, der Tzadik, würde die Geschichte in ein Gleichnis kleiden und dem König erzählen. David würde toben und erklären, dass der Mann in der Geschichte eine Strafe verdient hätte. Daraufhin würde N’tan die berühmten Worte sprechen: »Du bist jener Mann.«
Bathsebas und Davids erstes Kind würde sterben. Sie würden ein zweites bekommen, Salomon genannt.
Alles geschah genauso, wie in der Heiligen Schrift geschrieben stand. Nicht in der Weise, wie Cheftu sich diese biblischen Geschichten ausgemalt hatte, dennoch erfüllten sie sich Wort für Wort.
Genau jenen Worten entsprechend, die ein ägyptischer Schreiber am Hof der Israeliten aufgezeichnet hatte.
»Was für ein >Kram< ist das?«
»Wieso sind wir hier?« Sie sah ihn an. »Diese Geschichte findet doch bereits statt. Man hätte uns gar nicht gebraucht. Das war absolut sinnlos!«
Er sah zum Himmel auf und fragte sich, was le bon Dieu, falls er tatsächlich im Himmel wohnte, wohl von ihrem Kommentar hielt. »Sollen wir mit Jerusalem anfangen?«, fragte er.
Chloe zuckte mit den Achseln. »Klar.« Sie schnäuzte sich noch mal. »Es wurde eingenommen. Das wissen wir.«
»Du weißt das aus der Geschichte?«, fragte er.
Sie nickte.
»Woher willst du wissen, dass nicht du der Schlüssel zu dieser Invasion warst?«
»Jerusalem wurde von David eingenommen. Willst du etwa behaupten, ich hätte von jeher in dieser Geschichte eine Rolle gespielt?« Ihre Stimme klang beinahe hysterisch.
Es war eine Schwindel erregende Vorstellung, das musste er zugeben. Doch andererseits ergab sie in einer Art Zirkelschluss durchaus Sinn. »Pass auf: Du sprichst von Bestimmung, von einem Weg, den Gott dir zugedacht hat.«
»Wenn du Hebräisch sprichst, klingst du wie Avgay’el«, bemerkte sie.
Er sah sie kurz an und sprach dann weiter. »Dann sprichst du von der Geschichte als einem vorgezeichneten Weg.« Er zuckte mit den Achseln. »Daraus folgt, dass du möglicherweise von Anfang an ein Teil der Geschichte warst; vielleicht ist es deine Bestimmung, an der Invasion teilzunehmen.«
»Und deine, ein Verfasser der Bibel zu sein?«
Wenn die eine Annahme zutraf, dann konnte die zweite ebenso zutreffen, begriff Cheftu. Die Geschichte wurde also durch die Zukunft bestimmt? Das entsprach nicht der griechi-schen, linearen Denkweise und damit dem europäischen oder, wie er vermutete, amerikanischen Gedankengut. Zum Ausgleich folgte diese Argumentation geradezu byzantinischen Windungen, einem Vermächtnis der Labyrinthe.
Sie bewies Fantasie. Es war eine kreative Art, die Geschichte zu verweben. War es möglich, dass noch viel mehr Menschen von einer Zeit in eine andere reisten? Reisten Menschen aus Chloes Zukunft in eine Vergangenheit jenseits jener, die er und Chloe kannten?
Vielleicht waren sie gar nicht so einzigartig, wie er geglaubt hatte?
»Wenn das, was du da sagst, auch nur annähernd der Wahrheit entspricht, dann wäre, wenn ich nicht hier wäre ...«
Sie verstummte und schüttelte den Kopf. Der Regen, der vorübergehend nachgelassen hatte, setzte mit voller Wucht wieder ein. »Ein bestürzender Gedanke: kein Jerusalem für die Juden? Oder Christen? Oder Moslems?« Sie murmelte vor sich hin. »Keine Nahostkonflikte, aber auch kein Monotheismus?« Sie sah ihn an. »Wenn es kein Jerusalem gäbe, wo würde dann der Tempel erbaut? Wo würde Christus gekreuzigt? Wo würde Mohammed auf die Erde zurückkehren?«
Cheftu zog die Achseln hoch. Es erschien geradezu aberwitzig, dass ein so großer Teil der Geschichte auf diesen elfenbeinhellen Schultern lasten sollte.
»Yoav hat dich ausgesucht.«
»Aber warum? Warum mich?«
»Offenbar weiß er besser über deine militärische Erfahrung Bescheid als ich.«
»Nein, das tut er nicht. Niemand weiß von meiner militärischen Erfahrung.«
»Wirst du mir davon erzählen?« Cheftu hörte selbst, wie hoffnungsvoll er klang. Seit Jahren hatte ihn das interessiert, doch sie hatte so gut wie nie von ihrem Leben in der Moderne erzählt. Tatsächlich wusste er mehr aus RaEms Erzählungen über ihr früheres Leben als von ihr selbst. Wusste sie, wie faszinierend er sie fand?
»Klar, warum nicht?« Sie sprach nach wie vor Englisch, hatte sich also immer noch nicht beruhigt.
»Wie hast du gedient?«, fragte er.
»Ich war Offizier bei der Luftwaffe, der United States Air Force.«
Cheftu schüttelte verwundert den Kopf. »Fliegende Soldaten, mon Dieu, das ist ein Wunder! Erzähl mir alles von Anfang an.«
»Ich kam vorzeitig auf die High-School, weil ich schon in mehreren Schulen eine Klasse übersprungen hatte. Und das bedeutete, dass ich auch vorzeitig auf die Universität kam. Bei meinem Abschluss war ich erst zwanzig. Ich hatte vor, zwischendurch vielleicht fünf oder zehn Jahre als Offizier bei der Luftwaffe zu absolvieren.«
»Weshalb?«
Sie lachte. »In meiner Familie war immer ein Mitglied beim Militär. Im englischen Zweig meiner Familie kämpfen wir schon seit Cromwell. Und der amerikanische Zweig hat mir schon von frühester Kindheit an Geschichten aus dem Krieg zwischen den Staaten erzählt. Mein Vater hat in Vietnam gedient. Es war Tradition, und es war mir wichtig.«
»Aber du bist eine Frau.«
»Das ist dir aufgefallen?«, neckte sie ihn.
Cheftu küsste ihre Hand. »Schon.« Er zwinkerte. »Hat das keine Probleme gegeben?«
»Natürlich, aber das war mir gleich. Je schwieriger es wurde, desto entschlossener war ich. Ich hatte das Gefühl, die Ehre meiner Familie laste auf meinen Schultern.«
»Hat sie dich unterstützt?«
»Du machst wohl Witze. Mein Vater hat vor Wut gekocht, Mimi hat geweint, und meine Mutter hat vor Zorn einen ganzen Rosengarten ausgerissen. Nur meine Geschwister haben mich verstanden und mir den Rücken gestärkt.« Chloe verschränkte ihre Finger mit seinen. »Ich war die Letzte unter uns, die ihre töchterliche Freiheit verkündet hat. Und so ... habe ich die Ausbildung gemacht.«
Sie sah weg, als würde ihr eine ganz andere Welt vor Augen stehen.
»Ich war in Te - in dem Staat, in dem auch meine Großmutter lebte.«
»Mimi?«
»Ihr hätte bestimmt gefallen, wie du ihren Namen aussprichst, mit der Betonung auf dem zweiten mi.« Sie lächelte ihn an. In ihren grünen Augen stand düsterer Schmerz, doch sie rang ihn nieder. »Du bist so französisch.«
Cheftu gab ihr einen weiteren Kuss auf den Handrücken.
»Oui, madame. Und weiter?«
»Kurz vor ihrem Tod und vor meinen Abschlussprüfungen konnte ich sie noch einmal besuchen. Es war an einem Freitagnachmittag; die Blätter färbten sich bereits herbstlich. Ich hatte den Schlüssel zu ihrem Haus. Es war ein riesiger viktorianischer Kasten mit umlaufender Veranda.« Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Mimi saß im dunklen Wohnzimmer und weinte.« Cheftu drückte ihre Hand und gab sich alle Mühe, sie trotz ihres accent américain zu verstehen. »Sie hatte es eben von ihrem Arzt erfahren. Sie hatte Krebs.«
»Mon Dieu«, flüsterte er, und das Herz tat ihm weh. Krebs -jene unerforschliche, unbesiegbare Krankheit, die so viele Menschen völlig grundlos dahinraffte. Und das sollte bis in Chloes Zeit so bleiben? War sie denn ein unausrottbares Übel?
»Na ja, ich war gerade in meinem letzten Semester an der Universität. Ich hatte einen Zeitauftrag bei der Luftwaffe ganz in der Nähe. Mimi machte eine Chemotherapie, sie hat alles versucht, wirklich alles ... Doch nach einem Jahr, als ich im aktiven Dienst war, wurde klar, dass sie nicht länger allein zurechtkam. Mein Vater konnte nicht heimkommen, meine Mom war sporadisch mal da gewesen, aber ...« Sie seufzte. »Also bin ich zu meinem Kommandanten gegangen. Ich habe ihm erklärt, dass Mimi nicht mehr lang zu leben hätte und dass ich bei ihr bleiben wollte. Wir trafen ein Abkommen.«
Lächelnd sah sie auf. »Ich habe nicht oft gefeilscht, ich bin eine miserable Händlerin, aber dafür habe ich mit allem gekämpft, was sich angeboten hat.«
»Und was für ein Abkommen war das?«
»Ich würde aus dem aktiven Dienst ausscheiden und mich vorübergehend in den Ruhestand versetzen lassen, aber weiterhin meinen Reservistendienst ableisten. Was bedeutete, dass ich jeden Monat eine Woche und jedes Jahr einen Monat am Stück aktiv sein würde.« Sie zuckte mit den Achseln. »Mein Einsatzgebiet war sowieso der Computer.«
»Komm-pu-ter?«
Das war eine neue technische Errungenschaft das wusste er glücklicherweise von RaEm. Was genau sie beinhaltete, wusste er nicht. Doch aus RaEms Kommentaren schloss er, dass sie ebenso umwälzende Veränderungen in der Welt auslösen würde wie der Buchdruck mit beweglichen Lettern.
»Eine neue Technologie, ja.« Sie sprach immer noch Englisch. »Zum Ausgleich würde ich doppelt so lange als Reservistin dienen, abzüglich der Zeit, die ich bereits im aktiven Dienst abgeleistet hatte. Acht Jahre.« Sie stöhnte.
»Frag nicht, was RaEm mit diesem Teil meines Lebens angestellt hat. Du würdest es nicht wirklich wissen wollen. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich meine, auf diesen Dokumenten steht mein Name, mein Ruf ist davon abhängig. Mein armer Vater .«
Es war absolut dunkel und kalt. Der Winter sickerte in die Steinmauern. Chloe kuschelte sich an ihn und deckte ihn mit ihrem wollenen Umhang zu. »Glaubst du, wir kehren jemals in unsere Heimatstadt zurück?«, fragte sie. »Oder glaubst du, es ist unser Fluch, durch die Geschichte zu irren? Also kein Fluch in einem schlechten Sinn .«
»Kann Fluch denn etwas Gutes sein?«, neckte er sie.
»Vielleicht eher unsere Bestimmung.«
Er wickelte eine Strähne ihres kupferroten Haares um seinen braunen Finger. »Wäre das so schlimm, chérie?«
»Nein. Natürlich nicht. Es wäre spannend, es wäre aufregend. Vorausgesetzt, wir überleben.«
»Trifft das nicht auf jeden Tag zu jeder beliebigen Zeit zu?«, fragte er. »Ist jemals irgendetwas gewiss?«
»Aber was ist, wenn wir alt werden? Ich meine, selbst Indiana Jones hat sich irgendwann zur Ruhe gesetzt.«
Cheftu setzte sich im Schneidersitz auf. »Wer ist dieser Indiana Jones? Du hast ihn schon öfter erwähnt. War er einer deiner Lehrer?«
Sie kicherte. »Manche Lücken werden wir niemals füllen, chéri«, antwortete sie. Auf Französisch. Cheftu spürte, wie seine Sorgen sich ein wenig aufhellten; es ging ihr schon wieder besser.
»Yoav wusste also nichts von deiner militärischen Ausbildung?«
»Mein Computerwissen hätte ihm kaum geholfen«, meinte sie trocken. »Doch ihm war klar, dass ich eine Ausbildung gemacht hatte. Das war wahrscheinlich nicht zu übersehen.«
Wieder auf Englisch.
»Und damit hat er dich ausgesucht?«
»Wenn ich nicht hier gewesen wäre, dann wäre was - Jerusalem möglicherweise nicht erobert worden?« Sie lachte bitter. »Das kann doch nicht wahr sein.«
»Vielleicht gab es noch einen zweiten Plan. Vielleicht tausend weitere Pläne für tausend weitere Seelen«, entgegnete er. »Wenn du dich dagegen entschieden hättest, hätte es ein anderer tun müssen. Doch das hast du nicht.«
»Ich habe dir das noch nie gesagt, Cheftu, aber du spinnst.«
»Weil du nur eine einzige Frau bist?« »So wichtig kann ich unmöglich sein. Ich bin nur ein winziges Rädchen im Getriebe. Ich bin eine moderne Frau. Wir sind hier im Altertum, ich kann unmöglich so bedeutsam sein!«
»Wahrscheinlich hast du Recht«, pflichtete er ihr bei. Es war verrückt. »Wenn du nicht gewesen wärst, dann hätte es jemand anderer getan. Du hast wahrscheinlich Recht.«
»Und wenn ich mich irre?«, fragte sie nervös.
Er richtete sich auf, legte die Hand in ihren Nacken und massierte die Knötchen weg. »Gott hat dich aus deiner Familie gerissen und dich in meine Zeit geschickt. Hatschepsuts Zeit, haut«
Wieder nickte sie.
»Von dort aus hat er dich nach Aztlan gebracht?«
»Ken.«
»Jetzt bist du hier. Und du bist bereits von einer getreidemahlenden Sklavin zu einer Gefährtin von Daduas Gemahlinnen aufgestiegen. Du hast die Begegnung mit RaEm überlebt!«
»Du auch.« Sie lachte.
»Zu mir kommen wir später«, winkte Cheftu ab. »Lass dir das einmal durch den Kopf gehen, Geliebte. Ist Gott nicht groß genug, dich von allen Irrtümern abzuhalten, falls sie tatsächlich so allumfassend sein sollten?«
Sie hatte den Kopf gesenkt und schwieg. »Ich glaube an den freien Willen«, sagte sie schließlich.
»Du hast jeden Tag die freie Wahl«, antwortete Cheftu. »Doch just deine Angst vor einem Irrtum, dein Bedürfnis, das Richtige zu tun, haben dich zu einem Werkzeug Gottes werden lassen.«
»Also sind wir jetzt fertig? Wir können uns in Davids Jerusalem zur Ruhe setzen? Wo man eine Verlobung eingehen kann, indem man eine Frau vergewaltigt?« Plötzlich wurde ihre Stimme schrill, und er hörte ihren Abscheu, ihre Angst. »Und was ist, wenn wir ein kleines Mädchen bekommen?«
Seine Hand erstarrte auf ihrer Schulter. »Wäre das möglich?«
Sie zuckte mit den Achseln. »In diesem Monat nicht.«
Er legte einen Finger unter ihr Kinn. »Es gibt immer noch den nächsten Monat und den Monat danach. Ich werde niemals müde, dich zu lieben, chérie.«
Chloe nahm seine Hand in ihre und rückte näher an ihn heran, bis sie Knie an Knie im Schneidersitz saßen wie zwei Schreiber. »Wenn du mich ansiehst, dann weiß ich, dass die Zeitsprünge in unserem Leben nichts zu bedeuten haben, dass auch unsere unterschiedlichen Herkunftszeiten nichts zu bedeuten haben. Wenn mich jemals jemand geheilt oder gekannt hat, dann du.«
Cheftu las eben das jüngste Schreiben aus Ägypten, das der ägyptische Bote überbracht hatte, der nicht bei den Ägyptern bleiben wollte. Äußerst merkwürdig. Diesem Dokument zufolge regierte nun Pharao Tutenchaton. Echnaton oder der Aton wurden mit keinem Wort erwähnt. Wusste RaEm alias Se-menchkare, dass sie vom Thron gestoßen worden war?
War Tutenchaton nicht der kleine Junge aus dem Lager der Ägypter? Wichtiger noch, hatte RaEm ihn nicht unter ihre Fittiche genommen? Cheftu rätselte darüber nach, als er ein diskretes Räuspern hörte. Er drehte sich um. »N’tan!«
»Chavsha«, erwiderte der Tzadik.
Er zog die Tür hinter sich zu und schloss damit den Lärm der tsorischen Bauarbeiter und den allgegenwärtigen Kalkstaub aus.
Der Arzt in Cheftu stellte fest, dass der Mann nicht gesund aussah. Den Tod seiner Frau hatte er tapfer ertragen, doch in seinem Blick lag eine Trauer, die, so fürchtete Cheftu, womöglich nie wieder weichen würde. Chloe zufolge standen die Frauen schon Schlange, um zu sehen, wer seine nächste Braut würde, doch N’tan würdigte sie keines Blickes.
Unter den Augen lagen dunkle Ringe, und seine Hände zitterten.
»Setz dich, mein Freund«, sagte Cheftu. »Soll ich Wein bringen lassen? Oder einen Kräutertee?«
Er ging um seinen Tisch herum und setzte sich N’tan gegenüber.
»Sag, was ist geschehen?«
N’tan zupfte nervös an seinem Bart. Es fiel ihm schwer, Cheftu in die Augen zu sehen. »Ich fürchte, dass ich schwer gefehlt habe.«
»Warum das?«
»Der Tempel, das Haus Gottes.«
Cheftu spürte, wie ihm der Atem stockte.
»Bislang habe ich Dadua erklärt, dass er einen Tempel, ein Haus für Shaday bauen sollte, wenn ihm das richtig erschien. Doch in der Nacht plagen mich Träume.« N’tan schüttelte sich. »Grässliche Träume. Sobald ich aufwache, kann ich mich nicht mehr an sie erinnern, doch die Botschaft ist eindeutig.«
Cheftu nickte stumm.
»Dadua ist in Blut gebadet. Seine Absicht war es, ein Volk zusammenzuschmieden, es aus dem Fleisch unserer Nachbarn herauszuschneiden.« Wieder schauderte N’tan. »Einer seiner Söhne wird den Tempel erbauen, ein Mann des Friedens, so wie Dadua ein Mann des Krieges ist.«
Wieder nickte Cheftu.
»Es ist gefährlich, wenn der Tzadik seine Meinung ändert. Und darum wende ich mich an dich.«
»An mich?«
»Du trägst die magischen Steine bei dir.« N’tan wandte den Blick ab. »Das haben meine Vorväter mir niedergeschrieben, das wurde von einem Imhotep zum nächsten weitergegeben. Sie sagen dir, was richtig ist. Kannst du sie fragen, ob ich Da-dua sagen soll, dass er den Tempel nicht bauen darf? Kannst du mir Gewissheit verschaffen?«
Cheftu zog sie aus seiner Schärpe, denn es bestand keine Notwendigkeit mehr, sie an einem anderen, schwerer einzu-sehenden Platz aufzubewahren. Sie wärmten seine Hände und begannen zu zucken, sobald er sie zusammenführte. »Was willst du sie fragen?«
»Ob meine Träume wahr sind.«
»L-O, L-O.«
N’tan verstummte abrupt. »Frage sie, ob ich meine Träume richtig deute.«
Cheftu stellte die Frage und warf die Steine aus. Die Antwort war knapp und eindeutig.
»K-E-N.«
»Willst du noch mehr wissen?«
N’tan lächelte zaghaft. »Wie wütend wird Dadua sein?«, fragte er ironisch. Dann streckte er die Schultern durch. »Das will ich gar nicht wissen, nicht wirklich. Seine Reaktion tut nichts zur Sache.
Ich bin zum Tzadik berufen. Diese Last muss ich tragen. To-dah rabah, mein Freund.«
»Shalom, N’tan«, sagte Cheftu, während der Prophet bereits die Tür hinter sich schloss.
Cheftu sank auf die Knie, denn ihm standen die Worte so deutlich vor Augen, als läge die Heilige Schrift aufgeschlagen vor ihm:
»Geh hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Kinder Israel aus Ägypten führte bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Kindern Israels umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk zu weiden: Warum baut ihr mir nicht ein Haus?
Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr, der Allmächtige: Ich habe dich genommen von den Schafhütern und von den Herden, dass du über mein Volk Israel herrschen sollst. Ich war mit dir, wo du auch hingegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir gefällt.
Und ich will dir einen großen Namen machen gleich den Größten der Erde. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen, wie sie es vormals taten und von jeher, seit ich die Richter über mein Volk Israel ernannte. Und alle deine Feinde will ich unterwerfen.
Und ich verkünde dir, dass der Herr dir ein Haus erbauen wird. Wenn deine Zeit um ist und du zu deinen Vätern eingehst, dann will ich dir einen Sohn erwecken und sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich.«
Cheftu wusste nicht wie oder wieso, doch dies waren Gottes Worte, die durch alle Zeiten hindurch weiterleben würden. Davids Thron würde für alle Zeiten bestätigt. Er war Gottes Liebling, die Verkörperung der göttlichen Nishmat ha hayyim und erfüllt mit dem Eifer Shadays. Dafür würde er in Ehren gehalten.
Und durch ihn würden alle Erdenbewohner gesegnet. Cheftus Stirn berührte den Boden, und er flüsterte: »Sela.« Draußen grummelte der Donner.
Es begann wieder zu regnen.
Die Schweigsame, Bathseba, hatte kein Wort mehr gesprochen. Wir hatten uns um sie versammelt, als Ersatzfamilie der Braut. Lustlos starrte sie ins Leere. Shana und Hag’it hatten ihr die Haare zu Locken gedreht und dann ihr Gesicht mit einem leichten Rosa und Rauchgrau geschminkt.
Avgay’el hatte ihr ein Kleid in Rot, der Farbe der Freude, geliehen. Es war mit Silber und Gold bestickt und um den Hals mit winzigen Perlen besetzt. Ein Mitgiftstirnband mit den silbernen Münzen ergänzte den Halsschmuck aus Silbermünzen.
Sie setzte sich.
Die Atmosphäre war gezwungen, aber daran war wohl nichts zu ändern. Mir kam das barbarisch vor, dennoch war dies hier für sie besser als ein Leben als einfache Sklavin, nicht wahr? Schließlich musste Bathseba Uri’a und später, tja, Dadua heiraten, denn woher sollte andernfalls Salomon kommen?
Und wenn es keinen Salomon gab ... keine Ahnung.
Oder war es so, wie Cheftu angedeutet hatte: In Wahrheit gab es tausend Möglichkeiten, tausend andere Seelen, und wenn es nicht auf diese Weise geschah, dann würde ein anderer Weg eingeschlagen? Mein Geist sperrte sich gegen das Konzept alternativer Wirklichkeiten; das schmeckte mir zu sehr nach Science-fiction.
Indem wir eine Entscheidung trafen, sollten wir in ein ganz anderes Universum von Entscheidungen treten? Waren alle durch Fäden untereinander verbunden wie in einem riesigen Spinnennetz? Wäre ich nicht hier in Jerusalem gewesen, hätte dann eine andere Frau meinen Part übernommen, und ich wäre in der Schlacht von Ashqelon umgekommen?
Es war besser, wenn ich mich an die nahe liegende Aufgabe hielt, ‘Shevas Hände und Füße mit Henna zu verzieren. Die Frauen tanzten und tranken, während ich bei der Schweigsamen saß. Sie streckte mir die Handflächen entgegen.
»HaMelekh wird mich sehen«, flüsterte sie. »Machst du mich schön?«
Die Ironie dieser Frage war fast unglaublich, doch ich griff zu den Pinseln. Sie war mir nie wie eine Blumenliebhaberin vorgekommen; die meisten Hennazeichnungen, die ich gesehen hatte, rankten sich um Blumen.
Regentropfen!
Sie hatte lange, dünne Hände; eigenartig, dass mir das nie aufgefallen war. Perfekte Hände für eine Tänzerin, ausdrucksvoll und eloquent. Nachdem ich das Ende des Hennastäbchens, das mir als Pinsel diente, eingetaucht hatte, malte ich ein winziges Paisleymuster von lauter kleinen Regentropfen auf ihre
Finger. Dann umgab ich sie mit Pünktchen. Danach folgte ihre Handfläche.
»Was gefällt dir?« Mein Flüstern wurde fast von dem Lachen der Frauen übertönt.
»Die Regentropfen«, antwortete sie.
»Die habe ich schon.«
»Blätter.«
Blätter würden zu sehr nach Regentropfen aussehen, dachte ich. »Und was noch?«
»Sterne.«
Ich betrachtete ihre Handflächen. Die Linien schienen sich in zwei Richtungen aufzuteilen, wobei eine zum Venusberg verlief und die andere an der Außenkante verschwand. Ich folgte den Falten und verband sie dann. Es war ein Dreieck, das auf Grund seiner Schwünge sehr islamisch aussah.
»Sterne«, wiederholte sie.
Ich legte ein zweites, ebenso verwinkeltes und geschwungenes Dreieck über das erste. Danach malte ich, nur um die leeren Flächen zu füllen, Regentropfen, die davon wegflogen. In der anderen Hand wiederholte ich das Muster. Die Sterne sahen ein wenig nach jüdischen Sternen aus, doch schließlich war sie ein gutes jüdisches Mädchen, was also war daran auszusetzen? Als ich fertig war, stießen wir noch einmal gemeinsam auf sie an und gruppierten uns dann als Leibwache um sie herum, bevor wir, da es draußen kalt und nass war, in einer der erst kürzlich fertig gestellten Zedernräume auf Uri’a trafen. ‘Sheva zitterte nicht mehr; im Gegenteil, sie schritt voller Anmut und Stolz dahin, und ihr fließendes, platinsilbernes Haar stand in deutlichem Kontrast zu ihrem roten Kleid.
Der Klingone wartete unter dem Hochzeitshimmel auf sie. Da er sie bereits in Besitz genommen hatte, gab es keine große Feier.
Ihre Familie war nicht gekommen - falls sie überhaupt in Jerusalem war. Nur N’tan, Dadua und die Frauen aus dem Harem
waren anwesend.
Die Zeremonie war schnell erledigt, dann folgte das Festmahl. Alle aßen wenig und tranken viel, und dann nahm Uri’a seine Braut hoch, um sie in sein Heim zu tragen.
»Warte!«, rief Dadua. »Als König, Gibori, steht es mir zu, die Braut zu küssen!«
Wir lachten. Unter normalen Umständen wäre das ein unschuldiger Scherz gewesen. Doch heute wirkte es gezwungen. Trotzdem war ich ihm dafür dankbar, denn die Schweigsame wünschte sich nichts sehnlicher im Leben, als von David geküsst zu werden und im Regen zu tanzen. Würde sich dadurch die Geschichte verändern? Hatte sie das schon? Uri’a setzte sie ab, dann nahm Dadua ihre Hände in seine und sah ihr ins Gesicht.
Atmeten alle anderen ebenfalls schneller? Ich konnte kaum glauben, was ich da sah!
»Uri’a ist ein guter Mann. Er ist mir treu ergeben. Sei du ihm ebenfalls treu ergeben.« ‘Sheva glotzte ihn an, als hätte er nur für sie die Sterne an den Himmel gehängt, die Sterne, die ihr so gut gefielen. »Möge Shaday dich mit vielen Kindern segnen«, fuhr Dadua fort. »Mögen diese Kinder heranwachsen und den Stämmen Gutes erweisen.« Sie legte den Kopf in den Nacken, damit er sie besser küssen konnte. Doch Dadua küsste stattdes-sen erst ihre eine Handfläche, dann die andere. Er sah stirnrunzelnd auf mein Hennamuster und küsste nochmals ihre Handfläche. Uri’a hob ‘Sheva hoch, die vor Enttäuschung wie durch die Mangel gezogen wirkte, und trug sie davon.
Ein Donnern brachte das Gebäude zum Erbeben. Avgay’el lud mich ein, bei ihr zu bleiben und in den friedlichen Frauengemächern abzuwarten, bis Cheftu mit seiner Arbeit fertig war. Ich war schon eingeschlafen, als Avgay’el mich sanft wach rüttelte. Leise sagte sie: »Dadua möchte dich sehen.«
Ich spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht und ging mit Shana in einen kleineren Audienzraum. Dort war Yoav, der mit ernster Miene einen Papyrus studierte. Dadua sprang auf, sobald er mich erblickte. »Möchtest du Wein, Klo-ee?«
»B’seder«, sagte ich.
»Der Tempel, ach, nun, Shaday will nicht, dass ich ihn erbaue.«
Das hatte Cheftu bereits erwähnt; und das stimmte auch mit der Bibel überein, so wie ich sie kannte.
»Darum möchte ich jetzt eine Uniform machen lassen, die alle Giborim tragen sollen.«
Die professionelle Ausrüstung der Ägypter und Pelesti hatte seinen Neid geweckt?
»Yoav«, sagte er und deutete dabei auf den Rosh Tsor haHa-gana, »hat bei deinen Verwandten, den Pelesti in Ashdoid, bereits Schilde in Auftrag gegeben.«
Ich nickte.
»Vielleicht könntest du mit ihnen reden und bessere Konditionen für uns vereinbaren?«
Ich nickte; allmählich wurde ich besser im Feilschen, und ich würde Cheftu mitnehmen. Vielleicht würde ich sogar Wadia zu sehen bekommen?
Dadua trat vor mich hin. Er war mir so nahe, dass ich seine Haut riechen konnte. Die Schweigsame hätte mich umgebracht, um jetzt an meiner Stelle zu sein. »Ich war auf der Suche nach einem Emblem, der Tziyon, unsere Lage hier, symbolisieren sollte.« Er hob frustriert die Hände. »Doch mir will nichts, aber auch gar nichts einfallen. Nicht einmal Hirams geschickte und begabte Zeichner können mir helfen.«
»Ken?«
»Doch heute, bei der Hochzeit des Mädchens, habe ich es gesehen!«
»Was gesehen?«
»Das Zeichen! Es ist doch ganz eindeutig«, rief Dadua aus. »Ein Sinnbild für Tziyon, für die vereinte Monarchie!«
Ich hielt den Atem an.
»Das! Das ist es!« Er zerrte einen Papyrus hervor. Dort war mit weitaus weniger Eleganz als im Original mein Muster aus der Hand der Schweigsamen nachgezeichnet. Ohne Schwünge, Kurven und Winkel war es ein schlichtes Dreieck.
Über dem umgedreht ein zweites Dreieck lag.
»Es hat oben drei Spitzen, entsprechend den drei heiligen Städten im Norden, und unten drei Spitzen, entsprechend den heiligen Städten im Süden. Und in Tziyon überschneiden sich beide!«
Ich starrte auf den Papyrus. Zwei Dreiecke, die sich wahrhaftig überschnitten.
»Und so leicht zu zeichnen! Wir können es überall anbringen!«
Ich mag Sterne, hatte die Schweigsame gesagt.
Darum hatte ich ihr einen gezeichnet. Aus zwei Dreiecken. Ein Mann namens David, der eben einen Staat gegründet hatte, hatte ihn gesehen. Er hatte ihm gefallen. Und er hatte beschlossen, ihn zu verwenden.
Ob ich das wohl in meinem Lebenslauf verwenden konnte?
»Das wird das Schild Shalems sein, denn diese Stadt soll eine Stadt des Friedens sein, eine Stadt Shadays. Perfekt!«
Ich hatte den Schild Salomons entworfen, auch Davidsstern genannt, denn schließlich wusste ich aus der Geschichte, dass dies der Davidsstern werden würde. Ich hatte eben - irgendwie
- Geschichte gemacht. Darüber konnte ich nur noch lachen. Mein Leben schien nur noch aus Zirkelschlüssen zu bestehen.
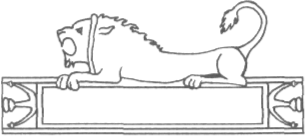
»Es erfreut mich, dass du zu meiner Feier gekommen bist«, sagte RaEm und lehnte sich zurück.
Dadua stand in ihrer Tür, von mehreren Soldaten flankiert. Die Zelte ihres Volkes waren nicht gegen den Regen gerüstet, darum hatten ihre Soldaten von den Tsori gelernt, Bäume zu fällen. Nun schützte ein hölzernes Dach ihr Zelt, verdüsterte es aber auch. Und die Kälte war durch nichts abzuhalten. Sie zitterte, doch als haNasis Blick kurz auf ihre steifen Brustwarzen fiel, schickte RaEm ein knappes Dankgebet zu den Göttern der Kälte.
»Bitte mach es dir bequem, Adoni«, lud sie ihn in jener Sprache ein, die ihr immer noch so fremd war. Dennoch, während der Sommerhitze hatte sie wenig anderes zu tun gehabt. »Deine Soldaten können es sich im Zelt nebenan gemütlich machen. Meine Sklavinnen werden dafür sorgen, dass unsere Wünsche erfüllt werden.«
Er hatte schwarze Augen, fast wie Hiram, doch in seinen lag schon beinahe zu viel Seele. Dadurch schien der diesbezügliche Mangel in ihren noch deutlicher hervorzutreten.
Er schickte seine Männer fort und gesellte sich zu ihr. Um sich seinen Sitten anzupassen, hatte sie einen niedrigen Tisch, umgeben von Seidenkissen, decken lassen. Überall im Raum glomm in Brandschalen Weihrauch, der Wärme und Duft spendete. Dadua ließ sich auf der anderen Seite des vergoldeten
Tisches nieder und streckte seinen Körper ihr gegenüber aus.
RaEm schenkte Wein ein und reichte ihn Dadua. »Auf die Vereinigung unserer beiden Völker«, sagte sie.
Er hielt den Becher an die Lippen und schluckte, doch ihr war klar, dass er nichts getrunken hatte. »Verzeih, Adoni«, sagte sie und nahm ihm den Becher wieder ab. »Wir kennen beide die Intrigen des Hofes nur zu gut, nicht wahr?« Sie nahm einen Schluck und fragte sich im gleichen Moment, wie viel von der zerstoßenen Alraunwurzel dadurch wohl in ihre Adern gelangte. »Jetzt weißt du, dass dir nichts passieren wird.« Sie gab ihm den Becher zurück.
Damit war es eine Frage der Ehre; nun würde er in vollen Zügen trinken müssen, wenn er den Pharao Ägyptens nicht als möglichen Mörder beleidigen wollte. Er leerte seinen Becher, und sie seufzte erleichtert. Es würde ein Leichtes sein; sie hätte mehr Vertrauen in sich haben sollen. Nur sein ruhiger Atem und sein allmächtiger, strenger Gott machten sie nervös.
Mit einem Lächeln rief sie die Sklavinnen herein. Sie trugen nichts als Perlenschnüre und Perücken, waren rasiert und parfümiert und allein auf Grund ihrer Schönheit und der Eleganz ihrer Bewegungen ausgesucht. Und dazu ausersehen, die Leidenschaft dieses Königs zu entfachen.
Er folgte ihnen mit Blicken, während er gleichzeitig mit RaEm beiläufig über die Landwirtschaft und den Hof plauderte. Sie stellte ihm absichtlich nur Fragen, die er im Schlaf beantworten konnte. Die Mädchen bedienten ihn, strichen dabei an seinem Körper vorbei, füllten seinen Becher nach und brachten dadurch noch mehr Alraunwurzel in seinen bereits erregten Leib.
RaEm dankte den Göttern. Alles lief nach Plan.
Je kühler der Abend draußen wurde, desto höher stieg die Temperatur im Zelt. Daduas Gesicht war gerötet, seine Augen glänzten, er begann zu lallen. RaEm spürte, wie zum ersten Mal seit vielen Monaten die Begierde in ihr erwachte. Die
Lampen blakten; hinter einem Vorhang spielte eine einsame Flöte. Sie lachte, er scherzte, ihre gelegentlichen Berührungen wurden bedeutungsschwangerer, bis er RaEm, während sie, auf seinen Schenkel gestützt, eine Geschichte erzählte, unvermittelt unterbrach.
»Bist du ein Mann oder eine Frau?«
RaEm warf den Kopf zurück und lachte. Genau das hatte sie gewollt. Mit zittrigen Fingern löste sie die Schließe an ihrem Kleid. Ihre Brüste waren schmählich zu sehen, doch immer noch empfindsam. Sie drehte sich um, sodass sie vor ihm auf den Fersen saß. Er verfolgte, wie ihre vergoldeten Fingernägel über ihren Leib wanderten und die festen Brustwarzen kniffen. Er starrte sie an und klappte den Mund auf. »Was glaubst du denn, Adoni?«, fragte sie. RaEm fasste nach seiner Hand und legte sie auf ihre Brust. Instinktiv umfasste er sie, während sein dunkler Blick sich auf ihr Gesicht heftete.
Seine Hände glitten über ihre Schulter an ihren Hals und zogen sie heran. Sein Mund war heiß und beweglich. Er küsste genauso wie er kämpfte, wie er verhandelte, wie er auch alles andere tat: Er verführte ganz langsam ihren Mund. Seine andere Hand wanderte über ihren nackten Rücken, schmiegte sich um ihre Hinterbacke und drückte sie an seinen Leib.
»Und wie kommt es, dass du der Ko-Regent Ägyptens bist?«, fragte er RaEm, ehe er ihr einen tiefen Kuss gab. Seine Finger schlüpften unter ihren Schurz und stellten fest, dass sie warm und feucht war.
»Pharao ... ist ... mein Schwiegervater«, hauchte RaEm und betete zugleich, dass er nicht aufhören möge, sie zu berühren. Es war so lange her; es war ein so gutes Gefühl.
»Er hat noch einen Sohn?« Er nuckelte an ihrer Brust.
»Seine Tochter Meritaton.« Sie sprach nur noch undeutlich, so intensiv spürte sie die Hitze ihres Körpers und seine Begierde.
Er erstarrte.
RaEm wand sich unter seinen Händen. »Keine Angst, wir verstoßen nicht gegen eure Gesetze. Sie ist gestorben.« Bitte, Hathor, lass ihn nicht aufhören, dachte sie. Seine Finger rollten sich in ihr ein. »Du warst mit einer Frau verheiratet?« Seine Stimme klang schlagartig klarer. »Es war eine politische Heirat.« Der Nebel in RaEms Hirn verflog in Windeseile, weil er nur noch sprach und sie nicht mehr berührte.
Mit einer einzigen Bewegung stieß er sie von sich, tauchte seine Finger in Wein und schmierte sie sich über den Mund. »Du Ungeheuer! Du warst mit einer Frau verheiratet?«
Sie hatte ihr Hemd abgelegt, und ihr Schurz hatte sich um ihre Taille gewickelt; sie war vollkommen entblößt.
»Es war eine politische Heirat!«
»Was für ein Monstrum bist du eigentlich?« Mühsam kam er auf die Füße. »Mit wem hätte ich mich da um ein Haar eingelassen?« Er spuckte aus und wischte die Finger an der Tischdecke ab.
RaEm tobte vor Zorn. »Vielleicht solltest du dir diese Frage wirklich stellen, Adoni«, fauchte sie. »Wie würden es deine Priester wohl aufnehmen, dass du mit dem Pharao Ägyptens, einem Mann, zusammen warst? Jeder meiner Sklaven würde beschwören, dass ich dich in die Knie gezwungen und wie ein Schwein bestiegen habe!«
Er zuckte zurück, als hätte sie ihn geohrfeigt. »Niemand würde es wagen anzudeuten, dass ich kein richtiger Mann bin, das kann sich niemand auch nur im Traum ausmalen.«
»Was willst du von mir, Semenchkare, falls du wirklich so heißt?«
»Du hast Gold. Das will ich.«
»Ach! Gier! Ich hätte es wissen müssen!«
»Deine fünfzig pelestischen Schilde, dann ziehe ich ganz friedlich ab.«
Sein Blick tastete sie von oben bis unten ab. Dann schüttelte er den Kopf. »Kein Wunder, dass Shaday uns aus Ägypten führen wollte. Du bist ein korruptes, niederträchtiges Scheusal. Du kannst erzählen, was du willst und wem du willst. Ich fürchte dich nicht.«
»Das solltest du aber!«, zischte RaEm. »Ich habe mehr Macht in dieser und der nächsten Welt, als du dir vorstellen kannst. Ich kann über den Blitz gebieten. Tausende würden für mich in den Tod gehen, sollte ich es nur wünschen. Ich kenne die Zukunft!« Sie schlotterte am ganzen Leib, so viel Kraft kostete es sie, gegen die Alraunwurzel anzukämpfen und gegen seinen Abscheu zu bestehen.
Er lachte. »Wenn du wirklich so mächtig bist, warum hältst du dann einen achtjährigen Jungen als Geisel, warum willst du einen Mann verführen, der dich für widerwärtig hält, und warum brauchst du dann mein Gold?«
Mit einem zornigen Aufschrei schnappte RaEm ihren Dolch und stürzte sich auf Dadua. Sie spürte, wie die Klinge sich in Fleisch senkte, dann wurde sie zur Seite geschleudert. Ein anderer Mann sprach sie mit schwerem Akzent auf Ägyptisch an. »Das war ein Mordversuch, Pharao. Wenn du keinen Krieg willst, dann verlasse unser Land.«
Sie blickte auf. Der große grünäugige Soldat schubste den Leichnam eines Mädchens, eines ägyptischen Sklavenmädchens, beiseite, in dessen Brust ein Dolch steckte. Dadua war umgefallen, aber nicht getroffen worden. RaEm hatte eine der ihren getötet. Ihr Blick traf auf Daduas. »Wenn du dein falsches Spiel weiterspielen willst«, sagte er, »dann solltest du deinen Frauenkörper verhüllen.«
RaEm sah an sich herab. Sie war nackt. Eine Frau.
Und machtlos.
Wieder einmal hatten wir uns versammelt - diesmal auf königliches Geheiß. Wo zuvor gelärmt worden war, herrschte nun Stille. Wo zuvor gezecht und gefeiert worden war, wurde nun gefastet. Wo die Atmosphäre ausgelassen und fröhlich gewesen
war, lag nun Ehrerbietung und Furcht in der Luft.
Wo zuvor die Sonne geschienen hatte, standen wir nun im strömenden Regen.
Wieder wurden die Tore geöffnet. Statt auf einem Karren zu fahren, hing der Thron nun zwischen goldenen Stangen und wurde wie eine Sänfte von den Levim getragen. Die Elohim hielten einander bei den Händen, und ihre geschwungenen Flügel schirmten den Deckel der Truhe vor den Regentropfen ab.
Ich zitterte. Ich würde sie gar nicht beachten. Ich wollte nicht wirklich wissen, ob sie sich bewegten oder nicht. Lieber redete ich mir ein, dass ich betrunken gewesen war. Nur dass niemand Wein dabei gehabt hatte.
Die blau und weiß gekleideten Levim traten mit dem schwebenden Thron vor. Mit ernster Miene schritten sie bedächtig wie ein Trauerzug dahin. Die Stangen, auf denen der Thron lagerte, waren mindestens drei Meter lang, und je drei Männer trugen ein Ende, in sicherem Abstand zu der Truhe.
Die Lade musste erheblich schwerer sein, als Indiana Jones geglaubt hatte.
In den mit Edelsteinen besetzten Brustpanzer des Hohen Priesters und einen schlichten Sklavenschurz gekleidet, ging Dadua vor dem Thron her. Ohne Krone und ohne Geschmeide, denn heute war er kein König, sondern ein Bittsteller.
Nach dem siebten Schritt blieb Dadua stehen. N’tan führte einen reinen, weißen und gesunden Ochsen herbei. Unter Gebeten schlitzte er dem Tier den Hals durch und verspritzte das Blut. Es sickerte in den Boden, vermischte sich mit dem Regen und lief den Levim zwischen den nackten Zehen hindurch.
Ich wagte einen hastigen Blick auf die zwei goldenen Figuren oben auf der Truhe. Waren sie einander näher gekommen? Frag nicht, schau nicht hin, ermahnte ich mich selbst.
Als der Ochse verendet war, wurde er von drei Levim weggeschleift. Alle warteten in angespannter Stille. Dadua, dem der Regen die Blutspritzer von den Beinen wusch, trat einen Schritt
vor.
Nichts geschah.
N’tan blies den Shofar, während die Levim weitergingen. Und zusammentraten. Alle warteten gespannt. Nichts geschah. Die Menschen der Stämme atmeten wie ein Mann aus. In gemessenem Tempo bewegte sich der Thron auf Gottes Tziyon zu. Nach weiteren sieben Schritten wurde der zweite Ochse geopfert.
Die gesamte Gruppe bewegte sich in der Geschwindigkeit des Thrones. Ich warf einen ängstlichen Blick auf die Statuen der Elohim. Hatten sie sich bewegt? Vielleicht sogar aufeinander zu? Hatten sie sich vorhin nicht nur an den Händen gehalten? Mit jedem Schritt löste sich die Spannung der Anwesenden mehr, dennoch war deutlich zu spüren, welche Bedeutung dieser Augenblick hatte.
Das Wetter schlug um, es blieb kühl, denn immerhin war es Dezember, doch es hörte auf zu regnen.
Noch unterwegs begannen die Levim Daduas neueste Komposition vorzutragen. Wir lauschten dem Anfang der Psalmen. Ich drückte Cheftus Hand. Sein Blick war wie hypnotisiert auf die Bundeslade gerichtet, doch er erwiderte meinen Händedruck.
»Die Erde ist Shadays und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn Er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet.
Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an Seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug. Nur der wird den Segen Shadays empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das da sucht Dein Antlitz, Gott unserer Vorväter.
Machet die Tore weit und die alten Türen hoch, dass Shaday, der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre?
Er ist el Elyon, der Starke und Mächtige, der Gott des Krieges, der Gott des Sieges.«
Dadua sang den Vers ein zweites Mal und forderte dann die Menschen auf einzustimmen.
Die Schönheit der Musik verschlug mir die Sprache. Auch wenn sie die für die Musik des Nahen Ostens typischen an-tiphonalen Grundelemente aufwies, verliehen ihr die Stimmen der uns umgebenden Chorknaben doch eine Unschuld und Majestät, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. Und in der Höhe wartete Tziyon, wo die Sonne durch die Wolken brach und den Stein mit rosafarbenem Licht überzuckerte.
»Machet die Tore weit«, sangen die Chorknaben.
Dadua schritt immer noch ehrfürchtig und mit flehend erhobenen Händen vor dem Thron her. Er ging dort, weil er keinesfalls wollte, dass sich jemand anderes in Gefahr begab, hatte Cheftu ihr erläutert. Die Giborim hatten gegen diese Geste Protest eingelegt, doch er war nicht auf ihre Bedenken eingegangen. Er sei für das Königreich und für dessen Beschlüsse verantwortlich, hatte er erklärt. Er würde vor Shadays Antlitz stehen. Wenn jemand niedergeschlagen werden sollte, dann er.
Er war ein wahrer Anführer.
Die Sonne verschwand hinter der nächsten Wolke, und schlagartig kühlte es ab. Die Stadttore, an denen sich schweigend die Stammesangehörigen drängten, standen weit offen.
Die Levim hielten an, Dadua blieb stehen. Worauf warteten wir? Ein mächtiger Wind zog über uns hinweg, fast als wollte die Luft die Versammelten mit Gewalt in die Stadt hineintreiben. Ich hatte diesen Wind schon früher gespürt, und zwar bei meinen Zeitreisen. Cheftus Hand schloss sich fester um meine.
Dann ergoss sich wie auf einem Renaissancegemälde ein Lichtstrahl durch die Wolken, durch ein Loch genau über Da-dua. Reglos stand er da, mit gesenktem Haupt, die Hände ehrfürchtig zum Himmel erhoben. Der Sonnenstrahl wurde intensiver, er ließ die roten, grünen, blauen und orangefarbenen Juwelen auf Daduas Brust aufflammen und das mahagonibraune
Haar auf seinem Kopf zu einem Heiligenschein erstrahlen.
Wir sahen, wie die Sonne ihn umhüllte. Vor unseren Augen wurde er mit Gold überzogen - ein ebenso göttliches und rätselhaftes himmlisches Sprachrohr wie die Elohim auf dem Thron.
Dann begann er zu tanzen, in einer Explosion von Bewegungen, die wir kaum mit Blicken nachzuvollziehen vermochten. Nicht wie in der Tanzschule: vorwärts, seitwärts, rückwärts, Schluss. Nein, wie Barischnikow oder Astaire und mit erstaunlicher Akrobatik.
Die Chorjungen begannen wieder zu singen, die Levim schritten weiter, wobei der Thron sacht zwischen ihnen schaukelte. Dann stockte den Menschen der Atem, denn der König der Stämme - der König Israels - warf seinen Schurz von sich.
Was tat er da? Was dachte er sich dabei? Der König war nackt?
Dadua tanzte.
Er tanzte in überschwänglicher Freude vor Shaday. Er tanzte mit jener Freude, die einen am Ende eines phantastischen Tages erfüllt - wo man tanzt, weil man einfach nicht still sitzen kann. Er tanzte, weil das Leben so gut ist. Weil er Leben und Blut in sich spürte.
Dadua tanzte nackt - befreit von der Last seines Ichs, seines Stolzes, seiner Scham. Ohne jeden sexuellen Unterton, sondern unbekleidet zum Ruhme des Menschseins, ein Geschöpf nach Gottes Ebenbild und ein Schöpfer wie Gott selbst.
Dadua tanzte nackt mit Gott.
Wir drängten in Tziyons schmale, sich überlagernde Straßen und folgten dabei der Menge, die sich dem Gesang der Chorknaben angeschlossen hatte und Gott pries - und nicht mehr sich selbst als Besitzer der Bundeslade. Die Menschen freuten sich, sie waren begeistert, doch diesmal waren sie auf das Ewige konzentriert, nicht auf sich selbst.
War dies der einzige Unterschied zwischen dem ersten Einzug und diesem? Und doch war es ein alles entscheidender.
»Machet die Tore weit und die alten Türen hoch, dass Shaday, der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre?
Er ist el Elyon, der Starke und Mächtige, der Gott des Krieges, der Gott des Sieges.«
Ich warf Cheftu einen schnellen Blick zu. Ob er wohl fassen konnte, wo wir uns befanden? Und in welcher Zeit?
Alle miteinander - Jebusi, die Angehörigen der Stämme, Männer und Frauen, Sklaven und Freie - folgten wir dem Thron hinauf zum Tempelberg. Die Farben des Zeltes, das dem Heiligsten unter den Heiligen geweiht war, leuchteten vor dem aquarellblassen Himmel und der Kalksteinterrasse. Hier würde der Thron seine Heimstatt finden, bis Dadua, oder genauer Da-duas Sohn, den Tempel errichten würde.
Die Prozession endete vor den gewebten Wänden um das Versammlungszelt. Die Priester lösten sich aus dem Volk und traten durch die Tore. Wir verstummten, die Menge von mehreren hundert Menschen wurde so still, dass man die nackten Füße der Priester auf den festgetretenen Boden klatschen hörte. Auch wie die goldenen Stangen leise gegen die goldenen Ringe der auf den Schultern der Levim schaukelnden Bundeslade schabte, war zu vernehmen. Der Thron schwebte so nahe an mir vorüber, dass ich die Granatapfel- und Traubenmuster auf dem Rand erkennen konnte. Ich sah zu den goldenen Figuren auf. Eisiger Schweiß lief mir über den Rücken.
Die Elohim umarmten sich.
Die Statuen hatten sich bewegt! Ohne jeden Zweifel!
Ohne innezuhalten stiegen die Priester die Stufen hinauf, bis die bestickten Vorhänge mit weichem Schwung hinter ihnen zufielen. Hinter uns war Daduas Stimme zu hören, der immer noch Shaday pries.
»Singe Shaday, alle Welt! Verkündet mit jedem Tag Sein Heil. Erzählet unter den Völkern der Erde von Seiner Herrlichkeit, unter allen Nationen von Seinen Wundern. Denn groß ist el Elyon und hoch zu loben! Mehr als alle Götter ist er zu fürchten. Vor Shaday sind alle Götter der Völker Götzen; aber Shaday hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit strömen aus Seinem heiligen Thron. Preiset el Elyon, ihr Heiden, preiset el Elyons Kraft und Größe, preiset el Elyon, wie es ihm zukommt. Kniet mit euren Gaben vor Ihm, betet Seine Heiligkeit an. Es fürchtet Ihn alle Welt!«
Ein paar atemlose Sekunden lang flogen die vergangenen Jahre an mir vorbei: der Exodus aus Ägypten, der Fall von Atlantis und jetzt das? Ich wusste, dass im Zelt Tiere geopfert wurden, dass Gott in Seinem neuen Heim willkommen geheißen wurde. Ich sah zu Cheftu auf. »Glaubst du -«
Plötzlich durchzuckte mich und alle um mich herum etwas Undefinierbares. Ich fühlte mich, als hätte mich der rote Punkt eines Laserstrahls erfasst und wäre dann weitergewandert.
Ein Ruf: »Er ist mit uns!«
Wie alle anderen schaute auch ich zum Zelt hin. Hinter den Wänden befand sich ein heiliger Raum: Gottes Boudoir. Vor dem blau getönten Himmel zuckten aus jenem Raum Blitze aufwärts. Streifen in gleißendem Gold vor dem EichelhäherEisblau des Himmels, umbettet von Wölkchen aus silbrigem, halb durchsichtigem Rauch.
Die Menschheit hatte ihre Hand zum Himmel ausgestreckt. El haShaday hatte seine Hand zur Erde ausgestreckt.
Alle Knie beugten sich.
Gott wohnte wieder unter dem Volk Israel.
Als sich - im wahrsten Sinn des Wortes - der Rauch verzog, erhielt jeder einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Es war ein Festtag und das Singen wollte kein Ende nehmen. Wer in der Umgebung wohnte, machte sich in der Abenddämmerung auf den Heimweg. Wer in der Stadt wohnte, kehrte mit frischem Stolz darauf, ein Kind Abrahams zu sein und in Tziyon zu wohnen, in sein Heim zurück.
Es begann wieder zu regnen; in der Ferne zuckten Blitze.
RaEm blickte durch den strömenden Regen ihre Soldaten an. »Ägypten fällt«, sagte sie. »Sie kommen, Tutenchaton zu holen, um ihn nach Noph zu bringen und ihn vor Horus, Ptah, Amun-Re und Hathor zu krönen. Pharaos Vision eines einzigen Gottes wird verloren gehen.«
Schweigend standen sie vor ihr, von ihren Köpfen und Nasen tropfte das Wasser. Sie wandten den Blick nicht ab. »Sie werden uns ebenfalls holen. Wir werden, wie so viele vor uns, durch ihre Hände sterben.«
Ein paar erbleichten, doch die meisten blieben ungerührt.
Resigniert.
»Wir brauchen nur Gold.«
RaEm stapfte davon, dass der Schlamm auf ihren Schurz spritzte. »Mit Gold können wir all unsere Probleme lösen. Damit können wir uns ein Amt, unsere Freiheit und Sicherheit im neuen Ägypten erkaufen. Ohne Gold wird man uns alles nehmen und uns als einen Überrest des verstoßenen Königreiches verrotten lassen.«
Sie sah sie, ihre Truppenführer, der Reihe nach an. Insgesamt fünfundzwanzig gehorsame, kräftige Männer. Und alle waren Ägypten treu ergeben. »Ich weiß, wo es Gold gibt. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir ganz und gar vertrauen. Ihr dürft keinen Moment an meinen Zauberkräften zweifeln.«
»Wie könnten wir an dir zweifeln?«, fragte einer von ihnen. »Du gebietest über den Blitz!«
Zustimmendes Gemurmel war zu hören. Gut! Dass sie gelernt hatte, den Himmel zu lenken, war also nicht unbemerkt geblieben. »Genau. Werdet ihr mir vertrauen?«
»Nicht dass wir dir nicht vertrauen, Meine Majestät, aber warum erstürmen wir Noph nicht einfach? Wir kontrollieren die Armee. Tausende von uns lagern zwischen Jebus und Ägypten. Jeder Soldat würde nur zu gerne nach Hause zurück-kehren und das Land für Pharao erobern.«
Sie lächelte. Sie waren so schlicht, so entzückend süß.
Sie würden Noph und auch Waset erstürmen. Doch bei den Verhandlungen in Karnak, bei den Verhandlungen mit jenen Adligen, deren Name seit mehreren Dynastien bei Hofe vertreten war, zählte nur Gold. Mit Brutalität und Angst würde sie bei jenen, deren Anerkennung sie mit Sicherheit brauchte, überhaupt nichts erreichen.
Immerhin wäre sie schließlich Pharao, genau wie Hat-schepsut vor ihr. Tuti hätte einen kleinen Unfall, und sie würde an seiner Stelle herrschen. Später würde er nach einem langen, qualvollen Kampf gegen eine Krankheit dahinscheiden. Und dann wäre Semenchkare der größte Pharao, den Ägypten je gekannt hatte.
Und der reichste. Nie wieder würde sie sich von einem König über einen Schlammhügel als »machtlos« beschimpfen lassen. Sie konnte es kaum erwarten, ihn auszuweiden, ihm sein Geschlecht in den Mund zu stopfen und ihn anzuzünden.
Vielleicht ließ sich auch das mit einem Blitz bewerkstelligen?
»Vertraut ihr mir?«, fragte sie.
»Ja!«
»Werdet ihr mir folgen?«
»Ja!«
»Nie meine Befehle hinterfragen, sondern sie stets gehorsam ausführen?«
»Ja!«
»Dann schwärzt eure Gesichter mit Schlamm und lasst eure Schwerter zurück. Noch heute Nacht werden wir den Heimweg antreten.«
Die Chorim, Zekenim und Giborim waren (dem wieder angekleideten) Dadua gefolgt, der sein neues Heim segnen wollte, solange er noch in Shadays Gnade stand. Wir standen innerhalb der Fundamente des Hofes von Daduas künftigem Palast. Die Lade war sicher auf dem Tempelberg untergebracht; für die Israeliten war alles im Lot.
Daduas Frauen standen dicht beisammen und beobachteten unser Eintreten. Er winkte jeder Einzelnen zu. Avgay’el senkte den Kopf, Hag’it errötete und winkte zurück, Ahino’am blies ihm unter unserem Jubel einen Kuss zu.
Mik’el stand auf der Seite gegenüber und wartete auf Daduas Geste. Sie reagierte nicht und schien ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen. Dadua winkte noch einmal; Mik’el machte auf dem Absatz kehrt und ging davon.
Verblüfftes Schweigen. Sie hatte haNasi vor den Kopf gestoßen? Das war nie besonders klug, und heute am allerwenigsten. Als Dadua sich wieder zu uns umdrehte, lächelte er immer noch, doch in seinen schwarzen Augen glühte es. Er warf den Kopf zurück und erbat Shadays Segen für sein Haus, sein Geschlecht, seine Dynastie und die vereinten Stämme von Y’srael und Yuda.
War ich wirklich dabei? Cheftu und ich mischten uns unter die Übrigen und wanderten unter Gesängen zurück zum Palast. Dort ließen wir uns um den Tisch herum nieder und speisten bis in die tiefe Nacht hinein, deren Sterne sich unter einer Wolkendecke verkrochen hatten.
Als vor uns nur noch ein paar Überreste von Lamm, Getreide, Obst und Gemüse lagen, entschuldigte sich Dadua.
Die Musikanten spielten, der Wein floss; es war ein perfekter Abend. Cheftu hatte mich eben geküsst und angedeutet, es sei an der Zeit, in unser eigenes Haus zurückzukehren, als wir alle ein lautes Krachen hörten.
»Was -«, hörte ich über die Gespräche der Männer hinweg. Wir klappten den Mund zu und bemerkten, dass auch alle Übrigen am Tisch still geworden waren.
»Was für eine Schande!« Mik’els Stimme war unverkennbar. Jetzt verstummten auch alle Übrigen im Raum und lauschten.
»Was denn? Dass der Thron nach Jerusalem zurückgekehrt ist? Jetzt sind wir die Hauptstadt aller Stämme!«, erwiderte Dadua.
»Ach! Ein Haufen ungekämmter, unzüchtiger Bauern, die immer noch Steine anbeten und sich mit Apiru verheiraten.«
Wir gaben nicht einmal vor, nicht zu lauschen.
Schweigen.
»Du vergisst dich, Isha. Meine Mutter ist Apiru.«
»Wie könnte man das vergessen. Vor allem nach dem heutigen Schauspiel! Hast du keine Würde? Keinen Stolz?
Wie beschämend, dass der Thron Yudas eine solche Farce geworden ist.«
In unserem Raum traute sich keiner, dem anderen ins Gesicht zu sehen. Es war zu spät, um noch ein unbefangenes Gespräch anzufangen; andererseits war es ausgesprochen peinlich, diesem Streit zuzuhören.
»Deine Sklavinnen haben dich nackt gesehen!«, zeterte sie. »Du bist der König! Man sollte nicht einmal dein Gesicht sehen dürfen, doch du zeigst deinen Penis her! Mein Vater würde sich schämen! Das Haus Labayus würde sich schämen!«
»Es gibt kein Haus Labayus!« Davids Erwiderung kam schnell, zornig und sehr, sehr laut. »Ich habe vor meinem Gott getanzt, und zwar so, wie mein Gott mich geschaffen hat. Er hat mich über deinen Vater, über deine Brüder, über dein gesamtes Haus Labayu erhoben! Ich bin der König. HaNasi Tziyons, haMelekh der Stämme, das bin ich!«
Wenn überhaupt, wurde Dadua noch zorniger.
»Vor meinem Gott werde ich so feiern, wie es mein Herz mir befiehlt. Vor Gott ist kein Platz für irgendwelche Würde; noch würdeloser will ich vor ihm sein. Vor Shaday ist kein Platz für Stolz; noch mehr will ich mich vor ihm erniedrigen. Auch wenn du an einem Herrscher, der seinem Herzen folgt, nichts Bewundernswertes siehst, werden die Sklavenmädchen, auf die du so herabsiehst, die Majestät Shadays im Gedächtnis behalten, denn sie haben begriffen, dass ich vor ihm und nicht vor ihnen nackt war.«
Wieder blieb es still.
Lange still.
»Aus meinen Augen, Mik’el. Nie wieder sollst du einen Mann erkennen.«
Der Vorhang bauschte sich zur Seite; wir starrten Dadua an, er starrte uns an. Mik’el stand hinter ihm im Dunklen. »Vor all diesen Menschen«, verkündete er, »hat Mik’el darum gebeten, das Haus Labayu zu verstoßen. Dass ich ihren Tod nicht fordere, beweist meinen Chesed.« Er drehte sich zu ihr um. »Du sollst Tziyon nie wieder betreten.«
Stolz und wunderschön trat sie vor. »Eher will ich auf mich allein gestellt sein, als mit einem König zusammenzuleben, der sich nicht königlich zu verhalten weiß.«
Ich konnte nicht anders; ich zuckte zusammen.
War sie wirklich so dumm? Oder wollte sie wirklich ihren Tod heraufbeschwören? Dadua sah sie an, als wollte er sie umbringen.
»Um Yohans willen, den ich geliebt habe, werde ich dich lediglich verstoßen. Gibori!«, rief er.
Yoav und Abishi eilten an seine Seite. Dadua wies mit einer Kopfbewegung auf sie, woraufhin sie sich neben ihr aufbauten und sie an beiden Handgelenken packten. Mik’el riss sich aus ihrem Griff los, und dann schritt sie, statt durch den Hinterausgang zu verschwinden, gemessen und elegant durch unsere Gruppe hindurch. Sie war vom Scheitel bis zur Sohle eine Prinzessin.
Wir waren wie vor den Kopf geschlagen.
Ein paar Minuten verstrichen. Was sollten wir unternehmen? Selbst N’tan war still geworden. Schließlich nahm Dadua sein Instrument, strich über seinen Kinor und begann zu singen.
»Shaday, man lobt Dich in der Stille Tziyons, Dir halten wir unsere Gelübde. O Du erhörst unsere Gebete, darum kommet alles Fleisch zu Dir. Dich wollen wir suchen. Wenn unsere Missetaten uns hart drücken, vergibst Du uns unsere Sünden und schenkst uns einen neuen Anfang.
Wohl dem, den Du erwählst. Wohl dem, den Du an Deinen Vorhöfen leben lässt. Wir sind erfüllt von Trost aus Deinem Hause, wir nutznießen von dem Dienst in Deinen heiligen Zelten. Du erhörest unsere Fragen mit allmächtigen Taten und zeigest Gerechtigkeit, o Gott, unser Heil.
Du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. In Deiner Kraft setztest Du Berge fest, Du bist gerüstet mit Macht. Du hast das Brausen der Wogen gestillt und das Toben der Völker. Die an den Enden wohnen, haben von Deinen Taten gehört und entsetzen sich vor Deinen Zeichen. Wo auch immer der Morgen dämmert oder der Abend sich senkt, singt man Dir zu.
Du hast das Land reich gemacht und es bewässert. Dein Chesedfließt wie ein Bächlein Deinem Volke zu und nährt uns wie bestes Korn. So hast Du das Land bebaut. Mit dem Wasser Deiner Worte tränkst du uns, besänftigst Du uns, machst Du uns fruchtbar wie das Land.
Du segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit Deinem Gut, die Marktkarren fließen über vor Reichtum, die Weiden in der Steppe nehmen kein Ende; und die Hügel sind erfüllt mit Freude. Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dicht mit Korn. Das ganze Land singt und jubiliert unter Deinen Gaben.«
»Sela«, antworteten wir im Chor.
RaEm führte sie durch die Nacht und durch den strömenden Regen. Ihre Rüstungen waren mit Schlamm überzogen; nirgendwo glänzte Metall, nirgendwo funkelte eine polierte Stelle. Sie kam an dem Baum an und öffnete ihn. Hiram war längst nicht so raffiniert, wie er glaubte.
Dann hinunter in die Tiefe, in die Dunkelheit. Nur dass sie diesmal eine Lampe dabeihatte. Beim ersten Mal hatte Zakar Ba’al sie zu verwirren versucht, indem er im Kreis gegangen war und keine sichtbaren Merkmale hinterlassen hatte. Doch unter ihren Füßen hatte sie weichen Boden gespürt. Jeder Schritt war wie ein Wegweiser. Jetzt brauchte sie nur die Lampe anzuheben und konnte leicht den Schritten dutzender Arbeiter in die Stadt folgen.
Wenn man es nicht darauf anlegte, jemanden in die Irre zu führen, war der Weg erheblich kürzer.
Sie kamen unterhalb des Speiseraums vorbei, wo sie die gedämpften Klänge von Daduas Kinor hören konnten. Dann durch die kleineren Kammern bis in die Schatzkammer. »Passt auf«, sagte sie zu den Männern. »Nehmt nur das, was ich euch befehle. Nichts weiter. Nicht ein einziges Stück, das ich nicht aufgezählt habe. Alles dient einem ganz bestimmten Zweck, einer Macht, die nur ich beherrsche. Habt ihr das verstanden?«
»Jawohl, Meine Majestät«, bestätigten sie leise.
Sie sah einen nach dem anderen an und fragte sich, wer von ihnen der Versuchung wohl erliegen würde, wer die Kammer nicht wieder verlassen würde. »Dort sind Schilde aus Gold und Silber. Nehmt alle mit. Außerdem findet ihr dort Rollen mit Draht und Kabeln aus Gold, Kupfer und Bronze. Auch die nehmt ihr mit.«
Sie nickten, und RaEm öffnete die Tür. Die Soldaten waren bestimmt geblendet, doch sie waren diszipliniert. Sie nahmen die Schilde von den Wänden und hoben die aufgewickelten Drähte und Kabel vom Boden auf. RaEm winkte sie heraus, und ein Mann nach dem anderen kehrte in den Gang zurück, jeder mit zwei Schilden und einer über die Schulter gehängten Rolle beladen.
Dann sah sie ihn; er war jung und nervös. »Halt«, sagte RaEm. Er blieb stehen, die dunklen Augen vor Angst geweitet. »Ich habe dir doch befohlen, nichts mitzunehmen außer den Dingen, die ich aufgezählt habe.« »Meine Majestät! Das habe ich auch nicht! Wirklich nicht!«, protestierte er.
Die anderen sahen zu. Sie hatten ihn noch nie leiden können, das hatte sie aus ihren Reaktionen geschlossen. »Du hast die Frechheit, mich anzulügen?«
»Meine Majestät -« Er warf sich zu Boden und sprudelte los: »Ich schwöre bei der Ma’at, bei den Hörnern Hathors -«
»Und nun beleidigst du mich auch noch, indem du bei Göttern schwörst, die es gar nicht gibt!«
Bibbernd lag er ihr zu Füßen. »Ich habe nichts getan, Meine Majestät«, sagte er. Doch seine Stimme war weicher geworden. Ihm war klar, dass er nicht mehr zu retten war.
»Steh auf.«
Er schauderte noch einmal, dann reichte sie ihm die Hand. Als er sich erhob, breitete sich eine eigenartige Miene auf seinem Gesicht aus. Er öffnete die Hand und zeigte ihr einen goldenen Ohrring, einen jener Ohrringe, die zufällig neben der von ihm aufgehobenen Drahtrolle gelegen hatten. Sein Blick traf auf RaEms. Er wusste Bescheid und verstand. In diesem Augenblick wich auch der letzte Schatten kindlichen Vertrauens in seinen Augen.
Wie sagte man noch in Chloes Welt? Das Leben kann ganz schön beschissen sein?
»Du stirbst für Ägypten.« RaEm senkte die Klinge in seinen Körper. Er wandte die Augen nicht von ihr ab. Sein Blick war fest auf sie gerichtet, sodass auch sie ihren nicht abwenden konnte. Heiß sprühte sein Blut über ihre Hände, über ihre Kleider und ihr Gesicht, doch sie schaffte es nicht, sich umzudrehen.
»Ich hätte beide nehmen sollen«, keuchte er. »Wie blöd, nur einen zu stehlen.«
Sie zog ihre Klinge zurück, wischte sie an seinem Schurz ab und drehte sich zu den Übrigen um. »Vertraut ihr mir?«
Sie vertrauten ihr nicht, doch plötzlich hatten sie Angst vor ihr.
»Werdet ihr mir folgen?«
Sie nickten hastig.
»Dann kommt, wir haben viel zu tun.«
Ich war eben - wieder - eingeschlafen, nachdem ich mich mit Cheftu geliebt hatte, als jemand an unsere Tür trommelte. Wir hatten Brust an Brust geschlafen, die Beine ineinander verschlungen, und schossen wie ein Mann hoch. »Was zum Teufel ...«, grummelte ich verschlafen.
»Ich gehe schon, chérie«, sagte er, stand auf und tappte davon. Der Besucher an der Tür wollte nicht aufhören mit Trommeln. Ich vergrub den Kopf unter dem Kissen und döste langsam wieder ein. Bis ich etwas hörte, das ich nie zu hören erwartet hätte: Cheftu, der »Heilige Scheiße!« rief.
Sekunden später war ich aufgesprungen, angezogen und an der Tür. Cheftu sah mich an. »Das Tabernakel ist mit Soldaten umstellt.«
»Was?«
Draußen rumpelte der Donner. N’tan, bis auf die Haut durchnässt, verdrehte die Augen.
»Dieser Ägypter hat das Tabernakel als Geisel genommen!«
»Semenchkare?«
»Ken! Das ist eine Beleidigung für Shaday, unsere Gastfreundschaft, für alles!«
»In der Bibel steht nichts Derartiges, und ich habe auch nirgendwo etwas darüber gelesen oder auch nur gehört«, sagte Cheftu zu N’tan.
Ich sah den Nachfahren Imhoteps I. und II. an. »Möchtest du etwas Wein?«, fragte ich und bewies damit, dass ich die geradezu absurde Gastfreundschaft der Südstaaten mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Ich schenkte drei Becher voll. N’tan erzählte uns, dass er zwei Boten zum Tabernakel ausgesandt hatte und sie, nachdem sie nicht zurückgekehrt waren, suchen gegangen war. Wobei er auf Soldaten gestoßen war.
Ägyptische Soldaten.
»Was ist mit den Priestern? Den Leuten, die dort oben waren?«
N’tan zuckte mit den Achseln. »Es war kaum jemand dort. Die Erntezeit, die Feiern und Opfer sind abgeschlossen. Es bleiben nur ein paar Priester beim Tabernakel, die sich den Winter hindurch beim Gottesdienst abwechseln.« Er kaute auf einer Schläfenlocke herum. »Vieles aus dem Tabernakel wurde ohnehin in die Unterstadt eingelagert.«
»Und was ist oben geblieben?«
»Nur die äußeren Vorhänge und der Thron.«
Cheftu schauderte und murmelte etwas von einer tödlichen Waffe in seinen Bart. »Was haben die Soldaten getan?«
»Sie haben das Zelt eingerissen.«
»Haben sie den Thron berührt?«
»Wieso fragst du das?«, mischte ich mich ein.
»Weil eine Frau, die acht Meter von der Bundeslade entfernt stand, um ein Haar an der Pest gestorben wäre.«
»Die Beulenpest ist in der Arche?« Vor Verblüffung sprach ich Englisch.
N’tan sah uns beide an, ohne ein Wort zu verstehen.
»Flöhe, chérie. Ich weiß nicht warum, aber Flöhe.«
»Bist du sicher?«
Cheftu piekte mit dem Finger in N’tans Richtung und wechselte wieder ins Hebräische. »Sie machen die Priester krank, damit sie sich in der Nähe des Throns aufhalten können, ohne sich anzustecken. Der Thron löst die Seuche aus.« Er wandte sich an N’tan und bat ihn, mir zu erklären, was ihnen die Pele-sti bei der Rückgabe des Thrones noch übergeben hatten.
»Goldene Darstellungen, G’vret. Von Tumoren.«
»Statuen von Pestbeulen«, erklärte Cheftu auf Englisch.
»Und goldene Totems von Ratten«, ergänzte N’tan auf Hebräisch.
Ich leerte meinen Becher in einem einzigen Zug.
»Und weshalb macht ihr euch solche Sorgen?«
Cheftu stand auf, fuhr sich mit den Händen über das Gesicht und erklärte hastig: »Schon ein winziger Spalt unter dem Dek-kel, nicht einmal breit genug für meinen Finger, hätte die Gemahlin des Königs beinahe das Leben gekostet.
Uns Übrigen ist nur nichts passiert, weil wir, wie nennst du das?, immun waren.«
Ich stand auf. »Aber wenn die Lade weiter geöffnet würde -«
»Dann könnte die Seuche das jüdische Volk auslöschen.«
War es möglich, dass RaEm die Vernichtung der Juden auslösen würde? In Europa hatte die Pest ein dunkles Zeitalter heraufbeschworen. War es möglich, dass sie auch hier ein dunkles Zeitalter herbeiführte? Statt Salomons Ruhm die düstere Herrschaft RaEms?
Der Donner ließ uns für Sekunden taub werden.
Das klang arg nach Gruselroman, aber wer hätte andererseits schon geahnt, dass ich mit Salomons Mutter Getreide mahlen oder König David den Davidsstern zeigen oder dass Cheftu einige Bücher der Bibel verfassen würde?
Wir rannten durch den Regen.
Unter dem tiefen, schwarzen Himmel, in peitschendem Regen und eisigem Wind stand Dadua. In der Ferne zuckten Blitze, und aus allen Ecken und Enden der Stadt strömten Männer und Frauen herbei, um sich seiner Gruppe anzuschließen. Mit triefender Nase und am Schädel klebendem Haar sprach Dadua zu seinen Giborim und zu uns.
»Niemand wird meine Stadt, meinen Tempelberg oder den Thron meines Gottes an sich reißen. Lasst den Shofar erschallen; ruft alle Bürger zum Tempelberg. Ägypten will den Kampf, Ägypten soll ihn bekommen.« Er wandte sich an Yoav. »Hast du nicht behauptet, dass der Ägypterknabe der neue Pharao sei? Hol ihn herbei.«
»Er ist schon hier.« Dion als Hiram kam herangelaufen. »Ich biete dir meine Dienste an, Adon.«
Blitz und Donner. Ich drückte Cheftus Hand. Dadua sah auf die Versammelten. »Wir werden Ägypten ein zweites Mal befehlen, Shadays Volk ziehen zu lassen!«
SIEBTER TEIL