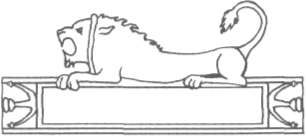Er flirtete zwar, aber er war nicht wirklich interessiert.
Erstaunt stellte RaEm fest, dass Hiram nichts von ihr als Frau wollte. Statt beleidigt zu sein, fühlte sie sich erleichtert und ein wenig provoziert. Er deutete auf das Spielbrett. »Darf ich dich herausfordern, falls dir sonst niemand Gesellschaft leistet?«
Sie klatschte in die Hände und befahl einem Sklaven, für Hiram Kissen, Wein, Obst und einen zweiten Fächerjungen zu bringen. Bald saß ihr Hiram auf gleicher Höhe gegenüber.
»Was hältst du von den Neuigkeiten über unseren Gastgeber?«, fragte er nach den Eröffnungszügen.
»Es ist ein eigenartiges kleines Volk«, antwortete RaEm.
Hiram rollte die Stäbe aus. »Ihr Gott Shaday kennt keine Nachsicht. Ich kenne zwanzig Jahre alte Geschichten.«
RaEm beobachtete seinen Zug und warf dann ihrerseits die Stäbe. »Was für Geschichten?«
»Komischerweise hatten die Pelesti den Thron in der Schlacht erobert. Sie stellten ihn in Dagons Tempel in Ashqe-lon. Du hast den Tempel gesehen, nicht wahr?«, fragte Hiram.
»Nein.«
»Ein erstaunlicher Bau«, erklärte er. »Sogar unter dem Meer haben sie Gebetsräume.«
»Unter dem Meer?«
»Ganz recht, dort befindet sich eine ganze Reihe von Räumen.«
RaEm warf ihm einen skeptischen Blick zu. Hielt er sie wirklich für so blöd? »Was war mit dem Thron?« Sie zog ihren Stein und lehnte sich dann zurück. »Soweit ich weiß, besteht dieser Totem aus reinem Gold?«
»Ja.« Er sprach immer noch Ägyptisch. »Eine goldene Truhe mit zwei auf dem Deckel angebrachten magischen Engeln, die ihr als Ushebti bezeichnen würdet und die sie Elohim nennen. Zweimal stürzten sie im Tempel in Ashqelon die Dagon-Statue um.«
RaEm beobachtete seinen Zug und sah dann auf. »Wie kam das?«
»Die Sache wurde Shadays Macht zugeschrieben. Die Pelesti beschlossen, den Thron an die Stämme zurückzugeben, da er viele von ihnen umgebracht hatte.«
»Wie?«
»Durch eine Seuche mit Geschwüren?«
»Die Lade überträgt eine Seuche?«
Er zuckte mit den Achseln. »Sie erzeugt sie. Doch wie sie von der Kiste auf die Menschen übergeht, ohne dass diese den Thron berühren, weiß ich nicht. Darum ist jede Berührung verboten; und genau das ist gestern geschehen. Ich habe gehört, aus der Kiste seien Blitze geschossen.«
RaEm schlug ihn beim letzten Zug. Sie gab sich alle Mühe, nicht zu lächeln. In der Kiste waren Blitze? Bedeutete das einen Segen Hathors? Oder bewies dadurch der Aton seine Existenz?
Hiram wirkt überrascht.
»Du spielst auf Sieg, Meine Majestät.«
»Du sprichst meine Sprache fließend, Zakar«, entgegnete sie. »Wie kommt das?«
»Ich habe einst die Gesellschaft eines ägyptischen Schreibers genossen«, antwortete Hiram langsam und studierte dabei angestrengt das Spielbrett.
»Genau wie ich«, gab RaEm lachend zu.
»Sag an.« Wieder schaute er sie mit seinen dunklen Augen an. »Bist du je auf die Inseln des Großen Grüns gereist?«
»Du von allen Menschen solltest die Ägypter kennen, Zakar. Um genau zu sein, vor gar nicht langer Zeit hast du Wenaton, unseren Botschafter, so herablassend behandelt, dass du ihn am Rande eines Nervenzusammenbruchs heimgeschickt hast.«
Er lachte, doch sein Blick blieb eindringlich. »Bist du in Ägypten geboren?«
»Ja, Zakar.«
»Bitte nenn mich doch Hiram.«
»Wie du wünschst.« Sie nannte ihm absichtlich nicht ihren Namen. Sie spielten fast wortlos noch ein paar Runden. Sklaven traten ein und zündeten Lampen an, brachten ihnen dann etwas zu essen und schenkten ihre Becher nach.
Schließlich ließ er sich zurücksinken. »Wieso bist du hier?«
»Um mit dem neuesten König zu sprechen«, log sie glatt.
»Wir wissen beide, dass das nicht stimmt«, sagte er. »Du würdest mir Respekt erweisen, indem du mir erklärst, dass mich das nichts angeht, aber glaube nicht, dass ich mich mit einer derart stümperhaft zusammengesponnenen Ausrede abspeisen lasse.«
»Dann sag du mir«, feuerte sie zurück, »wieso du hier bist.«
Er trank seinen Wein aus, setzte den Becher ab und sah sie an. Seine Augen waren dunkel und mit langen Wimpern besetzt. Seine Gesichtszüge waren perfekt modelliert, angefangen von der geraden Nase und der hohen Stirn über das kantige Kinn bis zu den sinnlichen Lippen, den vollen Wangen, der
Form seines Kopfes. Er war exquisit, er war zu schön, um wahr zu sein.
Sie vermisste Echnaton mit seinem traurig missgeformten Kopf und Körper, seinem bohrenden Blick und seiner tiefen, vollen Stimme. Obwohl er sie verstoßen hatte, begehrte sie ihn immer noch. Und genau darum verabscheute ihn RaEm, denn jetzt war ihr Leben nur noch ein Scherbenhaufen, der nie wieder gekittet werden konnte.
Hatte Horetamun seinen Auftrag erfüllt? Die Götter mochten ihr dafür vergeben, dass sie die perfekte Leidenschaft aufgegeben hatte.
Hiram war ein schöner Mann, doch ihm schien die Seele zu fehlen. Seine Augen waren ohne jeden Glanz. Er wandte den Blick ab. »Meine Pläne haben sich geändert«, antwortete er langsam. »Ursprünglich bin ich gekommen, um Dadua einen Palast zu erbauen.«
»Wieso solltest du das tun?«
»Ich habe keine Armee, um mich gegen dieses Volk durchzusetzen, darum muss ich subtiler vorgehen.«
»Du inszenierst eine Invasion von Zimmerleuten?«
Er lachte kurz. »Ich baue ihm eine Stadt, in der ich mich auskennen werde und er nicht. Sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kann ich mich mit einem anderen Herrscher verbünden und die Stadt einnehmen. Ich will Tziyon haben; mir gefällt die Lage, die Straßen, der Blick über die umliegenden Täler. Und vor allem will ich die Kontrolle über die Straße der Könige.«
RaEm konnte kaum fassen, dass er ihr einfach so seine Absichten verraten hatte. Entweder war er vollkommen unbedarft, oder er hielt sie dafür. »Treibst du Späße mit mir?«, fragte sie kühl. »Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen.«
Wieder heftete er seine Augen auf sie und durchbohrte sie mit seinem seelenlosen Blick. »Nein, ich besitze die Kühnheit, dir meine wahren Absichten zu verraten. Wirst du mir dieselbe
Ehre erweisen, Sybilla?«
»Gold«, antwortete sie knapp.
Er starrte sie lange an, dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte. »Ich scheine in letzter Zeit den Verstand zu verlieren«, sagte er. »Du hast es immer noch nicht gemerkt - aber wie ist das möglich?«, fuhr er leise fort. »Was habe ich mir nur davon erhofft?«
RaEm sah ihn zweifelnd an. »Du hast eine Frage gestellt, und ich habe dir Respekt erwiesen und dir darauf geantwortet. Worüber lachst du?«
Schlagartig wurde er ernst. »Verzeih mir. Dadua hat Gold?«
»Er besitzt genug Gold, um das Lösegeld für einen Pharao zu stellen.« Sie lächelte knapp. »Und ich habe einen Pharao, der dringend ausgelöst werden muss.«
»Du willst also das Gold, und ich will die Stadt.«
RaEm lachte. »Genau. Vielleicht sollten wir den Thron öffnen und abwarten, bis alle Stammesbrüder umgekommen sind, dann könnte ich die Stadt einnehmen und das Gold an mich nehmen, und du hättest eine Stadt ohne Bevölkerung.«
Hiram lachte. »Wir würden ihren eigenen Zauber gegen sie einsetzen, aii?«
»Es wäre nicht schwer«, bestätigte sie, »die Macht zu übernehmen, solange sie geschwächt sind.«
»Wie würdest du an das Gold kommen? Die Seuche würde nicht alle von ihnen umbringen.«
RaEm starrte in den Satz unten in ihrem Becher. Die abendliche Kühle war ihr fremd, genau wie die Bäume, die Hügel, der Tau. Sie seufzte. »Wahrscheinlich brauchten wir in Wirklichkeit einfach nur den Thron. Er besteht aus Gold, sagst du. Wir könnten ihn einfach mitnehmen.«
»Er kann aber auch töten«, wandte er ein. »Und er ist ziemlich schwer, würde ich meinen.«
»Ich brauche viel Gold, ob es nun der Thron ist oder der Schatz in haNasis Truhen.« Sie starrte kurz in die Ferne. »Der
Thron ist ihnen wichtig. Damit könnte man sie kriegen.«
»Du würdest ihn als Geisel nehmen, um das Lösegeld für deinen Pharao zu erpressen?«
Sie stellte sich seinem Blick. »Genau. Wenn dies hier nicht nur ein Gedankenspiel wäre.«
Er nahm sein Glas und klickte damit leise gegen die Tischplatte. »Dann wären wir Verbündete ... wenn dies hier nicht nur ein Gedankenspiel wäre.«
»Und warum, Zakar Ba’al?«
»Ich würde euch in die Stadt führen, wo ihr den Thron holen könntet. Ihr würdet ihn erst als Geisel nehmen, dann dafür sorgen, dass fast alle sterben, und mir danach die Stadt überlassen.«
»Ich bekäme das Gold.«
»So wie ich die Stadt.«
Sie klopfte mit ihrem Becher auf den Tisch. »Du hast Recht. Wenn dies nicht nur ein Gedankenspiel wäre, dann wären wir Verbündete.«
Etwa eine Woche lang, nachdem die Bundeslade Feuer gespuckt hatte - eine elektrische Entladung, vermutete ich auf Grund der Geschichten, die mir zu Ohren gekommen waren -, blieben die Stämme in Deckung. Vor Entsetzen ließen sie das Laubhüttenfest, das Sukkot, ausfallen. Am nächsten Tag schlief ich bereits, eng an Cheftu gekuschelt, als jemand an die Tür klopfte.
Cheftu weigerte sich aufzuwachen, doch das Klopfen nahm kein Ende. Ich quälte mich hoch, warf eine Tunika über und tappte zur Tür. »Wer ist da?«, fragte ich, ohne den Türriegel zurückzuschieben.
»Zorak«, antwortete er. »HaMelekh will, dass du zu G’vret Avgay’el kommst.«
Wozu sie so spät noch eine Hofdame brauchte, war mir unerfindlich, dennoch flocht ich mein Haar, band eine Schärpe um und schlüpfte in ein Paar Sandalen. Schweigend wanderten wir bergauf durch die kühle Stadt, an den Wachen vorbei und in das Viertel der Tsori, wo auf dem Milo der Palast erbaut wurde.
»Sie ist krank, Klo-ee«, eröffnete er mir, ehe er mich in den Frauenflügel einließ.
Dadua kniete an Avgay’els Seite, die sich unruhig auf dem Bett herumwälzte. Ihre Haare waren verfilzt, die Augen hatte sie fest geschlossen. Obwohl ich einen halben Meter von ihr entfernt stand, spürte ich die Hitze, die von ihr ausstrahlte. Blut verklebte die Vorderseite ihres Nachtgewands, Blut, das sie, mit Schleim vermischt, ausgehustet hatte.
Dies sah nicht nach einer einfachen Grippe aus. »Wie lange geht das schon so?«, erkundigte ich mich, während ich neben Dadua niederkniete.
»Ich bin aufgewacht, weil sie so heiß war«, antwortete der Prinz von Tziyon. »Normalerweise ist sie eher kühl. Und dann habe ich sie nicht wach bekommen.«
»Mein Gemahl ist Arzt«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich kann versuchen, ihr Linderung zu verschaffen, er hingegen wird wissen, was ihr fehlt und wie man ihr helfen kann.«
»Chavsha ist Arzt? Gibt es irgendetwas, wovon dieser Mann nichts versteht?«
Ich grinste und hoffte, Cheftu würde mir verzeihen, dass ich seine Tarnung gelüftet hatte. Sofort schickte Dadua jemanden los, Cheftu zu holen.
Während der nächsten Stunde bekämpfte ich Avgay’els Fieber mit kalten Umschlägen. Sie hatte sich nicht übergeben, doch sie würgte im Schlaf. Sie war so heiß, dass ich sie kaum berühren konnte. Vielleicht gehörte sie einfach zu den Menschen, die schnell hohes Fieber bekommen? Auf dem College hatte ich mit einer Frau zusammen im Zimmer gewohnt, bei der das so war. Das Tuch war bereits zum dritten Mal getrocknet. Der Morgen begann zu dämmern. Mir tränten die Augen, und dann packte mich das Grauen. Avgay’el bibberte, hustete, spuckte noch mehr Blut und begann das Licht zu fürchten. Ich gab mir alle Mühe, ihr Flüssigkeit einzuflößen, doch als ich ihre Zunge sah, war es mit meiner Beherrschung vorbei. Sie war weiß. Bis zum Vormittag hatte sich ihr ganzer Leib mit hellgrauen Kreisen überzogen.
Was hatte das zu bedeuten? Wo blieb Cheftu?
Bis zum Nachmittag war sie mit schwarzen Quaddeln übersät und am Hals, in den Achseln und im Schambereich waren ihr grässliche Beulen gewachsen. Endlich tauchte auch Cheftu auf, blutbefleckt und mit blutunterlaufenen Augen. »Was war denn los?«, fragte ich.
»Die Entbindung von N’tans Sohn war eine Katastrophe«, antwortete er. »Seine Frau hat nicht überlebt.«
»Sie ist tot?«
Cheftu wischte sich das Gesicht ab; wenigstens waren seine Hände sauber. »Ken. Das Kind ist sehr schwach.« Ich trat vor, und er erblickte Avgay’el. Mein Mann erstarrte, dann kniete er neben ihr nieder, ohne sie zu berühren. »Raus«, befahl er in klarem Englisch.
»Wieso? Was? Cheftu -«
»Verflucht, Chloe, raus hier, und zwar sofort! Alle außer den Priestern sollen verschwinden! Versiegelt die Räume und lasst niemanden herein.«
So hatte er noch nie mit mir gesprochen; ich hörte das Entsetzen in seiner Stimme. Ich zögerte noch einen Augenblick. »Sie hat die Beulenpest.« Er sah mich an. Seine Augen waren weit aufgerissen, bernsteingelb, braun - und voller Angst. »Raus!«
»Ihr müsst in Quarantäne«, sagte N’tan. »Chavsha besteht darauf.«
»Das mit deiner Frau tut mir Leid«, sagte ich.
Er sah weg. »Todah.«
»Solltest du nicht eigentlich trauern? Ich kann auf mich selbst aufpassen, ich kann sogar selbst in Quarantäne gehen«, bot ich ihm an. »Sie gehörte nicht zu meiner Familie«, antwortete er monoton. »Ich werde sie nicht betrauern.«
»Mah?«
»So will es das Gesetz.«
Ich wollte schon loszetern, doch in diesem Moment sah er mich an. Sein schmales, aristokratisches Gesicht war verkniffen, und unter seinen Augen lagen tiefe, graue Schatten. »Wie geht es deinem Sohn?«
Ein Lächeln zuckte kurz um seine Mundwinkel. »Er ist wunderschön, ein Geschenk Shadays.«
»Wie heißt er?« Ich fragte nicht aus Höflichkeit; ich merkte, dass ich ihn unbedingt wissen lassen wollte, wie sehr ich mit ihm fühlte und mich mit ihm freute.
»Ich werde ihm am achten Tag einen Namen geben.«
Noch mehr Bräuche, noch mehr Gesetze.
»G’vret, du warst genau wie Dadua in Avgay’els Nähe. Ihr beide müsst ein paar Tage von den anderen abgesondert werden, bis feststeht, dass ihr euch nicht angesteckt habt. Dein Gemahl will es so.«
Die Beulenpest. Eine erschütternde Vorstellung. Ich hatte mich mit europäischer Geschichte beschäftigt - wurde diese Krankheit nicht von Ratten übertragen? War Avgay’el etwa von einer Ratte gebissen worden? Ich wusste, dass mir das nicht passiert war, doch wenn Cheftu so viel daran lag, würde ich ein paar Tage Urlaub machen. Nachdem sich in den letzten Tagen und Wochen die Ereignisse derart überschlagen hatten, wäre das ganz angenehm.
Was die Pest betraf, irrte sich Cheftu doch bestimmt? Es gab hier keine Ratten.
»Was können wir für sie tun?«
»Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, woher sie die Krankheit hat«, sagte Cheftu. Er sah, wie Avgay’el schauderte, und benetzte ihre glühende Stirn mit feuchten Tüchern. »Und du? Wie ergeht es dir?« Cheftu konnte sich nicht einmal aus-malen, wie ihn der Verlust seiner Frau quälen musste. Eine Geburt barg große Gefahren. War er sicher, dass er Chloe, dass er ihr Leben einem solchen Risiko aussetzen wollte?
N’tan zuckte mit den Achseln. »Du zeigst keine Angst vor dieser Seuche«, sagte der Prophet. »Wie kommt das?«
»Du auch nicht«, entgegnete Cheftu.
»Ach, nun, über mich hat sie keine Gewalt.«
Cheftu drehte sich um und sah den Tzadik über die Schulter hinweg an. »Wie ist das möglich?«
»Jeder, der möglicherweise mit dem Thron in Berührung kommt, weil er unter den Levim dient, wird absichtlich angesteckt, damit er nie wieder krank werden kann.« Der Priester krempelte den Ärmel hoch und winkte Cheftu heran. Dort, in N’tans haariger Achselhöhle, war eine kaum zu erkennende Narbe gewachsen - eine Pestnarbe.
»Ihr wisst, dass der Thron den Tod bringen kann?«, fragte Cheftu fassungslos.
»Ken, und das ist einer der Gründe, warum nur die Priester Levis in seine Nähe dürfen. Nur sie werden schon als Kinder angesteckt.« Er ging neben Avgay’el in die Hocke. »Sie muss ihm zu nahe gekommen sein.«
»Was können wir für sie tun?«, fragte Cheftu. »Ohne Hilfe wird sie sterben.«
N’tan sah ihn mit dunklen Augen an. »Wir können für sie beten, unser Wort für sie einlegen.«
Wie konnte er noch an Gott glauben, nachdem eben erst seine Frau gestorben war? »Es gibt keine Medizin dagegen? Keine Kräuter?«
»Wir müssen ihr Fieber senken.« N’tans Hand legte sich auf eine der prallen, blutgefüllten Beulen an ihrem Hals. »Sie war eine so schöne Frau. Was für eine Tragödie.«
Was für eine Ironie, dachte Cheftu. Diese Seuche würde im vierzehnten Jahrhundert ein Viertel der europäischen Bevölkerung auslöschen, doch die Leviten infizierten ihre Kinder absichtlich damit. Damit sie überlebten. »Was macht die Lade so gefährlich?«, fragte er.
N’tan zuckte mit den Achseln. »Die Macht el haShadays.«
Cheftu badete Daduas Weib in eisigem Wasser und unternahm alles, um ihren Leib zu kühlen. Das Fieber war so hoch, dass ihr das Haar büschelweise ausfiel. Immer wieder hustete sie Blut und sank dann in tiefen Schlaf zurück. Auch wenn er sich dabei wie ein Großinquisitor vorkam, zwang er sie zu trinken, obwohl sie kaum schlucken konnte, und ließ sie immer weitertrinken, trotz ihrer Proteste, dass sie keinen weiteren Schluck mehr aufnehmen könne. Doch sie trank, sie urinierte und trank dann noch mehr. Würde er die Krankheit aus ihrem Körper spülen können? Wie hatte sie sich überhaupt angesteckt?
Sie hatte die Bundeslade nicht einmal berührt. Nur auf eine einzige Weise konnte die Krankheit vom Thron in ihren Leib gelangt sein ...
Durch die Flöhe.
Man hatte mich schon öfter eingesperrt. Der einzige spürbare Unterschied war, dass man mich diesmal nicht in die Zelle gestoßen hatte und dass man mir zu essen gab. In jeder anderen Hinsicht war dieser unterirdische, von einer mickrigen Lampe erhellte Raum genau wie alle anderen Gefängnisse.
Die Pest?
Ich hatte bereits zwei oder drei Tage lang müßige Nabelschau betrieben, als Dadua sich zu mir gesellte. Nicht mal für einen Espresso und ein Päckchen Camels hätte ich schneller reagiert. Zufällig war ich gerade dabei, Selbstgespräche oder eher Gespräche mit Gott über die Absurdität des Lebens, die Freiheit und die Suche nach dem Glück zu führen.
»Ist unser Leben nur ein Spiel?«, fragte ich eben laut, um Dampf abzulassen. »Wir werden von einer Zeit in die nächste verschleppt und in Situationen geworfen, wo uns nichts ande-res übrig bleibt, als das zu tun, was du sagst!« Ich starrte dem Unbekannten ins Gesicht. »Haben wir denn gar keinen freien Willen mehr?«
»Was für eine Sprache sprichst du da?«
Ich wirbelte herum. Keine dreißig Zentimeter hinter mir stand der Bezwinger Goliaths, der poetische Psalmist Israels, der x-fache Urgroßvater Jesu. »Mein, mein ... Adon«, verbeugte ich mich hastig.
»Wie geht es dir?« Er blickte sich um. »Hier ist es ja muffig wie in einem Gefängnis«, stellte er fest. »Wie viele Tage müssen wir hier ausharren?«
Ich merkte, wie ein eigenartig friedliches Gefühl sich meiner bemächtigte. Strahlte Dadua etwa ein Kraftfeld aus? »Ich weiß es nicht. Wie geht es Avgay’el?«
Dadua seufzte. »Sie weilt noch in diesem Leben, doch sie ist sehr krank.«
»Ich leide mit dir.«
»Sie ist eine gute Frau, eine bessere, als ich verdient habe«, meinte er nachdenklich. Er lehnte sich gegen die Mauer und ließ sich dann auf den Strohhaufen mir gegenüber sinken. »Was hast du Shaday eben gefragt?«
»Du, du hast mich verstanden?« Ich war schockiert. Mehr als schockiert.
Er lachte kurz. »Nicht die Worte, aber den Nefesh dahinter, ken. Ich erkenne den Tonfall wieder.« Er sah mich an, ein Ro-setti mit Leidensmiene. »Was hast du ihn gefragt?«
Warum sollte ich nicht David fragen? Ich meine, wenn jemand Gott kannte, dann doch er, oder? Ich fuhr mit der Zunge über meine Lippen und kämpfte ein hysterisches Lachen nieder. Ich würde mit dem König Israels plaudern und gleichzeitig abwarten, ob ich die Pest bekam. Mannomann, das Leben konnte ganz schön verrückt sein. »Ich wollte wissen, ob ich immer noch einen freien Willen habe.«
»Weil du Sklavin warst?«
Instinktiv fasste ich an das Loch in meinem Ohr, jenes Loch, an das ich kaum mehr dachte. Fast hätte ich »Nein« gesagt, doch dann begriff ich, dass ich als Zeitreisende tatsächlich eine Art Sklavin war - je nach Blickwinkel. »Zeitweise«, antwortete ich.
»Wir sind alle Sklaven«, sagte er.
»Wie kannst du als König so etwas sagen?«
»Soll ich dir eine Geschichte erzählen?«
»B'seder.«
»Ich habe etwas Wein mitgebracht.«
Er schenkte zwei Becher voll. Ich war wie geblendet von seiner Gesellschaft; er war wahrscheinlich krank vor Sorge um seine Frau.
»Ein König ist ebenfalls ein Sklave«, erklärte er. »Als ich noch nicht König war - tatsächlich war ich auf der Flucht vor dem Zorn des Königs und musste mich in den Höhlen von Ab-dullum verstecken -, da erwähnte ich an einem heißen Tag, wie gerne ich Wasser, kühles, erfrischendes Wasser, aus dem Brunnen im Garten meines Vaters trinken würde.«
»Ken?«
»Damals lag der Garten hinter den Linien des Feindes. Dorthin zu gelangen war gefährlich, und zurückzukehren noch gefährlicher.«
»Hattet ihr kein Wasser?«
»Das ist es ja. Wir hatten Wasser. Ich sehnte mich zurück nach der Sicherheit meines Heimes, nach der Labsal, mit meiner Familie zusammen zu sein, nach den Jahren, bevor all das begonnen hatte. Dies war der Grund, weshalb ich mir Wasser aus genau diesem Brunnen wünschte.« Er seufzte. »Nun denn: Zwei meiner Giborim schlichen durch die feindlichen Linien, schöpften Wasser und kamen zu uns zurück.
Es war ein kostspieliger Ausflug. Die beiden waren in Blut gebadet, denn sie mussten mehrere Menschen töten, um an das Wasser zu kommen.« Dadua fuhr sich mit der Zunge über die
Lippen. »Ich fühlte mich so elend, ich hatte solche Angst.«
Dass er sich elend fühlte, konnte ich verstehen, doch warum hatte er Angst? »Wieso?«
»Ich hatte leichtfertig gesprochen. Nur deswegen waren sie ein Wagnis eingegangen, das sie fast mit dem Leben hätten bezahlen müssen. Nur wegen meiner Unverfrorenheit!«
»Es waren erwachsene Männer, sie haben die Entscheidung selbst gefällt«, wandte ich ein.
»Ken, doch sie haben sie meinetwegen gefällt. Damals habe ich zum ersten Mal begriffen, dass ich Macht ausübe.«
Er leerte in einem langen Zug seinen Becher.
»Die Macht versklavt einen Menschen ebenso sehr wie jeder Ring, den du jemals in deinem Ohr getragen hast, G’vret.«
»Und wie verhält es sich mit der Sklaverei durch Gott?«, fragte ich. »Woher weißt du, dass du immer das Richtige tust?«
»Das Richtige?«, wiederholte er. »Wenn du keine Götzen anbetest, wenn du deiner Familie, deinem Stamm, Shaday gegenüber treu bist . « Er verstummte. »Was bleibt außerdem noch >Richtiges< zu tun?«
Ich klappte den Mund auf, um ihm etwas zu entgegnen, doch mir fiel keine Erwiderung ein. War es wirklich so einfach?
»Meine Mutter stammt aus diesem Land, sie ist eine Cousine, deren Vater nicht nach Ägypten gezogen war«, sagte er. »Diese Menschen folgen nicht den Gesetzen, die uns, den Stämmen, gegeben wurden. Für sie ist alles ganz einfach. Sie braucht sich kein Kopfzerbrechen über den Thron, über die Reinlichkeit oder Hal zu machen. Weil sie nicht auserwählt sind, fordert Shaday nur drei Dinge von ihnen.«
»Und zwar ...?«
»Sie sollen Gerechtigkeit üben, die Gnade lieben und jeden Tag ergeben unter Shaday gehen.«
»Das ist alles?«, fragte ich.
»Sie sind nicht auserwählt, darum wird ihnen weniger abverlangt.«
»Und den Stämmen wird mehr abverlangt, weil sie auserwählt sind? Wieso das denn?«
Seufzend schenkte sich Dadua noch einen Becher Wein ein. »Auserwählt zu sein ist ein Extrem, b’seder?«
Ich nippte an meinem Becher und bemühte mich, seine Worte zu begreifen. Offenbar spürte er meine Verwirrung, denn er wurde noch deutlicher. »Auserwählt zu sein bedeutet, dass man von den Übrigen abgesondert wird, dass man kein Teil der Menge mehr ist, sondern ein Einzelwesen.« Er ließ ein Lächeln aufblitzen. »Normalerweise wird man zu einem guten oder schlechten Zweck aus einer Gruppe ausgewählt. Nimm zum Beispiel eine Opferung.«
»Die Schafe und Ziegen?« Ich musste an den Sündenbock denken, der jetzt draußen vor dem Tor auf der Müllhalde leben musste.
»Ken. Sie werden ausgesucht, als Beste ausgewählt, um ihr Blut für uns zu vergießen. Diese Auslese geschieht in einer höchst frommen Absicht, aber sie bedeutet für die Schafe nichts Gutes, nachon?«
Ich lachte. »Nachon.«
»Oder eine Gruppe von Arbeitern. Derjenige, der ausgesucht wird, ist entweder der Beste der Gruppe oder der Schlechteste, ken?«
Ich nickte.
»Siehst du?«, sagte er achselzuckend. »Wir sind auserwählt, wir sind in einer bestimmten Absicht augesucht worden. Manchmal, um den anderen ein Vorbild zu sein, um zu zeigen, wie es sein sollte. Manchmal, ach, dienen wir aber auch als abschreckendes Beispiel. >So soll es nicht seine, will Shaday den anderen Völkern damit sagen. Jetzt dürft ihr sie nicht beachten.««
»Und was hat das -«
»Mit Sklaverei zu tun?«
»Ken?«
»So wie die Schafe dem Hirten gehören und ausgesucht werden, um verzehrt oder geopfert zu werden, und so wie die Arbeiter dem Aufseher gehören und ausgewählt werden, um befördert oder entlassen zu werden, so gehört ein Sklave seinem Besitzer.« Dadua kippte seinen Becher Wein hinunter. »Wir sind Sklaven. Shaday ist unser Besitzer.« Er streckte die Hand aus. »Die Felder und Hügel gehören nicht uns.« Er rülpste. »Sie gehören Gott. Alle fünfzig Jahre fällt das Land, wer es auch gerade besitzen mag, zurück an den allerersten Eigentümer aus der Zeit, als die ersten Stammesbrüder hier Land erwarben. Dadurch sollen wir daran erinnert werden, dass wir hier nur Pächter sind.«
Er goss Wein in meinen leeren Becher. »Durch unsere eigene Klugheit haben wir es hierher geschafft, sie gibt uns Nahrung, Kleidung, ein Heim und Schutz, ken, doch nur weil Shaday das zulässt. Wenn wir seine Gesetze brechen, wird er uns töten.« Dadua lachte freudlos. »Ganz offensichtlich, nachon?« Er schüttelte den Kopf. »Dann wird uns das Land ausspucken. Und deswegen müssen wir jeden Verstoß ahnden.«
Avayra goreret avayra, spukte es mir im Kopf herum. »Ist es ein Segen oder ein Fluch, auserwählt zu sein?«, fragte ich.
Ich hatte mehrere Wendepunkte der Geschichte miterleben dürfen. War das nun ein Segen oder ein Fluch? Und dass ich hier saß und mit dem Verfasser der Psalmen theologische Fragen diskutierte: War das ein Segen oder ein Fluch?
Er lachte und schenkte sich den nächsten Becher Wein voll. »Als wir als Könige in Ägypten lebten, war es ein Segen. Als wir als Sklaven in Ägypten lebten, war es ein Fluch.«
»Also ist es ein Segen, solange ihr die Herrscher seid?«
»Lo, auch als wir selbst über uns Volk herrschten, haben wir uns manchmal verflucht. Lo, ob Segen oder Fluch hängt davon ab, was wir von Shaday glauben. Wenn Er uns straft, damit wir uns richtig verhalten, weil das uns und dem Land Gewinn bringt, dann kann selbst ein Fluch ein Segen sein.«
»Ich glaube, ich bin zu betrunken, um dir noch folgen zu können.« Mir schwirrte der Kopf. Ich blickte in meinen Becher, bis auf den Grund, und fragte mich, ob ich wohl schon arg lallte. »Es steht euch also frei zu entscheiden, ob der Becher halb voll oder halb leer ist?«
Er sah überrascht auf den Becher in seiner Hand. Dann lachte er. »Ach, weil der Weinpegel unverändert bleibt, sondern sich nur unsere Wahrnehmung ändert? Isha! Das ist eine gute Lehre!«
Ich dankte im Stillen den unzähligen Lebenshilferatgebern, in denen ich das gelesen hatte.
Dadua streckte sich. »Wir sind alle Sklaven, G’vret. Du bist möglicherweise eine Sklavin Shadays, weil du, ohne dass du es dir ausgesucht hättest, auf eine bestimmte Weise oder an einem bestimmten Ort leben musst. Doch du bist frei, wenn du dich nur dazu entscheidest.«
Am nächsten Tag erhielten wir die gute Nachricht, dass Avgay’el zwar schwach, doch immer noch am Leben war. Die zweite gute Nachricht war, dass die Krankheit, falls Dadua und ich uns angesteckt hätten, bereits hätte ausbrechen müssen. Die schlechte Nachricht war, dass ich den schlimmsten Kater meines Lebens hatte - von einem Besäufnis mit dem König von Israel.
Und schließlich hatte man einen neuen Termin für das Suk-kot festgesetzt, das auf Grund der feuerspeienden Bundeslade verschoben worden war. Zorak, der mich aus meiner Zelle befreite, erklärte mir, dass wir während des Festes alle im Freien und in Zelten leben würden, die mit den vier Arten dekoriert seien.
»Und diese Arten wären ... ?«, fragte ich, während wir durch das Labyrinth dem Licht entgegenwanderten. Als wir oben ankamen, gingen mir die Augen über, denn wir befanden uns oberhalb der Stadt und blickten auf das Milo und die Stadttore
hinab.
»Ach«, fluchte Zorak. »Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein.«
Ich blickte über meine Schulter und schnappte unwillkürlich nach Luft. Die Stiftshütte?
»G’vret«, sagte Zorak, »ich muss dich wieder nach unten bringen. Ich weiß nicht, in welchem Hof wir hier sind.«
Wir befanden uns innerhalb der aus Stoff bestehenden Einfriedung, nur wenige Schritte von jenem Zelt entfernt, in dem eines Tages die Bundeslade aufbewahrt würde. Gierig sog ich jedes Detail auf. Die Wände bestanden aus gewebten Stoffbahnen und waren an Stangen befestigt, die eine Art Umzäunung für das Versammlungszelt bildeten. Zu beiden Seiten der bronzenen Meere, die Dadua uns auf seinem Plan gezeigt hatte, waren mannshohe Kerzenständer aufgebaut. In der Mitte stand die grellbunte Stiftshütte, deren Front mit violetten, blauen und roten Streifen gemustert war. Davor erhoben sich zwei Säulen, die einzigen festen Bauten in der Nähe. Sie waren dick wie Mammutbäume und oben mit einem Fries von Granatäpfeln und Trauben ausgekehlt.
Ein Wind fuhr über das Plateau; automatisch bückte ich mich, um meine Schuhe auszuziehen. Im Jerusalem des zwanzigsten Jahrhunderts stand auf dem Tempelberg der Felsendom. Mein Vater hatte mir erzählt, dass streng religiöse Juden den Tempelberg nicht betraten, da sie nicht wussten, wo genau sich der Altar befunden hatte und sie nicht unabsichtlich auf diese Stelle treten wollten. Jetzt begriff ich, was sie empfanden.
Schrecken, Freude, Ehrfurcht.
Gottes Berg.
Wie waren wir hierher gekommen?, fragte ich mich, während Zorak mich die Treppe hinuntergeleitete, die direkt von den städtischen Kalksteingruben in den Innenhof um die Stiftshütte führte - dort wo einst der Tempel stehen würde.
Wieder landeten wir am falschen Ende, doch schließlich er-reichten wir, schon im Dunkeln, die Straßen der Stadt.
»Wann wird das Fest beginnen?«
»Sieh doch, G’vret, es hat bereits begonnen.«
Und tatsächlich gab es überall in der Stadt aus Palmblättern zusammengeflickte Unterstände, aus denen der Schein der Lampen die Nacht durchflocht. Plötzlich fühlte ich mich unsagbar einsam. »Ist dies schon wieder so ein Fest, bei dem die Männer nach Qiryat Yerim ziehen?« Ich merkte, wie sehr ich Cheftu vermisste.
»Lo, Klo-ee, von nun an befindet sich die Stiftshütte hier, daher werden die Feierlichkeiten ebenfalls hier stattfinden. Morgen findet die Prozession statt, mit der die acht Tage offiziell beginnen.«
Wir wünschten einander Gute Nacht, und ich stolperte hungrig, schmutzig und sehnsüchtig heimwärts. Mein Mann wartete mit einem warmen Essen, einem warmen Bad und offenen Armen auf mich. Ich genoss eines nach dem anderen, wenn auch nicht in dieser Reihenfolge.
Der Shofar verkündete den Beginn der Feiern. Gesänge wehten durch mein Fenster herein, was an und für sich nicht ungewöhnlich war, in dieser Lautstärke allerdings schon. Auf den Straßen drängten sich die Menschen, die Angehörigen der Stämme aus der Umgebung, die allesamt dem Hügel oberhalb der Stadt entgegenzogen. Von hier aus konnte ich auch die Stiftshütte ausmachen, die Gottes Allmacht abschirmte.
Nach den Vorfällen der letzten Woche fühlten wir uns unter einem solchen Schutz wohl alle sicherer. Innerhalb des Geländes stand das kleinere Zelt, Gottes Heim. Das warme Licht des Sonnenuntergangs strahlte auf den Tafelberg und überzog ihn mit flüssigem Gold. Mit Früchten beladene, blumengeschmückte Ochsen und Esel wurden zum Zelt hinaufgeführt. Nebenher eilten, mit Kuchen und Ölkrügen vollgepackt, die Stammesangehörigen, deren Freude nur durch die Furcht gedämpft wurde, ob ihre Gaben wohl angenommen würden.
Irgendwie musste es ganz angenehm sein, sofort zu erfahren, ob Gott einem wohl oder übel gesonnen war. Falls der Regen einsetzte, meinte er es gut. Falls nicht, dann nicht.
Man brauchte sich nicht zu verstecken, man brauchte sich keine Fragen zu stellen, man brauchte nicht lange zu bangen. Andererseits wirkte eventuelle Reue nicht spontan ertragssteigernd. Niederschlag und Bodenqualität bestimmten die Fakten. Wo die Bundeslade mit ihrer zerstörerischen Sprengkraft dabei ins Spiel kam, war mir unerfindlich.
»Hosianna!« Singend zog die Menge an uns vorbei, denn wir waren Heiden und nicht in Gottes Nähe zugelassen. Sie veranstalteten einen ziemlichen Lärm; oder vielleicht war ich zum ersten Mal während meiner Reisen durch die Zeit wirklich ein Teil der Menge. Dass ich es wirklich hörte, war unwirklich. Bevor wir wussten, wie uns geschah, wurden Cheftu und ich von der Prozession mitgezogen und von der wandernden, aufgeregten Menge aufgesogen. Mit festem Schritt und im Rhythmus der Gesänge marschierten wir bergauf, bis wir alle oben auf der Bergkuppe standen.
Der Wind war stärker und kälter geworden; er peitschte über uns hinweg. In einem wellenförmigen Muster verstummten die Menschen, denn ein Gefühl von Jenseitigkeit überkam uns. Von dieser Anhöhe aus konnte man über alle Hügel rund um Tziyon und über die gesamte Stadt blicken. Wir waren über den Rest der Welt erhöht, wir befanden uns auf der Ebene, die Jerusalem darstellte. Über uns waren nur noch die Sterne.
»Wir sehen die Welt so, wie Gott sie sieht«, flüsterte Cheftu, kurz bevor wir in Männer, Frauen und Ausländer aufgeteilt wurden.
Überall um uns herum bedeckten die Frauen ihr Haar. Durch die Menge hindurch sah ich die von tausend Fackeln erhellte Stiftshütte. Die Männer ließen die Frauen und Kinder außerhalb der Stoffmauern zurück und betraten gottgeweihten Boden. Ich drängte durch die Menge nach vorne, näher an die Bespannungen hin, bis ich das eingewebte Muster von Granatäpfeln und geflügelten Löwen erkennen konnte, bis ich das Konzert klingelnder Glöckchen hören konnte. Die Musik der Glöckchen an den Säumen der Priesterroben.
Es fragte mich niemand, warum ich zu weinen begann. Es war kein trockenes Schluchzen, über mein Gesicht strömten die Tränen. Ich war hier, aus welchem Grund auch immer. Ich durfte all dies beobachten. Hatte ich es mir so ausgesucht? Oder war ich dazu ausgesucht worden? Sollte ich mein Glück preisen? Oder hatte ich Pech gehabt? Was würde noch von mir verlangt werden, oder sollte ich fortan ein ganz gewöhnliches Leben führen? War das Drama meiner Zeitreisen zu Ende? Es war bereits Oktober, und wir hatten immer noch kein neues Portal gefunden. War es uns bestimmt, hier zu bleiben?
»Wieso immer nur die Männer?«, zischte eine Frau hinter mir.
»Ach, Dvorka, hör auf zu klagen.«
»Ich frage ja nur. Immer bekommen die Männer Jahwe zu sehen. Wieso nicht wir? Schließlich lastet auf uns der Fluch des Gebärens!«
Ganz offenbar gehörten diese Frauen den Stämmen an und waren keine Jebusi, die sich über morgendliche Übelkeit freuten.
»Psst. Das Gebären ist ein Segen.«
Dass man sie zum Schweigen bringen wollte, ließ die Frau nur noch lauter werden. Sie schnaubte. »Erzähl das mal meinen Hüften! Seit Yohans Geburt sind sie so breit, dass die eine inzwischen in Y’srael ist und die andere in Yuda!«
Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht laut zu lachen.
»Du nennst das einen Segen? Mein Yuri meint, er kann mich innen nicht mehr spüren! Er behauptet, es würde sich anfühlen, als würde er eine Grotte lieben! Und das nennst du einen Se-gen?«
»Psst. Ich glaube nicht, dass du im Angesicht Gottes von deinen Ehegeschichten sprechen solltest.«
»Gott? Wie? Weiß er etwa nicht, was zwischen Mann und Frau passiert? Er weiß das nur zu gut! Er weiß genau, warum Lilith nicht bei Adama blieb.«
Der Hohe Priester kletterte auf ein Podest, von dem aus die Edelsteine auf seiner Brust in allen Farben über die Männer schillerten. Alle konnten ihn sehen. Sein Auftritt brachte die Frauen hinter mir zum Schweigen; die Autorität seines Amtes ließ jeden verstummen. Ernst und feierlich sprach er seine Gebete. Ich konnte mir vorstellen, dass die Priester ein wenig nervös waren. Im Chor sagten wir: »Sela.«
»Warum sind also keine Frauen im Zelt?«, zischte die Frau hinter mir. »Können wir etwa weniger gut Gebete nachsprechen als die Männer?«
»Wir sind nicht dort, denn wer würde sich sonst um die Kinder kümmern?«
»Und ihre Väter können das nicht?«
Die andere Frau erwiderte nichts darauf; es kostete mich einige Beherrschung, nicht den Kopf zu drehen, um den Blick zu sehen, mit dem sie ihre Freundin höchstwahrscheinlich bedachte. »B’seder. Das war eine dumme Frage«, gab die Frau zu, die sich so laut beschwert hatte.
Der Priester sagte etwas, und auf einmal reichten die Menschen Speisen nach vorne durch. Vor uns stieg ein Mann die stufenpyramidenähnliche Treppe hoch, und wir sahen zu, wie er einem Schaf die Kehle durchschnitt. Mir wurde ein bisschen flau im Magen - doch immerhin war es kein lebendes Baby.
Wir reichten die Opfergaben nach vorne durch: Brotlaibe, Ölflaschen, Weinschläuche, Honigtöpfe.
»Die Männer könnten das also nicht?«, löcherte die Frau hinter mir ihre Freundin.
»Du würdest deinem Yuri zutrauen, deine Brote zu backen und dafür zu sorgen, dass sie unbeschadet zum Allmächtigen gelangen?«
»Er bringt die Schafe zu Shaday«, entgegnete sie.
»Die Schafe brauchen auch nur zu sterben, wenn sie hier ankommen«, sagte sie. »Dazu brauchen sie nicht in makelloser Verfassung zu sein.«
»Ach ja, und meine Brote müssen wohl vor dem Allmächtigen tanzen?«
»Lieber sie als Yuri!«
Beide unterdrückten ein Lachen. Auch ich musste mir ein Grinsen verkneifen.
Priester mit Kegelhüten und weißgoldenen Schurzen bliesen in die Shofars. Die Männer sangen mit dröhnenden Stimmen, bis der Berggipfel selbst zu beben schien. Doch wie auf einen Schlag verstummten alle. »Ein Zeichen!«, rief jemand aus. Wir reckten unsere Hälse. Abiathar, der Hohe Priester, fiel auf die Knie.
»Was ist denn? Was gibt es denn zu sehen?«, fragte die Frau hinter mir.
Jeder versuchte auszumachen, was sich vorne abspielte. Der Hohe Priester hatte nicht wieder aufgesehen, doch das Flüstern wehte durch die Menge wie ein Wind, der in einem Weizenfeld die Ähren zum Rauschen bringt. Als es zu mir gedrungen war, gefror mir das Blut in den Adern:
Der Sündenbock war wieder da, er war den Hügel heraufgeklettert und in die Umfriedung getrabt.
Und die Schärpe um seinen Hals war immer noch rot.
Als die Botschaft eintraf, saß RaEm gerade in ihrem Zelt und verfasste im Geist einen Liebesbrief, den sie nie an Echnaton abschicken würde.
»Sie übernachten heute in Hütten. Möchtest du meine Gänge erkunden?«
Hirams Gänge. Bei jemand anderem hätte diese Nachricht obszön geklungen, doch nicht bei Zakar Ba’al. RaEm erklärte dem Boten, dass sie einverstanden sei.
»Würde Meine Majestät dann mit mir kommen?«
»Sofort?«
»Unter dem Deckmantel so vieler Gäste können wir dich von einem Lager ins andere bringen, ohne dass die Wachen aufmerksam werden.«
RaEm seufzte. Sie brauchte jemanden, der sich während der Nacht um Tuti kümmern würde. Was hatte sie nur geritten, ihn mitzunehmen, diesen kleinen Buben mit der Attitüde eines Imperators? »Meine Sklavinnen werden es merken«, sagte sie.
Der Tsori trat näher. »Zakar Ba’al hat eine Doppelgängerin für dich mitgeschickt. Falls es dir recht ist, wird sie deine Kleider tragen, während du dich eine Nacht lang als sie ausgibst.«
»Wo ist sie?«
Er trat zurück und winkte jemanden ins Zelt. RaEm sah sich selbst hereinkommen - groß, schlank, mit flacher Brust, kurzem, schwarzem Haar und dunklen Augen. Langsam breitete sich ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie fand Hirams Denkweise äußerst ansprechend. »Lass uns allein«, sagte sie zu dem tsori-schen Boten.
Wenig später machten sich die beiden tsorischen Lakaien auf ihren Weg den Hügel hinab, über den Bach, um die Stadt herum und den gegenüberliegenden Hügel wieder hinauf. Als sie in Hirams Lager eintrafen, dämmerte bereits der Abend.
RaEm war schweißverklebt; es war lange her, dass sie geklettert und so weite Strecken gewandert war. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, führte sie der Agent zu den Dienstbotenzelten, durch deren Rückwände man in Hirams Zelt gelangte. Augenblicklich wurde RaEm von Hirams einbrüstigen Soldatin-nen umringt. Sie gestikulierten untereinander, dann verschwand eine in einen anderen Zeltabschnitt.
Hiram erschien im Durchgang. RaEm hatte nicht vor, ihn zu verführen, trotzdem wünschte sie sich, sie würde nicht so ver-dreckt aussehen. »Ich habe mir die Freiheit genommen, dir ein Bad vorbereiten zu lassen«, sagte er.
»Nach unserer Exkursion.«
RaEms Freude wandelte sich zu Ungeduld.
»Damit wir besser mit der Nacht verschmelzen, würde ich dir raten, dein Gesicht zu schwärzen; doch dadurch würdest du ein weiteres Bad brauchen, ehe du in dein Lager zurückkehrst.«
Das klang sinnig, doch es war ihr zuwider, derart verschmutzt loszuziehen. »Ich werde mich nach deinem Vorschlag richten«, zwang sie sich zu sagen. »Es war ein sehr kluger Plan.«
Hiram lächelte; sein Gesicht war schön, aber absolut kalt. »Sollen wir zuvor noch speisen? Die Menschen aus den Stämmen versammeln sich eben zum Abendessen.«
Es war ein schnelles Mahl aus Getreide und Geflügel. Dann ließ er ihr dunkle Kleider und Schminke für ihr Gesicht bringen. Er entschuldigte sich. Nach nicht einmal einem Dekan war er zurückgekehrt - unsichtbar wie ein Schatten in der Nacht. Sein Blick, den sie nur noch anhand seiner weißen Augäpfel ausmachen konnte, musterte sie. »Das wird genügen. Gehen wir?«
»Wohin gehen wir?«, fragte sie. Während des Umkleidens war ihr der Gedanke gekommen, dass er möglicherweise vorhatte, sie in irgendeinem dunklen Tunnel zu beseitigen.
»Du wolltest doch wissen, ob er Gold besitzt, nicht wahr?«
RaEm nickte.
»Also werde ich dich zu seinen Schatztruhen führen. So weißt du, wie viel er aufbringen kann, falls du jemals Anlass haben solltest, mehr von ihm zu verlangen.« Er sah auf ihren Mund. »Es empfiehlt sich, stets zu wissen, wie weit der andere den eigenen Bedürfnissen entgegenkommen kann, meinst du nicht auch?« Er lächelte wieder. »Außerdem hat es dich zu Tode gelangweilt, auf deinem Berghang zu sitzen und zuzuschauen, wie sie hinter ihrem Gott herrennen.«
»Und was erhoffst du dir hiervon?«, fragte sie unvermittelt, denn es störte sie, dass er sie so durchschaute.
Er zuckte mit den Achseln. »Es macht mir Spaß.«
»Dir macht alles nur Spaß«, fauchte sie. »Hat dir dein kleiner ägyptischer Schreiber auch Spaß gemacht?«
Aus seinen Augen schlugen Flammen, und RaEm revidierte ihre ursprüngliche Einschätzung. Es war nicht so, dass er keine Seele besaß; er war ein Dämon. »Ich will nie wieder ein Wort darüber hören, sonst wird es dein letztes sein.«
»Meine Soldaten würden dich töten«, erwiderte sie hoheitsvoll.
»Ich kann nicht sterben.«
In jener Nacht erhob sich Dadua in der Sukkah, die Daduas energiegeladene Kinder erbaut hatten. »Ich habe gesündigt«, sagte er. »Ich habe zugelassen, dass sich in diesem Land unsere Nachbarn mit uns mischen.« Er wandte den Blick ab. »Wir wussten nicht mehr, wie wir mit dem Totem, dem Be’ma-Thron umgehen sollten. Wir haben die Worte der Weisen auf unserem Zug vergessen. Nie wieder soll das vorkommen. Fortan soll stets ein Schreiber bei uns sein, der uns ermahnt und uns anhält, den Worten Shadays zu folgen. Es genügt nicht, lediglich über dieses Land zu wandeln.« Seine Stimme brach, doch er sprach weiter.
»Ich habe Tziyon zu einer bloßen Sache herabgewürdigt. Wenn wir die Stadt oder den nackten Boden des Berges verehren, dann sind wir nicht besser als Götzendiener. Doch« - er sah uns eindringlich an - »wenn wir uns daran erinnern, was diese Stadt für uns bedeutet - dass unsere Geschichte unsere Zukunft ist, dass Shaday ein Gebender und Schöpfer jenseits all unserer Vorstellungen ist -, dann werden wir ein Ideal für die Ewigkeit geschaffen haben. Dann wird Tziyon nie zu Grunde gehen.«
Du hast überhaupt keine Ahnung, dachte ich.
»Aus diesem Grunde werden wir, indem wir das Antlitz und die Gunst Shadays suchen, zu einem Volk werden, das die Wahrheiten unseres Gottes erkennt. Es genügt nicht, an Feiertagen die Geschichten aufzusagen. Wir müssen jedes Wort, das er je zu unserem Volk sprach, im Gedächtnis behalten.«
Ich fasste meinen Becher fester. Ich hatte mir - was dumm war, wie mir jetzt aufging - nie zuvor Gedanken darüber gemacht, dass es zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Bibel gab.
»#aMoshe hat uns Gesetze gegeben. Gesetze, die wir befolgen, ohne zu wissen, warum. Während der nächsten Woche werden wir uns jeden Abend versammeln und von neuem erfahren, warum wir diese Gesetze befolgen. Wir werden lernen, wie wir Shaday Gefallen bereiten können. Und können auf diese Weise vielleicht seinem Zorn entkommen.«
Das zaghafte Klopfen einiger Knöchel auf den Boden wurde lauter. »Außerdem«, fuhr Dadua fort, »habe ich Schritte unternommen, um diese Stadt als Königsstadt zu organisieren. Auf diese Weise können wir besser darauf achten, dass wir Shaday folgen. Der Schreiber Chavsha wird die Worte der Priester, des Tzadik aufzeichnen, damit nichts mehr verloren geht. Dieser Chronist wird -«
Hinter den Reihen der Sklaven und Konkubinen sank ich in die Hocke. Das konnte doch nicht wahr sein! Das war doch nicht möglich! Aber ich konnte die Bücher auswendig aufsagen, das gehörte zu den Dingen, die ich mir aus jenen lang zurückliegenden und weit entfernten Schulstunden gemerkt hatte.
Genesis, Exodus, Levitikus, Zahlen, Deuteronomium, Josua, Richter, Ruth, Samuel I und II, Könige I und II, Chronik I und II! Mir wurde schwindelig; das war unglaublich!
»Wir werden als Stämme neu beginnen«, sagte er. »Wir werden aus Y’srael und Yuda eine vereinte Monarchie bilden. Wir werden eine Nation sein!«
Wir klopften begeistert. N’tan erhob sich. Er war im Priesterornat, in seiner goldenen Kappe spiegelten sich die zahllosen Lichter. Er sprach ein Gebet zu Shaday und deutete dann zu Dadua hin.
Dadua sprach erneut. »Shaday wird dies für uns tun«, sagte er. »Was zählt, ist nicht das Werk unserer Hände, sondern unser Gehorsam ihm gegenüber.« Er atmete tief durch. »Darum müssen wir Shadays Worte in unseren Nefesh einschreiben, sie müssen in unser Blut übergehen.« Es herrschte gespannte Stille. »N’tan wird uns diese Worte lehren, wir werden sie uns mit jedem Atemzug einverleiben und sie nie vergessen!«
Wir klopften zustimmend, während der Tzadik nach vorne trat.
»Heute Nacht werden wir das erste Gebet lernen!«, rief N’tan. »Shaday ist der einzige Gott der Stämme!«
Der Mond stand hinter einer Wolke, was dafür sprach, dass der Gott der Stämme ihnen bald verzeihen würde, denn er würde Regen schicken. Regen. RaEm schauderte. Was für ein ekliges, unnatürliches Zeug. Das einzig Gute am Regen waren die Blitze - die waren wirklich aufregend. Sie und Hiram kletterten die bewaldete Flanke des Hügels hinauf, auf einen Abschnitt der Mauer zu, wo es keine Tore, sondern nur Wohnhäuser gab. Hiram trat an einen riesigen Baum und betastete die Borke.
Sie schwang nach außen auf! Ein Teil des Baumes war eine Tür! RaEm war sprachlos. »Wie?«, fragte sie verblüfft.
»Wir schlagen sie in Tsor, doch wir lassen die Wurzeln am Stamm. Dann können sie leicht verpflanzt werden, ohne dass dies hier auffällt«, sagte er, wobei er eine Holzplatte abnahm. »Dieses Exemplar ist schnell und grob gearbeitet. Meine anderen Arbeiten sind feiner, aber ...« Er zog die Schultern hoch.
RaEm blickte in das Loch hinab. Es war tiefschwarz, eng und stank nach Dung. Hiram kletterte rückwärts hinab, wobei sich seine langen Röcke zwischen den Beinen verfingen. Er hielt sich kurz am Rand fest, dann war er in der Dunkelheit verschwunden.
Sie hörte einen dumpfen Aufschlag und dann nichts mehr.
Das Innere des Baumes war kaum geräumiger als ihre Duschkabine im modernen Ägypten. »Kommst du?«, hörte sie ihn von unten. Sie zögerte. Konnte sie diesem Mann trauen? Er wartete ein paar Atemzüge lang. »Semenchkare, du erinnerst mich an einen Jüngling, der sich nicht entscheiden kann, ob er ein Weib beschlafen oder von einem Mann beschlafen werden möchte. Entscheide dich!«
Er sprach nicht laut, doch mit aller Deutlichkeit: Hör auf, Zeit zu verschwenden.
RaEm zwängte sich durch das Loch, fühlte aber nichts als Luft, bis Hiram sie mit unpersönlichem Griff an den Knöcheln packte. Er stellte ihre Füße auf seinen Schultern ab, und gleich darauf war sie unten. Sie krochen aus einer Kalksteinkammer in einen weiteren Tunnel. Es gab kein Licht, keine Lampen, keine Kerzen. Sie folgte allein dem Klang seiner Stimme.
Eine Zeit lang wanderten sie geduckt dahin, dann durchbrach er das Schweigen.
»Wir befinden uns unterhalb der Stadt.«
Fast schlagartig änderte sich die Umgebung. Sie ließen sich in einen Kalksteintunnel fallen, der so hoch war, dass sie aufrecht gehen konnten. Hiram förderte eine Öllampe zu Tage, dann gingen sie weiter.
»Wir befinden uns jetzt unter der Rehov Shiryon«, sagte er.
»Können sie dich hören?«, fragte sie.
»Sie sitzen alle mit ihrem Propheten zusammen«, meinte Hiram. »Auf diese Weise können wir nach Lust und Laune einmarschieren.«
Die Giborim beugten sich vor und hörten N’tan gespannt zu. Sie schienen wirklich etwas lernen zu wollen, auch wenn ich gesagt hätte, dass sie mich an Profi-Wrestler erinnerten, die sich für Stickerei interessierten. Vielleicht hatte ich sie falsch eingeschätzt?
»Unser Gott«, sagte N’tan, »ist ein eifernder Gott.«
Ich zog die Stirn in Falten.
Ich hatte gehört, er sei eifersüchtig . waren diese Worte austauschbar oder wie? Ich wollte mein fast nicht mehr existentes Lexikon durchforsten, bekam aber keine Antwort.
»Wieso können wir nicht anderen, geringeren Göttern dienen?«, fragte einer der Giborim.
N’tan zog die Schultern hoch und hob die Hände. »Warum sollten wir?«
Sie starrten ihn verständnislos an. Auch ich starrte ihn verständnislos an; es war eine so nahe liegende Frage, dennoch hatte ich sie nie gestellt. Cheftu kritzelte seine Worte nieder. Selbst er sah N’tan verdutzt an.
»Nehmen wir an, du bist haMelekh einer Stadt, ken?«, schlug der Tzadik vor.
»Ziqlag«, erwiderte der Soldat schlagfertig. »Ich regiere als haMelekh über Ziqlag.«
Dort hatte Dadua zuerst geherrscht. Alle lachten, als sich der Mann aufrichtete und sein Gewand zurechtzog, als wäre es Daduas blaue Robe. Dadua lächelte nur und sah ihm mit einem feurigen Glänzen in den Augen zu.
»Du willst Ziqlag vor den plündernden ... Hochländern beschützen«, sagte N’tan. Die Zuhörer lachten. »Nun kannst du entweder eine ganze Division ausschicken oder einen Riesen, einen Anaki. Einen Krieger, der jeden einzelnen feindlichen Soldaten niederkämpft und tötet. Oder du kannst siebenhundert Männer aussenden, die den Hochländern ebenbürtig sind. Wen schickst du los?«
»Den Riesen. Warum sollte ich so viele aussenden, wenn ich mit einem Einzigen dasselbe erreiche?«
»Nachon«, bestätigte N’tan. »Andere Götter sind nicht mehr als diese Soldaten. Sie können etwas bewirken, doch niemals so viel wie der Riese, unser Shaday. Darum: Besteht kein Bedarf an anderen Göttern.«
»Warum hat Shaday ausgerechnet uns auserwählt?«, fragte jemand.
N’tan lehnte sich zurück und zupfte an seinem Bart. »Avram lebte in einer Gesellschaft mit vielen Göttern. Nun sehet: Er sehnte sich nach mehr als bloßen Statuen und Opfergaben. Er konnte sich einen Gott denken, den man nicht in Lehm oder Gold oder Glas darstellen kann.« N’tan hob den Blick und sah den Frager an. »Avram konnte glauben. Er sah nichts, und doch konnte er glauben, dass es alles sei.«
Ich betrachtete die Zuhörer. Ob sie das kapierten? Ein paar sahen verwirrt aus, doch die Mehrheit nickte. Hatte ich das kapiert? Dies entsprach genau Daduas Konzept, »auserwählt« zu sein.
»Doch wir brauchten noch etwas«, sagte N’tan. »Disziplin, wir brauchten Disziplin. Diese Disziplin konnten wir nur in der Not erlernen, daher Avrams Reise. Er musste, genau wie wir jetzt, unterscheiden lernen, was heilig und was weltlich ist. Dafür haben wir die Gesetze - damit wir den Unterschied begreifen.«
Der Tzadik beugte sich vor. »Shaday hat uns auserwählt, weil wir die Frucht von Avrams Reisen sind. Weil wir begreifen, dass dies Shadays Universum ist, aber dass Er nicht in den Bäumen oder der Erde haust. Er steht über allen anderen Göttern, so wie ein Riese über allen Soldaten steht.«
N’tan war ein guter Lehrer. Ich spürte, wie er mich in seinen Bann zog.
»Dies also ist das erste Gesetz: Kein Gott außer Shaday für die Menschen aus den Stämmen.« Er sah Cheftu an. »Hast du das, Ägypter Chavsha?«
»Nachon.« Cheftu wischte seinen Kiel trocken.
Wir lebten in der Bibel.
»Sollen wir es noch mal versuchen?«, stand auf der Nachricht.
RaEm lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie daran dachte, wie sie sich in der vergangenen Nacht in den Tunnels verirrt hatten, wie sie verlorenen Seelen gleich durch die dunklen Höhlen der Nachwelt gezogen waren. Schließlich waren sie oberhalb der ganzen Stadt gelandet, wo sie von jenem Ort aus, wo die Stammesangehörigen ihrem Gott ein erbärmliches Zelt erbaut hatten, auf ihre armseligen Hütten hinabgeschaut hatten.
RaEm konnte ihrem Gott nachfühlen, dass er nicht in diese Stadt kommen wollte. Hier roch es nach Bäumen, es gab keinen Fluss, die Luft schmeckte dünn, dem Auge boten sich keinerlei Reize. Alles war übervölkert und strebte den Wolken zu. Wollte sie noch einmal in die Tunnel steigen, um das Gold zu sehen? Ja, sie musste. Jeden Tag konnte die Nachricht aus Ägypten eintreffen. Man würde wissen wollen, wie lange die »diplomatische Reise« des Kronprinzen noch dauern würde.
Jeden Tag konnte sie erfahren, dass ihr Geliebter gestorben war.
Sie sah den Sklaven an. »Sag deinem Zakar Ba’al, dass ich später zu ihm kommen werde.«
Er verbeugte sich und verschwand. RaEm starrte hinaus auf die grünen Bäume, die braunen Hügel, den grauen Himmel und bibberte in ihrem Leinenhemd und -schurz. Sie musste an Da-duas Gold kommen, doch wie? Ihr Finger fuhr am Schenkel entlang aufwärts bis zum Sitz ihrer Begierde. Mit Sex hatte es noch immer geklappt. Sie hatte sogar den Pharao Ägyptens umsponnen. Ein König auf seinem Schlammhügel sollte ihr eigentlich ein Leichtes sein.
Nur dass ich ihn nicht will, dachte RaEm und vergrub das Gesicht im Leinenstoff. Wieso hat Echnaton mich nur verstoßen? Wieso hat er mich vor die Wahl gestellt? Und während der erste laue Regen auf das fremde Land Tziyon fiel, weinte sich RaEm in den Schlaf.
In der nächsten Nacht hockten wir wieder alle zusammen in der Sukkah. Diesmal hatten wir etwas schneller gegessen, es hatte weniger Wein und weniger Geplauder gegeben. N’tan erhob sich und zupfte an seinem Bart. »Worin bestand unser Sündenfall in der Wüste?«, wollte er von uns wissen.
»Wir sind von Shaday abgefallen!«
»Wir haben vergessen, wer uns vor den Ägyptern gerettet hat!«
N’tan sah uns an. Offenbar hatte noch niemand die richtige Antwort genannt. »Was haben unsere Vorväter getan?«
»Wir haben uns ein Bild von Gott gemacht«, sagte Dadua.
N’tan sah den König an. »Ken, wir fertigten ein goldenes Bildnis an und nannten es unseren Gott. Ihm haben wir unsere Rettung, unsere Freiheit zugeschrieben. Wir haben es mit unseren Händen gefertigt.«
Die Künstlerin in mir horchte auf. Das war seit jeher ein interessanter Punkt in der Kunstgeschichte gewesen. Weder Juden noch Moslems ließen Abbildungen von Mensch oder Tier zu. Wieso eigentlich?
Ein paar Atemzüge lang wanderte N’tan, an seinem Bart zupfend, auf und ab. »Wen verehren die Pelesti?«
»Dagon und Astarte.«
»Ken. Und die Amori, wen verehren die?«
Die Männer spuckten auf den Boden. »Sie dienen Molekh.«
»Ken. Und worüber herrscht Dagon?«, fragte der Tzadik.
»Das Meer? Hat er nicht deshalb das Geschlecht eines Fisches?«, schlug jemand vor.
»Vielleicht ist er ein Fisch, um sich vor der Liebe im Stil der Sodomiten zu schützen!« Die Männer grölten vor Lachen, verstummten aber unter N’tans Blick wieder.
Ich merkte, wie ich wütend wurde. Sie machten sich über Dinge lustig, von denen sie keine Ahnung hatten. Aber andererseits, Chloe, ist Dagon nur ein Götzenbild, es gibt ihn nicht wirklich, und er wird tatsächlich als Fisch dargestellt. Wieso sollte man da ernst bleiben? Ich sah zu Cheftu hinüber, der sich ganz und gar auf seinen Papyrus konzentrierte und dessen
Kiel über die Seite flog.
»Und Astarte?«, fragte N’tan weiter.
»Ach! Diese liebreizende Göttin fördert die Liebe«, antwortete der Klingonen-Gibori. »Sie macht die Felder fruchtbar.« Ich entsann mich, dass jemand mir erzählt hatte, er käme aus Hatti. Dort wurde Astarte ebenfalls verehrt. Wie war er hier gelandet?
»Und wenn es eine Trockenheit gibt?«, fragte N’tan. »Wenn der Regen ausbleibt. Was tun die Pelesti und Amori dann?«
»Sie bitten um mehr, sie opfern mehr? Sie versuchen, die Blicke der Götter auf sich zu lenken?«, meinte jemand.
»Ken. Doch herrschen ihre Götter über baYam! Den Regen? Können sie beschließen, weiterzuziehen oder etwas zu unternehmen?« Auf diese Frage hin blieb es erst einmal still.
»Äh, Lo.«
»Und wieso nicht?«
»Sie sind aus Stein«, erklärte jemand im Hintergrund.
N’tan stand mit geschlossenen Augen vor uns. Er sah aus wie ein Grundschullehrer, dessen Schüler nicht davon abzubringen waren, dass die Geschenke vom Weihnachtsmann gebracht wurden. Wir wollten es einfach nicht begreifen. Selbst ich verstand ihn nicht, trotz oder gerade wegen meiner neuzeitlichen Perspektive.
»Ken. Aus Stein«, sagte er. »Und was ist dann Shaday?«
Diesmal blieb es noch länger still. Was wollte er von uns hören? Aus welchem Stoff Gott bestand? Was für eine Frage war das? Ich sah zu Cheftu hinüber. Er sah N’tan mit leicht gerunzelter Stirn an.
»Unsichtbar«, antwortete Dadua schließlich.
Allmählich begriff ich, warum er König war; er wusste auf alles eine Antwort.
»Und wieso ist es uns verboten, ein Bildnis von Ihm zu machen?«, wollte N’tan jetzt wissen.
»Weil wir nicht wissen, wie Er aussieht?«, fragte eine der weiblichen Giborim zurück.
»Lo. Weil wir nur einen Teil von Ihm darstellen könnten. Nicht alles, weshalb das Bild eine Lüge wäre«, erläuterte N’tan.
»Wieso?«, fragte Cheftu.
»Weil es unvollständig wäre. Was ist Shaday?«
Nun, wenn er unsichtbar war, dann war N’tan möglicherweise nicht auf der Suche nach einem Aufsatzthema.
»Der Verteidiger Y’sraels, Jahwe, unser Kriegsgott«, antwortete Avgay’el in ihrer sanften Stimme. Sie wirkte schwach und zerbrechlich, doch sie war höchst intelligent und offenbar oft im Einklang mit Gott.
»Nachon. Wie würden wir uns davon ein Bildnis machen?«, fragte N’tan.
Er wollte, dass wir ein Götzenbild machten? Gott in einem Bild darstellten? Hatte man schon so früh mit psychologischen Provokativfragen gearbeitet?
»Äh, eine Hand?«, war aus dem Hintergrund zu hören.
N’tan zuckte mit den Achseln. »Dann verehren wir fortan eine Steinhand?«
Sie lachten, doch es war ein nervöses, verunsichertes Lachen. Allmählich wurde klar, worauf er hinauswollte.
»Wir könnten Ihn als Herrn über Tziyon darstellen?«, schlug jemand vor.
»Wie?«
Ein jüngerer Gibori stand auf. Er zitterte so stark, dass seine Schläfenlocken zu tanzen schienen. »Wir könnten Ihn als Miniatur Har Mori’as darstellen? Mit Gold überzogen?«
»Ein Goldklumpen soll unser Gott sein?«, rief jemand überrascht dazwischen.
Der Junge errötete, während seine Gefährten sich über ihn lustig machten.
»Wie wäre es mit einem Symbol, mit ein paar Buchstaben?«, meinte jemand.
»Die was bedeuten?«
»Seinen Namen«, war von hinten, aus dem Schatten zu hören.
»Wir dürfen Seinen Namen nicht verwenden.« N’tan spähte ins Dunkel. »Er ist Gott. Wenn wir Seinen Namen verwenden würden, hätten wir Gewalt über Ihn.«
»Ihr behauptet aber, Er hätte einen Namen verwendet, als ihr gegen die Ägypter gekämpft habt?«, meldete sich Cheftu. Wie er gleichzeitig schreiben und zuhören konnte, war mir ein Rätsel. Doch er hatte Recht; das wurde behauptet. Allerdings hätte RaEm diese Behauptung aufstellen sollen. Sie war nicht hier. Ich fragte mich, ob sie erwartete, dass wir ihr heute Abend etwas zu essen brachten? Meinetwegen konnte sie verhungern, beschloss ich.
N’tan antwortete darauf. »Auf diese Weise will Er von uns angerufen werden, darum kommt dies einem Namen am nächsten. Doch ist es nicht Sein wahrer Name. Den kennen wir nicht. Wir kennen lediglich ICH BIN.«
Es wurde totenstill.
»Es gibt zwei Gründe, weswegen wir kein Bildnis von Sha-day haben«, sagte er. »Echad: Weil wir Ihn nicht richtig und vollständig darstellen können. Weder durch Buchstaben, noch durch Symbole oder die feinsten Handwerksarbeiten. Selbst der Gnadenthron ist nichts als der Schemel Shadays.« Er streckte die Hand aus. »Der zweite Grund ist elementarer. Wir sollen ein Volk sein, das hört, keines, das sieht.«
»Kannst du sie nicht hören?«, fragte Hiram. RaEm unterdrückte ein Gähnen. Sie krochen schon eine ganze Weile durch die Gänge unter der Stadt. Der ganze Boden war durchzogen von Tunnels und Gängen, Hinterlassenschaften der vielen Völker, die hier schon gelebt hatten.
Man konnte vom Palast zur Tenne oder von der Brunnenkammer zum Marktplatz gelangen. Es gab Durchgänge in Häu-ser und Läden, von denen sogar die Bewohner nichts wussten.
Die zwei Herrscher saßen im Dunklen und schöpften Atem, ehe sie die Korridore unterhalb des Palastes erforschen wollten. Dadua lagerte seine Schätze im Fels, behauptete Hiram.
»Du tust das also, weil du die Stadt willst«, sagte RaEm leise. »Und die Straße der Könige?«
»Ganz recht. Und aus einem weiteren Grund.«
»Den Schreiber, Chavsha?«, riet sie.
»Genau.«
RaEm kratzte sich unter ihrem hochgebundenen Haar. »Du hast mir nie verraten, woher du ihn kennst und weshalb du ihn mit so verzehrender Leidenschaft begehrst.«
»Das habe ich nicht.«
»Nein.« Es blieb still. Sollte sie dem rätselhaften Herrscher verraten, dass sie »Chavsha« schon viele Male besessen hatte? Dass sie ihn als Erste genommen hatte? Ihr fiel wieder ein, wie zornig Hirams schwarze Augen geblitzt hatten, als sie zum ersten Mal von einem ägyptischen Schreiber gesprochen hatte. Lieber nicht. »Jetzt hätten wir Zeit.«
Dion atmete aus. »Ich bin ihm begegnet, als ich noch jung war.«
»Du bist immer noch jung«, wandte RaEm ein. »Warst du damals ein Kind?«
Sein Lachen klang bittersüß. »Im tiefsten Sinne des Wortes war ich wirklich ein Kind. Cheftu, Chavsha, aii, das war ein Mann ... ein wirklich eindrucksvoller Mann.«
Attraktiv schon, dachte RaEm. Begnadet gewiss. Aber eindrucksvoll? Der Mann besaß keine Macht, keinen Thron, kein Gold. Was sonst konnte solche Anziehungskraft haben?
»Doch er war verheiratet?«
Hiram schwieg wieder. RaEm hakte nach. »Das ist eine komplizierte Geschichte«, erwiderte er. »Nichts ist so einfach, wie es aussieht.«
»Das weiß ich nur zu gut«, lachte sie.
Er sah sie an. »Dein Gesicht ist mir vertraut, wenn auch nicht mit diesen Augen.«
»Wirklich?«
»Es war das Gesicht meiner Tante Sybilla. Derselben Tante, die Cheftu heiratete.«
RaEm lächelte. »Sybilla. So hast du mich schon einmal genannt, allerdings habe ich damals nicht erkannt, dass das ein Name ist.«
»In diesem Moment habe ich begriffen, dass du irgendwie nicht mehr diese grünäugige Hexe bist.«
»Aii, meinst du damit Cheftus Weib?«
»Er hat offenbar eine Schwäche für grünäugige Frauen. Seine neue Frau hat auch welche.«
Sie prustete los; er wusste nicht, dass Chloe immer noch hier war? War der Mann denn blind?
»Was bringt dich zum Lachen, Pharao?«, fragte er.
»Wenn du mir deine Geheimnisse verrätst, werde ich auch meine mit dir teilen«, bot ihm RaEm an. »Doch wenn du vorziehst, es nicht zu tun, werde ich meine ebenfalls für mich behalten.«
Sie spürte seinen Blick auf ihrem Gesicht, ehe er schließlich sprach: »Wir brauchen uns gegenseitig als Werkzeug. Es gibt keinen Grund für Vertraulichkeiten.«
Das wird dir noch Leid tun, dachte sie. Ich könnte es dir so einfach machen, an deinen Geliebten heranzukommen. »Wie du meinst«, sagte sie.
»Sollen wir uns jetzt Daduas Schatzkammer ansehen?«
»Wir sollen hören, nicht schauen«, fuhr N’tan fort. »So soll unser Leben sein.«
Stimmte das? Ich schaute auf Cheftu, weil ich seine Reaktion sehen wollte. Mit starrer Miene schrieb er die Worte des Tzadik nieder.
N’tan hatte uns in Bann geschlagen. »Wo haben der erste
Mann und die erste Frau gelebt?«, fragte er.
»In einem Garten.«
»Ken. Und was geschah am Abend eines jeden Tages?«
»Da wandelte Shaday mit ihnen und sprach zu ihnen.«
»Ken. Eure Eltern haben euch die Worte der Weisen gut gelehrt. Ach, und wie sah Shaday den Weisen zufolge aus?«, fragte N’tan.
Wir schwiegen. Nirgendwo in der Bibel gab es eine Beschreibung Gottes, da war ich ziemlich sicher.
»Und was wissen wir über Seine Worte?«, fragte N’tan wenig später.
»Mit Seinen Worten erschuf er die Welt. Er trennte das Licht vom Dunkel, das Meer von der Luft«, antwortete Avgay’el.
»Nachon. Mit Seinen Worten.« N’tan ließ das eine Weile einwirken. Ich sah nicht mehr auf diese unwissenden Soldaten herab; auch ich wusste nicht, worauf er hinauswollte. »Wie haben uns die Weisen diese Worte gelehrt? Wie haben sie die Schöpfungsgeschichte weitergegeben?«
Alle schwiegen.
»Diese Geschichten wurden nur an jene weitergegeben, die unsere Buchstaben kennen, die lesen können. Und warum?«
»Weil die Buchstaben und Worte heilig sind?«, rief jemand, wenn auch zaghaft, von hinten.
»Ken. Darum werden diese Geschichten aus dem Gedächtnis von einer Generation an die nächste weitergegeben. Und zwar Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, damit sich nicht das Geringste daran ändert. Buchstabe für Buchstabe.« Er streckte die Arme in die Luft und rezitierte: »Bet, raish, alef, shin, yud, taf. Beresheth.«
Am Anfang ... Waren all diese Geschichten tatsächlich so weitergegeben worden?
Einmal hatte im Philosophieunterricht der Lehrer uns in einer Reihe aufgestellt und dem Ersten in der Reihe etwas ins Ohr geflüstert. Wir hatten diesen Satz von einem zum anderen weitergeflüstert, bis ans Ende der Reihe. Dann hatte der letzte Student laut vorgetragen, was er gehört hatte.
Der Satz hatte sich nicht stark verändert, doch er hatte sich eindeutig gewandelt. Dies, hatte der Lehrer uns erklärt, sei nur ein Beispiel, weshalb nichts, was von einem Menschen geschrieben wurde, unfehlbar sein könne. Seit jenem Tag hatte ich nicht mehr an die Bibel geglaubt. Ich meine, es waren ein paar tausend Jahre vergangen. Wenn wir innerhalb von fünf Minuten und mit fünfzehn Schülern einen Satz versauen konnten, wer wollte dann noch behaupten, er wisse, was ursprünglich in der Bibel gestanden hatte?
Genau darüber hatte ich mich mit meiner Mutter gestritten, als ich die Schriftrollen aus dem Toten Meer gesehen hatte. Die Phraseologie war die Gleiche wie in der ersten, ältesten Version der Bibel. Meine Mutter wies mich darauf hin, doch ich reagierte spöttisch. Wer konnte das schon so genau wissen?, fragte ich.
Es erübrigt sich zu sagen, dass ich jetzt beschämt an meinen Sandalen kaute! Wenn diese ersten Bücher Buchstabe für Buchstabe weitergegeben worden waren, dann waren sie keiner kulturellen Konnotation ausgesetzt gewesen. Dann waren keine Worte ausgetauscht worden, zum Beispiel »Hügel« gegen »Berg«, was letzten Endes zu einer ganz anderen Aussage führen konnte. Dadurch wären diese Geschichten, zumindest in der hebräischen Version - ich schluckte hörbar -, im Grunde unfehlbar. N’tan stand schweigend und tiefernst vor uns.
Ausnahmsweise wirkte er einmal wirklich wie ein Prophet Gottes. »Wir sollen uns kein Bildnis von Shaday machen, weil wir Seine Worte hören, Seinem Wesen vertrauen und auf unseren Glauben bauen sollen. Nicht unseren Augen, nicht den Werken unserer Hände. Wir sind nach Seinem Ebenbild erschaffen. Nicht Er nach unserem.«
Er erhob seine Hände über die Priester, Frauen, Konkubinen und Giborim und dröhnte: »Möge el haShaday euch segnen
und behüten. Möge Er Sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch gnädig sein. Sela.«
Wir antworteten im Chor: »Sela.«
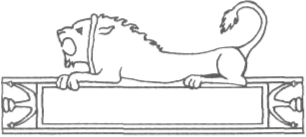
RaEm bekam glänzende Augen. Schilde aus pelestischen und jebusischen Palästen schmückten die Wände.
Weihrauchschalen, Kerzen, Lampen, durchwegs aus Gold und Bronze, mit Edelsteinen verziert und mit Silber oder Stein eingelegt, lagen im Raum verstreut. Geschmeide, mühsam gefertigt und fein geschmiedet oder auch schwer und majestätisch, lag körbeweise in der Schatzkammer aufgehäuft. Krüge voller Salben, Parfüms, Puder, Räucherwerk, Myrrhe, Pakete voller Salz und Gewürze waren schlampig an den Mauern aufgestapelt.
Hiram öffnete die Tür zu einem weiteren Raum, einem Raum voller Gold. Damit konnte sie ihr Volk retten! Damit konnte sie ihren Thron retten! Damit konnte sie sich die Treue der Priester in Waset erkaufen. RaEm brachte es nicht über sich, etwas zu berühren, sonst würde sie am Ende alles stehlen. Es war besser, wenn Dadua es ihr gab. Doch es stammte aus Ägypten; sie würde nicht stehlen, sie würde ihr Gold nur zurückholen. Dort sah sie noch eine Kartusche Hatschepsuts. Hatten diese Stämme die königliche Leibwache überfallen? Die Rüstungen aus massivem Gold, die Verkleidungen der Streitwagen, sogar die Waffen mit den Einlegearbeiten aus Karneol und Jaspis, Türkis und Beryll stammten aus Ägypten.
Wie war das möglich?
»Es gibt noch drei weitere Kammern«, sagte Hiram.
»Wie viel ist es?«, fragte RaEm.
»Wie viel?«
»Wie viel ist hier?«
Hiram seufzte und fuhr mit der Hand über sein Gesicht. »Knapp einhunderttausend Talente Gold und vielleicht eine Million Talente Silber? Ich habe keine Ahnung, wie viel Bronze es ist - davon haben sie so viel, dass sie nicht einmal hier aufbewahrt wird.«
Sie kehrten in den ersten Raum zurück. RaEm betrachtete die Schilde an den Wänden, jene Trophäen, die jeder Bergprinz und Wüstenkönig an sich nahm, wenn er eine Stadt unterwarf. Es waren mindestens sechzig Schilde, und alle waren aus Metall, größtenteils aus Gold. Knäuel von Gold- und Kupferdraht oder -kabeln lagen zusammengerollt auf dem Boden wie schlafende Schlangen. Kisten und Krüge, Tröge und Teller aus Gold, Silber und Bronze bedeckten den Boden.
Das hatte nichts mehr mit Schönheit zu tun; es war protziger Reichtum in einem Ausmaß, das sie sich nicht hatte vorstellen können. Hier, in diesem winzigen Königreich, von dem kein Mensch je gehört hatte.
»Hast du genug gesehen?«, fragte Hiram.
Sie hatte mehr als genug gesehen. Sie brauchte es nur noch nach Ägypten zu schaffen.
Und dazu brauchte sie nur .?
»Der Thron? Was ist damit?«
»Ich weiß, dass er aus einem schweren Goldüberzug über Akazienholz gefertigt wurde.«
Ihr Handgelenk lag in seiner Hand, während sie durch die schwarze Dunkelheit zu ihrem Baum zurückwanderten. »Und er ist ihr allerheiligster Besitz?«
»Genau.«
»Er schießt Blitze und bringt die Pest?«
»Genau.«
»Ich will alles.«
Seine Finger schlossen sich fester um ihr Gelenk.
Am nächsten Tag begann der Regen zu fallen - der erste Herbstregen. Weich, sanft, eher eine Dusche als einer jener prügelnd harten Wassergüsse, die ich als Regen kannte. Die Frauen in meiner Küche ließen die Arbeit liegen, liefen ins Freie und tanzten. Sie wiegten sich hin und her, drehten sich und wirbelten herum, streckten die Gesichter dem Himmel entgegen und sangen dabei.
»Deine Liebe, Shaday, strömt aus den Himmeln, Du verkündest Deinen chesed aus der Höbe. Deine Größe stehet fest wie der mächtige Berg, Deine Gerechtigkeit bleibet unergründlich wie die Meerestiefe. Du, el haShaday, bewahrest Mensch und Tier. Wie unersetzlich Dein unfehlbarer chesed«
Nie zuvor hatte ich an einem derart mit Gesang erfüllten Ort gelebt. Je stärker der Regen wurde, desto enthusiastischer wurden sie, bis sie sich unter den Armen einhakten und im Kreis tanzten. ‘Sheva packte mich am Arm, und zwar mit derselben Entschlossenheit und Leidenschaft wie damals, als wir über haMelekh gesprochen hatten. Sie zog mich in den Kreis hinein, in dem Sklavin und Besitzerin, Gläubige und Heidin tanzten und lachten - ohne dass ich auch nur wusste, warum!
Doch endlich entdeckte ich, was ‘Sheva schön machte.
Sie war eine Tänzerin. Wenn sie sich bewegte, verblassten ihre linkischen Bewegungen, ihr übergroßes Gebiss, die Glupschaugen. Sie wurde geschmeidig und schön. Ihr Leib schien keine Knochen, keine Gelenke mehr zu haben. Sie wirkte wie ein Zauberwesen, wie aus einer anderen Welt. Wie Wasser wogte sie hin und her und ließ eine Welle nach der anderen durch ihren Körper laufen.
Sie war zwar noch ein Kind, doch ihre Hüften verstanden bereits zu verführen.
Ich war nicht die Einzige, der das auffiel; nur ‘Sheva selbst ahnte noch nichts von ihrer Gabe, ihrem Talent, der Macht, die sie eines Tages durch ihre Tanzkunst über die Männer ausüben würde.
Als ich später zuschaute, wie das Wasser vom Säulengang weg durch den Hof abfloss, und zugleich Getreide nachschüttete, das ‘ Sheva mahlte, gestand sie mir, dass sie für ihr Leben gern im Regen tanzte. »Immer wenn es regnet, könnte man glauben, der Allmächtige schickt winzige Fußspuren der Freude zur Erde.«
Ich verkniff mir das Lachen - »Fußspuren der Freude«? -, denn es war ihr ernst damit. Sie sah wirklich glücklich aus.
»Manchmal tanze ich sogar beim Baden, dann gieße ich mir Wasser über den Kopf und tue so, als sei es Regen.«
Ich nickte bedächtig und schüttete langsam neues Getreide in den Mahlstein.
Cheftu spülte seine Pinsel aus und ließ sich noch einmal den vergangenen Tag und die vergangene Nacht durch den Kopf gehen. Plötzlich hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Langsam drehte er sich um, doch ohne sich seine Angst und seine Beklemmung anmerken zu lassen.
»Sei gegrüßt, Schreiber«, sagte der gegenwärtige Zakar Ba’al von Tsor; das ehemalige aztlantische Sippenoberhaupt; der einzige Mann, der jemals versucht hatte, Cheftu zu verführen, der aus diesem Grund Chloe zu töten versucht hatte und der auf Grund seiner Liebe Cheftus Leben für alle Zeiten verändert hatte.
»Dion.«
»Tausend Jahre sind inzwischen vergangen. Und du kannst mir noch immer nicht verzeihen?«
Tausend Jahre? Cheftu gab sich alle Mühe, sich sein Entsetzen nicht anmerken zu lassen. Das Elixier wirkte also? Welche Fragen konnte er stellen, und welche würden ihn verraten?
»Nichts zu sagen?«
Cheftu fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen. »Was willst du? Weshalb bist du hier?«
Dion lächelte. »Ich baue. Damit beschäftige ich mich, damit beschäftigt sich mein Volk.«
»Die Überlebenden von Aztlan?«
»Ken, wenn auch nicht von jenem Ausbruch, an den du dich erinnerst. Es gab später einen zweiten, vielleicht« - er dachte kurz nach - »vor vierhundert Jahren? Nun ist, so traurig es ist, nichts mehr übrig als ein qualmender, sichelförmiger Rest.«
Mon Dieu! Das musste der Ausbruch während der Zeit des Exodus gewesen sein! Die Hofmagier hatten Recht gehabt.
»Es erstaunt mich, dass unsere Wege sich nicht schon früher gekreuzt haben. Wo warst du?«
Cheftu hatte die vergangenen tausend Jahre nicht in Jahren durchmessen, er war in einem Augenzwinkern durch sie hindurchgeschlüpft. Doch wenn er Dion von den Zeitreisen erzählte, von den Portalen und den Steinen, würde er einen Mann in Versuchung führen, der ihr noch jedes Mal erlegen war. »Ich war hier und da«, antwortete er ausweichend.
»So wie ich. Nur wenige Menschen genießen das Leben so wie wir, Cheftu.« Dions Blick drang in sein Innerstes. »Ich war überzeugt, dass du gestorben warst, obwohl keine weise Frau je in der Lage gewesen war, deinen Schatten anzurufen.
Andererseits war es ausgeschlossen, dass jemand so vollkommen verschwindet. Nicht einmal ein Gerücht über dich ist mir zu Ohren gekommen.« Er zog die Stirn in Falten und nahm einen von Cheftus Federkielen. »Und doch bist du hier aufgetaucht, du musst also irgendwo gesteckt haben. Man kann schließlich nicht einfach in der Geschichte untertauchen und wieder auftauchen, oder?«
Genau das kann man, dachte Cheftu. Ganz genau. »Was soll diese Verkleidung?«, fragte er.
Dion zuckte mit den Achseln. »Hiram der König könnte nicht das einfache Leben eines Arbeiters genießen.«
»Und was soll das Altern?«
Dion reckte sich und offenbarte dabei den Körper eines Mannes in den besten Jahren: mit breiten Schultern, schmaler
Taille und festen Beinen. »Hiram der Baumeister lebt nun schon viele Jahre. Ewige Jugend, das habe ich inzwischen gelernt, ruft zwei Arten von Reaktion hervor. Entweder die Menschen weichen ängstlich vor dem Unbekannten zurück oder sie begehren es so sehr, dass sie dafür töten würden.«
»Diese Erfahrung hast du gemacht?«
Dion nickte und sah Cheftu aus zusammengekniffenen Augen an. »Du sprichst, als hättest du anders gelebt. Was für Geheimnisse bewahrst du in deiner Brust?«
Cheftu musste alle Kraft aufbringen, um nicht wegzuschauen. »Nicht mehr als du, Dion.«
Der Dunkle beugte sich vor und hob einen Pinsel von Chef-tus Tisch auf. »Wie ich sehe, hast du eine neue grünäugige Frau gefunden. Ein bezauberndes Wesen.«
Er wusste nicht, dass Chloe immer noch am Leben war. »Das ist sie«, stimmte Cheftu ihm gelassen zu.
Dion kam näher. »Was für einen Zauber trägst du in dir? Tausend Jahre sind vergangen, und ich begehre dich immer noch. Es ist mir egal, was du getan hast, dass du den Geist meiner Tante aus ihrem Körper gelöst hast oder welchen Dämon du jetzt hier leben lässt. Mir sind die aberhundert grünäugigen Frauen gleich, die du gehabt hast. Ich will nur dich. Seit tausend Jahren will ich einzig und allein nur dich.«
Cheftu starrte in Dions Augen.
Er entdeckte Liebe darin, genau dieselbe Liebe, die er in Chloes Augen sah, daher wusste er, dass Dions Gefühle aufrichtig waren. Er entdeckte Lust, Leidenschaft und die Pforten zu Dingen, die er sich lieber nicht ausmalen wollte. Dion war ihm ein Freund gewesen, ein Vertrauter und Verbündeter, ein Mann, den er geachtet und bewundert hatte. Früher einmal hätte er sein Leben für diesen dunklen Griechen gegeben.
Bis Dion in Cheftus Leben Gott gespielt hatte.
In einem Augenblick extremer Angst und extremer Manipulation hatte Dion ihm ein Elixier verabreicht, das angeblich das ewige Leben gewähren sollte. Dieses Mittel hatte Cheftu vom Abgrund des Todes zurückgerissen und seither immer wieder in sein Leben eingegriffen.
Die Sklaventreiber hatten Cheftu härter geschlagen, weil seine Wunden schneller heilten. Als er auf der Insel oder in der Wüste dem Tod geweiht war, als er nach drei Tagen des Star-rens in die Sonne hätte erblinden müssen, als er beinahe von den Briganten ermordet worden wäre, die sie in der Wüste überfielen, war ihm nie etwas zugestoßen. Schmerzen unter der Misshandlung, Qualen, die Todeswünsche in ihm weckten, die Raserei der Folter, und alles ohne Unterlass.
Und im Hinterkopf peinigte ihn Tag für Tag das Wissen, dass Chloe das Elixier nicht genommen hatte.
Dass die Geburt eines Kindes sie ihm womöglich entreißen würde.
Sie konnte ertrinken, zu Tode stürzen, von einer Waffe gefällt werden oder an einem Knochen ersticken, und er wäre für alle Zeit allein. »Nein«, antwortete er Dion. »Meine Antwort bleibt dieselbe.«
»Versuche es, Cheftu. Lass dich nur einmal von mir berühren, dann wirst du sehen, ob du etwas empfindest. Lass mich dich kosten -«
»Nein.«
»Ich kann dir helfen«, bot er an. »Ich biete dir Gold, Macht, Ansehen, alles, was du willst.«
Cheftu trat einen Schritt vor. Sein Blick war hart. Dion sah nur noch auf seinen Mund. »Sieh mir in die Augen, Dion«, warnte Cheftu. »Und höre die Wahrheit, die meine Lippen sprechen.«
»Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn ich dich nur küssen will.«
Cheftu knirschte mit den Zähnen. »Du würdest nicht verstehen, was ich will. Ganz gleich, was du denkst, du kennst meine Seele nicht. Und das, was du getan hast, bedeutet nicht, dass du mich besitzt, nicht einmal zum Teil.«
Wieder machte er angriffslustig einen Schritt auf Dion zu. Dion wich keine Handbreit. Angewidert bemerkte Cheftu, dass sein Widersacher erregt war. »Ich weise dich ab, weil ich meine Frau liebe. Und sollte sie mir, was Shaday verhindern möge, morgen genommen werden, würde das nichts an meiner Entscheidung ändern. Ich liebe sie, diese Frau, deren Leib so kostbar ist und Leben schenken kann, deren Verstand fruchtbar und scharf ist, deren Geist mich belebt und umfängt.« Er legte die Hand auf Dions Brust. »Du. Nicht.«
Cheftu schubste Dion von sich weg, sodass jener überrascht rückwärts taumelte. »Treib mich nie wieder in die Enge, geifere nie wieder nach mir, mache dir nie wieder meinetwegen Hoffnungen. Weder jetzt noch irgendwann. Nein.«
Er drehte sich um, tauchte seinen Pinsel wieder ein und fuhr mit seiner Niederschrift fort.
»Du wirst diese Worte noch bereuen, Ägypter«, drohte Dion. Und verschwand.
Die nächste Nacht verblüffte mich. Ich hatte geglaubt, die Zehn Gebote zu kennen. Die meisten westlichen Gesetzeswerke hatten ihren Ursprung in diesen schlichten, doch bindenden Bestimmungen. Ich rechnete fest damit, N’tan über Ehebruch oder Mord oder die Lüge sprechen zu hören, doch er fing an, von Festtagen zu reden.
Festtagen?
Er ließ sich darüber aus, dass die Stämme das Passahfest und das siebentägige Fest des Ungesäuerten Brotes in Ehren halten sollten. Dann erklärte er, sie sollten auch Shavu’ot feiern, das Fest der Wochen, und Sukkot, das Laubhüttenfest - das wir zur Zeit begingen. Bei diesen drei Festen sollten die Menschen der Stämme vor Shadays Angesicht stehen.
Das nächste Gesetz, verkündete N’tan, sei ganz einfach.
»Koche kein Zicklein in der Milch seiner Mutter.«
Das war’s. Finito. Dies waren die Gesetze der Stämme. Ein bisschen was über die Feiertage, die Sache mit dem keinen anderen Gott und dem keinen Bildnis von Gott, noch ein paar Merksätze über das Auslösen mit Blut ... und ein Gesetz, dass man kein Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen soll. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht laut zu plärren: »Was zum Teufel soll das denn?« Stattdessen sprach ich mit allen anderen zusammen: »Sela.«
Erst auf dem Heimweg brach es aus mir heraus. »Was ist mit den Zehn Geboten? Ich dachte, die solltest du niederschreiben! Die Gebote, die N’tan da angeführt hat, die er den Stämmen beigebracht hat, sind nicht die, die ich kenne. Was meinst du dazu?«
»Wenn man die sprachlichen Abweichungen berücksichtigt«, setzte Chef tu an.
»Lo. Auch mit sprachlichen Abweichungen lässt sich nicht erklären, warum es nicht heißt: >Du sollst nicht begehrenc, >du sollst Vater und Mutter ehren< und >du sollst nicht töten.c«
Er gab mir einen Kuss auf den Handrücken, doch es war kein erotischer, sondern ein rein nachdenklicher Kuss. »Wir haben das Gebot, keine Götter neben Shaday zu haben.«
»Ken. Weil man Ihn eifernd nennt, ist Er ein eifernder Gott.«
»Das Gebot, sich kein Bildnis von Ihm zu machen.«
»Richtig. Zumal nach der Katastrophe, dass sie nur wenige Monate, nachdem Shaday sie durch das Rote Meer geführt hat, Hathor angebetet hatten.« Wie hatten sie nur an ihm zweifeln können? Das mit dem Roten Meer hatte ich mit eigenen Augen beobachtet, und es hatte mein ganzes Leben verändert.
Na ja, wenigstens ein bisschen beeinflusst.
Okay gut, ich war also nicht anders. Auch ich zweifelte immer noch, obwohl ich das mit dem Roten Meer gesehen hatte.
»Doch statt all der Gesetze über Freunde und Familie, Ehrlichkeit und Gier folgen ein Haufen Vorschriften über Opfer und Feiertage«, beschwerte ich mich.
»Das Werkzeug, mit dem dieser Glaube am Leben erhalten wird, ist das Gedächtnis«, sagte Chef tu. »Genau wie N’tan erklärt hat. Wenn sie Shaday im Gedächtnis bewahren, und zwar durch all die kleinen Gesten - indem sie ihren Wein und das Brot segnen, ehe sie es verzehren, indem sie sich von fremden Völkern absondern, so wie sie die Aprikosenbäume von den Birnbäumen absondern - dann werden sie Shaday auch in den wichtigen Dingen leichter im Gedächtnis behalten.«
Wir gingen in unser immer noch ungeschmücktes, so wie fast alles ungeschmückt war, Haus. Cheftu zündete die Lampe an, während ich sofort auf den Balkon trat.
Ich zweifelte nicht daran, dass er mit seinem Einwand Recht hatte. Doch das beantwortete nicht meine Frage, ob die Zehn Gebote noch fehlten und warum. »Wie konnten die Gebote erst so und später ganz anders sein?« Ich drehte mich um und sah Cheftu an. Er starrte über meine Schulter in eine Ferne, die ihm ganz allein vorbehalten war.
»Vielleicht ...«, sann er nach, »vielleicht war es ja umgekehrt.«
Ich sah ihn abwartend an. Seine Augen waren mit Bleiglanz umschminkt, und in seinen Ohrringen blitzte das Licht der Lampe auf. Wie konnte es umgekehrt gewesen sein?
Schließlich sprachen wir hier über die Zehn Gebote.
»Diese Gesetze machten aus einem Haufen von Sklaven eine organisierte Armee«, meinte er gedehnt.
»Ken?«
»Vielleicht waren sie die allerersten Gesetze, der erste Versuch einer Organisation.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Meine Miene musste das verraten haben.
»Als sie aus Ägypten kamen, hatten sie jahrhundertelang als Diener gelebt. Und was tut ein Diener?«
»Dienen?«, meinte ich ironisch.
Cheftu zog eine Braue hoch.
»B’seder. Sie bedienen, sie schuften, sie -«
»Aber sie fällen keine Entscheidungen«, sagte er.
Ich verstummte. Ein Sklave hat keine Gelegenheit, selbstständig zu denken. Wir hatten nur ein paar Monate lang als Sklaven gelebt. Man hatte uns zu essen, etwas anzuziehen und ein Obdach gegeben und uns gesagt, wann wir wo zu sein hatten. Nach ein paar hundert Jahren hatte ein Volk bestimmt vergessen, wie man Entscheidungen fällt und ausführt. Nicht weil die Menschen zu dumm waren, sondern weil man ihnen diese Fähigkeit ausgeprügelt hatte. Die Apiru hatten also immer jemanden gehabt, der ihnen sagte, was sie tun sollten: Und über Nacht hatten sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen?
»Sie haben also ihre Aufseher gegen Shaday eingetauscht?«, fragte ich. Wieder kam mir Dadua und seine Theorie von Shaday als Sklavenbesitzer in den Sinn.
Cheftu hatte sich auf dem Mauersims niedergelassen und zog mich an seine Seite. »Denk doch mal nach. Die ersten Gesetze waren einfach und leicht zu befolgen. Sie drehten sich vor allem um Opferriten, denn die hatten sie auch als Sklaven beobachtet und konnten sie daher verstehen.
Weil sie unter Menschen gelebt hatten, die ihre Erstgeborenen verehrten, gaben ihnen die Bestimmungen, den Erstgeborenen auszulösen und nicht ohne ein Geschenk vor Shaday zu erscheinen, das Gefühl, einen Gott zu verehren, der dem ihrer Nachbarn ähnlich, wenn auch nicht gleich war. Diese Dinge waren ihnen vertraut.«
Er küsste meine Schulter und sprach dann weiter. »Die Feiertagsgesetze waren ihnen auf Grund ihres ägyptischen Erbes ebenfalls leicht begreifbar. Der religiöse Kalender und das Tabu, Götzen anzubeten, waren das Erste, was sie lernen mussten.«
»Weil ihnen das noch frisch im Gedächtnis war?«, meinte ich.
»Ken. Sie hatten erst kürzlich Hathor, das Goldene Kalb, angebetet. Man musste ihnen erklären, was daran falsch gewesen war.«
Ich nickte, denn jetzt konnte ich seinem Gedankengang folgen.
»Die von dir angeführten Gesetze, jene Gebote, die ich aus dem Katechismus kenne, waren viel komplizierter. Sie waren für Menschen bestimmt, die sich an den Gedanken gewöhnt hatten, dass sie ihr eigener Herr waren.«
»Also wurden diese Gesetze nicht von Moshe niedergeschrieben?«, fragte ich.
»Nein, von Shaday.«
»Das verstehe ich nicht«, gestand ich auf Englisch.
»Die ersten Tafeln hat Shaday selbst geschrieben, nachon?«, fragte Cheftu.
Der Film »Die Zehn Gebote« zog vor meinen Augen vorbei, wobei das Gesicht des Schauspielers durch das dunkeläugige Antlitz Moshes, des ehemaligen ägyptischen Kronprinzen, ersetzt wurde. Ein Blitz, vorgeblich der Finger Gottes, hatte die Gesetze in Steintafeln gemeißelt. Dann war Moshe den Berg hinabgestiegen, hatte die Steine auf den Boden geschleudert und sie dabei zerbrochen.
»Den Weisen zufolge«, antwortete ich zaghaft.
Cheftu lachte, gab mir einen Kuss auf den Hals und schlang die Arme um mich. »Ken. So erzählen es die Tzadikum. Nachdem haMoshe sein Volk bestraft hatte, stieg er den Berg wieder hinauf und nahm die Zehn Gebote mit eigener Hand auf.«
Ich drehte mich zu ihm um. »Willst du damit sagen, sie haben sie im zweiten Durchgang ein wenig geglättet? Weil die Menschen einfach noch nicht reif dafür waren?
Die Zehn Gebote, die ich kenne, die Mimi mir so oft aufgesagt hat, wären demnach die erste Fassung, doch sie waren zu kompliziert, sodass Moses und Gott eine Version für Abc-
Schützen hinterhergeschickt haben?«
Er zuckte mit den Achseln, ein Sinnbild gallischer Nonchalance. »Abraham hat mit Gott um ganz andere Dinge gefeilscht, wer will das also so genau sagen?«
Es war ein verblüffender Gedanke. »Du glaubst also, dass die Regeln, die Shaday selbst in Stein gemeißelt hat, jene Zehn Gebote waren, die wir kennen? Und jene, die haMoshe dem einfachen Volk vortrug, waren dann jene, die er beim zweiten Mal erhielt?«
Ich konnte mich nicht mehr stillhalten. Ich sprang von der Brüstung. »Die Gesetze, die N’tan aufgeführt hat, wären also der zweite Satz, den Moses erhalten hat? Die einfache Version, die Trainingsgebote? Dies sind die Gebote, die er selbst niedergeschrieben hat?«
Cheftu blieb lange stumm. »Es wäre denkbar, denn die Zehn Gebote, wie wir sie kennen, erforderten für eine Herde von Sklaven ein viel zu komplexes Denken.« Lächelnd fing er mit den Händen die Spitzen meiner Haare. »Es sähe Shaday ähnlich, zwei Pläne zu erstellen, einen für die Gegenwart und einen für die Nachwelt, die einander aber nicht widersprechen. Die Gebote, die wir hier befolgen, sind sehr körperliche Gebote. Die späteren Gebote sind eher geistiger Natur, sie richten sich an unser inneres Selbst.
Du kennst nur die Letzteren, doch in der Heiligen Schrift stehen beide Versionen.«
Ich war nicht sicher, ob ich mit ihm einer Meinung war.
»Was meinst du - in welcher Sprache hat Gott sie wohl niedergeschrieben?«
»Man wäre geneigt zu sagen Hebräisch«, antwortete Cheftu. »Die Urim und Thummim tragen hebräische Inschriften, wir wissen also, dass die Sprache bereits existierte.
Und geschrieben wurde.«
»Und in welcher Sprache hat Moshe seine verfasst?«, fragte ich weiter.
Cheftu klappte den Mund auf; in diesem Augenblick spürte ich denselben Kick wie er. »In Hieroglyphen?« Seine Stimme stieg um eine Oktave an.
Und über noch etwas hatte ich mir Gedanken gemacht.
»Wo befinden sich wohl die Gebote, die Gott selbst niedergeschrieben hat?«
»In der Bundeslade.«
SECHSTER TEIL