»Wo in Midian?« Wo lag Midian?
»Können wir ihnen zuvorkommen? Oder besser, können wir es ihnen später abnehmen?«
Er kratzte sich an der Nase und zog die Achseln hoch. »Ja, Meine Majestät. Sie haben es bereits ausgegraben. Wenn in den nächsten« - er zählte es an den Fingern ab - »drei Tage ein Truppenkontingent lossegelt, könnten wir ihnen das Gold abjagen, ehe sie nach Jebus zurückkehren.«
»Macht es so«, zitierte RaEm aus einer Fernsehserie. Sie hatte eine Schwäche für Jean-Luc Picard gehabt, er hatte einen geschorenen Kopf wie ein Ägypter. Er hatte über das gesamte Raumschiff Enterprise geherrscht. Ein vernünftiger und mächtiger Mann.
Es war das Einzige gewesen, worin sich RaEm und Chloes Schwester Camille einig gewesen waren.
»Bereitet alles vor. Ich werde mit euch kommen«, sagte sie. Ich hole Tuti, und wir kommen beide mit, dachte RaEm. Wir verlassen Achetaton, wo man uns nicht haben will, und erobern die Herzen der Soldaten, indem wir mit euch reisen.
Er verneigte sich und wich rückwärts aus dem Raum.
Danke, Hathor, hauchte sie.
Dafür baue ich dir einen goldenen Tempel. Lass mich nur erst meinem Volk zu essen geben. Lass mich nicht allein.
MIDIAN
Seit Tagen sprachen die Sklaven kaum ein Wort.
Alle marschierten in ehrfurchtsvollem Schweigen durch den schlüpfrigen, saugenden Sand. Cheftu bildete inzwischen die Nachhut, damit keiner zurückfiel. Alle waren gesund und kräftig, aber keiner versuchte zu fliehen. Unter dem tiefen Gewölbe des Himmels bekam sogar die Sklaverei etwas Tröstliches, sie erschien wie eine Art Heimat, sie gab ein Gefühl von Zugehörigkeit.
Dann blieben alle wie auf Kommando stehen und bildeten eine Menschenmauer. Cheftu drängte sich nach vorn und stellte dabei fest, dass sie einen kleinen braunen Hügel hinaufgestiegen waren, der in all dem Sand gar nicht aufgefallen war. Er kam um eine Biegung und sah nach oben.
Wie eine Burg stieg der Berg aus dem Wüstenboden auf. Zwei Gipfel zeichneten sich kohlenschwarz gegen den blauen Himmel ab. Keine Menschen, keine Tiere, nur der Berg. Hatten sie überhaupt das Recht, in Gottes Festung einzudringen?
Die Führer deuteten den Hügel hinunter. Die Führer selbst würden nicht mitkommen, sie würden nicht in das Tal der
Amaleki hinabsteigen oder gar den Berg Gottes betreten.
Cheftu übernahm die Esel mit dem übrig gebliebenen Proviant, dankte den Führern und machte sich an den Abstieg in Richtung Har Horeb - Moses’ Berg.
An ein paar struppigen Büschen und Bäumen vorbei, die aus der trockenen Erde aufragten, durchquerten sie die Ebene auf den größer werdenden Berg zu. In der Abenddämmerung hatten sie den Fuß erreicht. Vierzig Jahre waren vergangen, seit die letzten Angehörigen der Stämme hier gewesen waren. Trotzdem waren die Spuren ihres Aufenthalts unübersehbar. Die Lagerbefestigungen waren ebenso zu erkennen wie die Steinhaufen, die anzeigten, wo die einzelnen Stämme gelagert hatten. Die Sklaven, von denen viele den Stämmen angehörten, machten sich sofort ans Werk, das Lager neu aufzubauen.
Cheftu wanderte unterdessen am Fuß des Berges entlang und sah sich um. Schlampig in den Stein gehauene Inschriften verkündeten, dass es den Tod bedeutete, diesen Berg zu berühren, außerdem war etwa alle zehn Meter ein kleinerer Steinhaufen als Grenzstein aufgeschichtet.
Als Cheftu den Altar für das goldene Kalb entdeckte, spürte er, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Seitlich war eine unbeholfene Darstellung eingeschnitten, auf der die Göttin Hathor verehrt wurde. Wo hatten sie bloß das Gold versteckt?, fragte er sich. Doch ein Ruf hielt ihn davon ab, danach zu suchen. Eben traf die zweite Abteilung ein. Offenbar hatten Chef-tus Führer sie quer durch die Wüste geführt und dabei einen anderen Weg genommen als die Angehörigen der Stämme und Moses.
Wo hatte Gott mit den siebzig B’rith gespeist?
Nachts, nachdem die zweite Gruppe ihr Lager aufgeschlagen, gespeist und gerastet hatte, baute sich N’tan vor ihnen auf. Der Berg glühte bläulich, Millionen - oder »Milcharden und Aber-milcharden«, wie Chloe sagen würde - von Sternen prangten am Himmel. Der Mond war nur eine schmale Sichel und legte kaum Licht auf N’tan. Der Prophet führte die Männer durch einen Psalm nach dem anderen und punktierte die Nachtluft mit »Sela«-Ruten.
Cheftu merkte, wie der Rhythmus ihn ergriff und seinen Geist durchfuhr, bis ihm jede nur erdenkliche Tat vollkommen normal erschien. Wie ein Mann folgten die Männer N’tan und bauten sich jeweils zwischen zwei Grenzsteinen auf. Cheftu hatte das Gefühl, außerhalb seines Körpers zu stehen, so teilnahmslos beobachtete er, wie vierzig Männer im Dreck zu buddeln begannen.
Er hatte schon eine ganze Weile gegraben und mit bloßen Händen die Erde in seinem Bereich zwischen zwei Grenzsteinen weggeschabt, als er plötzlich etwas spürte, Stoff? Überall um ihn herum wühlten die Männer eingewickelte Päckchen aus dem Sand. Er packte den Gegenstand mit beiden Händen und zog. Das unförmige Objekt löste sich so unvermittelt aus dem Boden, dass er auf den Rücken kippte und das Ding auf seiner Brust landete.
Mit bebenden Fingern fummelte Cheftu an dem Stoff herum und riss ihn mit einer Gier beiseite, die er sich niemals zugetraut hätte. Staunend hielt er seinen Fund in das blaue Licht des Berges. Ein Götzenbild, eine Statue aus reinem Gold - mit herausgeschlagenem Gesicht.
>»Ihr sollt euch kein Bildnis machenc, so hat Shaday verkündet«, sagte N’tan in seinem Rücken. »Sieht er aus wie einer der Götter, die du angebetet hast, Sklave?«
Cheftu buddelte weiter im Sand. In gemeinschaftlicher Arbeit hoben sie einen Graben aus, den die ersten Zekenim mit dem Gold der Ägypter gefüllt hatten.
Geisterhaft im blauen Licht des Horeb leuchtend, kniete N’tan neben ihm nieder. Und endlich erkannte Cheftus fehlerfreies, wenngleich langsames Gedächtnis ihn unter dem langen Haar und dem jugendlichen Aussehen wieder.
»Du bist ein Imhotep!«
Der Hochmut im Gesicht des Tzadik war wie weggefegt.
»Und du bist der Reisende, der Nomade in den Leben meiner Familie.« Seine Augen wurden groß. »Ist die pelestische Göttin die andere?«
War Cheftu so vom Licht, vom Mysterium und Mirakel dieses Ortes durchdrungen oder hatte er wirklich gehört und verstanden, was N’tan, der N’tan der Bibel, da sagte? »Du bist ein Imhotep?«, wiederholte er.
Die Antwort sprach dem Mann aus den Knochen, aus seinen Augen, aus seinem Körperbau. Wie viele tausend Jahre waren vergangen? Wie viele Treueschwüre hatten die Imhoteps inzwischen abgelegt? Am Hof von Aztlan? An den vielen Höfen Ägyptens? »Wie kommt es, dass du Jude bist?«, fragte Cheftu.
N’tans verwirrte Miene verriet Cheftu, dass er Französisch gesprochen hatte. Wahrscheinlich gab es den Ausdruck »Jude« noch gar nicht. »Du gehörst den Stämmen an?«
»Du bist ein Verehrer des Einen Gottes«, gab N’tan zurück.
Ein Schrei lenkte sie ab und ließ Cheftu herumfahren. Unter dem langsam dahinziehenden Mond wuchs der Schatz immer weiter an. Je länger die Männer im Sand scharrten, desto mehr Armreifen, Statuen, Votivgaben, Kerzenhalter, Weihrauchgefäße wurden den glitzernden Haufen hinzugegeben.
Die Reichtümer raubten ihnen den Atem, blendeten sie und schlugen sie in Bann. Nicht einmal der Prunk im Grab eines Pharaos hätte es damit aufnehmen können. Und all dies hatte le bon Dieu in seinem Ratschluss den Israeliten zukommen lassen. Talente und Tonnen aus Gold und Bronze, mit Türkisen, Karneol, Jaspis und Jade besetzt. Ornamente aus Silber, Figurinen aus Elfenbein. Im Schatten von Gottes Berg wuchs ein Goldberg heran. Immer weiter drangen die Männer vor und gruben dabei riesige Stücke aus, Samoware und Räder - goldbeschlagene Räder von Pharaos geschlagener Armee -, Statuen, Brustpanzer, Kragen, Armbänder ... Cheftu fühlte sich wie betäubt angesichts dieser Pracht.
»Du und ich, wir werden uns unterhalten.«
N’tan erhob sich aus der Hocke.
»Heute Nacht muss ich alles von diesen Männern fordern. Der Graben zieht sich um den gesamten Berg herum.« Er streckte Cheftu die Hand hin. »Ich heiße Imhotep und stamme einer langen Linie von Imhoteps ab, auch wenn man uns Yofa-set nennt, ein weniger nach Kemt klingender Name, wie er einem Angehörigen der Stämme entspricht.«
Cheftu stand ebenfalls auf. »Ich habe viele Namen, doch nur einer entspricht dem Mann, zu dem ich herangewachsen bin.« Er verbeugte sich.
»Cheftu sa’a Khamese aus Ägypten.«
»Gemeinsam werden wir dem König eines freien Volkes den Schatz eines Pharao bringen«, erklärte N’tan.
Sie knieten Seite an Seite im bläulichen Licht nieder und gruben weiter.
JEBUS
Bald hatte man sich in Jebus an meinen Anblick gewöhnt; tatsächlich hatte ich sogar gelernt, den Krug auf der Schulter zu tragen - wenigstens halb voll. Wieder einmal stieg ich die Stufen hinab und warf einen kurzen Blick auf die Wachen, doch ich blieb still und zurückgezogen. Würde sich eine Frau in meiner Lage nicht tatsächlich so verhalten?
Unten warteten bereits die Frauen aus der Stadt. Ein paar nickten mir zu, aber keine sprach mich an. Als Fremde kam ich immer als Letzte an die Reihe. Gerade als ich den Eimer anhob, um ihn durch das unsäglich kleine Loch hinabzulassen, das immer noch mein Todesurteil bedeutete, hörte ich hinter mir ein Geräusch. Ich wandte mich um und sah, dass es das Mädchen von meinem ersten Tag hier war, die Schwangere.
Ihr Gesicht war von feuchten Spuren überzogen, als hätte sie geweint. Doch andererseits fiel die Beleuchtung hier unten eindeutig in die Kategorie »indirekt«, ich konnte mich also auch täuschen. Nachdem ich vier Eimer Wasser hochgezogen hatte, war ich für den Rückweg bereit. Sobald ich den Krug behutsam auf die Schulter geladen hatte, drehte ich mich um.
Sie weinte tatsächlich. Sie hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und bebte lautlos. Ich sah an dem Wachposten vorbei. Er schnitzte vor sich hin und gab sich alle Mühe, uns nicht zu beachten. Auch wenn mir das vollkommen geistlos vorkam, beugte ich mich vor und flüsterte: »Hakol b ’seder?« Ist alles in Ordnung?
Augenblicklich versiegten ihre Tränen. Sie sah auf, offenkundig fassungslos, dass ich sie angesprochen hatte.
Oder überraschte es sie, dass ich sie beim Weinen ertappt hatte? »Ken, ken«, sagte sie und nickte hastig dabei, ohne meinen Blick zu erwidern. Ihre Hände schoben sich schützend vor ihren Bauch. Einen Moment lang blieb ich schweigend vor ihr stehen, dann zuckte ich mit den Achseln und wünschte ihr einen guten Tag.
Als ich die Treppe - die ich mit Inbrunst hasste - zur Hälfte hinaufgestiegen war, hörte ich Schritte hinter mir. »Isha?«, rief sie. »Isha?«
Vorsichtig meine Balance und die des Kruges wahrend, wandte ich mich ihr zu. »Ich heiße Waqi«, sagte sie. »Mein Mann ist Kaufmann und auf Reisen. Würdest du ... gern zum Zenit das Brot mit mir teilen?«
»Wie viel Wasser brauchst du?«, fragte ich. Mittlerweile hatte ich gelernt, dass die Frauen der Jebusi nur sehr indirekt um meine Dienste baten, normalerweise in der Form einer freundlichen Einladung.
»Lo, lo. Du sollst mir nur Gesellschaft leisten«, sagte sie. »Ich werde eine Sklavin zum Wasserholen schicken.«
Ich blinzelte die Tränen zurück. Wie lange war es her, seit ich mit jemandem gesprochen hatte, der einfach nur mit mir zusammen sein wollte und nicht sofort fragte, was ich für ihn tun konnte? »Todah, aber gern.«
»Mein Haus liegt abseits des Platzes an der Rehov Abda«, sagte sie. »Ich erwarte dich dort.«
Auf dem Weg zu ihrer Wohnung an der Rehov Abda fiel mir auf, dass ich vieles noch nicht begriffen hatte. Zum einen war die Rehov Abda das Gegenstück zum Highland Park in Dallas; reich, aufgemotzt und auf Äußerlichkeiten bedacht. Selbst die Sklaven wirkten hier hochnäsig. Zum Zweiten war Waqis Mann niemand anderer als der Bronzelieferant für fast alle Handwerker. Die beiden gehörten zur High Society.
Was in aller Welt wollte sie mit mir? Meine Unsicherheit verstärkte sich zusätzlich, als ich von einem assyrischen Haushälter mit scheelem Blick von der Vordertür zur Hintertür geschickt wurde. Als ich hinten angekommen war, ließ man mich im Hinterhof Platz nehmen und warten.
Plötzlich fiel mir wieder ein, was ich am Anzeigenverkaufen am meisten gehasst hatte: das Warten. Beinahe eine Stunde lang hockte ich dort in der Sonne und sinnierte, wie es Cheftu wohl ergehen mochte, als ich plötzlich von oben jemanden rufen hörte. »Isha!« Es war die Frau. Sie winkte und verschwand dann vom Fenster.
Sekunden später wurde die Tür aufgerissen.
»Ich habe gar nicht gewusst, dass du schon da bist!« Sie warf dem blöde glotzenden Assyrer an ihrer Seite einen zornigen Blick zu. »Komm herein, komm herein, wasch dir die Füße, erfrisch dich.«
Sie setzte mich auf einen Hocker. Als ich mich vorbeugte, um meine Sandalen auszuziehen, begann sie zu tch’en.
Eine Sklavin kniete vor mir nieder. Sie löste die Bänder meiner Sandalen und badete behutsam meine Füße, während eine weitere Sklavin ein kühles Getränk - eine Art Jogurt - und ein Tuch für mein Gesicht brachte.
Das Gesicht konnte ich mir keinesfalls waschen, sonst würde ich meine aufgeschminkte Tarnung verwischen. Ich tupfte mich nur ein bisschen ab und sah dann zu, wie die Sklavin meine Füße abtrocknete. Waqi erwarte mich, erklärte mir die andere Sklavin. Ob ich die Güte hätte, ihr zu folgen?
Wir stiegen die Treppe hinauf, eine dunkle, schmale Treppe in einem dunklen, schmalen Haus, allem Reichtum zum Trotz. Teppiche bedeckten Boden und Wände. Auf jedem Treppenabsatz standen leere Samoware. Überall stolperte man über Lampen, Armleuchter und Stehlichter. Schließlich traten wir auf das Dach, wo ein niedriger Tisch, umgeben von bunten Kissen, aufgestellt worden war.
Ich fühlte mich an Daduas Palast erinnert.
»Bitte«, lud Waqi mich ein, »setz dich und iss.«
In der Sonne erkannte ich, dass sie jung war. Verdammt jung. Vielleicht fünfzehn? Und unglücklich dazu; ihre Augen waren vom vielen Weinen angeschwollen. Nur selten nahm sie die Hände aus der schützenden Position vor ihrem Bauch.
Schweigend aßen wir zu Mittag: gedämpftes Getreide, Gemüsefladen, Gurken- und Zwiebelsalat in Gewürzessig, dazu tranken wir Wein.
»Vielleicht möchtest du deinen Wein mit Wasser verdünnen«, schlug ich vor, »schließlich bist du -« Ich deutete auf ihren Bauch. Entsetzt beobachtete ich, wie Tränen in ihre Augen schossen. »Hakol b’seder«, plapperte ich hastig weiter, »ein wenig Wein wird dir nicht schaden, aber zu viel, also, das wäre nicht gut für das Baby, obwohl ich überzeugt bin, dass es deinem gut geht und so . ich meine .«
Chloe, halt den Schnabel.
Sie schluchzte schweigend. Ich ließ mein Brot fallen, krabbelte zu ihr hinüber, nahm sie in die Arme und wiegte sie. Die Frau krallte sich an mir fest und begann zu heulen, als hätte ihr jemand das Herz aus dem Leib gerissen. »Meine Eltern stammen nicht von hier«, schluchzte sie unter Tränen. »Mein Vater hatte keine Ahnung, was es für mich bedeuten würde, hier zu leben. Er hat es wirklich nicht gewusst. Sonst hätte er der Heirat nie zugestimmt .«
Das löste die nächste Tränenflut aus. Armes Kind, dachte ich und strich ihr übers Haar.
»Ich weiß wirklich nicht, wie die Frauen das aushalten«, fuhr sie fort. »Ich überlege die ganze Zeit, wie ich darum herumkomme, aber mir fällt nichts ein. Wohin sollte ich auch gehen? Was sollte ich dort anfangen?«
In meinem Gehirn begannen sich die Fragen zu überschlagen.
Sie löste sich von mir, wischte sich übers Gesicht und versuchte zu lächeln. »Möchtest du etwas Halva?«, bot sie mir den Nachtisch in gezwungen heiterem Gastgeberinnen-Tonfall an.
Du bist eine Sklavin, Chloe, rief ich mir ins Gedächtnis. Ich kehrte an meine Seite des Tisches zurück. Eine weitere Sklavin tauchte auf, servierte uns die mit Honig gesüßte Sesampaste und zog sich wieder zurück.
»Du lebst außerhalb der Stadt?«, fragte sie.
»Ja.«
»Es muss sehr anstrengend sein, jeden Tag durch das Tor zu gehen.«
Auf jeden Fall, vor allem wenn man jede Nacht von Yoavs Soldaten verhört wird, ob es Fortschritte gibt.
»Ken.«
»Mein Mann kommt erst in einigen Wochen zurück. Ich .«
Sie rang um Haltung. »Meine Zeit kommt bald. Ich habe keine Familie.«
Ich nickte.
»Möchtest du vielleicht zu mir ziehen? Ich habe noch ein Zimmer im ersten Stock. Es ist recht schlicht, aber es gibt eine Strohmatte dort, und es ist luftig. Natürlich wärst du mein Gast, aber ich würde auch verstehen, wenn du weiterhin deine Dienste anbieten möchtest.«
Ich konnte nicht glauben, dass sie mir ein Zimmer anbot!
»Und was ist mit den Wachen?«, fragte ich.
Sie zuckte mit den Achseln. »Ich bin Waqi bat Urek, Gemahlin von Abda, einem Cousin ersten Grades des Königs. Es wird keine Probleme geben.«
Rehov Abda - die Straße war nach ihm benannt.
Ich legte mein Halvastück ab. Das war ideal! Ich würde bei ihr wohnen können, während ich nach einer Möglichkeit suchte, allein aus der Stadt zu fliehen oder sie mit einer Armee einzunehmen. Das nenne ich die Gastfreundschaft ausnutzen, Chloe, seufzte ich in mich hinein. »Das würde zu viele Probleme geben. Ich kann dich nicht derart ausnutzen.«
Ich hörte ihr volles, aufrichtiges Lachen. »Mir liegt nur an deiner Gesellschaft, Isba. - Wie heißt du eigentlich?«
Verrate nie deinen wahren Namen, Chloe, im Namen liegt Magie, hörte ich Cheftu sagen. »Takala.«
»Takala, wie hübsch.«
Ich lächelte und fühlte mich hundeelend.
»Takala, ich bitte dich nicht aus Großherzigkeit, bei mir zu wohnen. Meine Zeit kommt bald, und dann hätte ich gern eine andere Frau bei mir, und zwar keine Sklavin.«
»Was ist mit den Frauen am Brunnen?«
Sie lächelte traurig. »Ich stamme aus einer Familie von Assy-rern, und die werden hier verachtet. Allerdings ist es in beiden Völkern Tradition, dass die Frau des Hauses das Wasser selbst holt. So verlangt es die Ehre eines Hauses und einer Familie.« Sie wandte den Blick ab. »Auch wenn ich am Brunnen nicht gern gesehen bin, würde ich meine Familie doch nicht dadurch entehren, dass ich eine Magd zum Wasserholen schicke. Das schickt sich nicht. Außerdem«, sagte sie und sah dabei zu mir auf, »verehre ich Ishtar, die Göttin der Geburt, der Liebe, der kindlichen Zuneigung. Die anderen verehren Molekh.« Ihr Tonfall wurde schärfer. »Eine solche Frau will ich nicht an meinem Wochenbett haben.«
Ideologische Differenzen, dachte ich. Ach, der Nahe Osten blieb sich durch alle Zeiten hindurch gleich. »B’seder. Ich bleibe bei dir«, sagte ich.
Waqi lächelte und holte mit einem Klatschen ein paar Sklavinnen herbei.
»Perfekt, Isha.« Yoav lächelte mich in der Dunkelheit des Zeltes an. »Jetzt hast du einen Vorwand, länger zu bleiben.« Er schlug mir auf die Schulter. »Wie lange wird es deiner Meinung nach dauern, uns in die Stadt zu führen?«
Praktischerweise hatte ich vergessen, ihm gegenüber zu erwähnen, dass die Öffnung im Brunnen so gut wie nicht vorhanden war. Man konnte das als Selbsterhaltungstrieb bezeichnen. Waqi hatte noch etwa zwei Monate bis zur Entbindung, dadurch blieben mir noch zwei Monate zum Planen, um Zeit zu schinden, um Cheftus Rückkehr abzuwarten. »Etwa drei Monate?«
Yoavs Blick war berechnend. »Bis zum Ende des Sommers?«
Ich zuckte mit den Achseln. Klar, warum nicht?
»Wie können wir mit dir Verbindung aufnehmen?«
»Dadurch würde ich meine Tarnung verraten«, sagte ich. »Es wird schwierig werden, schließlich bin ich ständig mit anderen Menschen zusammen.«
»Isha«, versprach Yoav, »wir werden mit dir in Verbindung bleiben. Wir werden dich nicht aus den Augen lassen, keinen Atemzug lang.«
Ich sah in seine glasgrünen Augen. Wie viele Städte hatte er schon geplündert? Wie viele Menschen ermordet?
»Wieso willst du diesen Posten haben?«, fragte ich, noch ehe ich begriff, dass ich die Worte ausgesprochen hatte.
Selbst er wirkte verblüfft. Und dann nachdenklich. »Dadua ist mein Onkel«, sagte er langsam, »auch wenn ich mehr Jahre zähle als er.« Er lächelte über irgendeine Erinnerung. »Dadua war schon immer ein spindeldürres Kind mit feuerrotem Haar, das ständig herumrannte und aus vollem Halse sang. Fast von Geburt an umschmeichelte er die Frauen im Harem, er war den alten Kameraden seines Vaters geistig haushoch überlegen, er beleidigte seine Brüder so geschickt, dass Tage vergingen, ehe sie es auch nur begriffen hatten.« Yoav sah mich an. »Dadua verkörpert das Leben schlechthin, er ist göttliche Kraft in ihrer reinsten Gestalt, ähnlich Yahwes Shekina-Kräften.«
»Ich dachte, Shekina sei eine Göttin?«
»Ach! Das sagen die Frauen, doch Yahwe ist einfach alles. Männlich und weiblich, dunkel und hell, Freude und Tränen.« Yoav zog die Schultern hoch. »Die Frauen ziehen Yahwes Mächte über die Nacht und über den Leib heraus und verleihen diesen Kräften einen Namen - Shekina. Doch die Shekina Yahwes, die Energie, die Nishmat ha hayyim, kann unmöglich von ihrer Quelle abgelöst werden.«
»Wenn du an Nishmat ha hayyim, an den göttlichen Odem glaubst, wie kannst du ihn dann so vielen Menschen rauben? Wenn das Leben heilig ist, wie kannst du dann deinen Lebensunterhalt mit Morden verdienen?«
»Weil Dadua es nicht kann, wenn er jenen Teil seines Wesens nicht verlieren will, welcher der Shekina-Ruhm Yahwes ist.«
»Dadua tötet nicht?«
Yoav warf den Kopf zurück und lachte. Der Schein der Lampe flackerte über die Muskeln in seinem Hals und seiner Brust und dämpfte die Narben auf seinem Gesicht. »Natürlich hat Dadua schon getötet. Doch es bereitet ihm Qualen. Sollten diese Qualen schwinden, sollte das Töten für ihn zum Beruf werden, dann wird das Licht der Shekina verglühen.« Yoav schüttelte den Kopf. »Y’srael würde leiden, und wir alle würden etwas Reines, Schönes verlieren, sollte Dadua werden wie wir alle. Gewöhnlich. Berührbar.«
»Darum befleckst du lieber deine Hände und dein Haupt mit
diesem Blut?«
»Ken«, bestätigte er. »Dadua ist ein Mensch und ein König, doch für Yahwe ist er das liebste seiner Kinder. Wir, Daduas Familie, müssen ihm diese Unschuld bewahren. Er überschreitet die Gebote nicht so wie wir.«
»Ach! Wie kannst du so etwas sagen? Er ist ein Erdung!«
Manche Worte hörten sich in der Übersetzung ausgesprochen befremdlich an.
»Das ist er. Doch sein Fleisch kennt keine Lust, keinen Hass und keinen Mord. Er ist wie Bronze, die niemals fleckig wird. Um seiner Reinheit willen werde ich in Blut baden.« Yoav sah mich an. »Das Land muss erobert werden, daran gibt es keinen Zweifel. Jene unter uns, die ihn lieben, müssen das bewirken, und sie müssen die ausgelöschten Leben auf ihre eigenen Seelen laden, nicht auf seine.«
Ich starrte ihn an, ich schaute in seine klaren grünen Augen, während sich tiefes Schweigen über uns senkte. Dies war Davids Henker, und er handelte aus den reinsten Motiven, die ich mir für ein solches Gemetzel ausmalen konnte. Machte das die Sache besser? Verzeihlicher? Ich wusste es nicht, doch plötzlich hatte ich das Gefühl, kein Urteil über ihn fällen zu können. Hatte ich jemals jemanden so geliebt?
Cheftu eingeschlossen?
»Ich bin mit Avgay’el einer Meinung«, erklärte ich leise. »Du verdienst es, Rosh Tsor zu werden.«
Er stand auf und streckte mir die Hand hin. Ich ergriff sie, und er zog mich hoch. »Dein Mann ist immer noch in der Wüste«, sagte er. Plötzlich fiel mir auf, wie nahe wir beieinander standen, wie dunkel sein Blick und wie warm das Zelt geworden war.
Und plötzlich fiel mir auf, dass meine Hand immer noch in seiner lag. Ich zog sie zurück. »Todah, ich danke dir, dass du mir das erzählt hast.«
In verlegenem Schweigen standen wir voreinander. »Gut.
Wir werden dann Verbindung mit dir aufnehmen, Klo-ee.« »Laylah tov, Yoav«, sagte ich in seinen Rücken.
Er drehte sich noch einmal um.
»Lo, heute Abend beginnt der Sabbat. Shabat shalom.«

10. KAPITEL
Heute war die Nacht der Nächte. Ich hatte die Tage seit meinem Treffen mit Yoav akribisch mitgezählt. Am Tag nach dem Sabbath würden die Soldaten die Stadt für einige Stunden unbeobachtet lassen. Und mir damit ein Zeitfenster öffnen.
Wir hatten Vollmond, was mir die Reise erleichtern würde. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich Waqi im Stich lassen musste, die ein wahrer Schatz war und Besseres verdient hatte. Doch wenn ich blieb, würde ich sie verraten müssen, genau wie Shamuz am Brunnen und Yorq, die mir Brot verkaufte. Sie alle waren wirkliche Menschen, dies war kein Spiel, dies war kein Computerkrieg. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, sie zu verraten.
Darum würde ich mich aus der Stadt schleichen. Mit geschnürtem Bündel behielt ich von meinem Zimmer aus die Straße im Auge. Heute Nacht war eine Menge los, unzählige Menschen eilten mit kleinen Lampen hin und her. Traurig warf ich meinen Umhang über und schlich die Treppe hinunter. Draußen ging ein Wind; er fühlte sich wunderbar an, so ungestüm und frei, als könnte er mich hochwehen und irgendwo anders wieder absetzen.
Ich hätte fast alles dafür gegeben, Cheftus Hand in meiner zu spüren und mit ihm gemeinsam den Abend zu genießen. Nachdem ich die Tür hinter mir zugezogen hatte, eilte ich durch die Straßen, immer im Schatten bleibend, wie ich hoffte. Auf meinem Weg fielen mir dutzende von schaukelnden Lichtern auf, ein stetiger Fluss, der durch das Mülltor aus der Stadt talwärts strömte. Die Menschen gingen ins Tal? Mitten in der Nacht?
Bizarr. Im Altertum standen die meisten Menschen mit der Sonne auf und gingen auch mit ihr zu Bett. Die Tage waren lang und hart; sie hatten die Ruhe dringend nötig. Ganz zu schweigen von den Ängsten vor den vielen Gefahren, die einem in der Nacht drohten. Was wurde hier gespielt? Sie wollten doch bestimmt nicht alle aus der Stadt fliehen?
Innerlich jubilierend ging ich durch das Mülltor hinaus, wobei ich die vielen Abfallhaufen umging - der Grund dafür, dass dieses Tor als Mülltor bezeichnet wurde. Ich war frei! Auf dem Weg den steilen Hügel hinab blies mir der Wind den Umhang aus dem Gesicht und fuhr mir unter die Röcke. Ich hielt einen Moment inne und sah mich noch einmal um, um einen letzten Blick auf Jerusalem zu werfen: Es kam mir so vor, als würde die Stadt von tausenden Glühwürmchen erhellt; in den Fenstern brannten Lampen, an den Mauern waren Fackeln angezündet worden, in den Toren loderten Kohlenpfannen. In der Luft lag der schwere Duft von Geißblatt, Rosen und Kräutern.
Vorsichtig den felsigen Untergrund abtastend, suchte ich mir einen Weg durch die immer schwärzer werdende Finsternis. Es war still, und die vielen Lichter, die ich anfangs gesehen hatte, waren verschwunden. Je tiefer ich ins Tal hinabstieg, desto weniger spielte der Wind mit mir und desto schwerer wurde der Duft der Blumen.
Als ich die Abzweigung zur Talsohle hinunter passierte, weil ich lieber auf der Straße nach Yerico bleiben wollte, hörte ich eine Art Schrei. Ich blieb kurz stehen und nahm dann den Weg in Richtung Süden.
Noch während ich abbog, schlug mir Gestank entgegen.
Ein widerwärtiger Gestank nach verkohlendem Fleisch. Er überdeckte den Duft der Zitrusblüten, das Geißblatt und sogar den leichten Hauch nach Immergrün von den Hügeln.
Luft in mein Gesicht fächelnd, beschleunigte ich meine
Schritte, bis ich um eine Ecke bog. Und dann sah ich, woher der Gestank kam.
Etwa zwanzig Meter unter mir brannte am Grund einer schmalen Schlucht ein Feuer. Ein paar Schritte davon entfernt standen dicht gedrängt unzählige Lampen - die Menschen, die so plötzlich verschwunden waren? Was ging hier vor? Ein tiefes Summen wie aus der Carmina Burana stieg zu meinem Pfad herauf.
Neugierig wagte ich mich ein paar Schritte nach unten, um mir die Sache näher anzusehen. Nur langsam passten sich meine Pupillen den grell aus der Dunkelheit leuchtenden Flammen an.
Vor meinen Augen drängten die Menschen immer näher an das Feuer heran. Schließlich näherte sich eine einzelne Gestalt, die jemand anderem einen Gegenstand überreichte. Ich kniff die Augen zusammen. Der Rauch, der Gestank, der meine Kehle verklebte, und der gespenstische Gesang wirkten geradezu surreal. Dann warf die zweite Gestalt, die den Gegenstand entgegengenommen hatte, etwas ins Feuer. Etwas Kleines. Die erste Gestalt war wieder verschwunden.
Verbrannten sie hier ihren Müll? Dem Gestank nach war das durchaus möglich. Ich presste die Hand auf die Nase und atmete durch den Mund. Schließlich mischte ich mich unter die Menge, weil mich interessierte, welcher Müll hier verbrannt wurde, dass sich so viele Menschen darum versammelten. Unter dem Singen hörte ich ein hysterisches Schluchzen und Flehen, auch wenn die Worte nicht auszumachen waren. Im Näherkommen erkannte ich, dass das Feuer nicht in einer Höhle, sondern im Bauch einer riesigen hässlichen Statue brannte.
Ein zweiter Mensch näherte sich und überreichte dem Werfer ein kleines Paket. Ein weinendes Paket. Ein winziges Wesen.
Alle meine Haare stellten sich auf.
»Nein«, entfuhr es mir auf Englisch. »Nein!« Ich schlug mir die Hand über den Mund, wobei es gleichgültig war, ob ich es tat, um nicht zu speien oder um nicht laut zu schreien. Das nächste Bündel flog in die Flammen. Zwei Männer hielten eine Frau zurück, eine brüllende Frau. Der Wind wehte in meine Richtung, sodass ich ihre Worte verstand: »Lo! Nicht mein Kind! Nicht mein teures Lämmchen! Verflucht seid ihr! Lo, nicht mein Kind!«
Sie opfern ihre Kinder, hörte ich im Geist Yoav sagen. Ich weiß nicht, wie die Frauen das aushalten, setzten mir Waqis Worte zu. Wenn mein Vater das nur gewusst hätte - o mein Gott. Und dies hier erwartete sie ebenfalls?
Bemüht, keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, setzte ich meinen Weg nach unten fort, entsetzt und strauchelnd und ohne recht begreifen zu können, was ich da gesehen hatte. Vor mir ging noch jemand, zum Glück mit leeren Händen.
Eine verhüllte Gestalt näherte sich, überreichte dem Werfer ein Baby und taumelte dann zurück, während der Mörder das Kind über seinen Kopf erhob, den Himmel anrief und das Baby schließlich ins Feuer schleuderte!
Die Gestalt vor mir knickte ein, wie ein Mantra »Lo« murmelnd. Ich war wie vom Blitz getroffen. Das hier hatte ich doch gewiss nicht, ganz gewiss nicht wirklich gesehen. Die Bilder wollten einfach keinen Sinn ergeben, obwohl der Geruch nach versengtem Fleisch, den ich zu meinem Leidwesen wieder erkannte, mir fast den Atem verschlug. Und nur allzu real war.
Fast wäre ich über die Frau vor mir gestolpert. Sie quiekte auf, und ich sah nach unten. Sie versuchte wieder aufzustehen, war aber so dickbäuchig, dass sie es nicht schaffte. »Waqi«, flüsterte ich.
Entsetzt sah sie auf. »Du gehörst auch dazu?«
»Lo, lo«, sagte ich schnell.
Weiteres Geschrei, weiteres Flehen hinter mir. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sollte ich mich auf den Priester stürzen? Ich musste Waqi fortschaffen; ich war auf der Flucht aus der Stadt ... o Gott.
Der Schrei eines Kleinkindes stieg zum Himmel auf und ging gleich darauf in den Gesängen der Betenden unter.
»Zu unserem Schutz geben wir dir Blut.
Um uns zu retten, geben wir dir unser Fleisch«
Es war ein grässliches Lied.
Ich kehrte zu Waqi zurück und half ihr auf. »Was tust du hier?«, flüsterte ich.
»Ich musste es sehen, mit eigenen Augen sehen. Lieber würde ich mir das Leben nehmen als zuzuschauen, wie mein Kind stirbt.« Ihr Gesicht fiel in sich zusammen, und Tränenspuren glänzten im Licht der Flammen. »Seine ersten drei Frauen haben diesen Kummer nicht überlebt.«
Sie war Abdas vierte Frau? »Wir müssen hier weg«, sagte ich. »Du kannst ihn noch heute Nacht verlassen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Heute Nachmittag haben die Wehen eingesetzt. Mein Kind kommt schon.«
Es gab bei weitem nicht genug Flüche in meinem Vokabular. Stattdessen hörte ich in meinem Kopf immer nur Prissys Geständnis aus Vom Winde verwebt. »Gibt es hier eine Hebamme? Eine weise Frau?«, fragte ich sie.
»Wenn ich eine hole, werden sie es erfahren . ich kann das Kind nur schützen, indem ich behaupte, ich hätte es verloren.«
Damit wären logistische Albträume verbunden, doch das war egal. »Wir gehen zurück in die Stadt.«
Waqi hinter mir herziehend, drängelte ich durch die Menge.
»Sie werden es erfahren, sie werden es erfahren«, beharrte sie.
Ich schob meine Nase gegen ihre. »Wenn du versuchst, das Kind allein zu bekommen, wirst du sterben. Und das Kind ebenfalls. Wenn du eine Hebamme rufst und dir helfen lässt, dann können wir dich und das Kind vielleicht aus der Stadt schmuggeln, aber wenigstens werdet ihr beide überleben.«
»Wohin wolltest du?« »Ich wollte gerade fliehen.«
»Vor mir?«
»Lo, du warst die Güte selbst zu mir. Ich habe -«
»Du bist keine einfache Brunnenmagd, habe ich Recht?« Sie stützte sich auf mich und hatte ihre Finger in meine geschoben. Immer wenn die Wehen einsetzten, quetschte sie meine Hand, doch ansonsten ließ sie sich ihre Beschwerden nicht anmerken.
»Lo«, sagte ich, »ich bin eine Spionin.«
Ihre Hand presste meine noch fester, und sie blieb kurz stehen. Als sie wieder sprach, kamen ihre Worte abgehackt. »Für wen?«
»Die Hochländer. Sie wollen eure Stadt einnehmen.«
Sie keuchte und brach mir praktisch die Finger. Ich spürte, wie ihre Beine neben meinen zu zittern begannen und sie alle Kraft aufbringen musste, um nicht einzuknicken. Ich sah zu der Stadt hoch, die ich eigentlich nie wieder sehen wollte. Sie war etwa vierzehn Lichtjahre von uns entfernt.
»Haben die Hochländer Kinder?«, fragte sie im Weitergehen.
»Ganze Heerscharen.« Ich schob meine Hand um ihre Taille, falls sie ins Stolpern kam.
»Ich wünschte, sie würden bald einmarschieren«, sagte sie. »Ich würde ihnen die Stadt sofort überlassen.« Ihr Griff wurde fester, doch sie kam nicht aus dem Schritt.
»Wieso tun sie das?« Der Gestank verschmorenden Fleisches brannte mir immer noch in der Nase; obwohl wir uns bereits der Stadt näherten, roch ich die Rosen nicht mehr.
»Zum Schutz. Jedes Kind, das sie Molekh geben, verwandelt sich in einen weiteren Dämonenwächter über die Stadt. Deshalb wurde die Stadt noch nie eingenommen.« Sie ging wimmernd in die Knie.
Ich sah mich um; wir befanden uns am Rand der Müllhalde -nicht gerade der ideale Platz, um ein Kind zur Welt zu bringen. »Komm, Waqi, nur noch ein kurzes Stück.« War irgendwo ein Wachposten? Während sie Atem schöpfte, suchte ich die Mauern, die Müllgrube, die Bäume um uns herum ab. »Hilfe!«, rief ich. »Ist da jemand?«
Waqi kreischte auf und schlug sich augenblicklich die Hand vor den Mund. Ich ging vor ihr in die Hocke. »Was ist? Werden die Schmerzen schlimmer?«
»Das Fruchtwasser«, keuchte sie. »Die Blase ist geplatzt.«
Ich stand auf und sah mich um. Nirgendwo regte sich etwas, kein Laut war zu hören. Der Rauch aus dem Tal überzog den Nachthimmel. Ich nahm den Dialekt an, in dem Yoav gelegentlich redete, und sprach laut und mit tragender Stimme: »Du hast gesagt, du würdest mich nicht aus den Augen lassen. Ich brauche deine Hilfe. Um Yahwes Liebe willen, steh uns bei!«
Bildete ich mir wirklich nur ein, dass ich Blicke auf mir spürte? Nichts regte sich. Ich kniete neben ihr nieder. »Leg deinen Arm um mich«, sagte ich. »Ich werde dich tragen.«
Ihren linken Arm über meine Schulter ziehend, richtete ich mich wieder auf. Sie war klein, aber schwanger und vor Schmerz halb besinnungslos. Wir hatten die Müllgrube zur Hälfte durchquert, als er uns in den Weg trat: der Soldat aus Mamre, der mir vor meinem ersten Treffen mit Yoav durch die Straßen gefolgt war. Ich wusste nicht einmal, wie er hieß. Wortlos nahm er sie hoch.
»Waqi«, sagte ich, ohne ihre Hand loszulassen. »Was sollen wir den Wachen sagen?« Der Soldat aus Mamre sah nicht aus wie ein Jebusi; vielleicht wie ein Pelesti?
»Heute Nacht gibt es keine Wachen«, keuchte sie. »Wir haben Molekhs Mond. Sie, sie -« Wieder schrie sie auf.
»Isha«, sagte er zu ihr. »Drück dein Gesicht in meinen Umhang, b’seder«
Waqi vergrub ihr Gesicht an seiner Brust. »Zeig uns den Weg, schnell«, sagte er. »Sie kann die Beine nicht länger zusammenhalten. Das Kind kommt gleich.«
Wir platzten durch die Tür des Hauses in der Rehov Abda.
Der Assyrer erfasste mit einem einzigen Blick die Situation und eilte uns unter ständigen Anrufungen Ishtars voran in Wa-qis Zimmer. Der Soldat legte sie auf der Strohmatte ab und sah mich an. Ich starrte mit großen Augen zurück.
»Keine Hebamme?«, fragte er.
»Das Kind wird sonst geopfert«, antwortete ich. Waqi war klatschnass vor Schweiß, darum zogen der Assyrer - der Um hieß - und ich sie aus, badeten sie und wickelten sie dann in trockene Tücher. Ihre Schenkel waren mit Blut verschmiert. Mir war elend zu Mute - was sollten wir nur tun? Der Soldat hatte uns den Rücken zugedreht und war mit irgendetwas beschäftigt.
Waqi schrie auf, weshalb wir eine weitere Decke über sie warfen. Uru eilte zu ihr und redete in einer mir unverständlichen Sprache auf sie ein. »Wo kann ich eine Hebamme finden?«, fragte ich die beiden. »Das ist unsere einzige Chance.«
Der Soldat drehte sich um und spießte Waqi mit seinem spektralblauen Blick auf. »Ich habe schon Lämmer, Kälber und Esel entbunden. Ich kann helfen, dieses Kind auf die Welt zu bringen, und es vor diesem blutrünstigen Gott retten.«
Ich sah auf Waqi, die still und schweißnass dalag. »Wie heißt du?«, flüsterte sie.
»Zorak ben Dani’el.«
Waqi kniff die Augen zu und knüllte die Decke in ihrer Hand zusammen. Sie hätte eigentlich durch den Schmerz hindurch atmen sollen. So hatte ich es im Fernsehen gesehen, ich wusste nur nicht, wie das ging. Die Wehe ging vorüber, und sie sprach ihn an: »Bring mein Kind zur Welt.«
Zorak verwandelte sich in einen General. Wir eilten mit sauberen Laken, heißem Wasser, Wein, einem Messer mit Eisenklinge und Lampen herbei und bauten alles ordentlich in ihrem Zimmer auf. Er schob die Schläfenlocken hinter die Ohren und wusch seine Hände in Wein. Die Wehen wollten kein Ende nehmen, aber Waqi war zäh. Sie schrie nur selten; meistens streichelte sie ihren Bauch und lächelte unter ihren Höllenqualen.
In regelmäßigen Abständen sprach Zorak ein Gebet, um danach zwischen ihre Beine zu schauen und ihr zu sagen, dass es noch dauern würde. Als er schließlich verkündete, dass es so weit sei, war die Nacht tintenschwarz und der Mond hinter einer Wolke verschwunden.
Ein paar Ziegelsteine wurden ins Zimmer gebracht und Waqi von ihrem Strohlager zu den Ziegeln geführt, auf denen sie kauern sollte. Ich wurde auf ihre linke Seite gestellt und eine Sklavin zu ihrer Rechten, während Uru hinter ihr stand und ihren Hals sowie das Rückgrat mit Duftölen massierte. Zorak hockte vor ihr, massierte die Innenseiten ihrer Schenkel und ihren Bauch und sprach ihr leise und beruhigend zu, wobei er ihr ununterbrochen in die Augen sah.
Waqi wandte den Blick kein einziges Mal von ihm ab.
Auch wenn die Wehen einsetzten, blieben ihre Augen offen und auf seine gerichtet, während wir sie aufrecht hielten und beobachteten, wie ihr massiger Leib sich in Wellen zusammenzog. Uru sang leise unverständliche Worte zu einer betörenden Melodie vor sich hin.
Wie Wasser aus einer Dusche floss der Schweiß über Waqis Leib. Eigentümlicherweise war mein Widerwille geschwunden, seit ich mit angesehen hatte, wie dieses junge Mädchen mit seinem Kind sprach und dabei in die Augen dieses Fremden schaute, der alles zu Stande bringen würde. Plötzlich fühlte ich mich ungeheuer unwichtig.
Dann schrie sie unvermittelt mehrmals kurz hintereinander auf und schien beinahe gegen unseren Griff anzukämpfen.
»Lasst sie runter«, befahl Zorak, und gehorsam ließen wir sie in die Hocke sinken. Die anderen Sklavinnen rückten näher, um so viel Licht wie möglich zu spenden. Zorak redete Waqi zu und rieb dabei über ihren Bauch, Uru sprach ihr Mut zu, selbst ich sagte ihr, dass sie das ausgezeichnet machte, dass alles b’seder sein würde, dass sie einfach weiteratmen solle.
Ihr Leib zitterte dermaßen, dass wir sie fast fallen ließen, weil der Schweiß sie so glitschig machte, und dann ... glitt eine blutige Masse in Zoraks Hände. Es war abstoßend; es war unfassbar!
Das Baby brauchte einen Moment, ehe es zu brüllen anfing.
Als ich schließlich begriff, was eben geschehen war, strömten mir Tränen über die Wangen. Vor meinen Augen war ein Kind geboren worden.
Wir machten alles sauber. Zorak entfernte die Nachgeburt, schlug sie in ein Tuch und überreichte sie einer Sklavin, die damit verschwand. Dann reichte er Waqi das eiserne Messer, die damit unter einem Gebet die Nabelschnur durchtrennte. Uru und Zorak rieben das Kind mit Salz ab, während die Sklavinnen alle Leintücher wechselten. Die andere Sklavin und ich wuschen Waqi und rieben anschließend ihre Schenkel, ihren Bauch und die Brüste mit Öl ein. Eigentlich hätte es mich verlegen machen müssen, eine andere Frau so zu berühren, doch stattdessen fühlte ich mich als Beschützerin und dadurch mit ihr verbunden. Was ihr Körper zu Stande gebracht hatte, konnte meiner ebenfalls zu Stande bringen, dieses Band schmiedete uns zusammen.
Das Kind war ein Junge. Zorak reichte ihn ihr. »Er ist bezaubernd«, sagte er. »Genau wie seine Mutter.« Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn und trat in den Hintergrund. Waqi nahm uns alle überhaupt nicht wahr. Sie strich dem Kind über das Gesicht, küsste jeden Zentimeter seines Leibes, der nicht eingewickelt war, und hielt es dann an ihre Brust.
Natürlich war er schnell von Begriff, schließlich war er das schönste Baby der Welt und das gescheiteste dazu, daran gab es keinen Zweifel. Gleich darauf nuckelte er wie ein Weltmeister. Mit einer Miene absoluter Glückseligkeit ließ sich Waqi zurücksinken. Ich sah kurz zu Zorak hinüber, der immer noch mit Blut verschmiert war, und bemerkte, dass er weinte.
Uru legte die Hand auf meinen Arm.
»Isha, lassen wir sie ein wenig allein.«
Wir schlichen aus dem Zimmer und ließen Mutter und Kind in vollkommener Verzückung zurück.
DIE WÜSTE
Gut bewaffnet und gepanzert marschierten die hundert Männer durch das Arava-Tal. Cheftus Blick war auf die Schotterebene gerichtet, als er ganz unerwartet einen winzigen Moment lang etwas wie einen Spiegel im Dreck aufblitzen sah. Nur seiner Erfahrung war es zu verdanken, dass er nicht stolperte und dadurch zu erkennen gab, was er gesehen hatte - das Gleißen der Sonne auf Metall. Er ging weiter, nun aber ganz und gar auf seine Umgebung konzentriert und auf jedes Geräusch lauschend. Hinter ihm befand sich, sorgfältig unter Proviant, Kleidung und einer toten Ziege versteckt, der Reichtum von Hat-schepsuts Ägypten.
Es war eine Wüste, doch anders als in Midian gab es hier keine Sandwellen und keine wild streunenden Kamelherden. Es war ein brutaler, felsiger Landstrich, in dem nur Akazien und wildes Gras überlebten. Die Hügel zu beiden Seiten waren von Höhlen durchlöchert. In regelmäßigen Abständen erspähten sie eine Ziege oder eine Wildkatze. Hyänen keckerten in der Ferne, und über die salzige Ebene hin und her ziehende Gazellenherden hatten ihre Spuren hinterlassen.
Der Schweiß verdampfte ebenso schnell, wie er aus den Poren trat, so trocken war es hier. Da ihre Rückkehr dringend erwartet wurde, marschierten sie tagsüber, was ausgesprochen unüblich war. Und so spät im Sommer der blanke Wahnsinn. Das sollte Echnaton mal ausprobieren, dachte Cheftu. Hier gab es mehr von seinem »Aton«, als selbst Pharao ertragen konnte.
Das Wandern in der Sonne, in Stoff gehüllt und einen Fuß monoton vor den anderen setzend, brannte ihm alle Gedanken aus. Darum war ihm nicht schon früher aufgefallen, dass sie
verfolgt wurden.
N’tan taumelte an seine Seite. »Spürst du es?«, fragte Cheftu leise.
»Wir werden beobachtet.«
Unauffällig ließ Cheftu den Blick wie so oft über die Hügel, die Akazien und Felsen wandern. »Ich kann sie nicht sehen.«
»Ich auch nicht.«
»Sollen wir weitergehen?«
»Was meinst du, sind es Tiere oder Menschen?«, fragte N’tan.
Cheftu musste ein Lachen unterdrücken. Tiere würden vor einer so großen Karawane die Flucht ergreifen. Nur ein einziges Lebewesen würde versuchen, so viele Menschen anzugreifen.
»Ganz eindeutig Menschen.«
»Ach!«, meinte N’tan. »Wir sind nahe der Salzmeerküste.«
»Wie nahe?«, hakte Cheftu nach.
»Wenn wir weiterziehen würden, wären wir in der Morgendämmerung dort.«
Was wäre wohl besser? Weiterzuziehen, in der Hoffnung, die Verfolger abzuhängen oder auszuspielen? Oder wie all die Abende zuvor ein Lager aufzuschlagen und sich auf eine Schlacht in der Morgendämmerung vorzubereiten?
»Was für Waffen haben unsere Männer?«
»Bronzeschwerter. Ein paar haben auch pelestische Klingen.«
»Wir werden uns wieder in drei Divisionen aufteilen. Um sie zu verwirren.«
»Was wird ... aus dem Schatz?«, wisperte N’tan.
»Heute Nacht werden wir im Schutz der Dunkelheit einiges davon vergraben. Den größten Teil.«
»Und zurücklassen?«
Cheftu widerstand der Versuchung, seine trockenen Lippen mit der Zunge anzufeuchten; dadurch würden sie nur noch mehr austrocknen. Er fummelte in seiner Schärpe nach einem kleinen Stein, seinem Lutschstein. Er hatte gelernt, dass ein Kiesel unter der Zunge Mund und Kehle feucht hielt. Gleich darauf hatte er wieder genug Speichel zum Schlucken und zum Sprechen. »Eine Abteilung schicken wir voraus, mit einem Teil des Goldes und den Männern mit den Bronzeklingen.
Sie werden den Weg durch Midian und Yerico hindurch und um Jebus herum nach Mamre nehmen.«
»Und die Übrigen?«
»Eine Abteilung bleibt zurück, um sich zum Kampf zu stellen, und die Beigesetzten werden später scheinbar den aufgewühlten Boden erklären.«
»Wir bringen sie um? Und vergraben das Gold dann mit ihnen?«
»Lo. Wer auch immer uns nachstellt, wird sie töten. Wir werden das Gold mit ihnen vergraben, die Gräber wie typische Wüstengrabstätten mit Steinen abdecken und das Gold später holen.«
»Glaubst du, das wird die Briganten davon abhalten, die Leichen und das Gold wieder auszubuddeln?«
Cheftus Blick tastete die weit entfernten Höhlenfelsen ab; steckten sie vielleicht dort? Wie viele? Und aus welchem Volk? »Falls es Ägypter sind, werden sie die Toten ruhen lassen.« Hoffentlich, dachte er. »Die andere Möglichkeit wäre, das Gold in diesen Höhlen zu verstecken - irgendwie.«
»Und was soll deiner Meinung nach die dritte Gruppe tun?«, fragte N’tan.
»Sie werden direkt nach Mamre ziehen, um Verstärkung zu holen.«
»Wir tun das im Schutz der Nacht?«
»Ken. Heute Nacht.«
N’tan blinzelte gegen die Sonne. »Also werden wir etwa in einer Wache unser Lager aufschlagen. Ich werde es den anderen sagen.« Damit fiel er zurück.
Den Blick fest auf die Felsklippen gerichtet, marschierte
Cheftu weiter. Ein einziges Gleißen würde ihm verraten, was er wissen musste. Falls Pharao dort lauerte, würden die Soldaten Rüstung tragen. Falls es andere Stämme waren, würde er sie rufen hören, die Laute der Wüste nachahmend.
Die nächste Wache würde zeigen, wer es war.
Nichtsdestotrotz würden sie das Gold zu Dadua schaffen. David würde sein Gold bekommen. Und Cheftu seine Freiheit wieder gewinnen.
Cheftu marschierte weiter.
Ich begriff, wie die Franzosen in der Résistance sich gefühlt haben mussten. Äußerlich schien alles ganz normal zu sein, doch ich wusste, dass es nicht so war. Die Frauen in den Straßen von Jebus waren keine Fremden mehr, sie waren meine Mitspioninnen; die lächelnden und so zuvorkommenden Männer waren dieselben Männer, die verlangten, dass ihre Kinder verbrannt werden sollten, damit sie selbst ungeschoren blieben. Sie waren zu Feinden geworden. Doch für einen Außenstehenden hatte sich nichts verändert.
Als wäre dies ein Tag wie jeder andere, ging ich zum Brunnen. »Heute bist du aber früh dran, was? Ein neuer Krug?«, kommentierte der erste Wachposten.
Ich zuckte mit den Achseln. »G’vret Waqi wünscht heute Morgen ein Bad.«
»Ach, die Reichen!« Lachend ließen sie mich passieren. Auf der Treppe kam ich an ein paar Frauen vorbei. Alles lief nach Plan.
Derselbe Wachposten wie jeden Tag hatte Dienst. »Dein Husten hört sich schlimmer an«, sagte er, als ich mich unter der Wucht meiner Hustenanfälle zusammenkrümmte. Trübe nickte ich ihn an. Der Husten war nicht gespielt, ich hatte mir irgendwo eine Erkältung eingefangen.
Statt mit einem Stapel Zeitschriften, meiner Fernbedienung und einer Familienpackung Eiscreme von Ben & Jerry’s im
Bett zu liegen - mein Universalrezept gegen alle Beschwerden -, würde ich die Invasion und den Verrat von Jebus anführen.
Das Adrenalin würde mich aufrecht halten müssen.
Wegen meines Hustens und Niesens schien es ewig zu dauern, bis ich den extragroßen Krug voll hatte. Ich sah den Wachmann an. »Kann man diese Öffnung irgendwie größer machen? Sonst«, ich nieste, »brauche ich den ganzen Tag.«
»Wer hat dir davon erzählt?«, fragte er misstrauisch.
Ich nieste.
»Waqi. Sie braucht Wasser, und zwar viel.«
»Zum Baden? Mitten unter der Woche?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Das Kind kann jeden Moment kommen.«
Er hüpfte von seinem Thron und trat an die Wand. Dort befanden sich einige an einem Haken befestigte Seile. Er zog ein paar Mal fest an, und schon hatte er die gesamte hölzerne Plattform nach oben gezogen und die natürliche Öffnung freigelegt, die etwa drei Meter groß war. Meine Begeisterung führte zu einem weiteren Niesen.
»Mach schnell.« Er sah mir zu. Ich war zwar kräftiger geworden, trotzdem brachte ich immer noch keinen normal großen Krug auf die Schulter, wenn ich ihn randvoll machte. Weshalb dieser Riesenkrug ein Unding für mich war, vor allem da ich immerzu niesen musste. Wütend trug er mir den vollen Krug die Treppe hinauf, an den hinabsteigenden Frauen vorbei. Bemerkte er die Blicke, die wir tauschten?
Ganz oben an der Treppe stolperte ich absichtlich und purzelte die Stufen wieder hinunter, darauf achtend, dass ich mir den Kopf nicht allzu fest anschlug. Der Wachposten rief nach Hilfe und stürzte dann die Treppe hinauf, um jemanden zu holen, wobei er meinen Krug auf den Stufen zurückließ. Innerhalb weniger Sekunden hatten die Frauen, an denen wir eben vorbeigekommen waren, mir aufgeholfen. Eine andere Frau schlüpfte in meinen Umhang; ihr Gesicht hatten wir so ange-malt, dass es meinem ähnelte. Traurigerweise hatte sie bereits blaue Flecken.
Sie legte sich an meine Stelle, während ich hoppelnd die Treppe hinunterrannte. Die anderen Frauen sammelten sich auf dem Treppenabsatz, sodass der Wachsoldat nicht nach unten konnte.
Nur wenige Augenblicke später starrte ich, im Eimer kauernd und das Seil mit beiden Händen fassend, in die Tiefen des schwarzen Wassers, während mir die umstehenden Frauen »Viel Glück« ins Ohr flüsterten.
Ich merkte, dass ich eigentlich Angst vor Höhlen voll schwarzem Wasser haben sollte; doch meine bisherigen Erfahrungen hatten mich auf genau diese Situation vorbereitet. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass ich einen Weg ins Freie finden würde, und ich befürchtete ebenso wenig, dass ich zu lange unter Wasser bleiben würde. Schließlich hatte ich während meiner Zeit auf Aztlan ein verflucht kompliziertes Labyrinth überlebt, und zwar nicht nur einmal, sondern dreimal. Dies hier war für mich ein Kinderspiel.
Ein kaltes Kinderspiel. Ich nieste wieder und spürte, wie die Brustwarzen kieselhart gegen mein Kleid drückten, so kühl wehte es von unten herauf. Meine Hände zitterten so, dass ich kaum die Seile bedienen konnte. Stimmen, die des Wachsoldaten und jene der Frauen, hallten zu mir herab. Jetzt oder nie.
Die Frauen hatten mir versichert, ich würde nur ein paar Sekunden lang untertauchen, da der Brunnen im Grunde eher ein Teich sei. Wenn ich es dorthin geschafft hatte, würde ich ins Freie schwimmen können - was auch den Verweis auf die »Lahmen« erklärte, da man sich im Wasser fortbewegen konnte, ohne die Beine zu bewegen. Wenn ich der Strömung folgte, würde ich irgendwo außerhalb der Stadt landen, wo einer von Yoavs Einsatztrupps auf mich warten sollte.
Falls man sich auf die Worte der Frauen verlassen konnte.
Was soll’s, dachte ich und löste meinen Griff um das Seil.
Der Flachs schürfte mir die Handflächen auf, während ich auf das Wasser zusauste. Sofort drang die eisige Kälte durch meine Kleider. Ich pfiff durch die Zähne, als ich sie erst an meinen Beinen und dann an meinem Bauch spürte. Ich holte ein letztes Mal tief Luft, dann tauchte ich in die nasse Dunkelheit ein.
Indem ich mich von einem angeborenen Richtungssinn und vor allem der Strömung des Wassers leiten ließ, gelangte ich schnell zu dem Abfluss unten im Brunnen. Alles verlief ganz nach Plan - ich machte mich steif wie ein Stück Holz, das nach draußen getrieben wurde -, als ich plötzlich stecken blieb.
Ich hielt den Atem an; ich steckte unter Wasser in einer Stromschnelle und klemmte dabei fest wie ein Korken. Der Fels schnitt mir in die Schultern und riss an meinen Brüsten. Von echter Angst gepackt, begann ich zu kämpfen. Ich kam weder vor noch zurück; meine Ohren schmerzten, weil das Wasser von oben auf mich herabdrückte.
O Gott, o Gott. Der Drang zu niesen wurde immer stärker; meine Lunge drohte zu platzen. Ich spürte, dass meine Beine unter mir in der Luft baumelten, während sich hinter mir immer mehr Wasser aufstaute. Ich konnte nichts sehen und fragte mich einen Moment lang, ob damit wohl alles aus war. Hatte meine Eitelkeit mich das Leben gekostet oder hatten mich die Frauen in einen Hinterhalt gelockt?
Meine Nase juckte, und ich holte automatisch Luft, wobei ich noch mehr Wasser schluckte. Und so kräftig nieste, dass mein Körper sich losriss.
Wie ein Stein knallte ich in den Kanal unter mir, zum Glück dämpften die aufgestauten Wassermassen meinen Aufprall.
Einen Moment lang schloss sich das Wasser über meinem Kopf, dann kam ich auf die Beine. Blaufleckig zwar, aber in hüfthohem Wasser.
In absoluter Dunkelheit legte ich etwa hundert Schritte zurück, wobei ich nichts hörte außer dem Platschen meiner Schritte, mit denen ich dem Wasserlauf behutsam bergab folg-te. Dann wurde ich langsamer, denn ich merkte, dass der Gang weiter wurde. Vielleicht stand draußen ja ein Wachposten. Ich spürte nichts dergleichen, aber ich war vorsichtig.
Plötzlich machte der Tunnel eine Biegung und fiel gleichzeitig nach unten ab. Mit der mir eigenen Grazie stolperte ich, glitt aus und klatschte in einen Tümpel im Sonnenlicht. Prustend tauchte ich wieder auf und wurde umgehend von dem Anblick einiger am Rand des Teiches aufgereihter, zugedeckter Leichen ernüchtert.
Einer der Giborim - Abishi, glaube ich - hieß mich willkommen und zog mich aus dem Wasser. Er legte einen Umhang über meine Schultern. »Was ist mit diesen Männern passiert?«, fragte ich, während ich mein Gesicht abtrocknete.
»Es sind Yoavs Spione. Sie wurden erwischt und mussten mit den Wachen der Jebusi kämpfen.« Abishi wandte den Blick ab, und mir fiel auf, dass er geweint hatte. »Möchtest du sie anschauen?«
Ich zögerte kurz, doch ich wollte sie nicht sehen. Ich wollte nicht die wenigen Gesichter, die ich mit lebendigen, lachenden Soldaten assoziierte, an einigen blutbesudelten Leichen neben einem Wasserlauf wieder sehen. Hatte auch nur einer von unseren Jungs gewonnen? »Wissen die Jebusi, dass wir hier sind?«
Abishis Miene wirkte resigniert. »Noch nicht, aber ab der nächsten Wache schon.«
Seine Antwort ließ mein Blut gefrieren. Diese Frauen, diese wenigen Frauen, hatten alles aufs Spiel gesetzt, um uns zu helfen, um ihre eigene Freiheit zu erkaufen, um in Zukunft ihre Kinder behalten zu dürfen. »Dann gehen wir«, sagte ich.
»Yoav hat an zwei verschiedenen Stellen der Stadtmauer Angriffe geplant, falls wir von uns ablenken müssen.«
»Der Mann ist ein fantastischer Stratege«, sagte ich.
»Ken«, bestätigte er und sah mich dann besorgt von oben bis unten an. »Isha! Hat man dich angegriffen? Bist du wohlauf? Brauchst du Wein? Brot?«
Ich nieste und schüttelte den Kopf. Ich konnte mir vorstellen, dass ich zum Fürchten aussah. Ungewaschen, klatschnass, mit verlaufener Schminke, zerrissenen Kleidern und gefärbtem Haar. Igitt! »Der Abfluss hat mich angegriffen.« Ich wollte gar nicht wissen, wo ich mir überall Verletzungen zugezogen hatte; die Kälte betäubte meinen Körper, was momentan nur hilfreich sein konnte. »Du wirst nicht hindurchpassen«, sagte ich und deutete dabei auf seine Schultern. »Der Durchlass ist sehr schmal. Such die kleinsten Männer aus, dann gehen wir.« Wie lange hatte ich hierher gebraucht? Im Wasser hatte ich jedes Zeitgefühl verloren.
Draußen schien immer noch die Sonne, und die Vögel sangen immer noch im sommerlichen Nachmittag.
»Gib es noch -«
»Lo. Gehen wir.«
In absoluter Dunkelheit durch das Quellwasser zu waten, war gleichzeitig kalt und irgendwie surreal. Während draußen alles hell und fröhlich war, schmiedeten wir unter der Stadt Mordpläne.
Allerdings hatten meine Gewissensbisse deutlich nachgelassen, seit Waqi mich angefleht hatte einzumarschieren. Dann hatten immer mehr Frauen - ich hatte keine Ahnung, woher sie Bescheid wussten - mich auf dem Markt angerempelt und mir zugeflüstert: »Ich helfe euch« oder »Auf mich könnt ihr zählen.« Die Frauen der Stadt wollten neue Regenten und neue Gesetze. Nicht alle, davon war ich überzeugt, aber eine ziemlich lautstarke Minderheit, die von der Königin persönlich angeführt wurde. Sie wollten endlich ihre Kinder heranwachsen sehen.
Im Gegenzug sollte ich um ihre Freiheit feilschen. Es sollte weder Herim noch Hal für sie geben. Auch keine Sklaverei. Yoav lag der Sieg so am Herzen, dass ich glaubte, er würde zustimmen. Zorak war der gleichen Meinung - Zorak, der sich von meinem stillen Schatten in einen Schutzengel für Waqi und das noch namenlose Kleine verwandelt hatte.
Die Männer hinter mir sprachen kein Wort, nur gelegentlich verrieten ein paar flache Atemzüge, dass zwölf Soldaten durchs Wasser schlurften. Meine Sandalen - es überraschte mich, dass ich sie immer noch hatte - zerrten an den Füßen und gaben mir das Gefühl, in Latschen zu gehen. Je weiter wir vorankamen, desto tiefer wurde das Wasser, von knietief über hüfttief bis zu bauchtief. Bibbernd und durchnässt führte ich die Männer den dunklen Gang hinauf. Licht zu machen wagten wir nicht, doch trotz der Dunkelheit spürte ich die Steinwände, die Decke, die über uns lastenden Erdmassen. Das Rauschen von Wasser ließ erkennen, dass wir uns dem Schacht näherten.
Wir befanden uns schon längst innerhalb der Stadtmauern. Verlief alles nach Plan?
Nachdem ich mein Kleid so zurechtgezogen hatte, dass es meine Knie bedeckte, machte ich mich an den anstrengenden Aufstieg durch den Schacht. Ich war schon früher geklettert, aber noch nie unter einem Wasserfall, ohne jede Ausrüstung und im Kleid! Die Soldaten unter mir rückten zusammen, um mich nach oben zu schieben. Die Steine rissen mir die Handflächen auf, von oben trommelte mir das Wasser auf den Kopf, und ich tastete mich blind aufwärts, immer weiter aufwärts.
Der Kanal wurde enger; wir würden es nie im Leben hindurch schaffen. Wie eine Entenmuschel an der Wand klebend, zog ich das Messer aus meinem Kleid und schlug mit dem Heft auf den Kalkstein ein. Schon ein paar Zentimeter mehr würden uns die Sache ganz erheblich erleichtern!
Erst purzelten kleine Bröckchen auf die Männer unter mir, dann löste sich ein größeres Stück. Ich zuckte zusammen, als ich den überraschten Aufschrei von unten hörte. Nachdem ich das Messer sorgfältig wieder eingeschoben hatte, kletterte ich weiter. Sich durchzuquetschen, kostete immer noch Mühe, war aber machbar, vor allem, da ich von unten angeschoben wurde.
Ich hatte kaum Zeit, ein letztes Mal Luft zu holen, ehe ich in dem Teich war.
Mit beinahe berstenden Lungen kam ich an die Wasseroberfläche. Einen Moment lang hielt ich wassertretend inne und las das vereinbarte Signal. Es war immer noch absolut still hier; wir befanden uns noch viele Meter unter der Stadt.
Um mich herum tauchten die Soldaten aus dem Wasser auf, wobei jedes Luftschnappen anzeigte, dass wieder einer zu uns gestoßen war. Ich war verdutzt, wie viel und wie gut ich in der Dunkelheit sehen konnte. Das Seil und der Eimer tanzten auf den Wellen, und das durch die Brunnenöffnung fallende Licht legte ein matt leuchtendes Viereck zwischen uns. Ein winziges Viereck. Wir mussten die Ausweichroute nehmen; diese hier wurde bewacht. Vor unseren Augen wurde der Eimer unter Wasser gesenkt, wobei von oben nur Schatten und Stimmen wahrzunehmen waren.
Möglichst ohne zu plätschern, winkte ich den Männern, mir zu folgen. Wir würden gegen die Strömung zur Quelle schwimmen, da das Wasser von hier aus hügelabwärts floss.
Von hier ab konnte die Sache haarig werden, denn dieser Weg war seit langem nicht mehr benützt worden, hatte Waqi mir erklärt. Während ich unter die Wasseroberfläche tauchte, erfüllte langsam ein vor langer Zeit eingeprägter Satz meinen Geist und beruhigte mich: Die Wasser werden führen, sie werden reinigen, sie werden Erlösung schenken. Die Worte von dem Zeitportal im modernen Ägypten, gerichtet an eine Reisende der dreiundzwanzigsten Macht.
Okay, Chloe. Vergiss das nicht.
Während die Soldaten abwarteten und die Abdeckung des Brunnens im Auge behielten, schwamm ich ans andere Ende des Teiches und tastete in der Steinmauer nach einer Öffnung. Das Wasser lief durch diesen Quellteich und dann durch die Öffnung ab, durch die wir eben heraufgekommen waren. Was bedeutete, dass es von weiter oben kommen musste - es war nur fraglich, wie groß genau der »Wasserhahn« war. Schließlich hatte ich ihn gefunden, einen sechzig auf sechzig Zentimeter großen Kanal in absoluter Schwärze, durch den das Wasser rauschte.
Ich winkte Abishi, mir ein Seil zu reichen, mit dem wir uns alle aneinander banden, ich ganz vorne und er als Letzter. Blind und lahm, echt wahr, dachte ich. Ich schloss die Augen, um ihnen etwas Erholung von dem Wasserdruck zu gönnen, der mir die Augäpfel aus den Höhlen zu spülen drohte.
Mit angehaltenem Atem, während die Wassermassen an unseren Leibern zerrten und auf uns einprügelten, arbeiteten wir uns nach oben. Ich sah schon Punkte hinter den geschlossenen Lidern, und meine Brust brannte und schmerzte unerträglich, als ich plötzlich feststellte, dass der Kanal erheblich breiter wurde. Der Wasserspiegel war gesunken.
Halb schwimmend, halb watend und mit aller Kraft an unserem Seil festgeklammert, kämpften wir gegen die Strömung an. Dann schwammen wir im Hundekraul praktisch senkrecht nach oben, weil der Kanal wieder enger wurde und uns das Wasser bis zum Kinn stand. Über dem Tosen der Strömung hörte ich kaum die Geräusche der Soldaten hinter mir. Dann gingen wir wieder eben dahin, durch hüfthohes Wasser.
Hätte ich mich nicht mit beiden Händen an den Wänden abgestützt, hätte ich die Öffnung übersehen. Ein schmaler Spalt, durch den Luft hereinwehte. Ich hielt an und spürte, wie der nachfolgende Soldat dicht hinter mir stehen blieb. Wenn ich den Kopf zur Seite drehte, konnte ich nach draußen sehen - ins Freie! Wir hatten es fast geschafft!
Aber wie sollten wir aus diesem Kanal und auf die Straße gelangen? Das hatte uns keine der Frauen sagen können.
Da ich keine Alternative sah und da ich wusste, die Jebusi würden mittlerweile festgestellt haben, dass ihre Wachposten verschwunden waren, was bedeutete, dass uns die Zeit knapp wurde, band ich mir die Röcke um die Schenkel hoch und zwängte mich dann durch den Spalt. Ich biss die Zähne zusammen, als der Stein meine Haut aufschürfte. Zum Glück war ich groß und dünn und kam seitlich durch die Lücke. Außerdem konnte ich, falls ich erwischt wurde, wahrscheinlich irgendeinen Vorwand finden, weshalb ich hier war. Ein Mann aus den Stämmen würde augenblicklich entdeckt werden.
Also drückte ich mich durch den ein Meter sechzig hohen spaltartigen Schacht und hielt am anderen Ende kurz inne. Hatte man mich in einen Hinterhalt gelockt? Ich wartete zwei, vielleicht drei Minuten. Niemand kam. Sollte ich dadurch in falscher Sicherheit gewiegt werden?
Nach fünf Minuten zischte ich Abishi zu, weiter gegen die Strömung anzuwaten. Mir drohte keine Gefahr, und ich würde ihn am anderen Ende dieses Kanals erwarten, wo auch immer das sein mochte. Bitte, lieber Gott, lass mich die Quelle finden.
Ich ließ mich, Ausschau haltend und hellhörig, auf alle viere fallen. Ich hörte nichts Ungewöhnliches - noch nicht. Nördlich von mir sah ich ein Haus stehen. Ich wusste, dass der Tunnel im Hof dieses Hauses endete; das hatte man mir erzählt. Bis jetzt hatten alle Angaben gestimmt. Wenn die Königin wie versprochen diesen Trakt hatte räumen lassen, dann war alles in Ordnung.
Andernfalls konnte es böse für mich enden, denn hier war niemand, der mir helfen konnte. Ich war ganz auf mich allein gestellt. O Gott, bitte mach, dass ich nicht erwischt werde.
Ich beobachtete die Hausfront, doch ich konnte keinerlei Wachhunde entdecken, nur einen alten Mann, der auf der Türschwelle schlummerte. Es war die Stunde der im ganzen Mittelmeerraum üblichen Siesta, und die Sonne war so heiß, dass meine Kleider in Windeseile trockneten. Als ich an der Hausfront vorbeilief, um durch die Hintertür hineinzukommen, rührte sich nichts.
Die Hintertür sollte offen sein, nicht wahr?
Ich drückte dagegen, dann nochmals, diesmal fester, bis ich den Gegendruck des Metalls spürte. Die Tür war von innen verriegelt. Verdammt, sie hatte die Türen nicht öffnen können. Ersatzplan? Ich ging langsam weiter und sah zu den Fenstern auf. Sie waren zu weit oben und zu schmal. Und vergittert. Super.
Am helllichten Tag eine Hausmauer zu erklimmen war vielleicht nicht besonders klug, aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Unter mir warteten die Soldaten; überall in den Häusern dieser Stadt warteten die Frauen. Seufzend wickelte ich das über meiner Schulter hängende Seil ab. Erst beim siebten Versuch schlang es sich um das Holzgitter in einer Fensteröffnung.
Ich biss die Zähne zusammen, um nicht laut aufzuschreien, als das Seil in meine bereits brennenden Handflächen schnitt -was mich dazu inspirierte, einen Streifen aus meinem Kleid zu reißen und ihn um die Hand zu winden -, dann kletterte ich nach oben und schlüpfte zwischen den Holzstäben hindurch.
Der Boden des Hofes war rund um ein großes Wasserbecken bunt bemalt. Aber jeder Zentimeter der Mauern war mit Schilden bedeckt - atemberaubenden Rüstungen aus Gold und Silber, die mit Halbedelsteinen besetzt waren. Es waren mindestens fünfzig. Ein Wasserfall ergoss sich aus der Hauswand in das Becken. Die Sonne spielte auf der Wasseroberfläche und spiegelte sich dann in den Schilden, wodurch der ganze Hof wirkte wie eine Unterwasserlandschaft. Wie hypnotisiert schaute ich zu, wie das Wasser in den Spiegel des Wasserbek-kens donnerte, ohrenbetäubend laut und die Luft mit kühler Gischt erfüllend. Dann dämmerte es mir: Man hatte das Haus in den Berg hineingebaut!
Mit angehaltenem Atem sprang ich in den Hof hinab, rollte mich ab, stand wieder auf und sah mich um. Und wartete ab. Mir drohte keine Gefahr, da niemand mich hören konnte. Aber würde man mich sehen? Ich blieb stehen. Offenbar hatte die Königin diesen Teil ihres Versprechens eingehalten. Vor dem, was ich für die Lagerräume hielt, sah ich einen Mann dösen. Nirgendwo waren Tiere zu sehen, was für diese Zeit und Weltgegend ausgesprochen ungewöhnlich war. Ein Esel wurde hier besser behandelt oder jedenfalls besser gefüttert und getränkt, als die eigenen Kinder. Vor allem in einer Stadt ohne Kinder, rief ich mir ins Gedächtnis. Ich wartete noch länger.
Nichts.
Nachdem ich das Seil wieder eingerollt hatte, näherte ich mich dem Becken, wobei ich die ganze Zeit über im Schatten blieb.
Ich konnte nicht bis auf den Beckenrand sehen, was gut war, da es keinen Beckengrund geben durfte.
Während ich das Seil um einen Pfeiler knotete, unterdrückte ich ein Niesen, sodass das leise Zischen im Tosen des Wasserfalls unterging. Hoffentlich war das Seil lang genug. Den Flachs in der Hand haltend, atmete ich tief ein, tauchte unter die Wasseroberfläche und tastete erst nach dem Boden und dann nach dem »Abfluss«.
Wie vermutet und wie schon einmal ging es erst nach unten, durch einen schmalen Durchlass und dann ... stürzte ich abwärts, umgeben von lauter Wasser. Im Gegensatz zu meinem letzten Sturz fiel ich diesmal nicht in weiches Wasser. Ich schoss knapp zwei Meter nach unten und landete auf einem Stein, der aus dem Bachbett herausragte. Mein Aufschrei verriet Abishi und seinen Leuten, dass ich eingetroffen war.
Er platschte durch das Wasser auf mich zu. »Oben«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen; das tat weh!
»Im königlichen Harem, in einem Hof.«
Mit schmerzverzogenem Gesicht stand ich auf.
»Wir sind auf der Ostseite. Das Stadttor befindet sich ein Stück hügelabwärts.«
»Kommst du mit uns?«
Ich unterdrückte ein Niesen. »Ich werde am Tor zu euch und den Frauen stoßen. Vergesst nicht, dass ihr mir euer Wort gegeben habt - keine Vergewaltigungen, keine Plünderungen, keine Frauen werden getötet. Wir warten ab, bis Yoav eingetroffen ist.«
Abishis Stimme wurde schärfer. »Ich habe nie ein solches Versprechen abgegeben, doch ich werde mich daran halten.«
»Sie verraten alles, was ihnen lieb ist«, erklärte ich leise.
»Bestraft sie nicht dafür, dass sie euch geholfen haben.«
Nach all meinen Stürzen schmerzte mir jeder Knochen im Leib, zusätzlich zu den elenden Erkältungsbeschwerden; leidend kehrte ich zu dem schmalen Spalt in der Wand zurück und quetschte mich hindurch. Die Stadt war eigenartig ruhig; eigentlich hätten schon wieder Menschen auf der Straße sein müssen, denn die Sonne würde bald untergehen.
Ich hatte das beunruhigende Gefühl, dass irgendetwas schief gelaufen war. Wo waren sie alle? Auf meinem Weg den Hügel hinunter zum Tor sah ich keine Menschenseele und hörte auch niemanden. Was war hier los? Menschen hätten zum Markt gehen müssen, Frauen hätten zum Brunnen gehen müssen.
Jebus war eine Geisterstadt.
Du hast es dazu gemacht, wisperte mein Gewissen mir ein. Das ist deine Schuld. Irgendwo weiter oben hörte ich das Blöken des Shofars und dann das Gebrüll von Männern. Kam das von drinnen oder von draußen? Ich wusste es nicht, doch ich rannte bereits zum Haupttor, das immer noch verriegelt war. Man musste mindestens zu zehnt sein, um diesen Balken anzuheben. Aus der Stadt hörte ich einen Aufschrei - »Man hat uns verraten!« -, der unvermittelt abbrach.
Nichts. Niemand. Das wurde ja immer gespenstischer.
»Hallo?«, rief ich. »Ist da jemand?«
»Isha!«, rief Yoav von der anderen Seite des Tores. »Öffne das Tor!«
Plötzlich begriff ich, dass dies meine Chance war. Ich hatte die Stadt in der Hand; es war an mir, sie ihm zu übergeben.
»Nur wenn du einen Eid ablegst, Yoav.« »Was?« Nur klang das in seiner Sprache viel barscher: Mah?
»Versprich, dass es keinen Hal geben wird.«
»Mah?« Er klang wenig begeistert. »Öffne das Tor, Isha. Ak-chav!«
Sofort, wie?
»Versprich es beim Namen des Allerhöchsten«, drängte ich.
»Öffne das verdammte Tor.«
»Versichere mir, dass diese Frauen nicht bestraft werden. Sie haben dir geholfen, die Stadt einzunehmen, du musst sie verschonen.«
»Dies ist nicht der Zeitpunkt, darüber zu streiten, Klo-ee«, widersprach er.
Ich schaute über meine Schulter. Drei zitternde Frauen mit weit aufgerissenen Augen hatten sich hinter mir versammelt.
»Akchav diskutieren wir darüber, Yoav. Kein Herim, kein Hal.«
Draußen blieb es kurz still. »B’seder. Öffne das Tor.«
»Und keine Sklaverei.« Die Gruppe war auf sieben Frauen angewachsen.
Wir waren wieder beim fassungslosen »Was?« angelangt.
»Wo ist Waqi?«, fragte ich eine der Frauen leise.
»Bei der Königin im Palast.«
»Was ist passiert?«
»Wir haben ihnen einen Schlaftrunk gegeben. Die meisten Männer schlafen.«
Yoav donnerte gegen das Tor. »Versprich es in Gottes Namen, Yoav«, brüllte ich ihn an, dann sagte ich leise zu den Frauen: »Und kein Mann soll sterben, es sei denn, er ist Soldat.«
Er brüllte vor Zorn und Entrüstung. Mir war klar, dass das bei den Stämmen nicht üblich war.
»Es ist nicht Art der Jebusi, ihre Geliebten zu hintergehen«, erklärte ich ihm, während ich auf die wachsende Gruppe hinter mir sah. »Nur Männer, die Soldaten sind, sterben.«
Weitere fünf Frauen kamen die Straße herabgelaufen. »Die Hochländer!«, riefen sie, und im nächsten Moment sprangen die Soldaten, die ich durch den Tzinor geführt hatte, auf die Straße. Ich schnappte mir ein Messer und hielt es drohend hoch. »Schwöre es, Yoav!«, schrie ich durch das Tor. Abishi hatte mit einem Blick die Situation erfasst und hielt an.
»Yoav!«, brüllte er.
»Bring diese Verrückte dazu, das Tor zu öffnen!«, bellte Yo-av zurück. »Das wird allmählich zu einer Farce!«
Abishi kam einen Schritt näher.
»Bleib stehen.« Ich schwenkte mein Messer. »Ich weiß, wie man damit umgeht.«
Wenn auch nur beim Truthahnschneiden.
»Schwöre, dass diese Frauen heil und unversehrt bleiben«, sagte ich. »Sie wollen nichts als die Freiheit, Kinder bekommen und sie und ihre Männer behalten zu können. Keine weiteren Opfer an Molekh, kein Opfer als Hal.«
Ich beobachtete, wie er Blut von seinem Schwert wischte.
»Isha, Yoav wird Dadua diese Stadt zum Geschenk machen. Er kann dir diese Zusicherungen nicht geben.«
»Es ist mir gleich, nach welchen Regeln ihr sonst vorgeht. Schwöre, Yoav!«, rief ich wieder. In dem Durchgang sammelten sich immer mehr Zuschauerinnen.
Zorak, der mit mir durchs Wasser gekommen war, auch wenn ich das nicht gemerkt hatte, rief Yoav zu. »Mit ihr ist nicht zu reden, Yoav. Ich fürchte, wir müssen zustimmen.«
Abishi sah ihn wutentbrannt an.
Ich hörte Gemurmel und versuchte mir auszumalen, was jetzt auf der anderen Seite vor sich ging. Plötzlich sah ich Pfeile herabregnen, und gleichzeitig hörte ich die Schreie der ersten Getroffenen. Jebusische Wachsoldaten aus den Türmen reihten sich auf den Wehrgängen auf und zielten in die Stadt hinein. Hastig öffnete ich das Tor, unterstützt von den Frauen und einigen Soldaten.
Hinter mir hörte ich Schlachtenlärm, Geschrei und Gestöhne.
Wir hoben den Riegel an und zogen das Tor auf, während die Soldaten auf der anderen Seite schoben. »Schwör es, Yoav«, brüllte ich in die Männer hinein.
»Schwöre, schwöre, schwöre!«
Er packte mich am Oberarm und starrte mir mit glasgrünen Augen ins Gesicht. »Verflucht seist du, ich schwöre.«
»Bei -«
»Ken! Ken! Beim Namen des Allmächtigen!« Dann schubste er mich beiseite und kämpfte sich durch die Menge.
Kein Film hatte mich darauf vorbereitet, tatsächlich in eine Schlacht verwickelt zu sein und zu beobachten, wie Menschen ihre Schwerter schwangen, um andere damit zu töten. Hier gab es keine Choreografie, kein geschmackvoll hindekoriertes Blut. Die Geräusche waren grässlich: das Schmatzen einer herausgezogenen Klinge, der dumpfe Aufprall der Leiber auf dem Dreck und den Steinen der Straße. Versteckt im dunkler werdenden Schatten des Torbogens sah ich zu, wie die Soldaten die Männer der Jebusi zurückdrängten, bis sie von der Mauer purzelten und vor uns auf den Boden klatschten.
Und die ganze Zeit über hörte ich bei jedem Blutstropfen meine Stimme im Kopf: Das warst du. Nur deinetwegen, Chloe Bennett Kingsley, geschieht all das. Hatte ich die Geschichte total durcheinander gebracht?
Verflucht spät, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen, Isha, erwiderte ich mir selbst sarkastisch. Doch dann wurde mir alles zu viel, der Anblick, der Lärm, der Gestank. Benommen und mit Schuldgefühlen beladen übergab ich mich auf den Boden.
Die Kämpfe verlagerten sich vom Tor weg und weiter in die Stadt hinein. Die Frauen verschwanden in ihre Häuser wie ein Schwarm Spatzen in den Himmel. Ich blieb zusammengekauert im Dunkel sitzen.
Irgendwann in den düstersten Minuten vor der Morgendämmerung hallte der unirdische Ruf eines Widderhorns über die
Stadt und durch das Tal. Das Signal verriet mir, dass Abishi und Yoav die Zitadelle eingenommen hatten. Der Shofar war erklungen. Jebus war eine offene Stadt.
War ich eine Verräterin? Oder nur eine Frau, die mit dem Rücken an der Wand stand? Die Frauen hatten mich darum gebeten, sie hatten ihre Männer geopfert. Oder legte ich mir das nur zurecht, weil es »sie oder ich« geheißen hatte und weil ich wusste, dass Jerusalem letzten Endes Dadua sowieso zufallen würde? War es wirklich so gewesen?
Hatte ich den Platz eines anderen Menschen in der Geschichte eingenommen? Hatte ich die gesamte Menschheitsgeschichte durcheinander gewirbelt?
Oder bestand die Menschheitsgeschichte, so wie Cheftu es sagte, nur aus Menschen, die sich Tag für Tag durchwursteln, und erst der zeitliche und räumliche Abstand entschied darüber, welches Ereignis wirklich wichtig war?
Ich wusste es nicht und ich konnte nicht mehr denken. Mein Körper war wie betäubt; ich keuchte vor Anstrengung. Mein Niesen wollte kein Ende nehmen, ich hatte überall Wunden und blaue Flecke; ich wollte nur noch heim.
Doch wohin heim?
Heim zu Cheftu, ergänzte ich; Ort und Zeit bedeuteten mir dabei nichts.
Noch während die Morgendämmerung den Stein tönte, schwärmten die Soldaten durch die Stadt. Die Leichen der in der Schlacht gefallenen Männer wurden im Tal ausgelegt.
In Wolle gehüllt, krampfhaft niesend und mit allmählich ver-schürfenden Schürfwunden verfolgte ich, wie die Männer die Bevölkerung der Stadt aufteilten.
Dadua würde bald eintreffen. Er würde auf einem Esel in die Stadt kommen.
Offenbar ritt ein Bergprinz, ein Nasi, auf einem Esel in seine Stadt ein.
Ein König, haMelekh, kommandierte seine Armee von einem
Streitwagen aus. Folglich war Dadua zwar haMelekh über alle Stämme, da er sie in den Krieg führte und von einem Streitwagen aus befehligte, hier jedoch war er Nasi.
Es gab keine hierarchische Abstufung zwischen König und Prinz, man brauchte auch nicht erst Prinz zu sein, um König zu werden. Beides fiel in vollkommen verschiedene Kategorien. Ein Prinz war man nur in einem Gebirgskönigreich. Ein König nur als Kriegsherr.
Infolgedessen waren die Herrscher über die Pelesti Könige, weil sie in Streitwagen fuhren. Dadua war haNasi von Jebus, weil er auf einem Esel in die Stadt kam. Mein Gehirn pochte im Gegenrhythmus zu meinen Wunden, so viel Anstrengung kostete es mich, das Konzept zu begreifen, das mein gesamtes bisheriges Verständnis von der Beziehung zwischen einem König und einem Prinzen auf den Kopf stellte.
Im klaren Licht des Vormittags erwarteten die überlebenden Männer und Frauen von Jebus aufrecht den neuen Nasi. Yoav stand in Habtachtstellung, blutfleckig, aber stolz, umgeben von seinen Soldaten, welche die mir inzwischen bekannten goldenen und silbernen Schilde trugen. Wir alle schauten zu, wie Dadua auf seinem Esel den Hügel heraufgeritten kam. Obwohl seine Füße beinahe im Staub schleiften, strahlte eine majestätische Aura von ihm aus, die uns allen ein Gefühl von Bedeutungslosigkeit gab. Gold glänzte an seinem Helm, seinem Hals, seinen Beinschienen.
Dies war David.
Der Esel, weiß und rein, schlängelte sich durch die Einfriedung hinter dem Tor und blieb im Schatten stehen. Yoav kam auf Dadua zu, aufmerksam beobachtet von der ganzen Stadt und all seinen Soldaten. »HaMelekh Dadua ben Yesse, ich überreiche dir diese Stadt, den Traum deines Herzens, die Sehnsucht deines Nefesh, auf dass sie dein sei für alle Zeiten und Sitz der Dynastie Daduas werde, die mit el haShadays Hilfe bis in alle Ewigkeit fortbestehen wird.«
Der Esel war ein bisschen nervös, er tänzelte hin und her und stampfte auf den Boden. »Nun, da ich diese Stadt betrete, dieses Geschenk deiner Treue, verkünde ich, dass du, Yoav ben Zerui’a, Rosh Tsor haHagana sein sollst, bis deinem Körper der letzte Atemzug entwichen ist«, erwiderte Dadua.
»Dein Wille geschehe«, bedankte sich Yoav mit einer Verbeugung.
Um uns herum begannen die Männer zu jubeln, und Dadua sah zu uns her. Ich fragte mich, ob er sich wohl darüber Gedanken gemacht hatte, wie viel diese Stadt gekostet hatte. Ob er wohl wusste, wie sehr Yoav ihn liebte, welchen Preis er entrichtet hatte, damit Dadua bekam, was er wollte, ohne sich beflecken zu müssen, indem er es selbst eroberte.
Unter lautem Jubel ritt Dadua in die Stadt ein, während wir alle auf die Knie sanken und den Kopf senkten. Heute sah er wahrhaft königlich aus. Er stieg ab und ging vor uns her, ausgesprochen eindrucksvoll mit seinem irisblauen Gürtel und Umhang, dem juwelenbesetzten Dolch an der Seite und der in der Sonne gleißenden Rüstung.
»Jebusi!«, rief er aus. »Ich will euch kein Leid zufügen! Euer Herrscher Abdiheba ist tot, Jebus gehört euch nicht länger. Bis in alle Zeiten soll diese Stadt mir gehören und bevölkert werden von meinen Chorim und Giborim.«
Freunden und Verbündeten, übersetzte das Lexikon. Darauf wäre ich auch von selbst gekommen.
»Von heute an ist Jebus eine neue Stadt«, fuhr er fort. »Diese Stadt ist von Alters her meinem Volk versprochen. Sie gehört weder den Stämmen des Nordens: Zebuion, Asher, Y’sakhar, Gad, Binyamin, Efra’im, Manasha, Naftali; noch den Stämmen des Südens: Yuda, Reuven, Tsimeon, Dan. Es ist eine neue Stadt, die Stadt Daduas, Qiryat Dadua.«
Auch wenn ich genau das erwartet hatte, blieb mir der Atem weg. David, Israel, Jerusalem. Ach Cheftu, was würdest du darum geben, jetzt hier zu sein.
Die Menge lauschte schweigend und stoisch. Die Frauen, deren Väter, Brüder und Männer entweder schliefen oder durch die Machenschaften ihrer weiblichen Verwandten zu Tode gekommen waren, standen wie angewurzelt da. Sie hielten einander fest bei den Händen und lauschten mit schmalen Augen und voller Zweifel diesem Mann, der die Pelesti unterworfen hatte. »Ich biete euch an, hier zu bleiben und mit uns zusammen diesen Ort zu einer Stadt des Versprechens zu machen. Doch ich erwarte, dass ihr zwei Bedingungen erfüllt.« Ich sah Yoav wütend an; hatte er Dadua von seinem Schwur erzählt? Man konnte fast hören, wie alle den Atem anhielten. Ich schaute zu und wartete ab.
»Erstens müssen die Gebote unseres Gottes befolgt werden. Er ist der einzige Gott unseres Volkes. Er wird der einzige Gott auf diesem Berg sein. Er allein ist höher als all die Hügel um uns herum. Über uns« - Dadua zeigte auf ein Plateau, das sich nördlich von uns erhob - »werde ich diesem Gott ein Haus erbauen, einen Platz auf Erden, an dem Er unter uns sein kann. Kein anderer Gott soll in dieser Stadt, in diesen Mauern, auf diesem Berg geduldet werden. Bis in alle Ewigkeit.«
Der Tempelberg, o Gott. Der Tempelberg? Dort hatten seit Urzeiten fast alle Schwierigkeiten in Jerusalem ihre Wurzel, jedenfalls behauptete das mein Vater.
Und hier hatte alles angefangen?
Daduas Miene wurde kühl. »Die Opferung von Yeladim wird nicht mehr hingenommen. Nie wieder sollt ihr im Tal den Bauch Molekhs mit der Saat eurer Lenden füttern. Es wird in Jebus keinen Gott außer el feaShaday geben.
Die zweite Bedingung ist folgende: Unser Brauch gebietet es, Witwen und« - Dadua kam kurz ins Straucheln, da es keine Waisen mehr gab - »ach, allen, die unter uns leben, Schutz zu gewähren. Sollte ein Mann aus unseren Stämmen sich euch nähern und euch zum Weib oder zu seiner Konkubine nehmen wollen, müsst ihr wissen, was sich geziemt.
Er ist verpflichtet, einen vollen Monat für euch zu sorgen. Während dieses Monats haltet ihr Trauer um eure Familie, um eure Verwandten.
Schert euer Haar, lasst eure Nägel wachsen und wisset, dass ihr einen Monat lang unter dem Schutz unserer Gesetze steht, um das zu ehren, was ihr verloren habt. Wenn er euch nach Ablauf dieser Zeit immer noch begehrt, kann er euch zur Frau nehmen, indem er euch erkennt. Er wird euch Kinder schenken, die ihr nicht töten werdet.«
Mein Blick wanderte über die Frauen. Wir sind wirklich das stärkere Geschlecht, dachte ich. Die Männer haben es leichter, sie fallen in der Schlacht. Die Frauen müssen ganz von vorne anfangen, sie müssen sich zu ihren Feinden ins Bett legen, ihnen Kinder schenken, den alten Sitten abschwören und neue annehmen.
War es die Sache wert gewesen? Tauschten sie dadurch die alten Ketten gegen neue ein? Mein Blick fiel auf die Kaufmänner, die Bauern, denen man das Leben geschenkt hatte.
Wussten sie zu schätzen, was ihre Frauen getan hatten?
Würden sie das neue Regime anerkennen?
»Falls er nach dieser Zeit, nach diesem Monat, euch nicht mehr zur Frau nehmen will, ist er verpflichtet, euch ziehen zu lassen. Er kann euch nicht verkaufen, denn er besitzt euch nicht.« Gott sei Dank, dachte ich. Keine Sklaverei, kein Hal, kein Herim. Ich atmete gerade erleichtert aus, als seine Worte in mein Bewusstsein drangen. »Ihr könnt mitsamt eurem Besitz von dannen ziehen.«
Aber er behält euer Haus, dachte ich. Ganz schön schlau, Dadua. Wirklich schlau.
»Sollte er darauf beharren, euch zur Frau zu nehmen, darf er sich nie wieder von euch scheiden lassen, denn ihr wurdet unter Zwang verheiratet. Ihr steht unter dem Schutz der Gesetze unseres Landes und der Ehre dieser Stämme. Eure Kinder sollen erzogen werden wie jene Y’sraels, sie werden Shaday anbeten und sich mit den unseren verheiraten.«
Daduas Blick wanderte über die Menge und kam endlich auf seinen Männern zu liegen. Sie antworteten im Chor: »Dein Wille geschehe.«
Er nahm ihre Zustimmung mit einem Kopfnicken zur Kenntnis und sprach dann zu Yoav: »Wie du es wünschst.«
Zorak ging direkt auf Waqi zu, zog sie in seine Arme und küsste sie. Es war eine zärtliche und liebevolle Geste, und sein Gesicht hatte denselben Ausdruck wie damals, als er ihr Kind zur Welt gebracht hatte, nur noch inniger.
Die Frauen wurden wie Obst gepflückt, behutsam und vorsichtig. Ohne alle unflätigen Bemerkungen, ohne Grabschen. Die Frauen, deren Männer noch am Leben waren, blieben dicht neben ihren Gemahlen stehen und wurden von den Männern aus den Stämmen übergangen. Es war ein stiller, geschäftsmäßiger und seltsam unpersönlicher Akt. Ich achtete darauf, im Schatten zu bleiben - ich wollte nicht für eine Bewohnerin von Jebus gehalten werden, nur falls jemand nicht gewillt war, mein zugeschminktes Gesicht zu übersehen. Dann berührte ich mein Gesicht mit dem Finger und bemerkte, dass meine Farbe, die Schutzmaske aus vorgetäuschter Akne, abgewaschen war.
In der Abenddämmerung wurden die Stadttore wieder geschlossen. Dadua hatte die ihm geschenkte Stadt in Besitz genommen und würde heute Nacht in seinem neuen Palast schlafen. Qiryat Dadua - mir schwirrte der Kopf.
Wenn ich in Ägypten während des Tages durch die Tempel gewandert war, hatte ich geglaubt, die Stimmen der Toten zu hören. Sie erzählten mir ihre Geschichten, sie eröffneten mir, wie schön es damals gewesen war. Mein Pinsel hatte danach gedrängt, sie aufzuzeichnen, doch das hatte meine Fähigkeiten überstiegen.
In Kallistae, inmitten der Wunder des aztlantischen Imperiums, hatte ein fast greifbares Gefühl von Magie in der Luft gelegen. Kein Wunder, dass dort unsere Götter- und Heldensagen ihren Ursprung hatten. Die mystische Stimmung ließ die Hügel selbst höher wirken.
Hier jedoch spürte ich etwas, das ich an keinem anderen Ort empfunden hatte. Heute Nacht, während der Wind durch mein schweißfeuchtes Haar fuhr und die Sterne den Himmel sprenkelten, spürte ich zum ersten Mal Heiligkeit.
Lag es daran, dass die Luft viel klarer war? Oder daran, dass wir so hoch lagen?
Oder daran, dass Jerusalem, unter welchem Namen auch immer, tatsächlich der Fußschemel Gottes war?
VIERTER TEIL
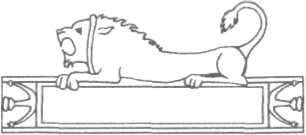
11. KAPITEL
In nicht einmal drei Tagen war der Umzug Daduas, seiner mannigfachen Gemahlinnen und seiner nie still haltenden Kinder in die Stadt vollzogen. Die reisenden Männer trafen zwei Wochen darauf ein, am bislang heißesten Tag des Jahres.
Anfangs sahen wir sie nicht; wir rochen sie nur.
Im ersten Moment glaubte ich mich in die Zeit zurückversetzt, als dies die Stadt Molekhs gewesen war, da verbrennende Leichen und herumgetragene, halb verrottete Ziegen einen ähnlich beißenden, Ekel erregenden Gestank erzeugen, der sich kilometerweit, über die Berge hinweg und durch Stein hindurch ausbreitet.
Wir Frauen saßen gerade unschuldig im Hof, fächelten uns Luft zu, tranken lauwarmen Gurkenjogurt und klatschten. Offenbar hatte haNasi seine Augen auf irgendein junges Ding geworfen. Aber wer war sie?
Eine Sklavin? Die Tochter von irgendwem? Shaday allein wusste, woher plötzlich all die Prinzen mit Töchtern im heiratsfähigen Alter auftauchten. Die enge Stadt hatte sich in eine Edelfrühstückspension für abgewiesene gekrönte Häupter verwandelt. Hatten sie sich draußen in den Hügeln versteckt und nur den Ausgang der Schlacht abgewartet?
Keine zwei Tage nach Daduas Einzug in die Stadt war der erste Wüstenkönig mit seiner verschleierten Tochter, einem einschmeichelnden Lächeln und schwer beladenen Eseln erschienen.
Doch konnte Dadua neben Mik’el, Avgay’el, Hag’it und Ahino’am wirklich noch mehr Gemahlinnen brauchen? Mik’el und Avgay’el weigerten sich, zusammen in einem Raum zu sein; Ahino’am verbot allen anderen, das tiefe Rot zu tragen, das ihre Lieblingsfarbe war; ich war fest davon überzeugt, dass Hag’it bisexuell war, und wenn die Kinder nicht gerade durch den Palast rannten, dann stritten sie miteinander.
Wer also war das junge Geschöpf? Jeder erging sich in Spekulationen.
Um Genaueres zu erfahren, bestach Mik’el die Wachposten vor Daduas Tür, damit sie ihr erzählten, wer dort ein und aus ging; Avgay’el bezahlte die Transuse dafür, dass sie aufpasste, welche Sklavinnen in seinen privaten Gemächern verschwanden und wie lange sie darin blieben: Hag’it steckte der Küchenhilfe etwas zu, damit sie die benutzten Tassen und Teller zählte und kontrollierte, ob Dadua nicht vielleicht für zwei aß; und Ahino’am aß selbst für zwei, da sie immer noch stillte. Da es bis zur Erfindung der Trockenmilch noch einige Zeit hin war, war es ganz normal, drei oder mehr Jahre lang zu stillen.
Es war das Essen zu Yom Rishon, und jede unter Daduas Frauen hatte ihre Spezialität zubereitet. Da wir am Sabbath nicht arbeiten durften, hatten wir bereits am Nachmittag zuvor Kleider ausgewählt oder ausgemustert, Geschmeide getauscht, die Hände mit Henna geschmückt. Ich hatte mich nach der schlichten Arbeit am Mühlstein gesehnt, nach dem Mahlen und Brotbacken. Auch wenn ich keine Sklavin war, so lebte ich doch im Harem, daher hätte es befremdlich gewirkt, wenn ich mich geweigert hätte.
Waqi hatte mich eingeladen, weiter bei ihr zu wohnen, doch Zorak und seine Mutter verbrachten dort Waqis »Trauermonat«, bevor die beiden ihre Verbindung offiziell bekannt geben würden. Ich brauchte sie nur zusammen zu sehen, ihre liebe-vollen Blicke sowie die beiläufigen Berührungen, um auf der Stelle Sehnsucht nach Cheftu zu bekommen. Doch andererseits gab es kaum etwas, das diese Sehnsucht nicht auslöste.
Auf dem Dach war alles für das Essen vorbereitet worden, und endlich war auch die Temperatur gesunken, sodass eine wunderbare, parfümierte Kühle die von einem makellosen Vollmond erhellte Tafel durchwehte. Ich stand bei den meisten anderen Frauen, während die Männer speisten. Nur selten, wenn überhaupt je, aß die gesamte Familie zusammen. Für die Männer bedeutete so ein Essen einen absoluten gesellschaftlichen Höhepunkt, für die Frauen bedeutete es eine massive Zeit- und Energieverschwendung. Infolgedessen würden wir später essen, nach ihnen.
Und während wir dort standen, wehte der grässliche Gestank über uns hinweg. Und verzog sich wieder.
In mancher Hinsicht gleichen die Sitten im Nahen Osten jenen in den amerikanischen Südstaaten; ich glaube, dass mein Vater sich aus diesem Grund in beiden Gesellschaften so wohl gefühlt hat. Mimi hatte mir eingebläut, es sei die oberste Pflicht einer Gastgeberin, alles dafür zu tun, dass die Gäste sich wohl fühlten und das Gefühl bekamen, gern gesehen zu sein. Nichts durfte dieses Gefühl trüben, weshalb meine Familie auch stets alle Familienzwiste unterdrückt hatte.
Bei den Saudis war das ganz ähnlich. Nichts durfte dem Gast Unbehagen bereiten. Über negative Dinge wurde keinesfalls gesprochen; man stocherte nicht in alten Wunden herum.
»Alles Unangenehme ignorieren« hieß das Motto.
Und nach diesem Motto wurde auch jetzt gehandelt, obwohl uns dieser entsetzliche Geruch überzog. Niemand erwähnte ihn mit einem Wort, auch wenn wir alle würgten, nach Luft schnappten, keuchten. Es war unvorstellbar. Dann drehte der Wind, und die Luft war wieder rein.
Die bunte Ansammlung von ausländischen Königen, Prinzen und Adligen gab vor, nicht das Geringste gerochen zu haben.
Daduas Augen tränten, doch er schwieg. Verlegenes Schweigen senkte sich über die Tische, darum reichte ihm der Gibori Abishi den Kinor. »Sing uns ein Lied, Adoni.«
Dadua sah nicht einmal auf; er zupfte ein paar Mal an den Saiten, um sie zu stimmen. Während wir auf seinen Einsatz warteten füllte sich die Luft mit unausgesprochenen Hoffnungen.
Wieder drehte der Wind, und erneut schlug uns der Gestank nieder. Höflich oder nicht, man hätte sowieso keinen passenden Kommentar finden können. Der Geruch war einfach nicht zu ignorieren. »Bei Shaday, was ist das?«, fragte eine Frau mit Tränen auf den Wangen.
»Sie kommen zurück!«, hörten wir einen Ruf vom Tor.
»N’tan kommt zurück!« Der Shofar erklang. Tumultartig hetzten wir aus dem Palast und rannten zum schwer bewachten Tor hinunter. Der Gestank war kaum auszuhalten. Er ging von den Männern aus; es war gar nicht anders möglich. Die Nacht hatte sich endgültig über das Land gesenkt, weshalb jeder von uns eine Fackel hielt und wir uns an der Straße aufbauten, um ihnen den Weg hinauf in die Stadt zu weisen.
Ich versuchte im Dunkel etwas zu erkennen, meinen Mann auszumachen. Doch ich sah ihn nicht; ich hatte das Gefühl, gleich laut heulen zu müssen. »Sind das die Männer?«, fragte jemand.
»Was haben sie getan?«, fragte Avgay’el, die Nase in der Hand verborgen und mit Tränen auf ihrem makellos ovalen Gesicht.
Abiathar, der Hohe Priester, trat vor. Auch ohne seine Robe wirkte er eindrucksvoll.»N’tan?«, rief er in die Nacht.
»Ken«, hörten wir eine Stimme aus dem Dunkel.
»Ihr müsst euch reinigen, ehe ihr die Stadt betretet«, rief er. »Ihr stinkt.«
Ich konnte nicht fassen, welche Zeremonien die Männer über sich ergehen lassen mussten, ehe man sie in die Stadt ließ.
Waschen und rasieren, Gebete und Besprechungen ... halb wahnsinnig wanderte ich durch die Nacht und versuchte Geduld zu bewahren. Schließlich kletterte ich auf den Wehrgang über dem Tor und sah hinaus ins Tal, während ich darauf wartete, dass man meinen Gemahl zu mir ließ.
Um Mitternacht ging Dadua zu den Männern hinaus. Die Akustik war bescheiden, deshalb hatte ich keine Ahnung, was dort gesprochen wurde. Schließlich ließ ich mich auf dem Gang zwischen den Wachtürmen nieder, zum Schutz vor dem Wind dicht an die Mauer gepresst, und schlief ein. Am Rande meines Bewusstseins hörte ich von Zeit zu Zeit Sandalen über Stein klatschen. »Chloe?«, hörte ich schließlich.
Ich erwachte aus einem Traum, schlug die Augen auf und blickte in das Gesicht, das ich über alles in der Welt liebte. »Du bist wieder da«, hauchte ich und streckte Cheftu die Arme entgegen. Kaum war der Schlaf von mir abgefallen und mir bewusst geworden, dass es bereits Tag war, da hatte ich mich auch schon wieder mit seinem Duft und dem Gefühl seiner Haut an meiner vertraut gemacht. »Du bist wieder da«, sagte ich noch einmal und hätte fast geweint vor Staunen darüber, dass er tatsächlich vor mir stand. »Wie geht es dir?«, fragte ich, rührte mich aber nicht dabei, weil ich den Kontakt zu seinem Fleisch nicht verlieren wollte.
»Jetzt ausgezeichnet«, sagte er.
»Habt ihr es gefunden?«, fragte ich. »Das Gold?«
»Ken, chérie. Genug Gold, um einen Pharao zufrieden zu stellen.«
Ich sah nach oben und stellte fest, dass der Himmel sich immer mehr aufhellte. »Wie kommt es, dass wir dieses Gold nicht gesehen haben?«, fragte ich. »Schließlich sind wir zusammen mit den Apiru aus Ägypten geflohen.«
»Es wurde vor unserem Aufbruch eingesammelt und gesondert transportiert. Die trauernden Ägypter waren damals nur zu gern bereit, die Apiru dafür zu bezahlen, dass sie fortzogen.«
Ich löste mich von ihm, um ihm ins Gesicht zu sehen. Einen Moment lang schwelgte ich einfach nur in seiner Schönheit. Dichte Brauen über einer messerscharfen Nase, ein kantiges Kinn, volle und sinnliche Lippen. »Was schaust du?« In seinen Augenwinkeln bildeten sich winzige Lachfältchen.
Ich streckte die Hand aus, strich über seine frisch rasierte Wange und bemerkte, wie das Lachen aus seinen Augen wich. »Es war -«
»Viel zu lang«, vollendete er den Satz für mich, zog mich in die Arme, drückte mich gegen die Steinmauer, presste seinen Mund auf meinen und verschlang mich mit Küssen.
Er packte mich am Kinn, sodass ich meinen Mund weiter öffnen musste. Meinen Schenkel über sein Bein ziehend und mit einer Hand meine Wade streichelnd, schob er meinen Rock hoch. Nach einigem Genestel und einem unterdrückten Lachen hatte er seinen Schurz gelöst.
Dort im morgendlichen Sonnenschein hielt er mich in seinen Händen, meine Beine um seine geschlungen, während er langsam meinen Leib auf seinen senkte. Meine Augen schlossen sich, ich spürte, ich kannte nur noch Cheftu. Schon ergoss sich das Licht der Sonne über uns, als würde eine Ofentür während des Vorheizens aufgerissen.
Ich spürte, wie sich seine Schultern unter meinen Händen bewegten und regten, wie seine Hände bedacht meinen Hintern hielten, wie unsere Beine sich ineinander verschränkten, wie er mich ganz und gar ausfüllte. Er war mein Universum, die einzige Wahrheit in diesem Raum in der Zeit. Mit langsamen und gleichmäßigen Bewegungen brachte er die Flamme dazu, höher zu brennen. Ich bat um mehr, ich flehte um Tempo, doch er spannte mich auf die Folter, er brachte meine Haut von innen zum Brennen. Bunte Flecken tanzten mir vor den Augen, verbrannten mich, entflammten mich, bis ich explodierte und wir beide, noch während ich in seinen Armen zusammensackte, bebend und schlotternd gegen die Mauer sanken.
»Was sollte das eben?«, fragte ich kurz darauf, immer noch außer Atem.
»Ach, na ja, du willst doch Kinder«, sagte er. »Als Sklave wollte ich auf keinen Fall welche bekommen, aber nun« - er zuckte mit den Achseln - »bin ich tatsächlich frei.« Er drehte den Kopf und lächelte mich an, doch seine Augen waren dabei gegen das Licht der Sonne geschlossen.
Ich brauchte einen Augenblick, ehe ich seine Worte verarbeitet hatte, doch dann schoss ich hoch. »Du bist frei!«
Die Löcher waren noch in seinen Ohren, doch ohne Kette. Er lächelte und hatte die Augen dabei immer noch geschlossen, aber seine ganze Haltung lockerte sich. »Oui, chérie. Wir haben ein Heim, ich habe Arbeit, wir befinden uns am Beginn des Aufstiegs des Volkes Israel ... ich finde, wir sollten jetzt eine Familie gründen.«
Ich schluckte die Tränen hinunter. »Und da wolltest du keine Zeit vergeuden, wie?«, neckte ich ihn.
Er drückte mein Gesicht an seine Brust und schloss mich beschützend in seine Arme. Seufzend hörte ich ihm zu. Absolut ernst antwortete er mir auf Englisch: »Mit dir ist kein einziger Moment vergeudet, ma Chloe.«
So blieben wir sitzen, bis wir das unnatürlich laute Klirren von Metall auf Stein hörten. »Merde, Soldaten«, meinte Cheftu und löste sich von mir. Die Sonne brannte auf uns herab und grillte uns in dieser Spalte aus weißem, reflektierendem Stein. Ich zupfte meinen hoffnungslos zerknitterten Rock zurecht, während Cheftu seinen Schurz gerade rückte.
Dann sah er mich an, wahrscheinlich zum ersten Mal bei Tageslicht. »Deine Ketten!«, rief er aus. »Wo sind sie?«
Ich grinste.
»Aschenputtel hat nicht auf den Prinzen gewartet«, meinte ich ironisch.
Wieder klirrte ein Schwert auf Stein, und jemand räusperte sich laut. »Wir sollten verschwinden, damit der arme Mann
nicht weiter seine Waffe malträtieren muss«, sagte ich.
»Ich rühre mich nicht von der Stelle, ehe du mir das erklärst.«
Lächelnd zuckte ich mit den Achseln. »Ich habe mir die Freiheit erworben. Ab dem heutigen Tag.«
»Was? Wie?«, fragte er. »Du setzt mich immer wieder in Erstaunen, chérie. Du hast sie heute erworben?«
»Lo«, korrigierte ich. Ein junger Gibori marschierte pfeifend vorbei, den Blick fest auf das Tal gerichtet. Ich sah wieder Cheftu an. »Doch als Yoav gehört hat, dass du hier bist und dass Dadua dich empfängt, hat er nach mir geschickt.«
Cheftu verschränkte die Arme und zog eine Braue hoch.
»Und?«
Wir hatten uns im düsteren Schein einer Lampe getroffen. Ich hatte den Wein gerochen, noch ehe ich in den Raum getreten war. »Du bist keine Sklavin mehr«, hatte Yoav gesagt. Er klang und wirkte nicht betrunken, doch er hatte sich bis auf die Untertunika ausgezogen. Im flackernden Licht der Lampe zuckten seine kräftigen Muskeln, und seine zerklüfteten Gesichtszüge wirkten weicher als sonst. »Darum komm und lass deine Ketten lösen.«
Seine Worte waren in keiner Weise zweideutig, doch seine Stimme klang suggestiv. So blieb ich stehen, denn einerseits wollte ich ohne Ketten sein, wenn ich Cheftu traf, andererseits jedoch hatte ich Angst davor, Yoav so nahe zu kommen. Mir war klar, dass er mich nicht anrühren würde, mir war klar, dass ich ihn nicht anrühren würde, dennoch war es ein merkwürdiges und beängstigendes Gefühl, ihn so extrem wahrzunehmen. Ich war verheiratet. Damit nicht genug, ich war glücklich verheiratet! Wieso stellte ich mich so an? Mein Schlucken hallte laut durch die Dunkelheit.
»Wir sind dir etwas schuldig.« Er räkelte sich in seinem Stuhl. »Ich jedenfalls. Ohne deine Mithilfe hätten wir keine Bresche in diese Stadt schlagen können.«
»Ich würde das kaum als >Mithilfe< bezeichnen. Es war schon eher eine Erpressung, Adoni.«
Er lachte leise und zuckte mit den Achseln. »Ich tue alles, um meinem Lehnsherrn zu dienen.«
»Du hast bekommen, was du dir gewünscht hast, Rosh Tsor haHagana.«
Seine grünen Augen blickten in meine. »Was ich wirklich will, kann ich nicht bekommen.«
Ich schluckte wieder, denn ich spürte die Hitze in meiner Brust und auf meinem Gesicht.
»Ich werde es mir nicht nehmen. Avayra goreret avayra.«
»Was soll das heißen, dass eine Missetat die nächste nach sich zieht?«
»Ach, Isha. Du bist eine solche Heidin.« Er nahm ein Werkzeug von dem niedrigen Tisch an seiner Seite. »Setz dich, dann werde ich dir etwas über mein Volk erklären.«
Die Spannung hatte sich gelöst, aber ich war immer noch nervös. Ich ließ mich vor ihm auf einem Hocker nieder und zog ganz behutsam die Kette heraus. Ich hatte sie Tag und Nacht tragen müssen, doch ich hatte mich irgendwann daran gewöhnt, an das Gewicht und das Gefühl. Es war ähnlich wie lange Haare zu haben oder sich ständig die Hände zu maniküren. Irgendwann fand man sich einfach damit ab. Allerdings hatte diese Art von Sklaverei wenig mit allen anderen Formen von Sklaverei zu tun, von denen ich je gehört hatte. Er zog die Metallglieder nach oben, bis ich ein leichtes Zerren an meinem Ohr spürte, dann hörte ich die Schläge des kleinen Hammers.
»Lifnay Dadua herrschte Labayu. Lifnay Labayu zum König gekrönt wurde, herrschten Richter über uns. Von der Zeit ha-Moshes bis zu Labayu lebte jeder Stamm für sich und hatte seine eigenen Richter, die wiederum ihre eigenen Richter hatten und so fort.«
Die Schläge von Metall auf Metall gaben seiner Geschichte Rhythmus.
»Als also die Stämme wieder ins Land zogen, war Achan unter den Soldaten, die ausgesandt wurden, die Stadt Ai einzunehmen. Sie verloren die Schlacht, die sie eigentlich nicht hätten verlieren dürfen. Achan war ein tapferer Soldat und hatte den Angriff geleitet. Der damalige Richter wollte von Shaday wissen, warum wir verloren hatten. Shaday sagte, er könne uns nicht helfen, nachdem wir die Übereinkunft mit ihm gebrochen hatten. Man hatte uns gesagt, dass die Eroberung des Landes eine heilige Aufgabe sei, Herim. Es steht uns nicht an, zu schänden und zu plündern, wie es die Unbeschnittenen tun. Ach, nun, nach einigen Nachforschungen wurde offenbar, dass Achan in einer früheren Schlacht Beute gemacht hatte.«
»Und was geschah?«
»Man musste ein Exempel statuieren: Avayra goreret avay-ra.«
Schon wieder dieser Satz: Eine Missetat zieht die nächste nach sich.
»Achan wurde mitsamt seinem ganzen Besitz und seiner Familie vor das Lager gebracht. Da es sich um einen Übergriff gegen die Gemeinschaft handelte, denn schließlich hatten wir eine Schlacht und viele Leben verloren, fällte die Gemeinschaft das Urteil über ihn.«
»Äh ... und welches?«
Ich hatte ein ungutes Gefühl. Schließlich war ich im Nahen Osten aufgewachsen. Gerechtigkeit war hier eine blutige Angelegenheit.
Das Metall löste sich mit einem Klirren. Einen Moment lang herrschte atemlose Stille. »Achan, seine Familie und sein Besitz wurden zu Tode gesteinigt.«
»Gesteinigt?«, wiederholte ich.
»Und die Überreste wurden verbrannt. Wann immer du einen großen Steinhaufen vor der Stadtmauer siehst, handelt es sich um ein Zeichen, dass jemand einen Verstoß gegen die Gemeinschaft begangen hat und von der Gemeinschaft dafür bestraft wurde.« Er ließ sich zurücksinken. »Du kannst deine Ketten selbst lösen.«
Ich zog sie durch die Ohren, die sich mit diesen riesigen Löchern eigenartig luftig und ohne das Gewicht des Metalls befremdlich leicht anfühlten. »Ich begreife das immer noch nicht. Wieso zieht eine Missetat die nächste nach sich?« Ich hatte ihm den Rücken zugewandt. Er beugte sich von mir weg, sodass ich die Wärme der Lampe auf meiner Haut spürte. Meine Hände zitterten.
Yoav seufzte tief. »Du führst mich in Versuchung«, erklärte er geradeheraus. »Wenn ich dich nehmen würde, wäre das ein Ehebruch. Doch wie du selbst sagst, bekleide ich den Rang des Rosh Tsor haHagana. Der König leiht mir sein Ohr. Du würdest niemandem etwas verraten. Ich würde niemandem etwas Verraten. Wenn ich das nächste Mal etwas möchte, das mir nicht zusteht, werde ich mir denken, ich habe Ehebruch begangen, ohne dass jemand davon erfahren hat. Wenn ich diesen Schatz stehle oder Lügen über jenen Mann verbreite, wer wird dann davon erfahren? Ich bin schon einmal davongekommen.«
Ich lauschte ihm absolut reglos; fast hatte ich Angst, mir bewusst zu machen, dass ich hier war.
»Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, doch sie lässt meine Eitelkeit wachsen. Irgendwann werde ich glauben, dass ich mehr weiß und klüger bin als Shaday. Diese Eitelkeit vergiftet ganz langsam meinen Nefesh, bis alle Gesetze nur noch Vorschläge für mich sind. Wenn ich die Grenzen überschreite und keine Bestrafung erfolgt, werde ich sie beim nächsten Mal noch weiter überschreiten.
Und beim übernächsten Mal noch weiter. Im Lauf der Zeit wächst so ein Baum der Unaufrichtigkeit heran, der die Luft und die Erde unseres Landes vergiftet.« Er rückte in seinem Sessel herum. »Missetaten vergiften das Land. Und wenn das Land vergiftet wird, wird es uns ausspucken.«
Seine Stimme wurde resoluter. »Ich opfere mein Blut für die-ses Land, für meinen Stamm. Und genauso werde ich meine Begierden opfern.«
Ich war aufgestanden; ohne anzuhalten ging ich aus dem Unterstand hinaus in die Nachtluft und die Treppe davor hinunter, bis ich, vom Wind umweht, auf dem Wehrgang stand und dorthin schaute, wo mein Herz war. Aus einem winzigen Samenkorn wächst ein großer Baum, hörte ich Mimi sagen. Pflanz ihn lieber nicht ein.
Ich sah meinen Ehemann an. »Er hat mir die Geschichte von Achans Fluch erzählt und mir erklärt, wie eine Missetat automatisch zur nächsten führt, bis alles verrottet. Danach bin ich hierher gekommen und habe auf dich gewartet.«
Seine Augen sprühten Funken; mir war klar, dass er verstanden hatte, was ich nicht gesagt hatte. Der Wind fuhr in mein Haar, und wieder spürte ich die Löcher in meinen Ohren, das Gefühl von Freiheit. Er legte eine Hand an meinen Hals und schmiegte sie um mein Gesicht. Sein Daumen fuhr das Loch in meinem Ohr nach. Wahrscheinlich konnte er den kleinen Finger hindurchstecken. Ich wollte ihn nicht ansehen, sein Blick war mir zu weich. So sah ich hinaus auf das Tal.
»Chloe?«, fragte er. Widerstrebend stellte ich mich seinem Blick. »Ich werde dich nie wieder verlassen. Das verspreche ich.«
»Nichts -«
Er schnitt mir das Wort ab. »Ich weiß das. Ich kenne dich.«
Ich hatte den Blick abgewandt, darum drehte er mein Gesicht in seine Richtung. »Ich war dir gegenüber säumig, ich habe meine Pflichten vernachlässigt.«
Unerklärlicherweise stiegen mir Tränen in die Augen. »Das hast du nicht -«
Cheftu küsste mich, fest und besitzergreifend. Der Sonne und der Hitze zum Trotz bekam ich am ganzen Leib eine Gänsehaut. Ich wollte diesen Mann gleich wiederhaben. Ich fragte mich kurz, ob der Soldat wohl die gesamte Mauer abmarschierte oder nur dieses Teilstück. »Doch«, flüsterte er gegen meine Lippen. »Ich brauche dich. Ich brauche es, dich zu berühren und dich zu halten und dir zuzuhören. Es ist meine Pflicht, dich zu lieben, für dich zu sorgen, mit dir zusammen zu sein.«
War es ein Wunder, dass ich diesen Mann liebte? Er nahm meinen Mund in Beschlag und sprach zugleich einen Teil meines Herzens an, jene absurde weibliche Schwäche, die sich wünschte, dass mir jemand - natürlich nur ein intelligenter, einfühlsamer, sanfter Mann - einen Knüppel über den Kopf haute und mich in die nächste Höhle schleifte, um mich dort ganz und gar »in Besitz zu nehmen«.
Mein Leib lag dicht an seinem, ich spürte seine Erregung, doch durch sein Reden und seine Küsse bezauberte er mich viel mehr. Wir taumelten in eine schattige Nische, wo er mich festhielt, eine Hand auf meinen Kopf gelegt. »Nein, Chloe«, erklärte er in seinem schweren, abgehackten Englisch. »Nie wieder werde ich dich verlassen.«
Die Zeit der Rebenpflege war über uns gekommen; und zwar über uns alle. Noch nie hatte ich derart intensive Teamarbeit erlebt. Das »Land«, das ständig und überall im Munde geführt wurde, wurde für mich zu einer Einheit. Nicht zu einem Gott, sondern eher zu einem Verwandten, zu jemandem, für den man sorgt, den man nährt und unterstützt. Infolgedessen fand ich mich bis tief in die Nacht im Weinberg wieder, zusammen mit Cheftu und fast allen anderen Stammesangehörigen und Sklaven, wo wir Knospen zurückschnitten, Reben hochbanden und Triebe stutzten.
Nie, nie wieder würde ich gedankenlos einen Schluck Wein trinken.
Das Gute an der Sache war, dass abends sich viele von uns auf einem Dach versammelten, gewöhnlich auf Daduas, wo wir aßen und Geschichten die Runde machten. Der kühle Wind erfrischte uns, das Lachen verjüngte uns, und nach unseren
Eskapaden, bei denen wir dicht am Tod vorbeigeschrammt waren, Psychopathen und Naturkatastrophen überlebt hatten, genossen Cheftu und ich unser neues Leben.
Immer noch war die Wohnungssituation in der Stadt prekär. Täglich zogen Menschen weg oder zu: Jebusi, die aufgegeben hatten und nach einem Ort suchten, an dem man Molekh freundlicher gesonnen war, Männer aus den Stämmen, die mit Kindern, Frauen und Rüstung Einzug hielten. Immer noch gab es in manchen Ecken der Stadt Blutflecken, doch ich zog es vor, meinen Blick abzuwenden.
Eines Nachts, nicht lange nach Cheftus Rückkehr und unserer Freilassung, saßen wir mit Zorak und Waqi, die inzwischen geheiratet hatten, sowie einigen anderen Auserwählten, deren Namen mir immer noch fremd waren, auf Daduas Dach, als Dadua verkündete, dass er ein neues Lied geschrieben habe. »Dieses Lied soll Yohanans, des Bruders meines Nefesh, gedenken, der in der Schlacht gefallen ist.« Es war eine klagende Melodie in noch schwereren Mollklängen als sonst in der Musik der Stämme üblich. Die Melodie der Laute und der gefühlvolle Klang seiner Stimme trugen weit über das stille Dach hinaus. Mir knurrte der Magen - die Frauen hatten noch nicht gegessen -, doch ich konnte nicht weg.