14
25. November 2012 Miami, Florida
21.54 Uhr Der schwarze Pronto Spyder biegt
nach rechts in die Twenty-third Street ein, wendet und parkt vor
einem Telefonmasten am Bordstein, gleich neben der sechs Meter
hohen, grell weißen Betonmauer. Die Seitenstraße, die an der
Nordseite der Anstalt entlangläuft, führt noch zwei Blocks weiter
nach Westen, wo sie an einer verwaisten Baumwollspinnerei endet.
Wie viele Straßen des verwahrlosten Viertels ist sie verlassen, nur
ein Dodge-Van parkt am anderen Ende des Blocks.
Dominique steigt aus dem Wagen. Adrenalin schießt
durch ihre Adern. Sie öffnet den Kofferraum, vergewissert sich,
dass niemand zu sehen ist, und holt ein fünfzehn Meter langes und
eineinhalb Zentimeter dickes Nylonseil heraus. Dann bückt sie sich,
als wolle sie ihren rechten Hinterreifen inspizieren, bindet ein
Ende des Seils an den Fuß des Telefonmasts und wendet sich wieder
dem Kofferraum zu.
Sie öffnet einen großen Pappkarton und entnimmt ihm
einen ferngesteuerten Modellhubschrauber, an dessen kleinem
Fahrgestell ein mechanischer Greifer hängt.
Dominique legt den Knoten am losen Seilende zwischen die Zangen
des Greifers und schließt ihn.
Okay, jetzt muss ich aufpassen. Das Seil darf
sich nicht im Stacheldraht verfangen.
Sie schaltet den batteriebetriebenen Motor des
Miniaturhubschraubers ein und zuckt zusammen, als sich die Rotoren
mit einem lauten, hohen Jaulen zu drehen beginnen. Das Fluggerät
hebt ab und schwankt bedenklich hin und her, während es das
Nylonseil anhebt. Dominique lässt es steil in die Höhe steigen, bis
das Seilende sich über die Mauerkrone erhebt.
Behutsam...
Mit dem Steuerhebel lässt sie den Hubschrauber über
die Mauer schweben. Als er über dem Hof der Anstalt steht, öffnet
sie den Greifer und lässt das Seil los.
Der befreite Knoten fällt zu Boden, während das
Seil zwischen den Stacheldrahtrollen auf die Mauerkrone
gleitet.
Geschafft. Weg mit dir! Dominique legt den
Steuerhebel ganz nach rechts. Der Modellhubschrauber rast auf die
Baumwollspinnerei am Ende der Straße zu und verschwindet über dem
Dach des verlassenen Gebäudes. Sie schaltet die Fernsteuerung aus
und hört in der Ferne das verräterische Geräusch von
zersplitterndem Plastik.
Dominique schlägt den Kofferraumdeckel zu, steigt
in den Roadster und lenkt ihn auf den Personalparkplatz.
Sie schaut auf ihre Armbanduhr: 22.07. Bald ist es
so weit. Sie greift ins Handschuhfach und holt eine
verbrauchte Zündkerze und einen Schraubenschlüssel heraus. Dann
stellt sie den Motor ab und öffnet die Haube des Wagens.
Drei Minuten später klappt sie die Haube wieder zu
und wischt sich mit einem feuchten Tuch die Schmiere von den
Fingern. Sie richtet ihr Make-up und rückt ihr enges Trägertop
zurecht, bevor sie dessen tiefen Ausschnitt mit einer rosa
Strickjacke aus Kaschmir verhüllt.
Okay, Mick, jetzt kommt’s auf dich an.
Sie eilt zum Eingang der Anstalt und hofft
inbrünstig, dass Mick bei dem Gespräch, das sie am Nachmittag mit
ihm geführt hat, klar bei Sinnen gewesen ist.
22.14 Uhr Michael Gabriel sitzt auf der
Kante seiner dünnen Matratze und starrt mit leeren schwarzen Augen
auf den Boden. Sein Mund steht offen, Speichel tropft ihm von der
Unterlippe. Sein mit Blutergüssen übersäter linker Unterarm ruht
mit der Handfläche nach oben auf dem Oberschenkel und bietet sich
dem Schlächter dar. Der rechte Arm liegt mit leicht geballter Faust
versteckt neben dem Körper.
Er hört den Pfleger kommen. »He, Marvis, hab ich
recht gehört? Ist das die letzte Nacht von diesem Wrack da
drin?«
Mick atmet tief durch, um seinen hektischen
Pulsschlag zu beruhigen. Dass Marvis in der Nähe ist,
verkompliziert die Sache. Du hast nur einen einzigen Versuch.
Wenn nötig, sind sie eben alle beide dran.
Marvis schaltet den Fernseher im Aufenthaltsbereich
aus und wischt die Saftflecken auf dem Couchtisch ab. »Ja. Morgen
bringt Foletta ihn nach Tampa.«
Die Tür geht auf. Aus dem Augenwinkel sieht Mick
den sadistischen Pfleger kommen; an der Tür steht schattenhaft ein
zweiter Mann.
Noch nicht. Marvis schlägt die Tür zu, wenn du
dich jetzt bewegst. Warte, bis die Luft rein ist Soll das Schwein
die Spritze doch noch reintun.
Der Pfleger packt Mick am linken Handgelenk und
stößt die Kanüle so brutal in die geschwollene Vene, dass die
Nadelspitze fast abbricht. Dann beginnt er das Chlorpromazin in das
geschundene Gefäß zu injizieren.
Mick spannt seine Bauchmuskeln an, damit sein
Oberkörper nicht vor Schmerz zusammenzuckt.
»He, Barnes, geh schonend mit ihm um, sonst melde
ich dich wieder.«
»Ach, leck mich doch am Arsch, Marvis.«
Der Wärter schüttelt den Kopf und geht.
Micks Augen drehen sich nach oben. Sein Körper
erschlafft. Er fällt auf die linke Seite und starrt wie ein Zombie
vor sich hin.
Barnes vergewissert sich, dass Marvis verschwunden
ist, dann öffnet er seinen Reißverschluss. »Na, Süßer, willst du
mal was Gutes schmecken?« Er bückt sich und bringt seine Hüften
näher an Micks Gesicht. »Wie wär’s, wenn wir mal deinen hübschen
kleinen Mund aufmachen und...«
Micks Faust sieht der Pfleger nicht, nur ein
grellrot explodierendes Licht, als ihm die Knöchel von Zeige- und
Mittelfinger an die ungeschützte Schläfe krachen.
Barnes bricht auf dem Boden zusammen, angeschlagen,
aber noch bei Bewusstsein.
Mick zieht ihn an den Haaren hoch und schaut ihm in
die Augen. »Jetzt kommt was wirklich Gutes. Pass mal auf, du
Scheißkerl!« Sein Knie zuckt hoch und landet mitten im Gesicht von
Barnes. Dann lässt er den Kopf des Pflegers sinken, damit kein Blut
auf dessen Uniform gerät.
22.18 Uhr Dominique gibt ihren Geheimcode
ein und wartet, bis die Infrarotkamera ihr Gesicht gescannt hat.
Als das rote Licht auf Grün umspringt, ist der Weg zur
Kontrollstation im Erdgeschoss frei.
Raymond dreht sich zu ihr um. »Na, wen haben wir
denn da? Du willst deinem debilen Süßen wohl die letzte Ehre
erweisen, was?«
»Du bist nicht mein Süßer.«
Raymond schlägt mit der Faust ans Stahlgitter. »Wir
wissen beide, wen ich meine. Noch ein, zwei Viertelstündchen, dann
werde ich ihn mal besuchen.« Er lässt
die gelben Zähne aufblitzen. »Ja, Schätzchen, ich und dein Süßer
werden uns so richtig amüsieren.«
»Mach doch, was du willst.« Sie geht auf den Aufzug
zu.
»Was soll denn das?«
»Mir reicht’s.« Dominique zieht einen Umschlag aus
der Handtasche. »Weißt du, was das ist? Das ist ein Brief an
Foletta. Ich breche das Praktikum ab, und mit der Uni mache ich
auch Schluss. Ist Foletta in seinem Büro?«
»Natürlich nicht.«
»Na schön, dann gebe ich den Umschlag Marvis.
Schick mich doch bitte in den sechsten Stock, falls du das schaffen
solltest.«
Raymond beäugt sie argwöhnisch. Dann wendet er sich
seinem Schaltpult zu, stellt den Aufzug an und drückt den Knopf für
den sechsten Stock. Während sie hoch fährt, beobachtet er sie auf
seinem Videomonitor.
Marvis steht gerade von seinem Tisch auf, um
festzustellen, wo Barnes geblieben ist, als sich die Aufzugtüren
öffnen. »Dominique? Was machen Sie denn hier?«
Sie nimmt Marvis am Arm und führt ihn am Tisch
vorbei, weg vom Aufzug und vom Flur, der zu Micks Station führt.
»Ich will Ihnen was sagen, aber das soll dieser Barnes nicht
mitbekommen.«
»Was soll er nicht mitbekommen?«
Dominique zeigt ihm den Umschlag. »Ich höre
auf.«
»Wieso? Ihr Praktikum ist doch bald vorbei.«
Tränen treten ihr in die Augen. »Mein... mein Vater
ist bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen.«
»Um Himmels willen. Mensch, das tut mir aber
Leid.«
Aufschluchzend lässt sie sich von Marvis trösten.
Sie legt ihm die Kopf an die Schulter, über die sie den Flur sehen
kann, der zu Station 7-C führt.
Mick taumelt aus seiner Zelle, gekleidet in Barnes’
Uniform und Baseballmütze. Er schlägt die Tür zu und geht Richtung
Aufzug.
Um Marvis daran zu hindern, sich umzudrehen, legt
Dominique ihm die Hand an den Hals, als wollte sie ihn streicheln.
»Tun Sie mir einen Gefallen und sorgen Sie dafür, dass Dr. Foletta
diesen Brief bekommt?«
»Ja, klar. Sagen Sie mal, wie wär’s, wenn wir noch
kurz was trinken gehen und ein bisschen drüber reden oder
so?«
Die Aufzugtüren gehen auf. Mick taumelt
hinein.
Sie tritt einen Schritt zurück. »Nein, danke, es
ist schon so spät. Ich muss losfahren. Morgen früh ist die
Trauerfeier. Barnes, halten Sie die Tür auf, bitte!«
Ein weißer Ärmel legt sich an die Türkante.
Dominique gibt Marvis einen Kuss auf die Wange.
»Alles Gute!«
»Ja, das wünsch ich Ihnen auch.«
Sie eilt zum Aufzug und schlüpft hinein, während
sich die Türen schließen. Statt Mick anzuschauen, blickt sie direkt
in die Kamera, die an der gegenüberliegenden Ecke der Decke
angebracht ist.
Wie zufällig greift sie in ihre Handtasche.
»Welcher Stock, Mr. Barnes?«
»Zweiter.«
Dominique hört die Müdigkeit in seiner Stimme. Sie
hält erst zwei, dann einen Finger vor die Kamera und blickt
weiterhin starr in deren Objektiv, während ihr Mick die schwere
Drahtschere aus der anderen Hand nimmt und einsteckt.
Der Aufzug hält im zweiten Stock. Die Türen gehen
auf.
Mick taumelt hinaus, wobei er fast auf die Nase
fällt.
Die Türen schließen sich.
Mick blickt sich um und sieht, dass er allein im
Flur ist. Während er vorwärts stolpert, drehen sich grün gekachelte
Wände in seinem Kopf. Die starke Dosis Chlorpromazin zieht ihn zu
Boden, doch das muss er jetzt aushalten. Er fällt zweimal hin, dann
lehnt er sich an die
Wand und zwingt sich, den Ausgang zum Hof anzusteuern.
Die Nachtluft lässt ihn vorübergehend aufleben. Er
schafft es, die Betontreppe zu erreichen, wo er sich ans stählerne
Geländer klammert. Vor sich sieht er verschwommen die drei
Treppenfluchten tanzen. Er blinzelt angestrengt, ohne dass der
Nebel vor seinen Augen verschwindet. Los, das schaffst du. Einen
Schritt vor... und jetzt den Fuß nach unten! Er stolpert die
ersten drei Stufen hinab, dann fängt er sich. Reiß dich
zusammen! Ein Schritt nach dem andern. Nur nicht
vornüberbeugen...
Die letzten drei Meter taumelt er hinunter und
fällt schmerzhaft auf den Rücken.
Einen gefährlichen Moment lang lässt er zu, dass
seine Augen sich schließen. Sofort überkommt ihn ein starkes
Schlafbedürfnis. Nein! Er dreht sich auf den Bauch, richtet sich
mit Hilfe der Hände auf und stolpert mühsam auf die Betonmauer zu,
die schwankend vor ihm aufragt.
Dominique knöpft die Strickjacke auf, atmet tief
durch und tritt aus dem Aufzug. Während sie sich der
Kontrollstation nähert, richtet sie den Blick auf die Reihe von
Videomonitoren in Raymonds Rücken, auf denen wechselnde Aufnahmen
von verschiedenen Bereichen der Anstalt erscheinen.
Sie sieht den Blick auf den Hof. Eine Gestalt in
Pflegeruniform kämpft sich mühsam an der nackten Betonmauer
empor.
Raymond hebt den Kopf und starrt auf ihr
Dekollete.
Micks Arme fühlen sich wie Gummi an. So sehr er
sich auch anstrengt, er schafft es nicht, dass seine Muskeln ihm
gehorchen.
Er spürt, wie ihm der Nylonknoten durch die Finger
gleitet, und fällt zweieinhalb Meter tief. Beim Aufprall auf dem
harten Boden brechen ihm fast beide Knöchel.
Dominique sieht Mick fallen und unterdrückt einen Schrei. Bevor
Raymond reagieren kann, schlüpft sie aus ihrer Strickjacke, wodurch
noch mehr nackte Haut sichtbar wird. »Mein Gott, warum ist es hier
eigentlich immer so heiß?«
Raymond quellen die Augen aus dem Kopf. Er steht
auf und stellt sich an die Schranke. »Du willst, dass ich es dir
besorge, stimmt’s?«
Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie Mick aufsteht.
Er beginnt wieder zu klettern. Das Bild wechselt.
»Ray, mach dir nichts vor - mit den ganzen
Steroiden, die du in den Muskeln hast, hältst du doch nicht so
lange durch, wie ich es brauche.«
Raymond öffnet die Schranke. »Ziemlich heiße Worte
für ’ne Frau, die mir vor drei Wochen fast den Kehlkopf ruiniert
hat.«
»Du hast es immer noch nicht kapiert, was? Keine
Frau mag es, wenn man sie dazu zwingt.«
»Du spielst doch bloß mit mir, oder? Du willst mich
so weit bringen, dass sie mich endgültig rausschmeißen!«
»Vielleicht will ich mich auch nur entschuldigen.«
Komm schon, Mick, beeil dich...
Der Schmerz hält ihn bei Bewusstsein.
Mick beißt noch fester die Zähne zusammen und zieht
sich stöhnend höher, während er sich wie ein Bergsteiger an der
Mauer hocharbeitet. Noch drei Schritte, bloß noch drei, mach
schon, du Arschloch. Jetzt sind es nur noch zwei - pass auf deine
Arme auf, schließ die Fäuste enger. Gut, gut. Halt, durchatmen.
Okay, jetzt der letzte halbe Meter, komm schon...
Er hat die Mauerkrone erreicht. Mit letzter Kraft
wickelt er sich das Seil ein halbes Dutzend mal um den linken Arm,
um nicht abzustürzen. Direkt vor sich sieht er die
Stacheldrahtrolle. Er zieht die Drahtschere aus der Gesäßtasche und
legt die Schneiden an eine Drahtschlinge rechts vom Seil.
Mit aller Kraft drückt er die Scherengriffe
zusammen, bis der stählerne Draht durchtrennt ist. Mick packt mit
der Schere die nächste Schlinge und konzentriert sich mühsam auf
den Draht, während die Droge sein Blickfeld rasch immer enger
werden lässt.
Raymond lehnt sich an die Wand und starrt auf die
beiden prallen Hügel, die sich unter Dominiques Top wölben. »Wie
wär’s mit einem Deal, Kleine? Wir schieben ’ne kleine Nummer, dann
lasse ich deinen Süßen in Ruhe.«
Sie greift sich an den Hals, als würde es sie
jucken, um einen Blick auf den Monitor hinter der Schranke zu
werfen. Mick arbeitet noch immer am Stacheldraht.
Spiel auf Zeit. »Willst du es etwa gleich hier
machen?«
Seine Hand bewegt sich an ihrem Arm empor. »Da bist
du nicht die Erste.« Übelkeit steigt in ihr auf, als er mit der
Spitze seines Zeigefingers über die Konturen einer Brustwarze
fährt.
Mick zerrt die Stacheldrahtschlinge von der
Mauerkrone, dann zieht er sich hinauf und liegt nun schwankend auf
der Brust. Er schiebt sich weiter vor und blickt auf der anderen
Seite sechs Meter tief hinab. »Puuuh...«
Stöhnend zieht er das Nylonseil zu sich herauf und
schlingt es mehrfach um den verbliebenen Stacheldraht, dessen
Spitzen sich in sein Fleisch bohren. Dann wickelt er sich das Ende
um die Handgelenke, schiebt sich über die Kante und lässt sich
fallen.
Mick stürzt fast vier Meter tief hinab, bevor das
Seil am Stacheldraht Halt findet und seinen Fall bremst. An den
Handgelenken hängend, spürt er, wie sein Gewicht die Drahtrolle von
der Mauerkrone wegzieht und ihn auf den Gehsteig sinken
lässt.
Sekunden später kniet er auf allen vieren und
starrt wie ein erschrockenes Tier in ein näher kommendes
Schweinwerferpaar.
»Aufhören, Ray! Ich hab gesagt, du sollst
aufhören!« Dominique schiebt seine Hand von ihrer Brust und zieht
eine kleine Dose Reizgas aus der Handtasche.
»Du verfluchtes Miststück - du willst mich bloß
verarschen!«
Sie weicht zurück. »Nein, mir ist nur gerade klar
geworden, dass Mick den Preis, den du verlangst, nicht wert
ist.«
»Verdammte Nutte...«
Sie dreht sich um und drückt das Gesicht an den
Infrarotscanner. Komm schon... Sie wartet auf den Summton,
dann drückt sie die Tür auf und schlüpft hinaus.
»Na schön, Kleine, du hast es so gewollt. Jetzt
wird dein Süßer damit leben müssen.« Raymond zieht die Schublade
seines Schreibtischs auf. Er holt einen dünnen Gummischlauch heraus
und geht zum Aufzug.
Dominique erreicht den Parkplatz und sieht
erleichtert, wie der Dodge-Van in Route 441 einbiegt. Sie klappt
die Motorhaube ihres Wagens auf und wählt die eingespeicherte
Nummer des Pannendienstes.
Der Aufzug hält im sechsten Stock. Raymond
schaltet ihn ab und tritt in den Flur.
Marvis blickt auf. »Was ist denn?«
»Kümmer dich um deinen Fernseher, Marvis.« Raymond
geht durch den Flur zu Station 7-C und bleibt vor Zimmer 714
stehen. Er gibt den Code der Tür ein.
Die Zelle ist nur schwach beleuchtet. Der ranzige
Geruch von Desinfektionsmitteln und mit Urin und Schweiß getränkter
Kleidung hängt in der Luft.
Eine Gestalt liegt auf der Matratze. Sie wendet
Raymond den Rücken zu und hat das Laken bis zu den Ohren hoch
gezogen.
»’n Abend, Arschloch. Hier ist ein kleiner Gruß von
deiner Süßen.«
Raymond schwingt den Gummischlauch und lässt ihn
mit voller Wucht auf das Gesicht des Schlafenden niedersausen. Mit
einem qualvollen Aufschrei versucht der Mann aufzustehen. Der
muskelbepackte Koloss stößt ihn mit einem Fußtritt wieder auf die
Liege und bearbeitet seinen Rücken und seine Schultern mit wütenden
Schlägen, bis seine Wut verraucht ist.
Schwer atmend steht der Wärter über dem reglosen
Körper. »Na, hat dir das gut getan, Scheißkerl? Hoffentlich, denn
mir hat’s sehr gefallen!«
Er zieht das Laken zurück. »Ach, du
Scheiße...«
Rabbi Steinberg lenkt den Dodge-Van an den
Straßenrand und parkt neben dem Mülleimer eines Supermarkts. Er
schiebt die Seitentür auf, holt das Nylonseil heraus und
wirft es rasch in den Müll. Dann steigt er hinten ein und hilft
Mick, sich vom Boden auf den Sitz zu stemmen. »Wie geht’s?«
Mick blickt ihn mit leeren Augen an.
»Chlorpromazin...«
»Ich weiß.« Der Rabbi hebt seinen Kopf an und flößt
ihm einen Schluck Wasser ein. Beim Anblick der lädierten Unterarme
zuckt er zusammen. »Jetzt wird alles gut. Ruhen Sie sich einfach
aus; es wird eine lange Fahrt.«
Mick wird ohnmächtig, noch bevor sein Kopf auf den
Sitz der Rückbank gesunken ist.
Als die ersten Streifenwagen eintreffen, zieht der
Abschleppwagen den Pronto Spyder schon auf seine Ladefläche.
Raymond kommt aus dem Eingang gelaufen, um die
Polizisten zu empfangen. Er sieht Dominique. »Das ist sie! Nehmt
sie fest!«
Dominique heuchelt Überraschung. »Was soll das
heißen?«
»Du weißt genau, wovon ich rede! Gabriel ist
ausgebrochen!«
»Mick ist ausgebrochen? O mein Gott, wie denn?« Sie
sieht die Polizisten an. »Sie werden doch nicht glauben, dass ich
etwas damit zu tun hatte. Ich warte schon seit zwanzig Minuten hier
draußen.«
Der Fahrer des Abschleppwagens nickt. »Das stimmt,
Officer, das kann ich bezeugen. Und wir haben nicht das Geringste
gesehen.«
Ein brauner Lincoln Continental hält mit
quietschenden Reifen vor dem Haupteingang. Anthony Foletta steigt
aus, in einen hellgelben Jogginganzug gekleidet. »Raymond, was...
Dominique, was zum Teufel machen Sie denn hier?«
»Ich bin vorbeigekommen, um mich brieflich
abzumelden. Mein Vater ist bei einem Bootsunfall ums Leben
gekommen. Ich breche mein Praktikum ab.« Sie wirft einen
Seitenblick auf Raymond. »Sieht ganz so aus, als hätte ihr Gorilla
da ganz schön was vermasselt.«
Foletta mustert sie, dann zieht er den ranghöchsten
Beamten beiseite. »Officer, ich bin Dr. Foletta, der Direktor
dieser Anstalt. Diese Frau hatte früher mit dem Insassen zu tun,
der ausgebrochen ist. Wenn die beiden das gemeinsam geplant haben
und sie ihn wegbringen sollte, besteht eine gute Chance, dass er
noch irgendwo drinnen ist.«
Der Beamte schickt seine Männer mit dem
mitgebrachten Suchhund auf das Anstaltsgelände, dann wendet er sich
an Dominique. »Holen Sie Ihre Siebensachen aus dem Wagen, junge
Frau. Sie kommen mit.«
AUS DEM TAGEBUCH VON JULIUS
GABRIEL
Es war im Spätherbst 1974, als meine zwei Kollegen
und ich in England landeten, allesamt ziemlich froh, wieder in der
>Zivilisation< zu sein. Ich wusste, dass Pierre seinen
archäologischen Ehrgeiz verloren hatte und in die Staaten
zurückkehren wollte. Unter dem Druck seiner politisch
einflussreichen Familie hatte er sich endlich entschieden, sich um
ein Amt zu bewerben. Meine größte Angst war, dass er Maria dazu
bringen würde, ihn zu begleiten.
Ja, Angst. Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich mich
in die Verlobte meines besten Freundes verliebt.
Wieso lässt man es zu, dass so etwas geschieht?
Diese Frage habe ich tausendmal hin und her gewälzt.
Herzensangelegenheiten sind schwer zu rechtfertigen, obgleich ich
das zuerst durchaus versucht habe. Es war Begierde, redete ich mir
ein, entstanden durch die Umstände unserer Arbeit. Die Archäologie
ist ein Beruf, der eine gewisse Isolation mit sich bringt. Die
Forschungsteams sind oft gezwungen, unter primitiven Bedingungen zu
leben und zu arbeiten. Dabei müssen sie auf jegliche Intimsphäre
und den minimalsten hygienischen Komfort verzichten, um ihre
Aufgabe zu erfüllen,
wodurch praktische Überlegungen wichtiger werden als jede
angelernte Schamhaftigkeit. Ein abendliehes Bad im Fluss, das
tägliche Ritual des An- und Auskleidens - schon das Zusammenleben
in der Gruppe kann zu einem Fest der Sinne werden. So können auch
durch einen scheinbar unschuldigen Vorgang Lustgefühle geweckt und
ein Herzklopfen verursacht werden, durch das sich die strapazierte
Psyche leicht täuschen lässt.
Im Grunde war mir klar, dass dies alles nur
Ausflüchte waren, denn Marias dunkle Schönheit hatte mich schon
seit dem Augenblick in ihren Bann gezogen, in dem Pierre uns in
unserem ersten Studienjahr in Cambridge miteinander bekannt gemacht
hatte. Die hohen Wangenknochen, das lange schwarze Haar, die
dunklen Augen, die eine fast animalische Intelligenz ausstrahlten -
Maria war eine Vision, die meine Seele gefangen hielt, ein Blitz,
der mich getroffen hatte, obgleich es mir verboten war zu handeln,
denn sonst hätte ich meine Freundschaft zu Borgia zerstört.
Ich gab meinen Gefühlen also nicht nach. Ich redete
mir ein, Maria so behandeln zu müssen wie eine exquisite Flasche
Wein, die ich gern gekostet hätte, aber nicht öffnen durfte. So
schloss ich all meine Emotionen in mir ein und warf den
verhängnisvollen Schlüssel weg. Jedenfalls glaubte ich, das getan
zu haben.
Während wir an jenem Herbsttag von London nach
Salisbury fuhren, spürte ich, dass sich unser Weg nun trennen würde
und dass einer von uns dreien - höchstwahrscheinlich ich - dazu
verdammt war, einsam weiterzureisen.
Stonehenge ist zweifellos einer der
geheimnisvollsten Orte der Erde. Es ist ein bizarrer Tempel aus
aufrecht stehenden Megalithen, die wie von Riesen zu einem
vollkommenen Kreis zusammengefügt wurden. Weil wir schon während
unseres Studiums einige Zeit an dieser uralten Stätte verbracht
hatten, erwartete eigentlich keiner von uns, dort in der sanften
Hügellandschaft Südenglands irgendwelche neuen Offenbarungen zu
finden.
Wir hatten Unrecht. Dort gab es tatsächlich ein
weiteres Stück des Puzzles, das uns direkt ins Auge sprang.
Obgleich Stonehenge bei weitem nicht so alt ist wie
Tiahuanaco, weist es technische und astronomische Aspekte auf, die
ebenso unerklärlich scheinen. Die Stätte war offenbar ein
kultisches Zentrum der Menschen, die sich am Ende der letzten
Eiszeit in dieser Region niederließen. Als heilig galt der Ort auf
jeden Fall, denn in einem Umkreis von drei Kilometern um den Tempel
befinden sich nicht weniger als dreihundert Grabstätten. In einigen
davon fanden wir später entscheidende Hinweise auf eine Verbindung
mit den Artefakten, die wir in Mittel- und Südamerika entdeckt
hatten.
Mithilfe der Radiokarbonmethode hat man
festgestellt, dass Stonehenge vor etwa fünftausend Jahren errichtet
wurde. Während der ersten Bauphase entstand ein makelloser Kreis
aus sechsundfünfzig hölzernen Totempfählen, von einem Wall samt
Graben umgeben. Später ersetzten relativ kleine >Blausteine<,
die von einem gut hundertfünfzig Kilometer entfernten Bergzug
stammten, diese Holzpfähle,
An die Stelle der Blausteine traten wieder später
die megalithischen Blöcke, die teilweise noch heute erhalten
sind.
Die gewaltigen vertikalen Felsblöcke, aus denen
Stonehenge besteht, bezeichnet man als >Sarsensteine<. Dieses
härteste Gestein der Gegend findet sich rund um die Stadt Avery,
die sechsunddreißig Kilometer weiter nördlich liegt. Ursprünglich
bestand die Anlage aus dreißig solchen Steinen, die das
unglaubliche Gewicht von fünfundzwanzig bis vierzig Tonnen hatten.
Jeder dieser großes Felsen musste viele Kilometer weit über
hügliges Gelände transportiert und dann so aufgerichtet werden,
dass sich ein perfekter Kreis von dreißig Metern Durchmesser ergab.
Verbunden waren die Sarsensteine mit insgesamt dreißig jeweils neun
Tonnen schweren Decksteinen. Jeder dieser Steine musste sechs Meter
hoch gehoben und dann auf die vertikalen
Blöcke gesetzt werden. Um eine sichere Verbindung zu
gewährleisten, meißelten die urzeitlichen Baumeister runde
Ausbuchtungen aus der Oberseite der Sarsensteine. Diese
>Dübel< passten in ausgehöhlte >Fassungen< an der
Unterseite der Decksteine, sodass die Blöcke wie riesige Legosteine
zusammengefügt werden konnten.
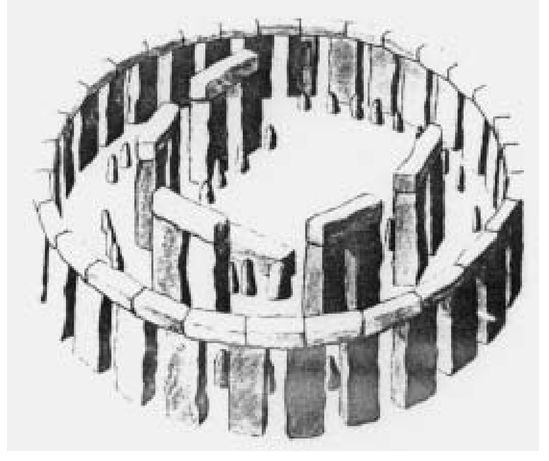
Sobald der monurnentale Steinkreis vollendet war,
errichteten die Erbauer fünf so genannte Trilithons. Sie bestehen
aus jeweils zwei aufrecht stehenden Sarsensteinen, die paarweise
mit einem Deckstein verbunden sind. Diese Blöcke - die größten der
Anlage - ragen knapp acht Meter über dem Boden auf, wobei sich ein
Drittel ihrer Masse unter der Erde befindet. Die fünf Trilithons
sind innerhalb des äußeren Steinkreises so gesetzt, dass sie ein
Hufeisen bilden. Genau gegenüber von dessen Öffnung steht der
Altarstein,
der nach der Sommersonnenwende ausgerichtet ist. Der mittlere und
größte Trilithon wiederum zeigt in Richtung der Wintersonnenwende.
Damit erinnert er an den einundzwanzigsten Dezember, den Tag der
düsteren Maya-Prophezeiung und ein Datum, das die meisten alten
Kulturen mit dem Tod assoziierten.
Wie ist es den steinzeitlichen Bewohnern des alten
England gelungen, vierzig Tonnen schwere Steinblöcke fast vierzig
Kilorneter weit über unwegsames, hügliges Gelände zu
transportieren? Wie schafften sie es, die neun Tonnen schweren
Decksteine sechs Meter hoch zu heben und sie dann perfekt an Ort
und Stelle abzusetzen? Und welche Missiott mag wohl so bedeutsam
gewesen sein, dass sich dieses prähistorische Volk dazu aufschwang,
ein so unglaubliches Werk zu schaffen?
Es gibt keine schriftlichen Belege, die uns dabei
helfen würden, die Erbauer von Stonehenge zu identifizieren, doch
heißt es in einer populären - wenn auch absurden - Sage, Merlin,
der Zauberer am Hof von König Artus, habe die Kultstätte gegründet.
Dieser bärtige Weise, heißt es, habe den Tempel als kosmisches
Observatorium und himmlischen Kalender entworfen. Abgesehen von
dieser - durchaus korrekten - Funktion diente die Stätte für
Zusammenkünfte und Rituale, bis sie um 1500 v. Chr. aus mysteriösen
Gründen verlassen wurde.
Während Pierre nach London zurückkehrte, blieben
Maria und ich in der Region, um die großen Hügelgräber zu
erforschen, die die Stätte umgeben. Wir hofften, auf die Überreste
länglicher Schädel zu stoßen, die eine Verbindung zu Mittel- und
Südamerika bedeutet hätten. Das größte Grab der Gegend ist ein
fünfunddreißig Meter langer Hügel, dessen Inneres ebenfalls aus
Sarsensteinen besteht. Hier liegen die sterblichen Überreste von
siebenundvierzig Menschen. Aus irgendeinem Grund hatte man die
Knochen anatomisch sortiert und auf verschiedene Kammern
verteilt.
Was wir fanden, war nicht so erstaunlich wie das,
was wir nicht fanden, denn mindestens ein Dutzend Schädel, die zu
den größten Skeletten gehörten, fehlten!
In den folgenden vier Monaten arbeiteten wir uns
von Grab zu Grab vor und stießen immer auf dasselbe Resultat.
Schließlich waren wir an der nach Meinung vieler Archäologen
heiligsten Stätte angelangt, einer Steinkonstruktion in einem
Grabhügel in Loughcrew, einer entlegenen Gegend in der Mitte
Irlands.
In die Wände dieses Grabs sind kunstvolle
Hieroglyphen eingraviert, deren Hauptmotiv eine Reihe
spiralförmiger konzentrischer Kreise ist. Ich weiß noch, wie ich
Marias Gesicht im Laternenlicht beobachtete, während sich ihre
dunklen Augen auf die bizarren Zeichen richteten. Mir stockte das
Herz, als ihre Miene sich plötzlich aufhellte. Sie zerrte mich aus
dem Grab ins Tageslicht, rannte zu unserem Auto und fing an, die
Schachteln mit den Hunderten von Fotos aufzureißen, die wir
gemeinsam in der Gluthitze der Wüste von Nazca gemacht
hatten.
»Schau nur, Julius, da ist es!«, rief sie und hielt
mir eine Schwarzweißaufnahme vors Gesicht.
Es war ein Foto der so genannten Nazca-Pyramide,
einer der älteren Wüstenzeichnungen, die wir für besonders
bedeutsam hielten. Zwischen den Schenkeln ihres Dreiecks befanden
sich zwei Motive: ein auf dem Rücken liegendes vierbeiniges Tier
und eine Spirale.
Die Spirale war identisch mit den Steinzeichnungen,
die wir soeben im Grab gefunden hatten.
Maria und ich waren ganz aufgewühlt von unserer
Entdeckung. Schon vor geraumer Zeit waren wir beide zu dem Schluss
gekommen, dass die Zeichnungen von Nazca eine uralte Botschaft für
den modernen Menschen darstellten, die sich auf die mögliche
Rettung vor dem vorhergesagten Weltuntergang bezog. Weshalb sonst
hätten die geheimnisvollen Künstler die Figuren so groß gezeichnet,
dass man sie nur von einem Flugzeug aus erkennen konnte?
Unser Enthusiasmus wurde von der nächsten logischen
Frage gedämpft: Welche Pyramide stellte die Zeichnung in Nazca
dar?
Maria glaubte felsenfest, es müsse sich um die
Große Pyramide von Giseh handeln, das größte steinerne Heiligtum
der Welt. Sie argumentierte, sowohl in Giseh wie auch in
Tiahuanaco, Sacsayhuaman und Stonehenge habe man megalithische
Steinblöcke verwendet, diese Stätten seien innerhalb derselben
Epoche entstanden jedenfalls unserer Meinung nach -, und der spitze
Winkel der Nazca-Pyramide erinnere an die steilen Seiten des
ägyptischen Bauwerks.
Ich war von diesen Schlüssen nicht so überzeugt,
hatte ich doch die Theorie entwickelt, viele der älteren
Zeichnungen in Nazca seien Wegweiser, die uns in die richtige
Richtung lenken sollten. Im Umkreis der Nazca-Pyramide befanden
sich mehrere Figuren, die man uns, wie ich meinte, hinterlassen
hatte, damit wir das mysteriöse Dreieck deuten konnten.
Das wichtigste dieser Symbole befindet sich
zwischen den Schenkeln der Pyramide selbst, direkt unterhalb der
Spirale. Es ist das Bild eines auf dem Rücken liegenden
vierbeinigen Tieres, das ich für einen Jaguar hielt, wohl das am
meisten verehrte Tier in ganz Mittelamerika.
Die zweite Figur ist die eines Affen. Dieses
gewaltige, mit einer einzigen durchgehenden Linie gezeichnete
Symbol weist einen Schwanz auf, der in einer Spirale endet. Sie
gleicht der Spirale innerhalb der Pyramide.
Die Maya verehrten den Affen und behandelten ihn
wie eine menschliche Spezies. Im Schöpfungsmythos des Popol Vuh heißt es, der vierte Zyklus der
Erdgeschichte habe mit einer zerstörerischen Sintflut geendet und
die wenigen überlebenden Menschen seien in Affen verwandelt worden.
Die Tatsache, dass es weder in Giseh noch im Süden Perus Affen
gibt, schien darauf hinzudeuten, dass die Pyramide, auf die die
Zeichnung in Nazca verwies, sich in Mittelamerika befinden
musste.
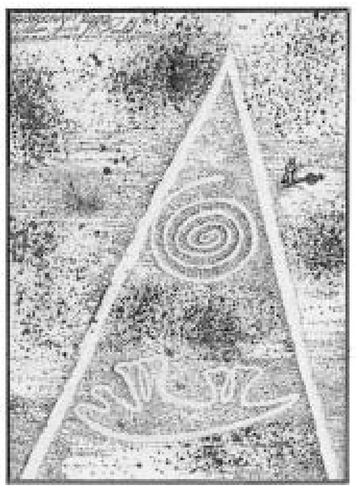

Auch Wale gehören nicht in diese Wüste, und doch
finden sich drei Darstellungen dieser majestätischen Tiere auf dem
Plateau von Nazca. Da ich vermutete, die geheimnisvollen Künstler
hätten die Walbilder dazu benutzt, um einen dreiseitigen Rahmen aus
Wasser anzudeuten, versuchte ich Maria davon zu überzeugen, dass es
sich bei der fraglichen Pyramide um einen der Maya-Tempel auf der
Halbinsel Yukatan handeln könnte.
Was Pierre Borgia betraf, so hatte er kein
Interesse an unseren Thesen. Den Geistern der Maya
hinterherzujagen, war Marias Verlobtem nicht mehr wichtig; es ging
ihm nur noch um Macht. Wie gesagt, ich hatte diese Entwicklung
schon eine Weile kommen sehen. Während Maria und ich mit der
Erforschung der Gräber beschäftigt waren, hatte Pierre sich
endgültig darauf vorbereitet, für den amerikanischen Senat zu
kandidieren. Zwei Tage nach unserer Entdeckung verkündete er mit
großer Geste, nun sei es an der Zeit, dass er und die zukünftige
Mrs. Borgia sich wichtigeren Dingen zuwendeten.
Mir brach das Herz.
Rasch wurde die Hochzeit in die Wege geleitet.
Pierre und Maria sollten in der St.-John’s-Kathedrale getraut
werden; ich war als Trauzeuge vorgesehen.
Was sollte ich tun? Ich war verzweifelt, da ich von
ganzem Herzen glaubte, Maria und ich seien verwandte Seelen. Pierre
behandelte sie wie sein Eigentum, nicht wie eine gleichberechtigte
Partnerin. Sie war seine Trophäe, seine Jackie Kennedy, eine
hübsche Frau an seinem Arm, die seine politischen Ambitionen mit
ihrem Liebreiz unterstützen konnte. Liebte er sie? Schon möglich,
denn welcher Mann hätte das nicht getan? Aber liebte sie ihn
wirklich auch?
Das musste ich herausbekommen.
Erst am Vorabend ihres Hochzeitstags brachte ich
den Mut auf, ihr meine Liebe zu gestehen. Ich sah in diese
wunderschönen Augen, deren Pupillen mich an schwarze, samtene
Seen denken ließen, und hatte das Gefühl, dass die Götter mir
lächelnd zunickten, als Maria meinen Kopf an ihre Brust zog und
schluchzte.
Sie hatte dieselben Gefühle für mich empfunden!
Maria gestand mir, sie habe inbrünstig darauf gewartet, dass ich
auf sie zukommen und sie vor einem Leben mit Pierre retten würde,
den sie schätzte, aber nicht liebte.
In diesem gesegneten Augenblick wurde ich zu ihrer
Rettung und sie zu meiner. Wie verzweifelte Liebende stahlen wir
uns in jener Nacht davon. Pierre hinterließen wir einen kurzen
Brief, in dem wir ihn um Verständnis für unser unentschuldbares
Handeln baten, da keiner von uns beiden die Kraft besaß, ihm offen
gegenüberzutreten.
Zwanzig Stunden später landeten wir in Ägypten -
als Mr. und Mrs. Julius Gabriel.
Auszug aus dem Tagebuch von Prof. Julius
Gabriel
Vgl. Katalog 1974-75, Seite 45-62
Fotojournal Diskette 2, Datei: NAZCA, Fotos 34 u. 35
Fotojoumal Diskette 3, Datei: STONEHENGE, Zeichnung 6
Fotojournal Diskette 2, Datei: NAZCA, Fotos 34 u. 35
Fotojoumal Diskette 3, Datei: STONEHENGE, Zeichnung 6