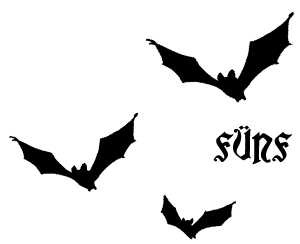»Das Greatwater-Anwesen?«, fragte ich, als ich aus dem Wagenfenster das früher einmal höchst imposante Gebäude betrachtete, das inzwischen jedoch stark heruntergekommen war. »Wow. Ich hatte eigentlich angenommen, dass ihr euch erst einmal etwas Kleineres vornehmen würdet.«
»Ich auch«, gab Stuart aufgeregt zu. »Aber der Preis stimmt, und der Profit, der sich möglicherweise machen lässt, ist enorm.«
Das Haus war in den zwanziger Jahren erbaut worden und hatte ursprünglich einmal einem berühmten Stummfilmproduzenten aus Hollywood gehört. Es war nur eines seiner zahlreichen Häuser gewesen. Schon damals floss in Hollywood das Geld in wahren Strömen.
Im Laufe der Jahrzehnte hatte das Haus mehrmals den Besitzer gewechselt und der Zahn der Zeit sichtbar an ihm genagt. Es war das einzige Gebäude auf dieser Seite der Straße, wobei es weit zurückgesetzt lag. Früher einmal hatte es sich hinter einer imposanten Steinmauer verborgen. Inzwischen jedoch war ein Großteil dieser Mauer eingestürzt, so dass man das heruntergekommene Haus und den überwucherten Garten von der Straße aus gut sehen konnte.
Ich blinzelte und stellte mir vor, wie unsere Ersparnisse von einem reißenden Strudel mitgerissen wurden. Theoretisch unterstützte ich Stuart natürlich hundertprozentig dabei, sich erneut im Immobiliengeschäft zu versuchen. Theoretisch. Praktisch jedoch war ich, was finanzielle Dinge betraf, ein ziemlicher Hasenfuß.
»Vermutlich gibt es viele Leute in Kalifornien, die gern ein solches Haus besitzen würden«, meinte ich. »Man glaubt wahrscheinlich, sich damit fast ein Stück Hollywood zu erwerben.«
»Genau das denken Bernie und ich uns auch. Möchtest du es dir ansehen?«
»Klar«, erwiderte ich. Wie hätte ich auch ablehnen können, wenn er mich derart begeistert anblickte?
Das Haus war aus der Nähe noch eindrucksvoller. Feine Steinmetzarbeiten und eine große Sorgfalt bei den Details waren überall zu erkennen, wie man das bei modernen Gebäuden so nicht mehr sah. »Ist es nicht fantastisch?«, begeisterte sich Stuart, als wir auf die majestätisch wirkende Eingangstür zuschritten. »Kannst du dir vorstellen, wie Timmy mit seinem Zug hier über die Schwelle fährt?«
Ich lachte. »Schmink dir das besser gleich wieder ab. Wenn du dieses Haus wirklich kaufen solltest, dann nur, um es wieder zu verkaufen.«
Insgeheim musste ich jedoch zugeben, dass es auch mir hier gefiel. Das Haus erinnerte mich an Europa, an meine Kindheit und Jugend. Ich konnte mir tatsächlich vorstellen, wie sich Timmys Spielzeuge vor dem Eingang stapelten und wie sich Allie mit ihren Freunden im Garten zwischen dem Hibiskus und den Strelitzien traf. Noch besser konnte ich mir vorstellen, wie meine Tochter und ich in einem Flügel des Hauses trainierten und wie sehr wir es alle genießen würden, auf einmal so viel Platz zu haben. Endlich einmal genügend Raum auf dem Speicher, um richtig Messerwerfen zu üben – welche Mutter würde sich das nicht für ihre Tochter wünschen?
»Seit wann steht es denn leer?«, erkundigte ich mich bei Stuart, während dieser eine PIN-Nummer in einen kleinen eingemauerten Tresor eingab, der sich daraufhin mit einem leisen Klicken öffnete.
»Seit sechs Monaten. Aber Emily Greatwater war seit Jahren krank, weshalb das Haus auch so verfallen wirkt.« Er holte den Schlüssel aus dem Schließfach und trat dann vor die Haustür. Als er den Knauf drehte, stellte er fest, dass die Tür bereits offen war. Die Angeln ächzten wie in einem alten Vincent-Price-Film.
Er sah mich an. »So viel zum Tresor.«
»Ja, sehr sicher wirkt das Ganze nicht.« Ich folgte ihm ins Innere. Wir fanden uns in einer großen Eingangshalle wieder, die durch riesige Fenstern mit Licht durchflutet wurde. Doch selbst die kalifornische Sonne konnte das unheimliche Gefühl nicht verscheuchen, das einen beim Anblick dieser Räumlichkeiten befiel. Schatten fielen über die Marmorböden, überall hingen Spinnweben.
Das Geländer der breiten Treppe, die nach oben führte, war jedoch völlig staubfrei, so als ob es ein Gespenst während seiner mitternächtlichen Eskapaden mit einem Staublappen sauber gewischt hätte. Überall standen Möbel herum. Obgleich die meisten mit weißen Tüchern abgedeckt waren, gab es noch ein paar imposante Stücke, die sich den Blicken darboten. Auch hier zeigten sich eindrucksvolle Handwerksarbeiten wie Intarsien, die zu dem großartigen Ambiente ausgezeichnet passten.
In einer Ecke lag ein Haufen Lumpen, der ebenso wie die unverschlossene Tür darauf schließen ließ, dass hier möglicherweise nicht nur Gespenster wohnten.
»Hier steckt viel Arbeit drin«, sagte ich zu Stuart und sah in Gedanken schon unsere Ersparnisse dahinschwinden. »Aber es könnte wirklich fantastisch aussehen.«
»Schau dich ruhig um«, meinte Stuart und zeigte auf einen Raum am anderen Ende der Eingangshalle. »Bernie zufolge soll es noch besser werden.«
Ich warf ihm einen fragenden Blick zu und tat, wie er mich geheißen hatte. Schon bald stand ich vor zwei breiten Verandatüren, durch die man auf eine Terrasse und in den Garten dahinter blicken konnte. Ich stieß sie auf und trat auf die großenteils gesprungenen Steinplatten hinaus. Die Terrasse reichte mindestens sechs Meter in den Garten hinein. Es war wahrhaftig imposant.
»Wow«, murmelte ich. »Wie ein weiteres Zimmer.« Stuart folgte mir zur Balustrade. Ich blickte mich um. Hier verstand man wieder einmal, weshalb Kalifornien so beliebt war. Üppiges Grün reichte bis zu dem herrlichen Sand des Strandes. Dahinter erstreckte sich über Kilometer hinweg das tiefe Blau des Pazifiks.
Das Haus stand auf einem der zahlreichen Hügel von San Diablo. Von hier schien es fast so, als ob das Gebirge im Hinterland versucht hätte, sich bis zur Küste hin auszustrecken, ihm aber im letzten Moment die Luft ausgegangen wäre. Von der Terrasse aus hatte man einen guten Blick auf einen weiteren Hügel, auf dem die schöne Kathedrale St. Mary stand – der Mittelpunkt unserer kleinen Stadt. Unterhalb des Hauses lag der Friedhof von San Diablo. Das alte Gebäude schien darüber zu wachen.
Ich entdeckte das Mausoleum der bekannten Familie Monroe. Für einen Moment stockte mir der Atem. Eric war direkt neben Alexander Monroe, unserem Stadtgründer, begraben worden. Die gesamte Familie Monroe war bei uns berühmt, angefangen mit dem Patriarchen Alexander bis hin zu dem ziemlich ausgeflippten Ur-Ur-Ur-usw.-Enkel Theophilus Monroe, der in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts an spiritistische Künste und Geisterbeschwörungen glaubte. Er ging nach Hollywood, wo er eine recht zweifelhafte Karriere als Manager unbedeutender Filmsternchen einschlug, die er um ihr weniges Geld brachte. Theophilus galt als schwarzes Schaf der Familie. Er hatte sein Bestes getan, um zu demonstrieren, dass er mit den frommen Idealen seiner Vorfahren nichts am Hut hatte.
Erst vor wenigen Monaten hatte das Monroe-Mausoleum bei meiner Wiedererweckung Davids eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.
»Großartig«, schwärmte ich, wandte mich vom Friedhof ab und hoffte, dass Stuart nicht aufgefallen war, wie mir bei der Erinnerung an diese Stunden ein kalter Schauder über den Rücken gelaufen war.
»Ich weiß. Wirklich großartig, nicht wahr? Es überrascht mich eigentlich, dass niemand behauptet, hier würde es spuken. Schau mal«, sagte er und zeigte auf eine Wendeltreppe, die von der Terrasse auf den Friedhof hinabführte. »Für romantische Spaziergänge im Mondschein.«
Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Vielleicht sollten wir heute Abend hierherkommen, statt ins Kino gehen. Was meinst du?«
»Kommt nicht infrage«, entgegnete er. »Ich habe für heute Abend genaue Pläne, und dazu brauche ich unbedingt ein dunkles Kino.«
»Ach, wirklich? Dann sollten wir uns besser beeilen. Ich habe heute nämlich noch ziemlich viel zu tun und möchte abends schließlich nicht abgelenkt sein.«
»Verstehe«, erwiderte er, als wir durch die Verandatüren wieder ins Innere des Hauses traten. »Also – was meinst du? Ist es eine verrückte Idee?«
Ich sah mich in dem riesigen Saal um, der früher einmal atemberaubend schön gewesen sein musste. Er besaß auch jetzt noch viel Potenzial, das sich allerdings unter einer dicken Schicht aus Schmutz und Staub verbarg, die man vermutlich in stundenlanger Arbeit erst einmal entfernen musste, ehe man mit den Restaurierungen begann.
»Ich weiß nicht, wie das alles zu schaffen sein könnte«, erwiderte ich ehrlich. »Deine Arbeit plus die Wahlkampagne plus die Kinder. Wenn du glaubst, dass du problemlos auch noch die Renovierung dieses Hauses managen kannst, will ich mich dir nicht in den Weg stellen. Aber ich befürchte, dass du dich vielleicht übernimmst.«
Ich wusste nun wirklich, was es bedeutete, wenn man sich zu viel vornahm. Aber das konnte ich Stuart natürlich nicht sagen.
»Das muss ich mir sicher genau überlegen«, gab er zu. »Aber ich habe mir bereits einiges durch den Kopf gehen lassen und darüber nachgedacht, wie ich alles unter Dach und Fach bringen kann.« Er nahm meine Hand und drückte sie zärtlich, wobei er mich verschmitzt angrinste. »Ich glaube, meine Idee ist gar nicht so schlecht.«
»Wirklich? Dann erzähl mal.«
Er lächelte geheimnisvoll. »Vielleicht heute Abend. Für schwierige Überlegungen brauche ich Popcorn.«
»Hm«, erwiderte ich. »Ich habe irgendwie den Eindruck, als ob du mir etwas verschweigst.«
»Verschweigen? Dir? Niemals«, entgegnete er mit einer solchen Inbrunst, dass sich sogleich wieder mein schlechtes Gewissen zu Wort meldete. Ich wäre bestimmt nicht in der Lage gewesen, eine solche Antwort zu geben.
»Falls es zu deinem Plan gehören sollte, dass ich die ganze Renovierungsarbeit übernehme, während du für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfst, dann kannst du das gleich vergessen.«
»Du würdest dir also nicht Zeit nehmen, Fliesen zu legen oder Trockenbauwände einzuziehen?«
»Für dich?«, erwiderte ich lächelnd. »Doch, natürlich. Jederzeit. Aber möglicherweise wärst du mit dem Ergebnis nicht allzu zufrieden. Denk nur an die Tapete in Allies Zimmer.« Ich hatte früher einmal die tolle Idee gehabt, Allies Zimmer selbst zu tapezieren. Lassen Sie mich es so sagen: Es hatte sich herausgestellt, dass die Idee doch nicht ganz so toll gewesen war.
»Wohl wahr«, sagte er.
Ich wollte ihm gerade noch mehr Fragen zu seiner Geheimniskrämerei stellen, als mein Handy klingelte. Hastig durchwühlte ich meine Handtasche, während mir das Herz vor Aufregung bis zum Halse schlug. Das tat es leider jedes Mal, wenn das Handy klingelte und sich meine Kinder nicht in Rufweite befanden.
Italien.
Ich dachte für einen Moment daran, nicht abzuheben, bis mir klar war, dass das ziemlich seltsam wirken würde. Also klappte ich das Telefon auf.
»Hi«, sagte ich fröhlich. »Ich bin froh, dass du anrufst. Ich habe die ganze Woche über mit den Ostervorbereitungen zu tun gehabt, aber es gibt noch einige Dinge, die ich wissen müsste.« War ich nicht perfekt im Schwindeln? Es verblüffte mich immer wieder selbst, wie geschickt ich in der hohen Kunst des Betrugs geworden war.
Am anderen Ende der Leitung hörte ich ein verwirrtes »Katherine?« Dann folgte hastig auf Italienisch: »Alles in Ordnung bei dir?«
»Natürlich ist das ein guter Zeitpunkt«, antwortete ich. »Wenn du einen Moment warten könntest…« Ich schenkte meinem Mann eines meiner besten Stress-Lächeln. »Es tut mir leid, Schatz, aber die Sache mit dem Komitee ist wirklich wesentlich komplizierter, als man annehmen könnte. Du möchtest dich doch sicher noch umsehen. Geh nur schon mal weiter, es wird nicht lange dauern.«
Zum Glück hatte ich Recht. Stuart wollte sich tatsächlich das Haus näher anschauen und folgte meinem Vorschlag, ohne zu murren. Er ging in die Küche, während ich die Marmortreppe in den ersten Stock hinaufstieg, um mich so weit wie möglich von ihm zu entfernen. Oben lief ich einen imposanten Gang entlang, bis ich in ein mit dunklem Holz verkleidetes Zimmer kam. Es war mit Möbeln bestückt, die wohl jedem Antiquitätenhändler den Atem geraubt hätten.
»Padre«, flüsterte ich. »Entschuldigen Sie bitte. Stuart stand direkt neben mir und…«
»Mach dir keine Sorgen, mein Kind«, erwiderte er und sprach nun auf Englisch weiter. »Ich habe inzwischen verstanden.«
»Was gibt es Neues? Wer hat es auf mich abgesehen?« Ich schloss die Tür hinter mir. Soweit ich Stuart kannte, war er wahrscheinlich gerade damit beschäftigt, sich auf Knien und Händen die Wasserleitungen genauer anzusehen. Trotzdem wollte ich es nicht riskieren, dass er mich suchte und aus Versehen hörte, worüber ich sprach. »Und was hat es mit diesem Schwert auf sich?«
»Ich befürchte, dass ich nichts Gutes zu berichten weiß, Katherine. Du hast viele Feinde – unter anderem diejenigen, denen du im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung gemacht und die du davon abgehalten hast, für immer unbesiegbar zu werden. Und ein solcher Dämon ist es auch, der sich an dir rächen will. Es handelt sich um den Zerstörer, der nach Vergeltung schreit.«
Mir lief ein kalter Schauder über den Rücken. Ich unterdrückte ein Stöhnen, als die Erinnerungen in mir aufstiegen… Meine Mitbewohnerin aus dem Waisenhaus… Cami. Die Katakomben… Das mysteriöse eiskalte Feuer.
Ich war damals fünfzehn Jahre alt gewesen, und meine Partnerschaft mit Eric hatte gerade erst begonnen. Wir waren mit fünf anderen Teams in eine Krypta geschickt worden, die tief unter der alten Stadt Rom lag.
Wir waren aus nur einem einzigen Grund hierhergekommen. Um einen der schrecklichsten Dämonen der Hölle, Abaddon, aufzuhalten. Er war nicht ohne Grund auch unter dem Namen ›der Zerstörer‹ bekannt.
An diesem Tag hatte er sich auf ein Ritual vorbereitet, das es ihm ermöglichen sollte, für immer in seiner wahren dämonischen Gestalt auf Erden zu wandeln – körperlich und beinahe unbesiegbar.
Diese Art von Gefahr bezeichnen wir in unserem Geschäftszweig als den größten anzunehmenden Unfall – ein wahrhaftiger GAU.
Dämonen zeigen sich auf Erden nicht oft in ihrer wahren Gestalt. Hollywoods Darstellung dieser Monster als zähnefletschende, schuppenüberzogene Tötungsmaschinen mit eitrig gelben Augen und Reißzähnen mochte der Industrie vielleicht viel Geld einbringen, entsprach aber nicht der Wahrheit. Ein solcher Dämon könnte sich niemals lange außerhalb der Hölle aufhalten.
Als Level-Zwei-Dämonenjäger bei der Forza Scura, einer geheimen Institution des Vatikans, hatten wir die Aufgabe, sicherzustellen, dass dieser Dämon den Status quo niemals verändern würde.
An diesem Tag traten wir als Sieger aus dem Kampf hervor. Aber wir bezahlten dafür einen hohen Preis.
»Katherine?«, fragte Padre Corletti sanft. Ich wusste, dass er mich und meine Gedanken wie immer wie ein Buch lesen konnte. »Bist du noch da?«
Ich blinzelte und zwang mich dazu, das Bild zu verdrängen, das vor meinem inneren Auge aufgestiegen war: wie der Dämon Camis Halsschlagader durchtrennt hatte und ihr Kopf nach vorn gesunken war. »Ja«, flüsterte ich heiser. »Ich bin noch da.«
»Es tut mir leid, dass ich solche Erinnerungen wieder wachrufen muss, aber…«
»Ich muss es wissen«, unterbrach ich ihn wie betäubt. »Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe.«
»In deinen Erinnerungen liegt eine große Kraft«, sagte Padre Corletti. »Selbst in den schmerzhaften. Ich möchte nicht, dass du…« Er brach abrupt ab, und ich hörte, wie das Telefon knirschte, als er es von einer Hand in die andere nahm. In der Ferne waren gedämpfte Stimmen zu hören. »Katherine«, sagte er auf einmal mit einer klaren und rauen Stimme. »Entschuldige bitte. Ich muss kurz weg, bin aber gleich wieder da.«
»Ja, natürlich. Gut, ich warte.« Ich holte tief Luft. Im Grunde wusste ich nicht, ob ich mit meinen Erinnerungen alleingelassen werden wollte. Doch da ich inzwischen nicht mehr sechs Jahre alt war, konnte ich Padre Corletti wohl kaum bitten, am Telefon zu bleiben. Die Zeit, da er mich ins Bett gebracht und mir versprochen hatte, auf mich aufzupassen, war schon lange vorbei.
In Wirklichkeit wusste ich natürlich, dass niemand auf mich aufpassen konnte. Im Grunde hatte ich das mein ganzes Leben lang gewusst. Doch diese simple Wahrheit hatte ich erst wirklich begriffen, als wir uns auf dieser Mission befunden hatten.
An jenem schrecklichen Tag verloren wir zehn Jäger. Eric und ich überlebten nur durch ein Wunder. Es waren keine Erinnerungen, an die ich gern dachte. Aber ich konnte mich nicht dagegen wehren. Auf einmal tauchte alles wieder vor mir auf, und ich taumelte in die Vergangenheit zurück. Zu jenem Tag des Terrors. Zu jenen Stunden, als wir uns absolut sicher waren, dass wir alle sterben müssten, dass es keinen Ausweg mehr gab.
Doch es hatte einen Ausweg gegeben. Wir beide hatten überlebt.
Bis heute wusste ich noch immer nicht, warum.
Unser Auftrag hatte recht typisch angefangen. Wir krochen durch dunkle, feuchte Katakomben und suchten nach einem Dämonenversteck. Wir hatten uns von unseren Kameraden getrennt. Jedes unserer sechs Teams nahm einen anderen Weg, um nach dem geheimen Eingang zu Abaddons geheimer Kammer zu suchen. Wir hatten wie immer alle unsere Waffen dabei und in diesem Fall noch etwas anderes. Jedes Team trug ein Stück des blutigen Steins von Golgatha mit sich. Die Reliquie war bereits vor vielen Jahrhunderten in sechs Teile zerbrochen und für diese Mission extra aus den Kellern des Vatikans geholt worden, wo der zerbrochene Stein in einer mit Samt ausgelegten Dose aus Ebenholz gelegen hatte.
Nach einer jahrhundertealten Legende besaß der blutige Stein die Macht, Abaddon in die dunkelste Hölle zurückzuschleudern und für alle Ewigkeit seine Absicht zu vereiteln, Gestalt anzunehmen, wenn man ihn nur zur rechten Zeit zusammensetzte. Dazu mussten wir nahe genug an den Dämon herankommen. Nachdem wir stundenlang bereits durch die Katakomben gekrochen waren, hatte ich das Gefühl, diese Chance niemals zu bekommen.
Wie viele Katakomben waren auch diese erbaut worden, um Tote aufzunehmen, als die Friedhöfe überquollen und die Gefahr von Seuchen bestand. Schädel, Oberschenkel- und Hüftknochen waren bis zu den Decken gestapelt. Es bot sich uns ein makaberer Anblick, der zu jener Zeit aber wohl recht normal und vor allem unter praktischen Gesichtspunkten akzeptabel gewesen war.
Eric und ich rannten einen Tunnel entlang, bis wir auf eine Wand stießen. Eine Horde Dämonen war uns auf den Fersen. Die Kreaturen folgten allerdings nicht uns, sondern wollten an Abaddons Ritual teilnehmen. Falls sie uns jedoch entdeckten, würde das Ergebnis auf dasselbe hinauslaufen, und wir würden zudem unseren Vorteil verlieren, sie zumindest mit unserem Auftauchen zu überraschen.
So suchten wir verzweifelt mit unseren Taschenlampen die Wand aus uralten Knochen ab, um einen Ausgang zu finden, denn umdrehen konnten wir auf keinen Fall. Die Dämonen kamen unaufhörlich näher. Ängstlich blickten wir uns um. Da entdeckten wir endlich einen Totenschädel, etwa eineinhalb Meter über dem Boden in die Wand eingelassen. Der Knochen hatte eine seltsam dunkle Farbe. Vermutlich hatten ihn die Zeit und der Ruß der Mönchsfackeln so schwarz werden lassen, denn in früheren Zeiten waren Klosterbrüder häufig unterirdisch ins Zentrum der Stadt geschlichen.
Auch jetzt konnte ich mich noch gut daran erinnern, wie aufmerksam ich damals die zahlreichen Kratzer und Furchen auf dem Schädel vor mir betrachtete. Auf einmal schienen sich die Linien wie bei einer optischen Illusion zu wandeln. Alle unnötigen Punkte und Striche verschwanden, und die übrig gebliebenen Konturen ergaben auf einmal ein mir vertrautes Muster aus ineinandergreifenden Kreisen, unter denen Wellenlinien auszumachen waren. Nun sah das Ganze wie das Symbol Abaddons aus.
Doch was sollten wir damit anfangen?
Hinter uns rückten die Dämonen immer näher. Wir konnten bereits das Licht ihrer Fackeln sehen, das im Tunnel flackerte und uns ebenso wie ihre Schritte ihr bevorstehendes Eintreffen verriet.
»Vielleicht funktioniert es wie ein Türknauf«, schlug ich vor. Ich richtete meinen Lichtstrahl auf ein verkrustetes Stück Metall, das aus der Nasenhöhle des Totenschädels hervorlugte. Neugierig trat ich näher. Ein rasiermesserscharfes Eisenstück war in den Knochen eingelassen worden und ragte etwa einen Zentimeter weit heraus. Die Verkrustung darauf war wohl…
»Opferblut«, sagte Eric, als er ein Stück der Kruste mit seiner Dolchspitze abgekratzt hatte.
Hinter uns wurde die Dämonenhorde immer lauter. Wir befanden uns in einer Sackgasse. Wir waren gefangen und konnten nur noch darauf warten, dass sich die Dämonen auf uns stürzten und sich ihren kleinen Jägerpreis holten. Wir mussten hier heraus, und soweit ich das in diesem Moment sagen konnte, lag der einzige Ausweg hinter der Wand.
»Versuchen wir es damit«, sagte ich und schlug mit meiner linken Handfläche fest gegen das scharfe Stück Metall. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das Brennen und Pochen meiner Hand ignorierte, weil ich nur daran interessiert war, ob sich die Wand öffnen würde oder nicht. Was ich genau erwartet hatte, weiß ich nicht, aber zumindest irgendeine Reaktion wäre erfreulich gewesen. Aber es geschah rein gar nichts.
»Es muss noch etwas anderes sein«, meinte Eric. »Vielleicht irgendeine Beschwörungsformel.«
»Ich könnte auch höflich bitten«, meinte ich spöttisch. »Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das funktionieren würde.«
Eric warf mir einen vernichtenden Blick zu. »Versuche mal, deine Hand gegen das Symbol zu drücken«, schlug er mir vor.
Ich sah ihn unsicher an und senkte dann rasch den Blick, damit er mein Zögern nicht bemerkte. Ich hatte schon viele Geschichten über Dämonenjäger in fast ausweglosen Situationen gehört und gelesen. Seit Menschengedenken hatte es immer wieder schreckliche Kämpfe mit Dämonen gegeben. Ich hatte zudem eine Seminararbeit über unsere blutigsten Kampftechniken geschrieben. All diese Schilderungen hatten mich jedoch nicht erschüttern können.
Doch ich zuckte jedes Mal erschrocken zusammen, wenn ich hören musste, dass die Seele eines Jägers Schaden erlitten hatte, oder wenn in einem Menschen auf einmal der Glaube an das Gute in der Welt verlorenging und sich in einem früheren Kämpfer gegen das Böse die Dunkelheit ausbreitete. Aus solchen Bildern bestanden meine schlimmsten Alpträume, die mich als junges Mädchen ziemlich regelmäßig aus dem Schlaf aufschrecken ließen.
Noch jetzt flößten mir diese Vorstellungen die größte Angst ein.
Obwohl ich wusste – und das tat ich wirklich –, dass kein Dämon in mich eindringen konnte, nur weil ich das Symbol jener Kreatur berührte, konnte ich doch ein angewidertes Schaudern nicht unterdrücken. Trotzdem tat ich, wie Eric mich geheißen hatte. Ich forderte das Schicksal sozusagen heraus und verdrängte für einen Moment meine Ängste. Tollkühn legte ich meine Hand auf Abaddons Zeichen.
Doch meine Überwindung war völlig umsonst gewesen. Es passierte wieder nichts. Nur die Dämonen rückten bedrohlich näher.
Wir drehten uns um, damit wir angreifen konnten. Auf einmal kam mir eine Idee. Warum versuchten wir es nicht auch noch mit Erics Blut? Schaden konnte es jedenfalls nicht. Als Eric seine Hand ebenso wie ich zuvor an dem kleinen Metallstück aufschnitt und damit den Schädel berührte, auf dem das Dämonenzeichen eingeritzt war, herrschte für einen Moment völlige Stille. Dann jedoch ertönte ein Ächzen, das so klang, als ob die Welt entzweibrechen würde.
Die Wand löste sich plötzlich in Nichts auf. Die Pforte zur Kammer der Rituale stand offen.
Doch leider geschah das nicht mehr schnell genug. Noch ehe wir eintreten und Abaddon aufhalten konnten, stürzten sich die herannahenden Dämonen auf uns. Es war ein schrecklicher Kampf. Wir standen etwa zwei Dutzend Monstern gegenüber, die uns nach dem Leben trachteten und es auch mehrmals beinahe schafften, uns auszulöschen. Bei dem Kampf verloren wir unser Stück des blutigen Steins. Es fiel in eine große Erdspalte, in dessen Tiefe nur wenige Augenblicke zuvor ein Dämon gestürzt war.
Obwohl wir unsere wichtigste Waffe verloren hatten, waren wir entschlossen, den Kampf nicht aufzugeben. Unser jugendlicher Übermut ließ uns weiterhin daran glauben, dass es einen Ausweg gab. Angst und Zorn verliehen uns Kräfte, und irgendwie gelang es uns, uns einen Weg durch die noch immer offen stehende Pforte zu bahnen. Im selben Moment, in dem wir über die Schwelle traten, waren wir die Dämonen los. Sie folgten uns nicht, sondern warteten vor der Kammer wie Hunde auf ein Zeichen ihres Herrn.
Sie warteten darauf, dass er sich auf uns stürzen und uns vernichten würde.