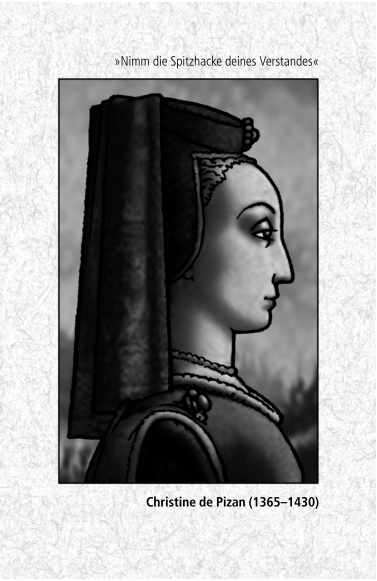
EIN KLEINES MÄDCHEN GEHT IN PARIS am Ufer der Seine spazieren. Es ist ein schöner Tag und man sieht einen der Paläste der königlichen Familie in der Sonne schimmern. Das Mädchen spielt mit den Steinen, die auf dem Weg liegen, und ist rundherum glücklich. Zu Hause warten die Mutter, die ihr alle Freiheiten lässt, und der Vater, ein angesehener Mann. Frieden herrscht im Land, die Untertanen des Königs gehen ihrer Arbeit nach und genießen am Abend die verdiente Ruhe.
Christine de Pizan wird 1365 in Venedig geboren. Ihr Vater, Tomaso Pizzano, arbeitet als Astrologe und Physikus. Seine Heimatstadt ist Bologna, wo er auch studiert hat. Ausgeübt hat er seinen Beruf zunächst in Venedig. Ein Physikus ist in der Sprache jener Zeit nichts weiter als ein Arzt: Er behandelt die physis, wie das griechische Wort für Körper lautet. Astrologe kann sich nur derjenige nennen, der sich präzise auskennt in den Bewegungen der Himmelskörper und über profunde Mathematik- und Geografiekenntnisse verfügt. Zu den von einem Astrologen zu beherrschenden Disziplinen gehört auch die Philosophie. Außerdem hat die Astrologie sich um eine Veredelung des Menschen zu kümmern, indem sie ihn die Schönheit des Himmels lieben lehrt. Die Wissenschaft und ihre Wirkung auf die Moral sind also nicht voneinander zu trennen. Heute ist das etwas anders, denn man betrachtet das wissenschaftliche Arbeiten im Allgemeinen als »zweckfrei«.
Über die Mutter von Christine de Pizan wissen wir nur, dass sie die Tochter eines Arztes war. Ihre Erziehung scheint ganz darauf ausgerichtet gewesen zu sein, einmal einen einflussreichen und wohlhabenden Mann zu heiraten, wie es im 14. Jahrhundert üblich war für Töchter aus »gutem Hause«.
Im Jahr 1368 wird Thomas de Pizan von König Karl V. von Frankreich an dessen Hof nach Paris geholt. Der König hat von den außergewöhnlichen Fähigkeiten dieses Mannes gehört und möchte ihn als Leibarzt und Hofastrologen in seiner direkten Nähe haben. Karl V. wird von seinen Untertanen »der Weise« genannt, weil er nicht nur gelehrt, sondern auch bedachtsam und mild ist und sich dadurch die Liebe und Achtung seines Volkes erobert hat. Von großer Berühmtheit ist auch seine Bibliothek, die mit über tausend Handschriften reich bestückt ist.
Der König empfängt den Physikus und seine Familie im Louvre, für die dreijährige Christine ein äußerst glanzvolles Erlebnis. Sie und ihre Mutter sind in prächtige, goldbestickte und edelsteinbesetzte Gewänder gehüllt. Bei Christine de Pizan hinterlässt Karl V. einen enormen Eindruck, sodass sich die Begegnung für immer in ihr Gedächtnis einprägt. Zeitlebens wird dieser Herrscher ihr als Vorbild für einen König gelten.
Der Familie geht es hervorragend in Paris. Die Bezahlung ist exzellent und zusätzlich wird der Physikus immer wieder einmal großzügig beschenkt, ihr Haus liegt am Ufer der Seine, unweit der Bastille. Hier verbringt Christine eine sorglose Kindheit mit ihren zwei jüngeren Brüdern, Aghinolfo und Paolo, die jedoch weit weniger wissensdurstig sind als ihre Schwester. Die wünscht sich nichts mehr, als ihrem Vater in dessen umfassender Bildung nachzueifern. Sehr früh schon regt sich bei Christine eine überdurchschnittliche intellektuelle Wachheit. Sie will lernen, und ihr Wissensdurst ist fast nicht zu befriedigen. Der Vater unterrichtet seine Tochter unter anderem in Philosophie und so hört Christine de Pizan sicher schon sehr früh etwas über Platon und dessen Lehre von den Ideen. Dieser antike Philosoph nimmt hinter der greifbaren Realität eine andere, ideale Welt an, die mit den Sinnen nicht zu fassen ist. Thomas’ Beschäftigung mit den Sternen weist ja auch darauf hin, dass er sich nicht zufriedengibt mit dem, was direkt vor den Augen liegt.
Was Christine de Pizan weit weniger gefällt als der Unterricht des Vaters, sind die Bemühungen der Mutter, sie mit Handarbeiten vertraut zu machen. Zu kostbar erscheint ihr die Zeit, zu viele interessante Dinge gibt es zu lernen, so vieles scheint unbegreiflich und fordert den Verstand heraus. Christine de Pizans Jugend ist ausgefüllt mit Studien, aber auch das direkte Erleben königlicher Prachtentfaltung kommt nicht zu kurz. Bei vielen Festlichkeiten und Empfängen von ausländischen Fürsten ist sie dabei, so auch, als Kaiser Karl IV. am 4. Januar 1378 den König besucht. Ein anderes prunkvolles Ereignis ist der Besuch des Sultans von Ägypten. Sehr bunt geht es bei allen derartigen Anlässen zu. Überhaupt sprechen die Farben eine ganz eigene Sprache, die jedermann in Frankreich versteht. So reitet der Herrscher normalerweise auf weißen Pferden, um seine Macht zu bekunden. Christine de Pizans kindliche Augen bekommen reichlich Nahrung. Sie genießt die herrlichen Feste und Empfänge und wird sie nie vergessen.
Bald aber trifft das Königshaus ein harter Schicksalsschlag: Die Königin stirbt im Februar 1378 bei der Geburt ihrer Tochter Katharina. Nicht lange danach geht das Gerücht um, der König solle vergiftet werden. Man macht die beiden des Anschlags verdächtigen Personen dingfest und schlägt ihnen den Kopf ab. Für uns heute wäre so ein grausames Vorgehen absolut undenkbar, aber zu jener Zeit war es allgemein üblich.
Das 14. Jahrhundert ist für Frankreich das Jahrhundert der Kriege. Ein großes Problem stellen immer wieder die Söldnertruppen dar, die man in Friedensphasen entlassen muss und die dann häufig vom Plündern und Stehlen leben. Um sie zu beschäftigen, hat Karl V. den bretonischen Ritter Bertrand du Guesclin als obersten Feldherrn eingesetzt, der jedoch schon zwei Jahre später stirbt: wieder ein schwerer Verlust für den König.
All dies bekommen Christine de Pizan und ihre Familie nur entfernt mit. Sie erleben die Regierungszeit Karls V. als eine wunderbare Zeitspanne. Für Christine ist es die ruhigste und harmonischste Phase ihres Lebens, an deren Ende noch ein bedeutendes Ereignis steht: Sie heiratet im Alter von erst 14 Jahren Etienne Castel, einen Edelmann aus der Pikardie. Er ist der Sohn eines Kammerdieners des Königs. Ein Jahr später wird er zum Notar und Sekretär des Königs ernannt. Der jedoch stirbt im September 1380. Die Gassen der Stadt sind erfüllt vom Wehklagen der Menschen: Der gute, weise, so geliebte König ist tot! Die Untertanen reagieren bestürzt, und von einem Tag auf den anderen fällt ein Schatten auch auf das Haus von Christines Familie. Das sorglose Dasein ist nun für immer zu Ende. Am Hof seines Nachfolgers, König Karls VI., wird am Können des Arztes und Astrologen gezweifelt, hat er doch das traurige Sterben seines Herrn nicht verhindern können. Der neue König denkt nicht daran, die Gunstbezeigungen seines Vorgängers fortzusetzen. Thomas de Pizan wird mit der neuen Situation nicht fertig, beginnt zu kränkeln und stirbt schließlich im Jahr 1385.
Für die junge Ehefrau kommt es jedoch noch schlimmer: 1389 wird ihr geliebter Mann Etienne von einer Seuche dahingerafft. Christine de Pizan muss nun mit 25 Jahren ihre drei Kinder alleine erziehen, und das in einer finanziell unsicheren Lage. Außerdem hat sie für ihre Mutter zu sorgen, die völlig mittellos dasteht.
Christine fällt in dieser prekären Lebenssituation das Bild der Frau Fortuna ein. In dieser Zeit ist es üblich, Allegorien zu verwenden, das heißt abstrakte Begriffe zu personifizieren, um das Leben besser verstehen zu können. Fortuna wird zumeist als Frau mit verbundenen Augen dargestellt, die ein Rad in Bewegung hält, das die Menschen zunächst ganz nach oben hebt, um sie dann unerbittlich fallen zu lassen. Diese Art, allgemeine Begriffe ins Bildhafte umzusetzen, ist uns heute fremd. Dadurch entsteht aber gerade eine große Anschaulichkeit. Frau Fortuna kann man vor sich sehen, das Schicksal hingegen bleibt unsichtbar.
Für die Menschen des 13. und 14. Jahrhunderts haben Begriffe noch etwas mit sinnlichem Begreifenkönnen zu tun. Das ist wichtig zu wissen, wenn man sich Christine als einer denkenden Person nähert, die verstehen will, was um sie herum in der Welt und mit ihr selbst geschieht. Christine bezieht in ihr Denken nicht nur sich, sondern auch die Gesellschaft, in der sie lebt, immer mit ein. Sie spürt am eigenen Leib, was es heißt, gesellschaftlich benachteiligt zu sein, und das Los ihres Vaters hat sie gelehrt, wie schnell einer aufsteigt und genauso schnell wieder hinabstürzt. Diese Grunderfahrung prägt ihr weiteres Leben und ihre Arbeit.
Christine de Pizan beginnt zu schreiben, zunächst Gedichte, die sich vor allem mit verlorener Liebe und dem Witwendasein beschäftigen:
Aber ach – wo finden jene Witwen Trost,
Die man um ihr Hab und Gut gebracht?
Denn in Frankreich, der einstigen Zuflucht
Der Vertriebenen und der Ratsuchenden,
Gewährt man ihnen heute keinen Beistand mehr.
Die Edelleute zeigen nicht das geringste Mitleid,
Und gleiches gilt für die Gelehrten jeglichen Ranges ...
Helft den Witwen, schenkt diesem Gedicht Glauben:
Ich sehe niemanden, der Mitgefühl mit ihnen hätte,
Und die Ohren der Fürsten sind taub für ihre Klagen.1
Dies ist kein Gedicht, das Christine nur für sich im stillen Kämmerchen geschrieben hat, um ihren Schmerz auszudrücken. Sie formuliert darin eine ganz klare Gesellschaftskritik. So wie die Welt ist, wie sie beispielsweise mit Witwen umgeht, so darf es nicht bleiben. Damit kann Christine nicht zufrieden sein. Gleichzeitig ist sie sich dessen bewusst, was es bedeutet, als Frau ihrer Zeit aufzumucken und revolutionären Geist zu zeigen. So geht sie lieber vorsichtig an die heiklen Themen heran, verhält sich äußerst geschickt und schreibt nicht nur kritische Texte, sondern auch reine Liebespoesie oder die im Mittelalter beliebten Hirtengedichte. Doch inmitten einer Sammlung anscheinend harmloser, unverfänglicher Liebesgedichte sehen sich die Leser dann plötzlich mit folgenden Versen konfrontiert:
Manche Leute könnten, was meine Person betrifft, auf falsche Gedanken kommen, weil ich Liebesgedichte schreibe.
Wer solche Vermutungen gehegt hat, möge diese schnellstens vergessen,
denn meine Interessen liegen in Wirklichkeit auf ganz anderen Gebieten.2
Christine de Pizan übt sich in den zeitgemäßen Themen und Formen. Auch Isabelle von Bayern beispielsweise, seit 1385 mit König Karl VI. verheiratet und 1389 gekrönt, hat eine Schäferei erworben. Schäferin und Schäfer gelten als Urbilder für das einfache Leben, das im Kontrast steht zu den Zeremonien am Hof. Die Dichterin findet Gefallen bei der Gesellschaft des Hofes, indem sie sich deren Geschmack scheinbar unterwirft. Man liest ihre Werke und sie kann, ohne völlig aus dem Rahmen zu fallen, wie beiläufig ihre kritischen Bemerkungen untermischen. So handelt eine kluge, diplomatische Frau. Sie fällt nicht mit der Tür ins Haus und verschreckt dadurch ihre Leserinnen und Leser. Wie oft mag sie still in sich hineinlächeln, wenn sie sich vorstellt, wie die Damen des Hofes verzückt ihre dem Zeitgeschmack »angepassten« Verse lesen. Christines Sprache ist realistisch und bilderreich. Sie lässt nichts aus, wenn es um die Beschreibung von Ritterturnieren oder rauschenden Festen geht. Mit ihren für die sinnliche Schönheit wachen Augen nimmt sie die Welt mit allem, was dazugehört, wahr. Sie gibt sich gern dem Genuss der Farben und Töne hin. Dahinter aber lauert ihr ebenso wacher intellektueller Blick, und das sieht jenseits von Glanz und Seide das Leid vieler Frauen, die ausgeschlossen sind vom gesellschaftlichen Leben, weil man sie nicht ernst nimmt, weil sie ohne Ehemann ein freudloses Dasein fristen, mittel- und schutzlos.
Christine ist voll und ganz eine Frau ihrer Zeit und gleichzeitig eine unerbittliche Kritikerin der Nachteile, die es vor allem für eine Frau mit sich bringt, in ebendieser Zeit zu leben. Ihr Denken bleibt eingebunden ins mittelalterliche Weltbild und versucht gleichzeitig, den Blick für Ungerechtigkeiten zu schärfen, das Prinzip Gerechtigkeit stärker ins Blickfeld zu heben. Hier erkennt sie einen erheblichen Mangel. Sie verwendet die Themen, die Denkformen und die stilistischen Mittel des 14. Jahrhunderts, um Aufschluss zu geben über gesellschaftliche Missstände. Damit erreicht sie wenigstens innerhalb ihrer eigenen Schicht ein breites Publikum, einfache Frauen aber sind ausgeschlossen von der Lektüre, da sie nicht lesen und schreiben können.
Der Erfolg tut Christine de Pizan gut, persönlich und finanziell, weil sie seit dem Tod ihres Mannes in Geldnöten steckt und deshalb in Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist. Der Rechnungshof schuldet ihrem Mann noch Lohn, der erst nach einundzwanzig Jahren ausbezahlt werden wird. Sie lebt zurückgezogen und füllt die einsamen Stunden damit, ihr Wissen zu vertiefen. »Ganz wie ein Mann, der gefährliche Wege gegangen ist und sich umwendet, seine Fußspur betrachtet ... so schlage ich, die Welt betrachtend, die voller gefährlicher Fallstricke ist und in der es nur einen Weg gibt, nämlich den der Wahrheit, schlage ich den Pfad ein, zu dem mein Wesen neigt, nämlich den des Studiums ...«3
Christine interessiert sich für Geschichte und Astronomie, für Philosophie und Dichtung. In der Bibliothek Karls V., die sie benutzen darf, findet sie alles, was ihr wissensdurstiges Herz begehrt. Aber es tut sich noch mehr in ihrem Geist: Hier herrscht eine wahre Aufbruchstimmung. Sie spürt in sich den Ansporn, weitere eigene philosophische und literarische Werke zu schaffen. Außerdem beschäftigt sie sich eingehend mit der Zeitgeschichte und den politischen Ereignissen. Ein Rückzug ins reine Denken läge ihr nicht, denn in ihrem Wesen verbinden sich beide Tendenzen: die Wachheit für das politische und gesellschaftliche Geschehen und der Wunsch, sich völlig dem Studium und der produktiven Denkarbeit zu widmen.
Das Jahr 1395 scheint eine entscheidende Wendung im Verhältnis zwischen England und Frankreich zu bringen, die schon lange zerstritten sind: König Richard II. von England gibt am 8. Juli seine Verlobung mit der erst fünf Jahre alten Isabella von Frankreich bekannt. Ganz sicher weiß man es nicht, aber die Quellen sprechen dafür, dass Christine als Hofdame Isabellas nach Ardres reist, wo der König und die zukünftige Königin von England einander vorgestellt werden sollen. Bei dieser Gelegenheit macht der Graf von Salisbury Christine das Angebot, ihren ältesten Sohn, Jean Castel, nach England zu schicken. Dort könnte er zum Ritter erzogen werden. Christine ist entzückt von dieser Idee. Sie willigt ein und stellt dadurch erneut ihre Kunst der Diplomatie unter Beweis: Ihr Bekanntheitsgrad wächst durch diese Angelegenheit und die Gedichte werden ins Englische übersetzt.
Das Schicksalsrad wird mächtig nach oben gedreht, bis Fortuna es sich doch wieder anders überlegt: Der König von England wird nämlich 1399 gewaltsam abgesetzt und in den Kerker geworfen, während man den Herzog von Lancaster zum neuen König macht. Raue Sitten sind das, und Christine hat diesen neuen Rückschlag zu verschmerzen. Zum einen ist sie zutiefst betrübt, weil Richard in ihren Augen ein untadeliger, den Frieden im Land unterstützender Mann war, der noch dazu die Schriftstellerei förderte. Zum anderen macht sich Christine Sorgen um ihren noch immer in England weilenden Sohn. Als sie offiziell eingeladen wird, ihre »Karriere« in England fortzusetzen, also Frankreich zu verlassen, ist sie empört ob dieser Dreistigkeit. Sie setzt alles daran, dass Jean Castel zurückkommt, und tatsächlich kann sie ihn bald in die Arme schließen.
Ständig wird Christine herausgerissen aus der intellektuellen Arbeit. Man muss sich ja immer vor Augen halten, wie sehr sie die Zurückgezogenheit liebt, gern allein ist mit ihren Gedanken und sich nichts sehnlicher wünscht, als genug Zeit zu haben, um in Frieden nachdenken und schreiben zu können. Anders als ihre Tochter, die den Hang zum kontemplativen Leben geerbt und das Kloster von Saint-Louis in Poissy als Lebensraum gewählt hat, muss Christine de Pizan sich tagtäglich mit jeder nur möglichen Unbill auseinandersetzen. Nie kommt sie zur Ruhe und kann sich angemessen dem widmen, was ihr so wichtig ist. Dass Christine auch in ihrem Denken und Dichten die Welt draußen nicht wird ausklammern können, ist klar. Auf Schritt und Tritt stößt sie auf Probleme des Alltags und wird konfrontiert mit der aktuellen Politik und Zeitgeschichte. Sie lebt nicht in einem gläsernen Käfig, sondern mitten im Geschehen. Ihr Philosophieren geht aus von der Beobachtung der Welt und ist von vornherein auf das »rechte Handeln« bezogen und nie bloße Theorie. In der intensiven Auseinandersetzung mit der politischen und vor allem der gesellschaftlichen Wirklichkeit entwirft sie ihre Gedanken, die um ethische Probleme kreisen und auf das Tun der Menschen bezogen sind. Um alle diese Fragen gedanklich bewältigen zu können, bräuchte man mehr Muße und die Möglichkeit zum Alleinsein.
Einschneidend für Pizans geistige Entwicklung ist die Kontroverse um den zu dieser Zeit als Bestseller gehandelten Rosenroman. Der erste Teil dieser Versdichtung ist bereits um 1245 erschienen, und zwar ganz im Stil der mittelalterlichen Liebeslyrik, die von einem hohen Frauenideal geprägt war. Es geht in diesem Roman um die Schilderung eines Traums: Der Dichter Guillaume de Lorris träumt von einer Rose, die eine wilde Sehnsucht in ihm entfacht. Es ist für ihn nahezu unmöglich, zum Gegenstand seines Verlangens vorzudringen; zuerst sind Gefahren, Eifersucht und üble Nachrede zu überwinden. Diese treten als Personen auf, wie wir es auch von Frau Fortuna kennen. Plötzlich jedoch verstummt die Stimme des Dichters: Er ist über seiner Arbeit gestorben.
Das Gedicht bleibt unvollendet, bis Ende des 13. Jahrhunderts ein gewisser Jean de Meung, Professor an der Pariser Universität, auf die unselige Idee kommt, daran weiterzuschreiben. Guillaume de Lorris wäre noch einmal tot umgefallen, hätte er dieses üble Machwerk zu Gesicht bekommen. Offenbar haben sich die Zeiten gewaltig geändert, und mit ihnen das Frauenbild, das nicht negativer sein könnte. Jean de Meung schildert die Frau als Wesen ohne Intellekt, als phantasie- und gefühllos, unmoralisch und der Verachtung würdig. Es ist seiner Meinung nach die Aufgabe der Frau, sich dem Mann zu unterwerfen und der Befriedigung seiner Lust zu dienen. Die Liebe sei ein Trugbild und existiere in Wirklichkeit überhaupt nicht, schreibt der Autor. Kein Funken Hochachtung dem weiblichen Geschlecht gegenüber ist übrig geblieben.
Eine Rolle bei dieser Entwicklung spielt auch der Zuwachs an Macht, den die Universität und damit die Professoren zu verzeichnen haben. Frauen dürfen keine Vorlesungen besuchen, sind von jeder akademischen Bildung ausgeschlossen. In ihrer frauenfeindlichen Haltung verbinden sich die Professoren mit den Geistlichen. Die Päpste des 14. Jahrhunderts sind Franzosen und alle an der Pariser Universität ausgebildet worden, was den Stolz des Professorenstandes noch mehr anstachelt. Interessanterweise ist im Rosenroman zu lesen, dass es die Universität sei, die das Tor zum Christentum öffne. In der Frage nach dem guten Leben, in der Ethik also als einer philosophischen Disziplin, spielt die Religion schon immer eine entscheidende Rolle. Dass nun auch die Wissenschaft miteinbezogen werden soll, hat bereits Thomas von Aquin (um 1225 – 1274) gefordert. Er hat versucht, Gott mit der Methode logischer Schlussfolgerungen zu beweisen. Es reicht für ihn nicht mehr aus, einfach zu glauben, sondern er will den Glauben mit dem Wissen verbinden. Damit nähern sich Kirche und Universität an.
Im Bereich solch tiefsinniger Gedanken und Diskussionen haben die Frauen keinen Platz. Sie dürfen nicht mitreden, worüber sich Christine entrüstet zeigt. Sie hat es allerdings schwer mit ihrer Kritik, zumal König Karl VI. mittlerweile Anfälle von geistiger Umnachtung zeigt. Wenn Unruhe und allgemeine Orientierungslosigkeit herrschen, bleibt keine Kraft und Zeit, sich auch noch mit den Fragen zu beschäftigen, die eine Frau aufwirft. Auf niemanden mehr können die Frauen zählen. Christine jedoch setzt sich an ihr Schreibpult und bringt zu Papier, was sie über Männer wie Jean de Meung denkt: »Dichtwerke verfassen sie, Reimsprüche, Prosa, Verse; / Verunglimpfen weibliches Verhalten auf unterschiedliche Weise.«4
Sie ist der Meinung, dass Frauen ganz andere Bücher schreiben würden als Männer, dass sie friedfertiger sind und den Krieg verurteilen. In ihren Schriften beklagt sie, dass es keine echten Werte mehr gibt. Keiner kümmert sich noch um so etwas wie eine Grundlegung ethischen Verhaltens. Auch wenn die Wissenschaft Fortschritte erzielt und es nicht an klugen Köpfen mangelt, fehlt doch die Neigung, die Klugheit zur Lösung ethischer Probleme einzusetzen. Intelligenz schützt eben nicht vor Unmoral und ermöglicht sogar eine derartige Verzerrung des Frauenbildes, wie Christine sie erlebt.
Jede Zeit ist auch daran zu messen, wie sie mit den sozial Schwachen umgeht. Christines Zeitgenossen neigen weit eher zu Verhöhnung und Missachtung denn zu Einsicht und Mitmenschlichkeit. Die Ritterlichkeit, die den Umgang des Mittelalters, zumindest in den idealen Entwürfen der Dichtung, mit den Frauen und den gesellschaftlich Schlechtgestellten weitgehend geprägt hatte, existiert nicht mehr. Wertvorstellungen aus dem kriegerischen Bereich sind gefragt. Wer stark genug ist zu kämpfen, überlebt, wer schwach ist, unterliegt. Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau wird mit Begriffen aus dem Kriegsvokabular gedeutet. Der Frau gebührt eher die Opferrolle, während der Mann Machtfunktionen ausübt.
Christine kann natürlich eine solche Ansicht nicht gutheißen und protestiert offen, indem sie Briefe an die Geistesgrößen der Universität schreibt und damit einen Streit unter den Professoren entfacht, den die frauenfeindlichen Hardliner gewinnen. Die Hochschullehrer haben die Position inne, die einst den Rittern zukam: Sie entscheiden, welche Prinzipien gelten. Gedankenfreiheit besteht nicht. Diejenigen, denen der Zugang zur Universität verwehrt wird, sind ausgegrenzt, unterlegen, schwach.
Eine positive Seite hat der Streit jedoch: Christine wird noch berühmter. Selbst die Königin hat Werke von ihr in der Bibliothek stehen, bewundert diese Frau und macht ihr sogar Geschenke. Christine hat eine weitere Einnahmequelle entdeckt: Sie lässt alle ihre Handschriften binden und von Handschriftenmalerinnen mit schönen Miniaturen versehen. Die verkauft sie dann an Adelige, denen es besonders gefällt, wenn sie sich auf einer der Miniaturen wiedererkennen.
Christines Sohn ist inzwischen in die Dienste des Herzogs von Burgund getreten. 1404 erhält Christine von Herzog Philipp dem Kühnen den Auftrag, ein Buch über die Herrschaft Karls V. zu schreiben, und er stellt ihr hierfür seine gesamte Bibliothek zur Verfügung. Das Werk soll einer alten Tradition zufolge dem Volk zur Belehrung dienen. Diese Aufgabe bedeutet auch deshalb viel für die schriftstellerische und denkerische Entwicklung Christines, weil sie zum ersten Mal gezwungen ist, Prosa zu schreiben. Bisher hat sie alle Werke in Versform verfasst.
Obwohl Philipp noch im selben Jahr stirbt, arbeitet Christine unbeirrt weiter. Nichts kann sie aufhalten, diese für sie so bedeutsame Arbeit zu vollenden. Karl V. dient ihr als Beispiel für einen Menschen, in dem sich Intelligenz, Wissen und Güte verbunden haben zum Wohle eines Volkes. Ihr Buch wird später als bedeutendes geschichtliches Dokument gelten.
Es ist, als wäre Christine erst jetzt wirklich auf der Höhe ihrer Fähigkeiten angelangt. »Ich habe damit begonnen, anmutige Gebilde zu ersinnen, und diese waren in meinen Anfängen ohne allzu viel Tiefgang. Dann aber erging es mir wie dem Handwerker, der mit der Zeit immer kompliziertere Dinge herstellt: In ähnlicher Weise bemächtigte sich mein Verstand immer außergewöhnlicherer Gegenstände; mein Stil wurde eleganter, meine Themen gewichtiger.«5 Und wirklich beginnt sie etwa zur gleichen Zeit mit dem Entwurf des Buchs, das sie als Philosophin über die Grenzen des Landes und weit über die eigene Zeit hinaus bekannt machen sollte: Le Livre de la Cité des Dames (Das Buch von der Stadt der Frauen). Es scheint, als sei alles Bisherige Vorbereitung gewesen, Einübung in Denken und Schreiben.
Christine beginnt bezeichnenderweise ihre Erörterung mit einer ganz alltäglichen Situation. Sie beschreibt, wie sie sich der Lektüre schwieriger Bücher hingibt und dabei ermüdet. Sie hofft, sich ein wenig entspannen zu können mit einem leicht zu lesenden Buch, von dem sie schon oft gehört hat, das sie jedoch selbst noch nicht kennt. Es handelt sich um die 1300 entstandenen Lamentationes Matheoli des Klerikers Matheus aus Boulogne-sur-mer. Christine liest die französische Übersetzung des in Latein geschriebenen Werkes, der die Lamentationes ihre große Verbreitung verdanken. »Ich fing also an, darin zu lesen, und kam auch ein Stück voran. Da mir aber sein Inhalt für all jene, die an Verleumdung wenig Gefallen finden, nicht sonderlich erheiternd schien, da ich in ihm keinerlei Nutzen für den Entwurf eines ethischen oder moralischen Systems erblicken konnte und es außerdem anstößige Ausdrücke und Themen enthielt, blätterte ich nur ein wenig darin herum und legte es, mit einem Blick auf den Schluss, beiseite, um mich anspruchsvolleren und nützlicheren Studien zuzuwenden.«6
Was aber ist denn so Anstößiges in dem Werk zu finden? Klagen über Klagen sind es und sie betreffen nichts anderes als die unsägliche Schlechtigkeit der Frauen. Christine stürzt nach dieser Lektüre in eine tiefe Unsicherheit. Wieder einmal schreibt ein gelehrter Mann Niederträchtiges über ihr Geschlecht, wieder werden die Frauen an den Pranger gestellt. Selbstzweifel bestürmen sie. Eine Zeit lang glaubt sie sogar, es wäre besser, ein Mann zu sein, wenn denn die Frauen so wenige echte Fähigkeiten besitzen. So sitzt sie oft grübelnd und niedergeschlagen an ihrem Schreibtisch. »Während ich mich mit so traurigen Gedanken herumquälte, ich den Kopf gesenkt hielt wie eine, die sich schämt, mir die Tränen in den Augen standen und ich den Kopf in meiner Hand barg, den Arm auf die Stuhllehne gestützt, sah ich plötzlich einen Lichtstrahl auf meinen Schoß fallen, als wenn die Sonne schiene. ... Ich hob den Kopf, um die Lichtquelle zu suchen, und erblickte drei gekrönte Frauen von sehr edlem Aussehen, die leibhaftig vor mir standen.«7
In ihrer bilderreichen, sinnlichen Sprache schildert Christine, wie es zu einer Wendung in ihrem Leben kommt. Hautnah können ihre LeserInnen miterleben, dass in der größten Not, in einem Moment düsterer Grübeleien, etwas eintritt, das Licht ins Dunkel bringt und die Schreibende von ihrer Trübsal erlöst. Denn grüblerisches Nachdenken befreit den Kopf ja gerade nicht, sondern stürzt einen nur immer tiefer in einen Kreislauf, der zu keinem Ende führt. Für Christine kommt die Befreiung von diesem deprimierenden Zustand blitzartig.
Wie sich herausstellt, verkörpern diese drei Frauen drei Tugenden: Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Indem Christine sie als allegorische Figuren einführt, will sie zeigen, dass die Tugenden als solche in ihrer wahren Gestalt zu ihr kamen, dass sie keine Hirngespinste sind, sondern fassbare Gestalten. Wir heutigen LeserInnen würden sagen, diese Frauen sind Bilder für den inneren Monolog, den Christine führt. Um sich verständlich zu machen, lässt sie ihre Gedanken erscheinen, setzt sie diese aus sich heraus und gibt ihnen Körper und Gesicht, Sprache und Gesten, Farbe und Licht. Die Plötzlichkeit ihrer Einsicht überwältigt sie. Sie macht sich zwar selbstständig ans Denken, aber die Wahrheit, zu der sie gelangt, ergibt sich unvermittelt. Weil Christine eine gläubige Person ist, sind in ihrer Vorstellungskraft die Ideen, die ihr aufgehen, Eingebungen Gottes. Gott selbst hat diese drei Damen zu ihr geschickt.
Die drei edlen Frauen beginnen nun ein Gespräch mit Christine. Die »Frau Vernunft« ist die Erste, und sie stellt vorab klar, dass es bei der Frage um die höchsten Dinge des Lebens die größten Probleme und die unterschiedlichsten Meinungen gibt. Man schaue sich die berühmten Philosophen einmal an. Einer korrigiert den anderen; manchmal meinen sie auch das Gegenteil von dem, was sie niederschreiben. Man kann sich als selbstständiger Mensch nicht einfach ihren Gedanken anvertrauen: »Teure Freundin, deshalb sage ich dir zu guter Letzt, dass allein die Einfalt die Ursache deiner gegenwärtigen Auffassung ist. Darum werde wieder du selbst, bediene dich deines Verstandes und kümmere dich nicht weiter um solche Torheiten!«8
Da meint man doch tatsächlich, vier Jahrhunderte später in der Aufklärung und bei Immanuel Kant gelandet zu sein. Was Christine Einfalt nennt, heißt in der Aufklärung »selbstverschuldete Unmündigkeit«, meint aber das Gleiche. Man muss sich seines eigenen Verstandes bedienen, um zur Wahrheit zu kommen. Man darf sich nicht verlassen auf das, was andere sagen oder gesagt und geschrieben haben. Demut und Bescheidenheit in Ehren, aber wenn es um die Wahrheit geht, dann muss jeder selbst nachdenken. Niemand kann einem die Wahrheitsfindung abnehmen. Der Glaube an Gott reicht nicht aus, um die großen Rätsel der Welt zu verstehen. Dem Glauben überhaupt wird aber nicht abgeschworen, lediglich an seiner Allmacht gerüttelt und dem Verstand zu seinem Recht verholfen.
Frau Vernunft erklärt, dass sie und ihre Freundinnen zu Christine gekommen seien, weil diese so kontinuierlich über die großen Fragen des Lebens nachgedacht und die Einsamkeit dem Getriebe vorgezogen habe. Chrsitines Beharrlichkeit hat sich also gelohnt. Damit ist für sie aber nun auch eine Aufgabe verbunden. Sie soll die »Stadt der Frauen« erbauen – mithilfe der drei edlen Damen. Ausschließlich »edle«, das heißt charakterstarke und unabhängige, Frauen sollen die Stadt bewohnen, damit sie vor den Anfeindungen der Männerwelt geschützt sind. Frau Vernunft wird ihr helfen, die Grundlagen zu schaffen: »Nach unser dreier Ratschluss bin ich damit beauftragt, den Anfang zu machen und dich mit haltbarem, unverfälschtem Mörtel zu versehen, damit ein solider Grund gelegt wird; dann um sie herum starke Mauern zu ziehen, hoch, breit, bestückt mit starken Türmen und wehrhaften Kastellen mit Gräben, richtigen Bollwerken, mit eben allem, was zu einer stark und dauerhaft befestigten Stadt gehört.«9
Wichtig ist vor allem der Grund, ohne den nichts gebaut werden kann, das Bestand haben soll. Frau Vernunft spricht die logische Denkfähigkeit an, die sachlich vorgeht. Der solide Grund und die festen Mauern stehen für die harte Arbeit der Erkenntnis. Bevor die Menschen handeln, müssen sie sich zuerst klar werden über die Basis ihres Handelns. Sie müssen versuchen, zu erkennen, was das Wesentliche des Lebens ausmacht, worauf wir unser Dasein bauen wollen. Bei Christine hat Frau Vernunft nicht wie üblich ein Zepter in der Hand, sondern einen Spiegel. Sie herrscht nicht, sondern weist den Menschen darauf hin, dass er in der Reflexion einen Blick in das eigene Innere werfen muss, um seine Pläne zu prüfen und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Vernunft bestimmt die theoretische Seite der Philosophie. Christine erlebt ihre Welt als eine aus den Fugen geratene. Diese Gesellschaft muss von Grund auf erneuert werden, man kann nicht nur hier und da ausbessern. Das wäre nichts als Flickwerk. Deshalb tritt Frau Vernunft als Erste auf.
Die zweite Dame ist die »Frau Rechtschaffenheit«. Sie versteht sich als Botin des Himmels. Sie hilft den Menschen dabei, das Gute zu bewirken, Gerechtigkeit walten zu lassen, den Armen zu helfen. Die Rechtschaffenheit hat eher mit dem Alltagsleben zu tun als die Vernunft und ist zuständig für ein geregeltes Miteinander unter den Menschen. Sie hält ein Lot in der Hand, damit Bewertungsmaßstäbe gefunden werden können, denn es ist nicht immer einfach, das Gute vom Schlechten zu trennen. »Dieses funkelnde Lot, das du mich anstelle eines Zepters in der rechten Hand halten siehst, ist die gerechte Regel, die Recht vom Unrecht trennt und den Unterschied zwischen Gut und Böse anzeigt: Wer ihr folgt, geht nie fehl.«10
Die Rechtschaffenheit hilft den Menschen, die Geheimnisse Gottes zu deuten. Sie ist die Vermittlerin zwischen Gott und den Menschen. Auch hier zeigt sich die tiefe Religiosität Christines. Nie würde sie an der Allmacht und Güte Gottes zweifeln. Von ihm hat der Mensch das Maß für ein gutes Leben zu nehmen. Aber das Wissen darum fliegt ihm nicht zu. Er muss kämpfen dafür, das Denken einsetzen, der Glaube allein reicht nicht. Es gehört eine Willensanstrengung dazu, will man das Gute in der Welt verwirklichen.
Als dritte Tugend schließlich stellt sich die »Frau Gerechtigkeit« vor. Sie hat insofern eine Sonderstellung, als sich die zwei anderen Tugenden auf sie beziehen. Die Gerechtigkeit gilt für jeden, niemand sollte sich ihr verschließen. »Ich lehre jeden vernunftbegabten Mann und jede vernunftbegabte Frau, der oder die mir Glauben schenken will, zunächst sich selbst zu bessern, zu erkennen und sich wieder in die Gewalt zu bekommen, dem Mitmenschen das zuzufügen, was man selbst erfahren möchte, alles gerecht aufzuteilen, die Wahrheit zu sagen, die Lüge zu meiden und zu hassen und alles Lasterhafte von sich zu weisen.«11
Die Aufgabe der Gerechtigkeit ist es vor allem, die Stadt, die es zu bauen gilt, mit würdigen Frauen zu bevölkern. Außerdem wird sie beim Errichten von Befestigungen und starken Toren helfen und Christine den Schlüssel aushändigen. Die Gerechtigkeit stellt den direkten Bezug zu Gott her und ist himmlischen Ursprungs. Ist sie einmal erkannt, so herrscht sie unwandelbar und absolut. Auch sie ist nicht einfach gefühlsmäßig zu erfassen.
Die drei Frauen erscheinen Christine ungetrennt wie eine einzige Person. In der Tat gehören sie zusammen und befruchten einander gegenseitig. Keine kann ohne die andere sein, und nur gemeinsam werden sie den Plan von der »Stadt der Frauen« verwirklichen können. Die Vernunft legt den Grund im Blick auf Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit, die wiederum die Vernunft als den Boden, auf dem sie stehen, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wenn Christines Vater noch hätte erleben können, mit was für einem ausgeklügelten und spannenden Werk seine Tochter die Philosophiegeschichte bereichert! Er hätte Freude daran gehabt und wäre stolz auf seine Tochter gewesen. Ob ihre Mutter noch lebt und die denkerische Entwicklung Christines mitbekommt, wissen wir nicht. Seit dem Tod ihres Mannes ist uns nichts über sie überliefert. Sie teilt das Schicksal vieler Frauen jener Zeit: Mit dem Tod eines Mannes verliert sich auch die Spur der Frau an seiner Seite.
Doch weiter in Christines Schrift: Nachdem die drei Damen ihre Reden beendet haben, wirft sich Christine ihnen zu Füßen und dankt. Frau Vernunft drängt darauf anzufangen, denn es sei keine Zeit zu verlieren: »Jetzt fang an, Tochter. ... Nimm die Spitzhacke deines Verstandes, grabe tief und hebe überall dort einen tiefen Graben aus, wo es mein Lot dir anzeigt: Ich werde dir mit meinen eigenen Schultern helfen, die Erde fortzuschaffen.«12
Indem Christine die drei Tugenden vorstellt, gibt sie Instanzen an, mit deren Hilfe es gelingen könnte, das Leben der Menschen zu ordnen. Das ist wichtig für sie, nachdem sie erlebt hat, auf welche Abwege Menschen geraten können, wie ungerecht und verleumderisch sie zuweilen urteilen. Zu ihrer Zeit herrscht mehr Chaos als Ordnung. Ihre Situation als Witwe und als kritisch denkende Frau hat sie immer wieder in schwierige Situationen geraten lassen, in denen sie auf die Ritterlichkeit und Moral der Männer nur äußerst selten hoffen konnte. Ihr Anliegen ist es, vor allem den Frauen zu helfen, ohne jedoch den Blick auf alle Menschen zu verlieren. Der Verfall der Sitten ist ihr Thema, und sie will einen Weg zeigen, wie hier eine Veränderung möglich wäre. Die konkrete Erfahrung stachelt den Verstand an, und dieser lässt nicht locker, bis er Licht ins Dunkel bringt.
Die drei Damen sind allegorische Figuren, die die verschiedenen Tugenden darstellen. Zusammen verkörpern sie für Christine die Idee des Guten, deren Urheber Gott ist. Damit ist Christine Philosophin und Theologin zugleich. Die Suche nach der Wahrheit und die Auseinandersetzung mit Gott sind für sie nicht voneinander zu trennen. Die Denkmethode Christines ist der ihrer Zeit angemessen. Abstrakte Dinge werden ins sinnlich Wahrnehmbare übertragen. So können die Menschen besser verstehen, was die Autorin meint. Und darauf kommt es ihr an. Sie schreibt nicht für sich, sondern für die Menschen, vor allem für die Frauen. Und sie hat den Anspruch, mit ihren Werken erfolgreich zu sein. Sie will kein System erbauen, das dann in den Bibliotheken verschwindet, sondern sie wünscht sich, dass ihre Schriften eine direkte Wirkung auf ihre Zeitgenossen haben: ein hoher Anspruch!
Neben dieser komplexen Arbeit an ihrem großen und schwierigen Werk setzt sich Christine weiterhin mit der Tagespolitik auseinander. Und die ist zum Verzweifeln. Karl VI. erleidet immer häufiger Anfälle von Geisteskrankheit und hat die Macht längst an andere abgegeben: Herzöge, Geistliche und Universitätsprofessoren. Jean Petit, ein Gelehrter an der Universität, bekommt sehr viel Einfluss im Königshaus, unter anderem auch auf die Meinung des Herzogs von Burgund, Johann Ohnefurcht, Sohn von Philipp dem Kühnen.
Im Februar 1408 findet im Sitzungssaal des Palastes ein Treffen statt, an dem viele der renommiertesten Hochschulprofessoren teilnehmen. Das Thema der Debatte ist die Frage des Tyrannenmordes. Ist es moralisch zu verantworten, einen Tyrannen zu töten? Auch für Christine ist diese Frage natürlich interessant, wie alles, was mit Moral zu tun hat. Ein konkreter Fall bietet Anlass zu einer solchen Diskussion: Man hat Ludwig von Orléans, den Bruder des Königs, ermordet, und nun geht es darum, diese Tat im Nachhinein zu rechtfertigen, indem man den Getöteten der Tyrannei bezichtigt. Jean Petit hat seine große Stunde, wobei das mit Ludwig und der Tyrannei nicht so einfach ist, wie man es sich vorgestellt hat, aber es gibt ja andere, nicht minder gefährliche Eigenschaften, die einen Mord rechtfertigen können. Jean Petit fährt schwere Geschütze auf: Er bezichtigt Ludwig der Zauberei, wofür die Menschen des Mittelalters immer ein offenes Ohr haben. Um seine Anschuldigungen zu beweisen, greift er tief in die Klatsch- und Tratschtüte, blendet mit seiner gekonnten Rhetorik, und so gelingt es dem Auftraggeber des Mordes, Johann Ohnefurcht, vom König begnadigt zu werden.
Für Christine ist das ein skandalöser Vorgang. Frau Meinung hat es wieder einmal geschafft, über logisches Argumentieren zu siegen. Überhaupt scheint diese Dame gerade jetzt im Land die Oberhand zu haben. Eine gewisse Einfalt herrscht vor und die lässt sich leicht gängeln von der Arroganz der Herrscher und Professoren. Sprache wird als Mittel zur Manipulation der öffentlichen Meinung eingesetzt. Rhetorik ist zur Kunst demagogischer Beeinflussung geworden.
All dies sind Probleme, die Christines Kritik herausfordern. Wie weit entfernt man doch noch von Toleranz und einem freien Denken ist. Solange es möglich ist, Menschen der Zauberei zu bezichtigen, hat die Vernunft einen schweren Stand.
Der geniale Redner und Meisterwortverdreher Jean Petit wird reich belohnt für seine Ratgeberdienste; er wohnt fortan in einem prächtigen Haus und lebt vortrefflich. Er hat die Gunst der Stunde für sich genutzt, ohne sich um Gerechtigkeit zu scheren.
Christine de Pizan ahnt nichts Gutes. Wenn ein Land moralisch so tief gefallen ist, kann das in der Folge nur Unglück bringen, und tatsächlich nimmt die Unruhe zu. Seinen Anfang nahm das Ganze bereits nach dem Tod Karls V., als ein Machtkampf ausbrach zwischen den Häusern Burgund und Orléans, dem, wie berichtet, Ludwig von Orléans zum Opfer fiel. Ludwigs Sohn ruft die »Armagnacs« zu Hilfe und es entbrennt ein Kampf bis aufs Messer und ohne Rücksicht auf Verluste. Einen neuen Anlass bietet die Enthauptung von Jean de Montaigu, einem ehemaligen Ratgeber des Königs Karls V., auf Befehl von Johann Ohnefurcht 1409. Man kommt nicht umhin, der zu dieser Zeit vielfach verbreiteten Tötungsmethode des Köpfens symbolische Bedeutung zuzumessen, als ginge es darum, die Leute ihres eigenen Kopfes zu berauben, sie am Denken zu hindern. Eine in mancher Hinsicht »kopflose« Zeit, in der Christine gerade ihren Verstand einsetzt, bei klaren Sinnen bleibt und darauf hinweist, dass Handlungen ohne Beteiligung des Denkens mörderisch enden können.
Frankreich spaltet sich. Der Süden erhebt sich gegen den Herzog von Burgund. Die Burgunder kämpfen gegen die Armagnacs, viele Soldaten sterben. Christine schreibt sich in der Klage über die Toten des Bruderkrieges den Kummer von der Seele. Der Krieg aber geht weiter, ohne Schonung der Zivilbevölkerung. Ein brutales Hauen, Stechen, Morden und Plündern ist im Gange. Wie immer kann Christine nicht einfach zusehen. Ihre Waffe ist die Feder, und so schreibt sie einen Traktat mit dem Titel Das Buch von den Heldentaten und der Ritterlichkeit, worin sie sich auseinandersetzt mit der Rolle, die im Kriegsfall die Verteidigung zu spielen habe. Damit aber steht sie im Widerspruch zur Mehrzahl der Pariser, die ihre Angriffslust offen zur Schau stellen, indem sie zum Beispiel Burgunderkappen tragen. An Frieden denkt hier fast keiner. Das wilde Gemetzel scheint die Menschen in eine Art Rausch zu versetzen.
Mit einer weiteren Arbeit wendet sich Christine an den Dauphin, von dem sie sich für die Zukunft eine Art Gesinnungsänderung erhofft. Ihr Buch vom Frieden widmet sie Ludwig von Valois, dem Sohn Karls V I. Darin lässt sie Frau Umsicht dem Dauphin Ratschläge für einen dauerhaften Frieden geben.
Der Krieg hat bereits Unmengen von Geld verschlungen. Das Volk meutert. Es beschuldigt die Adeligen der Bereicherung. Insgesamt herrscht eine feindselige Stimmung: Jeder setzt jedem nach, man verfeindet sich und verleumdet einander. Christine schreibt weiter am Buch über den Frieden und rät dem Dauphin, alles zu tun, um die Liebe seiner Untertanen zu erringen. Er solle milde, gütig und wahrhaftig sein. Christine zählt die Tugenden auf, die sie schon an Karl V. fasziniert hatten. Anfang 1414 schließt sie das Werk ab, aber es kommt ganz anders, als diese Streiterin für Frieden und Gerechtigkeit es sich wünscht.
Da die Franzosen schon immer gern die Engländer um Hilfe baten, weiß Heinrich V. von England, dass er in Frankreich kein schweres Spiel haben wird. Das zerrissene Land ist leichte Beute, und so erobert England nach und nach die weiteren Provinzen Frankreichs. Christine leidet sehr unter diesem Krieg, der kein Ende nimmt, und sieht keinen Sinn mehr in ihrem Schreiben. Was haben all ihre Texte bewirkt? Zum ersten Mal resigniert sie, und 1421 sieht sie keine andere Möglichkeit mehr, als sich aus der Welt zurückzuziehen ins Kloster von Poissy zu ihrer Tochter. Im Konvent will sie ihr Leben zu Ende bringen. Im Kloster erreicht sie 1426 die schlimme Nachricht, dass ihr Sohn Jean gestorben ist und eine Witwe mit drei Kindern hinterlässt. Ein Schicksalsschlag mehr, auf den sie nur mit Beten reagieren kann. Sie hat mit dem Leben draußen in der Gesellschaft abgeschlossen und glaubt nicht, dass es noch einmal einen glücklichen, hoffnungsvollen Augenblick geben wird für sie. Christine, die immer mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen und Gerechtigkeit gelebt hat, kann nun, da sie nichts als Zerfallserscheinungen erblickt, nicht mehr froh werden. Ihre innere Zufriedenheit ist stets abhängig von dem, was draußen in der Welt passiert. Gerade hierin zeigt sie sich als Frau ihrer Zeit, die festes Mitglied der Gesellschaft bleibt und nicht von einem persönlichen Glücksstreben geprägt ist, wie wir heutigen Menschen es kennen. Zwar nimmt Christine in ihrem Denken Positionen ein, die sehr modern klingen. Sie bleibt aber auch eine Frau des Mittelalters, eingebunden in einen Kosmos, aus dem Gott nicht wegzudenken ist und in dem das Individuum noch längst nicht die Rolle spielt, die es heute einnimmt.
Das Jahr 1429 bringt noch einmal eine Überraschung für die Philosophin hinter Klostermauern. Die Belagerung von Orléans durch den Feind nimmt einen anderen Verlauf als die Belagerungen anderer französischer Städte. Die Gerüchteküche brodelt und Christine erfährt, dass es da eine junge Frau geben soll, die es geschafft hat, den Feind zu vertreiben. Aus Lothringen soll sie sein, ein einfaches Mädchen. Angeblich hat sie erzählt, sie sei gekommen, um Frankreich mit Gottes Hilfe beizustehen. Tatsächlich ist Orléans noch frei. Ein Wunder? In den Annalen des Parlaments von Paris ist zu lesen: »Nach dem letzten Sonntag sind die Soldaten des Thronfolgers nach mehreren Sturmangriffen, die ständig mit Waffengewalt verstärkt wurden, sehr zahlreich in die Bastei eingedrungen, die William Glasdale und andere englische Hauptleute und Bewaffnete auf Befehl des Königs (Heinrich VI. von England) ebenso wie den Turm am Ende der Loire-Brücke von Orléans besetzt hielten. An diesem Tag sind die Hauptleute und Bewaffneten, die die Belagerung vorgenommen haben, abgezogen ... und haben die Belagerung abgebrochen, um gegen die Feinde zu kämpfen, in deren Begleitung sich eine Jungfrau befand, die allein ein Banner trug.«13
Die »Jungfrau von Orléans«, eine Erleuchtete oder eine Verrückte?
Christine schreibt in Versform diese Geschichte auf. Zum ersten Mal nach unendlich langer Zeit schöpft sie wieder Hoffnung. Sie kann einen besonderen geschichtlichen Moment miterleben. Wunderbar ist für sie gerade auch, dass es eine Frau ist, die Frankreich Glück gebracht hat. Hat sie nicht ein Leben lang darum gekämpft, dass man die Frauen achten solle? Und nun kommt dieses Mädchen, ganz allein, voller Entschlusskraft und Willensstärke.
Johanna verkörpert in Christines Augen die Männertugend der Ritterlichkeit. Sie gehört in den Kreis der »edlen Frauen«, die ihre »Stadt der Frauen« bewohnen sollen. Unabhängig ist sie und stark, kennt die Gesetze des Krieges und schafft doch Frieden. Sie ist gottestreu und weiß, dass sie sich auf die Hilfe Gottes verlassen kann. Christine hegt schwesterliche Gefühle ihr gegenüber.
Die Professoren jedoch sprechen sich gegen Johanna aus. Sie fordern das Todesurteil. Beim Schreiben dieses Gedichts hatte Christine schon ganz leise geahnt, dass die tapfere Johanna bestraft werden würde dafür, dass sie es gewagt hatte, sich als Frau an die Spitze eines Heeres zu stellen. Die Zeit allgemeiner Frauenfeindlichkeit ist also noch keineswegs vorbei.
Wie recht Christine mit ihrem Misstrauen hat, erlebt sie nicht mehr. Die Umstände ihres Todes sind unbekannt. Wahrscheinlich stirbt sie nach 1430. Auch über zeitgenössische Reaktionen auf ihr Gedicht liegen keine Quellen vor.
Christine de Pizans Wirkung ist jedoch unumstritten. Durch all die folgenden Jahrhunderte hindurch wird sie gelesen. Ein Problem für uns Heutige ist, dass sie in mittelfranzösischer Sprache geschrieben hat und viele ihrer Texte noch nicht übersetzt sind. Die Stadt der Frauen beispielsweise liegt erst seit 1986 in deutscher Übersetzung vor. Hier bleibt noch einiges zu tun, um dieses spannende philosophische Lebenswerk in all ihren Texten zugänglich zu machen.
Christines philosophische Erörterungen sind immer geprägt durch ihre persönlichen Erfahrungen. Ihr unmittelbares Erleben ist Ausgangspunkt für ihr Denken. Dass sie sich fast ausschließlich ethischen Fragen zuwandte, liegt in dem begründet, was sie als moralischen Niedergang in der eigenen Zeit beobachten und in ihrem alltäglichen Leben erfahren konnte. Wie viele ihrer Nachfolgerinnen in der Geschichte der Philosophinnen musste sie sich einen Großteil der formalen Bildung selbst aneignen. Ihre große Begabung zum klaren und vorurteilslosen Denken hat sie erkannt und genutzt, ohne jemals im Ernst ihrer Zeit den Rücken kehren zu wollen.
Christine de Pizan war eine große Denkerin des ausgehenden Mittelalters mit einem visionären Blick in die Zukunft.