Kapitel 2
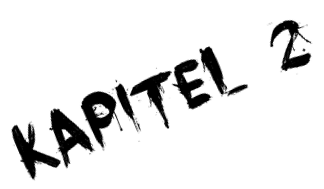
»Hey, Lexi!«
Ich war schon halb die Treppe der Flinders Street Station hinaufgestiegen, mit müden Schritten auf dem Weg nach Hause von der Nachtschicht in einem 7-Eleven in der Innenstadt, als sie mich rief und ihre Stimme plötzlich und scharf den morgendlichen Verkehr übertönte.
»Lexi!«
Nur eine Person hatte mich je so genannt.
Ich suchte die ausdruckslose Menge der Pendler ab, fragte mich, ob ich mich verhört hatte, einen anderen Ruf vollkommen falsch verstanden hatte, aber dann war sie da, stand mit einem irren Grinsen und zur Umarmung weit ausgebreiteten Armen direkt vor mir. Kein kleines Mädchen mehr – das war vor zwölf Jahren gewesen, Schnee von gestern – und in einem Moment der Verwirrung verwechselte ich sie mit ihrer Mutter. Mein Gott, sie sah aus wie Katherine.
»Lexi?« Ihr Lächeln verlosch, in ihren Augen flackerte Zweifel. »Du bist es, oder?«
Und mir dämmerte die Erkenntnis. »Madigan?«
So viel Zeit war vergangen, seitdem sie gegangen war. Seitdem sie mir genommen worden war. Diese plötzliche, unerklärliche Abreise, angekündigt nur von einem verweinten Telefonanruf am Abend zuvor – Irland, sagt Dad und Wir kommen nie zurück und Ich hasse ihn so sehr, ich hasse ihn, Lexi – und dann nichts. Keine weiteren Anrufe mehr, keine Nachsendeadresse, obwohl es drei Jahre oder mehr dauerte, bis ich aufhörte, diese hoffnungslosen, ziellosen Briefe zu schreiben, bis ich sie alle aus der untersten Schublade meiner Kommode holte und verbrannte. Und jetzt war sie zurück, war hier, direkt vor mir: Madigan, leibhaftig.
Meine Madigan.
Dann schlang sie die Arme um meinen Hals und umarmte mich fest, ihr warmer Atem in meinem Ohr – »Ich wusste, du bist es, ich wusste es« – und ich umarmte sie zurück. Zuerst fühlte es sich seltsam an, weil ihr Körper eine geschmeidige Landschaft aus unvertrauten Hügeln und Kurven war. Sie war jetzt so groß wie ich und ihre Schultern waren fast genauso breit; langes rotes Haar kitzelte meine Handrücken und ihr Gesicht an meiner Wange fühlte sich heiß an.
Schließlich trat sie zurück und ergriff meine Hände. »Was tust du gerade, jetzt in diesem Moment, Lexi? Irgendetwas, das nicht warten kann?«
Und an diesem Punkt hätte ich sogar meine eigene Beerdigung verschoben.
∞
Der Tempel der Isis, eines ihrer Stammlokale. Ein exklusives Café am eleganten Ende der Collins Street mit auf ägyptisch gemachter Einrichtung und einer Frühstückskarte, von der mich eine Bestellung nur ein bisschen weniger kosten würde als der gestrige Gehaltsscheck; kein Wunder, dass wir uns dort nie begegnet waren. Eine dünne Kellnerin mit blondem Bob kam, um unsere Bestellung aufzunehmen, und war schon dabei, die Besonderheiten der Frühstückskarte aufzuzählen, als ich eine Hand hob.
»Nur einen Kaffee, bitte. Schwarz.« Wenn ich mehr bestellte, würde mein Kontostand wahrscheinlich unter den nötigen Betrag für die Miete sinken, mit der ich bereits ein paar Tage im Rückstand war. Aber Madigan schüttelte den Kopf. »Nach einer Nachtschicht musst du doch am Verhungern sein. Ich bin diejenige, die dich unter Schlafentzug setzt; ich kann wenigstens dafür sorgen, dass du ein anständiges Frühstück bekommst.« Sie tat meinen Protest ab und bestellte für uns beide, während ihre hellen Finger schnell über die Karte glitten: das, das und das.
»Jetzt werd bloß nicht chauvinistisch, Lexi«, flüsterte sie, sobald die Kellnerin außer Hörweite war. »Ich kann es mir leisten, du nicht. So einfach ist das.«
Und irgendwie war es das auch. Ihre Worte waren eine einfache Erklärung der Tatsachen, frei von jeder Beleidigung oder Anspielung. Hätte mir irgendwer anders am Tisch gegenübergesessen, hätte ich mich herabgesetzt gefühlt und schuldig, hätte versucht, das Versprechen zu erlangen, dass ich die Einladung eines Tages erwidern dürfte. Aber ihr Ton war einfach zu klar: Mach keinen Wirbel; es ist schon vergessen. Es waren also nicht nur Äußerlichkeiten, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Mit Katherine zusammen zu sein war genauso gewesen. Sie hatte dieselbe ungewöhnliche, beneidenswerte Grazie, die Fähigkeit, sofort dafür zu sorgen, dass man sich wohlfühlte. Sie löste jedes Unbehagen einfach auf, egal in welcher Situation.
Das ist nichts, was ich als Kind hätte in Worte fassen können. Ich hatte einfach nur gewusst, dass Madigans Mutter dafür sorgte, dass ich mich willkommen und gebraucht und ganz fühlte, anders als in meiner Familie. Was wahrscheinlich ein wenig unfair ist. Außer um mich musste meine Mum sich auch noch um meine Zwillingsschwestern kümmern, die geboren wurden, als ich gerade in die Schule kam. Und dabei war sie ziemlich auf sich allein gestellt, weil Dad immer lange in der Möbelfabrik arbeitete und kaum da war. Trotz allem schienen sie mehr als froh zu sein darüber, dass ich an den meisten Tagen nach der Schule mit Madigan nach Hause ging und den Großteil meiner Wochenenden und Ferien im Haus der Sargoods verbrachte.
Manchmal tat ich so, als wäre Katherine meine echte Mutter, die aus irgendwelchen dunklen, mysteriösen Gründen gezwungen gewesen war, mich an eine andere Familie abzugeben.
»Schau dich an, Lexi.« Madigan rümpfte die Nase und lächelte. »Da hattest du doch die Frechheit, erwachsen zu werden.«
»Das musst gerade du sagen«, meinte ich. »Du siehst deiner Mum so ähnlich, es ist einfach erstaunlich. Ist sie auch zurück in Melbourne?«
Sie fiel in ihrem Stuhl zurück, als hätte ich sie geschlagen, die Augen weit aufgerissen und eine Hand vor dem Mund. »Oh, Lexi …«
Dann kam die Kellnerin mit unserem Frühstück. Die vereinten Düfte von Kaffee, Speck und heißen, gebutterten Croissants weckten meinen Hunger und ich wurde rot, weil mir das laute, schlecht getimte Magenknurren peinlich war.
»Madigan?« Ich griff über den Tisch, um ihre Hand zu berühren. »Geht es dir gut?«
»Sie haben es dir nie gesagt?«, fragte Madigan. »Nein, natürlich haben sie das nicht. Sie hätten nicht einmal daran gedacht …«
»Was? Was ist los?«
Ihre grünen, leuchtenden Augen trafen meine. »Meine Mutter ist tot, Lexi. Sie ist seit sechs Jahren tot.«
Meine Mutter ist tot.
Es gab keine Worte, um darauf zu antworten. Ich saß einfach da, drückte ihre Hand und sah ihr in die Augen.
»Sie war eine Weile krank«, sagte Madigan und löste ihre Finger sanft aus meinem Griff. »Eigentlich ihr ganzes Leben lang. Ihr Herz war … nicht gut. Deswegen sind wir umgezogen, weißt du? Mum wollte Irland wiedersehen, wollte, dass Bailey und ich es mit ihr sehen, bevor sie stirbt. Ich glaube, mein Vater hätte zu diesem Zeitpunkt alles getan, um sie glücklich zu machen. Er hätte ihr das ganze verdammte Land gekauft und hierher liefern lassen, wenn er gekonnt hätte.«
»War sie das?«, fragte ich. »Glücklich?«
»Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin mir sicher, dass sie glücklicher war, als wenn sie hier in Melbourne festgehangen wäre, aber sie wirkte so traurig. Abwesend, weißt du? Als wäre sie nicht ganz bei uns. Das ist alles, was Irland jetzt für mich bedeutet; es ist der Ort, an dem meine Mutter aufhörte zu lächeln.«
»Es tut mir so leid, Madigan.«
»Mir tut es leid, dass man dir nichts gesagt hat. Du hast sie auch geliebt.«
»Na ja.« Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, den Schmerz mit einem Schluck Kaffee hinunterzuspülen. »Es ist ja nicht so, als wäre irgendwer hier gewesen, der es mir hätte sagen können; Irland ist am anderen Ende der Welt.«
»Nein.« Madigan schüttelte den Kopf. »Vater ist danach fast sofort mit Bailey zurückgekommen.« Hatte alles zusammengepackt und war in weniger als einer Woche reisefertig gewesen – ein Hauch von Bitterkeit schlich sich in ihre Stimme –, als hätte er nur abgewartet, bis seine Ehefrau gestorben war. Madigan hatte sich strikt geweigert, mit ihrer Familie nach Melbourne zurückzukehren. Stattdessen hatte sie sich dafür entschieden, in Dublin zu bleiben und die Schule zu beenden, jede endlos lange Nacht auf einem ungemütlichen Ausziehbett im Haus einer Freundin zu verbringen und still zu trauern, allein, bis ihre Tränen versiegt waren. Erst dann war sie bereit gewesen, Irland und den Tod ihrer Mutter hinter sich zu lassen, die zwei waren für immer verbunden, unmöglich zu vergessen.
Oder zu vergeben.
Sie hatte angefangen zu reisen. Zuerst die Britischen Inseln, dann Jahre, in denen sie durch Europa und den mittleren Osten flüchtete, bei fast Fremden oder neuen Bekannten unterkroch, bei jedem, der ein freies Bett und genug Geduld hatte, um ihre endlosen Fragen zu ertragen, und sei es nur für ein paar Tage. Einige waren zu Liebhabern geworden – diesen Leckerbissen warf sie mir beiläufig zu, beobachtete mich dabei aber aus den Augenwinkeln –, in manche davon hatte sie sich sogar verliebt oder hatte es zumindest geglaubt, aber es gab immer noch etwas zu sehen, Gründe, weiterzuziehen, und sie war bei keinem von ihnen wirklich lange geblieben.
An diese Heftigkeit erinnerte ich mich noch aus unserer Kindheit. Sobald sie ein Ziel vor Augen hatte – ob es darum ging, ein Klavierstück zu lernen oder darum, sich wegen einer tatsächlichen oder eingebildeten Beleidigung an einem Klassenkameraden zu rächen –, Madigan hatte ihren Vorsatz immer stur und unerbittlich verfolgt, bis nichts anderes oder niemand anderer in ihrem Leben mehr zählte.
Aber da war noch etwas anderes, etwas, das sie in ihrem fröhlichen Reisebericht ausließ: das Warum. Was hatte sie so umtriebig werden lassen, wie sie es nannte, was ließ sie vor jeder Art der Stabilität weglaufen, als handle es sich um ein Krebsgeschwür? Über dieses fehlende Stück in ihrer verkürzten Lebensgeschichte konnte ich Vermutungen anstellen. Vielleicht hatte der Tod ihrer Mutter Madigan tiefer getroffen, als sie zugeben wollte, auch vor sich selbst, oder vielleicht hatte sie doch nicht alle Trauer in Irland zurückgelassen und stattdessen einen kleinen Teil davon mit auf die Straße genommen; eine ständige Erinnerung daran, was für Folgen es hatte, wenn man jemanden zu nah an sich heranließ.
Und ich schwöre, gerade als ich diesen Gedanken hatte, schien etwas in mir klick zu machen. Wie lautet das Wort, dass diese Selbsthilfe-Gurus verwenden? Offenbarung? Ja.
Eine verdammte Erleuchtung.
Mein Leben glitt vor meinem inneren Auge vorbei: eine Reihe von missglückten Beziehungen (obwohl missglückt das völlig falsche Wort ist, weil es andeutet, dass es einen Versuch gegeben hat, sie glücklich werden zu lassen; vielleicht wäre abgebrochen besser, misslungen, noch vor der Geburt ertränkt); die zur Gewohnheit gewordene Entfremdung von meiner Familie, die ich inzwischen kaum noch sehe außer zu Geburtstagen und Weihnachten; meine sehr wenigen Freunde, die eher eine lose Ansammlung von Bekannten sind, die ich mit jedem neuen Job oder jeder neuen WG gefunden hatte, um sie zu vergessen, sobald ich weiterzog.
Eine kranke Furcht vor emotionaler Bindung?
Das war nicht Madigan, das war ich.
Immer noch zwölf Jahre alt, immer noch in Trauer über den Verlust meiner besten und einzigen echten Freundin und über den Verlust einer Frau, die genauso gut meine Mutter hätte sein können, so sehr, wie ich sie geliebt hatte. Beide wurden mir ohne Vorwarnung oder Erklärung genommen, ohne auch nur die Zeit, sich richtig zu verabschieden. Gut versteckte Wunden, die niemals richtig verheilt waren.
Natürlich war das ich.
»Hey, da drüben.« Madigan wedelte mit einer Hand vor meinem Gesicht. »Ich langweile dich doch nicht, oder?«
»Hmmm, was?« Ich schluckte schwer. Madigan, endlich zurückgekehrt; auf keinen Fall würde ich sie wieder verlieren. »Tut mir leid, ich habe nur … habe nur gerade an etwas gedacht.«
»Möchtest du auch dem Rest der Klasse davon erzählen?«
»Ähm … vielleicht später.« Ich rieb mir die Augen und bedeutete ihr, weiterzuerzählen. »Bitte, sprich weiter. Es interessiert mich, ehrlich. Ich bin nur ein wenig müde.«
»Zeit, nach Hause zu gehen?«
»Nein«, versicherte ich ihr. »Nicht schläfrig müde, eher … weggetreten müde. Verstehst du?«
Madigan nickte. »O ja, ich verstehe. Weggetreten müde.«
»Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, richtig? Aber jetzt will ich das hören; ich will von dir hören, was du so getrieben hast. Die Welt zu bereisen, Himmel, das klingt wirklich großartig.«
»Das war es zu Beginn. Aber dann …« Sie zuckte mit den Achseln und schob mit der Gabel ein Stück Omelette über ihren Teller. »Heutzutage kann die Welt ein sehr enttäuschender Ort sein.«
So viele enttäuschte Erwartungen, erklärte sie, so viele zerstörte Illusionen. Zum ersten Mal passierte es ihr schon am Anfang ihrer Reise: die großen Steinkreise von Stonehenge und ihr langgehegter Traum, sich auf einem der Monumente auszustrecken, die Wange kühl und ruhig gegen die raue Oberfläche gedrückt, während sie den Sonnenaufgang beobachtet.
»Aber sie haben jetzt diesen riesigen Zaun darum errichtet – man kann sich den Steinen nicht nähern, außer man bucht eine spezielle Führung, und selbst dann kannst du es vergessen, sie zu berühren, und noch weniger darfst du dich auf einen setzen.«
Ähnliche Enttäuschungen wurden zur Regel. Wann immer sie Orte aufsuchte, die einst ihre Phantasie beflügelt hatten, stellte sie fest, dass sie bereits verpackt und aufgeteilt waren, eingekapselt und aufbereitet zum Vergnügen von fotoapparattragenden Touristen und gelangweilten Schulkindern. Oder sie waren vollkommen verrammelt, geschützt vor den achtlosen Füßen und den neugierigen Fingern Der Öffentlichkeit – eine Gruppe, in die Madigan eingeschlossen war, egal wie sehr sie flehte und welche Bestechungsversuche sie startete.
Am Ende war es Berlin, das den größten Eindruck auf sie machte. Es war etwas Authentisches in dieser einst geteilten Stadt; eine rohe Energie und eiserne Entschlossenheit, wieder auf die Beine zu kommen, ihre Identität zu finden, und das alles in einem ständigen Strudel von Wandel und Veränderung. Besonders hatte sie sich in das alte Ostberlin verliebt, wo heruntergekommene Häuser, von Kugeln getroffen und überzogen mit Graffiti im Sowjet-Stil, sich direkt neben massiven Baustellen erhoben, die modernen Kaufhäuser und schicken Apartmentkomplexe der Zukunft. Eine Stadt, die, zumindest für den Moment, genau dieselbe Ausstrahlung von Chaos und Wandel, Zerstörung und Erneuerung hatte, wie sie sie tief in sich selbst spürte.
Ein Kollektiv junger Künstler und Schriftsteller – einige Aussiedler aus Russland, andere tatsächlich aus Berlin – hatte sie aufgenommen, nur allzu bereit, stundenlang ihre Ideen über die Avantgarde darzulegen, zu vertreten, wie edel es war, für seine Kunst zu leiden oder über die Vorzüge guten, russischen Wodkas zu sprechen. In Berlin hatte sie gelernt, mit einem Pinsel umzugehen, die Kunst einzusetzen, um den Aufruhr in sich sichtbar zu machen und ihn zu beruhigen. Die Stadt wurde zur Ausgangsbasis, von der aus sie immer wieder Erkundungsreisen unternahm, und auch zum Ruhepol, an den sie müde und übersättigt zurückkehren konnte. Dort hatte dann für mehrere glückliche Wochen am Stück ihre gesamte Welt aus einem kühlen, von Kerzen beleuchteten Ausklappsofa bestanden, aus einer Handvoll Café-Bars, die Hochprozentiges und billiges Essen anboten, und aus den leerstehenden Lagerhäusern, die ihre Künstlerfreunde als Studios, Wohnungen und öffentliche Galerien besetzt hatten.
Und langsam, mit der schleichenden Mühelosigkeit von langgehegten Gewohnheiten und nicht hinterfragter Zuneigung war Berlin zu dem geworden, dem sie so lange ausgewichen war.
Berlin war zu einem Zuhause geworden.
»Meinem Zuhause«, flüsterte Madigan.
Ich fühlte einen Stich des Verlustes, als ich sie mir dort vorstellte. Nach der Art, wie sie darüber sprach, war klar, dass sie dorthin zurückkehren würde. »Aber warum bist du dann nach Melbourne zurückgekommen?«
»Huh! Frag doch meinen Vater, wie wär’s?« Sie rammte ihre Gabel in die Reste ihres Omeletts und verwandelte es in eine Masse aus geronnenen Klumpen. »Er hat verlangt, dass ich zurückkomme, hat erklärt, er wäre es leid, dass ich durch die Welt tingle wie eine Stewardess.«
»Hättest du nicht Nein sagen können?« Mir fiel es schwer, mir vorzustellen, wie Madigan gegen ihren Willen zu irgendetwas gezwungen wurde.
Sie seufzte. »Mit meinem Vater ist es nie so einfach.«
Und da war es wieder, das Gefühl, dass mir immer noch ein Puzzleteil fehlte, dass es eine kleine, aber wichtige Information gab, die sie mir nicht mitteilte. Verwirrt nippte ich an den Resten meines Kaffees und versuchte, nicht das Gesicht zu verziehen, als das inzwischen kalte und gar nicht mehr gutschmeckende Getränk durch meine Kehle glitt.
»Es gab zwei Bedingungen«, fuhr Madigan fort und zählte sie an ihren Fingern ab. »Erstens, dass ich bei ihm und Bailey in Melbourne lebe; zweitens, dass ich etwas Konstruktives mit meiner Zeit anfange, während ich hier bin – wobei man bedenken muss, dass im Kopf meines Vaters ›konstruktiv‹ gleichbedeutend ist mit entweder ›Arbeit‹ oder ›Studium‹.«
»Und du hast dich entschieden für …«
»Die Uni. Einen Abschluss in bildender Kunst.« Sie grinste. »Na ja, ich habe mich wirklich bemüht, etwas noch weniger Konstruktives zu finden, aber der Masterstudiengang in fortgeschrittener Nabelschau war schon voll.«
Ich lachte. »Gefällt es dir nicht?«
»Oh, ich weiß nicht.« Sie zuckte mit den Achseln. »Die Theorie ist langweilig und sie haben noch nicht mal von einem der Leute gehört, die ich in Berlin kannte, aber die praktischen Fächer sind nicht so schlecht. Ich kann etwas schaffen, ein wenig experimentieren. Es füllt den Tag aus, oder?«
»Erzähl mir davon.« Mir, dem geheimen Meister des Tagefüllens, der Zeitverschwendung, mein Leben eine Ansammlung von unbedeutenden Trivialitäten. »Hey, glaubst du …«
»Oh, Dreck!«
Ich hatte gerade vorschlagen wollen, dass wir einen Tag gemeinsam verbrachten – vielleicht mit einem Ausflug an die Küste oder dem Bummeln durch die Galerien der Innenstadt, wenn ihr das lieber war –, aber Madigan schaute bereits auf ihre Uhr, während sie die rechte Hand hob, um die Rechnung zu verlangen. »Tut mir leid, Lexi, ich muss los. Mein Bildhauer-Kurs fängt in zehn Minuten an und ich sollte wirklich versuchen, den Großteil davon mitzubekommen.«
Eine dumpfe Panik stieg mir in die Kehle. Die abrupte Art, wie sie ihre Sachen zusammensammelte, wirkte einfach zu desinteressiert. Ich stellte fest, dass mir die Worte fehlten; dass ich sie nach ihrer Telefonnummer fragen wollte, aber zugleich Angst hatte, dass ich zu verzweifelt, zu überstürzt klingen würde. Ich hatte Angst, dass sie Nein sagen würde, es wäre wunderbar gewesen, sich mal zu sehen und über alte Zeiten zu reden, aber vielleicht sollten wir es besser dabei belassen.
Ich hatte Angst, sie wieder zu verlieren.
Ich holte tief Luft. »Madigan …«
Und dann küsste sie mich.
Nichts Dramatisches: ihre Hand leicht auf meiner Schulter, ein schnelles Vorbeugen und die feste, volle Berührung ihrer Lippen an meinen, wo sie einen langen Moment verweilten, bevor sie sich mit einem Lächeln zurückzog.
»Ich bezahle auf dem Weg nach draußen.« Sie wedelte mit der Hand Richtung Tisch. »Bleib und frühstücke fertig.« So beiläufig, als wären wir ein vertrautes Paar und solche Zuneigungsbekundungen die normale Art, uns zu verabschieden.
Noch mal, wollte ich sagen. Bitte, noch mal.
»Ich sehe dich später, Lexi.« Sie fuhr mir mit den Fingerrücken leicht über meine Wange und in ihren Augen leuchtete ein Versprechen. »Ich werde dich sehen.«
Nicht für eine Sekunde zweifelte ich daran.
∞
Spät an diesem Freitagabend: Ich arbeitete allein im Slick Video, meiner anderen regelmäßigen Einkommensquelle, obwohl ich nicht mehr sicher war, für wie lange noch, nachdem mein Chef anfing, etwas über Schichtzusammenlegungen und Fixkostensenkung zu murmeln. Ich stellte DVDs zurück in die Neuheiten-Regale und dachte darüber nach, ob ich es wagen sollte, früher zu schließen, als ich ein leises Geräusch hinter mir hörte und dann eine Stimme, die mir warm und süß ins Ohr flüsterte: »Ich spendiere dir einen Kaffee, wenn du mir zeigst, wo ihr die wirklich unanständigen Filme versteckt.«
»Madigan.« Ich drehte mich um und grinste sie an.
Die Antwort war ein kokettes Halblächeln, die Unterlippe zwischen die Zähne gezogen, während sie mir einen Pappbecher mit Deckel entgegenstreckte. »Nur geblufft, ich habe den Kaffee schon gekauft.«
»Danke«, sagte ich und nahm ihn ihr ab. »Woher wusstest du, wo ich bin?«
»Du hast mir erzählt, dass du hier arbeitest. Ich habe heute Morgen angerufen und sie haben mir gesagt, dass du heute Abend da bist.«
Okay, sicher. Ich hatte den Job erwähnt, aber nur nebenbei, während wir neulich zum Café gelaufen waren.
»Daran hast du dich erinnert?«
»Ich erinnere mich an eine Menge.«
Während ich die DVDs fertig einordnete, lehnte Madigan sich an den Tresen und trank ihren eigenen Kaffee, während sie in einer der kostenlosen Werbebroschüren des Ladens blätterte. Ihre Gegenwart hatte etwas Angenehmes, fast Intimes; wie sie mir einfach von den Belanglosigkeiten ihres Tages erzählte, ohne mich dabei auch nur anzusehen – als hätten wir solche Gespräche ständig und wären uns des Interesses und der Aufmerksamkeit des anderen sicher.
Ich lächelte.
Hätte ein anderes Mädchen sich so schnell so vertraut gegeben, hätte ich sie für zu selbstsüchtig, zu aufdringlich erklärt und wäre sprichwörtlich davongelaufen – das hatte ich, um ehrlich zu sein, mehr als einmal getan. Aber bei Madigan war es etwas anderes. Ich spürte nicht mal den Anflug meiner üblichen Klaustrophobie, nicht den Hauch der mangelnden Zugehörigkeit, die ich bei anderen Mädchen empfunden hatte. Bei Madigan gab es nur ein entspanntes Zugehörigkeitsgefühl, als hätten wir all die unangenehmen Anfangsschritte unserer Beziehung bereits hinter uns gebracht.
Unserer Beziehung.
Der Gedanke überraschte mich und meine alte Unsicherheit suchte sich ihren Weg in meine Gedanken. Was, wenn sie nicht dasselbe empfand? Was, wenn sie einfach nur abhing, sich einfach nur ablenkte, bis etwas – jemand – Besseres des Weges kam?
Ich warf ihr einen schnellen Blick zu, als könnte ich ihre Absichten besser einschätzen, ihr Gesicht besser lesen, wenn ich es heimlich betrachtete. Und natürlich wählte sie genau diesen Moment, um mit einem wissenden Lächeln auf ihren Lippen aufzusehen. »Gefällt dir, was du siehst?«
Ich wurde rot. »Tut mir leid, ich …«
Sie lachte und schüttelte den Kopf. »Mein Lexi, immer noch so leicht aus der Fassung zu bringen.«
Ich schnaubte. »Sehr witzig.«
»Ich tue mein Bestes. Hör mal, wann bist du hier fertig?« Madigan streckte die Arme mit verschränkten Fingern vor sich aus. Ihre Ellbogen knackten laut. »Es ist Freitagabend, es ist Vollmond und ich will da raus und etwas unternehmen. Außer …«
»Außer?«, echote ich und spielte mit.
»Außer, dir steht der Sinn danach, dir eine dieser Scheiben zu schnappen« – sie machte ein vage Handbewegung, die den gesamten Laden einschloss, und legte den Kopf auf eine Art und Weise schräg, die fast, fast, vollkommen unschuldig wirkte – »und für die Nacht in deine Wohnung zu gehen?«
Es gab nicht wirklich eine andere Wahl.
∞
Die Heizung voll aufgedreht lagen wir auf meiner Couch, einem riesigen Dreisitzer mit verblasstem braunem Velourbezug, den meine Familie schon zu Tode gesessen hatte, bevor er auf mich übergegangen war. Ein hässlicher Klotz, aber auf eine müde, ergebene Weise immer noch gemütlich und groß genug, um uns beide Seite an Seite zu halten, unsere Glieder lose verschlungen, mein Arm leicht um die Rundung ihrer Hüfte gelegt. Es lief der Director’s Cut von Blade Runner, mit leiser Lautstärke, um meine Mitbewohnerin nicht zu stören. Ruth, die zu der Zeit, als wir angekommen waren, bereits im Bett gelegen hatte. Ich war seltsam glücklich darüber, als wäre Madigan eine Art Phantom, das verschwinden würde, sobald es in Kontakt mit meiner Lebensrealität kam. Ich war noch nicht bereit, sie zu teilen, jetzt noch nicht.
Ich hatte den Film schon ein Dutzend Mal oder öfter gesehen – hatte ihn immer gern in der Arbeit gespielt, wenn der Chef nicht da war, um den neuesten Hollywoodstreifen einzulegen – und so ertappte ich mich dabei, wie meine Aufmerksamkeit wanderte. Mein Kopf schwirrte angenehm von dem Bier, auf das Madigan bestanden hatte. Sie hatte das meiste davon getrunken, aber sie wirkte vollkommen unbeeinflusst. Sie lag mit ihrem Kinn auf den Fäusten und konzentrierte sich auf das Schattenspiel des Fernsehers. An einem Punkt hatte ich ihr die Augen zugehalten, eine spielerische, betrunkene Geste, die sie zur Seite geschlagen hatte, ihre Wut brauste so plötzlich auf – Lass das, Lexi, ich schaue den Film! –, dass ich jetzt ruhig dalag, zerknirscht und zufrieden, einfach bei ihr zu sein und die Wärme ihres Körpers an meinem zu spüren.
Auf dem Bildschirm fiel trostloser blauer Regen, während Rutger Hauer seine berühmte Todesansprache hielt, All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, und mir fiel auf, dass Madigan synchron mitflüsterte.
»Was?« Ich stieß sie sanft mit dem Knie an. »Was hast du gesagt?«
Sie drehte sich halb und sah mich mit ernsten, glitzernden Augen an. Biertränen; anscheinend war sie doch betrunken. Ihre Wangen waren feucht und leuchteten im reflektierten Licht des Fernsehers.
»Ich werde nicht so sein, Lexi. Ich werde nicht so verloren sein.«
»Shhh.« Ich streichelte ihr das Haar. »Es ist nur ein Film.«
»Ich werde nicht so sein.« Ein trotziges Schniefen, bevor sie sich wieder Blade Runner zuwandte und schweigend die letzten Szenen beobachtete. Erst als der Abspann langsam über den Bildschirm flimmerte, bewegte sie sich wieder und bog ihren gesamten Körper in einem langen, katzenartigen Streckvorgang. Als sie sich schließlich herumrollte, um mich wieder anzusehen, waren ihre Augen klar und leuchtend, ihre Wangen rot, aber trocken.
Ich fragte mich, ob ich mir ihre Tränen nur eingebildet hatte.
»Also«, sagte sie und tippte mir mit einem Finger gegen das Kinn.
»Also?«
»Also, was machen wir jetzt?«
»Ähm.« Ich grinste dümmlich und war plötzlich verlegen. »Wir könnten Scrabble spielen?«
»Hmmm.« Madigan runzelte die Stirn, als würde sie ernsthaft darüber nachdenken, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich glaube, ich habe eine bessere Idee.«
Diesmal war es kein schneller Kuss. Nur eine leichte Berührung meines Mundes mit ihrem, bei der ihre Zunge zwischen meine Zähne glitt und ich zu langsam, zu verwirrt war, um sie mit meiner zu jagen. Stattdessen vergrub ich meine Hände in ihrem Haar, wickelte dichte Strähnen um meine Finger, während ich sie an mich drückte und das kostbare Gefühl ihres Körpers an meiner Brust, meinem Bauch, meinen Schenkeln genoss. Ich wollte sie verschlingen; von ihr verschlungen werden. Dann glitten ihre Hände zu den Knöpfen meiner Jeans, fummelten daran herum und fast instinktiv zog ich mich zurück.
»Was?«, flüsterte sie und nagte an meiner Unterlippe.
»Ich denke …« Die Welt drehte sich in einer schwindelerregenden Mischung aus Alkohol und Erregung, und ich kämpfte darum, meinen Kopf klar zu bekommen. Ich wollte mich an jeden einzelnen Moment erinnern. »Ich weiß nicht, ob wir das jetzt tun sollten.«
Aber ihre Hand drückte fest gegen meinen Genitalbereich und fing an, sich in langsamen Kreisen zu bewegen. »Wirklich?«
Himmel!
»Es gibt nur das Jetzt, Lexi.« Noch ein Kuss, tiefer und sogar noch berauschender als der letzte, während sie meinen Hosenschlitz ganz öffnete und ihre Hand hineinschob, sodass ihre Finger sich leicht um mich schlossen. So intim, diese Berührung ihrer nackten Haut auf meiner, so spannungsgeladen, dass ich mich gegen sie drängte und sie fest, fest an mich drückte, bis aus ihrer Kehle ein gedämpftes Keuchen kam.
»Mein Handgelenk!« Ihre Stimme klang halb erstickt, voller Schmerz. »Du brichst mir das Handgelenk!«
Ich zog mich zurück, als hätte ich mich verbrannt, als hätte ich sie verbrannt, und entschuldigende Phrasen drängten sich auf meine Lippen. Aber sie lachte bereits, schob mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und wies mich an, ruhig zu sein, weil kein Schaden entstanden war, obwohl wir die Feierlichkeiten vielleicht in einer passenden Umgebung fortsetzen sollten.
Mit einem festen Griff hob sie mein Kinn. »Wo ist dein Schlafzimmer?«
Es war meine Idee, sie zu tragen, eine spontane, romantische Geste, und sie kicherte, als ich versuchte, sie hochzuheben; kicherte noch mehr, als ich nach einem dummen, betrunkenen Fehltritt auf ihren Schoß fiel. »Um Himmels willen, Lexi! Ich bin viel zu schwer und du bist viel zu betrunken.«
Stattdessen taumelten wir ungeschickt zu meinem Zimmer, alle Hemmungen jetzt vergessen, in der Eile, uns gegenseitig auszuziehen und eifrig Küsse auf jede neu freigelegte Hautfläche zu setzen. Endlich nackt und in der eisigen Winterluft zitternd fielen wir auf mein ungemachtes Bett, zogen uns die Decke über den Körper und lachten nervös durch klappernde Zähne.
»Sch-Scheiße«, stammelte ich. »Es ist zu kalt, um irgendetwas zu tun.«
»Da würde ich nicht drauf wetten.«
Sie packte meine Schultern, rollte mich auf den Rücken und dann in einer eleganten Bewegung ihr Gewicht auf mich, sodass sie auf mir saß und mich in die Matratze drückte. Ihr Anblick war so unglaublich erotisch: wie sie über mir aufragte, ihre vollen Brüste weiß wie Alabaster im Mondlicht, das durch meine Fenster fiel. Die Kurve ihres Bauches, der sich mit jedem Atemzug hob und senkte. Der scharfe, fast schon schmerzhafte Druck ihrer Fersen in meine Oberschenkel schickte neue Wellen der Erregung durch meinen Körper und ich stöhnte, als ihr Fingernagel meine Wangenknochen nachzeichnete.
»Und jetzt«, flüsterte Madigan. »Was sollen wir mit dir machen?«
Ich schloss die Augen. »Alles, was dir verdammt noch mal gefällt.«
Es war nicht mein erstes Mal, bei Weitem nicht, aber als sie sich auf mich gleiten ließ, sich langsam und kontrolliert bewegte, kleine, drängende Kreise beschrieb, ging mir auf, dass es das erste Mal mit jemandem war, den ich tatsächlich liebte – und, so abgedroschen es auch klingt, das veränderte wirklich alles. Jede Empfindung wurde jetzt so unmittelbar von Bedeutung begleitet, dass ich mir wünschte, sie wäre die erste, mir wünschte, ich könnte all die anderen auslöschen und von vorne anfangen. Für diesen Moment. Für sie.
Ich liebe sie, die Worte stiegen in meinem Geist auf, als ich meine Hände an ihre Brüste hob. Ich liebe sie, ein ekstatisches Echo, als sie meine Schultern, mein Gesicht umfasste. Ich liebe sie, mein Gelöbnis im Wahnsinn, als ich kam, sie an mich zog, um meinen Kopf tief in der Kuhle ihres Halses zu vergraben, während der Duft frischen Schweißes meine Sinne erfüllte.
Ich liebe dich. Wild und verzweifelt in sie stoßend.
Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.
»Ich weiß, Lexi. Shhh, ich weiß.«
Erst dann ging mir auf, dass ich es laut ausgesprochen hatte, meine selbstvergessenen Erklärungen wieder und wieder geflüstert hatte. Seltsamerweise machte es mir nichts aus. Es gab keinen Stich der Verletzlichkeit oder der Peinlichkeit, nur ein Gefühl der Erleichterung, als wäre etwas Schweres und Belastendes, etwas, das ich schon lange mit mir herumtrug, verschwunden.
»Ich liebe dich«, sagte ich wieder. »Das tue ich wirklich.«
Madigan lachte und lehnte sich vor, um mir einen Kuss auf die Wange zu geben. »Dummer Junge, ich habe dich schon das erste Dutzend Mal gehört.«
Später, als ich gerade wegdämmerte, seufzte sie und piekte mich sanft in die Rippen. »Bist du wach?«
»Mmmm.«
»Ich habe nachgedacht. Erinnerst du dich an das erste Mal, als wir uns getroffen haben?«
»Ähm, nein. Nicht wirklich.« Es war nicht, als hätte ich es vergessen, nicht ganz; es war eher, als könnte ich mich an keine Zeit erinnern, in der Madigan – oder ihre Abwesenheit – nicht Teil meines Lebens gewesen waren. Es war, als versuche man sich an seine ersten Schritte als Kind zu erinnern oder an das erste gesprochene Wort. Unmöglich, denn war man nicht immer schon gelaufen, hatte man nicht immer schon gesprochen, genauso wie man es heute tut?
»Also, ich erinnere mich.« Der Tadel verwandelte sich in Nostalgie, als sie von einem lange vergangenen Morgen sprach, an dem unsere Kindergartengruppe eifrig damit beschäftigt gewesen war, lächelnde Sonnen und hellgrüne Kätzchen, Mamis in dreieckigen Kleidern und Papis mit extravaganten orangefarbenen Bärten zu malen. Sie wollte sich meine rote Wachsmalkreide ausleihen, weil das ihre Lieblingsfarbe war und alle anderen von irgendeinem Kind mit einer Schwäche für Wachs angekaut worden waren. Rot war auch meine Lieblingsfarbe, also hatten wir die nächsten paar Minuten damit verbracht, uns über Farben und Kreiden zu verbrüdern – die Art von zufälliger Freundschaft, die, nach allen Gesetzen der Kindheit, kaum den Nachmittag hätte überleben dürfen. Aber am nächsten Tag hat sie ihre Erdbeeren mit mir geteilt, und ich habe ihr eine rote Kreide von der Tafel gestohlen, und so hatte alles angefangen.
»Fühlst du es?«, fragte sie plötzlich und stützte sich auf den Ellbogen auf. »Sag mir, dass du es fühlst.«
»Was?«
Ein Gefühl von Unumgänglichkeit, antwortete sie, von Schicksal – weil ihr kein weniger dramatisches Wort einfiel. Als zöge sich eine Verbindung von diesem ersten Moment bis ins Jetzt, und alles, was jemals passiert war, jede geplatzte Möglichkeit und falsch getroffene Entscheidung enthielte in sich einen unerbittlichen Drang zu genau diesem Punkt, der Gegenwart, zu uns.
Schicksal. Die Begründung für alles.
Ich lächelte. »Muss es einen Grund geben?«
»Ja.« Ihre Antwort kam mit so wilder Energie, dass sie außer Frage stand. »Ja, muss es. Sonst ergibt nichts einen Sinn.«
»Nichts was?«
Schweigen. Viel zu lang.
»Madigan?«
Sie stöhnte, ein langgezogenes, zitterndes Geräusch, das mir sofort einen kalten Schauder über den Rücken jagte. Ich hatte plötzlich die feste Überzeugung, dass ich ihre nächsten Worte absolut nicht hören wollte.
Aber es war bereits zu spät.
»Ich bin krank, Lexi«, sagte Madigan. »Das musst du wissen. Genau jetzt, hier mit dir, und morgen und auch am Tag danach. Ich bin krank. Ich sterbe.«
Nein, auf keinen Fall. Es war unmöglich, nicht wenn ihr Körper so warm und nackt und lebendig in meinen Armen lag, ihr Atem so sanft meine Haut streichelte. Absolut unfassbar, und ich musste etwas in dieser Richtung gemurmelt haben, weil sie meine Hand ergriff und sie so fest gegen ihre Brust drückte, dass ich das Klopfen ihres Herzens unter meiner Handfläche spüren konnte.
»Es klingt stark, oder? Als würde es nie aufhören zu schlagen.«
Ich nickte und Furcht stieg wie Galle in mir auf.
»Der Schein kann trügen.«
Und diese spezielle Lüge besaß sogar einen Namen, erklärte sie. Hypertrophe Kardiomyopathie. Ihr verräterisches Herz war in sich schadhaft und schwach, ein unheilbares Vermächtnis von Veranlagung und Zufall – wie die Mutter, so die Tochter, beide stolze Besitzer einer genetischen Zeitbombe. Dieser wichtigste klopfende Muskel war von Geburt an darauf programmiert, jederzeit zum Verräter zu werden, oft ohne Vorwarnung und sicherlich ohne Gnade.
Ein gebrochenes Herz, ohne Heilungschance.
»Meine Mutter hatte einen vorausgehenden Herzinfarkt«, erklärte Madigan. »Nur klein, aber sie haben jede Menge Tests gemacht – natürlich wurden keine Kosten gescheut –, und als sie schließlich entdeckt haben, dass es HCM ist …« Sie schnaubte abfällig. »Natürlich bestand Vater darauf, dass auch Bailey und ich uns sofort testen ließen, als machte es einen Unterschied, es zu wissen. Sie können es nicht heilen, weißt du. Oh, sie können es dir erklären, können dir ihre Resultate vor die Nase halten und dir genau die kleinen Marker zeigen, die bedeuten, dass du, Madigan, sterben wirst, während du, Bailey, weiterleben darfst – aber sie können es nicht heilen. Sie werden es niemals heilen können.«
Wut und Frustration stiegen in Wellen von ihrem Körper auf. Sie zitterte und ich konnte sie nur fester an mich drücken, als könnte ich durch diese Nähe ihren Schmerz, ihre Angst, den ganzen verhedderten Knoten ihrer Krankheit in mich aufnehmen.
»Uns wurde nichts gesagt«, erzählte Madigan weiter. »Nicht bevor Mutter gestorben war.« Vielleicht hatte Katherine nicht gewollt, dass ihre Kinder es wussten, hatte es für besser gehalten, ihre Träume nicht mit der Angst zu vergiften, dass genau diese Träume vielleicht nie stattfinden würden. Also war es erst später, nach der Beerdigung und dem Leichenschmaus, lange nachdem Katherines Verwandte aufgehört hatten, mit ihren Rosenkränzen zu klappern, und gegangen waren, dass ihr Vater sich mit ihnen hingesetzt und ihnen alles erklärt hatte. Madigan, tief erschüttert, war aus dem Haus gerannt und gelaufen, bis ihre Lungen brannten und ihre Knie zitterten und ihr Herz, dieses vertraute Organ, das sie nun fürchtete und hasste, heftig gegen ihre Rippen schlug und drohte, noch in diesem Moment zu zerspringen.
Wie sie ihren Vater da gehasst hatte.
Ihre Krankheit war nur eine Tatsache, aber das Wissen, das er ihr aufgezwungen hatte, wurde zum Fluch.
Und so war sie weitergelaufen, war ständig in Bewegung geblieben, hatte versucht, jede mögliche Erfahrung in die wenige Zeit zu pressen, die ihr vielleicht nur noch blieb. Stillstand war der Feind – denn Stillstand war es, der sie am Ende zu sich holen würde – und ihr Leben nahm schließlich alle Merkmale einer Flucht an.
Rennen, immer Rennen.
Ihrem eigenen Fleisch aber konnte sie nicht entkommen.
Egal, wie weit sie reiste oder wie sehr sie sich bemühte, sich im Leben anderer und dem komplizierten Lauf der Welt zu vergraben, die Wahrheit ihrer eigenen Sterblichkeit folgte ihr auf Schritt und Tritt. Ihr Herz wurde zu einer morbiden Besessenheit und jeder einzelne Schlag markierte einen Moment, den sie nicht mehr leben konnte, einen verlorenen Augenblick.
Rennen, rennen, bis ihr Vater sie schließlich nach Hause gerufen und angedroht hatte, ihr den Geldhahn vollkommen zuzudrehen, wenn sie sich weigerte. Ohne Geld konnte sie nicht mehr reisen; der Gedanke, sich mühsam ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen, selbst in ihrem geliebten Berlin, war ihr ein Gräuel.
So hatte sie sich zurückgeschleppt ins Familienanwesen in Toorak, zurück zu ihrem Vater, der sie in Watte packte und immer aufmerksam beobachtete. Seltsamerweise war ihr die Anpassung daran nicht so schwergefallen, wie sie befürchtet hatte.
»Warum nicht?«, fragte ich. »Ich würde es hassen, so gefangen zu sein.«
»Weil ich mich immer noch bewege«, antwortete sie. »Das ist eine der Sachen, die Berlin mir beigebracht hat: Manchmal geht es nicht darum, wie weit du reist, sondern wie tief du gehst.«
Ich verstand nicht wirklich, was sie damit meinte, aber ich beschloss, nicht weiter in sie zu dringen. Die ganze Nacht war so überwältigend gewesen und mein müdes, biergetränktes Hirn war nicht fähig, alles aufzunehmen – noch weniger, alles zu verstehen –, was Madigan mir erzählt hatte. Morgen früh wäre sicherlich alles anders. Morgen früh … Mein Magen verkrampfte sich. Scheiß auf den Morgen; er könnte niemals kommen.
»Madigan?« Ich streichelte mit dem Handrücken ihre Wange, vorsichtig, als wäre sie etwas Fragiles, das nur zu leicht brechen könnte.
»Ja?«
»Was willst du tun?« Eine allumfassende Frage, mit so vielen Bedeutungen: was willst du mit mir tun, mit uns, mit dem Jetzt, mit morgen …
Sie seufzte, ein erschöpftes, sehnsüchtiges Rauschen.
»Alles, Lexi. Ich will alles tun.«