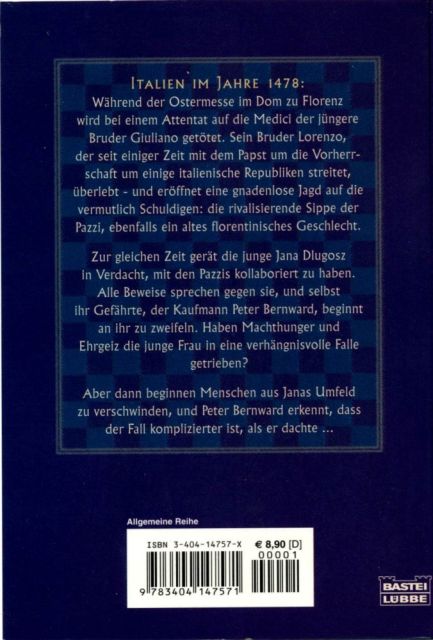Nachwort
D
as Grundgerüst dieses Buches ist, wie bei meinen vorangegangenen Werken, eine verbriefte historische Begebenheit: Diesmal handelt es sich um das Attentat auf Lorenzo und Giuliano de’ Medici zu Ostern des Jahres 1478 in Florenz. Die Verschwörer, vom sechzehnjährigen Kardinal Raffaelle Riario bis zum siebzigjährigen Jacopo de’ Pazzi, sind historische Persönlichkeiten; ebenso wie ihre Opfer aus dem Hause Medici und die mit ihnen verbundenen Menschen. Erfunden habe ich neben den Hauptpersonen Jana Dlugosz und Peter Bernward den Kaufmann Pratini und seine Familie, Janas Geschäftspartner (mit Ausnahme Francesco Noris), Peters Schwiegersohn Johann Kleinschmidt, Stepan Tredittore und Lapo Rucellai.
Selbstverständlich musste ich, um der Dramaturgie eines Romans gerecht zu werden, die historischen Begebenheiten da und dort verändern; dabei habe ich hauptsächlich die Hintergründe der Verschwörung ein wenig vereinfacht. Tatsächlich ist es so, dass die Florentiner signoria die Ernennung Francesco Salviatis zum Bischof von Florenz ablehnte, ein altes Recht, das die Stadt bereits im vierzehnten Jahrhundert dem Heiligen Stuhl abgenötigt hatte, und dass Salviati seit dieser Zeit feindschaftliche Gefühle für die Stadt und ihre Bewohner hegte. Es stimmt, dass Lorenzo de’ Medici die Versuche des Papstes, seinem Nepoten Girolamo Riario das Herzogtum Imola zuzuschanzen, zu durchkreuzen versuchte und Sixtus den Medici deshalb aus Rache die Finanzverwaltung des Vatikan entzog. Die Feindschaft der Pazzi, einer alten, aber erst vor zwei Generationen zu Geld gekommenen Adelsfamilie zu den aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden Medici habe ich ein wenig übertrieben. In Wahrheit weiß man von der ursprünglichen Weigerung Jacopo de’ Pazzis, bei diesem Mordkomplott mitzuwirken, und er gab erst auf das Drängen Franceschino de’ Pazzis nach. Im Großen und Ganzen darf man annehmen, dass die Motive und Beweggründe für die Verschwörung und die in ihrem Verlauf geplanten Morde vielschichtiger, komplizierter und vor allem schwerer darstellbar sind, als ich es getan habe – und dass die Mitwisserschaft des Papstes weit weniger eindeutig beweisbar ist.
Die Handlungen der Florentiner, der Rückhalt, den Lorenzo de’ Medici fand, die gnadenlose Jagd auf die Verschwörer und vor allem das Scheitern des Aufstands habe ich jedoch exakt so wiedergegeben, wie ich sie in verschiedenen Quellen gefunden habe. Dies gilt auch für die Schicksale, welche die gescheiterten Verschwörer ereilten.
Es ist zu lesen, dass der Lynchjustiz gleich nach dem Mord im Dom knapp hundert Menschen zum Opfer fielen. Die meisten davon dürften aus dem Tross Bischof Salviatis gewesen sein. Salviati besaß die ungeheure Dummheit (oder Arroganz), ohne Kunde vom tatsächlichen Gelingen des Mordanschlags in den Palazzo della Signoria (heute Palazzo Vecchio) zu spazieren und einfach vorauszusetzen, dass seine Pläne aufgegangen waren. Gonfaloniere Petrucci ließ ihn und seine Helfer nach kurzem Prozess am Nordfenster des Palazzo aufknüpfen. Die Mitglieder seines Trosses warf man einfach aus dem Fenster des Saales, in dem man sie eingesperrt hatte, auf den Platz hinaus; wo sie von den wütenden Medici-Anhängern in Stücke gerissen wurden. Wer vermag aber zu sagen, ob es daneben nicht auch Szenen gab wie die vor der Mutter-Gottes-Ikone, die ich erfunden habe, und Schicksale wie die des Bieco Alepri oder des Benozzo Cerchi?
Der historischen Wahrheit entspricht auch die Hinrichtung der Giftmörderin in Prato – wenngleich dieses Ereignis nichts mit dem Aufstand gegen Lorenzo de’ Medici zu tun hatte und zu einer ganz anderen Zeit passiert ist.
Was ich im Roman nicht erwähnt habe, aber als geschichtliche Kuriosität nicht im Dunkel bleiben sollte, ist die Tatsache, dass der berühmte Maler Sandro Botticelli den Auftrag erhielt, die gehängten Verschwörer als Fresko an der Außenwand des Palazzo della Signoria zu verewigen, nachdem ihre Körper verwest waren. Dieses Fresko blieb bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein erhalten. Der Leichnam von Bernardo Bandini, dem eigentlichen Mörder Giuliano de’ Medicis, beschäftigte ebenfalls einen bekannten Künstler der Renaissance: Nachdem Bandini Monate nach der Verschwörung in Istanbul gefangen genommen und nach Florenz zurückgeschickt worden war, wo man ihn dem Strick überantwortete, zeichnete Leonardo da Vinci eine bis heute erhaltene Porträtskizze auf ein Stück Pergament.
Das moralische Dilemma eines erfolgreichen Kaufmanns am Anfang der Renaissance, das ich am Beispiel Antonio Pratinis geschildert habe, mag uns heutigen Menschen ein wenig fremd erscheinen, war aber ungeachtet dessen eine der Haupttriebfedern aller Schenkungen, Stiftungen und sozialen Einrichtungen, die aus bürgerlichem Wohlstand genährt wurden. Vielleicht lassen sich die Sammlungen »für einen guten Zweck«, die heute von vielen Prominenten veranstaltet werden, damit vergleichen. Der Unterschied ist nur, dass die Prominenz des ausgehenden Quattrocento in Florenz ihr eigenes Geld für diesen guten Zweck gab, anstatt welches von ihren Bewunderern einzukassieren.
Möglicherweise habe ich Papst Sixtus IV. ein wenig Unrecht getan, indem ich ihn als geldgieriges, rachsüchtiges Ungeheuer hingestellt habe, das vor Mordanschlägen während der heiligen Messe keinesfalls zurückschreckt, um seine Ziele zu erreichen. Andererseits ist dies genau die Charakterisierung, die viele seiner Zeitgenossen, aber auch Historiker von ihm zeichnen. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Francesco della Rovere bis zum siebenundfünfzigsten Lebensjahr den untadeligsten Lebenswandel führte, den man sich denken kann, und erst mit dem Besteigen des Heiligen Stuhls der machtbesessene Gewaltmensch wurde, als der er der Nachwelt überliefert ist. Wie sagt Ferdinand Boehl zu Peter Bernward: Geh ein Jahr mit einem Krüppel, und du wirst selbst hinken. Der Mensch ist stets auch ein Produkt seiner Umwelt, und Kardinal della Rovere mag genügend Gründe oder Ausreden gefunden haben, ab sofort nur noch das Wohlergehen seiner Familie ins Auge zu fassen, sobald er sich die Verhältnisse im Vatikan des ausgehenden fünfzehnten Jahrhunderts genauer angesehen hatte.
Im Übrigen gelang es keiner politischen Intrige und keiner offenen oder versteckten Gewalt, die fünfzigjährige Herrschaft einer Familie über die Republik Florenz zu brechen. Dazu bedurfte es des Fanatismus eines Mönches, der seinerseits ein gottesfürchtiges Schreckensregime errichten sollte, und der Dummheit von Piero de’ Medici, der weder die Intelligenz noch die Güte noch die Menschenfreundlichkeit seines großartigen Vaters Lorenzo geerbt hatte. Doch das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Nachdem die Geschichte nun zu Ende ist, möchte ich auch das Bedürfnis nicht länger unterdrücken, mich zu bedanken.
Ein Roman, besonders ein historischer, ist niemals das Werk des Autors allein. Deshalb danke ich in erster Linie meiner Frau Michaela, die trotz eines Umzugs, trotz vielerlei Verpflichtungen und vor allem trotz des wunderbaren Umstands, dass während des Entstehens dieses Buches unser Sohn Mario in unser Leben trat, nicht müde wurde, mich darauf hinzuweisen, dass ich noch ein paar Seiten zu schreiben habe – und furchtlos alle diejenigen verwarf, die unserem gemeinsamen Anspruch an Qualität nicht gewachsen waren.
Ich habe mich bei der Recherche zu Hause verschiedenster Quellen bedient; meine hauptsächlichen Ratgeber waren Gene Brucker, Robert Davidsohn, James Cleugh und Gloria Fossi, die mit ihren teilweise bahnbrechenden Werken über Florenz und die Medici für den geschichtlichen Hintergrund des Romans unentbehrlich waren. Die tiefe Einsicht von Will Durant in die kulturelle Entwicklung der Menschheit während ihrer vielen Epochen war mir bei diesem wie bei all meinen anderen historischen Romanen ein willkommener Begleiter.
Für die unbürokratische Hilfe während unserer Recherchen in Florenz danke ich Signora Alba Antuono von der Biblioteca Comunale Centrale, die mir nicht nur das Stöbern in alten Büchern, sondern auch den Zutritt zu einem seit Jahren geschlossenen Archiv über die Stadtgeschichte von Florenz ermöglichte. Tante grazie, signora Antuono. Ich habe die verstaubten Tickets für dieses Archiv gerne bezahlt.
Meinem Freund Rudi Heilmeier und seiner Familie danke ich für die Begeisterung für meine Arbeit, die vielen Gespräche und gegenseitigen kulinarischen Einladungen sowie für die zahllosen E-Mails, in denen meine Latein- und Italienisch-Kenntnisse geschärft wurden. In vielen Telefonaten erwies sich mein Bruder Joe als Kraftquelle, wenn ich mich beruflich zu ausgelaugt fühlte, um weiterzuschreiben. Mike und Michele Schenker waren mir mit ihrer unkomplizierten Ehrlichkeit nicht nur gute Freunde, sondern auch wertvolle und willkommene Kritiker.
Heike Mayer danke ich dafür, mich bei der Entwicklung der Idee zu diesem Roman begleitet zu haben; Sabine Jaenicke, dass sie es mit ihrer fröhlichen, direkten und sorgfältigen Art möglich machte, die Idee in eine erzählende Geschichte umzusetzen. Ihnen und ihren Kolleginnen und Kollegen von nymphenburger Verlag danke ich außerdem für die gewohnt freundliche und kreative Unterstützung.
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, danke ich nicht zuletzt dafür, dass Sie sich für meine Bücher interessieren. Ohne Sie würde es keinen großen Sinn machen, sie zu schreiben.