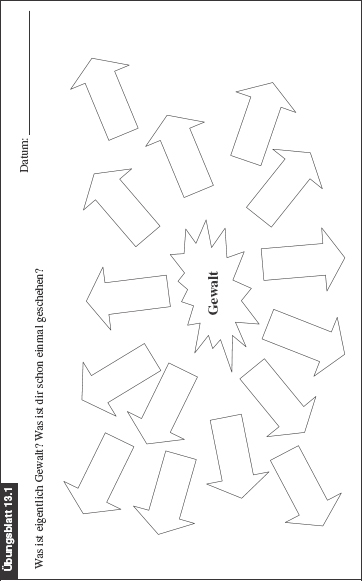13 Wie kann ich die Persönlichkeit meines Kindes stärken?
„Eines Tages brachte mein großer Bruder einen Freund mit nach Hause. Ich war 12, er war 19 und in der Abschlussklasse. Ich fand ihn toll. Er führte mich sogar aus. Er kaufte mir ein Eis. Endlich jemand, der sich für mich interessierte. Er sagte, er wolle mein Freund sein. Das Knutschen fand ich auch schön. Dann wollte er mit mir schlafen. Ich wollte eigentlich nicht. Er sagte, es müsse aber so sein. Er sei mein Freund. Wenn ich nicht mit ihm schlafen würde, würde er sich eine andere Freundin suchen. Es tat sehr, sehr weh und ich weinte. Er wurde böse mit mir. Er schlief noch ein paar Mal mit mir. Weil ich aber ständig weinte, hörte er auf. Er traf sich lieber mit einem anderen Mädchen. Ich war froh, dass er nicht mehr mit mir schlief. Aber ich war auch sehr traurig. Ich war nichts Besonderes mehr.“
„Als ich kleiner war, war ich recht pummelig. Ich war auch nicht hübsch. Klug war ich wohl auch nicht. Jedenfalls hörte ich das häufig genug. Als der Freund meiner Mutter begann, mich zu betatschen, sagte er mir, dass ich froh sein sollte, dass sich überhaupt jemand mit mir abgibt.“
Was sollten Sie wissen?
Sinnvolle Prävention vor sexuellem Missbrauch kann sich niemals nur auf punktuelle Warnungen („Steige niemals zu Fremden ins Auto!“) beschränken. Es ist eine kontinuierlich wirkende Erziehungshaltung. Unsere Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, heißt vor allem, sie zu stärken. Kinder, die in ihrer Persönlichkeit gestärkt wurden, einen hohen Selbstwert entwickeln konnten und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung (Erwartung, die gesetzten Ziele zu erreichen) mit sich bringen, unterliegen einem geringeren Risiko, sexuell missbraucht zu werden.
Kinder, die aus Familien mit einem positiven Familienklima stammen, haben vermutlich klare innere Grenzen kennengelernt. Sie konnten sich auf ihre Eltern verlassen und wussten, welches ihre Rolle und ihre Aufgabe waren. Die Grenzen zur Umwelt außerhalb ihrer Familie waren zwar klar, aber zugleich auch durchlässig, so dass sie Freunde haben konnten. Sie haben vermutlich kleinere Aufgaben zugewiesen bekommen, die ihren Fähigkeiten entsprachen und die sie meistern konnten. Aus diesem Grund konnten sie eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln. Kinder mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung haben den Eindruck hoher Kontrolle. Sie haben den Eindruck, gesetzte Ziele durch eigene Fähigkeiten erreichen zu können. Hieraus entsteht ein hoher Selbstwert. Mit zunehmendem Alter werden Bestätigungsmöglichkeiten, z. B. Hobbys und bestimmte Fertigkeiten wichtiger. Diese im Verein auszuüben, kann für ein Kind enorm wichtig sein. Ein guter Selbstwert versetzt ein Kind überhaupt erst in die Lage, für die eigenen Rechte einzustehen und sich gegen Unrecht zu wehren. Ein Kind, welches immer wieder negative Attribute zu hören bekommt („Moppelchen“, „Du bist dick.“, „Du bist dumm.“, „Du bist hässlich.“), wird angreifbar.
In engem Zusammenhang zu hoher Selbstwirksamkeit steht auch ein hohes Vertrauen darin, Probleme lösen zu können. Statt sich bei jedem Problem der Hilfe anderer zu versichern, ist ein Kind idealerweise in der Lage, in Stresssituationen Probleme auch selbstständig zu lösen. Dies setzt aktives Verhalten voraus. Passiv-abwartendes Verhalten löst keine Probleme. Dies heißt jedoch nicht, dass das Kind keinerlei Hilfe in Anspruch nehmen würde, wenn es diese braucht. Im Gegenteil, aktives Problemlösen kann auch heißen, aktiv Hilfe zu suchen und angebotene Hilfe zu nutzen. Die Fähigkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, gilt ebenfalls als Schutzfaktor gegen sexuellen Missbrauch.
Hat ein Kind hohe soziale Fertigkeiten und hat es den Umgang mit anderen Menschen gelernt und konnte es Freunde gewinnen, dann hat es vermutlich eine gute Fähigkeit sich durchzusetzen und wird mit geringer Wahrscheinlichkeit sexuell missbraucht. Eine mindestens durchschnittliche Intelligenz und gute Schulleistungen gehören ebenfalls zu den Schutzfaktoren.
Welche Übungen können Sie einsetzen?
Jede Übung setzt andere Akzente. Zu den wichtigen Übungen gehören 13.1 und 13.3.
13.1 Wie kann ich den Selbstwert meines Kindes stärken?
Einzelne Übungen werden nicht in der Lage sein, die grundlegende Erziehungshaltung zu ersetzen, die notwendig ist, um unseren Kindern Selbstwert zu vermitteln. In diesem Absatz möchten wir Ihnen Anregungen geben, die dazu beitragen können, den Selbstwert und die Selbstwirksamkeitserwartung (Erwartung, die gesetzten Ziele zu erreichen) Ihres Kindes zu steigern.
- Ein Schutzfaktor für sexuellen Missbrauch sind spezielle Talente und Interesse an Hobbys. Beides hängt eng mit dem Selbstwert zusammen. Hat ein Kind besondere Talente oder ein hohes Interesse an seinem Hobby, so kann es hierüber seinen Selbstwert definieren. Besondere Talente sollten gefördert werden. Jedes Kind wird ein Interesse an einem Hobby haben. Auch dieses sollte unterstützt werden.
- Zur Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung geben Sie Ihrem Kind „mittelschwere“ Aufgaben. Dies sind Aufgaben, die es herausfordern, zur gleichen Zeit jedoch nicht überfordern. Wenn Ihr Kind Interesse zeigt, Ihnen z. B. beim Kochen zur Hand zu gehen, dann ist dies eine sehr gute Möglichkeit, Ihrem Helfer entsprechende Aufgaben zu übertragen. Immer sehr leichte Aufgaben (z. B. „Bring mir den Topf.“) sind keine Herausforderung und reduzieren die Motivation des Helfens. Aber auch überfordernde Aufgaben sind nicht hilfreich. Mit mittelschweren Aufgaben kann Ihr Kind hingegen die Erfahrung machen, dass es auch „schwerere“ Aufgaben alleine bewältigen kann.
- Wenn Ihr Kind sich vorgenommen hat, ein Ziel zu erreichen und beim ersten Anlauf scheitert, ermutigen Sie es zu einem zweiten oder dritten Versuch! Erst dann bieten Sie Ihre Hilfe an.
- Auch das Vertrauen der Eltern in die Fähigkeit des Kindes, Probleme selbst zu lösen, ist ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen. Bleiben die Eltern im Hintergrund, unterstützen sie ihr Kind, indem sie mit ihm zu Hause üben, zeigen sie ihr Vertrauen in das Kind, das Problem zu lösen. Die Schwierigkeit dürfte sein, abzuschätzen, welches Problem von Ihrem Kind lösbar ist. Auch Ihr Kind wird es nicht immer einschätzen können. Wenn jemand die Fähigkeiten Ihres Kindes einschätzen kann, dann sind Sie es. Sie können auch die Einschätzung eines Lehrers zu Rate ziehen.
13.2 Hat mein Kind schon Gewalt erfahren müssen?
Ähnlich wie frühere Gewalterfahrungen Sie und Ihr Leben prägen, so können Gewalterfahrungen auch Ihr Kind prägen.
Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, was Gewalt ist (Übungsblatt 13.1, vgl. Seite 104). Hierzu lassen Sie Ihr Kind (oder alle Ihre Kinder) Beispiele für verschiedene Arten von Gewalt sammeln (z. B. Ohrfeige, Schimpfworte, lächerlich machen, Bein stellen, anfassen). Der nächste Schritt wäre zu überlegen, ob und wann Ihr Kind solch eine Gewalt erlebt hat oder anderen Kindern gegenüber gewalttätig wurde. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Gewalterfahrung:
- Gibt es Gewalt, die „o. k.“ ist?
- Wie fühlt sich es an, Gewalt zu erleben?
- Wie fühlt es sich an, Gewalt auszuüben?
Überprüfen Sie für sich selbst: Von welchen Gewalterfahrungen Ihrer Kinder wussten Sie, von welchen nicht?
Sie können vorsichtig nachfragen, warum Sie bislang von manchen Gewalterfahrungen nichts erfahren haben. Diese Fragen sollten keinesfalls von Ihrem Kind als Vorwurf verstanden werden. Sie können jedoch helfen, Interesse am Leben und an den Erfahrungen Ihres Kindes auszudrücken.
Die Fähigkeit, schwere Fragen („Das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du, warum du es mir nicht erzählt hast?“) zu beantworten, wird auch vom Entwicklungsstand des Kindes abhängen. Falls Ihr Kind die Frage nicht beantworten kann, dann wird es die Erfahrung gemacht haben, dass sie gerne wissen würden, wenn jemand „gemein“ zu ihm war.
Ziel dieser Übung ist es, die Sinne ihres Kindes für Grenzüberschreitungen zu schärfen. Wann erlebt es wo im Alltag Grenzüberschreitungen. Sind diese in Ordnung? Gelingt es Ihnen, Interesse und Hilfsbereitschaft auszudrücken, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Kind bei erneuter Gewalterfahrung mit Ihnen spricht.
13.3 Wie lernt mein Kind, Probleme zu lösen?
Probleme selbstständig angehen und lösen zu können, sind wichtige Fähigkeiten, die einem Kind oder Jugendlichen in Krisensituationen weiterhelfen können. Im klassischen Problemlösetraining der Verhaltenstherapie nach D´Zurilla und Goldfried (1971) werden fünf Stufen unterschieden:
- Allgemeine Problemorientierung: Was ist das Problem? In welchem Zusammenhang tritt das Problem auf?
- Beschreiben des Problems: Was genau ist das Problem? Definiere!
- Erstellen von Alternativen: Es wird ein Brainstorming durchgeführt. Ohne Einschränkung oder Begrenzungen dürfen die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten gesammelt werden.
- Treffen einer Entscheidung: Aus allen möglichen Lösungsansätzen wird der passendste herausgesucht.
- Anwendung und Überprüfung: Die gewählte Strategie wird angewendet. Es wird überprüft, ob das gewünschte Ziel erreicht wurde. Wurde das Ziel nicht erreicht, so soll überprüft werden, ob das Problem korrekt beschrieben wurde. Die weiteren Schritte werden erneut durchgeführt.
Dieses sehr strukturierte Vorgehen kann mit Kindern geübt werden (Übungsblatt 13.2, vgl. Seite 105). Während die ersten Durchgänge eher langwieriger sein können, wird sich der Ablauf mit genügend Übung automatisieren.
13.4 Wie können die sozialen Fertigkeiten meines Kindes gestärkt werden?
Spätestens im Kindergarten sind Kinder mit anderen Gleichaltrigen konfrontiert und müssen lernen, mit diesen zurechtzukommen. Sind sie allerdings schon früher im Kontakt mit anderen Kindern, so können sie lernen, nebeneinander und miteinander zu kooperieren. Nimmt ein 15 Monate alter Junge einem 16 Monate alten Mädchen im Sandkasten die Schaufel aus der Hand und quietscht diese entrüstet auf, so war dies eine soziale Interaktion. Auch in diesem Alter lernen Kinder angemessen miteinander umzugehen. Eltern stellen bereits hier Weichen. Die Begleitpersonen können das Verhalten des Jungen tolerieren und erwarten, dass das Mädchen sich wehrt, oder sie können einschreiten.
Schreiten die Eltern des Mädchens in dieser Situation, wie auch in allen anderen ähnlichen Situationen, ein, so wird sie nicht lernen, für sich einzustehen. Vielmehr wird sie vermutlich lernen, bei Problemen mit Gleichaltrigen, aufzuschreien und sich klagend und hilfesuchend an Ihre Eltern zu wenden. Das andere Extrem, sich nie einzumischen, wird vermutlich ebenfalls ungewünschte Folgen haben. Das Mädchen würde lernen, dass sie in Situationen, in denen ihr Unrecht zugefügt wird, immer alleine dasteht und keine Hilfe erhält. Zwei mögliche (extreme) Reaktionen sind denkbar: (a) Sie erwartet, dass ihr nichts zusteht. Sie zieht sich in der Folge zurück. (b) Sie erwartet, dass ihr nichts geschenkt wird und sie sich alles erkämpfen muss. Sie wird im Laufe ihres Lebens um jede Kleinigkeit, die sie sich wünscht, erbittert kämpfen.
Die Welt ist selten so schwarz-weiß, wie hier an dem Beispiel verdeutlicht. Ideal ist eine gesunde Balance. In Situationen, in denen Eltern merken, dass ihre Kinder überfordert sind und ihre sozialen Fertigkeiten nicht ausreichen (z. B. Mobbing), sollten sie ihren Kindern beistehen. Haben sie aber den Eindruck, dass ihre Kinder in der Lage sind, Probleme selbstständig zu lösen, sollten sie ihnen auch diese Gelegenheit geben.
Handwerkszeug kann den Kindern mit auf den Weg gegeben werden. Im sicheren, häuslichen Umfeld können bevorstehende schwierige Gespräche geübt werden. Weiß das Kind, dass es sich beispielsweise am nächsten Tag mit einem Lehrer oder einem Klassenkameraden auseinandersetzen muss, so kann
a) gemeinsam überlegt werden, wie es sein Anliegen formulieren kann.
b) im Rollenspiel das Überlegte geübt werden. Beispielsweise kann ein Elternteil die Rolle des Lehrers/Klassenkameraden übernehmen. Der Jugendliche versucht, sein Anliegen „an den Mann zu bringen.“
c) vor dem Spiegel die eigene Rede geübt werden.
Datum: _____________________
1. Bitte beschreibe dein Problem – mit allen wichtigen Informationen!
2. Fasse dein Problem in einen Satz!
3. Brainstorming: Wie verrückt auch immer – schreibe alle möglichen Lösungen auf!
4. Suche nun die beste Lösung aus!
5. Probiere sie aus!
Hat es geklappt?
Wenn nein: Starte bei (2) eine neue Runde.
Wenn ja: Herzlichen Glückwunsch!