TEIL VIER
Die Welt der Einfältigen
Einleitung
Als ich vor einigen Jahren mit Retardierten zu arbeiten begann, dachte ich, daß mich das bedrücken würde, und teilte Lurija meine Befürchtung in einem Brief mit. Zu meiner Überraschung widersprach er mir entschieden. Diese Patienten, schrieb er, seien ihm alles in allem mehr «ans Herz gewachsen» als alle anderen, und seine Jahre am Institut für Hirndefekte hätten zu den bewegendsten und interessantesten seiner ganzen beruflichen Laufbahn gezählt. Im Vorwort zu seiner ersten klinischen Biographie (Die Funktion der Sprache in der geistigen Entwicklung des Kindes» bringt er einen ähnlichen Gedanken zum Ausdruck: «Wenn es einem Autor gestattet ist, die Gefühle zu äußern, die er bei seiner Arbeit empfindet, so muß ich bemerken, daß ich stets mit Wärme an die Erfahrungen zurückdenke, die in diesem Büchlein ihren Niederschlag gefunden haben. »
Was ist diese «Wärme», von der Lurija spricht? Sie ist offenbar der Ausdruck von etwas Emotionalem und Persönlichem, das nicht da wäre, wenn die geistig Behinderten nicht «reagiert» hätten, wenn sie nicht ihrerseits, worin auch immer ihre (intellektuelle) Behinderung bestand, über sehr reale Empfindungen, über emotionale und persönliche Potentiale verfügt hätten. Aber es schwingt noch mehr darin mit: Lurijas Bemerkung bringt ein wissenschaftliches Interesse an etwas zum Ausdruck, das er eines ganz besonderen wissenschaftlichen Interesses für wert hielt. Was könnte das sein? Gewiß etwas anderes als «Behinderungen» oder «Defekte» -
Dinge, die an sich nur von beschränktem Interesse sind. Was also ist es, das die Einfältigen so besonders interessant macht? Es hat etwas zu tun mit geistigen Fähigkeiten, die erhalten bleiben, ja sogar verstärkt werden, so daß diese Menschen, obwohl sie in gewisser Weise «geistig behindert» sind, in anderem Sinne geistig interessant, ja sogar vollkommen sein mögen. Es handelt sich hierbei um geistige Qualitäten, die sich vom Konzeptuellen unterscheiden - dies läßt sich besonders gut am Geist der Einfältigen erforschen, wie übrigens auch am Geist von Kindern und «Primitiven». Dabei ist, wie Clifford Geertz wiederholt betont hat, zu beachten, daß diese Gruppen nicht miteinander gleichzusetzen sind: «Primitive» sind weder einfältig noch Kinder, Kinder haben keine primitive Kultur, und Einfältige sind weder Kinder noch primitiv. Und doch bestehen zwischen ihnen wichtige Verbindungen, und alles, was Piaget an Erkenntnissen über das Denken von Kindern und Levi-Strauss über das «Denken der Primitiven» gesammelt haben, findet sich, in veränderter Form, wieder, wenn wir das Denken und die Welt der Einfältigen erforschen.[20]
Die Beschäftigung mit diesem Thema ist für das Herz ebenso befriedigend wie für den Verstand. Sie hat Lurija ganz wesentlich zu seiner «romantischen Wissenschaft» angeregt.
Was also ist diese geistige Eigenschaft, diese Disposition, die die Einfältigen kennzeichnet und ihnen jene rührende Unschuld, Transparenz, Vollständigkeit und Würde verleiht - eine Eigenschaft, die so charakteristisch ist, daß wir von einer «Welt» der Einfältigen sprechen müssen (so wie wir von der «Welt» der Kinder oder der Primitiven sprechen)?
Wenn wir diese Eigenschaft mit einem einzigen Wort umreißen wollten, so müßte dieses Wort «Konkretheit» lauten - ihre Welt ist bunt, vielfältig und intensiv, und zwar gerade, weil sie konkret ist; sie ist weder kompliziert noch gedämpft, noch durch Abstraktion vereinheitlicht.
Durch eine Art Umkehrung oder Umsturz der natürlichen Ordnung der Dinge wird Konkretheit von Neurologen oft als etwas Armseliges, Zusammenhangloses, Zurückgebliebenes betrachtet, das einer weiteren Beachtung nicht wert ist. So liegt für Kurt Goldstein, den größten Systematiker seiner Generation, die Domäne des Geistes, auf den der Mensch ja so stolz ist, ausschließlich im Abstrakten und Kategoriellen, und jede wie auch immer geartete Hirnverletzung führt seiner Überzeugung nach dazu, daß der Betreffende aus diesen luftigen Höhen in den unterhalb des Menschlichen liegenden Sumpf des Konkreten hinab gestoßen wird. Wenn jemand die «abstraktkategorielle Geisteshaltung» (Goldstein) oder die «propositionale Denkfähigkeit» (Hughlings Jackson) verliert, so ist das, was von ihm übrig bleibt, eines Menschen nicht würdig und somit von keinerlei Bedeutung oder Interesse.
Ich bezeichne dies als Umkehrung, weil das Konkrete etwas Elementares ist, weil es das ist, was die Realität «real», lebendig, persönlich und bedeutsam macht. Dies alles geht verloren, wenn sich das Verständnis für das Konkrete verliert - wie wir am Fall des fast außerirdisch wirkenden Dr. P. gesehen haben, jenes Mannes, der seine Frau mit einem Hut verwechselte und der (im Gegensatz zu Goldsteins These) vom Konkreten ins Abstrakte gefallen war.
Viel einfacher zu verstehen und insgesamt natürlicher ist der Gedanke der Bewahrung des Konkreten bei einer Gehirnschädigung - nicht Regression zum Konkreten, sondern Erhaltung des Konkreten, so daß das Eigentliche der Persönlichkeit, der Identität und des Mensch-Seins, das Wesen des Betroffenen bewahrt bleibt.
Dies ist es, was wir an Sasetzkij, dem «Mann, dessen Welt in Scherben fiel», beobachten können: Trotz der Zerstörung seiner propositionalen und abstrakten Denkfähigkeit bleibt er in seinem Wesen ein Mensch und behält die ganze moralische Bedeutung, die ganze reiche Vorstellungswelt, die dem Menschen eigen ist. Lurija scheint Hughlings Jacksons und Goldsteins Ansichten zu stützen, kehrt jedoch gleichzeitig ihren
Sinn um. Sasetzkij ist nicht der blasse Abklatsch eines Menschen, wie Hughlings Jackson und Goldstein glaubten, sondern eine vollwertige Person, deren Gefühlsempfindung und Vorstellungsvermögen vollständig erhalten, ja vielleicht sogar gesteigert ist. Der Titel des Buches ist irreführend: Seine Welt ist nicht «in Scherben gefallen» - es fehlt ihr zwar an Abstraktionen, die sie zusammenhalten, aber er erfährt sie als eine außerordentlich reiche, tiefe und konkrete Realität.
Ich glaube, daß all dies auch für die Welt der Einfältigen gilt um so mehr, als sie, für die die Welt nie anders war, das Abstrakte nicht kennen und nie durch es verführt worden sind, sondern die Realität immer direkt und unmittelbar mit einer elementaren und zuweilen überwältigenden Intensität erfahren haben.
Wir stehen hier an der Schwelle zu einem Reich der Faszination und der Paradoxa, dessen Mittelpunkt die Vieldeutigkeit des «Konkreten» bildet. Als Ärzte, Therapeuten, Lehrer und Wissenschaftler sind wir aufgefordert, ja geradezu gezwungen, das Konkrete zu erforschen. Eben dies ist Lurijas «romantische Wissenschaft», und seine beiden großen klinischen Biographien oder «Romane» können als eine Erforschung des Konkreten aufgefaßt werden: Im Fall des hirngeschädigten Sasetzkij geht es um die Erhaltung des Konkreten im Dienst der Realität und im Fall des Mnemonikers mit seinem «Superhirn» um die Übersteigerung des Konkreten auf Kosten der Realität.
Die klassische Wissenschaft hat für das Konkrete keine Verwendung - in der Neurologie und Psychiatrie wird es gleich gesetzt mit dem Trivialen. Eine «romantische Wissenschaft» ist erforderlich, um ihm gerecht zu werden und seine außerordentlichen Kräfte - und Gefahren - zu würdigen. Im Umgang mit Einfältigen haben wir es mit dem Konkreten in seiner reinsten, unverfälschtesten Form zu tun, hier sind wir mit einer durch nichts eingeschränkten Intensität konfrontiert.
Das Konkrete kann Türen aufstoßen oder verschließen. Es kann das Tor zu Sensibilität, Phantasie und Tiefe sein. Es kann aber auch denjenigen, der das Konkrete beherrscht (oder von ihm beherrscht wird), in einem Netz belangloser Einzelheiten gefangen halten. Bei den Einfältigen sehen wir diese beiden Möglichkeiten gewissermaßen verstärkt.
Eine Verstärkung der konkreten Einbildungs- und Erinnerungsfähigkeit, dieser natürliche Ausgleich für mangelndes begriffliches und abstraktes Denkvermögen, kann leicht in eine zwanghafte Beschäftigung mit Einzelheiten, in die Entwicklung eidetischer Vorstellungs- und Erinnerungswelten und die Ausformung einer Schausteller- oder «Wunderkind» Mentalität umschlagen (wie es bei Lurijas Mnemoniker und, in vergangenen Zeiten, durch die Überkultivierung der auf das Konkrete bezogenen «Kunst der Erinnerung» [21] geschah). Eine solche Tendenz besteht bei Martin A. (Kapitel 22), bei Jose (Kapitel 24) und ganz besonders bei den Zwillingen (Kapitel 23), und sie wird, vor allem bei den Zwillingen, durch die Anforderungen der öffentlichen Auftritte sowie durch ihre eigene Zwanghaftigkeit und ihren Exhibitionismus noch verstärkt.
Aber von weit größerem Interesse und weit menschlicher, bewegender, «realer» ist die richtige Anwendung und Entwicklung des Konkreten - und obwohl diese Tatsache den Eltern und einfühlsamen Lehrern sogleich ins Auge fällt, findet sie in wissenschaftlichen Studien, die sich mit Einfältigen beschäftigen, kaum Beachtung.
Das Konkrete kann ebensogut Einsichten in das Geheimnis volle, Schöne und Tiefe vermitteln, es kann ebensogut das Tor zum Reich der Gefühle, der Phantasie, des Geistes öffnen wie irgendein abstraktes Konzept, ja vielleicht sogar noch besser als abstrakte Konzepte, wie Gershom Scholem (1960) in seiner Gegenüberstellung des Begrifflichen und des Symbolischen oder wie Jerome Bruner (1984) in seiner Gegenüberstellung des «Paradigmatischen» und des «Narrativen» argumentiert hat. Das Konkrete läßt sich bereitwillig mit Gefühlen und Bedeutungen erfüllen bereitwilliger vielleicht als jedes abstrakte Konzept. Es öffnet sich für das Ästhetische, das Dramatische, das Komische, das Symbolische, für die ganze weite Welt der Kunst und des Geistes. Vom Standpunkt des Begrifflichen aus betrachtet mögen geistig Behinderte also Krüppel sein - aber was ihre Fähigkeit betrifft, Konkretes und Symbolisches zu erfassen, können sie jedem «normalen» Menschen ganz und gar ebenbürtig sein. Niemand hat dies klarer ausgedrückt als Kierkegaard, als er auf dem Totenbett schrieb (ich zitiere seine Worte leicht abgeändert): «Ihr einfachen Menschen! Die Symbolik der Heiligen Schrift ist etwas unendlich Hohes ... aber sie ist nicht (hoch› in dem Sinne, daß sie etwas mit intellektueller Erhöhung oder mit den intellektuellen Unterschieden zwischen den Menschen zu tun hat... Nein, sie ist für alle da... Jeder kann diese unendlichen Höhen erklimmen. »
Ein Mensch mag intellektuell sehr «tief» stehen, er mag unfähig sein, eine Tür aufzuschließen, noch unfähiger, die Newtonschen Gesetze der Mechanik zu verstehen, und vollends unfähig, die Welt als Anordnung von Konzepten zu begreifen - und doch mag er durchaus die Gabe besitzen, die Welt als Konkretheit, als Anordnung von Symbolen zu erfassen. Dies ist die andere Seite, die fast sublime andere Seite solcher einzigartigen Menschen, solcher begnadeten Einfaltspinsel wie Martin, Jose und die Zwillinge.
Man mag einwenden, sie seien Ausnahmefälle und untypisch. Darum beginne ich diesen letzten Teil meines Buches mit Rebecca, einer gänzlich «unscheinbaren», einfältigen jungen Frau, mit der ich vor zwölf Jahren zusammentraf. Ich denke mit Wärme an sie zurück.
21
Rebecca
Als Rebecca in unsere Klinik gebracht wurde, war sie kein Kind mehr. Sie war neunzehn Jahre alt, aber - wie ihre Großmutter erklärte- «in mancher Beziehung wie ein Kind». Wenn sie allein auf die Straße ging, verlief sie sich sofort, und sie war nicht in der Lage, auf Anhieb eine Tür aufzuschließen, weil sie nicht «sah» und auch nie zu begreifen schien, in welche Richtung sie den Schlüssel drehen mußte. Sie konnte links und rechts nicht unterscheiden und zog ihre Kleider manchmal, offenbar ohne es zu merken, verkehrt an- «links rum» oder mit dem Rückenteil nach vorn. Und wenn sie es doch einmal bemerkte, wußte sie nicht, wie sie den Fehler korrigieren sollte. Sie konnte Stunden mit dem Versuch zubringen, einen linken Schuh oder Handschuh am rechten Fuß oder an der rechten Hand anzuziehen. Ihre Großmutter sagte, sie scheine «kein Raumgefühl» zu haben. Alle ihre Bewegungen waren unbeholfen und schlecht koordiniert- sie war, wie es in einem Bericht hieß, «ein Tölpel», und in einem anderen stand, sie sei «motorisch debil» (obwohl ihre Unbeholfenheit verschwand, sobald sie tanzte).
Rebeccas Gaumen war teilweise gespalten, wodurch sich ihre Worte mit Pfeifgeräuschen vermischten; sie hatte kurze, dicke Finger mit stumpfen, deformierten Nägeln und litt an hochgradiger, degenerativer Kurzsichtigkeit, so daß sie eine sehr dicke Brille tragen mußte. Dies alles waren Symptome ihres angeborenen Leidens, das auch die zerebrale und geistige Behinderung hervorgerufen hatte. Sie war sehr schüchtern und gehemmt, denn sie hatte seit früher Kindheit das Gefühl, eine «Witzfigur» zu sein.
Dennoch war sie fähig, warme, tiefe, ja sogar leidenschaftliche Bindungen einzugehen. Sie empfand eine tiefe Liebe für ihre Großmutter, die sich seit ihrem dritten Lebensjahr (als ihre Eltern durch einen Unfall ums Leben gekommen waren) um sie gekümmert hatte. Sie liebte die Natur, und wenn man sie in einen Park oder in den Botanischen Garten mitnahm, verbrachte sie dort viele glückliche Stunden. Auch Geschichten mochte sie sehr, wenn sie auch (trotz beharrlicher, ja sogar verzweifelter Versuche) nie lesen gelernt hatte, und sie bat immer wieder ihre Großmutter oder andere, ihr etwas vorzulesen. «Sie hat einen Hunger nach Geschichten», sagte ihre Großmutter, und glücklicherweise las die alte Frau gern vor, nicht nur Geschichten, sondern auch Gedichte - und hatte eine schöne Stimme, der Rebecca gebannt lauschte. Rebecca schien ein tiefes Bedürfnis danach zu haben - für ihren Geist waren diese Geschichten und Gedichte eine unerläßliche Nahrung, ein Stück Realität. Die Natur war schön, aber stumm, und reichte daher nicht aus. Rebecca brauchte die Wiedergabe der Welt durch Sprachbilder und schien, trotz ihrer Unfähigkeit, einfache Aussagen und Anweisungen zu begreifen, selbst bei recht anspruchsvollen Gedichten wenig Schwierigkeiten zu haben, die darin enthaltenen Metaphern und Symbole zu verstehen. Die Sprache des Gefühls, des Konkreten, der Bilder und Symbole ließ eine Welt entstehen, die sie liebte und in der sie sich auskannte. Obwohl unfähig zu begrifflichem (und «propositionalem») Denken, war sie nicht nur mit der Sprache der Poesie vertraut, sondern auch selbst, auf unbeholfene, rührende Weise, eine Art «primitive», natürliche Dichterin. Metaphern, Sprachfiguren und recht verblüffende Allegorien fielen ihr von selbst ein, wenn auch unvermittelt, als plötzliche poetische Ausbrüche und Anspielungen. Ihre Großmutter war auf eine ruhige, stille Art fromm, und dasselbe galt auch für Rebecca: Sie liebte das Entzünden der Sabbat-Kerzen, die Gebete und Segenssprüche, die den jüdischen Tagesablauf begleiten, sie ging gern in die Synagoge, wo man ihr mit Liebe begegnete (und sie als ein Kind Gottes, als eine Art unschuldige, heilige Närrin betrachtete), und sie verstand die Liturgie, die Gesänge, Gebete, Riten und symbolischen Handlungen, aus denen der jüdischorthodoxe Gottesdienst besteht. All dies war ihr möglich, war ihr zugänglich und wohlig vertraut, obwohl ihre Wahrnehmung, ihr Raum-Zeit-Gefühl und ihr gesamtes Einordnungsvermögen stark beeinträchtigt waren: Sie konnte kein Wechselgeld zählen, war mit den einfachsten Rechnungen überfordert, brachte es nie fertig, Lesen und Schreiben zu lernen, und hatte bei Intelligenztests einen durchschnittlichen IQ von sechzig oder weniger (wobei zu sagen ist, daß sie im verbalen Teil deutlich besser abschnitt als im praktischen).
Sie war also «debil», eine «Närrin» oder «Verrückte» - jedenfalls hatte sie ihr Leben lang diesen Eindruck gemacht und war auch immer so bezeichnet worden -, aber sie verfügte über eine unerwartete, seltsam rührende poetische Kraft. Oberflächlich betrachtet war sie tatsächlich eine Ansammlung von Behinderungen und Unfähigkeiten und mit allen Frustrationen und Ängsten belastet, die diesen Zustand begleiten; auf dieser Ebene war sie ein geistiger Krüppel und fühlte sich auch so - die Mühelosigkeit und Geschicklichkeit, mit der andere ihren Alltag bewältigen, blieb für sie unerreichbar. Aber auf einer tieferen Ebene empfand sie kein Gefühl von Behinderung oder Unfähigkeit, sondern eine ruhige Vollkommenheit, eine Lebendigkeit und das Gefühl, eine kostbare Seele zu besitzen und allen anderen ebenbürtig zu sein. Intellektuell fühlte sich Rebecca als Krüppel, spirituell hingegen als vollwertiger, vollständiger Mensch.
Als ich ihr zum erstenmal begegnete und sah, wie unbeholfen und linkisch sie war, glaubte ich, sie sei nichts weiter als ein gebrochener Mensch, dessen neurologische Unzulänglichkeiten ich feststellen und genau abgrenzen konnte: Es lagen zahlreiche Apraxien und Agnosien sowie eine Vielzahl senso-motorischer Behinderungen und Ausfälle vor, und sie verfügte lediglich über begrenzte intellektuelle Schemata und Konzepte, die (nach Piagets Kriterien) etwa denen eines achtjährigen Kindes entsprachen. In meinen Augen war sie ein armes Ding, das, vielleicht durch eine Laune der Natur, über eine
«rudimentäre Fähigkeit» zur Sprache verfügte, ein Mosaik nur aus höheren kortikalen Funktionen und Piagetschen Schemata, zurückgeblieben und verkümmert.
Als ich sie das nächste Mal sah, hatte ich einen völlig anderen Eindruck. Es handelte sich dabei allerdings nicht um eine klinische Testsituation, in der es um eine «Beurteilung» ging. Es war ein herrlicher Frühlingstag, und da meine Arbeit erst in einigen Minuten begann, ging ich noch ein wenig im Park der Klinik spazieren. Ich sah Rebecca auf einer Bank sitzen und schweigend, mit offensichtlicher Freude, die jungen Blätter und Triebe der Bäume betrachten. Ihre Haltung hatte nichts von der Unbeholfenheit, die mir beim erstenmal so ins Auge gesprungen war. Wie sie da saß, in einem dünnen Kleid und mit einem leichten Lächeln auf ihrem ruhigen Gesicht, erinnerte sie mich plötzlich an eine von Tschechows jungen Frauen - Irene, Anja, Sonja, Nina - vor dem Hintergrund eines Kirschgartens. Sie hätte irgendeine junge Frau sein können, die einen schönen Frühlingstag genießt. Dies war das menschliche Bild, der totale Gegensatz zu meinem neurologischen Bild.
Ich ging auf sie zu. Als sie meine Schritte hörte, drehte sie sich um, lächelte mich an und machte eine wortlose Geste. «Sehen Sie nur: die Welt wie schön sie ist!» schien sie zu sagen. Und dann brachen stoßweise seltsame, poetische Wendungen aus ihr hervor: «Frühling», «Geburt», «Wachsen», «Regung», «zum Leben erwachen», «Jahreszeiten», «alles zu seiner Zeit». Unwillkürlich mußte ich an das Buch Prediger Salomo denken: «Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit...» Dies war es, was Rebecca, auf ihre wirre Art, zum Ausdruck gebracht hatte - eine Vision von Zeiten und Jahreszeiten, wie die des Predigers. Sie ist eine geistig behinderte Predigerin, sagte ich zu mir selbst. Und in diesem Satz begegneten sich, kollidierten und verschmolzen die zwei Eindrücke, die ich von ihr hatte: die geistig Behinderte und die Symbolikerin. Sie hatte bei den Tests sehr schlecht abgeschnitten, und diese waren ja, wie alle neurologischen und psychologischen Tests, darauf abgestellt, nicht nur Ausfälle festzustellen, sondern den Patienten darüber hinaus in Funktionen und Ausfälle zu zerlegen. In der formalen Testsituation war sie erschreckend «auseinandergefallen», aber hier war sie auf geheimnisvolle Weise wieder «gebündelt» und zusammengesetzt.
Wie kam es, daß sie, die zuvor so aufgespalten gewesen war, nun wieder ein Ganzes bildete? Ich hatte das starke Gefühl, daß ich es hier mit zwei völlig verschiedenen Arten des Denkens, der mentalen Organisation oder des Seins zu tun hatte. Die erste Art betraf das Schematische: Wir hatten ihr Geschick getestet, Muster zu erkennen und Probleme zu lösen, und dabei hatte sie sich als unzulänglich, als vollkommen unfähig erwiesen. Aber diese Tests hatten uns lediglich Aufschlüsse über ihre Mängel gegeben und nicht über irgend etwas, das sozusagen jenseits dieser Mängel lag.
Die Tests hatten mir nichts verraten über ihre positiven Fähigkeiten, über die Tatsache, daß sie die reale Welt - die Welt der Natur und vielleicht auch die der Phantasie - als ein voll ständiges, verständliches, poetisches Ganzes begreifen und dies sehen, denken und (wenn sie Gelegenheit dazu hatte) leben konnte; sie hatten mir nichts über ihre innere Welt verraten, die offenbar tatsächlich geordnet und kohärent war und der man sich anders nähern mußte als einer Reihe von Problemen oder Aufgaben.
Aber wie sah das ordnende Prinzip aus, das ihr diese Ruhe ermöglichte? Es lag auf der Hand, daß es nichts mit Schemata zu tun haben konnte. Ich dachte an ihre Begeisterung für Geschichten, für narrative Struktur und Verbundenheit. Vermochte diese junge Frau - die so bezaubernd war und gleich zeitig in ihrer Erkenntnisfähigkeit debil - tatsächlich an Stelle des schematischen Vorgehens, das bei ihr derart unterentwickelt war, daß sie es einfach nicht anwenden konnte, eine narrative (oder dramaturgische) Methode einzusetzen, um eine logisch zusammenhängende Welt zu schaffen und zu ordnen? Und während ich noch darüber nachdachte, fiel mir ein, wie sie getanzt hatte und wie koordiniert ihre sonst so unbeholfenen, plumpen Bewegungen dabei gewirkt hatten.
Unsere Tests, unsere Ansätze und «Bewertungen» sind geradezu lächerlich unzulänglich, dachte ich, während ich sie dort auf der Bank sitzen sah, wo sie in eine Betrachtung der Natur versunken war, die nichts Einfältiges, sondern geradezu etwas Heiliges hatte. Sie zeigen uns nur die Mängel, überlegte ich weiter, nicht aber die Fähigkeiten; sie führen uns Puzzles und Schemata vor, während es doch darauf ankommt, Musik, Geschichten und Spiele zu begreifen und zu erkennen, wie ein Mensch sich spontan, auf seine eigene, natürliche Weise beträgt.
Ich hatte das Gefühl, daß Rebecca unter Umständen, die es ihr erlaubten, ihr Leben auf narrative Weise zu organisieren, als «narratives» Wesen vollständig und intakt war. Und dies zu wissen, war sehr bedeutsam, denn so konnte man sie und ihre Möglichkeiten unter einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachten als dem, den die schematische Methode eröffnete.
Es war ein glücklicher Umstand, daß ich diese beiden so grundverschiedenen Erscheinungsformen von Rebecca vor geführt bekam - einerseits war sie hoffnungslos zurückgeblieben, andererseits gaben ihre Potentiale Anlaß zur Zuversicht und daß sie zu den ersten Patienten gehörte, mit denen ich in der Klinik zu tun hatte. Denn was ich in ihr sah, was sie mir zeigte, entdeckte ich jetzt auch in allen anderen.
Je öfter ich mit ihr zusammentraf, desto mehr gewann sie an Tiefe. Aber vielleicht verhielt es sich auch eher so, daß sie mir diese Tiefen in zunehmendem Maße enthüllte oder daß ich diese Dimension in ihr immer mehr respektierte. Diese Tiefen waren nicht ausschließlich mit Glücksgefühlen verbunden - das sind sie nie-, aber insgesamt überwogen sie doch für den größten Teil des Jahres.
Dann, im November, starb ihre Großmutter, und das Licht und die Freude, die sie im April ausgestrahlt hatte, verwandelten sich nun in abgrundtiefen Schmerz und undurchdringliche Dunkelheit. Sie war tieftraurig, ertrug ihr Schicksal aber mit großer Würde. Diese Würde und eine ethische Tiefe traten nun hinzu und bildeten einen düsteren und dauerhaften Kontrapunkt zu dem hellen, lyrischen Ich, das mir zuvor aufgefallen war.
Sobald ich vom Tod ihrer Großmutter erfahren hatte, besuchte ich sie, und sie empfing mich würdevoll, aber starr vor Trauer in ihrem kleinen Zimmer in dem jetzt leeren Haus. Ihre Sprache war wieder abgehackt, «jacksonisch», und bestand aus kurzen Äußerungen der Trauer und des Kummers. «Warum mußte sie mich verlassen?» rief sie und fügte hinzu: «Ich weine um mich, nicht um sie. » Und dann, nach einer Pause: «Oma hat es gut. Sie ist jetzt in dem Haus, in dem sie für immer wohnen wird. » Das Haus, in dem sie für immer wohnen wird! War dies ihr eigenes Symbol? Oder war es eine Anspielung auf das Buch Prediger, vielleicht auch eine unbewußte Erinnerung daran? «Mir ist so kalt», weinte sie und schlug die Arme um ihre Knie. «Es kommt nicht von draußen innen ist es Winter. Kalt wie der Tod», fügte sie hinzu. «Sie war ein Teil von mir. Ein Teil von mir ist mit ihr gestorben. »
In ihrer Trauer war sie ganz - tragisch und ganz -, und es konnte jetzt keine Rede davon sein, daß sie eine «geistig Behinderte» war. Nach einer halben Stunde wich ihre Erstarrung einer gewissen Wärme und Belebtheit, und sie sagte: «Es ist Winter. Ich fühle mich tot. Aber ich weiß, daß der Frühling wieder kommen wird.
Die Trauerarbeit ging langsam voran, aber sie gelang, wie Rebecca, selbst im Zustand völliger Niedergeschlagenheit, vorausgesehen hatte. Dabei erhielt sie viel Zuspruch von einer mitfühlenden und hilfsbereiten Großtante, einer Schwester ihrer Großmutter, die jetzt in das Haus zog. Auch in der Synagoge und der jüdischen Gemeinde fand sie Unterstützung. Vor allem aber gab ihr der Ritus des «Schiva-Sitzens» Kraft und der besondere Status, den sie als Trauernde und Hauptleidtragende hatte. Vielleicht half es ihr darüber hinaus, daß sie offen mit mir sprechen konnte. Und interessanterweise wurde sie auch durch Träume unterstützt, die Rebecca mir lebendig schilderte und die deutlich die Stadien ihrer Trauerarbeit erkennen ließen (siehe Peters 1983).
So wie ich mich an sie als eine Nina in der Aprilsonne erinnere, so sehe ich sie mit tragischer Klarheit vor mir, wie sie im düsteren November jenes Jahres auf einem trostlosen Friedhof in Queens steht und das Kaddisch über dem Grab ihrer Großmutter spricht. Gebete und biblische Geschichten hatten ihr schon immer gefallen, denn sie entsprachen der glücklichen, der lyrischen, der «gesegneten» Seite ihres Lebens. In den Trauergebeten, im 103. Psalm und vor allem im Kaddisch fand sie nun die passenden Worte der Trauer und des Trostes.
In den Monaten zwischen unserer ersten Begegnung im April und dem Tod ihrer Großmutter im November hatte man Rebecca, wie all unsere «Klienten» (ein unschönes Wort, daß damals gerade in Mode kam, wahrscheinlich weil es weniger abwertend klingt als «Patienten»), im Rahmen unseres «Programms zur Förderung der geistigen und kognitiven Entwicklung» (auch dies Bezeichnungen, die damals en vogue waren) verschiedenen Arbeits- und Fördergruppen zugeteilt.
Aber wie bei den meisten anderen funktionierte dieses «Programm» auch bei Rebecca nicht. Es war, das ging mir langsam auf, einfach nicht richtig - denn wir trieben sie damit an ihre Grenzen, wie es ihr Leben lang schon andere, und oft auf geradezu grausame Weise, erfolglos versucht hatten.
Wir widmeten, und Rebecca war die erste, die mir das sagte - den Behinderungen unserer Patienten viel zuviel Aufmerksamkeit und beachteten viel zuwenig, was intakt oder erhalten geblieben war. Um einen anderen Ausdruck zu gebrauchen: Wir waren zu sehr auf «Defektologie» fixiert und kümmerten uns zu wenig um «Narratologie», die vernachlässigte, notwendige Wissenschaft vom Konkreten.
Rebecca führte mir durch konkrete Beispiele, durch ihr eigenes Ich, die beiden völlig verschiedenen, völlig voneinander getrennten Formen des Denkens und des Geistes vor: die (in Bruners Terminologie) «paradigmatischen und die «narrative» Form. Und obwohl beide dem sich entwickelnden menschlichen Geist gleichermaßen angeboren sind und in ihm ihren Platz haben, steht das Narrative an erster Stelle und genießt geistige Priorität. Kleine Kinder lieben Geschichten und wollen immer wieder welche hören. Sie können komplexe Zusammenhänge begreifen, sobald man sie ihnen in Form von Geschichten präsentiert, auch wenn ihre Fähigkeit, allgemeine Konzepte und Paradigmata zu verstehen, fast überhaupt nicht entwickelt ist. Dort, wo ein abstrakter Gedanke nichts ausrichten kann, erzeugt diese narrative oder symbolische Kraft ein Gefühl für die Welt- eine konkrete Realität in der Phantasieform eines Symbols oder einer Geschichte. Ein Kind versteht die Bibel, bevor es Euklid versteht. Nicht weil die Bibel einfacher ist (eher das Gegenteil ist der Fall), sondern weil sie eine symbolische und narrative Struktur hat.
Und wie ihre Großmutter gesagt hatte, war Rebecca in dieser Hinsicht auch mit neunzehn Jahren noch «wie ein Kind». Sie war wie ein Kind, aber kein Kind, sondern eine Erwachsene. (Der Ausdruck «retardiert» bezeichnet jemanden, der ein Kind geblieben ist, der Ausdruck «geistig behindert» dagegen einen behinderten Erwachsenen; beide Ausdrücke, beide Konzepte sind gleichzeitig richtig und falsch.)
Bei Rebecca - und bei anderen Behinderten, bei denen eine persönliche Entwicklung zugelassen oder unterstützt wird - kann eine starke und fruchtbare Entwicklung der emotionalen, narrativen und symbolischen Kräfte stattfinden und (wie in Rebeccas Fall) zur Entfaltung einer Art natürlicher Poesie oder (wie in Joses Fall) zu einer Art natürlichen künstlerischen Empfindens führen. Die paradigmatischen oder begrifflichen Kräfte dagegen, die von Anfang an erkennbar schwach ausgebildet sind, machen nur sehr langsam und mühsam Fortschritte und sind lediglich zu einer sehr begrenzten, kümmer lichen Entwicklung fähig. Dies war Rebecca vollkommen klar, wie sie mir schon vom ersten Tag an deutlich gezeigt hatte. Damals hatte sie von ihrer Unbeholfenheit gesprochen und davon, daß ihre unkoordinierten Bewegungen durch Musik flüssig und geordnet würden. Und sie hatte mir gezeigt, wie sie selbst durch den Anblick eines Stückes Natur, das von einer organischen, ästhetischen und dramatischen Einheit und Sinnhaftigkeit erfüllt war, zu einer geordneten Ganzheit fand.
Nach dem Tod ihrer Großmutter äußerte sie sich recht plötzlich deutlich und entschieden. «Ich will keine Arbeits- und Fördergruppe mehr», sagte sie. «Sie helfen mir nicht. Sie helfen mir nicht, mich zusammenzubringen. » Und dann bewies sie wieder einmal jene Fähigkeit, die richtige Metapher zu finden, die ich an ihr so bewunderte und die, trotz ihres niedrigen IQ, so gut entwickelt war. Sie sah auf den Teppich, der in meinem Büro lag, und sagte: «Ich bin eine Art lebendiger Teppich. Ich brauche ein Muster wie das hier, auf dem Teppich. Wenn ich kein Muster habe, falle ich auseinander und löse mich auf. » Bei ihren Worten betrachtete ich den Teppich und dachte an Sherringtons berühmtes Bild: das Gehirn, der Geist als «magischer Webstuhl», der Muster webt, die sich unablässig wandeln, aber immer eine Bedeutung haben. Kann es, so überlegte ich, einen grob gewebten Teppich ohne Muster geben? Kann es ein Muster ohne einen Teppich geben? (Aber das wäre wie ein Lächeln ohne Gesicht.) Rebecca verkörperte gewissermaßen einen «lebendigen» Teppich, und als solcher mußte sie beides haben. Und gerade sie, mit ihrem Mangel an schematischer Struktur (die sozusagen Kette und Schuß, das Gewebe ihres Teppichs war), lief ohne ein Muster (die szenische oder narrative Struktur des Teppichs) Gefahr, sich aufzulösen und zu verlieren.
«Ich brauche einen Sinn», fuhr sie fort. «Die Gruppen, die kleinen Arbeiten, mit denen ich beschäftigt werde, finde ich sinnlos ... Was mir wirklich gefällt», fügte sie voller Sehnsucht hinzu, «ist das Theater. »
Wir nahmen Rebecca aus der verhaßten Werkstatt heraus und verschafften ihr einen Platz in einer Theatergruppe. Sie ging vollkommen darin auf- diese Tätigkeit verschaffte ihr ein Zentrum. Sie machte ihre Sache erstaunlich gut: In jeder Rolle wurde sie ein ganzer Mensch und agierte flüssig, mit Ausdruckskraft und aus einem inneren Gleichgewicht heraus. Das Theater und die Theatergruppe waren bald ihr Leben geworden, und wenn man sie heute auf der Bühne sieht, würde man nie auf den Gedanken kommen, daß sie einmal als geistig behindert galt.
Nachschrift
Die Macht von Musik, Erzählungen und Schauspielen ist von größter theoretischer und praktischer Bedeutung. Dies läßt sich selbst bei geistig Schwerbehinderten mit einem IQ von unter zwanzig beobachten, die motorisch extrem beeinträchtigt und verwirrt sind. Mit Musik oder Tanz verschwinden ihre ungeschlachten Bewegungen von einem Augenblick auf den anderen- plötzlich wissen sie, wie man sich bewegt. Man kann sehen, wie Retardierte, die nicht in der Lage sind, recht einfache Arbeiten auszuführen, sobald diese vier, fünf Bewegungen oder Abläufe erfordern, mit Musik ohne Schwierigkeiten arbeiten können - die Bewegungsabläufe, die sie sich schematisch nicht merken können, sind eingängig, wenn sie in Musik eingebettet sind. Dasselbe läßt sich bei Patienten feststellen, die an schweren Stirnlappenschäden und Apraxie leiden, die also unfähig sind, zu handeln, die einfachsten motorischen Abläufe und Programme zu behalten, ja sogar zu gehen, obwohl ihre Intelligenz in jeder anderen Hinsicht vollständig erhalten ist. Dieser Verfahrensdefekt, diese, wie man sagen könnte, motorische Debilität, die sich allen normalen Ansätzen zur Rehabilitation widersetzt, verschwindet sofort, wenn Musik eingesetzt wird. Dies ist zweifellos der Grund, oder einer der Gründe, für Arbeitslieder.
Grundsätzlich sehen wir also, daß die Musik auf wirksame (und angenehme!) Weise zu strukturieren vermag, wo abstrakte oder schematische Formen von Organisation scheitern. Dies ist, wie nicht anders zu erwarten, besonders eindrucksvoll dort, wo keine andere Art der Organisation etwas bewirken kann. Daher ist Musik oder jede Art von narrativer Darstellung bei der Arbeit mit Retardierten oder Apraktikern unerläßlich - bei Therapie oder Unterricht muß die Musik oder etwas Gleichwertiges im Mittelpunkt stehen. Das Schauspiel bietet noch größere Möglichkeiten: Die Rolle kann eine Struktur und, für die Dauer der Darstellung, eine ganze Persönlichkeit vermitteln. Anscheinend ist die Fähigkeit, zu spielen, darzustellen, zu sein, dem Menschen, unabhängig von allen intellektuellen Unterschieden, «eingeboren». Das läßt sich an Kindern, an Senilen und besonders deutlich an Menschen wie Rebecca beobachten.
22
Ein wandelndes Musiklexikon
Martin A., einundsechzig Jahre alt, kam Ende 1983 in unser Heim. Er litt an der Parkinsonschen Krankheit und konnte nicht mehr für sich selbst sorgen. In seiner Kindheit hatte er eine Gehirnhautentzündung gehabt, die fast tödlich verlaufen wäre und zu Retardierung, Impulsivität, Anfällen und einer halbseitigen Spastizität geführt hatte. Er besaß nur eine rudimentäre Schulbildung, hatte aber, da sein Vater ein berühmter Sänger an der Metropolitan Opera gewesen war, eine bemerkenswerte musikalische Ausbildung genossen.
Bis zu ihrem Tod hatte er bei seinen Eltern gelebt, und danach fristete er ein kümmerliches Leben als Laufbursche, Pförtner und Koch in einem Schnellimbiß. Er nahm jeden Job an, den er bekommen konnte, wurde aber wegen seiner Langsamkeit, Verträumtheit oder Unfähigkeit jedesmal bald wieder gefeuert. Es wäre ein trübes, stumpfsinniges Leben gewesen, wenn er nicht eine herausragende musikalische Begabung und Empfindsamkeit besessen hätte, die ihm und anderen viel Freude bereitete.
Er hatte ein erstaunliches musikalisches Gedächtnis - «Ich kenne mehr als zweitausend Opern», sagte er mir einmal -, obwohl er nie gelernt hatte, Noten zu lesen. Ob er es hätte lernen können, war nicht festzustellen, er hatte sich immer auf sein überragendes Gehör und auf seine Fähigkeit verlassen, eine Oper oder ein Oratorium nach einmaligem Anhören zu behalten. Leider war seine Stimme nicht so gut wie sein Ohr; sie war zwar voll, aber sehr rauh, und er litt an einer leichten spastischen Dysphonie. Seine angeborene, ererbte musikalische Begabung hatte die Meningitis und die damit verbundene Schädigung des Gehirns offenbar überstanden - oder nicht? Wäre ohne diese Krankheit ein Caruso aus ihm geworden? Oder war seine musikalische Entwicklung gewissermaßen eine «Kompensation» für den Hirnschaden und seine intellektuelle Beschränktheit? Wir werden es nie erfahren. Gewiß ist nur, daß ihm der Vater nicht nur eine musikalische Veranlagung, sondern - bedingt durch eine enge Vater-Sohn-Beziehung und vielleicht auch durch die besonders zärtliche Fürsorge, die Eltern einem behinderten Kind angedeihen lassen - seine eigene große Liebe für die Musik mit auf den Weg gab. Martin war unbeholfen und schwer von Begriff, aber sein Vater liebte ihn, so wie er seinen Vater leidenschaftlich liebte; ihre gegenseitige Liebe wurde gefestigt durch ihre gemeinsame Liebe zur Musik.
Martin konnte zu seinem großen Kummer nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er überwand jedoch seinen Kummer und stellte fest, daß er durch das, was er konnte, viel Freude geben und erleben konnte. Selbst berühmte Musiker konsultierten ihn wegen seines phänomenalen Gedächtnisses, in dem nicht nur die Musik, sondern auch alle Einzelheiten der Aufführung gespeichert waren. Er genoß einen bescheidenen Ruhm als «wandelndes Lexikon», denn er kannte nicht nur zweitausend Opern, sondern auch alle Sänger, mit denen sie je besetzt gewesen waren, sowie alle Details, die Bühnenbild, Kostüme und Ausstattung betrafen. (Er war auch stolz darauf, daß er alle Straßen, alle Häuser, alle Bus- und U-Bahn-Linien von New York auswendig kannte.) Martin war, mit einem Wort, ein Opernnarr, und irgendwie auch ein idiot savant. Die Beschäftigung damit bereitete ihm - was zumeist der Fall ist bei Eidetikern und Menschen, die von einer bestimmten Sache geradezu besessen sind - eine gewisse kindliche Freude. Die wirkliche Erfüllung jedoch (und sie machte ihm das Leben erträglich) war es für ihn, an musikalischen Aufführungen teilzunehmen und in Kirchenchören zu singen (zu seinem Kummer konnte er wegen seiner Dysphonie nicht als Solist mitwirken), vor allem bei den großen Aufführungen zu Ostern oder zu Weihnachten. Seit fünfzig Jahren, als Junge wie als erwachsener Mann, wirkte er in den großen Kirchen und Kathedralen der Stadt bei den Aufführungen der «Johannes-Passion», der «Matthäus-Passion», des «Weihnachtsoratoriums» und des «Messias» mit. Diskret versteckt in den riesigen Chören der Wagner- und Verdi-Opern, hatte er auch in der Metropolitan Opera und, als diese abgerissen wurde, im Lincoln Center gesungen.
Bei solchen Gelegenheiten - besonders bei den Oratorien und Passionen, aber auch bei den bescheideneren Kirchengesängen und Chorälen - ging Martin völlig in der Musik auf und vergaß, daß er «retardiert» war, vergaß alles Niederdrückende und Schlechte in seinem Leben, spürte die Weite des Raumes, der ihn umschloß, und fühlte sich als ganzer Mensch und Kind Gottes.
Das war Martins Welt, seine innere Realität. Aber wie nahm er die Welt um sich herum wahr? Sein Wissen von der Welt, zumindest das lebendige, praktisch verwertbare Wissen, war sehr gering, und er hatte auch kein Interesse an dem Leben, das ihn umgab. Wenn man ihm eine Seite aus einer Enzyklopädie oder einer Zeitung vorlas, wenn man ihm eine Karte mit den Flüssen Asiens oder den U-Bahn-Linien von New York zeigte, dann wurde dies in seinem eidetischen Gedächtnis so fort festgehalten. Er konnte jedoch keine Beziehung zu diesen eidetischen Aufzeichnungen herstellen - sie waren, um Richard Wollheims Wort zu gebrauchen, «azentrisch», das heißt, sie besaßen kein lebendiges Zentrum, in, ihrem Mittelpunkt stand weder er noch ein anderer Mensch, noch irgendeine Sache. Diese Erinnerungen beinhalteten kaum Gefühle - nicht mehr Gefühle als ein Stadtplan von New York-, und es gab in ihnen keinerlei Verbindung, Verzweigung oder Verallgemeinerung. Sein eidetisches Gedächtnis, seine herausragende Besonderheit, gestaltete und vermittelte ihm also nicht einen Sinn der «Welt». Es besaß keine Geschlossenheit, kein Gefühl, keine Beziehung zu sich selbst. Man hatte den Eindruck, es sei physiologisch eher wie das Mark der Erinnerung oder wie eine Datenbank als der Bestandteil eines wirklichen und persönlichen lebendigen Ichs.
Aber auch hier gab es eine verblüffende Ausnahme, und dabei handelte es sich gleichzeitig um die gewaltigste, persönlichste und gottesfürchtigste Leistung seines Gedächtnisses: Er kannte Groves ‹Dictionary of Music and Musicians) auswendig, jenes umfangreiche, neunbändige Werk aus dem Jahre 1954 - er war sozusagen ein «wandelndes Musiklexikon». Sein Vater war damals alt und etwas kränklich geworden, konnte nicht mehr auftreten und verbrachte die meiste Zeit zu Hause. Dort hörte er sich seine große Sammlung von Opernplatten an, sang, zusammen mit seinem dreißigjährigen Sohn (es war die engste und liebevollste Beziehung ihres Lebens), alle seine Rollen und las die sechstausend Seiten des Lexikons laut vor. Sie gruben sich unauslöschlich in Martins Gedächtnis ein, das, obwohl er ein Analphabet war, unbegrenzt aufnahmefähig war. Von da an «hörte» er das Musiklexikon in der Stimme seines Vaters, und jede Erinnerung daran war mit Emotionen verbunden.
Solche erstaunlichen Hypertrophien des eidetischen Gedächtnisses scheinen manchmal, besonders wenn sie «professionell» angewendet oder genutzt werden, das wirkliche Ich zu verdrängen oder jedenfalls mit ihm zu konkurrieren und es in seiner Entwicklung zu behindern. Und wenn solche Erinnerungen keine Tiefe, kein Gefühl besitzen, so existiert in ihnen auch kein Schmerz. Daher können sie als «Fluchtweg» aus der Realität benutzt werden. Dies war bei Lurijas Mnemoniker offensichtlich in beträchtlichem Ausmaß der Fall und wird von Lurija im letzten Kapitel seines Buches über diesen Patienten eindringlich beschrieben. Und so verhielt es sich offenbar in gewisser Weise auch bei Martin A., Jose und den Zwillingen. In jedem dieser Fälle jedoch wurde das Gedächtnis auch zur Schaffung einer Realität, ja einer «Super-Realität» genutztes half dabei mit, die Welt mit einer außergewöhnlichen, mystischen und intensiv erlebten Bedeutung zu erfüllen...
Wie sah, abgesehen von seinem eidetischen Gedächtnis, seine Welt aus? Sie war in vieler Hinsicht klein, schäbig, häßlich und dunkel - die Welt eines Retardierten, der als Kind gehänselt und ausgeschlossen worden war und dem man als erwachsenem Mann verächtlich begegnete und nur drittklassige Jobs gab, die er bald darauf wieder verlor. Es war die Welt von jemandem, der sich selbst nur selten als vollwertigen Menschen empfunden beziehungsweise behandelt gefühlt hatte.
Er war oft kindisch, manchmal auch boshaft, und neigte zu plötzlichen Wutausbrüchen. Die Sprache, die er dann benutzte, war die eines Kindes. «Ich werf dir Baggermatsch ins Gesicht!» hörte ich ihn einmal schreien, und gelegentlich spuckte er andere an oder trat nach ihnen. Er schniefte, er wusch sich selten, er wischte sich die Nase mit dem Ärmel ab, und dabei sah er aus wie ein kleines, schmuddeliges Kind (und zweifellos fühlte er sich auch so). Diese kindlichen Eigenarten, sein Mangel an zwischenmenschlicher Wärme und Freundlichkeit sowie die irritierende Prahlerei mit seinem eidetischen Gedächtnis verhinderten, daß er Freunde fand. Im Heim war er bald unbeliebt und wurde von vielen der Bewohner geschnitten. Eine Krise entwickelte sich - Martin regredierte mit jeder Woche, mit jedem Tag mehr. Anfangs waren alle ratlos.
Zunächst tat man das ganze Problem als «Anpassungsschwierigkeiten» ab, wie sie alle Patienten haben, die nach einem selbständigen Leben «draußen» in ein Heim kommen. Aber die Krankenschwester hatte das Gefühl, daß es hier um etwas Spezifischeres ging. «Irgend etwas zehrt an ihm, ein Hunger, ein nagender Hunger, den wir nicht stillen können. Es macht ihn kaputt», sagte sie. «Wir müssen etwas tun. »
Also suchte ich Martin im Januar ein zweites Mal auf- und fand einen völlig veränderten Menschen vor: Er war nicht mehr keck und eingebildet wie früher, sondern verzehrte sich vor Sehnsucht und wurde von seelischen und auch körperlichen Schmerzen gequält.
«Was ist los mit Ihnen?» fragte ich.
«Ich muß singen», sagte er mit heiserer Stimme. «Ohne das kann ich nicht leben. Und mir geht es nicht nur um die Musik - ohne Musik kann ich auch nicht beten. » Und dann, mit einem plötzlichen Aufblitzen seines alten Gedächtnisses, fuhr er fort: «‹Für Bach war Musik ein Hilfsmittel zum Gottesdienst› - Grove, Eintrag über Bach, Seite 304... Jeden Sonntag», fuhr er sanfter, nachdenklicher fort, «bin ich zur Kirche gegangen und habe im Chor gesungen. Zuerst mit meinem Vater und
dann, nach seinem Tod 1955, allein. Ich muß einfach», rief er erregt. «Ich sterbe, wenn ich nicht singen kann. »
«Natürlich können Sie in die Kirche gehen», antwortete ich. «Wir wußten nicht, daß Ihnen das so sehr fehlt. »
Die Kirche lag in der Nähe des Heims, und Martin wurde herzlich begrüßt - nicht nur als treues Mitglied der Gemeinde und des Chors, sondern als Leiter des Chors, der er, wie sein Vater vor ihm, gewesen war.
Von Stund an änderte sich sein Leben grundlegend. Martin hatte das Gefühl, den Platz, der ihm zukam, wieder eingenommen zu haben. Er konnte singen, er konnte jeden Sonntag durch Bachs Musik Gott dienen, und er konnte die stille Autorität genießen, die man ihm zugestand.
«Sehen Sie», sagte er bei meinem nächsten Besuch zu mir, und es klang nicht, als wolle er sich dessen brüsten, sondern als stelle er lediglich eine Tatsache fest, «diese Leute hier wissen, daß ich Bachs gesamtes Orgel- und Gesangswerk kenne. Ich kenne alle Kirchenkantaten, alle zweihundertzwei, die Grove aufgeführt hat, und ich weiß, an welchen Sonn- und Feiertagen sie gesungen werden sollen. Dies ist die einzige Kirche in der Diözese, die ein richtiges Orchester und einen Chor hat, die einzige, in der alle Gesangswerke von Bach regelmäßig aufgeführt werden. Jeden Sonntag singen wir eine Kantate - und nächstes Ostern werden wir die ‹Matthäus-Passion› singen! »
Ich fand es eigenartig und rührend, daß Martin, ein Retardierter, eine solche Leidenschaft für Bachs Musik empfand. Bach war so intellektuell - und Martin war ein Einfaltspinsel. Erst als ich bei meinen Besuchen Kassetten mit den Kantaten und einmal mit dem «Magnificat» mitbrachte, erkannte ich, daß Martins musikalische Intelligenz trotz all seiner intellektuellen Beschränktheit durchaus in der Lage war, einen großen Teil der technischen Komplexität des Bachschen Werks zu würdigen. Darüber hinaus merkte ich, daß Intelligenz in diesem Fall gar keine Rolle spielte. Für ihn war Bach lebendig, und er, Martin, lebte für ihn.
Martin hatte tatsächlich «abnorme» musikalische Fähigkeiten - aber sie wirkten nur abnorm, wenn man sie isoliert von ihrem richtigen und natürlichen Kontext betrachtete.
Was für Martin, wie vor ihm für seinen Vater, im Mittelpunkt stand und was jene tiefe Verbundenheit zwischen den beiden geschaffen hatte, war immer der Geist der Musik (besonders der religiösen Musik) und der Stimme gewesen, jenes göttlichen Instruments, dessen Aufgabe es ist, zu singen und sich zu Lob und Preis zu erheben.
Sobald Martin zur Kirche und zur Musik zurückgekehrt war, begann er, sich zu verändern, er erholte sich, er sammelte sich, er wurde wieder wirklich. Die Pseudopersönlichkeiten - der gezeichnete Retardierte, der rotznasige, spuckende kleine Junge - verschwanden, und mit ihnen verschwand der aufreizende, emotionslose, unpersönliche Eidetiker. Der wirkliche Mensch kam wieder zum Vorschein: ein würdiger, anständiger Mann, den die anderen Bewohner des Heims jetzt respektierten und schätzten.
Aber wirklich wunderbar war es, Martin zuzusehen, wenn er sang oder, eins geworden mit der Musik, mit einer an Verzückung grenzenden Hingabe lauschte - dann war er «ein Mann in seiner Ganzheit, ganz und gar anwesend». In diesen Augenblicken war Martin - wie Rebecca, wenn sie etwas auf der Bühne aufführte, oder Jose, wenn er zeichnete, oder die Zwillinge bei ihrem seltsamen Umgang mit Zahlen - mit einem Wort: wie ausgewechselt. Alles Fehlerhafte oder Pathologische fiel von ihm ab, und man sah nur einen versunkenen und beseelten, einen ganzen und gesunden Menschen.
Nachschrift
Diese und die beiden folgenden Fallstudien schrieb ich aus schließlich auf der Grundlage eigener Erfahrungen. Ich kannte fast keine Literatur zu diesem Thema, ich wußte nicht einmal, daß es überhaupt eine umfangreiche Literatur dazu gab (siehe zum Beispiel die 52 Literaturangaben in Lewis Hill 1974). Erst als «Die Zwillinge» erschien und ich körbeweise Briefe und Separatdrucke erhielt, merkte ich, wie viele, oft widersprüchliche und faszinierende, Veröffentlichungen zu diesem Thema vorliegen.
Vor allem eine gelungene und detaillierte Fallstudie von David Viscott (1970) erregte meine Aufmerksamkeit. Zwischen seiner Patientin Harriet G. und Martin gibt es viele Parallelen. Beide verfügten über außergewöhnliche Fähigkeiten, die sie manchmal in «azentrischer» und lebensverneinender Weise, manchmal hingegen als lebensbejahende und kreative Impulse einsetzten. So kannte Harriet die ersten drei Seiten des Bostoner Telefonbuchs, die ihr Vater ihr vorgelesen hatte, auswendig («und konnte noch Jahre später jede gewünschte Nummer, die auf diesen Seiten stand, aufsagen»), war aber andererseits auch erstaunlich kreativ; sie schrieb Musikstücke und konnte im Stil jedes Komponisten Melodien kreieren und improvisieren.
Offenbar konnte man beide - wie auch die Zwillinge (siehe nächstes Kapitel) - zu jener Art von mechanischen Leistungen drängen, die als typisch für idiots savants gelten - Leistungen, die ebenso erstaunlich wie sinnlos sind. Beide aber (wie auch die Zwillinge) waren, wenn sie nicht gerade dem Druck von außen gehorchten oder den inneren Drang verspürten, diese Leistungen zu vollbringen, auf einer ständigen Suche nach Schönheit und Ordnung. Obwohl Martin ein erstaunliches Gedächtnis für wahllos herausgegriffene, unbedeutende Fakten hat, bereitet ihm die Erfahrung von Ordnung und Zusammenhang die größte Freude, sei es im musikalisch und religiös geordneten Aufbau einer Kantate, sei es in der enzyklopädischen Struktur des Musiklexikons. Sowohl Bach als auch dieses Lexikon vermitteln eine Welt. Martin - und auch Viscotts Patientin - steht keine andere Welt als die der Musik zur Verfügung. Aber diese Welt ist real; sie vermittelt ihm ein Gefühl der Wirklichkeit und vermag ihn umzuformen. Dies bei Martin zu beobachten ist eine wunderbare Erfahrung - und offenbar verhielt es sich mit Harriet G. genauso: «Diese plumpe, linkische Frau, diese zu groß geratene Fünfjährige, war wie umgewandelt, als sie auf meine Bitte im Rahmen eines Seminars im Boston State Hospital auftrat. Ernst nahm sie Platz, wartete ruhig, mit gesenktem Kopf, bis es still geworden war, und legte ihre Hände langsam auf die Tastatur, wo sie sie einen Moment lang ruhen ließ. Dann nickte sie und begann,mit dem Gefühl und der Ausdruckskraft einer Konzertpianistin zu spielen. Von dieser Sekunde an war sie ein anderer Mensch.»
Man redet über idiots savants, als beherrschten sie einen aus gefallenen «Trick» oder besäßen eine Art mechanisches Talent, nicht aber ein echtes Verständnis oder wirkliche Intelligenz. In Martins Fall dachte ich zunächst auch so, bis ich ihm das «Magnificat» vorspielte. Erst da wurde mir bewußt, daß Martin in der Lage war, die ganze Komplexität dieses Werkes zu verstehen, und daß es sich hier nicht um einen Trick oder um ein bemerkenswertes Gedächtnis, sondern um eine echte und hochentwickelte musikalische Intelligenz handelte. Mein Interesse war daher sofort geweckt, als ich nach der ersten Veröffentlichung dieses Buches einen Aufsatz von L. K. Miller aus Chicago erhielt, in dem dieser die Ergebnisse einer eingehenden Untersuchung schildert, die an einem fünfjährigen Wunderkind vorgenommen worden war, das infolge einer Rötel-Erkrankung der Mutter körperlich und geistig schwer behindert ist. Die Studie bewies, daß hier kein in irgendeiner Weise mechanisches Gedächtnis vorlag, sondern «ein beeindruckendes Gefühl für die Regeln der Komposition, vor allem für die Rolle, die verschiedene Töne bei der Bestimmung von [diatonischen] Tonarten spielen... [was auf] eine implizite Kenntnis der Strukturregeln in einem generativen Sinne [hindeutet], das heißt Regeln, die nicht aufgrund eigener Erfahrungen aus spezifischen Beispielen abgeleitet sein können». Ich bin davon überzeugt, daß dies auch bei Martin der Fall ist und man muß sich fragen, ob es nicht für alle idiots savants gilt. Vielleicht beherrschen sie nicht nur irgendeinen mechanischen «Trick», sondern verfügen auf jenem besonderen Gebiet, auf dem sie sich hervortun (dem musikalischen, rechnerischen, visuellen oder irgendeinem anderen), über eine echte und kreative Intelligenz. Daß die Leistungen, die Martin, Jose oder die Zwillinge in einem bestimmten, wenn auch sehr eng umrissenen und besonderen Bereich an den Tag legen, auf Intelligenz beruhen, ist letztlich nicht bestreitbar. Und eben diese Intelligenz ist es, die erkannt und gefördert werden muß.
23
Die Zwillinge
Als ich den Zwillingen John und Michael 1966 in einem staatlichen Krankenhaus zum erstenmal begegnete, waren sie bereits Berühmtheiten. Sie waren im Radio und im Fernsehen aufgetreten und Gegenstand eingehender wissenschaftlicher und eher populärer Darstellungen geworden.[22] Ich vermute, daß sie sogar Eingang in die Sciencefiction-Literatur gefunden haben, ein wenig «fiktionalisiert» zwar, im wesentlichen aber in den Umrissen, die die Veröffentlichungen von ihnen zeichneten. [23]
Die Zwillinge waren damals sechsundzwanzig Jahre alt und seit ihrem siebten Lebensjahr immer in Heilanstalten gewesen. In den Diagnosen hatte man sie mal als autistisch, mal als psychotisch, mal als erheblich retardiert bezeichnet. Die meisten Berichte kamen zu dem Schluß, daß sie für das Thema idiots savants nicht viel hergaben, sah man einmal von ihren bemerkenswerten «dokumentarischen» Gedächtnissen ab, die noch die winzigsten visuellen Einzelheiten ihrer eigenen Erfahrungen festhielten, und von der Tatsache, daß sie eine unbewußte, kalendarische Rechenweise beherrschten, die sie in die Lage versetzte, sofort den Wochentag zu bestimmen, auf den ein Datum der entferntesten Vergangenheit oder Zukunft fiel. Dies ist die Meinung, die Steven Smith in seinem umfassenden und anregenden Buch ‹The Great Mental Calculators› (1983) vertritt. Seit Mitte der sechziger Jahre sind meines Wissens keine weiteren Untersuchungen über die Zwillinge mehr veröffentlicht worden - das kurze Interesse, das sie weckten, wurde durch die augenscheinliche «Lösung» der Probleme befriedigt, die sie aufgeworfen hatten.
Doch dies ist, glaube ich, ein Mißverständnis, ein ganz naheliegendes vielleicht, denkt man an die stereotypen Ansätze, die festgelegte Zielsetzung der Fragen, die Beschränkung auf diese oder jene «Aufgabe», mit denen die damaligen Untersuchenden die Zwillinge konfrontierten und mit denen sie sie - ihre Psychologie, ihre Methoden, ihr Leben - fast auf ein Nichts reduzierten.
Die Wirklichkeit ist weit rätselhafter, komplexer und unerklärlicher, als diese Studien nahelegen. Durch aggressive formale «Tests» jedoch läßt sich diese Realität ebensowenig enthüllen wie durch die immer gleichen Fragen in Fernseh-Talk-Shows.
Die Frage ist nicht, ob diese Untersuchungen oder Fernsehauftritte «falsch» sind. Sie sind ganz vernünftig, manchmal, in Grenzen - auch informativ, aber sie beschränken sich auf die sicht- und untersuchbare «Oberfläche» und gehen nicht in die Tiefe, ja sie lassen nicht einmal andeutungsweise vermuten, daß eine solche Tiefe überhaupt existiert.
Natürlich erhält man nur dann Hinweise auf diese Tiefen, wenn man aufhört, die Zwillinge zu testen und als «Untersuchungsgegenstand» zu betrachten. Man muß sich von diesem Drang, beständig einzugrenzen und auszufragen, befreien und die Zwillinge kennenlernen, sie beobachten, offen und ruhig, ohne Voreingenommenheit, aber mit einer uneingeschränkten und mitfühlenden phänomenologischen Aufgeschlossenheit für ihr Leben, ihr Denken und ihren Umgang miteinander. Man muß beobachten, wie sie spontan und auf die ihnen eigene Weise ihr Leben gestalten. Dann stellt sich heraus, daß hier etwas außerordentlich Mysteriöses am Werk ist, daß hier Kräfte und Abgründe einer möglicherweise fundamentalen Art existieren, die mir, obwohl ich die beiden nun schon seit achtzehn Jahren kenne, noch immer Rätsel aufgeben.
Wenn man den beiden das erste Mal begegnet, wirken sie
nicht sehr anziehend: Sie sind eine groteske Variante von Zwiddeldei und Zwiddeldum, nicht voneinander zu unterscheiden, Spiegelbilder, identisch im Gesicht, in den Körperbewegungen, in der Persönlichkeitsstruktur und in ihrem Wesen, identisch auch in Art und Ausmaß ihrer Hirn- und Gewebeläsionen. Sie haben zwergenhafte Körper mit beunruhigend unproportionierten Köpfen und Händen, Steilgaumen, hochgewölbte Füße, monotone, piepsende Stimmen, eine Vielzahl sonderbarer Tics und Eigenarten, dazu eine starke fortschreitende Kurzsichtigkeit, die sie zwingt, so dicke Brillen zu tragen, daß auch ihre Augen überdimensional erscheinen, wodurch sie aussehen wie absurde kleine Professoren, die mit einer unangebrachten, besessenen und lächerlichen Konzentration hierhin und dorthin starren und deuten. Dieser Eindruck verstärkt sich, sobald man sie befragt - oder es ihnen gestattet, ihrer Neigung nachzugeben und wie Marionetten puppen eine spontane «Standardaufführung» zu geben.
Das ist das Bild, das durch die Veröffentlichungen über sie, durch ihre Bühnenauftritte - sie pflegen bei der alljährlichen Show der Klinik, in der ich arbeite, mitzuwirken - und durch ihre nicht gerade seltenen und ziemlich peinlichen Darbietungen im Fernsehen entstanden ist.
Die unter diesen Umständen festgestellten «Tatsachen» sind wieder und wieder untersucht und überprüft worden. Die Zwillinge sagen: «Nennt uns ein Datum - irgendwann in den letzten oder den nächsten vierzigtausend Jahren. » Man ruft ihnen ein Datum zu, und fast sofort geben sie den Wochentag an, auf den es fällt. «Noch ein Datum!» rufen sie, und die Vorführung wiederholt sich. Sie können auch den Termin jedes beliebigen Osterfestes im Zeitraum dieser achtzigtausend Jahre nennen. Dabei kann man beobachten (was im übrigen normalerweise in den Berichten nicht erwähnt wird), daß sich ihre Augen auf eine ganz eigentümliche Weise bewegen - als betrachteten oder untersuchten sie eine innere Landschaft, einen geistigen Kalender. Sie machen den Eindruck des «Sehens», einer intensiven Visualisierung, obwohl man festgestellt hat, daß es bei diesen Vorgängen nur um reines Rechnen geht.
Ihr Zahlengedächtnis ist ungeheuerlich, vielleicht sogar un-
begrenzt. Mit gleichbleibender Lässigkeit wiederholen sie drei-, dreißig- oder dreihundertstellige Zahlen. Auch diese Fähigkeit hat man einer «Methode» zugeschrieben.
Wenn man jedoch ihre Rechenfähigkeit untersucht - die typische Domäne mathematischer Wunderkinder und «Kopfrechner» -, schneiden sie überraschend schlecht ab, so schlecht, wie es ihre IQs von sechzig auch nahelegen. Sie scheitern an einfachen Additionen oder Subtraktionen, und was Multiplizieren oder Dividieren bedeutet, können sie nicht einmal begreifen. Womit haben wir es zu tun: mit «Rechnern», die nicht rechnen können und die nicht einmal die einfachsten Grundbegriffe der Arithmetik beherrschen?
Und doch nennt man sie «Kalenderrechner» - und man hat, praktisch ohne jede Begründung, unterstellt und akzeptiert, daß es hier nicht um das Gedächtnis geht, sondern um die Anwendung einer unbewußten Rechenmethode zur Kalenderberechnung. Wenn man daran denkt, daß sogar Carl Friedrich Gauß, einer der größten Mathematiker und ein Rechengenie, erhebliche Schwierigkeiten hatte, eine Berechnungsmethode für den Ostertermin zu finden, so ist es kaum glaubhaft, daß diese Zwillinge, die nicht einmal die einfachsten Grundregeln der Arithmetik beherrschen, eine solche Methode abgeleitet, ausgearbeitet und in Anwendung gebracht haben könnten. Es ist bekannt, daß sehr viele Rechenkünstler tatsächlich über ein großes Repertoire von Methoden und Berechnungstechniken verfügen, die sie für sich selbst ausgearbeitet haben. Vielleicht verleitete dieses Wissen W. A. Horwitz und seine Koautoren zu dem Schluß, daß dies auch auf die Zwillinge zutreffe.
Steven Smith hat diese frühen Untersuchungen für bare Münze genommen. Er kommentiert: «Etwas Rätselhaftes, wenn auch Alltägliches ist hier am Werk - die mysteriöse Fähigkeit des Menschen, auf der Grundlage von Beispielen unbewußte Rechentechniken zu entwerfen. »
Wenn das alles wäre, dann wären die Zwillinge tatsächlich etwas Alltägliches, und man könnte nicht von etwas Rätselhaftem reden, denn die Berechnung von Algorithmen, die ebensogut eine Maschine vornehmen kann, ist im wesentlichen mechanisch, fällt unter die Rubrik «Probleme» und hat mit «Rätseln» nichts zu tun.
Und doch offenbart sich selbst in einigen ihrer Auftritte, ihrer «Tricks» eine Qualität, die den Betrachter stutzig macht. Die Zwillinge können uns für jeden Tag ihres Lebens (etwa von ihrem vierten Lebensjahr an) berichten, wie das Wetter war und welche Ereignisse stattgefunden haben. Ihre Art zu reden - Robert Silverberg hat sie in der Figur des Melangio genau festgehalten - ist gleichzeitig kindlich, detailbesessen und ohne Emotionen. Man nennt ihnen ein Datum, sie verdrehen einen Moment lang die Augen, blicken dann starr vor sich hin und erzählen mit flacher, monotoner Stimme vom Wetter, von den wenigen politischen Ereignissen, von denen sie gehört haben, und von Erinnerungen aus ihrem Leben - dazu gehören oft schmerzliche und tief eingebrannte Traumata der Kindheit, die Verachtung, der Hohn, die Erniedrigungen, die sie erleiden mußten. Doch all das erzählen sie in einem gleich bleibenden Ton, der nicht den kleinsten Hinweis auf persönliche Betroffenheit oder Gefühle gibt. Es geht hier offensichtlich um Erinnerungen «dokumentarischer» Art, in denen kein Bezug auf etwas Persönliches, keine persönliche Betroffenheit, kein lebendiges Zentrum existiert.
Nun könnte man einwenden, daß persönliches Engagement und eigene Gefühle aus diesen Erinnerungen auf jene defensive Art und Weise gelöscht worden sind, die man bei schizoiden oder von Zwangsvorstellungen befallenen Patienten (beides trifft ganz sicher auf die Zwillinge zu) beobachten kann. Aber mit demselben, wenn nicht gar größeren Recht könnte man argumentieren, daß solche Erinnerungen überhaupt nie persönlicher Natur gewesen seien, denn eben dies ist der wesentliche Charakterzug eines eidetischen Gedächtnisses.
Was nämlich hervorgehoben werden muß - und das ist allen bisherigen Beobachtern entgangen, für einen naiven Zuhörer aber, der die Bereitschaft mitbringt, sich in Erstaunen versetzen zu lassen,. durchaus offensichtlich-, ist die Größenordnung des Gedächtnisses der Zwillinge, sein offenbar grenzenloses Fassungsvermögen (so kindlich und banal der Inhalt auch sein mag) und damit auch die Art und Weise, in der die Erinnerungen hervorgeholt werden. Und wenn man sie fragt, wie sie so viel in ihrem Gedächtnis bewahren können - eine dreihundertstellige Zahl oder die Milliarde Ereignisse von vier Jahrzehnten -, so sagen sie ganz einfach: «Wir sehen es.» Und «Sehen» oder «Visualisieren» von ungeheurer Intensität, grenzenloser Ausdehnung und absoluter Exaktheit scheint der Schlüssel zu sein. Es geht offenbar um eine angeborene physiologische Fähigkeit ihres Verstandes, analog etwa der, über die der in A. R. Lurijas (The Mind of the Mnemonist› beschriebene Patient verfügte. Auch dieser «sah»; allerdings scheinen die Zwillinge nicht die Kunst der Zusammenführung und bewußten Organisierung der Erinnerungen entwickelt zu haben, die jener Patient so souverän beherrschte. Ich habe jedoch nicht den geringsten Zweifel, daß die Zwillinge ein gewaltiges Panorama überblicken, eine Art Landschaft oder Physiognomie von allem, was sie je gehört, gesehen, gedacht oder getan haben, und daß sie mit einem Augenzwinkern, nach außen sichtbar als ein kurzes Rollen und Fixieren der Augen, in der Lage sind, mit dem «geistigen Auge» fast alles zu erfassen und zu «sehen», was sich in dieser ungeheuren Landschaft befindet.
Eine solche Gedächtnisleistung ist sehr ungewöhnlich, aber kaum einzigartig. Wir wissen nichts oder nur sehr wenig dar über, warum die Zwillinge oder irgendjemand anders darüber verfügt. Steckt also, wie ich angedeutet habe, noch etwas in den Zwillingen, was unser Interesse in höherem Grade verdient? Ich glaube, ja.
Von Sir Herbert Oakley, der im 19. Jahrhundert in Edinburgh Professor für Musik war, wird berichtet, daß er einmal auf einem Bauernhof ein Schwein quieken hörte und sofort rief. «Gis! » Jemand lief zum Klavier - und tatsächlich, es war Gis. Mein erster Einblick in die «natürlichen» Fähigkeiten und die «natürlichen» Methoden der Zwillinge erfolgte auf eine ähnlich spontane und, wie ich fand, komische Art und Weise.
Eine Streichholzschachtel fiel vom Tisch, und der Inhalt lag verstreut auf dem Boden. «Hundertelf», riefen beide gleichzeitig; dann murmelte John: «Siebenunddreißig». Michael wiederholte das, John sagte es ein drittes Mal und hielt inne. Ich zählte die Streichhölzer - das dauerte einige Zeit -, und es waren einhundertelf.
«Wie konntet ihr die Hölzer so schnell zählen?» fragte ich sie. «Wir haben sie nicht gezählt», antworteten sie. «Wir haben die Hundertelfgesehen. »
Ähnliche Geschichten erzählt man sich von Zacharias Dase, dem Zahlenwunder, der sofort «Hundertdreiundachtzig» oder «Neunundsiebzig» rief, wenn ein Glas mit Erbsen ausgeschüttet wurde, und der, so gut er konnte - auch er war ein Einfaltspinsel -, klarzumachen versuchte, daß er die Erbsen nicht zählte, sondern ihre Zahl im ganzen, blitzartig, «sah».
«Und warum habt ihr ‹Siebenunddreißig› gemurmelt und das zweimal wiederholt?» fragte ich die Zwillinge. Sie sagten im Chor: «Siebenunddreißig, siebenunddreißig, siebenunddreißig, hundertelf »
Und dies fand ich noch verwirrender. Daß sie einhundertelf - die «Hundertelfheit» blitzartig «sehen» können sollten, war ungewöhnlich, aber vielleicht nicht ungewöhnlicher als Oakleys «Gis» - sozusagen eine Art «absolutes Gehör» für Zahlen. Doch dann hatten sie die Zahl Hundertelf noch in «Faktoren» zerlegt, ohne über eine Methode für diesen Vorgang zu verfügen, ja ohne (im üblichen Sinne) zu «wissen», was ein Faktor überhaupt ist. Hatte ich nicht bereits festgestellt, daß sie unfähig waren, auch nur die einfachsten Rechenvorgänge durchzuführen, und nicht «verstanden» (oder zu verstehen schienen), was multiplizieren oder teilen eigentlich bedeutet? Und doch hatten sie jetzt, ganz spontan, eine Zahl in drei Teile zerlegt.
«Wie habt ihr das herausbekommen?» fragte ich ziemlich erbost. Sie erklärten, so gut sie konnten, in armseligen, unzureichenden Begriffen - aber vielleicht gibt es hierfür auch gar keine passenden Worte -, sie hätten es nicht «herausbekommen», sondern es nur blitzartig «gesehen». Mit zwei ausgestreckten Fingern und seinem Daumen machte John eine Geste, die offenbar bedeuten sollte, daß sie die Zahl spontan dreigeteilt hätten oder daß sie ganz von selbst in diese drei gleichen Teile «zerbrochen» sei, wie durch eine plötzliche numerische «Spaltung». Meine Überraschung schien sie zu überraschen als sei ich irgendwie blind; und Johns Geste vermittelte ein Gefühl unmittelbarer, direkt erlebter Realität. Ist es möglich, fragte ich mich, daß sie die Eigenschaften von Zahlen irgendwie «sehen» können, und zwar nicht auf begriffliche, abstrakte Art, sondern als Qualitäten, auf eine unmittelbare, konkrete Weise sinnlich und fühlbar? Und nicht nur isolierte Eigenschaften, wie «Hundertelfheit», sondern auch Eigenschaften der Beziehungen? Daß sie gar, ähnlich wie Sir Herbert Oakley, sagen könnten: «Eine Terz» oder «Eine Quinte»?
Durch die Gabe der Zwillinge, Ereignisse und Daten zu «sehen», hatte ich den Eindruck, daß sie in ihrem Gedächtnis eine riesige Erinnerungstapete, eine weite (vielleicht unendliche) Landschaft hatten, auf der alles zu sehen war, entweder isoliert oder in Beziehung zueinander. Beim Entfalten ihrer unerbittlichen, zufallsbestimmten «Dokumentationen» stand die Isolierung wohl mehr im Vordergrund als das Gefühl für Beziehungen. Doch könnte nicht eine derart erstaunliche Fähigkeit zur Visualisierung - eine im wesentlichen konkrete Fähigkeit und ganz deutlich von der Konzeptualisierung unterschieden - es den Zwillingen möglich machen, willkürliche oder signifikante Beziehungen zu sehen, formale Beziehungen oder Beziehungen zwischen Formen? Wenn sie auf einen Blick «Hundertelfheit» sehen konnten (wenn sie eine ganze «Konstellation» von Zahlen sehen konnten), sollten sie dann nicht auch auf einen Blick ungeheuer komplexe Zahlenformationen und -konstellationen sehen, erkennen, miteinander in Verbindung bringen und vergleichen können, und zwar auf eine ausschließlich sinnliche und nichtintellektuelle Art? - Eine lächerliche, zu Verkümmerung führende Fähigkeit - ich dachte an Borges' Figur Funes: «Wir nehmen mit einem Blick drei Gläser auf einem Tische wahr; Funes alle Triebe, Trauben und Beeren, die zu einem Rebstock gehören... Ein Kreis auf einer Schiefertafel, ein Rhombus sind Formen, die wir ganz und gar wahrnehmen können; ebenso erging es Funes mit den verwehten Haaren eines jungen Pferdes - mit einer Viehherde auf einem Hügel... Ich weiß nicht, wie viele Sterne er am Himmel sah. »
War es möglich, daß die Zwillinge mit ihrer eigenartigen Leidenschaft für Zahlen und ihrer Beherrschung von Zahlen,
daß diese Zwillinge, die auf einen Blick «Hundertelfheit» gesehen hatten, in ihrem Geist vielleicht einen aus Zahlen bestehenden «Rebstock» erfassen konnten, mit all den Zahlen Blättern, Zahlen-Zweigen, Zahlen-Früchten, aus denen er besteht? Ein befremdlicher, vielleicht absurder, fast unmöglicher Gedanke - aber was sie mir gezeigt hatten, war ohnehin schon so seltsam, daß es mein Verständnis fast überstieg, und doch erschien es mir nur wie eine Andeutung dessen, wozu sie fähig waren.
Ich dachte über die Sache nach, aber das Nachdenken brachte mich kaum weiter. Und dann vergaß ich es - bis zu einer zweiten, sich spontan entwickelnden Situation, einem magischen Geschehen, in das ich ganz zufällig hineinstolperte.
Diesmal saßen sie zusammen in einer Ecke, mit einem rätselhaften, heimlichen Lächeln auf ihren Gesichtern, einem Lächeln, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie schienen ein seltsames Vergnügen, einen seltsamen Seelenfrieden gefunden zu haben und zu genießen. Ich näherte mich ihnen vorsichtig, um sie nicht zu stören. Es hatte den Anschein, als seien sie in eine einzigartige, rein numerische Unterhaltung vertieft. John nannte eine Zahl, eine sechsstellige Zahl. Michael griff die Zahl auf, nickte, lächelte und schien sie sich gewissermaßen auf der Zunge zergehen zu lassen. Dann nannte er seinerseits eine andere sechsstellige Zahl, und nun war es John, der sie entgegennahm und auskostete. Von weitem sahen sie aus wie zwei Connaisseurs bei einer Weinprobe, die sich an einem seltenen Geschmack, an erlesenen Genüssen ergötzen. Verwirrt und wie gebannt saß ich, ohne von ihnen bemerkt zu werden, ganz still da.
Was machten sie da? Was in aller Welt ging da vor? Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Vielleicht war es eine Art Spiel, aber es hatte etwas Bedeutungsvolles, eine Art von heiterer, meditativer und fast heiliger Intensität, wie ich sie bislang bei keinem gewöhnlichen Spiel beobachtet und bei den normalerweise aufgeregten und zerstreuten Zwillingen ganz sicher nie zuvor gesehen hatte. Ich begnügte mich da mit, die Zahlen aufzuschreiben, die sie hervorbrachten -jene Zahlen, die ihnen ein so offensichtliches Vergnügen bereiteten, die sie «abwogen», genossen, miteinander teilten. Auf dem Heimweg fragte ich mich, ob diese Zahlen irgendeine Bedeutung haben konnten, einen «realen» oder universalen Sinn, oder ob dieser Sinn (wenn es ihn überhaupt gab) lediglich einer Schrulligkeit, einer privaten Übereinkunft entsprang, wie bei den «Geheimsprachen», die Geschwister manchmal erfinden. Ich dachte an die Zwillinge, die Lurija studiert hatte - Ljoscha und Jura, hirngeschädigte und sprachbehinderte eineiige Zwillinge, die in einer primitiven, babbelnden Sprache miteinander schwatzten, die nur sie allein verstanden (Lurija und Judowitsch 1970). John und Michael gebrauchten nicht einmal Worte oder halbe Worte sie warfen sich lediglich Zahlen zu. Handelte es sich dabei sozusagen um «Borgessche» oder «Funessche» Zahlen, um numerische Rebstöcke oder Pferdemähnen, oder waren dies private Zahlenformen und Konstellationen - eine Art von numerischem Slang -, deren Bedeutung nur die Zwillinge kannten?
Zu Hause beugte ich mich über Tabellen von Logarithmen, Potenzen, Faktoren und Primzahlen - Erinnerungen und Relikte einer eigenartigen, einsamen Periode meiner eigenen Kindheit, in der auch ich über Zahlen gebrütet, Zahlen «gesehen» und für Zahlen eine ganz besondere Leidenschaft empfunden hatte. Die Vorahnung, die ich bereits gehabt hatte, wurde nun zur Gewißheit: Alle Zahlen, jene sechsstelligen Zahlen, die die Zwillinge untereinander ausgetauscht hatten, waren Primzahlen - das heißt Zahlen, die nur durch eins oder durch sich selbst zu teilen sind. Hatten die Zwillinge ein Buch wie das meine gesehen oder besessen, oder konnten sie auf eine unerklärliche Weise selbst Primzahlen «sehen», etwa so, wie sie die Hundertelfheit oder die dreifache Siebenunddreißig «gesehen» hatten? Ganz sicher konnten sie sie nicht errechnet haben - sie konnten überhaupt nichts errechnen.
Am nächsten Tag besuchte ich sie wieder in ihrer Abteilung. Mein Buch mit den Tabellen und Primzahlen hatte ich mitgebracht. Wieder fand ich sie in ihrer Zahlenandacht vereint, aber diesmal setzte ich mich, ohne ein Wort zu sagen, zu ihnen. Zuerst waren sie überrascht, aber als ich sie nicht unterbrach, nahmen sie ihr «Spiel» mit sechsstelligen Primzahlen wieder auf. Nach einigen Minuten beschloß ich, ebenfalls mitzuspielen, und nannte eine achtstellige Primzahl. Beide wandten sich mir zu und schwiegen plötzlich. Auf ihren Gesichtern lag ein Zug von intensiver Konzentration und vielleicht auch Erstaunen. Es entstand eine lange Pause - die längste, die ich sie je hatte machen sehen, sie muß eine halbe Minute oder länger gedauert haben-, und dann begannen sie plötzlich gleichzeitig zu lächeln.
Nach einer rätselhaften gedanklichen Prüfung hatten sie mit einem mal meine eigene achtstellige Zahl als Primzahl erkannt, und das bereitete ihnen offenbar eine große Freude, eine doppelte Freude: einmal, weil ich sie mit einem verlockenden neuen Spielzeug bekannt gemacht hatte, einer Primzahl, der sie noch nie zuvor begegnet waren, und zum zweiten, weil es ganz offensichtlich war, daß ich erkannt hatte, was sie taten, daß es mir gefiel, daß ich es bewunderte und mich daran beteiligen konnte.
Sie rückten ein Stück auseinander, um mir, dem neuen Zahlenspielkameraden, dem dritten in ihrer Welt, Platz zu machen. Dann dachte John, der immer die Führung übernahm, eine lange Zeit nach mindestens fünf Minuten lang, während deren ich mich nicht zu rühren wagte und kaum atmete - und nannte eine neunstellige Zahl; nach einer ebenfalls langen Pause antwortete sein Zwillingsbruder Michael mit einer ähnlichen Zahl. Als nun die Reihe wieder an mir war, warf ich heimlich einen Blick in mein Buch und steuerte meinen eigenen, ziemlich unehrlichen Beitrag bei: eine zehnstellige Primzahl, die ich in den Tabellen gefunden hatte.
Wieder und noch länger als zuvor herrschte verwundertes Schweigen. Nach eingehender Kontemplation nannte John schließlich eine zwölfstellige Zahl. Ich konnte sie weder überprüfen noch mit einer eigenen Zahl antworten, denn mein Buch - das meines Wissens einmalig in seiner Art war - hörte bei zehnstelligen Primzahlen auf. Aber Michael war der Herausforderung gewachsen, wenn er auch fünf Minuten dafür brauchte - und eine Stunde später tauschten die Zwillinge zwanzigstellige Primzahlen aus. Das jedenfalls nahm ich an,
denn ich besaß keine Möglichkeit, diese Zahlen zu überprüfen. Das war damals, im Jahre 1966, auch gar nicht so einfach, sofern man nicht über einen hochentwickelten Computer verfügte. Und selbst dann wäre es schwierig gewesen, denn es gibt keine einfache Art, Primzahlen zu errechnen - ganz gleich, ob man das Sieb des Eratosthenes benutzt oder irgendeine andere Rechenweise. Es gibt keine einfache Methode, Primzahlen in dieser Größenordnung zu errechnen - und doch taten die Zwillinge genau das. (Vgl. jedoch die Nachschrift.)
Wieder dachte ich an Dase, von dem ich vor Jahren in Frederic William Henry Myers' faszinierendem Buch Human Personality› (1903) gelesen hatte: «Wir wissen, daß es Dase (der vielleicht erfolgreichste dieser Zahlenkünstler) in ungewöhnlichem Maße an mathematischem Verständnis mangelte... Dennoch fertigte er in zwölf Jahren Tabellen der Faktoren und Primzahlen für die siebte und fast die ganze achte Million an - diese Leistung hätten nur wenige Menschen ohne mechanische Hilfsmittel innerhalb eines ganzen Lebens zustande gebracht. »
Man kann ihn daher, schreibt Myers, als den einzigen Mann bezeichnen, der sich um die Mathematik verdient gemacht hat, ohne die Grundrechenarten zu beherrschen.
Was Myers nicht klärt und was vielleicht auch nicht zu klären war, ist die Frage, ob Dase nach einer Methode arbeitete oder ob er (und einfache «Zahlensehen»-Experimente deuteten daraufhin) diese großen Primzahlen irgendwie «sah», wie es bei den Zwillingen offenbar der Fall war.
Während ich die Zwillinge still beobachtete, was für mich nicht schwierig war, da ich auf ihrer Station mein Büro hatte, erlebte ich sie in zahllosen anderen Zahlenspielen oder Zahlendialogen. Worum es dabei genau ging, konnte ich weder feststellen noch erraten.
Es dürfte jedoch wahrscheinlich, wenn nicht sogar sicher sein, daß sie mit «realen» Eigenschaften umgehen, denn der Zufall - zum Beispiel beliebig herausgesuchte Zahlen - bereitet ihnen kein oder nur ein sehr geringes Vergnügen. Ganz bestimmt müssen ihre Zahlen für sie einen «Sinn» ergeben-ähnlich vielleicht dem, den die Harmonie für einen Musiker hat.
Unwillkürlich vergleiche ich sie mit Musikern- oder mit dem ebenfalls retardierten Martin (Kapitel 22), der in den heitergelassenen, großartigen Klanggebäuden Bachs eine Manifestation der letzten Harmonie und Ordnung der Welt fand, einer Harmonie, die ihm wegen seiner intellektuellen Beschränktheit begrifflich nicht zugänglich war.
‹Jeder, der harmonisch gebildet ist», schreibt Sir Thomas Browne, «ergötzt sich an Harmonie... und am tiefen Nachsinnen über den Höchsten Komponisten. Es ist in ihr mehr Göttliches, als sich dem Ohr erschließt; sie ist eine hieroglyphische und dunkle Lektion über die ganze Welt... ein spürbarer Anklang an jene Harmonie, die in den Ohren Gottes klingt... Die Seele... ist harmonisch und neigt am meisten der Musik zu. »
In ‹The Thread of Life› (1984) zieht Richard Wollheim einen scharfen Trennstrich zwischen Berechnungen und jenen Phänomenen, die er «ikonische» Bewußtseinszustände nennt, und er nimmt auch gleich mögliche Einwände gegen diese Trennung vorweg: «Man könnte gegen die Tatsache, daß alle Berechnungen nichtikonisch sind, einwenden, daß der Rechnende bisweilen seine Rechnungen optisch auf ein Blatt Papier wirft. Doch das ist kein Gegenbeispiel. Denn in einem solchen Fall wird nicht die Rechnung selbst dargestellt, sondern eine Repräsentation derselben; gerechnet wird in Zahlen, visualisiert werden dagegen Chiffren, die Zahlen darstellen. »
Von Leibniz dagegen stammt eine verlockende Analogie zwischen Zahlen und Musik: Das Vergnügen, schreibt er, das uns die Musik bereite, rühre vom unbewußten Zählen. Musik sei nichts als unbewußte Arithmetik.
Was also können wir über die Lage sagen, in der sich die Zwillinge und vielleicht noch andere befinden? Lawrence Weschler, der Enkel des Komponisten Ernst Toch, erzählte mir, sein Großvater habe sich eine sehr lange Zahlenkette nach einmaligem Hören sofort merken können, und zwar indem er diese Zahlenkette in eine Melodie «umwandelte» (wobei jeder Zahlenwert einer bestimmten Tonhöhe entsprach). Jedediah Buxton, einer der umständlichsten und zugleich beharrlichsten Arithmetiker aller Zeiten, ein Mann mit einer veritablen, ja pathologischen Leidenschaft für das Rechnen und für Zahlen (wie er selbst sagte, konnte ihn «das Kalkulieren trunken» machen), pflegte Musik und Schauspiel in Zahlen «umzusetzen». «Während des Tanzes», heißt es in einem Bericht aus dem Jahre 1754 über ihn, «betrachtete er aufmerksam die Zahl der Schritte; nach einem schönen Musikstück erklärte er, die zahllosen Töne, die die Musik hervorgebracht habe, hätten ihn über die Maßen verwirrt, und er besuchte sogar Mr. Garrick, nur um die Worte zu zählen, die jener aussprach, was ihm, wie er behauptete, vollkommen gelungen sei».
Dies ist ein hübsches, wenn auch extremes Beispielpaarein Musiker, der Zahlen in Musik, und ein Rechner, der Musik in Zahlen umwandelt. Man findet wohl selten so entgegenge setzte Arten oder Bedingungen des Bewußtseins.[24]
Ich glaube, daß die Zwillinge, die ja überhaupt nicht rechnen können, mit ihrem außerordentlichen «Gefühl» für Zahlen in dieser Beziehung eher Ähnlichkeit mit Toch als mit Buxton haben. Allerdings mit einer Ausnahme, und diese Ausnahme können normale Menschen wie wir uns nur schwer vorstellen: Die Zwillinge «übertragen» Zahlen nicht in Musik, sondern können sie in sich selbst erfühlen, und zwar als «Formen», als «Töne», wie die vielfältigen Formen, die in der Natur vorkom- men. Sie sind keine Rechner, und ihr Verhältnis zu Zahlen ist «ikonisch». Sie beschwören seltsame Zahlenszenen, in denen sie sich wie zu Hause fühlen; sie wandern ungezwungen durch riesige Zahlenlandschaften; sie erschaffen, wie Drama-
tiker, eine ganze Welt von Zahlen. Vermutlich verfügen sie über eine einzigartige Phantasiezu deren Besonderheiten
es gehört, daß sie sich ausschließlich in Zahlen entwickelt. Anscheinend «operieren» sie nicht mit Zahlen wie ein Rechner; sie «sehen» sie unmittelbar, ikonisch, wie eine gewaltige Naturszene.
Fragt man nun weiter, ob es zu diesem «Ikonozismus» wenigstens eine Analogie gibt, dann wird man diese, glaube ich, am ehesten im Geist bestimmter Wissenschaftler finden. Dimitrij Mendelejew zum Beispiel trug stets, auf Karten niedergeschrieben, die Zahlenangaben der Elemente mit sich, bis sie ihm so vertraut waren, daß er sie nicht mehr als Summe ihrer Eigenschaften betrachtete, sondern (in seinen eigenen Worten) als «vertraute Gesichter». Von da an sah er die Elemente ikonisch, physiognomisch, als «Gesichter», die miteinander verwandt waren, wie die Mitglieder einer Familie, und die, in toto und periodisch zusammengefügt, das formale Gesicht der Erde darstellten. Ein solcher wissenschaftlicher Geist ist im wesentlichen «ikonisch» und «sieht» die gesamte Natur als Gesichter und Szenen, vielleicht auch als Musik. Wenn diese innere «Vision» mit dem Phänomenalen verschmilzt, behält sie trotzdem ein integrales Verhältnis zur Welt der Materie; und wenn dieser Vorgang umgekehrt, von der Sphäre des Psychischen in die des Physikalischen, verläuft, entsteht die sekundäre oder externe Arbeit einer solchen Wissenschaft. («Der Philosoph sucht den Gesamtklang der Welt in sich tönen zu lassen», schreibt Nietzsche, «und ihn aus sich herauszustellen in Begriffen. ») Ich glaube, daß die Zwillinge, auch wenn sie schwachsinnig sind, den Gesamtklang der Welt hören - aber sie hören ihn nur in Zahlen.
Unabhängig von der Intelligenz ist die Seele «harmonisch», und für manche, wie zum Beispiel Wissenschaftler und Mathe matiker, ist der Sinn für Harmonie wohl in erster Linie durch den Intellekt bestimmt. Dennoch kann ich mir nichts Intellektuelles vorstellen, das nicht auch irgendwie sinnerfüllt ist - wie ja auch das Wort «Sinn» immer diese doppelte Bedeutung hat. Es muß also sinnerfüllt und in gewisser Weise auch «persönlich» sein, denn man kann nichts empfinden, nichts «sinnvoll» finden, wenn es nicht auf irgendeine Weise mit der eigenen Person verknüpft oder verknüpfbar ist. So stellen Bachs mächtige Klanggebäude nicht nur für Martin A. «eine hieroglyphische und dunkle Lektion über die ganze Welt» dar, sondern sind auch ein erkennbarer, einmaliger, inniger Teil von Bachs Persönlichkeit. Auch Martin A. spürte dies deutlich und verknüpfte es mit der Liebe, die er für seinen Vater empfand.
Die Zwillinge haben, glaube ich, nicht nur eine merkwürdige «Fähigkeit», sondern auch eine Sensibilität für Harmonien, die der Musik vielleicht sehr nahe liegt. Man könnte deshalb natürlich von einer «pythagoreischen» Sensibilität sprechen - verblüffend ist nicht, daß es sie gibt, sondern daß sie offenbar so selten vorkommt. Vielleicht ist das Bedürfnis, eine letztgültige Harmonie oder Ordnung zu finden oder zu erfühlen, ein universales Streben des Geistes, ganz gleich, welche Fähigkeiten er besitzt und welche Gestalt diese Harmonie da bei annimmt. Die Mathematik wurde seit jeher die «Königin der Wissenschaften» genannt, und Mathematiker haben die Zahl stets als das große Geheimnis betrachtet und die Welt als eine auf geheimnisvolle Weise durch die Macht der Zahlen organisierte Sphäre gesehen. Sehr schön drückt Bertrand Russell dies im Vorwort zu seiner (Autobiographie› aus: «Mit gleicher Leidenschaft habe ich nach Erkenntnis gestrebt. Ich wollte das Herz der Menschen ergründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen. Ich habe die Kraft zu erfassen gesucht, durch die nach den Pythagoreern die Zahl den Strom des Seins beherrscht.»
Es mag etwas befremdlich erscheinen, diese schwachsinnigen Zwillinge mit einem Intellekt, einem Geist wie dem von Bertrand Russell zu vergleichen. Dennoch ist dieser Vergleich nicht so weit hergeholt. Die Zwillinge leben ausschließlich in einer Gedankenwelt, die von Zahlen beherrscht wird. Die Herzen der Menschen oder das Funkeln der Sterne interessieren sie nicht. Und doch, so glaube ich, sind Zahlen für sie nicht «nur» Zahlen, sondern Bedeutungen, Boten, deren «Botschaft» die Welt ist.
Sie gehen nicht, wie die meisten Rechner, leichten Herzens an Zahlen heran. Sie interessieren sich nicht für das Rechnen, sie haben kein Verständnis, keine Begabung dafür. Statt dessen sind für sie Zahlen Gegenstand heiterer Betrachtungen - sie treten ihnen mit Respekt und Ehrerbietung entgegen. Für sie sind Zahlen heilig, bedeutungsträchtig. Sie sind ihr Mittel - wie die Musik für Martin A. -, das Wirken des Höchsten Komponisten zu begreifen.
Doch Zahlen sind für die Zwillinge nicht nur ehrfurchtgebietend, sie sind auch Freunde - vielleicht die einzigen Freunde, die ihnen in ihrem isolierten, autistischen Leben begegnet sind. Unter zahlenbegabten Menschen ist dies im übrigen eine recht weit verbreitete Empfindung - und Steven Smith, für den «die Methode» alles andere an Bedeutung übertrifft, gibt viele berückende Beispiele dafür an: etwa George Parker Bidder, der über seine frühe Kindheit schrieb: «Zahlen bis Hundert waren mir völlig vertraut, sie wurden sogar meine Freunde, und ich kannte alle ihre Verwandten und Bekannten»; oder der indische Mathematiker Shyam Marathe, ein Zeitgenosse Bidders: «Wenn ich sage, Zahlen seien meine Freunde, dann meine ich, daß ich mich irgendwann in der Vergangenheit einmal mit einer bestimmten Zahl auf verschiedene Arten beschäftigt und bei verschiedenen Gelegenheiten neue und faszinierende Eigenschaften herausgefunden habe, die in ihr verborgen waren. Wenn ich also bei einer Rechnung auf eine bekannte Zahl stoße, dann betrachte ich sie sofort als einen Freund. »
Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Musik weist Hermann von Helmholtz darauf hin, daß zusammengesetzte Töne tatsächlich analysiert und in ihre Bestandteile zerlegt werden können, daß sie normalerweise aber als Qualitäten, als einzigartige Klangqualitäten und als ein unteilbares Ganzes gehört werden. Er spricht von einer «synthetischen Wahrnehmung», die die Analyse übersteigt und die unanalysierbare Essenz aller musikalischen Empfindung ist. Er vergleicht diese Klänge mit Gesichtern und stellt die Vermutung an, daß wir sie auf dieselbe, persönliche Art und Weise erkennen wie Gesichter. Für das Ohr seien Töne - und ganz gewiß Melodien - tatsächlich «Gesichter» und könnten als solche von ihm sofort als «Personen» («Persönlichkeiten») erkannt werden. Ein solches Erkennen setze Zuneigung, Gefühl und eine persönliche Beziehung voraus.
So scheint es auch denen zu gehen, die Zahlen lieben. Auch Zahlen können wie vertraute Gesichter wiedererkannt werden - und das unvermittelte, intuitive, persönliche Gefühl dabei ist: «Ich kenne dich!»*[25] Der Mathematiker Wim Klein: «Zahlen sind sozusagen meine Freunde. Für Sie ist das nicht so, stimmt's? Zum Beispiel 3844-für Sie ist das bloß eine 3, eine 8, eine 4 und noch eine 4. Ich aber sage: ‹Hallo, 622!x»
Ich glaube, daß die scheinbar so isolierten Zwillinge in einer Welt voller Freunde leben, daß sie Millionen, Milliarden von Zahlen haben, denen sie ein freundliches «Hallo» zurufen und die ganz gewiß dieses «Hallo» zurückgeben. Aber keine dieser Zahlen ist zufällig - wie 622 -, und soweit ich feststellen konnte, stoßen die Zwillinge auf sie (hier liegt das Geheimnis), ohne die herkömmlichen Methoden oder überhaupt eine Methode anzuwenden. Sie scheinen sich der direkten Erkenntnis zu bedienen - wie die Engel. Sie sehen, ganz unmittelbar, ein Universum, einen Himmel voller Zahlen. Und das verhilft ihnen, so einzigartig, so bizarr es auch sein mag - aber was gibt uns das Recht, hier von einem «pathologischen» Befund zu reden? -, zu einer außerordentlichen Selbstgenügsamkeit und Heiterkeit, die zu zerstören tragisch ausgehen könnte.
Zehn Jahre später wurde diese Heiterkeit zerstört. Man beschloß, daß die Zwillinge «zu ihrem eigenen Besten» getrennt werden sollten, um ihre «ungesunden Zwiegespräche» zu unterbinden und sie (wie es im medizinsoziologischen Jargon hieß) «in die Lage zu versetzen, ihrer Umwelt in einer sozial akzeptablen, angemessenen Art entgegenzutreten». So wurden sie 1977 getrennt, was zu Ergebnissen führte, die man entweder als befriedigend oder beklagenswert ansehen kann. Beide wurden in «halboffene Anstalten» verlegt und verrichteten dort unter strenger Aufsicht für ein Taschengeld niedere Arbeiten. Sie können jetzt sogar mit dem Bus fahren, wenn man ihnen sorgfältige Anweisungen und einen Fahrschein gibt. Sie können sich außerdem relativ sauber und präsentabel halten, obwohl man natürlich ihre Debilität immer noch auf den ersten Blick erkennt.
Dies sind die positiven Aspekte der Bilanzaber es gibt auch eine negative Seite (die in ihren Krankengeschichten nicht auf taucht, weil sie nie erkannt worden ist). Ohne ihren wechselseitigen «Austausch» von Zahlen, ohne Zeit und Gelegenheit für Kontemplation oder überhaupt irgendeine Form des Austausches - man treibt sie ständig von einer Arbeit zur nächsten - haben sie offenbar ihre merkwürdige numerische Kraft verloren und damit auch ihre größte Freude und den Sinn ihres Lebens. Allerdings scheint man das für einen angemessenen Preis dafür zu halten, daß die beiden jetzt fast unabhängig und «sozial akzeptabel» sind.
Man fühlt sich unwillkürlich an die Behandlung erinnert, die Nadia zugedacht war, einem autistischen Kind mit einer phä-nomenalen Zeichenbegabung (siehe Kapitel 24). Auch Nadia wurde einer Therapie unterzogen, die darauf abzielte, «ihre inneren Kräfte auf anderen Gebieten zu maximieren». Das Ergebnis war, daß sie zu reden begann - und aufhörte zu zeichnen. Nigel Dennis kommentiert: «Wir haben jetzt ein Genie, dem man den Genius genommen hat, so daß nichts weiter übrig ist als eine umfassende geistige Behinderung. Was soll man von einer derart sonderbaren Therapie halten?»
Man sollte hinzufügen - Myers ist in seinem Kapitel über Genies, das er mit einer Betrachtung von «Zahlenwundern» beginnt, auch schon darauf eingegangen -, daß jene Fähigkeit «seltsam» ist und daß sie ebensogut plötzlich verschwinden kann, obwohl sie gewöhnlich ein Leben lang anhält. Für die Zwillinge ging es natürlich nicht nur um die «Fähigkeit», sondern um das seelische und emotionale Zentrum ihres Lebens. Nun sind sie getrennt, nun ist die Fähigkeit verloren und damit auch der Lebenssinn, der Kernpunkt ihres Daseins.*[26]
Nachschrift
Als ich Israel Rosenfield das Manuskript zu diesem Kapitel vorlegte, wies er mich daraufhin, daß es auch andere Arten der Arithmetik gibt, die sowohl höher als auch einfacher sind als die «konventionelle» Arithmetik der Rechenoperationen. Er warf die Frage auf, ob die einzigartigen Fähigkeiten (und Behinderungen) der Zwillinge nicht darauf beruhen könnten, daß sie sich einer solchen «Modularithmetik» bedienten. In einer Notiz an mich äußerte er die Vermutung, daß Modulrechenverfahren jener Art, wie sie Ian Steward im dritten Kapitel seines Buches (Concepts of Modern Mathematics) (1975) beschreibt, die kalendarischen Fähigkeiten der Zwillinge erklären könnten:
«Ihre Fähigkeit, den Wochentag eines bestimmten Datums innerhalb eines Zeitraumes von 80.000 Jahren zu bestimmen, deutet auf ein relativ einfaches Rechenverfahren hin: Man teilt einfach die Summe der Tage zwischen dem heutigen und dem gewünschten Tag durch sieben. Wenn kein Rest bleibt, fällt das Datum auf denselben Wochentag wie der heutige Tag, wenn ein Rest von eins bleibt, fällt das Datum auf den folgenden Wochentag usw. Bedenken Sie, daß die Modularithmetik zyklisch ist: Sie besteht aus sich wiederholenden Mustern. Vielleicht visualisierten die Zwillinge. diese Muster, sei es in Form einfach konstruierter Tabellen, sei es in Form einer ‹Landschaft›, wie der in Stewards Buch auf Seite 30 abgebildeten Spirale der ganzen Zahlen.
Dies läßt die Frage unbeantwortet, warum die Zwillinge in Primzahlen miteinander kommunizieren. Kalenderberechnungen erfordern jedoch die Verwendung der Primzahl sieben. Und wenn man an Modularithmetik im allgemeinen denkt, so fällt einem auf, daß die Moduldivision nur dann geordnete zyklische Muster ergibt, wenn man mit Primzahlen operiert. Da die Primzahl sieben den Zwillingen hilft, Daten und damit auch Ereignisse an bestimmten Tagen in ihrem Leben wiederzufinden, mögen sie festgestellt haben, daß andere Primzahlen Muster ähnlich denen erzeugen, die für ihre Erinnerungsleistungen so bedeutsam sind. (Im Fall der Streichhölzer sagten sie: (Einhundertelf - dreimal siebenunddreißig) - beachten Sie, daß es die Primzahl siebenunddreißig war, die die Zwillinge mit drei multipliziert haben.) Es wäre möglich, daß sie nur Primzahlmuster (visualisieren› können. Die durch verschiedene Primzahlen gebildeten unterschiedlichen Muster (zum Beispiel Multiplikationstabellen) könnten die Bestand teile jener visuellen Information sein, die sie einander geben, wenn sie eine bestimmte Primzahl wiederholen. Kurz: Die Modularithmetik hilft ihnen vielleicht, ihre Vergangenheit wiederzufinden, und daher ist es möglich, daß die Muster, die durch diese Berechnungen entstehen (und die nur bei Primzahlen auftreten), für die Zwillinge eine besondere Bedeutung erhalten. »
Ian Steward weist darauf hin, daß man durch den Einsatz dieser Modularithmetik in Situationen, in denen jede «normale» Arithmetik versagt, schnell zu einer eindeutigen Lösung kommt. Dies gilt besonders für das Anpeilen (mit Hilfe des sogenannten «Ablagefachsystems») extrem großer, mit konventionellen Methoden nicht mehr berechenbarer Primzahlen.
Wenn man diese Methoden, diese Visualisierungen, als Rechenverfahren bezeichnen kann, dann sind sie - da sie nicht algebraisch, sondern räumlich, als Bäume, Spiralen, räum liche Anordnungen und «Denklandschaften» strukturiert sind -sehr sonderbare Rechenverfahren, Konfigurationen in einem formalen und doch quasisensorischen geistigen Raum. Israel Rosenfields Bemerkungen und Ian Stewards Ausführungen über «höhere» Arithmetik (und besonders die Modularithmetik) erregten meine Aufmerksamkeit, denn hierin deutet sich, wenn nicht eine «Lösung», so doch ein tiefer Einblick in sonst unerklärliche Fähigkeiten wie die der Zwillinge an.
Diese höhere oder vertiefte Arithmetik wurde im Prinzip von Gauß entwickelt und in seinem Werk ‹Disquisitiones arithmeticae) dargelegt. Sie ist jedoch erst in den letzten Jahren praktisch angewendet worden. Man muß sich fragen, ob es vielleicht nicht nur eine «konventionelle» Arithmetik gibt (dasheißt eine Arithmetik der Rechenoperationen), die «unnatürlich» und schwer erlernbar ist und Lehrer wie Schüler oft vor Probleme stellt, sondern auch eine tiefe Arithmetik von der Art, wie Gauß sie beschrieben hat, die der Arbeitsweise des Gehirns ebenso entspricht wie Chomskys Tiefenstruktur und seine generative Transformationsgrammatik. Eine solche Arithmetik könnte in einem Geist wie dem der Zwillinge dynamisch, ja fast lebendig sein: Kugelförmige Zahlenhaufen und -nebel entfalten sich und wirbeln durch ein unablässig expandierendes mentales Universum.
Wie ich bereits erwähnt habe, erhielt ich nach der Veröffentlichung von «Die Zwillinge» zahlreiche Zuschriften, und es setzte ein reger Austausch persönlicher wie wissenschaftlicher Art über das Thema ein. Manche Briefe beschäftigten sich mit dem «Sehen» oder Erfassen von Zahlen, manche mit dem Sinn oder der Bedeutung, die dieses Phänomen haben könnte, manche mit den Neigungen und Empfindungen von Autisten im allgemeinen und damit, wie man sie fördern oder ihnen entgegenwirken kann, und manche mit dem Thema «eineiige Zwillinge». Besonders interessant waren die Briefe von Eltern solcher Kinder, vor allem die Berichte jener Eltern, die durch die Umstände gezwungen waren, das Terrain auf eigene Faust zu erkunden, und denen es gelungen war, ihre Gefühle und ihre Betroffenheit mit einer großen Objektivität zu verbinden. Dies traf beispielsweise auf die Parks zu, die Eltern eines hochbegabten, aber autistischen Kindes (siehe C. C. Park 1967 und D. Park 1974, 5.313-323). Dieses Kind, Ella Park, war eine talentierte Zeichnerin und besaß, besonders in frühen Jahren, ein stark ausgeprägtes Gefühl für Zahlen. Ella war fasziniert von der «Ordnung» der Zahlen, vor allem der Primzahlen. Dieses eigenartige Gefühl für Primzahlen ist offenbar recht verbreitet. ClaraC. Park schilderte mir in einem Brief den Fall eines anderen autistischen Kindes, das sie kannte. Es schrieb «zwanghaft»Papierbögen mit Zahlen voll. «Es waren ausnahmslos Primzahlen», schrieb sie und fügte hinzu: «Diese Zahlen sind Fenster zu einer anderen Welt. » Später schildertesie mir eine Begegnung, die sie kurz zuvor mit einem jungen Autisten gehabt hatte. Auch er sei von Faktoren und Primzahlen fasziniert gewesen und habe diese sofort als «etwas Besonderes» erkannt. Tatsächlich habe man das Wort «besonders» gebrauchen müssen, um ihn zu einer Reaktion zu bringen:
«Ist an dieser Zahl (4875) irgend etwas Besonderes, Joe?» Joe: « Sie ist nur durch 13 und 25 teilbar. »
Über eine andere Zahl (7241) sagte er: «Sie ist nur durch 13 und 557 teilbar. »
C1araC. Park bemerkt dazu: «Niemand in seiner Familie fördert diese Beschäftigung mit Primzahlen; er befaßt sich ausschließlich zu seinem eigenen Vergnügen mit ihnen. »
Wir wissen nicht, wie es kommt, daß diese geistig Behinderten die Antworten fast blitzschnell geben könnenob sie sie «ausrechnen», ob sie sie «wissen» (das heißt sich an sie erinnern) oder ob sie sie einfach irgendwie «sehen». Wir wissen nur, daß sie mit Primzahlen eine sonderbare Freude und Bedeutung verbinden. Manches davon scheint mit einem Gefühl für formale Schönheit und Symmetrie zusammenzuhängen, manches aber auch mit einer merkwürdigen assoziativen «Bedeutung» oder «Potenz». Ella bezeichnete dies oft als «magisch»: Zahlen, und vor allem Primzahlen, riefen ihr besondere Gedanken, Bilder, Gefühle und Beziehungen ins Bewußtseinmanche davon waren fast zu «besonders» oder «magisch», um ausgesprochen zu werden. Dies wird in David Parks Arbeit gut beschrieben.
Kurt Gödel hat in einem allgemeinen Zusammenhang aus geführt, wie Zahlen, zumal Primzahlen, als «Markierungen» für Gedanken, Menschen, Orte oder irgend etwas anderes die nen können; eine solche Markierung würde den Weg zu einer «Arithmetisierung» oder «Bezifferung» der Welt ebnen (siehe E. Nagel und J. R. Newman 1958). Sollte dieser Fall eintreten, dann ist es möglich, daß die Zwillinge und andere, die ebenso veranlagt sind wie sie, nicht mehr lediglich in einer Welt aus Zahlen, sondern als Zahlen in der Welt leben werden. Ihr Spiel mit Zahlen, ihre Zahlen-Meditation, wird dann eine Art existentieller Meditation seinund wenn man (wie es David Park manchmal gelingt) den Schlüssel zum Verständnis dieser Meditation entdeckt, dann wird sie auch eine seltsame und präzise Art der Kommunikation darstellen.
24
Der autistische Künstler
«Zeichne das», sagte ich und gab Jose meine Taschenuhr.
Er war etwa einundzwanzig Jahre alt, galt als hoffnungslos retardiert und hatte kurz zuvor einen jener schweren Anfälle gehabt, die ihn hin und wieder überkommen. Er war mager und sah zerbrechlich aus.
Seine Abgelenktheit und Ruhelosigkeit waren plötzlich verschwunden. Er nahm die Uhr vorsichtig, als sei sie ein Juwel oder ein Talisman, in die Hand, legte sie vor sich auf den Tisch und starrte sie in regloser Konzentration an.
«Er ist ein Idiot», mischte sich der Pfleger ein. «Sie brauchen sich gar keine Mühe zu geben. Er weiß nicht, was das ist - er kann die Uhr nicht lesen. Er kann noch nicht einmal sprechen. Alle sagen, er wäre ‹autistisch›, aber er ist bloß ein Idiot. » Jose wurde blaß, vielleicht mehr wegen des Tonfalls, in dem der Pfleger sprach, als wegen seiner Worte - der Pfleger hatte mir schon vorher gesagt, Jose könne mit Worten nichts anfangen. «Nur zu», sagte ich. «Ich weiß, daß du das kannst. »
Ohne einen Laut begann Jose zu zeichnen. Er konzentrierte sich ganz und gar auf die kleine Uhr, die vor ihm lag. Alles andere um ihn herum war versunken. Zum erstenmal sah ich ihn jetzt beherzt und entschlossen, nicht abgelenkt, sondern gesammelt. Er zeichnete rasch, aber peinlich genau, mit einer klaren Linienführung, und ohne etwas auszubessern.
Ich bitte meine Patienten fast immer, etwas zu schreiben oder zu zeichnen, zum Teil, um mir schnell einen groben Oberblick über ihre verschiedenen Fähigkeiten zu verschaffen, zum Teil aber auch, weil darin ihr «Charakter» oder «Stil» zum Ausdruck kommt.
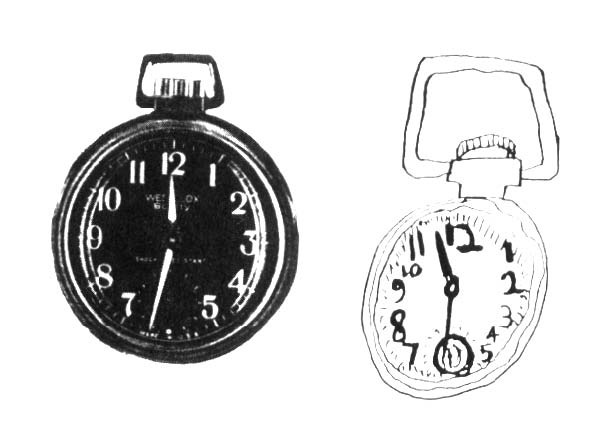
Jose hatte die Uhr detailgetreu abgezeichnet, er hatte jede Einzelheit wiedergegeben (oder jedenfalls jede wichtige Einzelheit - die Aufschrift « Westclox, Shock Resistant, Made in USA» fehlte), und zwar nicht nur «die Uhrzeit» (auch sie stimmte: 11 Uhr 31), sondern auch den kleinen Sekundenzeiger und nicht zuletzt den Kronenaufzug und die trapezförmige Öse, an der die Uhrkette befestigt wird. Diese Öse war erstaunlich vergrößert dargestellt, während alles andere richtig proportioniert war. Erst als ich genauer hinsah, bemerkte ich, daß die Ziffern sich in Größe, Form und Gestaltung unterschieden - manche waren fett, manche mager; manche standen dort, wo sie hingehörten, andere waren eingeschoben; manche waren schlicht, andere verziert. Und dem Sekundenzeiger, der beim Original kaum zu erkennen ist, hatte Jose eine besondere Bedeutung beigemessen, ähnlich etwa der, die die kleinen inneren Zeiger bei einer Sternenuhr oder einem Astrolabium haben.
Die allgemeine Auffassung des Gegenstandes, das «Gefühl» für ihn, hatte Jose treffend herausgearbeitet - und das war um so verblüffender, als er, wie der Pfleger gesagt hatte, keinerlei Vorstellung von Zeit besaß. Andererseits lag hier eine ungewöhnliche Mischung aus peinlicher, ja geradezu zwanghafter Genauigkeit und seltsamen (und, wie ich fand, komischen) Verzierungen und Abänderungen vor.
Ich stand vor einem Rätsel, das mich auch auf dem Heim weg nicht losließ. Ein «Idiot»? Ein Autist? Nein, hier war irgend etwas anderes im Spiel.
Ich wurde nicht gebeten, Jose noch einmal aufzusuchen. Das erste Mal hatte es sich um einen Notfall gehandelt. Man hatte mich an einem Sonntagabend gebeten zu kommen, nachdem ich bereits nachmittags telefonisch krampflösende Mittel verschrieben hatte, andere als die, mit denen Jose bis dahin behandelt worden war. Jetzt, da man seine Anfälle «unter Kontrolle» hatte, wurde der fachliche Rat eines Neurologen nicht mehr benötigt. Doch die Fragen, die die Zeichnung aufgeworfen hatte, ließen mir keine Ruhe mehr. Ich hatte das Gefühl, daß hier ein ungelöstes Rätsel auf mich wartete. Ich mußte ihn wiedersehen. Also bat ich darum, Jose nochmals untersuchen und seine ganze Krankengeschichte einsehen zu dürfen - beim erstenmal hatte man mir lediglich einen wenig informativen Überblick gegeben.
Jose wirkte gleichgültig, als er die Klinik betrat - er hatte keine Ahnung, warum er herbestellt worden war (und vielleicht war ihm das auch egal) -, aber als er mich sah, begann er zu lächeln. Die indifferente, teilnahmslose Maske, die ich in Erinnerung hatte, fiel von ihm ab. Dieses plötzliche, scheue Lächeln war wie ein Lichtstrahl, der durch einen Tür spalt fällt.
«Ich habe über dich nachgedacht, Jose», sagte ich. Er mochte den Sinn meiner Worte nicht verstehen, aber er verstand meinen Tonfall. «Ich möchte noch mehr Zeichnungen sehen.» Mit ermunterndem Blick gab ich ihm meinen Bleistift.
Was sollte er diesmal zeichnen? Ich hatte wie immer ein Exemplar von Arizona Highways dabei, einem reich illustrierten Magazin, das mir besonders gut gefällt und das ich zu Testzwecken immer zur Hand habe. Das Umschlagbild zeigte eine idyllische Szene: Zwei Kanufahrer paddeln auf einem See, im Hintergrund Berge und ein Sonnenuntergang.

Jose begann mit dem Vordergrund, der sich fast schwarz gegen das Wasser abhob, zeichnete die Umrisse mit äußerster Genauigkeit und fing dann an, sie auszumalen. Das war mühsam mit dem Bleistift. «Laß das aus», sagte ich und zeigte auf das Foto. «Mach mit dem Boot weiter. » Rasch und ohne zu zögern zeichnete Jose die Umrisse des Kanus und der beiden Paddler. Er betrachtete das Foto, prägte es sich ein und sah dann weg. Darauf machte er sich daran, die Umrisse mit der flachen Seite des Bleistifts auszumalen.

Auch diesmal - und sogar noch mehr als zuvor, denn hier ging es ja um eine ganze, zusammenhängende Szenerie - verwunderte es mich, wie rasch und genau er zeichnete, und dies um so mehr, als Jose die Vorlage betrachtet und dann, nachdem er sie sich eingeprägt hatte, den Blick abgewendet hatte. Das deutete darauf hin, daß er nicht lediglich etwas abmalte - «Er ist nichts weiter als ein lebender Fotokopierer», hatte der Pfleger beim erstenmal gesagt-, sondern die Szene als ein Bild in sich aufgenommen hatte. Zu seinem verblüffenden Talent, etwas abzumalen, trat also eine ebenso verblüffende Wahrnehmungsfähigkeit. Sein Bild besaß nämlich eine dramatische Qualität, die in der Vorlage fehlte. Die kleinen menschlichen Gestalten waren vergrößert und wirkten intensiver und lebendiger. Es ging etwas Absichtsvolles, Zielgerichtetes von ihnen aus, das im Original nicht so deutlich zum Ausdruck kam. Subjektivität, Absichtlichkeit, Dramatisierung - alle Kennzeichen dessen, was Richard Wollheim «Ikonozität» nennt, waren vorhanden. Ober die an sich schon bemerkenswerte Fähigkeit zum bloßen Kopieren hinaus schien Jose also über eine gut entwickelte Phantasie und Kreativität zu verfügen. Das Bild zeigte nicht irgendein, sondern sein Kanu.
Ich schlug einen Artikel über Forellenfischen auf, der mit einem Aquarell illustriert war. Man sah einen Gebirgsbach, im Hintergrund Felsen und Bäume und im Vordergrund eine Regenbogenforelle, die nach einer Fliege schnappte. «Zeichne das», sagte ich und zeigte auf den Fisch. Jose betrachtete ihn genau, schien in sich hinein zu lächeln und wendete sich ab.
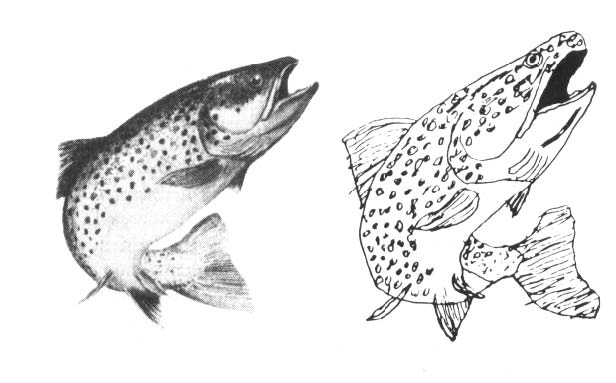
Und dann zeichnete er mit offensichtlicher Freude und einem immer breiter werdenden Lächeln den Fisch so, wie er ihn sah.
Während ich ihm zuschaute, mußte auch ich lächeln, denn jetzt, da er Vertrauen zu mir gefaßt hatte, zeigte er, was in ihm steckte, und der Fisch, der langsam Gestalt annahm, war nicht irgendein Fisch, sondern ein Fisch mit einer Art «Charakter».In der Vorlage hatte er nichtssagend, leblos, zweidimensional, ja ausgestopft gewirkt. Joses gekrümmter, emporschnellender Fisch dagegen erschien viel plastischer, viel echter als das Original. Er war nicht nur naturgetreuer und sozusagen lebendiger - es war noch etwas Ausdrucksvolles, wenn auch nicht gerade Fischartiges hinzugekommen: ein großes, höhlenartiges Maul, das mich an einen Wal denken ließ, eine an ein Krokodil erinnernde Schnauze und ein Auge, das menschlich war und das durch und durch schurkisch in die Welt blickte. Es war ein merkwürdiger Fisch kein Wunder, daß Jose gelächelt hatte-, eine Art Fischpersönlichkeit, eine Märchengestalt, wie der Froschlakai in (Alice im Wunderland).
Jetzt hatte ich etwas Konkretes, das mir weiterhalf. Seine Uhrenzeichnung hatte mich überrascht und mein Interesse geweckt, ließ aber für sich allein keine weiteren Schlüsse zu. Mit dem Kanu hatte Jose gezeigt, daß er über ein beeindruckendes visuelles Gedächtnis, aber darüber hinaus noch über andere Fähigkeiten verfügte. Der Fisch bewies, daß Jose nicht nur eine lebhafte, ausgeprägte Phantasie und Sinn für Humor besaß, sondern auch etwas, das mit Märchenkunst verwandt war. Es handelte sich hier sicher nicht um «große Kunst» - sie war «primitiv», vielleicht auch kindlich, und doch ohne Zweifel eine Art von Kunst. Und Phantasie, Verspieltheit, Kunst ist das letzte, was man bei einem Verrückten, einem idiot savant oder einem Autisten erwartet. So jedenfalls lautet die vorherrschende Meinung.
Meine Freundin und Kollegin Isabelle Rapin war Jose schon Jahre zuvor begegnet, als er wegen «unkontrollierbarer Anfälle» in die neurologische Kinderklinik gebracht worden war - und sie, mit ihrer großen Erfahrung, hatte keinen Zweifel daran gehabt, daß er «autistisch» war. Über Autismus im allgemeinen hatte sie geschrieben: «In einzelnen Fällen sind autistische Kinder überaus erfolgreich im Entziffern geschriebener Sprache und werden hyperlexisch oder beschäftigen sich ausschließlich mit Zahlen... Die frappante Fähigkeit mancher autistischer Kinder, Puzzles zusammenzusetzen, mechanisches Spielzeug auseinanderzunehmen oder Geschriebenes zu entziffern, ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß Aufmerksamkeit und Lernen übermäßig auf visuellräumliche Aufgaben gelenkt werden, die keinerlei Verbalisierung erfordern. Hierbei wird der Wunsch, die Sprache zu erlernen, außer acht gelassen, vielleicht, weil er nicht zum Ausdruck gebracht wird. »
Ähnliche Beobachtungen, vor allem hinsichtlich des Zeichnens, schildert Lorna Selfe in ihrem Buch ‹Nadia› (1978). Anhand der verfügbaren Literatur stellte sie fest, daß alle Fähigkeiten und Darbietungen von idiots savants oder Autisten offenbar ausschließlich mit Berechnungen und Gedächtnisleistungen und nie mit etwas Persönlichem oder Phantasievollem zu tun hatten. Und wenn diese Kinder zeichnen konnten - was vermutlich nur sehr selten vorkam -, dann waren auch ihre Zeichnungen rein mechanisch. In der Literatur ist die Rede von «vereinzelten Begabungsinseln» und «bruchstückhaften Fähigkeiten». Eine individuelle oder gar kreative Persönlichkeit gesteht man ihnen nicht zu.
Was für ein Wesen, so mußte ich mich fragen, war dann Jose? Was ging in ihm vor? Wie war er zu dem geworden, was er jetzt war? Und in welchem Zustand befand er sich? Konnte man ihm irgendwie helfen?
Die verfügbaren Informationen, die Menge der «Daten», die man seit den ersten Anfängen seines merkwürdigen Leidens, seines «Zustandes», gesammelt hatte, halfen mir weiter und setzten mich gleichzeitig in Erstaunen. Ich stieß auf eine ausführliche Krankengeschichte, die Beschreibungen des Ausbruchs seiner Krankheit enthielt: Mit acht Jahren hatte er sehr hohes Fieber bekommen, das mit anhaltenden, immer wieder kehrenden Anfällen und dem raschen Auftreten eines Bewusstseinszustandes einherging, wie er für Hirngeschädigte oder Autisten typisch ist. (Man hatte von Anfang an nicht genau gewußt, was bei ihm eigentlich vor sich ging.)
Der Befund der Rückenmarksflüssigkeit war im akuten Stadium der Krankheit pathologisch gewesen. Man war sich einig, daß er wahrscheinlich an einer Art Gehirnhautentzündung litt. Seine Anfälle waren verschiedener Art: petit mal, grand mal, «akinetisch» und «psychomotorisch», und gerade diese letzte Art von Anfällen ist ungeheuer komplex.
Psychomotorische Anfälle können mit plötzlichen Ausbrüchen von Gewalt und Leidenschaft und mit sonderbaren Verhaltensmustern (der sogenannten psychomotorischen Persönlichkeit) einhergehen, die auch zwischen den eigentlichen Anfällen vorhanden sind. Sie treten immer im Zusammenhang mit Störungen oder Verletzungen der Schläfenlappen auf, und eine schwere beidseitige Schläfenlappen-Störung war bei Jose durch unzählige EEGs nachgewiesen worden.
Die Schläfenlappen sind auch der Sitz des Hörzentrums und insbesondere der Fähigkeit zur Wahrnehmung und Erzeugung von Sprache. Isabelle Rapin hatte Jose nicht nur als «autistisch» bezeichnet, sondern sich auch gefragt, ob nicht vielleicht eine durch eine Schläfenlappen-Störung hervorgerufene «verbalauditive Agnosie» vorlag - eine Unfähigkeit, Sprachlaute zuerkennen, die seine Fähigkeit beeinträchtigte, Worte zu gebrauchen und zu verstehen. Denn besonders bemerkenswert war, wie auch immer man diesen Befund beurteilte (und es wurden sowohl psychiatrische als auch neurologische Interpretationen angeboten), der Verlust oder die Regression der Sprache: Jose, der bis dahin (jedenfalls nach Aussage seiner Eltern) «normal» gewesen war, wurde mit seiner Krankheit «stumm» und sprach nicht mehr mit anderen. Eine Fähigkeit war offenbar «verschont» geblieben und sogar, vielleicht als Ausgleich, verstärkt worden: Jose zeigte eine ungewöhnliche Begeisterung und Begabung für das Malen. Das war schon in früher Kindheit zu erkennen gewesen und schien gewissermaßen in der Familie zu liegen - sein Vater hatte schon immer gern Skizzen angefertigt, und sein (erheblich) älterer Bruder war ein erfolgreicher Künstler. Mit dem Einsetzen seiner Krankheit, mit seinen scheinbar unkontrollierbaren Anfällen (an manchen Tagen überfielen ihn zwanzig bis dreißig schwere Anfälle, und außerdem hatte er zahllose «kleine Anfälle», fiel zu Boden oder hatte «Blackouts» und «Traumzustände»), mit dem Verlust der Sprache und mit seiner allgemeinen intellektuellen und emotionalen «Regression» befand sich Jose in einer seltsamen und tragischen Situation. Er wurde von der Schule genommen und noch eine Zeitlang von einem Privatlehrer unterrichtet. Dann gab man ihn als «vollen» Epileptiker, als autistisches, vielleicht aphasisches, retardiertes Kind, ganz in die Obhut seiner Familie. Man war der Meinung, er sei unerziehbar, nicht zu behandeln, ein hoffnungsloser Fall. Mit neun Jahren «stieg er aus» - aus der Schule, aus der Gesellschaft, aus fast allem, was für ein normales Kind «Realität» bedeutet.
Fünfzehn Jahre lang kam er kaum aus dem Haus, angeblich wegen seiner «widerspenstigen Anfälle». Seine Mutter behauptete, sie habe es nicht gewagt, ihn hinauszulassen, weil er dann täglich zwanzig, dreißig Anfälle auf offener Straße bekam. Man versuchte es mit allen möglichen krampflösenden Mitteln, aber seine Epilepsie schien «inkurabel» - jedenfalls war das die Meinung, die in der Krankengeschichte zum Ausdruck kam. Jose hatte zwar Geschwister, war aber mit Abstand der Jüngste - das «große Kind» einer Frau, die auf die Fünfzig zuging.
Wir wissen viel zuwenig über diese Jahre. Jose verschwand praktisch und wäre vielleicht für immer in seinem Kellerraum geblieben, wo er immer wieder in krampfartige Anfälle verfiel, wenn er nicht vor kurzem einen gewalttätigen «Ausbruch» gehabt hätte und zum erstenmal in eine Klinik gebracht worden wäre. Im Keller war sein Innenleben nicht ganz erloschen. Er blätterte mit Begeisterung in Illustrierten, besonders solchen, die sich mit der Natur befaßten, und wenn er zwischen den Anfällen und den Vorhaltungen seiner Eltern dazu kam, suchte er sich einen Bleistiftstummel und zeichnete, was er in den Zeitschriften sah.
Diese Zeichnungen waren wahrscheinlich seine einzige Verbindung mit der Außenwelt, besonders mit der Welt der Pflanzen und Tiere, mit der Natur, die ihm, vor allem wenn er mit seinem Vater Skizzen gemacht hatte, so sehr ans Herz gewachsen war. Dies, und nur dies, durfte er beibehalten, und es war der einzige Bezug zur Realität, der ihm geblieben war.
Dies also war die Geschichte, die ich dort las und mir nach der Lektüre der Krankenblätter zusammenreimte. Was sie enthielten, war ebenso bemerkenswert wie das, was sie verschwiegen - es war die Dokumentation einer «Lücke» von fünfzehn Jahren: Die einzigen Angaben über diese Zeit stammten von einem Sozialarbeiter, der hin und wieder in Joses Elternhaus aufgetaucht war und Jose besucht hatte, ohne etwas für ihn tun zu können, und von seinen jetzt alten und gebrechlichen Eltern. Aber nichts davon wäre ans Licht gekommen, hätte Jose nicht einen plötzlichen, unerwarteten und beängstigend heftigen Wutanfall bekommen.
Es war völlig unklar, was diesen Wutanfall hervorgerufen hatte: ob es sich um einen epileptischen Ausbruch handelte (wie man ihn in seltenen Fällen bei sehr schweren Schläfenlappen-Anfällen erlebt), ob es, wie es vereinfachend im Aufnahmeprotokoll hieß, lediglich eine «Psychose» war, oder ob es ein letzter verzweifelter Hilferuf einer gequälten, stummen Seele sein sollte, die keine andere Möglichkeit besaß, ihrer Not und ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen.
Dagegen war deutlich, daß er durch seine Einlieferung in die Klinik und die Verabreichung neuer, starker Medikamente, die seine Anfälle «unter Kontrolle» brachten, zum erstenmal eine Art innerer und äußerer Freiheit genoß, daß er eine physische und psychische «Entlastung» erlebte, wie er sie seit seinem achten Lebensjahr nicht mehr erfahren hatte.
Staatliche Nervenheilanstalten werden (um Erving Goffman zu zitieren) oft als «totale Institutionen» bezeichnet, deren Maßnahmen in erster Linie der Erniedrigung der Patienten gilt. Zweifellos ist dies sehr häufig der Fall. Doch sie können auch «Asyle» im besten Sinne des Wortes sein, und diesen Aspekt hat Goffman zuwenig berücksichtigt. Sie können Zufluchtsorte für gequälte, von inneren Konflikten aufgewühlte Seelen sein und genau jene Mischung von Ordnung und Freiheit bieten, die diese Seelen so dringend brauchen. Jose hatte nicht nur unter Verwirrung zu leiden gehabt - zum Teil durch seine Epilepsie, zum Teil durch die Auflösung seines Lebens bedingt -, sondern auch unter einer epileptischen wie existentiellen Eingeschlossenheit und Fesselung. Zu diesem Zeitpunkt seines Lebens war die Anstalt gut für ihn, rettete ihm vielleicht sogar das Leben, und es kann kein Zweifel daran bestehen, daß er dies deutlich spürte.
Nach der dumpfen moralischen Enge seines Elternhauses stieß er hier plötzlich auf eine neue Welt, auf andere Menschen, die ein berufliches und auch persönliches Interesse an ihm zeigten, die nicht urteilten, keine ihn einengenden Moralvorstellungen vertraten, ihn nicht anklagten, die ihm Raum gaben und gleichzeitig ein echtes Gefühl für ihn und seine Probleme entwickelten. Daher schöpfte er zu diesem Zeitpunkt (er war jetzt vier Wochen in der Anstalt) neue Hoffnung; er wurde lebhafter und wendete sich anderen stärker zu, als er es je zuvor getan hatte jedenfalls seit jenem Zeitraum, als sein Autismus in seinem achten Lebensjahr offenbar geworden war.
Aber Hoffnung, Zuwendung, Interaktion waren ihm «verboten» und sicher auch beängstigend schwierig und «gefährlich». Fünfzehn Jahrelang hatte Jose in einer abgeschirmten, verschlossenen Welt gelebt, einer Welt, die Bruno Bettelheim in seinem Buch über Autismus die «leere Festung» genannt
hat. Für ihn war sie jedoch niemals ganz leer gewesen - es hatte in ihr immer seine Liebe zur Natur, zu Tieren und Pflanzen gegeben. Dieser Teil von ihm, dieses Tor war immer offen geblieben. Jetzt aber spürte er die Versuchung und den Druck der «Interaktion», und dieser Druck kam zu früh und war für ihn oft zu stark. Und dies war der Moment, wo Jose «rückfällig» wurde, sich wieder in die Isolation zurückzog, als gebe sie ihm Sicherheit und Geborgenheit, und die primitiven Schaukelbewegungen wieder aufnahm, die er anfangs gezeigt hatte.
Bei meiner dritten Begegnung mit ihm ließ ich ihn nicht in die Klinik kommen, sondern ging, ohne mich anzumelden, hinauf in die Aufnahmestation. Er saß schaukelnd in dem deprimierenden Aufenthaltsraum, mit geschlossenen Augen und abweisendem Gesicht - der Inbegriff der Regression. Einen Moment lang war ich entsetzt, als ich ihn so sah, denn ich hatte die Hoffnung gehegt, es werde bei ihm eine stetige Besserung geben. Ich mußte Jose erst (wie auch später noch so oft) in diesem Zustand sehen, um zu erkennen, daß es für ihn kein einfaches «Erwachen» geben konnte, sondern daß er seinen Weg im Bewußtsein der Gefahr gehen mußte und daß dieser Weg für ihn ein doppeltes Risiko barg, ihn zurückschrecken ließ, aber auch reizte, denn er hatte sein Gefängnis lieben gelernt.
Sobald ich ihn ansprach, sprang er auf und folgte mir eifrig, ja begierig in den Kunstsaal. Auch diesmal zog ich Stifte aus der Tasche, denn er schien eine Abneigung gegen die Wachsmalkreiden zu haben, die die Patienten auf der Station benutzen durften. «Dieser Fisch, den du gezeichnet hast» - ich deutete mit einer Geste an, was ich meinte, da ich nicht wußte, wieviel er von meinen Worten verstand-, «kannst du dich an ihn erinnern, kannst du ihn noch mal zeichnen?» Er nickte eifrig und nahm mir die Buntstifte aus der Hand. Es war drei Wochen her, daß er das Bild mit der Forelle gesehen hatte. Was würde er jetzt zeichnen?
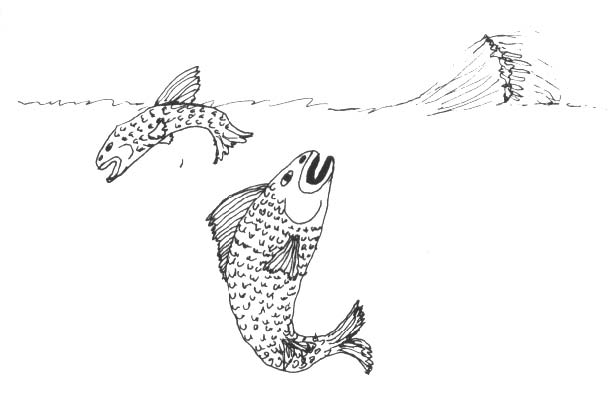
Ein paar Sekunden lang schloß er seine Augen - vielleicht beschwor er innerlich das Bild herauf - und begann dann zu zeichnen. Es war immer noch eine Forelle mit ausgefransten Flossen, einem gegabelten Schwanz und Flecken in allen Farben des Regenbogens, aber diesmal hatte sie ausgesprochen menschliche Gesichtszüge, ein sonderbar anmutendes Nasen loch (welcher Fisch hat Nasenlöcher?) und die vollen Lippen eines Menschen. Ich wollte ihm schon die Stifte wieder aus der Hand nehmen, merkte aber, daß er noch nicht fertig war. Was hatte er vor? Das Bild war doch vollständig. Ja, das Bild vielleicht, aber nicht die Szenerie. Der erste Fisch war, wie eine Ikone, von allem anderen isoliert gewesen; dieser hier jedoch sollte Teil einer Szene, einer Welt sein. Jose zeichnete schnell einen kleineren Fisch ein, der, ein Gefährte des großen, offenbar in einer Art Spiel einen Freudensprung vollführt hatte und gerade wieder ins Wasser eintauchte. Und danach zeichnete Jose die Wasseroberfläche, aus der sich unvermutet eine große Welle erhob. Während er die Welle malte, wurde er immer erregter und stieß einen seltsamen Schrei aus.
Ich konnte mich des, vielleicht vorschnellen, Eindrucks nicht erwehren, daß diese Zeichnung symbolisch zu verstehen war: Der kleine Fisch und der große Fisch - waren damit er und ich gemeint? Aber das Wichtige und Erregende war die spontane Darstellung, der nicht auf meinen Vorschlag hin, sondern aus ihm selbst heraus entstandene Impuls, ein neues Element einzuführen - ein lebendiges Wechselspiel in seiner Zeichnung. Weder in seinem Leben noch in dem, was er gemalt hatte, war es bisher zu irgendeiner Interaktion gekommen. Jetzt aber ließ er sie zu, wenn auch nur im Spiel, als Symbol. Oder vielleicht auch nicht? Was bedeutete diese wütende, Rache drohende Welle?
Es erschien mir besser, mich wieder auf sicheren Boden zu begeben und vorerst keine freie Assoziation mehr zuzulassen. Ich hatte einen Eindruck von den Möglichkeiten bekommen, aber auch die Gefahren gesehen und gehört, die in ihnen lauerten. Also zurück in den sicheren Schoß von Mutter Natur, zurück zum Paradies vor dem Sündenfall. Auf dem Tisch lag eine Weihnachtskarte mit dem Bild eines Rotkehlchens auf einem Baumstumpf, der inmitten von Schnee und schwarzen Bäumen stand.

Ich zeigte auf den Vogel und gab Jose einen Stift mit verschiedenen Farbminen. Er zeichnete den Vogel in allen Einzelheiten und malte die Brust rot aus. Die Füße wirkten wie Klauen, die sich in die Rinde krallten. (Ich war sowohl bei dieser Gelegenheit als auch bei späteren Gelegenheiten überrascht über sein Bedürfnis, bei Händen und Füßen die Funktion des Festhaltens zu betonen und jeden Kontakt eng, fast zwanghaft zupackend, darzustellen.) Aber was war das? Der dürre Zweig neben dem Baumstumpf war in seiner Zeichnung gewachsen und aufgeblüht. Es gab noch andere Einzelheiten, die ich war mir nicht sicher - symbolischer Natur sein konnten. Die am meisten ins Auge springende, bedeutsamste Veränderung war jedoch, daß Jose aus dem Winter Frühling gemacht hatte.

Jetzt endlich begann er zu sprechen - obwohl «sprechen» ein viel zu großes Wort für die seltsam klingenden, gestammelten und weitgehend unverständlichen Äußerungen ist, die er her vorstieß und die ihn gelegentlich ebenso überraschten wie uns - denn wir alle hatten ihn für gänzlich und unheilbar stumm gehalten, sei es aus Unfähigkeit oder Unwilligkeit oder beidem, und er hatte unsere Einschätzung geteilt. Er hatte auch nie den Versuch unternommen zu sprechen, und auch hier konnten wir unmöglich sagen, wieviel davon «organisch» bedingt oder wie sehr es eine Frage der «Motivation» war. Wir hatten seine Schläfenlappen-Störungen reduziert, aber nicht beseitigt - seine EEGs waren nie normal; sie zeigten immer noch Allgemeinveränderungen im unteren Spannungsbereich, gelegentliche Spitzen, Dysrhythmien und langsame Wellen. Verglichen mit den Werten, die man nach seiner Einlieferung festgestellt hatte, waren sie jedoch deutlich verbessert. Wir konnten zwar die krampfartigen Ausbrüche beseitigen, nicht aber die Schäden, die er bereits davongetragen hatte.
Es war unbestreitbar, daß es uns gelungen war, seine physiologische Sprachbefähigung zu verbessern, wenn auch seine Fähigkeit, Sprache einzusetzen, zu verstehen und zu erkennen, nach wie vor eingeschränkt war und er mit dieser Behinderung zweifellos immer würde leben müssen. Aber - und das war ebenso wichtiger bemühte sich jetzt, seine Fähigkeit wiederzuerlangen, zu sprechen und Sprache zu verstehen (und dabei wurde er von uns allen, besonders aber von seinem Sprachtherapeuten, unterstützt), während er sein Unvermö-gen, sich sprachlich auszudrücken, zuvor mutlos, mit einer geradezu masochistischen Ergebenheit hingenommen und sich geweigert hatte, verbal oder auf andere Weise zu kommunizieren. Seine Sprachbehinderung hatte sich zuvor mit seiner Weige rung zu sprechen verbunden und damit die nachteiligen Auswirkungen seiner Krankheit verstärkt, und umgekehrt wirkten sich jetzt die Wiedererlangung seiner Sprechfähigkeit und seine Sprechversuche positiv auf seine beginnende Genesung aus. Selbst den größten Optimisten unter uns war jedoch klar, daß Jose nie eine auch nur annähernd normale Sprachkompetenz erlangen würde, daß Sprache für ihn nie ein wirkliches Ausdrucksmittel sein, sondern lediglich dazu dienen würde, einfache Bedürfnisse zu äußern. Auch er selbst schien das zu spüren und bemühte sich, während er um die Wiedererlangung der Sprache kämpfte, um so mehr, sich durch Zeichen auszudrücken.
Eine letzte Episode: Jose war von der Aufnahmestation mit ihrer angespannten Atmosphäre in eine ruhigere Spezialabteilung verlegt worden, die, im Gegensatz zum Rest der Anstalt, mehr einem Heim als einem Gefängnis glich. Diese Abteilung verfügte über zahlreiches und gut ausgebildetes Personal. Sie war, wie Bettelheim sagen würde, eine «Heimstatt des Herzens» für autistische Patienten, die eben jene liebevolle Zuwendung brauchen, die ihnen nur die wenigsten Anstalten bieten können. Als ich diese neue Station betrat, winkte Jose mir lebhaft zu, sobald er mich sah - es war eine offene, nach außen gerichtete Geste. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß er so etwas vorher schon einmal getan hatte. Er zeigte auf die verschlossene Tür. Er wollte, daß ich sie öffnete, er wollte hinaus.
Er ging voraus, die Treppe hinunter in den überwucherten, sonnendurchfluteten Garten. Soweit ich wußte, war er seit seinem achten Lebensjahr, seit dem Beginn seiner Krankheit und seines Rückzugs aus dem Leben, nicht mehr freiwillig hinaus gegangen.
Neu war auch, daß ich ihm keinen Stift anzubieten brauchte - er nahm ihn sich selbst. Während wir im Garten umhergingen, betrachtete Jose die Bäume und den Himmel, hielt aber meistens den Blick auf den Boden gerichtet, auf die roten und gelben Klee- und Löwenzahnblüten. Er hatte ein sehr gutes Auge für Pflanzenformen und Farben, entdeckte schnell eine seltene weiße Kleeblüte, die er pflückte, und kurz darauf ein noch selteneres vierblättriges Kleeblatt. Er fand sieben verschiedene Grasarten und schien jede wie einen Freund zu begrüßen. Mehr als alles andere aber entzückten ihn die großen gelben Löwenzahnblüten, die voll aufgeblüht waren und sich der Sonne entgegenreckten. Der Löwenzahn war seine Blume - genau so fühlte er sich, und um das auszudrücken, begann er, einen Stengel mit einer Blüte zu zeichnen. Das Bedürfnis, diese Blume darzustellen, ihr seine graphische Referenz zu erweisen, war stark und unmittelbar: Er kniete nieder, legte seinen Block auf den Boden und malte den Löwenzahn, den er in der Hand hielt.
Dies war vermutlich Joses erste Zeichnung nach der Natur, seit sein Vater ihn als Kind, vor seiner Krankheit, auf seine Ausflüge mitgenommen hatte. Es ist ein genaues und lebendiges Bild und gibt seine Liebe für die Realität, für eine andere Lebensform unmittelbar wieder. Für mich hat es einige Ähnlichkeit mit den genauen Abbildungen, die man in mittelalterlichen Pflanzen- und Kräuterbüchern findet, und steht ihnen in nichts nach: Es ist anspruchsvoll und botanisch exakt, auch wenn Jose über keine formalen botanischen Kenntnisse verfügt und diese auch nicht erlernen oder verstehen könnte. Sein Geist ist nicht für das Abstrakte, das Begriffliche geschaffen. Dieser Weg zur Wahrheit bleibt ihm verschlossen. Aber er besitzt eine Leidenschaft, eine echte Veranlagung für das Erkennen von Eigenarten, er genießt sie, er geht auf sie ein, er bildet sie nach und erschafft sie neu. Und Eigenarten, wenn sie nur eigenartig genug sind, sind ebenfalls ein Weg - man könnte sagen: der Weg der Natur - zu Realität und Wahrheit.

Das Abstrakte und Kategorielle ist für Autisten nicht von Interesse - ihr Augenmerk gilt ausschließlich dem Konkreten, dem Besonderen, dem Einzigartigen. Dies ist immer wieder auffallend, ganz gleichgültig, ob es für den jeweiligen Patienten eine Frage der Fähigkeit oder der Neigung ist. Da sie das Allgemeine nicht sehen können oder wollen, scheint das Welt bild von Autisten ausschließlich auf der Beobachtung von Besonderheiten zu beruhen. Sie leben also nicht in einem Universum, sondern (um einen Ausdruck von William James zu gebrauchen) in einem «Multiversum», das aus unzähligen, genau erfaßten und mit einer leidenschaftlichen Intensität erlebten Einzelheiten besteht. Diese Art zu denken steht im krassen Gegensatz zur verallgemeinernden, wissenschaftlichen Denkweise. Dennoch ist sie, wenn auch auf ganz andere Art, ebenso «real» wie diese.
Eine solche Denkweise führt Borges in seiner Geschichte «Funes el Memorioso» (in der sich zahlreiche Anklänge an Lurijas (The Mind of a Mnemonist› finden) vor: «Vergessen wir nicht, daß er zu Gedanken allgemeiner, platonischer Art fast unfähig war... Funes' überfüllte Welt bestand nur aus
Einzelheiten, die fast unmittelbar gegenwärtig waren... Niemand... war je der Hitze und dem Druck einer so unermüdlichen Realität ausgesetzt, wie sie Tag und Nacht über den unseligen Ireneo hereinbrach. »
Dasselbe wie für Borges' Ireneo Funes gilt auch für Jose. Aber dieser Zustand ist nicht unbedingt beklagenswert - die Wahrnehmung von Einzelheiten kann mit einer tiefen Befriedigung verbunden sein, besonders wenn ihnen, wie dies bei Jose der Fall zu sein scheint, ein sinnbildlicher Glanz eigen ist.
Ich glaube, daß Jose, so einfältig und autistisch er auch sein mag, eine solche Begabung für das Konkrete, die Form, besitzt, daß er auf seine Art ein Naturforscher und geborener Künstler ist. Für ihn besteht die Welt aus Formen, unmittelbar und intensiv erlebten Formen, die er erfaßt und reproduziert. Er hat eine ausgeprägte Begabung für naturalistische, aber auch für symbolische Darstellungen. Er kann Blumen und Fische mit bemerkenswerter Genauigkeit wiedergeben, er kann sie aber auch so zeichnen, daß sie Personifikationen, Symbole, Träume oder Witze sind. Und dabei heißt es, Autisten hätten nichts Spielerisches, nichts Künstlerisches und keine Phantasie!
Für die Menschheit existieren Autisten wie Jose einfach nicht. Auch autistische «Wunderkinder» wie Nadia wurden nie zur Kenntnis genommen. Sind sie tatsächlich so selten, oder werden sie nur übersehen? In einem brillanten Essay über Nadia, der im New York Review of Books (4. Mai 1978) erschien, wirft Nigel Dennis die Frage auf, wie viele «Nadias» als lediglich verrückt abgetan oder übersehen werden, wie viele ihrer bemerkenswerten Werke zerrissen werden und wie viele von ihnen, wie Jose, wir gedankenlos als vereinzelte, irrelevante, verirrte Talente abtun, die kein weiteres Interesse verdienen. Aber der autistische Künstler - oder (um es weniger hochtrabend auszudrücken) das Vorhandensein von Phantasie bei Autisten - ist keineswegs selten. Ich bin im Laufe der Jahre Dutzenden solcher Fälle begegnet, ohne irgendwelche besonderen Anstrengungen zu unternehmen, sie aufzuspüren.
Autisten sind zwangsläufig selten offen für eine Einflußnahme von außen. Es ist ihr «Schicksal», isoliert und damit unverfälscht zu sein. Ihre «Vision», wenn sie von außen erkennbar ist, kommt von innen und erweckt den Eindruck des Urwüchsigen. Je besser ich sie kennenlerne, desto mehr erscheinen sie mir wie eine seltsame, urwüchsige, völlig nach innen gerichtete Spezies, die mitten unter uns lebt und sich von allen anderen Menschen unterscheidet.
Früher galt Autismus als Kindheitsschizophrenie, aber phä-nomenologisch verhält es sich genau umgekehrt. Der Schizophrene beklagt sich immer über einen «Einfluß » von außen: Er ist passiv, ein Spielball seiner Umgebung, er kann nicht er selbst sein. Der Autist würde sich - wenn er es täte - über das Fehlen von Einfluß, über die absolute Isolation beklagen.
«Kein Mensch ist eine Insel», schrieb Donne. Und doch ist dies genau die Situation des Autisten: Er ist eine Insel, er ist vom Festland abgeschnitten. Beim «klassischen» Autismus, der sich, und dann oft total, bis zum dritten Lebensjahr manifestiert, erfolgt die Isolation zu einem so frühen Zeitpunkt, daß unter Umständen keine Erinnerung an das Festland mehr vorhanden ist. Beim «sekundären» Autismus, der, wie in Joses Fall, in einem späteren Lebensabschnitt durch eine Hirnkrankheit entsteht, bleiben gewisse Erinnerungen an das Festland erhalten, die man als eine Art Nostalgie bezeichnen könnte. Dies erklärt vielleicht, warum Jose zugänglicher ist als die meisten Autisten und warum er, zumindest in seinen Bildern, manchmal Interaktionen zuläßt.
Bedeutet vom Festland abgeschnitten, eine Insel zu sein, notwendigerweise den Tod? Es kann, muß aber nicht tödlich sein. Denn obwohl die «horizontale» Verbindung mit anderen, mit der Gesellschaft und der Kultur verlorengeht, kann es lebenswichtige, intensivierte «vertikale» Verbindungen geben: direkte Verbindungen mit der Natur und mit der Realität, die unmittelbar sind und sich dem Einfluß anderer entziehen. Dieser «vertikale» Kontakt ist bei Jose besonders ausgeprägt daher die große Treffsicherheit, die absolute Klarheit seiner Wahrnehmungen und Zeichnungen. Hier zeigt er nicht die kleinste Unsicherheit oder Ziellosigkeit, dies ist eine Urkraft, die unabhängig von den Beziehungen zu anderen Menschen existiert.
Dies führt uns zu unserer letzten Frage: Gibt es einen «Platz» in der Welt für einen Menschen, der wie eine Insel ist, der nicht akkulturiert und Teil des Festlands werden kann? Kann das «Festland» das Außergewöhnliche, das Einzigartige aufnehmen und ihm Raum geben? Es gibt hier Parallelen zu den sozialen und kulturellen Reaktionen auf Genies. (Damit will ich natürlich nicht behaupten, daß Autisten Genies sind. Sie sind jedoch wie diese mit dem Problem der Einzigartigkeit konfrontiert.) Konkret gefragt: Was wartet auf Jose? Gibt es irgendeinen «Platz» für ihn auf der Welt, wo man Verwendung für ihn hat, ohne seine Autonomie in Frage zu stellen?
Könnte er, mit seinem scharfen Auge und seiner großen Liebe zu Pflanzen, Illustrationen für botanische, zoologische oder anatomische Werke herstellen? (Man beachte die Zeichnung, die er nach einer Graphik in einem Fachbuch anfertigte.) Könnte er an wissenschaftlichen Expeditionen teilnehmen und seltene Arten malen? Mit seiner uneingeschränkten Konzentration auf das, was er vor sich hat, wäre er für solche Aufgaben ideal geeignet.
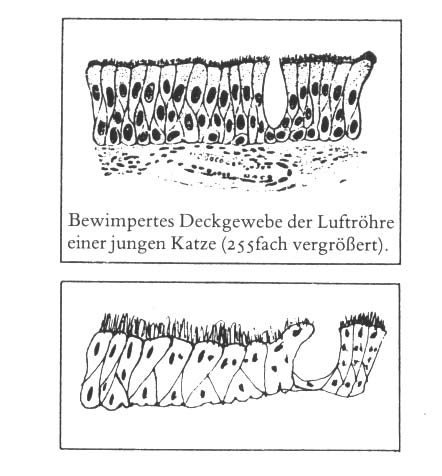
Ein anderer, vielleicht auf den ersten Blick befremdlicher, aber nicht abwegiger Vorschlag: Wäre er, mit seiner Eigenart und seiner Veranlagung, nicht geradezu prädestiniert, Märchen, biblische Geschichten und Mythen zu bebildern? Oder vielleicht könnte er (da er nicht lesen kann und Buchstaben für ihn nur schöne, aber bedeutungslose Symbole sind) die großen Majuskeln in den Prachtausgaben von Brevieren und Meßbüchern verzieren und illustrieren? Er hat bereits wunderschöne Altarbilder in Mosaiktechnik aus farbigen Steinchen und gefärbtem Holz geschaffen. Er hat reich verzierte Inschriften in Grabsteine gemeißelt. Sein gegenwärtiger «Job» besteht darin, im Handdruck die verschiedensten Aushänge für das Schwarze Brett der Station anzufertigen und er bringt darauf Schnörkel und Verzierungen an, als handle es sich bei diesen Zetteln um eine zweite Magna Charta. Er wäre von Nutzen, und andere und er selbst würden Freude daran haben. Das alles könnte er tun - aber leider wird nichts davon eintreten, solange nicht ein verständnisvoller und geschickter Mensch ihm die Gelegenheit dazu gibt, ihn anleitet und beschäftigt. Denn so, wie die Dinge liegen, wird er wahrscheinlich nichts tun und, wie so viele andere Autisten, weiterhin unbeachtet ein nutzloses, fruchtloses Leben in einer unscheinbaren Station der staatlichen Nervenheilanstalt fristen.
Nachschrift
Nach der Veröffentlichung dieses Aufsatzes erhielt ich wieder zahlreiche Separatdrucke und Briefe, von denen der interessanteste der von Clara C. Park war. Obwohl Nadia vielleicht ein einmaliger Fall, eine Art Picasso war, ist tatsächlich deutlich geworden (wie Nigel Dennis schon vermutete), daß recht hohe künstlerische Begabungen bei Autisten nicht ungewöhnlich sind. Testverfahren zum Nachweis eines künstlerischen Potentials, zum Beispiel der Goodenough-«Zeichne einen Mann» Intelligenztest, sind praktisch wertlos: Es muß sich um eine spontane, wirklichkeitsgetreue Darstellung handeln.
In einer profunden, reich illustrierten Rezension von ‹Nadia›
hat Clara C. Park 1978 deutlich gemacht, worin die Hauptcharakteristika solcher Zeichnungen zu bestehen scheinen. Dazu gehören «negative» Charakteristika wie abgeleiteter und gleichförmiger Stil, aber auch «positive» Merkmale wie die ungewöhnliche Fähigkeit zur zeitlich verzögerten Wiedergabe und die Darstellung des Objekts als etwas Wahrgenommenes, nicht als etwas Vorgestelltes (daher die besonders ins Auge fallende inspirierte Naivität). Park weist auch auf eine relative Indifferenz gegenüber den Reaktionen anderer hin, die den Anschein erweckt, als seien solche Kinder unerziehbar. Und doch ist dies offenbar nicht unbedingt der Fall. Diese Kinder sind nicht immer unempfänglich für Aufmerksamkeit oder Anleitungen- allerdings muß ihre Unterweisung unter Umständen auf ganz besondere Art erfolgen.
Neben ihren Erfahrungen mit ihrer Tochter, die inzwischen erwachsen und eine anerkannte Künstlerin ist, schildert Clara C. Park die faszinierenden und nur wenig bekannten Erfolge, die japanische Wissenschaftler, vor allem Morishima und Motzugi, zu verzeichnen haben. Ihnen ist es gelungen, begabten autistischen Kindern, die nicht gefördert wurden und scheinbar unerziehbar waren, dabei zu helfen, vollwertige professionelle Künstler zu werden. Dabei stützt sich Morishima auf eine besondere Technik der strukturierten Unterweisung und auf eine Art Lehrzeit, wie sie in der klassischen japanischen Kultur üblich ist, aber auch auf ein Verfahren, das die Patienten dazu ermutigt, Malen als Mittel der Kommunikation einzusetzen. Aber eine solche formale Ausbildung allein, so unabdingbar sie auch sein mag, reicht nicht aus. Zusätzlich ist eine sehr enge, persönliche Beziehung erforderlich. Die Sätze, mit denen Clara C. Park ihre Rezension schließt, sind auch ein passender Abschluß für dieses Kapitel: «Das Geheimnis liegt wahrscheinlich woanders, nämlich in der Hingabe, mit der Motzugi mit einem geistig behinderten Künstler zusammenlebte und schrieb: ‹Das Geheimnis der Entwicklung von Yanamuras Talent lag darin, an seinem Gast teilzuhaben. Der Lehrer sollte den geistig Behinderten in all seiner Schönheit und Aufrichtigkeit lieben und gemeinsam mit ihm in seiner unverfälschten und retardierten Welt leben. ›»