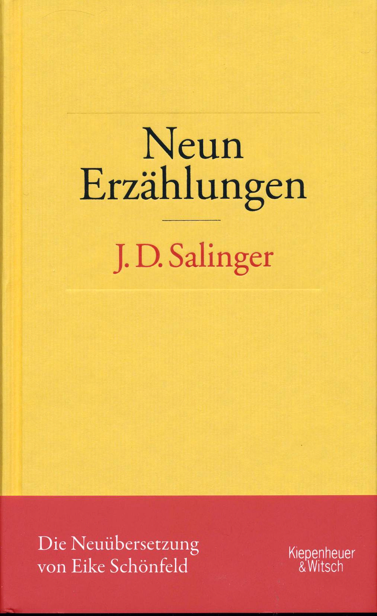
J. D. SALINGER
NEUN ERZÄHLUNGEN
Deutsch von Eike Schönfeld
Kiepenheuer & Witsch
1. Auflage 2012
Die Originalausgabe erschien 1953 unter dem Titel Nine Stories
bei Little, Brown and Company, Inc., New York.
Copyright© 1948, 1949, 1950, 1951, 1953 by J.D. Salinger Copyright
renewed 1975, 1976, 1977, 1979, 1981 by J.D. Salinger
Erste deutsche Übersetzung von Annemarie und Heinrich Böll und Elisabeth Schnack
© 1966, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Neuübersetzung von Eike Schönfeld
© 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte Vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Bärbel Flad
Umschlaggestaltung: Rudolf Linn, Köln
Gesetzt aus der Stempel Garamond
Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-462-04382-2
Für
Dorothy Olding
und
Gus Lobrano
Wir kennen den Laut zweier klatschender Hände,
Doch wie ist der Laut einer klatschenden Hand?
– Ein Zen-Koan –
INHALT
Ein idealer Tag für Bananenfische
Onkel Wiggily in Connecticut
Kurz vor dem Krieg gegen die Eskimos
Der lachende Mann
Am Dingi
Für Esmé – in Liebe und Elend
Hübsch mein Mund, die Augen grün
De Daumier–Smiths blaue Periode
Teddy
EIN IDEALER TAG FÜR BANANENFISCHE
In dem Hotel waren siebenundneunzig New Yorker Werbeleute, die die Fernverbindungen derart in Beschlag hielten, dass die junge Frau auf 507 von mittags bis beinahe halb drei warten musste, ehe sie mit ihrem Anruf durchkam. Aber sie nutzte die Zeit. Sie las in einer taschenbuchgroßen Zeitschrift einen Artikel mit dem Titel »Sex ist schön – oder die Hölle«. Sie wusch Kamm und Bürste aus. Sie entfernte den Fleck aus dem Rock ihres beigefarbenen Kostüms. Sie versetzte den Knopf an der Saks–Bluse. Sie zupfte zwei frisch gewachsene Härchen auf ihrem Leberfleck aus. Als die Telefonistin sie schließlich auf dem Zimmer anrief, saß sie auf der Fensterbank und hatte die Nägel ihrer linken Hand fast vollständig lackiert.
Sie war eine von denen, die wegen eines klingelnden Telefons nun wirklich nichts weglegten. Sie sah aus, als hätte das Telefon unablässig geklingelt, seit sie in die Pubertät gekommen war.
Mit ihrem kleinen Lackpinsel bestrich sie, während das Telefon klingelte, den Nagel ihres kleinen Fingers, betonte besonders die Linie des Nagelmonds. Dann schraubte sie den Deckel auf das Lackfläschchen und wedelte beim Aufstehen mit der linken – der nassen – Hand durch die Luft. Mit der trockenen nahm sie einen übervollen Aschenbecher von der Fensterbank und trug ihn zum Nachttischchen, auf dem das Telefon stand. Sie setzte sich auf eines der beiden gemachten Einzelbetten und nahm – beim fünften oder sechsten Klingeln – den Hörer ab.
»Hallo«, sagte sie, wobei sie die Finger der linken Hand ausgestreckt von ihrem weißen Seidenmorgenmantel weghielt, der bis auf die Pantoffeln das Einzige war, was sie trug – ihre Ringe lagen im Badezimmer.
»Ich habe jetzt Ihren Anruf nach New York, Mrs Glass«, sagte die Telefonistin.
»Danke«, sagte die junge Frau und machte auf dem Nachttischchen Platz für den Ascher.
Eine Frauenstimme meldete sich. »Muriel? Bist du das?«
Die junge Frau drehte den Hörer ein klein wenig vom Ohr weg. »Ja, Mutter. Wie geht es dir?«, sagte sie.
»Ich habe mich zu Tode um dich gesorgt. Warum hast du denn nicht angerufen? Ist alles in Ordnung?«
»Ich hab’s gestern Abend versucht und auch noch den Abend davor. Das Telefon hier ist –«
»Ist alles in Ordnung, Muriel?«
Die junge Frau vergrößerte den Winkel zwischen Hörer und Ohr. »Mir geht’s gut. Mir ist ganz heiß. Es ist der heißeste Tag, den sie in Florida seit –«
»Warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich habe mich zu –«
»Liebste Mutter, schrei mich nicht an. Ich kann dich hervorragend hören«, sagte die junge Frau. »Ich habe dich gestern Abend zweimal angerufen. Einmal gleich nach –«
»Ich habe deinem Vater noch gesagt, dass du wahrscheinlich gestern Abend angerufen hast. Aber nein, er musste ja – Ist alles in Ordnung, Muriel? Sag mir die Wahrheit.«
»Mir geht’s gut. Hör bitte auf, mich das zu fragen.«
»Wann bist du angekommen?«
»Ich weiß nicht. Mittwochvormittag, früh.«
»Wer ist gefahren?«
»Er«, sagte die junge Frau. »Und reg dich nicht auf. Er ist sehr schön gefahren. Ich war erstaunt.«
»Er ist gefahren? Muriel, du hast mir dein Ehren–«
»Mutter«, unterbrach sie die junge Frau. »Gerade habe ich es dir gesagt. Er ist sehr schön gefahren. Im Übrigen die ganze Strecke unter achtzig.«
»Hat er wieder diese komischen Sachen mit den Bäumen probiert?«
»Ich sagte doch, er ist sehr schön gefahren, Mutter. Also bitte. Ich habe ihn gebeten, sich dicht an die weiße Linie zu halten, und er wusste, was ich damit meinte, und er hat es getan. Er hat sich sogar bemüht, nicht auf die Bäume zu gucken – das war ganz offensichtlich. Hat Daddy übrigens den Wagen repariert bekommen?«
»Noch nicht. Die wollen vierhundert Dollar, nur wegen –«
»Mutter, Seymour hat Papa doch gesagt, dass er es bezahlt. Es gibt keinen Grund zu –«
»Na, wir werden sehen. Wie hat er sich benommen – im Wagen und überhaupt?«
»Ganz gut«, sagte die junge Frau.
»Hat er dich mit diesem grässlichen –«
»Nein. Er hat jetzt einen neuen Namen für mich.«
»Was?«
»Ach, was ändert das schon, Mutter.«
»Muriel, ich will es wissen. Dein Vater –«
»Schon gut, schon gut. Er nennt mich Miss Spirituelles Flittchen 1948«, sagte die junge Frau und kicherte.
»Das ist nicht lustig, Muriel. Das ist überhaupt nicht lustig. Es ist grauenvoll. Eigentlich traurig. Wenn ich daran denke, wie –«
»Mutter«, unterbrach sie die junge Frau, »hör mir mal zu. Erinnerst du dich an das Buch, das er mir aus Deutschland geschickt hat? Du weißt schon – diese deutschen Gedichte. Was habe ich damit nur gemacht? Ich zerbreche mir den –«
»Du hast es doch.«
»Bist du sicher?«, sagte die junge Frau.
»Aber natürlich. Vielmehr, ich habe es. Es ist in Freddies Zimmer. Da hast du es liegen gelassen, und ich hatte keinen Platz dafür im – Warum? Will er es?«
»Nein. Er hat mich nur auf der Herfahrt danach gefragt. Er wollte wissen, ob ich es gelesen habe.«
»Es war auf Deutsch!«
»Ja, Mutter. Das ändert doch nichts«, sagte die junge Frau und schlug die Beine übereinander. »Er hat gesagt, die Gedichte seien nun mal vom einzigen großen Dichter des Jahrhunderts geschrieben worden. Er hat gesagt, ich hätte eine Übersetzung oder so was kaufen sollen. Oder bitte schön die Sprache lernen.«
»Grässlich, ganz grässlich. Eigentlich ist es traurig, das ist es nämlich. Gestern Abend sagte dein Vater –«
»Einen Moment, Mutter«, sagte die junge Frau. Sie ging zur Fensterbank, nahm sich eine Zigarette, zündete sie an und kehrte zu ihrem Platz auf dem Bett zurück. »Mutter?«, sagte sie und stieß Rauch aus.
»Muriel. Nun hör mir mal zu.«
»Ich höre.«
»Dein Vater hat mit Dr. Sivetski gesprochen.«
»Ach«, sagte die junge Frau.
»Er hat ihm alles erzählt. Wenigstens hat er das gesagt – du kennst deinen Vater ja. Die Bäume. Die Sache mit dem Fenster. Die grauenvollen Dinge, die er zu Omi wegen ihrer Sterbepläne gesagt hat. Was er mit den ganzen hübschen Bildern von den Bermudas gemacht hat alles.«
»Ja?«, sagte die junge Frau.
»Ja. Als Erstes hat Dr. Sivetski gesagt, es sei ein absolutes Verbrechen, dass die Armee ihn aus dem Krankenhaus entlassen hat – Ehrenwort. Er hat deinem Vater sehr nachdrücklich gesagt, dass die Möglichkeit besteht – die Möglichkeit ist sehr groß, hat er gesagt –, dass Seymour vollständig die Beherrschung verlieren könnte. Ehrenwort.«
»Hier im Hotel gibt’s einen Psychiater«, sagte die junge Frau.
»Wer? Wie heißt er?«
»Das weiß ich nicht. Rieser oder so ähnlich. Er soll sehr gut sein.«
»Nie gehört.«
»Na, jedenfalls soll er sehr gut sein.«
»Muriel, werde bitte nicht pampig. Wir machen uns sehr große Sorgen um dich. Dein Vater wollte dir gestern Abend sogar telegrafieren, du solltest nach Hause kom–«
»Ich komme jetzt nicht nach Hause, Mutter. Entspann dich also.«
»Muriel. Ehrenwort. Dr. Sivetski hat gesagt, Seymour könnte vollständig die Beherr–«
»Ich bin doch erst angekommen, Mutter. Das ist mein erster Urlaub seit Jahren, und ich werde jetzt nicht einfach wieder alles einpacken und nach Hause kommen«, sagte die junge Frau. »Ich könnte jetzt ohnehin nicht reisen. Ich habe einen solchen Sonnenbrand, ich kann mich kaum rühren.«
»Einen schlimmen Sonnenbrand hast du? Hast du denn nicht die Dose Bronze genommen, die ich dir in den Koffer getan habe? Ich habe sie genau –«
»Ich habe sie genommen. Trotzdem bin ich verbrannt.«
»Das ist ja furchtbar. Wo bist du denn verbrannt?«
»Überall, Mutter, überall.«
»Das ist ja furchtbar.«
»Ich werd’s überleben.«
»Sag, hast du mit diesem Psychiater gesprochen?«
»Ja, gewissermaßen«, sagte die junge Frau.
»Was hat er gesagt? Wo war Seymour, als du mit ihm gesprochen hast?«
»Im Ocean Room, er hat Klavier gespielt. An beiden Abenden, seit wir hier sind, hat er Klavier gespielt.«
»Und, was hat er gesagt?«
»Ach, nicht viel. Er hat mich angesprochen. Ich habe gestern Abend beim Bingo neben ihm gesessen, und er hat mich gefragt, ob das nicht mein Mann sei, der im anderen Raum Klavier spielt. Ich habe Ja gesagt, und er hat mich gefragt, ob Seymour krank sei oder so was. Also habe ich gesagt –«
»Warum hat er das denn gefragt?«
»Ich weiß es nicht, Mutter. Vermutlich, weil er so blass und so weiter ist«, sagte die junge Frau. »Nach dem Bingo hat er mich jedenfalls gefragt, ob ich mit ihm und seiner Frau etwas trinken wolle. Das habe ich dann getan. Seine Frau war grauenvoll. Erinnerst du dich an das grässliche Abendkleid, das wir bei Bonwit im Schaufenster gesehen haben? Von dem du gesagt hast, da bräuchte man einen ganz, ganz kleinen –«
»Das grüne?«
»Das hatte sie an. Und dann diese Hüften. Ständig hat sie mich gefragt, ob Seymour mit dieser Suzanne Glass verwandt ist, die diesen Laden in der Madison Avenue hat – diesen Modesalon.«
»Aber was hat er gesagt? Der Arzt.«
»Ach, eigentlich nicht viel. Schließlich waren wir ja in der Bar und so weiter. Es war schrecklich laut.«
»Ja, aber hast du – hast du ihm gesagt, was er mit Omis Stuhl machen wollte?«
»Nein, Mutter. Ich bin nicht weiter in die Details gegangen«, sagte die junge Frau. »Wahrscheinlich habe ich morgen noch einmal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Er ist den ganzen Tag in der Bar.«
»Hat er gesagt, es könnte die Möglichkeit bestehen, dass er – na ja – komisch oder dergleichen werden könnte? Dir etwas antut!«
»Nicht so richtig«, sagte die junge Frau. »Er braucht mehr Fakten, Mutter. Sie müssen etwas über die Kindheit wissen – diesen ganzen Kram. Ich habe dir doch gesagt, wir konnten kaum reden, weil es da so laut war.«
»Na schön. Was ist mit dem blauen Mantel?«
»Alles in Ordnung. Ich habe die Polster ein wenig verkleinern lassen.«
»Wie sind denn die Kleider dieses Jahr?«
»Schrecklich. Aber sagenhaft. Man sieht Pailletten – alles«, sagte die junge Frau.
»Wie ist dein Zimmer?«
»Ganz gut. Mehr aber auch nicht. Das Zimmer, das wir vor dem Krieg immer hatten, haben wir nicht gekriegt«, sagte die junge Frau. »Die Leute sind grässlich dieses Jahr. Du solltest mal sehen, was da im Speisesaal so neben uns sitzt. Am Nebentisch. Die sehen aus, als wären sie mit dem Lastwagen gekommen.«
»Ach, es ist überall das Gleiche. Und wie ist dein Ballerinarock?«
»Zu lang. Ich habe dir ja gesagt, er ist zu lang.«
»Muriel, ich frage dich jetzt nur noch ein Mal – ist alles in Ordnung?«
»Ja, Mutter«, sagte die junge Frau. »Zum neunzigsten Mal.«
»Und du willst nicht nach Hause kommen?«
»Nein, Mutter.«
»Dein Vater sagte gestern Abend, er sei nur zu gern bereit, es zu bezahlen, wenn du allein irgendwohin fahren wolltest, um dir einmal alles zu überlegen. Du könntest ja eine nette Kreuzfahrt machen. Wir haben beide gedacht –«
»Nein danke«, sagte die junge Frau und streckte die Beine wieder. »Mutter, dieses Gespräch kostet ein Verm–«
»Wenn ich daran denke, wie du den ganzen Krieg hindurch auf diesen Jungen gewartet hast – ich meine, wenn man mal an die ganzen verrückten Ehefrauchen denkt, die –«
»Mutter«, sagte die junge Frau, »wir legen jetzt lieber auf. Seymour könnte jeden Moment kommen.«
»Wo ist er?«
»Am Strand.«
»Am Strand? Allein? Benimmt er sich denn am Strand?«
»Mutter«, sagte die junge Frau, »du sprichst von ihm, als wäre er ein tobender Irrer –«
»Etwas Derartiges habe ich nicht gesagt, Muriel.«
»Na, so hat es sich jedenfalls angehört. Er liegt doch einfach nur da. Er zieht nicht mal den Bademantel aus.«
»Er zieht den Bademantel nicht aus? Warum nicht?«
»Das weiß ich nicht. Vermutlich, weil er so blass ist.«
»Meine Güte, er braucht doch Sonne. Kannst du ihm das nicht sagen?«
»Du kennst doch Seymour«, sagte die junge Frau und schlug die Beine wieder übereinander. »Er sagt, er will nicht, dass so viele Idioten seine Tätowierung sehen.«
»Er hat doch gar keine Tätowierung! Hat er eine von der Armee?«
»Nein, Mutter. Nein«, sagte die junge Frau und stand auf. »Hör zu, ich rufe dich vielleicht morgen wieder an.«
»Muriel, nun hör mir mal zu.«
»Ja, Mutter«, sagte die junge Frau und verlagerte das Gewicht aufs rechte Bein.
»Ruf mich sofort an, wenn er etwas auch nur annähernd Komisches macht oder sagt – du weißt, was ich meine. Hörst du?«
»Mutter, ich habe keine Angst vor Seymour.«
»Muriel, ich möchte, dass du mir das versprichst.«
»Na gut, versprochen. Wiedersehen, Mutter«, sagte die junge Frau. »Und grüß Papa von mir.«
Sie legte auf.
»Sieh mehr Glas«, sagte Sybil Carpenter, die mit ihrer Mutter in dem Hotel wohnte. »Sieh mehr Glas.«
»Mein Kätzchen, sag das nicht. Es macht Mami absolut verrückt. Halt bitte still.«
Mrs Carpenter trug Sonnenöl auf Sybils Rücken auf, verrieb es auf ihren zarten, flügelartigen Schulterblättern. Sybil saß wackelig auf einem riesigen aufgeblasenen Strandball und blickte auf den Ozean. Sie trug einen kanariengelben zweiteiligen Badeanzug, dessen einen Teil sie die nächsten neun oder zehn Jahre eigentlich gar nicht brauchen würde.
»Es war wirklich nur ein gewöhnliches Seidentuch – das konnte man sehen, wenn man nahe dran war«, sagte die Frau in dem Liegestuhl neben Mrs Carpenter. »Wenn ich nur wüsste, wie sie es gebunden hat. Es war zu goldig.«
»Es klingt goldig«, pflichtete Mrs Carpenter ihr bei. »Sybil, halt still, mein Kätzchen.«
»Ist sieh mehr Glas da?«, sagte Sybil.
Mrs Carpenter seufzte. »Na schön«, sagte sie. Sie schraubte die Kappe auf die Sonnenölflasche. »Nun lauf und spiel, mein Kätzchen. Mami geht ins Hotel und trinkt mit Mrs Hubbel einen Martini. Ich bringe dir dann die Olive.«
Freigegeben, rannte Sybil sogleich zum flachen Teil des Strandes hinunter und lief dann in Richtung des Fischerpavillons. Nur einmal hielt sie an, um den Fuß in eine durchweichte, eingefallene Burg zu stecken, dann war sie schon bald außerhalb des Areals, das für die Hotelgäste reserviert war.
Sie ging ungefähr einen halben Kilometer und rannte dann unvermittelt den weichen Teil des Strandes schräg hinauf. Abrupt blieb sie stehen, als sie die Stelle erreichte, wo ein junger Mann auf dem Rücken lag.
»Gehst du ins Wasser, sieh mehr Glas?«, fragte sie.
Der junge Mann fuhr zusammen, seine rechte Hand griff nach dem Revers seines Frotteemantels. Er drehte sich auf den Bauch, ließ ein zur Wurst aufgerolltes Tuch von den Augen fallen und blinzelte zu Sybil hinauf.
»Hey. Hallo, Sybil.«
»Gehst du ins Wasser?«
»Ich habe auf dich gewartet«, sagte der junge Mann. »Was gibt’s Neues?«
»Was?«, fragte Sybil.
»Was gibt’s Neues? Was steht auf dem Programm?«
»Mein Papa kommt morgen mit dem Fluchzeug«, sagte Sybil, mit Sand herumkickend.
»Nicht mir ins Gesicht, Herzchen«, sagte der junge Mann und packte Sybil am Knöchel. »Es wird auch allmählich Zeit, dass er kommt, dein Papa. Ich erwarte ihn stündlich. Stündlich.«
»Wo ist die Frau?«, fragte Sybil.
»Die Frau?«
Der junge Mann strich sich Sand aus den dünnen Haaren. »Schwer zu sagen, Sybil. Sie kann an tausend Orten sein. Beim Friseur. Wo sie sich die Haare nerzbraun färben lässt. Oder sie macht auf ihrem Zimmer Puppen für arme Kinder.«
Er lag nun flach auf dem Bauch, ballte die Fäuste, setzte eine auf die andere und legte das Kinn darauf. »Frag mich was anderes, Sybil«, sagte er. »Da hast du aber einen schönen Badeanzug an. Wenn ich etwas mag, dann blaue Badeanzüge.«
Sybil starrte ihn an und dann auf ihren vorgestreckten Bauch. »Das ist ein gelber«, sagte sie. »Ein gelber ist das.«
»Wirklich? Komm ein bisschen näher.«
Sybil trat einen Schritt vor.
»Du hast vollkommen recht. Was bin ich doch für ein Trottel.«
»Gehst du ins Wasser?«, fragte Sybil.
»Das erwäge ich ernsthaft. Ich denke intensiv darüber nach, Sybil, das hörst du sicher gern.«
Sybil stupste das Gummifloß an, das der junge Mann manchmal als Kopfstütze nahm. »Da fehlt Luft«, sagte sie.
»Du hast recht. Da fehlt mehr Luft, als ich gern zugeben würde.«
Er nahm die Fäuste weg und legte das Kinn in den Sand. »Sybil«, sagte er, »du siehst gut aus. Schön, dich zu sehen. Erzähl mir was von dir.«
Er streckte die Hände aus und packte Sybil an beiden Knöcheln. »Ich bin Steinbock«, sagte er. »Was bist du?«
»Sharon Lipschutz hat gesagt, du lässt sie mit dir auf der Klavierbank sitzen«, sagte Sybil.
»Das hat Sharon Lipschutz gesagt?«
Sybil nickte heftig.
Er ließ ihre Knöchel los, zog die Hände zurück und legte das Gesicht seitlich auf den rechten Unterarm. »Na«, sagte er, »du weißt ja, wie solche Sachen passieren, Sybil. Ich habe dann gesessen und gespielt. Und du warst nirgends zu sehen. Und dann kam Sharon Lipschutz und hat sich neben mich gesetzt. Da konnte ich sie doch schlecht runterschubsen, oder?«
»Doch.«
»O nein. Das ging nicht«, sagte der junge Mann. »Aber ich sage dir, was ich gemacht habe.«
»Was?«
»Ich habe so getan, als wäre sie du.«
Sogleich beugte sich Sybil herunter und grub im Sand. »Gehn wir ins Wasser«, sagte sie.
»Na gut«, sagte der junge Mann. »Ich glaube, das kann ich einschieben.«
»Das nächste Mal schubst du sie aber runter«, sagte Sybil.
»Wen soll ich runterschubsen?«
»Sharon Lipschutz.«
»Ah, Sharon Lipschutz«, sagte der junge Mann. »Wie dieser Name immer wieder auftaucht. Erinnerung mit Begehren vermengt.«
Unvermittelt stand er auf. Er schaute auf den Ozean. »Sybil«, sagte er, »weißt du, was wir machen? Wir sehen mal, ob wir einen Bananenfisch fangen können.«
»Einen was?«
»Einen Bananenfisch«, sagte er und öffnete den Gürtel seines Bademantels. Er zog ihn aus. Seine Schultern waren weiß und schmal, seine Badehose war königsblau. Er faltete den Bademantel zusammen, erst längs, dann zu Dritteln. Er rollte das Handtuch auseinander, das er über den Augen gehabt hatte, breitete es auf dem Sand aus und legte dann den zusammengefalteten Bademantel darauf. Er bückte sich, hob das Floß hoch und klemmte es sich unter den rechten Arm. Dann nahm er mit der linken Hand Sybils Hand.
Zusammen gingen sie zum Ozean.
»Ich könnte mir denken, du hast in deinem Leben auch schon einige Bananenfische gesehen«, sagte der junge Mann.
Sybil schüttelte den Kopf.
»Nicht? Wo wohnst du denn?«
»Weiß ich nicht«, sagte Sybil.
»Klar weißt du das. Das musst du doch wissen. Sharon Lipschutz weiß auch, wo sie wohnt, und die ist erst dreieinhalb.«
Sybil blieb stehen und riss die Hand von ihm los. Sie hob eine gewöhnliche Strandmuschel auf und betrachtete sie mit eingehendem Interesse. Sie warf sie wieder hin. »Whirly Wood, Connecticut«, sagte sie und ging wieder weiter, Bauch voran.
»Whirly Wood, Connecticut«, sagte der junge Mann. »Liegt das zufällig in der Nähe von Whirly Wood, Connecticut?«
Sybil sah ihn an. »Da wohne ich doch«, sagte sie ungeduldig. »Ich wohne in Whirly Wood, Connecticut.«
Sie lief ein paar Schritte voraus, fasste den linken Fuß mit der linken Hand und hüpfte zwei–, dreimal.
»Du hast ja keine Ahnung, wie klar dadurch alles wird«, sagte der junge Mann.
Sybil ließ ihren Fuß los. »Hast du ›Der kleine schwarze Sambo‹ gelesen?«, fragte sie.
»Sehr eigenartig, dass du mich das fragst«, sagte er. »Rein zufällig habe ich es gestern Abend zu Ende gelesen.«
Er griff wieder nach Sybils Hand. »Wie fandest du es?«, fragte er sie.
»Sind die Tiger um den Baum rumgerannt?«
»Ich hab gedacht, die hören nie auf. Noch nie habe ich so viele Tiger gesehen.«
»Es waren doch nur sechs«, sagte Sybil.
»Nur sechs!«, sagte der junge Mann. »Das nennst du nur?«
»Magst du Wachs?«, fragte Sybil.
»Ob ich was mag?«, fragte der junge Mann.
»Wachs.«
»Sehr. Du nicht auch?«
Sybil nickte. »Magst du Oliven?«, fragte sie.
»Oliven – ja, Oliven und Wachs. Ohne die gehe ich nicht aus dem Haus.«
»Magst du Sharon Lipschutz?«, fragte Sybil.
»Ja. Doch, ich mag sie«, sagte der junge Mann. »Besonders gern mag ich an ihr, dass sie in der Hotellobby nie gemein zu kleinen Hunden ist. Zum Beispiel zu dem kleinen Zwergterrier, der der Frau aus Kanada gehört. Wahrscheinlich wirst du es mir nicht glauben, aber manche kleine Mädchen stupsen den kleinen Hund mit Ballonstöckchen. Sharon aber nicht. Sie ist nie gemein oder unfreundlich. Deswegen mag ich sie so gern.«
Sybil schwieg.
»Ich kaue gern an Kerzen«, sagte sie schließlich.
»Wer mag das nicht?«, sagte der junge Mann und machte sich die Füße nass. »Huu, ist das kalt.«
Er ließ das Gummifloß fallen. »Nein, warte noch kurz, Sybil. Warte, bis wir ein wenig weiter drin sind.«
Sie wateten hinein, bis das Wasser Sybil an die Taille ging. Dann hob der junge Mann sie hoch und legte sie bäuchlings auf das Floß.
»Trägst du nie eine Bademütze oder so was?«, fragte er.
»Nicht loslassen«, befahl Sybil. »Halt mich jetzt ja fest.«
»Miss Carpenter. Bitte. Ich weiß, was ich zu tun habe«, sagte der junge Mann. »Halt du nur nach Bananenfischen Ausschau. Heute ist der ideale Tag für Bananenfische.«
»Ich seh keine«, sagte Sybil.
»Das ist verständlich. Sie haben sehr eigentümliche Gewohnheiten. Sehr eigentümliche.«
Er stieß das Floß weiter. Das Wasser ging ihm nicht ganz bis zur Brust. »Sie haben ein sehr tragisches Leben«, sagte er. »Weißt du, was sie tun?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Also, die schwimmen in ein Loch, wo es viele Bananen gibt. Wenn sie hineinschwimmen, sind sie ganz gewöhnliche Fische. Aber kaum sind sie drin, führen sie sich auf wie die Schweine. Also, ich habe Bananenfische gesehen, die sind in ein Bananenloch geschwommen und haben achtundsiebzig Bananen gefressen.«
Er schob das Floß und dessen Passagier einen halben Meter näher zum Horizont. »Und dann sind sie so fett, dass sie natürlich nicht mehr aus dem Loch rauskommen. Passen nicht mehr durch die Tür.«
»Nicht zu weit raus«, sagte Sybil. »Was passiert dann mit ihnen?«
»Was passiert mit wem?«
»Den Bananenfischen.«
»Ach, du meinst, nachdem sie so viele Bananen gefressen haben, dass sie nicht mehr aus dem Bananenloch rauskommen?«
»Ja«, sagte Sybil.
»Also, gern sage ich es dir nicht, Sybil. Sie sterben.«
»Warum?«, fragte Sybil.
»Na, die kriegen Bananenfieber. Das ist eine schreckliche Krankheit.«
»Da kommt eine Welle«, sagte Sybil nervös.
»Die ignorieren wir. Die schneiden wir«, sagte der junge Mann. »Zwei Snobs.«
Er packte Sybil an den Knöcheln und drückte sie runter und nach vorn. Das Floß schob sich über den Wellenkamm. Das Wasser machte Sybils blonde Haare nass, aber ihr Schrei klang vergnügt.
Als das Floß wieder waagerecht lag, wischte sie sich mit der Hand eine flache, nasse Haarsträhne von den Augen und berichtete: »Gerade habe ich einen gesehen.«
»Was hast du gesehen, mein Schätzchen?«
»Einen Bananenfisch.«
»Mein Gott, nein!«, sagte der junge Mann. »Hatte er Bananen im Maul?«
»Ja«, sagte Sybil. »Sechs.«
Plötzlich hob der junge Mann einen von Sybils nassen Füßen hoch, die über den Rand des Floßes hingen, und küsste ihn auf den Spann.
»He!«, sagte die Besitzerin des Fußes und drehte sich um.
»Selber he! Wir gehen jetzt raus. Hast du genug?«
»Nein!«
»Tut mir leid«, sagte er und stieß das Floß Richtung Ufer, bis Sybil abstieg. Den Rest der Strecke trug er es.
»Wiedersehen«, sagte Sybil und rannte ohne Bedauern Richtung Hotel.
Der junge Mann schlüpfte in den Bademantel, zog das Revers fest zu und stopfte das Handtuch in die Tasche. Er nahm das glitschig nasse Floß und klemmte es sich unter den Arm. Allein stapfte er durch den weichen, heißen Sand zum Hotel.
Im Untergeschoss des Hotels, wo die Badenden auf Wunsch der Direktion hineingehen sollten, stieg eine Frau, Zinksalbe auf der Nase, mit dem jungen Mann in den Fahrstuhl.
»Wie ich sehe, schauen Sie auf meine Füße«, sagte er zu ihr, als die Kabine sich in Bewegung gesetzt hatte.
»Wie bitte?«, sagte die Frau.
»Ich sagte, wie ich sehe, schauen Sie auf meine Füße.«
»Wie bitte? Zufällig schaue ich auf den Fußboden«, sagte die Frau, den Blick auf die Kabinentür.
»Wenn Sie auf meine Füße schauen wollen, brauchen Sie es nur zu sagen«, sagte der junge Mann. »Aber machen Sie es nicht so verdammt heimlich.«
»Lassen Sie mich bitte aussteigen«, sagte die Frau rasch zu der jungen Frau, die den Aufzug bediente.
Die Aufzugtüren gingen auf, und die Frau stieg aus, ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Ich habe zwei normale Füße, ich sehe nicht den mindesten verdammten Grund, dass jemand sie anstarren sollte«, sagte der junge Mann. »Fünfter, bitte.«
Er zog seinen Zimmerschlüssel aus der Bademanteltasche.
Im fünften Stock stieg er aus, ging durch den Flur und schloss 507 auf. Das Zimmer roch nach neuem Kalbsledergepäck und Nagellackentferner.
Er warf kurz einen Blick auf die junge Frau, die auf einem der beiden Einzelbetten schlief. Dann ging er zu einem der Gepäckstücke, öffnete es und zog unter einem Stapel Unterhosen und -hemden eine Ortgies Automatik, Kaliber 7,65 hervor. Er klinkte das Magazin aus, betrachtete es und schob es wieder hinein. Er spannte die Waffe. Dann ging er zu dem freien Einzelbett und setzte sich, schaute auf die junge Frau, legte die Pistole an und schoss sich eine Kugel durch die rechte Schläfe.
ONKEL WIGGILY
IN CONNECTICUT
Es war schon beinahe drei Uhr, als Mary Jane endlich Eloise’ Haus fand. Sie erklärte Eloise, die zu ihrer Begrüßung in die Auffahrt gekommen war, alles sei absolut perfekt gelaufen, sie habe den Weg exakt in Erinnerung gehabt, bis sie am Merrick Parkway abgebogen sei. Eloise sagte: »Merritt Parkway, Schätzchen«, und erinnerte Mary Jane daran, dass sie das Haus vorher schon zweimal gefunden habe, doch Mary Jane jammerte nur undeutlich, etwas über ihre Schachtel Kleenex, und lief zu ihrem Cabrio zurück. Eloise schlug den Kragen ihres Kamelhaarmantels hoch, stellte sich mit dem Rücken zum Wind und wartete. Schon bald war Mary Jane wieder da, mit einem Kleenex hantierend, und wirkte noch immer aufgebracht, gar befleckt. Eloise sagte fröhlich, das ganze verdammte Mittagessen sei verbrannt – das Bries, alles –, aber Mary Jane sagte, sie habe ohnehin schon unterwegs gegessen. Auf dem Weg zum Haus fragte Eloise Mary Jane, wie es komme, dass sie einen Tag frei habe. Mary Jane sagte, sie habe nicht den ganzen Tag frei, es sei nur so, dass Mr Weyinburg einen Bruch habe und zu Hause in Larchmont sei und dass sie ihm jeden Nachmittag die Post bringen und ein paar Briefe abholen müsse. Sie fragte Eloise: »Was ist denn überhaupt genau ein Bruch?« Eloise ließ ihre Zigarette auf den schmutzigen Schnee zu ihren Füßen fallen und meinte, so ganz genau wisse sie es auch nicht, aber Mary Jane müsse nicht allzu große Angst haben, einen zu bekommen. Mary Jane sagte »Oh«, und dann betraten die beiden Frauen das Haus.
Zwanzig Minuten später tranken sie im Wohnzimmer schon ihren ersten Highball aus und unterhielten sich auf eine Weise, die ehemaligen Zimmergenossinnen am College eigen, womöglich sogar auf sie beschränkt ist. Etwas noch Stärkeres verband sie; beide hatten sie keinen Abschluss gemacht. Eloise hatte das College mitten in ihrem zweiten Studienjahr verlassen, 1942 war das, eine Woche, nachdem sie in einem geschlossenen Fahrstuhl im dritten Stock ihres Wohnheims mit einem Soldaten erwischt worden war. Mary Jane war – im selben Jahr, im selben Kurs, fast im selben Monat – abgegangen, um einen in Jacksonville, Florida, stationierten Luftwaffenkadetten zu heiraten, einen schmalen Jungen aus Dill, Mississippi, der nur die Fliegerei im Kopf hatte und zwei der drei Monate, die Mary Jane mit ihm verheiratet war, im Gefängnis saß, weil er einen Militärpolizisten niedergestochen hatte.
»Nein«, sagte Eloise gerade. »Sie waren vielmehr rot.«
Sie hatte sich auf der Couch ausgestreckt und ihre dünnen, aber sehr hübschen Beine an den Knöcheln übereinandergeschlagen.
»Ich habe gehört, sie waren blond«, wiederholte Mary Jane. Sie saß auf dem blauen Stuhl. »Soundso hat Stein und Bein geschworen, sie waren blond.«
»Mm. Ganz bestimmt.«
Eloise gähnte. »Ich war praktisch im selben Zimmer mit ihr, als sie sie gefärbt hat. Was denn? Sind da keine Zigaretten mehr drin?«
»Schon gut. Ich habe eine ganze Schachtel«, sagte Mary Jane. »Irgendwo.«
Sie kramte in ihrer Handtasche.
»Dieses dämliche Hausmädchen«, sagte Eloise, ohne sich von der Couch zu rühren. »Vor ungefähr einer Stunde habe ich ihr zwei nagelneue Schachteln vor die Nase gelegt. Jeden Moment wird sie reinkommen und mich fragen, was sie damit machen soll. Wo war ich denn nun stehen geblieben, Herrgott?«
»Thieringer«, half Mary Jane nach und zündete sich eine ihrer Zigaretten an.
»Ja, richtig. Ich erinnere mich genau. Sie hat sie am Abend vor ihrer Hochzeit mit diesem Frank Henke gefärbt. Erinnerst du dich überhaupt an ihn?«
»Bloß vage. So ein kleiner Gefreiter? Schrecklich unattraktiv?«
»Unattraktiv. Gott! Der sah aus wie ein ungewaschener Bela Lugosi.«
Mary Jane warf den Kopf zurück und lachte dröhnend. »Großartig«, sagte sie und nahm wieder ihre Trinkhaltung ein.
»Gib mir mal dein Glas«, sagte Eloise, schwang die bestrumpften Füße auf den Boden und stand auf. »Ehrlich, diese Kuh. Ich habe alles unternommen, dass Lew sie bekniet, sie soll zu uns kommen. Jetzt tut es mir leid, dass ich – Woher hast du denn das Ding da?«
»Das?«, sagte Mary Jane und fasste sich an die Kameenbrosche an ihrem Hals. »Liebe Güte, die hatte ich schon im College. Sie hat mal Mutter gehört.«
»Gott«, sagte Eloise, die leeren Gläser in der Hand. »Ich habe verdammt nichts Heiliges anzuziehen. Sollte Lews Mutter je sterben – ha ha –, dann hinterlässt sie mir wahrscheinlich einen alten Eispickel mit Monogramm oder so was.«
»Wie kommst du denn in letzter Zeit mit ihr aus?«
»Mach keine Witze«, sagte Eloise auf dem Weg zur Küche.
»Das ist aber wirklich der letzte für mich!«, rief Mary Jane ihr nach.
»Von wegen. Wer hat hier wen besucht? Und wer ist zwei Stunden zu spät gekommen? Du bleibst hier, bis ich dich satthabe. Zum Teufel mit deiner dämlichen Karriere.«
Mary Jane warf erneut den Kopf zurück und lachte dröhnend, doch Eloise war schon in der Küche.
Mit wenig oder gar nichts versorgt, um in einem Zimmer allein gelassen zu werden, stand Mary Jane auf und trat ans Fenster. Sie zog den Vorhang beiseite und lehnte sich mit dem Handgelenk an eine der Sprossen zwischen den Scheiben, zog es aber, als sie Staub spürte, wieder zurück, rieb es mit der anderen Hand sauber und stellte sich aufrechter hin. Draußen verwandelte sich der verdreckte Matsch sichtbar in Eis. Mary Jane ließ den Vorhang los und schlenderte zu dem blauen Stuhl zurück, vorbei an zwei übervollen Bücherregalen, ohne auch nur auf einen Titel zu schauen. Als sie saß, öffnete sie ihre Handtasche, holte den Spiegel heraus und betrachtete ihre Zähne. Sie schloss die Lippen, fuhr mit der Zunge kräftig über die oberen Schneidezähne und betrachtete sie erneut.
»Draußen wird es ganz eisig«, sagte sie, während sie sich umdrehte. »Gott, das ging aber schnell. Hast du denn auch Soda reingetan?«
Eloise, in jeder Hand ein frisch gefülltes Glas, blieb stehen. Sie streckte beide Zeigefinger wie Pistolenläufe aus und sagte: »Keiner bewegt sich. Das ganze verdammte Haus ist umstellt.«
Mary Jane lachte und steckte den Spiegel weg.
Eloise kam mit den Gläsern. Unsicher stellte sie Mary Janes auf den Untersetzer, behielt ihres aber in der Hand. Sie streckte sich wieder auf der Couch aus. »Was glaubst du, was die da draußen macht?«, fragte sie. »Sie sitzt auf ihrem fetten schwarzen Hintern und liest ›Das Gewand‹. Mir sind beim Rausholen die Eisschalen runtergefallen. Und sie hat ganz gereizt aufgeschaut.«
»Das ist mein letzter. Ganz ehrlich«, sagte Mary Jane und nahm ihr Glas. »Ach, hör mal! Weißt du, wen ich letzte Woche gesehen habe? Bei Lord & Taylor’s im Erdgeschoss?«
»Mm«, sagte Eloise und rückte das Kissen unter ihrem Kopf zurecht. »Akim Tamiroff.«
»Wer?«, fragte Mary Jane. »Wer ist das denn?«
»Akim Tamiroff. Der ist Filmschauspieler. Der sagt immer: ›Du maks große Wietz – hah?‹ Köstlich. … In diesem Haus ertrage ich kein einziges verdammtes Kissen. Wen hast du gesehen?«
»Jackson. Sie war –«
»Welche?«
»Weiß nicht. Die, die bei uns in Psycho war, die immer –«
»Die waren doch beide bei uns in Psycho.«
»Na. Die mit dem irrwitzigen –«
»Marcia Louise. Der bin ich auch mal über den Weg gelaufen. Hat sie dir ein Loch in den Bauch geredet?«
»Gott, ja. Aber weißt du, was sie mir erzählt hat? Dr. Whiting ist tot. Sie sagte, Barbara Hill habe ihr geschrieben, Whiting habe letzten Sommer Krebs bekommen und sei gestorben und so weiter. Sie habe nur noch achtundzwanzig Kilo gewogen. Als sie starb. Ist das nicht furchtbar?«
»Nein.«
»Eloise, du wirst eisenhart.«
»Hm. Was hat sie noch gesagt?«
»Ach, sie ist gerade aus Europa zurückgekehrt. Ihr Mann war in Deutschland oder so stationiert, mit dem war sie dort. Sie hatten ein Haus mit siebenundvierzig Zimmern, hat sie gesagt, nur mit noch einem weiteren Paar, und ungefähr zehn Leute Personal. Ein eigenes Pferd, und ihr Stallbursche war Hitlers persönlicher Reitlehrer oder so ähnlich. Ach, und dann fing sie an, mir zu erzählen, dass sie beinahe von einem farbigen Soldaten vergewaltigt wurde. Mitten im Erdgeschoss von Lord & Taylor’s fing sie damit an – du kennst die Jackson ja. Sie sagte, er sei der Chauffeur ihres Mannes gewesen und eines Vormittags habe er sie zum Markt gefahren oder so. Sie sagte, sie habe eine solche Angst gehabt, dass sie gar nicht –«
»Moment mal.«
Eloise hob den Kopf und die Stimme. »Bist du das, Ramona?«
»Ja«, antwortete die Stimme eines kleinen Kindes.
»Schließ bitte die Haustür hinter dir«, rief Eloise.
»Ramona ist das? Ach, ich will sie unbedingt sehen. Ist dir klar, dass ich sie nicht mehr gesehen habe, seit sie ihre –«
»Ramona«, schrie Eloise mit geschlossenen Augen, »geh in die Küche und lass dir von Grace die Galoschen ausziehen.«
»In Ordnung«, sagte Ramona. »Komm, Jimmy.«
»Ach, ich will sie unbedingt sehen«, sagte Mary Jane. »O Gott! Sieh nur, was ich gemacht habe. Es tut mir schrecklich leid, El.«
»Lass nur. Lass nur«, sagte Eloise. »Ich kann diesen Teppich sowieso nicht mehr sehen. Ich bring dir ein neues.«
»Nein, sieh doch, es ist noch mehr als halb voll!«
Mary Jane hielt ihr Glas hoch.
»Wirklich?«, fragte Eloise. »Gib mir mal ’ne Zigarette.«
Mary Jane hielt ihr die Schachtel Zigaretten hin und sagte: »Oh, ich muss sie unbedingt sehen. Wem sieht sie jetzt ähnlich?«
Eloise riss ein Streichholz an. »Akim Tamiroff.«
»Nein, ernsthaft.«
»Lew. Sie sieht aus wie Lew. Wenn seine Mutter vorbeikommt, sehen die drei wie Drillinge aus.«
Ohne sich aufzusetzen, griff Eloise nach einem Stapel Aschenbecher am hinteren Ende des Rauchtischchens. Erfolgreich hob sie den obersten hoch und stellte ihn sich auf den Bauch. »Einen Cockerspaniel oder so, das brauche ich«, sagte sie. »Jemanden, der aussieht wie ich.«
»Wie geht es jetzt mit ihren Augen?«, fragte Mary Jane. »Sie sind doch nicht etwa schlechter geworden?«
»Gott! Nicht, dass ich wüsste.«
»Sieht sie ohne Brille überhaupt was? Ich meine, wenn sie nachts aufsteht und aufs Klo muss oder so.«
»Das erzählt sie keinem. Bei Geheimnissen ist sie schlimm.«
Mary Jane drehte sich auf ihrem Stuhl um. »Ja, hallo, Ramona!«, sagte sie. »Was ist das nur für ein hübsches Kleid!«
Sie stellte ihr Glas ab. »Bestimmt erinnerst du dich nicht mehr an mich, Ramona.«
»Natürlich erinnert sie sich an dich. Wer ist die Dame, Ramona?«
»Mary Jane«, sagte Ramona und kratzte sich.
»Großartig!«, sagte Mary Jane. »Gibst du mir denn auch ein Küsschen, Ramona?«
»Hör auf damit«, sagte Eloise zu Ramona.
Ramona hörte auf, sich zu kratzen.
»Gibst du mir denn auch ein Küsschen, Ramona?«, fragte Mary Jane noch einmal.
»Ich küsse Leute nicht gern.«
Eloise schnaubte und fragte: »Wo ist Jimmy?«
»Hier.«
»Wer ist denn Jimmy?«, fragte Mary Jane Eloise.
»O Gott! Ihr Kavalier. Ist immer da, wo sie ist. Tut, was sie tut. Alles ein Riesengetue.«
»Tatsächlich?«, sagte Mary Jane begeistert. Sie beugte sich vor. »Einen Kavalier hast du, Ramona?«
Ramonas Augen hinter den dicken Brillengläsern gegen Kurzsichtigkeit spiegelten Mary Janes Begeisterung nicht im Geringsten.
»Mary Jane hat dich etwas gefragt, Ramona«, sagte Eloise.
Ramona steckte sich einen Finger in die kleine, breite Nase.
»Lass das«, sagte Eloise. »Mary Jane hat dich gefragt, ob du einen Kavalier hast.«
»Ja«, sagte Ramona, mit ihrer Nase beschäftigt.
»Ramona«, sagte Eloise. »Hör auf damit. Sofort.«
Ramona ließ die Hand sinken.
»Also, das finde ich ja ganz wunderbar«, sagte Mary Jane. »Wie heißt er denn? Sagst du mir, wie er heißt, Ramona? Oder ist das ein großes Geheimnis?«
»Jimmy«, sagte Ramona.
»Jimmy? Oh, was für ein wundervoller Name, Jimmy! Jimmy wie, Ramona?«
»Jimmy Jimmereeno«, sagte Ramona.
»Steh still«, sagte Eloise.
»Na! Das ist ja ein Name. Und wo ist Jimmy? Sagst du mir das, Ramona?«
»Hier«, sagte Ramona.
Mary Jane sah sich um, sah dann wieder Ramona an und lächelte so herausfordernd wie nur möglich. »Wo hier, mein Schatz?«
»Hier«, sagte Ramona. »Ich halte ihn an der Hand.«
»Das kapiere ich nicht«, sagte Mary Jane zu Eloise, die gerade ihr Glas leer trank.
»Sieh nicht mich an«, sagte Eloise.
Mary Jane sah wieder Ramona an. »Aah, verstehe. Jimmy ist nur ein kleiner Fantasiejunge. Großartig.«
Mary Jane beugte sich freundlich vor. »Wie geht es dir, Jimmy?«, sagte sie.
»Der redet nicht mit dir«, sagte Eloise. »Ramona, erzähl Mary Jane doch bitte von Jimmy.«
»Was soll ich ihr erzählen?«
»Steh bitte grade.… Erzähl Mary Jane, wie Jimmy aussieht.«
»Er hat grüne Augen und schwarze Plaare.«
»Was noch?«
»Keine Mama und keinen Papa.«
»Was noch?«
»Keine Sommersprossen.«
»Was noch?«
»Ein Schwert.«
»Was noch?«
»Ich weiß nicht«, sagte Ramona und kratzte sich wieder.
»Er klingt wunderbar!«, sagte Mary Jane und beugte sich noch weiter auf ihrem Stuhl vor. »Ramona. Sag mal. Hat Jimmy auch seine Galoschen ausgezogen, als du hereingekommen bist?«
»Er hat Stiefel«, sagte Ramona.
»Großartig«, sagte Mary Jane zu Eloise.
»Das glaubst nur du. Ich hab das hier den ganzen Tag. Jimmy isst mit ihr. Badet mit ihr. Schläft mit ihr. Sie schläft ganz außen auf einer Bettseite, damit sie ihm nicht wehtut, wenn sie sich umdreht.«
Von dieser Information offenbar tief beeindruckt und erfreut, zog Mary Jane die Unterlippe ein und ließ sie wieder los, um zu fragen: »Aber woher hat er denn diesen Namen?«
»Jimmy Jimmereeno? Weiß der Himmel.«
»Wahrscheinlich von einem kleinen Jungen aus der Nachbarschaft.«
Eloise schüttelte gähnend den Kopf. »In der Nachbarschaft gibt’s keine kleinen Jungen. Überhaupt keine Kinder. Hinter meinem Rücken nennen sie mich das Karnickel …«
»Mama«, sagte Ramona, »kann ich raus, spielen?«
Eloise schaute sie an. »Du bist doch eben erst reingekommen«, sagte sie.
»Jimmy will wieder raus.«
»Und warum, wenn ich fragen darf?«
»Er hat sein Schwert draußen liegen lassen.«
»Ach, der und sein verdammtes Schwert«, sagte Eloise. »Na, dann geh mal. Zieh dir wieder deine Galoschen an.«
»Kann ich das haben?«, fragte Ramona und nahm ein abgebranntes Streichholz aus dem Aschenbecher.
»Darf ich das haben. Ja. Aber geh bitte nicht auf die Straße.«
»Wiedersehen, Ramona!«, trällerte Mary Jane.
»Wiedersehen«, sagte Ramona. »Komm, Jimmy.«
Plötzlich sprang Eloise auf. »Gib mir dein Glas«, sagte sie.
»Nein, wirklich nicht, El. Ich sollte doch schon in Larchmont sein. Mr Weyinburg ist doch so reizend, und da möchte ich nicht –«
»Ruf an und sag, man hat dich umgebracht. Lass das verdammte Glas los.«
»Nein, ehrlich, El. Es friert doch so schrecklich. Ich habe kaum noch Frostschutzmittel im Wagen. Wenn ich doch nicht –«
»Lass es frieren. Ruf an. Sag, du bist tot«, sagte Eloise. »Gib her.«
»Na ja … Wo ist das Telefon?«
»Es ist«, sagte Eloise und ging mit den leeren Gläsern Richtung Esszimmer, »– irgendwo dort.«
Abrupt blieb sie auf den Dielen zwischen Wohnzimmer und Esszimmer stehen und wackelte mit den Hüften. Mary Jane kicherte.
»Du hast Walt doch gar nicht richtig gekannt«, sagte Eloise um Viertel vor fünf; sie lag rücklings auf dem Boden, auf ihrer kleinbusigen Brust stand prekär ein Glas. »Er war der einzige Junge, den ich kannte, der mich zum Lachen gebracht hat. Und zwar richtig.«
Sie sah zu Mary Jane hin. »Erinnerst du dich noch an den Abend – in unserem letzten Jahr –, als diese verrückte Louise Hermanson ins Zimmer platzte, in ihrem schwarzen Büstenhalter, den sie in Chicago gekauft hatte?«
Mary Jane kicherte. Sie lag bäuchlings auf der Couch, das Kinn auf der Armlehne, das Gesicht zu Eloise gedreht. Ihr Glas stand in Reichweite auf dem Fußboden.
»Also, so konnte er mich zum Lachen bringen«, sagte Eloise. »Er konnte es, wenn er mit mir redete. Er konnte es am Telefon. Er konnte es sogar in einem Brief. Und das Beste daran war, dass er gar nicht versuchte, lustig zu sein – er war es einfach.«
Sie drehte leicht den Kopf zu Mary Jane. »Hey, möchtest du mir nicht mal ’ne Zigarette rüberwerfen?«
»Ich komm nicht dran«, sagte Mary Jane.
»Kannst mich mal.«
Eloise blickte wieder an die Decke. »Einmal«, sagte sie, »bin ich gestürzt. Ich habe immer an der Bushaltestelle auf ihn gewartet, direkt vorm PX, und einmal ist er zu spät gekommen, gerade als der Bus abfuhr. Wir sind hinterhergerannt, und dann bin ich gestürzt und hab mir den Knöchel verstaucht. Er sagte: ›Armer Onkel Wiggily.‹ Er meinte den Knöchel. Armer alter Onkel Wiggily, nannte er ihn .… Gott, war der nett.«
»Hat Lew denn keinen Humor?«, fragte Mary Jane.
»Was?«
»Hat Lew keinen Humor?«
»O Gott! Wer weiß das schon? Ja. Wahrscheinlich. Er lacht über Karikaturen und so.«
Eloise hob den Kopf, nahm das Glas von der Brust und trank.
»Also«, sagte Mary Jane. »Das ist ja nicht alles. Also, das ist ja nicht alles.«
»Was ist nicht alles?«
»Ach … na ja. Lachen und so.«
»Wer behauptet das denn?«, fragte Eloise. »Hör mal, wenn du nicht Nonne werden willst oder so was, kannst du genauso gut auch lachen.«
Mary Jane kicherte. »Du bist schrecklich«, sagte sie.
»Ah, Gott, er war so nett«, sagte Eloise. »Er war entweder lustig oder reizend. Aber nicht reizend wie so ein verdammter kleiner Junge. Er war auf ganz besondere Weise reizend. Weißt du, was er einmal gemacht hat?«
»M–m«, machte Mary Jane.
»Wir fuhren im Zug von Trenton nach New York – es war unmittelbar nach seiner Einberufung. Es war kalt im Waggon, und ich hatte meinen Mantel so irgendwie über uns gebreitet. Ich weiß noch, ich hatte Joyce Morrows Strickjacke drunter an – du erinnerst dich doch an ihre süße blaue Strickjacke?«
Mary Jane nickte, doch Eloise sah nicht zu ihr hin und bekam das Nicken nicht mit.
»Na, und er hatte so irgendwie die Hand auf meinem Bauch. Weißt schon. Jedenfalls sagte er ganz plötzlich, wie schön mein Bauch sei, er wünsche, ein Offizier würde auftauchen und ihm befehlen, die andere Hand aus dem Fenster zu strecken. Er sagte, er wolle tun, was gerecht sei. Dann nahm er die Hand weg und sagte zum Schaffner, er solle die Schultern nicht hängen lassen. Er sagte zu ihm, wenn er eines nicht ertragen könne, dann einen Mann, der nicht stolz auf seine Uniform sei. Der Schaffner sagte bloß, er solle weiterschlafen.«
Eloise überlegte einen Augenblick und sagte dann: »Es war nicht immer das, was er sagte, sondern wie er es sagte. Weißt du.«
»Hast du Lew schon mal von ihm erzählt – ich meine, überhaupt?«
»Ach«, sagte Eloise, »einmal habe ich angefangen. Aber als Erstes hat er mich gefragt, welchen Dienstgrad er hatte.«
»Welchen Dienstgrad hatte er?«
»Ha!«, sagte Eloise.
»Nein, ich meinte doch nur …«
Eloise lachte plötzlich, aus dem Zwerchfell heraus. »Weißt du, was er mal gesagt hat? Er hat gesagt, er habe den Eindruck, er komme in der Armee voran, aber in eine andere Richtung als alle anderen. Er sagte, wenn er seine erste Beförderung bekäme, würde er keine Streifen kriegen, sondern die Ärmel würden ihm abgenommen. Er sagte, sollte er General werden, wäre er splitternackt. Dann hätte er nur noch seinen kleinen Infanterieknopf im Bauchnabel.«
Eloise sah zu Mary Jane hin, die nicht lachte. »Findest du das nicht lustig?«
»Doch. Nur, warum erzählst du Lew nicht irgendwann mal von ihm?«
»Warum? Weil er zu verdammt unintelligent ist, darum«, sagte Eloise. »Und außerdem, hör mir mal zu, du Karrieremädel. Solltest du je wieder heiraten, dann sag deinem Mann gar nichts. Hörst du?«
»Warum?«, fragte Mary Jane.
»Weil ich es sage, darum«, sagte Eloise. »Die wollen glauben, dass du dein ganzes Leben lang gekotzt hast, wenn mal ein Junge in deine Nähe kam. Und genau so meine ich das. Ach, du kannst ihnen alles Mögliche erzählen. Aber nie im Ernst. Wirklich nie im Ernst. Wenn du ihnen erzählst, du hättest mal einen hübschen Jungen gekannt, musst du im selben Atemzug sagen, dass er zu hübsch war. Und wenn du ihnen erzählst, du hast einen witzigen Jungen gekannt, musst du ihnen auch erzählen, dass er außerdem irgendwie ein Klugscheißer war, ein Besserwisser. Tust du das nicht, reiben sie dir den armen Jungen bei jeder Gelegenheit unter die Nase.« Eloise machte eine Pause, um einen Schluck zu trinken und um nachzudenken. »Oh«, sagte sie, »sie hören dir sehr vernünftig und so weiter zu. Sie machen sogar ein wahnsinnig intelligentes Gesicht dabei. Aber lass dich nicht täuschen. Glaub mir. Du gehst durch die Hölle, wenn du ihnen Intelligenz unterstellst. Verlass dich drauf.«
Mary Jane sah bekümmert aus und hob das Kinn von der Armlehne der Couch. Zur Abwechslung stützte sie das Kinn nun auf dem Unterarm ab. Sie dachte über Eloise’ Ratschlag nach. »Du kannst Lew doch nicht als unintelligent bezeichnen«, sagte sie.
»Wer kann das nicht?«
»Ist er denn nicht intelligent?«, sagte Mary Jane unschuldig.
»Ach«, sagte Eloise, »wozu reden? Lassen wir das. Es bedrückt dich nur. Sag, ich soll still sein.«
»Na, warum hast du ihn dann geheiratet?«, fragte Mary Jane.
»O Gott! Das weiß ich nicht. Er hat mir erzählt, er liebt Jane Austen. Er hat mir erzählt, ihre Bücher bedeuten ihm sehr viel. Genau das hat er gesagt. Als wir dann verheiratet waren, habe ich herausgefunden, dass er kein einziges Buch von ihr gelesen hat. Weißt du, wer sein Lieblingsautor ist?«
Mary Jane schüttelte den Kopf.
»L. Manning Vines. Schon mal von ihm gehört?«
»M–m.«
»Ich auch nicht. Und auch sonst niemand. Er hat ein Buch über vier Männer geschrieben, die in Alaska erfroren sind. Lew weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es ist das am schönsten geschriebene Buch, das er je gelesen hat. Lieber Gott! Er ist nicht mal so ehrlich, offen zu sagen, dass es ihm gefallen hat, weil es von vier Kerlen handelt, die in einem Iglu oder so was verhungert sind. Er muss sagen, dass es schön geschrieben ist.«
»Du bist zu kritisch«, sagte Mary Jane. »Du bist einfach zu kritisch. Vielleicht war es ja doch ein gutes –«
»Verlass dich drauf, das kann gar nicht sein«, sagte Eloise. Sie überlegte einen Augenblick und setzte dann hinzu: »Du hast wenigstens eine Stelle. Also, wenigstens hast –«
»Aber hör doch mal«, sagte Mary Jane. »Glaubst du, du sagst ihm jemals, dass Walt umgekommen ist? Ich meine, er würde doch nicht eifersüchtig sein, oder, wenn er wüsste, dass Walt – na ja. Umgekommen ist und überhaupt.«
»Ach, meine Liebe! Du armes, unschuldiges kleines Karrieremädel«, sagte Eloise. »Dann wäre er noch schlimmer. Ein Ghul wäre er. Hör zu. Er weiß lediglich, dass ich mit einem namens Walt gegangen bin – einem klugscheißerischen Gl. Dass Walt umgekommen ist, wäre das Letzte, was ich ihm erzählen würde. Das Allerletzte. Und wenn ich’s täte – was ich nicht tu –, aber wenn ich es täte, würde ich ihm sagen, dass er im Kampf gefallen ist.«
Mary Jane schob das Kinn weiter vor, über den Rand des Unterarms.
»El …«, sagte sie.
»Hm?«
»Warum willst du mir nicht sagen, wie er ums Leben gekommen ist? Ich schwöre dir, ich würde es niemandem sagen. Im Ernst. Bitte.«
»Nein.«
»Bitte. Im Ernst. Ich sag’s auch niemandem.«
Eloise trank ihr Glas leer und stellte es sich wieder auf die Brust. »Akim Tamiroff würdest du es sagen«, sagte sie.
»Nein, bestimmt nicht! Wirklich, ich würde es nie –«
»Ach«, sagte Eloise, »sein Regiment lag irgendwo. Es war zwischen zwei Schlachten oder so, hat sein Freund gesagt, der mir geschrieben hat. Walt und ein anderer packten so ein kleines japanisches Öfchen in einen Karton. Irgendein Oberst wollte es nach Hause schicken. Oder sie nahmen es aus dem Karton raus, um es neu einzupacken – so genau weiß ich es nicht. Jedenfalls war es voller Benzin und Zeug, und es ist vor ihrer Nase explodiert. Der andere hat nur ein Auge verloren.«
Eloise begann zu weinen. Sie legte die Hand um das leere Glas auf ihrer Brust, um es festzuhalten.
Mary Jane rutschte von der Couch, machte auf den Knien drei Schritte zu Eloise hin und strich ihr über die Stirn. »Nicht weinen, El. Nicht weinen.«
»Wer weint denn hier?«, fragte Eloise.
»Ich weiß ja, aber weine nicht. Das ist es doch nicht wert oder so was.«
Die Haustür ging auf.
»Da kommt Ramona zurück«, sagte Eloise durch die Nase. »Tu mir einen Gefallen. Geh in die Küche und sag der da, sie soll ihr früh das Abendessen machen. Bist du so lieb?«
»Na gut, aber nur, wenn du mir versprichst, nicht mehr zu weinen.«
»Versprochen. Geh jetzt. Mir ist im Moment nicht danach, in diese verdammte Küche zu gehen.«
Mary Jane stand auf, verlor dabei das Gleichgewicht und fand es wieder und verließ das Zimmer.
Keine zwei Minuten später kam sie zurück, Ramona rannte vor ihr herein. Ramona rannte so plattfüßig wie möglich, um mit ihren offenen Galoschen den größtmöglichen Lärm zu machen.
»Ich durfte ihr nicht die Galoschen ausziehen«, sagte Mary Jane.
Eloise, die noch immer rücklings auf dem Boden lag, hatte ihr Taschentuch vorm Gesicht. Sie sprach, an Ramona gewandt, hinein. »Geh raus und sag Grace, sie soll dir die Galoschen ausziehen. Du weißt doch, dass du damit nicht ins –«
»Die ist auf der Toilette«, sagte Ramona.
Eloise legte das Taschentuch weg und richtete sich auf. »Gib mal deinen Fuß«, sagte sie. »Bitte setz dich erst hin .… Nicht da – hier. Gott!«
Auf Knien suchte Mary Jane unterm Tisch nach ihren Zigaretten und sagte: »Hey. Rate mal, was mit Jimmy passiert ist.«
»Keine Ahnung. Anderer Fuß. Anderer Fuß.«
»Er ist überfahrt worden«, sagte Mary Jane. »Ist das nicht tragisch?«
»Ich hab Skipper mit einem Knochen gesehen«, sagte Ramona zu Eloise.
»Was ist mit Jimmy passiert?«, sagte Eloise zu ihr.
»Er ist überfahrt und getötet worden. Ich hab Skipper mit einem Knochen gesehen, und er hat ihn nicht –«
»Zeig mir mal deine Stirn«, sagte Eloise. Sie legte Ramona die Hand auf die Stirn. »Du scheinst mir ein bisschen fiebrig zu sein. Sag Grace, du sollst oben essen. Danach gehst du sofort ins Bett. Ich komme später hoch. Und nun geh, bitte. Nimm die mit.«
Ramona stapfte langsam mit Riesenschritten aus dem Zimmer.
»Wirf mir eine rüber«, sagte Eloise zu Mary Jane. »Trinken wir noch einen.«
Mary Jane brachte Eloise eine Zigarette. »Ist das nicht toll? Das mit Jimmy? So eine Fantasie!«
»Mm. Du besorgst die Drinks, ja? Und bring die Flasche mit … ich will da jetzt nicht hin. Da riecht’s überall nach Orangensaft, verdammt.«
Um fünf nach sieben klingelte das Telefon. Eloise erhob sich von der Fensterbank und tastete im Dunkeln nach ihren Schuhen. Sie fand sie nicht. Auf Strümpfen ging sie ruhig, fast träge zum Telefon. Mary Jane, die mit dem Gesicht nach unten auf der Couch schlief, störte das Klingeln nicht.
»Hallo«, sagte Eloise in den Hörer, ohne das Deckenlicht angemacht zu haben. »Hör zu, ich kann dich nicht abholen. Mary Jane ist hier. Sie hat ihren Wagen direkt vor mir abgestellt, und sie findet den Schlüssel nicht. Ich kann nicht raus. Wir haben rund zwanzig Minuten damit verbracht, ihn in dem Dingsda zu suchen – im Schnee und so Zeug. Vielleicht können dich ja Dick und Mildred mitnehmen.«
Sie horchte. »Oh. Na, das ist hart, mein Junge. Bildet doch einfach einen Trupp und marschiert nach Hause. Du kannst ja dieses Hopp-hopp-klopp-klopp- Ding sagen. Du kannst der große Zampano sein.«
Wieder horchte sie. »Ich bin nicht komisch«, sagte sie. »Ehrlich nicht. Ich sehe nur so aus.« Sie legte auf.
Weniger sicher ging sie ins Wohnzimmer zurück. An der Fensterbank goss sie sich den Rest Scotch ins Glas. Ungefähr fingerhoch. Sie trank ihn aus, schüttelte sich und setzte sich hin.
Als Grace im Esszimmer Licht machte, schrak Eloise zusammen. Ohne aufzustehen, rief sie Grace zu: »Servieren Sie lieber nicht vor acht, Grace. Mr Wengler verspätet sich ein wenig.«
Grace erschien im Esszimmerlicht, kam aber nicht näher. »Die Dame gehen?«, sagte sie.
»Sie ruht sich aus.«
»Oh«, sagte Grace. »Mis Wengler, ich wollt fragen, ob mein Mann den Abend heut hier verbringen kann. In meinem Zimmer ist viel Platz, und er muss erst morgen früh wieder in New York sein, und draußen isses so schlimm.«
»Ihr Mann? Wo ist er?«
»Na, im Moment«, sagte Grace, »ist er in der Küche.«
»Also, leider kann er hier nicht übernachten, Grace.«
»Ma’am?«
»Ich sagte, leider kann er hier nicht übernachten. Das ist hier kein Hotel.«
Grace blieb noch einen Augenblick stehen, dann sagte sie »Ja, Ma’am« und ging in die Küche.
Eloise verließ das Wohnzimmer und ging die Treppe hinauf, die vom Lichtschein aus dem Esszimmer sehr schwach erhellt war. Auf dem Treppenabsatz lag eine von Ramonas Galoschen. Eloise hob sie auf und warf sie, so kräftig sie konnte, übers Geländer; mit einem heftigen Knall schlug sie auf dem Dielenboden auf.
In Ramonas Zimmer knipste sie das Licht an und hielt, wie zur Stütze, den Lichtschalter fest. Eine Weile stand sie still da und betrachtete Ramona. Dann ließ sie den Lichtschalter los und ging schnell zum Bett.
»Ramona. Wach auf. Wach auf.«
Ramona schlief am äußersten Rand des Bettes, ihre rechte Pobacke ragte darüber hinaus. Ihre Brille lag, säuberlich zusammengeklappt und mit den Bügeln nach unten, auf einem kleinen Donald-Duck-Nachttischchen.
»Ramona!«
Das Kind erwachte und sog scharf die Luft ein. Es schlug die Augen weit auf, kniff sie aber gleich wieder zusammen. »Mama?«
»Ich dachte, du hättest mir erzählt, Jimmy Jimmereeno sei überfahren und getötet worden.«
»Was?«
»Du hast mich doch verstanden«, sagte Eloise. »Warum schläfst du so weit am Rand?«
»Weil«, sagte Ramona.
»Weil warum? Ramona, ich habe keine Lust –«
»Weil ich Mickey nicht wehtun will.«
»Wem?«
»Mickey«, sagte Ramona und rieb sich die Nase. »Mickey Mickeranno.«
Eloise erhob kreischend die Stimme. »Du legst dich in die Mitte dieses Betts. Los.«
Ramona, zutiefst verängstigt, schaute einfach nur zu Eloise auf.
»Na schön.«
Eloise packte Ramona an den Knöcheln, und halb hob, halb zerrte sie sie in die Bettmitte. Ramona wehrte sich nicht und weinte auch nicht; sie ließ sich anders hinlegen, ohne sich richtig zu fügen.
»Und jetzt schlaf«, sagte Eloise schwer atmend. »Mach die Augen zu .… Du hast gehört, was ich gesagt habe, mach sie zu.«
Ramona machte die Augen zu.
Eloise ging zum Lichtschalter und knipste ihn aus. Doch sie stand noch lange in der Tür. Dann stürmte sie im Dunkeln auf einmal zu dem Nachttischchen und stieß mit dem Knie gegen das Fußende des Betts, war aber viel zu entschlossen, um Schmerz zu empfinden. Sie nahm Ramonas Brille und drückte sie sich mit beiden Händen an die Wange. Tränen liefen ihr übers Gesicht, auf die Gläser. »Armer Onkel Wiggily«, sagte sie immer wieder. Schließlich legte sie die Brille aufs Nachttischchen zurück, die Gläser nach unten.
Sie beugte sich vor, verlor dabei das Gleichgewicht und stopfte die Decken von Ramonas Bett fest. Ramona war wach. Sie weinte und hatte geweint. Eloise küsste sie nass auf den Mund, strich ihr die Haare aus den Augen und verließ dann das Zimmer.
Sie ging, nun sehr stark schwankend, nach unten und weckte Mary Jane.
»Wassis? Wer? Hm?«, sagte Mary Jane und setzte sich kerzengerade auf der Couch auf.
»Mary Jane. Hör zu. Bitte«, sagte Eloise schluchzend. »Du erinnerst dich doch an unser erstes Studienjahr, da hatte ich das braungelbe Kleid, das ich in Boise gekauft hatte, und Miriam Ball sagte zu mir, so ein Kleid trägt in New York niemand, und wie ich dann die ganze Nacht weinte?« Eloise rüttelte Mary Jane am Arm. »Ich war doch ein nettes Mädchen«, flehte sie, »findest du nicht?«
KURZ VOR DEM KRIEG
GEGEN DIE ESKIMOS
Fünf Samstagvormittage hintereinander hatte Ginnie Mannox mit Selena Graff, einer Klassenkameradin an Miss Basehoars Schule, auf den East-Side-Plätzen Tennis gespielt. Ginnie hielt Selena offen für die größte Null der Schule, wo es von enormen Nullen angeblich nur so wimmelte, aber gleichzeitig war ihr noch niemand begegnet, der wie Selena neue Dosen Tennisbälle mitbrachte. Die stellte Selenas Vater her oder so was. (Einmal hatte Ginnie beim Abendessen zur Erbauung der gesamten Familie Mannox ein Bild von einem Abendessen bei den Graffs heraufbeschworen; dazu gehörte ein perfekter Diener, der bei jedem links herantrat, nur statt eines Glases Tomatensaft eine Dose Tennisbälle servierte.) Doch dass sie Selena nach dem Tennis immer bei ihr zu Hause absetzen musste und dann – aber auch jedes Mal – auf dem ganzen Taxipreis sitzen blieb, das ging Ginnie auf die Nerven. Schließlich war es Selenas Idee gewesen, von den Plätzen statt mit dem Bus mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Am fünften Samstag jedoch, das Taxi war in der York Avenue gerade Richtung Norden losgefahren, sagte Ginnie plötzlich doch etwas.
»Hey, Selena …«
»Was?«, fragte Selena, die gerade mit der Hand auf dem Fußboden des Taxis herumtastete. »Ich finde meine Schlägerhülle nicht!«, jammerte sie.
Trotz des warmen Maiwetters trugen beide Mädchen einen Mantel über den Shorts.
»Die hast du in die Manteltasche gesteckt«, sagte Ginnie. »Hey, hör mal –«
»O Gott! Du hast mir das Leben gerettet!«
»Hör mal«, sagte Ginnie, die von Selenas Dankbarkeit nichts wissen wollte.
»Was?«
Ginnie beschloss, es ohne Umschweife auszusprechen. Das Taxi war schon fast in Selenas Straße. »Ich habe keine Lust, heute wieder auf dem ganzen Taxigeld sitzen zu bleiben«, sagte sie. »Schließlich bin ich kein Millionär.«
Selena sah erst verblüfft, dann verletzt drein. »Zahle ich denn nicht immer die Hälfte?«, fragte sie unschuldig.
»Nein«, sagte Ginnie kategorisch. »Du hast am ersten Samstag die Hälfte bezahlt. Ganz am Anfang des letzten Monats. Und seitdem kein einziges Mal mehr. Ich will ja nicht schäbig sein, aber ich lebe praktisch von vier-fünfzig die Woche. Und davon muss ich –«
»Aber bringe ich denn nicht immer die Tennisbälle mit?«, fragte Selena unwirsch.
Manchmal hätte Ginnie Selena am liebsten umgebracht. »Die macht doch dein Vater oder so was«, sagte sie. »Die kosten dich doch gar nichts. Ich muss für jeden kleinen –«
»Schon gut, schon gut«, sagte Selena laut und mit einer Endgültigkeit, die ihr genügte, um wieder Oberwasser zu bekommen. Gelangweilt kramte sie in ihren Manteltaschen. »Ich hab nur fünfunddreißig Cent«, sagte sie kühl. »Reicht das?«
»Nein. Entschuldige, aber du schuldest mir einen Dollar fünfundsechzig. Ich habe jede –«
»Ich muss nach oben und es bei meiner Mutter holen. Hat das nicht Zeit bis Montag? Ich könnte es zum Turnen mitbringen, wenn es dich glücklich macht.«
Selenas Haltung verbot jede Nachsicht.
»Nein«, sagte Ginnie. »Ich muss heute Abend ins Kino. Ich brauche es.«
Feindselig schweigend, starrten beide Mädchen aus entgegengesetzten Fenstern, bis das Taxi vor Selenas Wohnblock hielt. Dann stieg Selena, die auf der Seite zum Bordstein saß, aus. Die Taxitür gerade einen Spalt offen lassend, ging sie forsch und selbstvergessen wie eine Hollywood-Berühmtheit auf Besuch ins Gebäude. Mit hochrotem Gesicht bezahlte Ginnie den Fahrpreis. Dann raffte sie ihre Tennissachen zusammen – Schläger, Handtuch und Sonnenhut – und folgte Selena. Mit fünfzehn war Ginnie in ihren Tennisschuhen Größe 42 ungefähr eins fünfundsiebzig groß, und als sie die Eingangshalle betrat, verlieh ihr ihre befangene, gummibesohlte Staksigkeit etwas gefährlich Dilettantisches. Was Selena veranlasste, lieber die Anzeige über dem Fahrstuhl zu betrachten.
»Damit schuldest du mir jetzt einen Dollar neunzig«, sagte Ginnie, als sie zum Fahrstuhl schritt.
Selena drehte sich um. »Vielleicht interessiert es dich ja«, sagte sie, »dass meine Mutter sehr krank ist.«
»Was hat sie denn?«
»Sie hat praktisch Lungenentzündung, und wenn du glaubst, es macht mir Spaß, sie bloß wegen Geld zu stören …«
Selena sagte den unvollständigen Satz so souverän wie möglich.
Tatsächlich war Ginnie von dieser Information doch ein wenig irritiert, wie hoch ihr Wahrheitsgehalt auch war, aber nicht bis zur Sentimentalität. »Von mir hat sie sie nicht«, sagte sie und folgte Selena in den Fahrstuhl.
Nachdem Selena die Wohnungsklingel gedrückt hatte, wurden die Mädchen von einer farbigen Hausangestellten, mit der Selena offenbar nicht sprach, eingelassen oder vielmehr, die Tür wurde nach innen gezogen und blieb angelehnt. Ginnie ließ ihre Tennissachen auf einen Stuhl im Flur fallen und folgte Selena. Im Wohnzimmer drehte Selena sich um und sagte: »Macht es dir was aus, hier zu warten? Womöglich muss ich Mutter wecken und so.«
»Okay«, sagte Ginnie und ließ sich aufs Sofa plumpsen.
»In meinem ganzen Leben hätte ich nicht geglaubt, dass du wegen etwas so kleinlich sein könntest«, sagte Selena, die gerade zornig genug war, um das Wort »kleinlich« zu gebrauchen, aber doch nicht mutig genug, um es zu betonen.
»Jetzt weißt du’s«, sagte Ginnie und schlug vor ihrer Nase eine Vogue auf. Sie hielt sie so, bis Selena aus dem Zimmer war, dann legte sie sie wieder aufs Radio. Sie betrachtete das Zimmer, stellte im Geist die Möbel um, warf Tischlampen hinaus, entfernte künstliche Blumen. Ihrer Meinung nach war es ein absolut scheußliches Zimmer – teuer, aber kitschig.
Plötzlich rief aus einem anderen Zimmer der Wohnung eine Männerstimme: »Eric? Bist du’s?«
Ginnie nahm an, es sei Selenas Bruder, den sie noch nie gesehen hatte. Sie schlug ihre langen Beine übereinander, zog den Saum ihres Polo-Coats über die Knie und wartete.
Ein junger Mann mit Brille, im Schlafanzug und ohne Pantoffeln stürzte mit offenem Mund ins Zimmer. »Oh. Ich dachte, es ist Eric, Herrgott«, sagte er. Ohne stehen zu bleiben durchquerte er in außerordentlich schlechter Haltung das Zimmer und hielt dabei etwas an seine schmale Brust gedrückt. Er setzte sich auf das freie Ende des Sofas. »Ich habe mir gerade in den verdammten Finger geschnitten«, sagte er ziemlich erregt. Er sah Ginnie an, als hätte er erwartet, dass sie hier saß. »Hast du dir schon mal in den Finger geschnitten? Bis zum Knochen und so?«, fragte er. Seine plärrende Stimme klang richtig flehend, als könnte Ginnie ihn mit ihrer Antwort vor einer besonders einsam machenden Form von Pionierarbeit bewahren.
Ginnie starrte ihn an. »Also, nicht gerade bis auf den Knochen«, sagte sie, »aber geschnitten habe ich mich schon mal.«
Er war der komischste Junge oder Mann – schwer zu sagen, was er war –, den sie je gesehen hatte. Seine Haare waren bettzerwühlt. Er hatte einen spärlichen, blonden Zweitagebart. Und er sah – nun ja, blöd aus. »Wie hast du dich denn geschnitten?«, fragte sie.
Er starrte, den schlaffen Mund offen, auf seinen verletzten Finger. »Was?«, sagte er.
»Wie du dich geschnitten hast.«
»Verdammt, wenn ich das wüsste«, sagte er, wobei er durch den Tonfall andeutete, dass die Antwort auf diese Frage hoffnungslos im Dunkeln lag. »Ich habe nach was in dem verdammten Mülleimer gesucht, und der war voller Rasierklingen.«
»Bist du Selenas Bruder?«, fragte Ginnie.
»Ja. Lieber Gott, ich verblute noch. Bleib doch. Vielleicht brauche ich ja noch eine verdammte Transfusion.«
»Hast du was draufgetan?«
Selenas Bruder hielt die Wunde ein wenig von der Brust entfernt und enthüllte sie für Ginnie. »Bloß verdammtes Toilettenpapier«, sagte er. »Stillt die Blutung. Wie wenn man sich beim Rasieren schneidet.«
Wieder sah er Ginnie an. »Wer bist du?«, fragte er. »’ne Freundin von der Doofen?«
»Wir gehen in dieselbe Klasse.«
»Ach ja? Wie heißt du?«
»Virginia Mannox.«
»Du bist Ginnie?«, sagte er und sah sie durch seine Bril le mit zusammengekniffenen Augen an. »Du bist Ginnie Mannox?«
»Ja«, sagte Ginnie und stellte die Beine gerade.
Selenas Bruder wandte sich wieder seinem Finger zu, für ihn offensichtlich der einzig wahre Bezugspunkt im Zimmer. »Ich kenne deine Schwester«, sagte er leidenschaftslos. »Verdammter Snob.«
Ginnie krümmte den Rücken. »Wer ist ein Snob?«
»Hast schon verstanden.«
»Sie ist kein Snob!«
»Und ob sie einer ist«, sagte Selenas Bruder.
»Gar nicht!«
»Und ob sie einer ist. Sie ist die Königin. Die Königin der verdammten Snobs.«
Ginnie sah zu, wie er die dicke Schicht Toilettenpapier auf seinem Finger anhob und darunterspähte.
»Du kennst meine Schwester doch gar nicht.«
»Und ob ich sie kenne.«
»Wie heißt sie denn? Wie heißt sie mit Vornamen?«, wollte Ginnie wissen.
»Joan .… Joan der Snob.«
Ginnie schwieg. »Wie sieht sie aus?«, fragte sie dann plötzlich.
Keine Antwort.
»Wie sie aussieht«, wiederholte Ginnie.
»Wenn sie nur halb so gut aussieht, wie sie glaubt, dass sie aussieht, hätte sie schon verdammtes Glück«, sagte Selenas Bruder.
Das hatte das Format einer interessanten Antwort, fand Ginnie insgeheim. »Dich hat sie aber nie erwähnt«, sagte sie.
»Das macht mir Sorgen. Das macht mir höllische Sorgen.«
»Und außerdem ist sie verlobt«, sagte Ginnie und beobachtete ihn. »Nächsten Monat heiratet sie.«
»Wen denn?«, fragte er, aufblickend.
Ginnie nutzte es sofort aus, dass er aufgeblickt hatte. »Keinen, den du kennst.«
Wieder zupfte er an seiner Erste-Hilfe-Arbeit herum. »Ich bedaure ihn«, sagte er.
Ginnie schnaubte.
»Das blutet immer noch wie verrückt. Meinst du, ich sollte was drauftun? Was wäre denn da gut? Taugt Mercurochrom was?«
»Jod ist besser«, sagte Ginnie. Dann fand sie, dass ihre Antwort unter diesen Umständen zu freundlich war, und fügte noch hinzu: »Mercurochrom ist dafür überhaupt nicht gut.«
»Warum denn nicht? Was ist damit?«
»Es ist für so was halt einfach nicht gut. Du brauchst Jod.«
Er sah Ginnie an. »Das brennt aber doch ziemlich?«, sagte er. »Brennt das nicht ziemlich schlimm?«
»Es brennt schon«, sagte Ginnie, »aber es bringt dich nicht um oder sonst was.«
Anscheinend ohne Ginnie ihren Ton übel zu nehmen, wandte sich Selenas Bruder wieder seinem Finger zu. »Ich mag es nicht, wenn es brennt«, sagte er.
»Das mag niemand.«
Er nickte zustimmend. »Ja«, sagte er.
Ginnie betrachtete ihn eine Weile. »Mach nicht ständig daran rum«, sagte sie plötzlich.
Wie als Reaktion auf einen Stromschlag riss Selenas Bruder seine unverletzte Hand zurück. Er setzte sich eine Spur aufrechter hin – oder saß vielmehr eine Spur weniger zusammengesackt da. Er betrachtete einen Gegenstand am anderen Ende des Zimmers. Ein beinahe verträumter Ausdruck legte sich auf seine wirren Züge. Er steckte den Nagel seines unverletzten Zeigefingers in den Spalt zwischen den beiden Schneidezähnen, entfernte einen Speiserest und wandte sich wieder an Ginnie. »Schwas gegessen?«, fragte er.
»Was?«
»Schon Mittag gegessen?«
Ginnie schüttelte den Kopf. »Ich esse, wenn ich nach Hause komme«, sagte sie. »Meine Mutter hat immer das Mittagessen fertig, wenn ich nach Hause komme.«
»Ich habe ein halbes Hühnchensandwich in meinem Zimmer. Willst du’s? Ich hab’s nicht angerührt oder sonst was.«
»Nein danke. Ehrlich.«
»Du hast doch gerade Tennis gespielt, Herrgott. Hast du denn keinen Hunger?«
»Das ist es nicht«, sagte Ginnie und schlug wieder die Beine übereinander. »Es ist bloß so, dass meine Mutter immer das Mittagessen fertig hat, wenn ich nach Hause komme. Ich meine, sie dreht durch, wenn ich dann keinen Hunger habe.«
Selenas Bruder schien diese Erklärung zu akzeptieren. Immerhin nickte er und schaute weg. Aber plötzlich drehte er sich wieder zu ihr hin. »Wie wärs mit ’nem Glas Milch?«
»Nein danke .… Trotzdem danke.«
Geistesabwesend beugte er sich vor und kratzte sich an seinem nackten Knöchel. »Wie heißt der Kerl, den sie heiratet?«, fragte er.
»Du meinst Joan?«, fragte Ginnie. »Dick Heffner.«
Selenas Bruder kratzte sich weiter am Knöchel.
»Er ist Lieutenant Commander bei der Marine«, sagte Ginnie.
»Na großartig.«
Ginnie kicherte. Sie sah zu, wie er sich am Knöchel kratzte, bis der rot war. Als er anfing, mit dem Fingernagel an einem kleineren Hautausschlag am Schienbein herumzukratzen, sah sie nicht mehr hin.
»Woher kennst du Joan?«, fragte sie. »Ich habe dich nie bei uns im Haus oder sonst wo gesehen.«
»War auch nie in eurem verdammten Haus.«
Ginnie wartete, doch nichts führte von dieser Erklärung weiter. »Woher kennst du sie also?«, fragte sie.
»Party«, sagte er.
»Von einer Party? Wann?«
»Weiß ich doch nicht. Weihnachten ’42.«
Aus der Brusttasche seines Schlafanzugs zweifingerte er eine Zigarette heraus, die aussah, als wäre darauf geschlafen worden. »Wie wär’s, wenn du mir mal die Streichhölzer da rüberschmeißt?«, sagte er. Ginnie reichte ihm eine Schachtel Streichhölzer von dem Tisch neben ihr. Er zündete seine Zigarette an, ohne sie gerade zu biegen, dann steckte er das abgebrannte Streichholz in die Schachtel zurück. Er warf den Kopf zurück, stieß langsam eine gewaltige Menge Rauch aus dem Mund und atmete ihn wieder durch die Nase ein. Derart »französisch« inhalierend, rauchte er weiter. Sehr wahrscheinlich war es nicht Teil des Sofa-Varietés eines Angebers, sondern vielmehr die persönliche, öffentlich gemachte Leistung eines jungen Mannes, der irgendwann einmal versucht haben mochte, sich linkshändig zu rasieren.
»Warum ist Joan ein Snob?«, fragte Ginnie.
»Warum? Weil sie einer ist. Woher soll ich denn wissen, warum?«
»Ja schon, ich meine aber, warum du es sagst.«
Müde wandte er sich zu ihr. »Hör mal zu. Ich habe ihr acht verdammte Briefe geschrieben. Acht. Sie hat keinen einzigen beantwortet.«
Ginnie zögerte. »Hm, vielleicht hatte sie ja viel zu tun.«
»Ja. Viel zu tun. Dann arbeitet sie ja wie eine verdammte Wilde.«
»Musst du denn so viel fluchen?«, fragte Ginnie.
»Und ob ich das muss, verdammt.«
Ginnie kicherte. »Wie lange hast du sie überhaupt gekannt?«, fragte sie.
»Lange genug.«
»Also, ich meine, hast du sie mal angerufen oder sonst was? Ich meine, hast du sie nicht mal angerufen oder sonst was?«
»Nee.«
»Na, Mensch. Wenn du sie nie angerufen hast oder sonst –«
»Das konnte ich doch nicht, Herrgott!«
»Warum denn nicht?«, fragte Ginnie.
»War gar nicht in New York.«
»Ach! Wo denn?«
»Ich? Ohio.«
»Ach, warst du auf dem College?«
»Nö. Bin abgegangen.«
»Ach, warst du beim Militär?«
»Nö.«
Mit der Zigarettenhand tippte sich Selenas Bruder links auf die Brust. »Pumpe«, sagte er.
»Dein Herz, meinst du?«, sagte Ginnie. »Was ist damit?«
»Das weiß ich doch nicht, was damit ist, verdammt. Als Kind hatte ich mal Gelenkrheumatismus. Verdammte Schmerzen im –«
»Na, solltest du da nicht lieber aufhören zu rauchen? Ich meine, solltest du denn da überhaupt rauchen und so weiter? Der Arzt hat meiner –«
»Aha, die erzählen einem viel«, sagte er.
Ginnie hielt sich noch kurz zurück. Sehr kurz. »Was hast du in Ohio gemacht?«, fragte sie.
»Ich? Hab in einer verdammten Flugzeugfabrik gearbeitet.«
»Tatsächlich?«, sagte Ginnie. »Hat es dir gefallen?«
»›Hat es dir gefallen?‹«, äffte er sie nach. »Es hat mir richtig gefallen. Ich bin verrückt nach Flugzeugen. Die sind so süß.«
Ginnie war jetzt viel zu involviert, um beleidigt zu sein. »Wie lange hast du da gearbeitet? In der Flugzeugfabrik.«
»Das weiß ich doch nicht, Herrgott. Siebenunddreißig Monate.«
Er stand auf und ging ans Fenster. Er schaute auf die Straße hinab und kratzte sich dabei mit dem Daumen am Rücken. »Sieh dir mal die an«, sagte er. »Verdammte Idioten.«
»Wer?«
»Das weiß ich doch nicht. Alle irgendwie.«
»Dein Finger blutet gleich noch mehr, wenn du ihn so nach unten hältst«, sagte Ginnie.
Er hörte auf sie. Er stellte den linken Fuß auf den Fenstersitz und legte die verletzte Hand auf den waagerechten Schenkel. Er schaute weiter auf die Straße hinab. »Die gehen alle zu der verdammten Musterungsstelle«, sagte er. »Als Nächstes kämpfen wir gegen die Eskimos. Hast du das gewusst?«
»Gegen wen?«, fragte Ginnie.
»Die Eskimos. .… Sperr doch die Ohren auf, Herrgott.«
»Warum die Eskimos?«
»Das weiß ich doch nicht. Woher zum Teufel soll ich das denn wissen? Dieses Mal gehen die ganzen alten Knacker hin. Die um die sechzig. Da können jetzt bloß die hin, die um die sechzig sind«, sagte er. »Die kriegen einfach kürzere Dienstzeiten, sonst nichts .… Na, großartig.«
»Du müsstest doch sowieso nicht hin«, sagte Ginnie und meinte damit nichts anderes als die Wahrheit, wusste aber noch bevor die Feststellung vollständig raus war, dass sie das Falsche sagte.
»Ich weiß«, sagte er rasch und nahm den Fuß vom Fenstersitz. Er schob das Fenster ein wenig hoch und schnippte die Zigarette auf die Straße. Dann, als er am Fenster fertig war, drehte er sich um. »Hey. Tu mir einen Gefallen. Wenn dieser Typ kommt, sag ihm, ich bin in drei Sekunden so weit, ja? Ich muss mich bloß schnell rasieren. Okay?«
Ginnie nickte.
»Soll ich Selena Beine machen oder sonst was? Weiß sie, dass du da bist?«
»Ach, die weiß, dass ich da bin«, sagte Ginnie. »Ich habs nicht eilig. Danke.«
Selenas Bruder nickte. Dann warf er einen letzten, langen Blick auf seinen verletzten Finger, wie um zu sehen, ob der Finger in einem Zustand war, der die Rückkehr aufs Zimmer gestattete.
»Warum machst du denn kein Pflaster drauf? Hast du denn kein Pflaster oder sonst was?«
»Nee«, sagte er. »Na. Machs gut.«
Er schlenderte aus dem Zimmer.
Nach wenigen Sekunden war er wieder da, mit dem halben Sandwich.
»Iss das«, sagte er. »Das ist gut.«
»Ehrlich, ich bin überhaupt nicht –«
»Nimm es, Herrgott. Ich habs nicht vergiftet oder so.«
Ginnie nahm das halbe Sandwich. »Na, vielen Dank jedenfalls«, sagte sie.
»Es ist Huhn«, sagte er, als er vor ihr stand und sie beobachtete. »Hab ich gestern Abend in einem verdammten Feinkostladen gekauft.«
»Es sieht sehr gut aus.«
»Dann iss es auch.«
Ginnie biss davon ab.
»Gut, hm?«
Ginnie schluckte mit Schwierigkeiten. »Sehr«, sagte sie.
Selenas Bruder nickte. Geistesabwesend schaute er sich im Zimmer um, kratzte sich in der Magengrube. »Na, dann zieh ich mich jetzt wohl mal an .… Mann! Da klingelts. Dann machs gut!« Und weg war er.
Als Ginnie wieder allein war, sah sie sich, ohne aufzustehen, nach einer guten Stelle um, wo sie das Sandwich wegwerfen oder verstecken konnte. Sie hörte jemanden durch den Flur kommen. Sie steckte das Sandwich in die Tasche ihres Polo-Coats.
Ein junger Mann Anfang dreißig, weder klein noch groß, kam herein. Seine regelmäßigen Züge, sein Kurzhaarschnitt, der Schnitt seines Anzugs, das Muster seiner Foulardkrawatte gaben keine wirklich endgültige Auskunft. Er mochte Redaktionsmitglied bei einem Nachrichtenmagazin gewesen sein oder versucht haben, es zu werden. Er mochte auch einfach in Philadelphia in einem Stück gewesen sein, das abgesetzt worden war. Er mochte einer Anwaltskanzlei angehört haben.
»Hallo«, sagte er herzlich zu Ginnie.
»Hallo.«
»Franklin gesehen?«, fragte er.
»Er rasiert sich gerade. Er hat gesagt, ich soll Ihnen sagen, Sie sollen auf ihn warten. Er kommt gleich.«
»Er rasiert sich. Großer Gott.«
Der junge Mann schaute auf seine Armbanduhr. Dann setzte er sich auf einen roten Damaststuhl, schlug die Beine übereinander und legte sich die Hände aufs Gesicht. Als wäre er ganz allgemein abgespannt oder hätte sich gerade die Augen überanstrengt, rieb er sich mit den Spitzen der ausgestreckten Finger die geschlossenen Augen. »Das war der grässlichste Vormittag meines ganzen Lebens«, sagte er und nahm die Hände vom Gesicht. Er sprach ausschließlich aus dem Kehlkopf heraus, als wäre er viel zu müde, um seinen Worten etwas Zwerchfellatem mitzugeben.
»Was ist passiert?«, fragte Ginnie und sah ihn an.
»Ach .… Das ist eine zu lange Geschichte. Leute, die ich nicht mindestens tausend Jahre kenne, langweile ich nicht.« Unzufrieden starrte er ungefähr in die Richtung der Fenster. »Aber ich werde mich nie wieder auch nur im Entferntesten als Kenner der menschlichen Natur betrachten. Damit können Sie mich hemmungslos zitieren.«
»Was ist passiert?«, fragte Ginnie erneut.
»Ach Gott. Dieser Mensch, der seit Monaten und Monaten und Monaten die Wohnung mit mir teilt – ich will gar nicht über ihn sprechen .… Dieser Schriftsteller«, fügte er voller Befriedigung hinzu, möglicherweise weil er sich an eine Lieblingsverwünschung aus einem Roman von Hemingway erinnerte.
»Was hat er getan?«
»Ehrlich gesagt, würde ich nicht sonderlich gern in die Details gehen«, sagte der junge Mann. Den durchsichtigen Humidor auf dem Tisch ignorierte er und zog aus seiner eigenen Schachtel eine Zigarette, die er mit seinem Feuerzeug anzündete. Seine Hände waren groß. Sie wirkten weder kräftig noch geschickt noch empfindsam. Dennoch gebrauchte er sie, als hätten sie einen nicht leicht zu beherrschenden, ganz eigenen ästhetischen Elan. »Ich habe mich entschlossen, nicht mal daran zu denken. Aber ich bin nur so wütend«, sagte er. »Ich meine, da kommt diese schreckliche kleine Person aus Altoona, Pennsylvania – oder von irgendwo daher. Anscheinend im Begriff zu verhungern. Ich bin so freundlich und anständig – ich bin der geborene gute Samariter –, ihn in meiner Wohnung aufzunehmen, dieser absolut mikroskopisch kleinen Wohnung, in der ich mich selbst kaum bewegen kann. Ich stelle ihn allen meinen Freunden vor. Lasse zu, dass er die ganze Wohnung mit seinen grässlichen Manuskriptseiten übersät, mit seinen Zigarettenstummeln und Rettichen und was nicht alles. Stelle ihn jedem Theaterproduzenten in New York vor. Schleppe ihm seine dreckigen Hemden zur Wäscherei und wieder zurück. Und die Krönung all dessen ist –« Der junge Mann brach ab. »Und das Ergebnis meiner ganzen Freundlichkeit und Anständigkeit«, fuhr er fort, »ist, dass er morgens um fünf oder sechs das Haus verlässt – ohne auch nur eine Notiz zu hinterlassen – und alles und jedes mitnimmt, was ihm in die dreckigen, schmutzigen Finger kommt.« Er machte eine Pause, um an seiner Zigarette zu ziehen, und stieß den Rauch in einem dünnen, zischenden Strom durch den Mund aus. »Ich will nicht darüber sprechen. Wirklich nicht.« Er sah Ginnie an. »Ein schöner Mantel ist das«, sagte er, als er schon von seinem Stuhl aufgestanden war. Er ging zu Ginnie und nahm das Revers ihres Polo–Coats zwischen die Finger. »Sehr hübsch. Das erste richtig gute Kamelhaar, das ich seit dem Krieg gesehen habe. Darf ich fragen, wo Sie ihn herhaben?«
»Den hat mir meine Mutter aus Nassau mitgebracht.«
Der junge Mann nickte nachdenklich und zog sich wieder zu seinem Stuhl zurück. »Einer der wenigen Orte, wo man richtig gutes Kamelhaar kriegt.«
Er setzte sich. »War sie lange dort?«
»Was?«, fragte Ginnie.
»War Ihre Mutter lange dort? Ich frage deswegen, weil meine Mutter im Dezember dort war. Und einen Teil des Januars. Für gewöhnlich begleite ich sie, aber in diesem Jahr ging bisher alles drunter und drüber, sodass ich einfach nicht weg konnte.«
»Sie war im Februar dort«, sagte Ginnie.
»Prächtig. Wo hat sie gewohnt? Wissen Sie das?«
»Bei meiner Tante.«
Er nickte. »Darf ich fragen, wie Sie heißen? Sie sind eine Freundin von Franklins Schwester, nehme ich an?«
»Wir gehen in dieselbe Klasse«, sagte Ginnie, womit sie nur seine zweite Frage beantwortete.
»Sie sind doch nicht etwa die berühmte Maxine, von der Selena spricht?«
»Nein«, sagte Ginnie.
Der junge Mann wischte unvermittelt mit der flachen Hand über seine Hosenaufschläge. »Ich bin von Kopf bis Fuß voller Hundehaare«, sagte er. »Mutter war übers Wochenende in Washington und hat ihr Vieh in meiner Wohnung geparkt. Es ist schon ganz lieb. Aber so üble Angewohnheiten. Haben Sie einen Hund?«
»Nein.«
»Ich finde es eigentlich grausam, Hunde in der Stadt zu halten.«
Er hörte auf zu wischen, lehnte sich zurück und schaute wieder auf seine Armbanduhr. »Dass dieser Junge pünktlich ist, habe ich noch nie erlebt. Wir wollen uns Cocteaus ›Es war einmal‹ ansehen, und das ist der einzige Film, bei dem man wirklich pünktlich da sein sollte. Denn sonst ist sein ganzer Charme verloren. Haben Sie ihn gesehen?«
»Nein.«
»Oh, das müssen Sie! Ich habe ihn achtmal gesehen. Absolut total genial«, sagte er. »Seit Monaten versuche ich, Franklin hinzukriegen.«
Hoffnungslos schüttelte er den Kopf. »Sein Geschmack. Während des Krieges haben wir beide in derselben grässlichen Fabrik gearbeitet, und dieser Junge musste mich unbedingt in die unmöglichsten Filme der Welt zu schleppen. Wir haben Gangsterfilme, Western, Musicals gesehen –«
»Haben Sie auch in der Flugzeugfabrik gearbeitet?«, fragte Ginnie.
»Gott, ja. Jahre und Jahre und Jahre. Reden wir bitte nicht darüber.«
»Haben Sie auch ein schwaches Herz?«
»Um Himmels willen, nein. Toi, toi, toi.« Er klopfte dreimal auf die Armlehne seines Stuhls. »Ich habe die Konstitution eines –«
Als Selena hereinkam, stand Ginnie rasch auf und ging ihr auf halbem Weg entgegen. Selena hatte ihre Shorts gegen ein Kleid getauscht, was Ginnie normalerweise geärgert hätte.
»Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen«, sagte Selena, »aber ich musste warten, bis Mutter aufwachte .… Hallo Eric.«
»Hallo, hallo!«
»Ich will das Geld sowieso nicht«, sagte Ginnie, und zwar so leise, dass sie nur von Selena zu hören war.
»Was?«
»Ich hab nachgedacht. Schließlich bringst du ja die Tennisbälle und so weiter mit, die ganze Zeit. Das hab ich vergessen.«
»Aber du hast doch gesagt, weil ich nichts dafür bezahlen müsste –«
»Bring mich zur Tür«, sagte Ginnie und ging voraus, ohne sich von Eric zu verabschieden.
»Aber ich dachte, du hast gesagt, du wolltest heute Abend ins Kino und du brauchtest das Geld und so weiter!«, sagte Selena im Flur.
»Ich bin zu müde«, sagte Ginnie. Sie bückte sich und nahm ihre Tennissachen. »Hör zu. Ich ruf dich nach dem Abendessen an. Machst du heute Abend was Besonderes? Vielleicht kann ich ja vorbeikommen.«
Selena machte große Augen und sagte »Okay«.
Ginnie öffnete die Wohnungstür und ging zum Fahrstuhl. Sie drückte auf die Klingel. »Ich habe deinen Bruder kennengelernt«, sagte sie.
»Ehrlich? Ist das nicht ein komischer Kerl?«
»Was macht er überhaupt?«, fragte Ginnie beiläufig. »Arbeitet er oder so?«
»Er hat gerade gekündigt. Daddy will, dass er wieder aufs College geht, aber er will nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Keine Ahnung. Er findet sich zu alt und so weiter.«
»Wie alt ist er denn?«
»Keine Ahnung. Vierundzwanzig.«
Die Fahrstuhltür ging auf. »Ich ruf dich später an!«, sagte Ginnie.
Draußen wandte sie sich nach Westen Richtung Lexington, um dort den Bus zu nehmen. Zwischen Third und Lexington griff sie in die Manteltasche nach ihrer Geldbörse und fand die Sandwichhälfte. Sie zog sie heraus und senkte schon den Arm, um das Sandwich auf die Straße zu werfen, stattdessen aber steckte sie es wieder in die Tasche. Einige Jahre zuvor hatte sie drei Tage gebraucht, um das Osterküken wegzuwerfen, das sie tot in den Sägespänen auf dem Boden ihres Mülleimers gefunden hatte.
DER LACHENDE MANN
1928, da war ich neun, gehörte ich mit höchstem Korpsgeist einer Organisation an, die Komantschen-Klub hieß. An jedem Schultag wurden fünfundzwanzig von uns Komantschen nachmittags von unserem Häuptling vor dem Jungenausgang der Public School 165 in der 109th Street nahe der Amsterdam Avenue abgeholt. Dann drängelten und rempelten wir uns in den umgebauten Bus des Häuptlings, der uns (gemäß seiner finanziellen Abmachung mit unseren Eltern) zum Central Park fuhr. Während des übrigen Nachmittags spielten wir, wenn die Witterung es zuließ, Football, Fußball oder Baseball, je nach Saison (was aber locker gehandhabt wurde). Regnete es, ging der Häuptling mit uns ausnahmslos ins Museum of Natural History oder ins Metropolitan Museum of Art.
An Samstagen und den meisten nationalen Feiertagen holte uns der Häuptling schon morgens bei unseren diversen Häusern ab und fuhr uns in seinem schrottreifen Bus aus Manhattan hinaus in die vergleichsweise weiten Flächen des Van Cortlandt Park oder der Palisades. Stand uns der Sinn nach richtigem Sport, fuhren wir zum Van Cortlandt, wo die Spielfelder Normgröße hatten und wo zur gegnerischen Mannschaft kein Kinderwagen und auch keine gereizte alte Dame mit Stock gehörten. Hatten wir uns Kampieren in unseren Komantschen-Kopf gesetzt, ging’s rüber in die Palisades, und wir machten auf spartanisch. (Ich weiß noch, wie ich mich an einem Samstag irgendwo in dem unübersichtlichen Gelände zwischen dem Linit-Plakat und dem westlichen Ende der George Washington Bridge verlaufen hatte. Ich behielt allerdings die Ruhe. Ich setzte mich einfach in den majestätischen Schatten einer riesigen Reklametafel und klappte, wenn auch weinerlich, meine Lunchbox auf, halb im Vertrauen, dass der Häuptling mich finden würde. Der Häuptling fand uns immer.)
In den Stunden, in denen der Häuptling von den Komantschen befreit war, war er John Gedsudski aus Staten Island, ein äußerst schüchterner, sanfter junger Mann von zwei- oder dreiundzwanzig Jahren, der Jura an der N.Y.U. studierte und überhaupt ein sehr denkwürdiger Mensch war. Ich will hier nicht versuchen, seine zahlreichen Leistungen und Tugenden aufzuführen. Nur nebenbei, er war ein Eagle Scout und auch ein Halbstürmer, der es fast ins All-America-Team von 1926 geschafft hatte, und man wusste, dass das Baseball-Team der New York Giants ihn sehr herzlich zum Probetraining eingeladen hatte. Bei allen unseren hektischen Sportaktivitäten war er ein unparteiischer und unaufgeregter Schiedsrichter, ein meisterlicher Feuerbauer und -löscher und ein fachkundiger, teilnahmsvoller Erste-Hilfe-Mann. Wir alle, vom kleinsten bis zum größten Rowdy, liebten und respektierten ihn.
Das körperliche Erscheinungsbild des Häuptlings im Jahr 1928 steht mir noch immer klar vor Augen. Wären Wünsche Meter, dann hätten wir Komantschen ihn allesamt auf der Stelle zum Riesen gemacht. Doch wie es halt so ist, war er gedrungene eins sechzig oder zweiundsechzig – nicht mehr. Seine Haare waren blauschwarz, sein Haaransatz extrem tief, seine Nase war groß und fleischig und sein Rumpf nur ungefähr so lang wie seine Beine. In seiner Lederwindjacke waren seine Schultern mächtig, aber schmal und abfallend. Damals jedoch fand ich, dass im Häuptling die fotogensten Züge von Buck Jones, Ken Maynard und Tom Mix problemlos vereinigt waren.
Jeden Nachmittag, wenn es so dunkel war, dass die verlierende Mannschaft eine Entschuldigung dafür hatte, einige Infield-Popups oder Endzonenpässe zu verpassen, griffen wir Komantschen sehr stark und eigennützig auf das Talent des Häuptlings als Geschichtenerzähler zurück. Um diese Zeit waren wir in der Regel schon ein überhitzter, gereizter Haufen, und wir kämpften – entweder mit den Fäusten oder mit unseren schrillen Stimmen – um die dem Häuptling nächsten Sitze im Bus. (Der Bus hatte zwei parallele Reihen Strohsitze. Die linke hatte drei zusätzliche – die besten im Bus –, sie gingen bis nach vorn auf Höhe des Fahrerprofils.) Erst wenn wir alle ordentlich saßen, stieg der Häuptling in den Bus. Dann setzte er sich zu uns gewandt rittlings auf den Fahrersitz und trug uns mit seiner näselnden, aber modulationsreichen Tenorstimme die neue Folge von »Der lachende Mann« vor. Hatte er erst angefangen, erlahmte unser Interesse nie. »Der lachende Mann« war genau die richtige Geschichte für uns Komantschen. Sie könnte sogar klassische Dimensionen gehabt haben. Es war eine Geschichte, die in alle Richtungen wucherte, und dennoch blieb sie im Wesentlichen transportabel. Man konnte sie jederzeit mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken, wenn man beispielsweise im ablaufenden Wasser in der Badewanne saß.
Als einziger Sohn eines reichen Missionarspaars wurde der lachende Mann als Kleinkind von chinesischen Banditen entführt. Als das reiche Missionarspaar sich (aus religiöser Überzeugung) weigerte, das Lösegeld für seinen Sohn zu bezahlen, klemmten die Banditen, erheblich ungehalten, den Kopf des kleinen Burschen in einen Schraub stock und drehten den entsprechenden Hebel mehrmals nach rechts. Das Objekt dieser einzigartigen Erfahrung wuchs mit einem haarlosen, pecannussförmigen Kopf und einem Gesicht, das statt des Mundes eine gewaltige ovale Höhlung unterhalb der Nase hatte, zum Mann heran. Die Nase selbst bestand aus zwei fleischbedeckten Nasenlöchern. Wenn der lachende Mann atmete, erweiterte und kontrahierte sich folglich die scheußliche, freudlose Spalte unterhalb seiner Nase wie (so sehe ich es) eine monströse Vakuole. (Der Häuptling demonstrierte diese Form der Atmung eher, als sie zu erklären.) Beim Anblick des grausigen Gesichts des lachenden Mannes fielen Fremde sofort in Ohnmacht. Bekannte mieden ihn. Merkwürdig dagegen war, dass die Banditen ihn in ihrem Hauptquartier herumlungern ließen – solange er das Gesicht mit einer blassroten, hauchdünnen Maske aus Mohnblütenblättern bedeckt hielt. Die Maske ersparte den Banditen nicht nur den Anblick des Gesichts ihres Pflegesohns, sie wussten auch immer, wo er sich gerade aufhielt; den Umständen entsprechend roch er stark nach Opium.
Jeden Morgen stahl sich der lachende Mann (er war graziös auf den Beinen wie eine Katze) in seiner ungeheuren Einsamkeit in den dichten Wald, der das Versteck der Banditen umgab. Dort freundete er sich mit jeder Menge und Art von Tieren an: Hunden, weißen Mäusen, Adlern, Löwen, Königsboas, Wölfen. Zudem nahm er dann auch die Maske ab und sprach mit ihnen, leise, melodiös, in ihren Sprachen. Sie fanden ihn nicht hässlich.
(Der Häuptling brauchte zwei Monate, um mit der Geschichte bis dahin zu kommen. Von da an wurde er mit seinen Folgen, zur vollsten Zufriedenheit der Komantschen, immer eigenwilliger.)
Der lachende Mann hielt immer gern die Ohren offen, und so hatte er in Windeseile die wertvollsten Betriebsgeheimnisse der Banditen aufgeschnappt. Doch er gab nicht viel darauf und baute sich rasch ein eigenes, effizienteres System auf. Er arbeitete, zunächst in ziemlich kleinem Rahmen, freischaffend auf dem chinesischen Land, raubte, entführte und mordete, wenn es unbedingt nötig war. Schon bald trugen ihm seine genialen kriminellen Methoden, gepaart mit seiner einzigartigen Liebe zum Fairplay, einen warmen Platz im Herzen der Nation ein. Merkwürdigerweise bekamen seine Pflegeeltern (die Banditen, die ihm ursprünglich den Weg zum Verbrechen gewiesen hatten) ungefähr als Letzte von seinen Taten Wind. Und dann waren sie wahnsinnig eifersüchtig. Im Gänsemarsch zogen sie eines Nachts in dem Glauben, sie hätten ihn erfolgreich in Tiefschlaf narkotisiert, am Bett des lachenden Mannes vorbei und hieben mit ihren Macheten auf die Gestalt unter der Decke ein. Ihr Opfer erwies sich als die Mutter des Banditenhäuptlings – eine unangenehme, keifende Person. Der Vorfall ließ die Banditen nur noch mehr nach dem Blut des lachenden Mannes lechzen, sodass er sich schließlich gezwungen sah, den ganzen Haufen in ein tiefes, aber freundlich ausgestaltetes Mausoleum zu sperren. Hin und wieder brachen sie aus und bereiteten ihm gewissen Arger, doch er weigerte sich, sie zu töten. (Diese mitfühlende Seite im Wesen des lachenden Mannes trieb mich praktisch in den Wahnsinn.)
Schon bald überquerte der lachende Mann regelmäßig die chinesische Grenze nach Paris, Frankreich, wo er immer gern mit seinem großen, aber bescheidenen Genie gegenüber Marcel Dufarge protzte, dem international berühmten Detektiv und geistreichen Schwindsüchtigen. Dufarge und seine Tochter (ein reizendes Mädchen, allerdings auch so etwas wie eine Transvestitin) wurden die er bittertsten Feinde des lachenden Mannes. Immer wieder versuchten sie, ihn aufs Glatteis zu führen. Spaßeshalber ging der lachende Mann ein Stück darauf ein und verschwand dann, häufig auch ohne den leisesten glaubhaften Hinweis auf seine Fluchtmethode zurückzulassen. Nur gelegentlich brachte er einen scharfzüngigen kleinen Abschiedszettel in der Pariser Kanalisation an, der dann prompt zu Dufarges Stiefel gelangte. Die Dufarges verbrachten eine gewaltige Menge Zeit damit, in den Pariser Abwasserkanälen herumzuplatschen.
Bald hatte der lachende Mann das größte Privatvermögen der Welt angehäuft. Das meiste davon spendete er anonym den Mönchen eines örtlichen Klosters – bescheidenen Asketen, die ihr Leben der Aufzucht deutscher Polizeihunde verschrieben hatten. Was von seinem Vermögen übrig war, tauschte der lachende Mann in Diamanten um, die er beiläufig in Smaragdgruften im Schwarzen Meer versenkte. Seine persönlichen Bedürfnisse waren gering. Er lebte ausschließlich von Reis und Adlerblut in einem winzigen Häuschen mit unterirdischer Turnhalle und Schießstand an der stürmischen Küste Tibets. Bei ihm lebten vier ihm blind ergebene Komplizen: ein zungenfertiger Timberwolf namens Black Wing, ein liebenswerter Zwerg namens Omba, ein riesiger Mongole namens Hong, dem die Zunge von Weißen ausgebrannt worden war, und eine hinreißende Eurasierin, die aus unerwiderter Liebe zu dem lachenden Mann und tiefer Sorge um seine persönliche Sicherheit zuweilen eine ziemlich heikle Einstellung zum Verbrechen hatte. Der lachende Mann erteilte seine Befehle an die Mannschaft durch eine schwarze Seidenwand hindurch. Nicht einmal Omba, der liebenswerte Zwerg, durfte sein Gesicht sehen.
Ich sage nicht, dass ich es tun werde, aber ich könnte den Leser stundenlang – unter Zwang, falls nötig – hin und her über die Pariser-chinesische Grenze geleiten. Zufällig betrachte ich den lachenden Mann als eine Art superdistinguierten Vorfahren von mir – sagen wir, eine Art Robert E. Lee, wobei die ihm zugeschriebenen Tugenden unter Wasser oder Blut gehalten werden. Und diese Illusion ist nur bescheiden verglichen mit der, die ich 1928 hatte, als ich mich nicht nur als den direkten Nachfahren des lachenden Mannes betrachtete, sondern als den einzigen rechtmäßigen noch lebenden. 1928 war ich nicht einmal der Sohn meiner Eltern, sondern ein teuflisch geriebener Hochstapler, der darauf wartete, den kleinsten Fehler von ihnen als Vorwand zu benutzen, um anzufangen – möglichst ohne Gewalt, aber nicht unbedingt –, meine wahre Identität geltend zu machen. Als Vorsichtsmaßnahme, damit ich meiner falschen Mutter nicht das Herz brach, plante ich, sie bei mir in der Unterwelt mit einer unbestimmten, aber angemessen fürstlichen Aufgabe zu beschäftigen. Das Wichtigste aber, das ich 1928 zu tun hatte, war, mich vorzusehen. Die Farce mitzuspielen. Mir die Zähne zu putzen. Mir die Haare zu kämmen. Um jeden Preis mein natürliches, grässliches Lachen zu unterdrücken.
Tatsächlich aber war ich nicht der einzige rechtmäßige noch lebende Nachfahre des lachenden Mannes. Im Club gab es fünfundzwanzig Komantschen, also fünfundzwanzig rechtmäßige noch lebende Nachkommen des lachenden Mannes – und alle liefen wir unheilvoll und inkognito in der Stadt herum, betrachteten Fahrstuhlführer als potenzielle Erzfeinde, flüsterten Cockerspaniels aus dem Mundwinkel, aber flüssig Befehle ins Ohr, malten Arithmetiklehrern mit dem Zeigefinger Schweißtropfen auf die Stirn. Und warteten, warteten immerzu auf eine annehmbare Gelegenheit, im nächsten mediokren Herzen Entsetzen und Bewunderung zu entfachen.
Eines Nachmittags im Februar, kurz nach Eröffnung der Baseball-Saison bei den Komantschen, bemerkte ich im Bus des Häuptlings einen neuen Gegenstand. Uber dem Rückspiegel, oben an der Windschutzscheibe, befand sich das kleine, gerahmte Foto einer jungen Frau in akademischer Tracht. Ich fand, dass das Bild von einer Frau sich mit dem allgemeinen rein männlichen Dekor des Busses biss, und so fragte ich den Häuptling unverblümt, wer das sei. Erst wich er aus, aber letztlich räumte er ein, dass sie eine Frau sei. Ich fragte ihn, wie sie heiße. Er antwortete unfreimütig: »Mary Hudson.« Ich fragte ihn, ob sie beim Film oder so was sei. Er sagte, nein, sie sei aufs Wellesley College gegangen. Dann fügte er noch als langsam entwickelten Gedanken hinzu, das Wellesley sei ein erstklassiges College. Ich fragte ihn, warum er ihr Bild im Bus habe. Er zuckte leicht die Achseln, als wollte er, wie mir schien, damit andeuten, dass das Bild ihm mehr oder weniger untergeschoben worden sei.
Während der folgenden zwei Wochen wurde das Bild – wie unzulässig oder zufällig es dem Häuptling auch untergeschoben worden war – nicht aus dem Bus entfernt. Es wurde nicht mit den Baby-Ruth-Papierchen und den heruntergefallenen Lakritzpeitschen entfernt. Allmählich nahm es die unauffällige Persönlichkeit eines Tachometers an.
Eines Tages aber, auf der Fahrt zum Park, fuhr der Häuptling mit dem Bus auf der Fifth Avenue in Höhe der Sixties, einen knappen Kilometer hinter unserem Baseball-Platz, rechts ran. Ungefähr zwanzig Besserwisser verlangten unisono eine Erklärung, doch der Häuptling gab keine. Stattdessen nahm er seine Geschichtenerzählerposition ein und legte vorzeitig mit einer neuen Folge des »Lachenden Mannes« los. Doch er hatte kaum begonnen, als es an die Bustür klopfte. An dem Tag waren die Reflexe des Häuptlings besonders ausgeprägt. Er schleuderte sich buchstäblich auf seinem Sitz herum und riss den Bedienungsknüppel der Tür hoch, und eine junge Frau in einem Bibermantel stieg in den Bus.
Auf Anhieb kann ich mich nur an drei Frauen in meinem Leben erinnern, die mir auf den ersten Blick als von unklassifizierbar großer Schönheit erschienen. Eine war eine ziemlich dünne in einem schwarzen Badeanzug im Jones Beach Park, die erhebliche Schwierigkeiten hatte, einen orangefarbenen Schirm aufzuspannen, circa 1936. Die zweite war an Bord eines Karibik-Kreuzfahrtschiffs 1939 und warf ihr Feuerzeug nach einem Tümmler. Und die dritte war die Freundin des Häuptlings, Mary Hudson.
»Bin ich sehr spät dran?«, fragte sie den Häuptling und lächelte ihn an.
Ebenso gut hätte sie ihn fragen können, ob sie hässlich sei.