11 NACHDEM ER SEINEN VATER
auf dem Feld der Sterbenden gefunden hatte, schob er ihm seine Jacke unter den verbundenen Kopf und besorgte sich eine andere, blaue Jacke mit zerrissener gelber Paspel, in der er sich hier ungehindert bewegen konnte. In den heißen Tagen und feuchten Nächten, die folgten, wurden die abziehenden Truppen abwechselnd von der Sonne versengt und vom niederprasselnden Regen aufgeweicht, der den Boden auswusch und die Spuren der Schlacht, die nicht allzu tief in ihn eingedrungen waren. Tagsüber brannte eine erbarmungslos stechende Sonne, die Dampfschwaden und Myriaden von Fliegen aufsteigen ließ.
An diesem ersten Morgen wachte er vor Tagesanbruch auf, band die Zügel des Glanzrappen an das Handgelenk seines Vaters, legte das Schreiben des Majors auf die Decke und beschwerte es mit einem kleinen Stein. Als der Vater langsam zu sich kam, schloß Robey ihm unter der Decke die Finger um den Pistolengriff. Erst dann machte er sich auf, um nach Nahrung und Wasser zu suchen, während das Pferd beim Vater blieb.
Bei seinem Streifzug über das Schlachtfeld stellte er sich vor, er wäre ein Geist, ein toter Junge, der mit den anderen Toten lebte und sich um sie kümmerte. Er war noch nicht tot, das nicht, aber so jung, daß er nicht die Aufmerksamkeit der Feldgendarmen erregte, die sich hier einfanden, um ihrem Auftrag zu folgen und an den verwüsteten Orten der Schlacht für etwas Ordnung zu sorgen. Er stöberte nach etwas Eßbarem, das er dem Vater und seinen sterbenden Kameraden bringen konnte. In den herumliegenden Tornistern fand er Butterstücke, Hammelfleisch, Kalbfleisch, Speck und Gläser mit Süßem. Er fand Weinflaschen und seltsamerweise auch alte Babymützen, Babyschuhe, Frauengamaschen, Federkissen, Silberbesteck und Schmuck. Dann hörte er, daß in der Stadt eine Wagenladung mit Brot angekommen sei, aber das war bald alle, und in den nächsten Tagen kamen keine neuen Lieferungen mehr.
Er sah alle Arten von Verletzungen, gräßlich verstümmelte Gesichter und Männer ohne Arme oder Beine, die aber noch lebten und im Schlamm zappelten wie die Hinterlassenschaften einer riesigen Flutwelle. Männer, die in Pfützen ertranken, weil sie sich nicht mehr auf den Rücken drehen konnten. Männer, die in der Nacht auf der kalten und nassen Erde lagen, ins Dunkel starrten und ihre letzten Gebete flüsterten. Wer Glück hatte, lag auf Heu und Stroh, auf einer Decke oder einer Jacke, aber die meisten hatten nichts mehr, keine Schuhe oder Stiefel, keine Mütze, keine Jacke und keine Hose, waren aller ihrer Habseligkeiten beraubt.
Anfangs hatte er sich ein Damenhalstuch um Kopf und Gesicht gebunden und es nur abgenommen, wenn er zum Vater zurückkehrte, aber nach einer Weile gewöhnte er sich an den allgegenwärtigen Geruch des Todes, steckte das Tuch ein und war für immer immun, ließ sich vom Eisengeruch des vergossenen Blutes, von den Ausdünstungen der Verwundeten und vom eigentümlichen Hauch des letzten Atemzugs und der entweichenden Seele nicht mehr irritieren.
Er sah mit Papierschnipseln übersäte Tote, die ihre Briefe und die Fotos ihrer Liebsten zerrissen hatten, damit sie nicht in die Hände gefühlloser Menschen fielen und in den Gazetten des Nordens veröffentlicht wurden. Die, die noch lebten, winkten ihn zu sich und drückten ihm ihre letzten Zeugnisse in die Hand, und er nahm die Briefe an sich, um sie vor den Fledderern zu bewahren, die jetzt immer zahlreicher auf das Schlachtfeld kamen.
Die Fledderer schwärmten aus wie hungrige Geier. Sie sammelten all die liebgewonnenen Dinge ein, die die Soldaten in ihre Taschen eingenäht hatten oder als Talisman um den Hals trugen – Haarlocken, Medaillons, Damenschals und andere Dinge. Wie Krähen im Garten hüpften sie von einem Toten zum nächsten, tasteten verstohlen ihre Taschen und das Futter ihrer Kleider ab und nahmen alles an sich, was sie fanden. Sie drehten ihnen die Ringe von den Fingern und schlichen mit ihrer schändlichen Beute davon. Als anonyme Andenken an die Toten einer der größten Schlachten der Welt waren sie für eine Schublade, einen Schrank oder für ein Privatmuseum bestimmt, oder auch zum Verkauf an Familien, die einen Toten zu beklagen hatten und das Andenken nun auslösen mußten. Wer dieses Geschäft in größerem Umfang betrieb, sammelte Decken, Pferdegeschirre und Waffen. Sie bedienten sich der Pferde, Munitionswagen und sogar der Ambulanzfahrzeuge, um sie zu Milch- und Futterkarren umzubauen.
Überall an Felsbrocken und Baumstämmen klebten Haare, Hirnmasse, Eingeweide und Fleischfetzen, in der Hitze schwarz verfärbt. Da lagen Männer und Pferde, auf das Doppelte angeschwollen, und in den folgenden Tagen konnte er mit ansehen, wie sich ihre Augäpfel blähten und hervorquollen und schließlich unter dem Druck der Faulgase aufplatzten wie schreckliche Blumenkelche.
Die Totengräber begannen ihr Werk, hoben über ihre Spaten gebeugt mit mechanischen Bewegungen die Erde aus, schaufelten einen Hügel nach dem anderen. Er beobachtete zwei, die ein Grab mit der Erde füllten, die sie für das nächste ausgehoben hatten. Sie mußten die ganze Nacht gearbeitet haben, so lang war die Reihe der Grabhügel hinter ihnen. Er sah ihnen zu, bis sie erschöpft innehielten und der eine einen Krug faßte und dabei feststellte, daß er leer war. Robey war nicht nahe genug, um ihren Wortwechsel zu verstehen, aber offensichtlich ging es um den leeren Krug. Der eine ließ seinen Spaten fallen und ballte die Hände zur Faust, woraufhin der andere seinen Spaten ergriff und ihn dem ersten auf die Schulter knallte. Sie fingen an zu rangeln, zu ihren Füßen die Toten mit ihren weißen milchigen Augen, bis sie schließlich beide neben den Leichen zu Boden sanken und sich nicht mehr rührten, nur noch flach atmeten.
Etwas weiter traf er auf junge Männer, die die amputierten Gliedmaßen einsammelten und in Holzfässer legten. Er fragte, was sie mit all diesen Körperteilen vorhatten, und sie sagten ihm, sie seien Medizinstudenten und wollten die Fässer im Boden vergraben, bis das Fleisch verwest war, und die Knochen dann zu ihrem College nach Washington bringen. Eine andere Gruppe von Studenten war damit beschäftigt, in gußeisernen Kesseln die Leichen der konföderierten Soldaten so lange zu kochen. bis sich das Fleisch vom Skelett löste. Sie hantierten sorgfältig mit Löffeln und Haken, während die Flammen an den dampfenden Kesseln leckten.
Er folgte zwei Fledderern, um zu sehen, wie sie vorgingen. Bald begriff er, was an den beiden anders war, denn sie waren nicht an Andenken oder Erinnerungen oder sonstigen nützlichen Dingen interessiert, sondern gingen sehr gezielt vor. Sie hatten Gerätschaften bei sich wie Ärzte oder Mechaniker. Sie besaßen Karbidlampen, mit denen sie das Gelände nachts durchstreifen konnten, und tarnten sich auf verschiedene Weisen. Ihr Lager hatten sie etwas abseits aufgeschlagen. Sie waren nicht am Zubehör des Kriegshandwerks interessiert, und wenn sie Kriegsgerätschaften stahlen, wählten sie sehr sorgfältig aus. Ihr Interesse konzentrierte sich auf Schmuck und bestimmte persönliche Gegenstände. Sie suchten nach allem, was eine Inschrift hatte oder eine Adresse, damit sie die Gegenstände an die Angehörigen verkaufen konnten. Sie durchsuchten nicht die Taschen der Toten und das Futter ihrer Kleider, sondern gingen sehr geschickt und viel effizienter vor, mit Rasiermessern, die sie an ihren Ärmeln befestigt hatten. Mit Eisenscheren schnitten sie den Toten den Ringfinger ab, und mit Kneifzangen rissen sie ihnen die Goldzähne aus dem Mund.
An diesem Nachmittag strömten die Menschen bereits in Scharen zum Schlachtfeld und machten einen Rundgang. Väter und Mütter, Brüder und Schwestern suchten nach ihren verwundeten und toten Angehörigen. Das Gelände war übersät mit Gewehren und allem möglichen Kriegsgerät, und auch solche Dinge wurden als Trophäen mitgenommen. Mehr als einer dieser Unkundigen und Neugierigen kam ums Leben, weil sich aus einer geladenen und entsicherten Waffe versehentlich ein Schuß löste.
Nebengeschäfte begannen zu blühen. Frauen mußten zwanzig Dollar zahlen, damit ihr Mann oder Sohn vom Schlachtfeld aufgesammelt, in eine Holzkiste gelegt und auf einen Karren gehoben wurde. Robey packte die Gelegenheit beim Schopf, und bald taten ihm die Arme vom vielen Heben so weh, daß er sie kaum noch bewegen konnte. Anfangs weigerte er sich, von den Frauen Geld anzunehmen, aber dann gab er nach und hob die wenigen Münzen auf, die sie vor ihm auf den Boden legten, weil sie seine blutverschmierten, glitschigen Hände nicht anfassen wollten.
Mit dem Geld ging er in die Stadt, um Wasser und einen neuen Verband für seinen Vater zu kaufen. Auf dem Weg sah er auf der Treppe vor einem grauen Steinhaus zwei Frauen sitzen, eine ältere und eine jüngere. Direkt neben der Treppe blühten Fliederbüsche, und Lilien hatten auf dünnen, gebogenen Stengeln ihre weißen Kelche geöffnet. Er vermutete, daß sie Mutter und Tochter waren. Sie lachten, als ob nichts passiert wäre, und er konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, als er sah, wie fröhlich sie trotz dieser Umgebung schienen. Er öffnete das Gartentor und bat sie mit trockener Kehle um einen Schluck Wasser.
»Wasser«, sagte die Ältere, »nach dem, was du getan hast, willst du Wasser?«
Er drehte langsam den Kopf nach links und nach rechts. Sosehr er sich auch bemühte, er kam nicht darauf, was er getan haben sollte.
»Das weißt du nicht?« fragte die Frau und beantwortete dann die Frage für ihn. »Du hast die Vögel verscheucht, die kommen nie mehr zurück.«
Die beiden Frauen lachten über diesen Witz.
»Ein Schluck Wasser fünf Cent, ein Glas fünfzig«, sagte die Jüngere zu ihm.
Er hielt ihr die Hand mit den Münzen hin, und sie forderte ihn auf, näher zu kommen. Über einen Weg aus roten Ziegelsteinen, der von zertrampelten gelben Blumen gesäumt war, ging er zu ihnen. Die jüngere Frau hatte blaue Augen und schielte, und über ihre Wangen zogen sich tiefrote Äderchen. Sie hatte die Arme um die angezogenen Beine geschlungen und das Kinn auf die Knie gelegt. Die Ältere sah aus, als wäre ihr Gesicht verbrüht worden, aber das war es nicht. Der Schweiß rann an ihrem schmalen Gesicht hinab und sammelte sich in der kleinen Kuhle zwischen Hals und Schulter. Die beiden Frauen drückten sich Stofftücher vors Gesicht, durch die sie tief einatmeten, und zwischen ihnen stand eine verstöpselte Flasche mit Rosenwasser. Robey hielt ihnen die Silbermünzen noch einmal hin, und die jüngere Frau bedeutete ihm, sie in den Beereneimer zu ihren Füßen zu legen. Dann stand die Ältere auf und verschwand im Haus.
»Brot?« fragte er.
»Ein Laib zwei Dollar«, sagte die Jüngere mit wachsender Ungeduld in der Stimme.
Auch dieses Geld ließ er in den Beereneimer fallen. Diesmal beugte er sich dabei vor und schaute in den Eimer, und er sah, daß er bereits voller Münzen und Scheine war.
»Weg da«, sagte sie mit harter Stimme. »Nicht so nah ran. – Bring einen Laib Brot mit«, rief sie ins Haus.
Die ältere Frau kam mit einem Glas Wasser und einem Brot, das kleiner war als ein Brötchen. Sie scheuchte ihn weg, und als er zurück zum Gartentor ging, folgte sie ihm und stellte das Glas und das Brot ein Stück vor ihm auf den Ziegelsteinen ab. Dann eilte sie zurück zur Treppe, setzte sich und gab ihm mit einem Nicken zu verstehen, daß er jetzt zugreifen konnte.
»Trink das Wasser, und geh«, sagte sie. »Und nimm das Brot mit. Das kannst du hier nicht essen.«
»Hätten Sie auch ein Stück Leinen für einen Kopfverband?« fragte er, nachdem er das Glas in einem Zug geleert hatte.
»Zwei Dollar.«
Er zahlte auch das, nahm den zusammengerollten Stoff entgegen und entfernte sich durchs Gartentor. Hinter ihm lachten die beiden Frauen wieder über etwas, was er nicht verstand.
Auf dem Weg zurück durch die dichter werdende Menge kam er an einem Friedhof vorbei, wo eine Frau neben einer Reihe toter Soldaten ein Grab aushob. Das Gras hinter dem schmiedeeisernen Tor schimmerte bläulich, und er verspürte den Drang, hineinzugehen und sich in dieses Gras zu stellen. Als er dort stand, kam ihm das Schlachtfeld draußen in der sengenden Sonne wie weiß gebleicht vor.
Fasziniert von der Ruhe diese Ortes strich er zwischen den zerborstenen Steinplatten auf dem Friedhof umher. Auch hier hatte der Krieg gewütet, und an manchen Stellen wirkte der Boden wie umgepflügt. Die Grabsteine waren zerbrochen und viele Gräber durch Granateinschläge beschädigt. Die Grabmale, die man umgekippt hatte, damit sie Deckung boten, waren jetzt wie mit Pockennarben übersät. In den Leichen der Männer, die hinter den Steinen zusammengesackt waren, steckten noch die Geschosse aus reinem Weichblei, die fast tausend Meter weit geflogen kamen, um zu töten, um die Knochen zu zersplittern, das Gewebe zu zerreißen und die riesigen, klaffenden Wunden zu schlagen, die sich jetzt wie aufgerissene Münder der Sonne darboten.
Er zählte vierunddreißig Tote, die die Frau zu begraben hatte, und als er ihr seine Hilfe anbot, erfuhr er, daß sie im sechsten Monat schwanger war, aber von einem Ehemann oder einem Vater des Kindes sprach sie nicht.
»Wie ist das passiert?« fragte er und war sich nicht sicher, was er eigentlich meinte.
Sie hielt inne, stützte sich auf die Schaufel und sah ihn mit schräg gelegtem Kopf verwundert an.
»Du bist nicht von hier«, stellte sie fest.
»Nein, Madam.«
»Was hast du hier zu suchen?«
»Meine Mutter hat mich geschickt, den Vater zu holen.«
»Hast du ihn gefunden?«
»Er ist da drüben. Ich wollte Wasser holen, hab es aber selber getrunken. Dann hab ich einen Verband gekauft und hatte kein Geld mehr, um Wasser für die Feldflasche zu besorgen.«
»Wenn du willst, kannst du mir helfen«, sagte sie, »und ich geb dir Wasser. Ich kann dir das Wasser auch so geben, und du gehst zurück zu deinem Vater.«
»Mir hat noch nie jemand für meine Hilfe Geld angeboten.«
»Dann freut es mich um so mehr, daß ich dich mit Wasser bezahlen kann.«
Er half der Frau eine Zeitlang, die Soldaten zu begraben. Die Todesursachen waren offensichtlich, denn die todbringenden Miniergeschosse waren auf dem Weg zu ihrem Ziel mit so verheerender Wirkung in die Körper eingedrungen, daß die Knochen zersplitterten wie morsche Zweige und das Blut aus den Adern ins Gewebe gepreßt wurde. Die Miniekugeln rissen tödliche Wunden an Kopf und Hals, Brust und Bauch. Sie wurden beim Einschlag platt gedrückt und zertrümmerten alle Knochen, auf die sie trafen. Oft flogen abgesplitterte Knochen und Zähne mit so heftigem Drall davon, daß sie im Körper eines anderen Soldaten neue Wunden schlugen.
Die meisten der Soldaten hier auf dem Friedhof hatten aus großer Entfernung einen tödlichen Kopfschuß abbekommen, obwohl sie im Schutz der Grabsteine kauerten, als hätten diese bedeutungsvollen Steine nur darauf gewartet, ihren Sinn im Leben zu erfüllen. Viele der Soldaten waren an der linken Hand getroffen worden, als sie den Ladestock in den Gewehrlauf schoben.
Schweigend stach Robey den Spaten in die Erde, Hüfte an Hüfte mit der Frau, der immer wieder einzelne Haarsträhnen in das müde Gesicht fielen. Sie schob sie zurück hinter die Ohren, doch sie lösten sich wieder, so daß sie sich schließlich aufrichten und die Haarnadeln neu stecken mußte. Er dachte an seine Mutter und wurde zum kleinen Jungen, war wieder zu Hause, wo sie im Garten arbeiteten, mit Umgraben, Pflanzen und Harken beschäftigt, und wo er bald die Ankunft eines Brüderchens oder Schwesterchens mit der Welt teilen würde.
Als das Loch tief genug war, legten sie einen Soldaten hinein, hoben direkt daneben ein weiteres Loch aus und schaufelten mit der Erde daraus das erste Grab zu. Er arbeitete mit ganzer Kraft, damit sie sich nicht so anstrengen mußte, doch sie stach den Spaten mit großer Ausdauer in die Erde und behielt ihr Tempo bei.
Als sich die Dunkelheit über diesen ersten langen Tag zu legen begann, stieg er aus dem frisch ausgehobenen Grab und wollte dem nächsten Soldaten unter die Schulter greifen, als er sah, daß der kaum älter war als er selbst. Seine Zähne waren zertrümmert, und das Hüftgelenk mußte zerschmettert sein, denn ein Bein stand in einem merkwürdigen Winkel vom Körper ab. Er verspürte gleichzeitig Schrecken und Ehrfurcht, weil der kleine Soldat noch so jung war. Die Frau begann zu schluchzen und preßte den Handrücken an die Lippen, und er wußte, sie trauerte nicht so sehr um den Jungen selbst, sondern darum, daß er nur ein Tropfen im Ozean war und dennoch die Last, die sie trug, um ein weiteres Gewicht erschwerte. Ihr Brustkorb senkte sich, die Schultern zuckten, und sie weinte still in ihre Hände. Er half ihr, sich hinzusetzen, und blieb neben ihr stehen, als der Schmerz durch ihren Körper fuhr wie ein beständiger, quälender Wind.
»Tut mir leid«, sagte sie, tupfte sich das Gesicht trocken und verschmierte es dabei mit Friedhofserde.
»Er war ein kleiner Trommler«, sagte er, bückte sich und nahm dem Jungen die zerbrochenen Stöcke aus den Händen.
»Großer Gott«, sagte sie, »er war noch so jung.«
»Ja, Madam. Noch ganz jung.«
»Nimm dir seine Schuhe«, sagte sie, und wieder standen ihr die Tränen in den Augen.
»Wie bitte?«
»Du wirst sie noch brauchen.«
Sie bedeckten den kleinen Trommler mit der Erde aus dem nächsten Grab, das sie aushoben, und als der Hügel fertig war, nahm er die zerbrochenen Trommelstöcke und steckte sie in die Erde.
»Das reicht für heute«, sagte sie.
Dann ging er mit ihr zu einem Haus ganz in der Nähe, dessen Mauern voller Einschußlöcher waren. Sie schöpfte einen Krug Milch aus einem Faß und ließ ihn trinken, bis ihm der Bauch schmerzte, dann füllte sie seine Feldflasche mit frischem Wasser und gab ihm einen Laib Brot. Sie entschuldigte sich in einem fort bei ihm, aber er verstand nicht, warum. Er sah nichts, woran sie Schuld gehabt hätte, nichts, was sie hätte falsch machen können. Im Brustton der Überzeugung erklärte sie ihm, die Menschen sollten zweimal geboren werden: einmal so wie sie sind und einmal so wie sie nicht sind. Das verstand er zwar auch nicht, aber so, wie sie es sagte, mußte es wohl stimmen.
»Da glaubt einer was, das falsch ist«, sagte sie, »und bringt andere dazu, das auch zu glauben. Und zum Schluß glauben alle an den gleichen Fehler.«
Er fragte sie, welchen Fehler sie meine, und da wurde ihre Stimme eiskalt. Sie sagte, er solle seine Wahl treffen, wenn er es denn wolle, und dann wurde ihre Stimme wieder wärmer, voll Mitgefühl.
»Sei vorsichtig«, sagte sie und legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Ja, Madam«, sagte er, erleichtert, daß sie sich wieder gefangen hatte.
»Bringst du deinen Vater nach Hause?«
»Ich hab es meiner Mutter versprochen.«
»Ein gebrochenes Versprechen ist schlimmer als ein gebrochener Knochen.«
»Ja, Madam.«
Als er aufbrach, sah es wieder nach Regen aus, und ein Wetterleuchten zuckte über die Gesichter der noch nicht beerdigten Toten am Friedhofstor. Er eilte zurück zu seinem Vater und deckte ihn mit den Gummiplanen zu, die er sich unterwegs beschafft hatte. Als ein sanfter Nieselregen einsetzte, schlief der Vater noch immer friedlich und wachte erst auf, als Robey ihm die Plane links und rechts unter den Körper schob. Der Glanzrappe lockerte einen verkrampften Muskel und wieherte. Robey hatte einen Futtersack voller Hafer mitgebracht und kippte den Inhalt auf den Boden.
»Hallo Robey«, sagte der Vater, froh, daß er wieder da war, »ich muß sagen, ich fühl mich heute ein bißchen schwach.«
Der Vater lächelte ihm zu und hob den Kopf ein wenig an, um aus der Feldflasche zu trinken. Robey hielt die Flasche schräg und ließ ihm das Wasser in den Mund laufen. Dann bettete er seinen Kopf sanft auf die Jacke, die ihm die Mutter genäht hatte.
»Die Kirche ist voll mit Verwundeten«, erzählte er, »und davor steht ein Karren, auf den sie die Arme und Beine werfen. Sie sagen, es gibt kein Chloroform und keine scharfen Sägen mehr für so viele Verletzte. Fast zwanzigtausend.«
»Ja, das war was«, sagte der Vater und dachte offensichtlich an die letzte Schlacht. »So was hast du im Leben noch nicht gesehen. Manche Jungs mußten sich dreimal betrinken, um es durchzustehen.«
»Da liegen reihenweise Tote«, sagte Robey und versuchte noch immer zu verstehen, was er gesehen hatte.
»Wenn sie vorrücken, haben sie Angst und wollen jemanden neben sich haben«, sagte der Vater. »Sie wollen den Rock des nächsten spüren, aber sie müssen sich verteilen.«
»Sie müssen sich verteilen«, wiederholte Robey für sich.
»Es war furchtbar«, sagte der Vater. »Wie wenn ganze Brigaden in einer Rauchwolke verschwinden.«
»Ich hab einen neuen Verband.«
»Ja. Der muß gewechselt werden. Laß uns heute nacht noch hier ausruhen, und dann gehen wir morgen mit einem frischen Verband nach Hause.«
Robey betastete das verkrustete Leintuch am Kopf des Vaters. Es war schwarz und hart.
»Wo war heute die Sonne?« fragte der Vater. »Ist sie gar nicht durch die Wolken durchgekommen?«
»Sie hat den ganzen Tag geschienen« sagte er, und es war in der Tat ein heißer Tag gewesen.
»Hier aber nicht«, sagte der Vater, und Robey konnte nur vermuten, daß es an dem Rappen lag, der dem Lauf der Sonne von Ost nach West gefolgt war und den Vater so mit seinem Schatten abgeschirmt hatte.
Er bettete den Kopf des Vaters in seinen Schoß, nahm das Taschenmesser und löste den alten Verband, so vorsichtig er konnte. Der Hengst hörte auf zu kauen, als die Binde in kleinen Fetzen abging wie eine alte Baumrinde, und Robey wußte nicht, ob das, was er in Händen hielt, Knochen war oder verrotteter Verbandsstoff. Er blickte hoch und sah, wie der Hengst sie beobachtete. Robey meinte, so was wie Neugier in seinen Augen zu erkennen.
»Es gibt ein Naturgesetz«, sagte der Vater, »daß nach einer großen Schlacht immer Regen oder Schnee fällt. In Frankreich und Deutschland ist das auch so. Ich wußte, deine Mutter würde alles tun, um mich zu finden.«
»Sie hat mich losgeschickt, als General Jackson ums Leben kam.«
»Ich war dabei«, sagte der Vater.
»Als er getötet wurde?«
»Ich war dabei«, wiederholte der Vater.
Zusammen mit dem Verband lösten sich immer mehr Hautfetzen und Knochensplitter und abgestorbenes Gewebe ab. Dann sah er das schwarze Loch in der Wange des Vaters.
»Das juckt wie der Teufel«, sagte der Vater und tastete mit der Hand in Richtung seines Gesichts, gab dann aber auf und ließ die Hand wieder sinken. »Vielleicht bleiben wir noch einen Tag hier, und dann bringst du mich zu deiner Mutter nach Hause.«
»Ja, Vater«, sagte er, und es schnürte ihm die Kehle zu, den geschundenen Kopf seines Vaters im Schoß zu halten und zu sehen, wie die Maden durch seine Finger hinab in den Schoß fielen.
Der Vater wurde von einem Krampf geschüttelt, seufzte tief und wurde wieder ruhiger, als wäre ein weiteres Stück von ihm gestorben, hätte seinen Körper verlassen, und die Hoffnung, es zurückzubekommen, wurde immer kleiner. Robey arbeitete zügig und kratzte mit der Messerklinge behutsam das faulende Gewebe ab. Dann verband er die Wunde mit dem sauberen Leinenstoff, den er an diesem Tag von den beiden Frauen erstanden hatte, legte sich neben den Vater und bettete dessen zerschundenen Kopf an seine Brust.
»Vielleicht kannst du später einen Karren und ein Pony beschaffen. Ich meine nicht stehlen, wir können das ja zurückgeben.«
»Das mach ich«, sagte er und dachte, das ist mein Vater und ich bin sein Sohn, und dieser Gedanke ließ ihn ruhiger werden.
»Oder vielleicht morgen abend«, sagte der Vater. »Wenn ich mich noch einen Tag erholen kann, bin ich stärker.«
»Morgen«, wiederholte Robey und dachte, die Aufregung in seinem Gesicht würde ihm die Tränen heraustreiben, doch dem war nicht so. »Es war an der Zeit, daß du ein bißchen Schlaf bekommst«, schlug er vor.
»Bald«, sagte der Vater.
»Bald«, wiederholte Robey.
In dieser Nacht wurde er durch einen Schuß geweckt und hörte einen Mann aufschreien. Die Nacht hatte keine Erholung von der Hitze des Tages gebracht, und jetzt auch noch ein Gewehrschuß. Er setzte sich auf und sah zu den flachen Gräbern hinüber, die im Mondlicht einen phosphoreszierenden Schimmer verbreiteten. Er stieg aus der frisch ausgehobenen Erde auf, und durch diesen schwachen Schein sah Robey geduckt Wildschweine rennen, die sich daranmachten, die frisch Beerdigten wieder auszugraben. Vom hinteren Ende des Feldes der Sterbenden hörte er einen Schrei, Kampfgeräusche und dann einen lauten Fluch, der die anderen Verletzten weckte und sich als langgezogenes Stöhnen über die ganze Reihe hinweg fortsetzte.
Er packte einen abgebrochenen Säbel und lief die Reihe entlang, bis er auf einen Soldaten traf, der sich auf einen Arm hochstützte. Der Soldat gab unverständliche Laute von sich, hielt einen Revolver in die Ferne gerichtet. Seine Augen, die Nase, die Lippen und der Mund waren von Granatsplittern zerfetzt.
»Mein Bein«, sagte er wieder und wieder.
Er deutete mit dem Lauf des Revolvers auf ein Wildschwein, das nicht weit weg von ihm mit Fressen beschäftigt war, und Robey verstand zunächst nicht, was der Soldat ihm erklärte, daß es sein Bein sei, was das Schwein da fraß, daß er schon wisse, daß das Bein nicht mehr an seinem Körper hing, daß er aber trotzdem die nagenden Zähne des Wildschweins spüre.
»Es nagt an meinem Schienbein, das tut weh«, rief er und zielte mit dem Revolver ins Dunkel.
Neben ihm lag ein Soldat auf dem Rücken, sog laut rasselnd Luft ein und stieß beim Ausatmen kleine Schaumblasen aus, die ihm als weiße Schleimspur die Wangen hinabliefen und sich auf einer Seite zwischen Ohr und Hals aufstauten. Direkt über der Schläfe hatte eine Kugel eine Furche in den Schädelknochen gerissen. Aus dieser Öffnung wölbte sich das Hirn, hing in Flocken und Fäden herunter. Dann hörte er auf zu atmen und war tot.
»Bleib hier«, sagte der Soldat, »laß mich nicht allein. Ich kann nichts sehen.«
»Die Schweine sind da drüben«, sagte Robey und zeigte auf die flachen Schatten, die durchs Dunkel huschten.
»Ich bin blind«, sagte der Soldat.
»Mein Vater«, sagte Robey.
»Bleib, bis ich tot bin, ich will nicht, daß mich das Schwein bei lebendigem Leib auffrißt. Es dauert nicht mehr lange.« Robey wollte nicht so lange von seinem Vater wegbleiben, aber er hob trotzdem den Säbel auf und bewachte in der nächsten Stunde das Feld der Sterbenden. Er hätte sich viele Fragen stellen können, aber die einzige Frage, über die er nachdachte, war, warum der Soldat blind war.
»Warum ist er blind?« flüsterte er auf seinem Patrouillengang. »Warum ist er blind, aber immer noch nicht tot.«
Er lief die Reihe der Länge nach ab und ging nach einer zackigen Kehrtwende zurück zu dem Soldaten mit dem Phantomschmerz, und nach mehreren solchen Rundgängen wurde er müde, verlor die Geduld und ging hinaus auf das Schlachtfeld, wo die Wildschweine den Boden aufwühlten. Er legte sich mit dem Säbel in der Hand ins nasse Gras und wartete ab, und als schließlich ein neugieriger Keiler auf ihn zukam und ihn mit seiner riesigen Schnauze beschnüffelte, hob er den Säbel und stieß ihn dem Wildschwein in den Hals. Das Tier quiekte und stürzte sich mit weit aufgerissenem Maul auf ihn. Als er mit einem heftigen Ruck die Klinge im Hals des Wildschweins herumdrehte, spritzte warmes Blut und lief an seinem Arm hinab, und dann gab das Tier keinen Laut mehr von sich. Er zerlegte es auf der Stelle, steckte sich soviel Fleisch in die Taschen, wie er tragen konnte, und ließ den Rest für die Artgenossen liegen. Am nächsten Morgen würde er sich den Speck und die Schwarte dieses Tiers braten, das sich vom Fleisch und von den Gesichtern der toten Soldaten ernährt hatte, und er stellte sich unwillkürlich vor, daß er den Soldaten, wenn er ihnen davon zu essen gab, etwas von ihnen selbst zurückgab.
Als er zu dem Soldaten mit dem Phantomschmerz zurückkehrte, wollte er ihm sagen, daß er vielleicht deshalb erblindet war, weil Gott beschlossen hatte, daß er für ein Menschenleben genug gesehen hatte, aber als er bei ihm ankam, sah Robey, daß er gestorben war. Auf seiner Brust lag ein Revolver, ein Remington mit sechs Schuß. Er war geladen, und Robey wußte, daß er für ihn bestimmt war. Er wußte auch, daß sich sein Glaube an Gott ein für allemal erledigt hatte.
12 ER FAND DIE GANZE NACHT
keinen rechten Schlaf, und im Dunkel des frühen Morgens wurde er von den leisen Schritten mehrerer Frauen geweckt. Augenblicklich hellwach, setzte er sich auf und sah sie auf dem Schlachtfeld von einem Toten zum nächsten schleichen. Sie weinten in Taschentücher, die sie zuvor mit Minzöl getränkt hatten. Sie waren schlichte, gequälte Kreaturen mit offenem Haar und gebeugtem Rücken, die im Halbdunkel umherwanderten, sich neben die Toten knieten und zu Boden sanken. Er wollte sie ansprechen, wollte sie anfassen, um sicherzugehen, daß er nicht nur träumte.
Er sah auf den Hengst, der still neben ihm Wache stand, erkannte in dessen Gesicht die eigene Trauer und schöpfte Stärke aus der Teilnahmslosigkeit, mit der das Tier dastand. Bestimmt spürte das Pferd, was er spürte. Bestimmt wußte es, was er wußte. Die Frauen waren Schwestern oder Mütter oder Geliebte. Ganz gleich, sie weinten und gingen stockend weiter, und er überlegte, ob sie die Männer, nach denen sie suchten, wirklich finden wollten. Er selbst hatte den gefunden, den er suchte, und er wünschte sich, es wäre nicht geschehen, denn jetzt war fast alle Hoffnung dahin.
Als er wieder aufwachte, war es Tag, und er wurde mit Steinchen beworfen. Er öffnete die Augen und erblickte das Mädchen. Er wußte, daß sie es war, ehe er sie sah, aber er schloß noch einmal die Augen und öffnete sie erneut, und sie stand immer noch da.
Sie schaute ihn reglos an, die Sonne blendete ihn, und er erkannte nur ihre schwarze Silhouette und schirmte die Augen mit der Hand ab, um sie besser betrachten zu können. Er drehte sich auf die Seite und begegnete ihrem merkwürdigen Blick. Sie trug ein einfaches schwarzes Kleid mit weißen Spitzenmanschetten an den Ärmeln und eine Trommel an der Hüfte. Wie sie in diesem schwarzen Kleid neben dem Glanzrappen stand, schien sie Teil des Pferdes zu sein, schien wie aus ihm geboren, und der dünne gelbe Lichtspalt zwischen ihnen, der langsam breiter wurde, war die endgültige Trennung, die sich gerade vollzog.
Sie legte den Kopf schief, blinzelte und musterte ihn weiter. Sie schien zu überlegen, woher sie ihn kannte, und er hatte das Gefühl, ihr dies unbedingt sagen zu müssen. Er wollte sagen, ja, du kennst mich, aber er tat es nicht, erwiderte nur ihren Blick, und die Schuldgefühle, die für ihn mit dem gemeinsamen Erlebnis verbunden waren, standen ihm ins Gesicht geschrieben.
»Du hast gedacht, ich würde dich nicht wiedererkennen«, sagte sie schließlich und biß sich auf die Lippe. In ihren Worten schwang kein Vorwurf mit, und doch fühlte er sich wie auf der Anklagebank.
Er stand auf, zupfte verlegen an seiner Kleidung und ging dann ein paar Schritte von ihr weg zu einem Baum. Sie folgte ihm, und er hörte sie fragen: »Wer bist du?«
Dann wurde ihre Stimme lauter und aggressiver. »Du hättest ihn aufhalten können.«
»Ich konnte nichts tun«, sagte er, drehte sich um und schaute in ihr trauriges Gesicht. »Ich mußte meinen Vater suchen.«
Sie rührte sich nicht, glaubte ihm kein Wort.
Er versuchte verzweifelt, seine Stimme unter Kontrolle zu bringen, damit sie nicht schwach oder bittend klang. Er hatte nichts getan, um den Mann aufzuhalten, und sosehr er sich auch einredete, daß er auch gar nichts hätte tun können, so wußte er es jetzt doch besser, und dieses Wissen im nachhinein, das Wissen, das der Erfahrung folgt, brannte sich in ihn ein, und alles, was er vorher geglaubt hatte, war jetzt belanglos und der Erinnerung nicht wert. Er konnte nicht leugnen, daß ihn seit jener Nacht in dem kaputten Haus mit diesem Mädchen etwas verband. Er konnte nicht leugnen, daß es in seiner Macht gelegen hatte, den Mann aufzuhalten.
»Und ist es dir gelungen?«
»Was?«
»Deinen Vater zu finden.«
Sie hatte zu weinen begonnen, und ihre Tränen rannen seltsam glitzernd über das schmutzige Gesicht. Sie wischte sie nicht weg. Sie stand da in ihrem schwarzen Kleid, mit der Trommel an der Hüfte, als wäre sie die Beschuldigte.
»Nicht weinen«, versuchte er sie zu trösten, aber das machte sie nur noch wütender, und er spürte, daß alles, was er sagen konnte, in ihren Ohren dumm und wenig überzeugend klingen mußte.
»Ich weine gar nicht«, sagte sie, »es sind meine Augen.«
»Mein Vater liegt da unter dem sterbenden Baum«, flüsterte er und zeigte hinüber zum Glanzrappen, der in der Morgensonne einen langen Schatten warf und die beiden beobachtete.
»Wie heißt du?« fragte sie.
»Robey.«
»Wirklich?«
»Ja.«
Er nickte.
»Wie alt bist du?« »Vierzehn.«
»Dich haben sie noch nicht zerbrochen, aber das kommt noch, und wenn es passiert, dann wirst du wissen, wie es für mich war. Was er mir angetan hat, würde kein Tier einem anderen antun.«
Er wollte ihr sagen, daß man ihm in den Kopf geschossen hatte und seinem Vater auch. Er wollte ihr sagen, daß sie auch ihn schon zerbrochen hatten und daß er trotzdem weiterlebte, aber daß sein Vater nicht so viel Glück haben würde. Diesen Gedanken hatte er sich bis jetzt verboten, und er merkte, wie etwas in ihm zerfiel, eine Struktur, die ihm Halt gegeben hatte, und der Gedanke ließ seine Augen brennen.
»Wie heißt du?« fragte er zurück.
»Rachel«, sagte sie, »wie im Buch Mose.«
»Wie alt bist du?« fragte er.
»Fünfzehn.«
»Man sollte zweimal geboren werden«, sagte er.
»Ich wäre lieber gar nicht geboren worden«, erwiderte sie bitter.
»Wie konnte er so was tun?« fragte er töricht, und ein Ausdruck huschte über ihr Gesicht, als wäre das eine unglaubliche Frage, und er bereitete sich innerlich auf weitere Vorwürfe vor, doch ihre Wut war jetzt so groß, daß sie es nicht mehr aushielt. Sie fing an zu zittern, und er wollte ihr vorschlagen, sich in den Schatten zu setzen und durchzuatmen, aber ihre Anwesenheit machte ihn so verlegen, daß er keine halbwegs sinnvollen Worte mehr fand.
»Er hält sich für etwas Besseres«, sagte sie. Sie hatte viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken und sich in ihrem Bemühen um Verstehen für diese Erklärung entschieden. »Er spricht immer davon, eine neue Seite aufzuschlagen, aber er wird sich nicht ändern, kein bißchen. Er hat Schlangen in den Taschen und wirft sie den Leuten hin. Er sagt, niemand kann ihn töten.«
Als sie das sagte, spürte er, wie sie wieder in sich selbst verschwand. Er war nicht mehr da. Es gab nur noch sie und diese Worte, die aber weder das, was geschehen war, erklären noch die Erinnerung daran verscheuchen konnten.
»Jeder kann getötet werden«, sagte er und wartete darauf, daß sie weitersprach, aber das Mädchen namens Rachel war nun verstört und verwirrt, und so unmittelbar und eindrücklich ihre Umgebung auch war, wußte sie offenbar nicht, wo sie sich gerade befand. Abwehrend hob sie die Hand. Mehr konnte sie nicht tun. Er wartete ab, und langsam senkte sie die Hand wieder, sah ihn an und seufzte.
»Wir sind dahinten in dem Kuhstall«, sagte sie, und dann: »Du kannst von hier aus das Dach sehen.«
Sie deutete über das verwüstete Schlachtfeld, und er konnte ein Dach erkennen, das im gedämpften Sonnenlicht matt leuchtete.
Sie sagte, sie wolle, daß er das wußte.
Dann schaute sie in seine Richtung, den Blick aber ins Ungefähre gerichtet, so als würde sie einen Gedanken abwägen. Ein langes Schweigen legte sich zwischen sie, und keiner von ihnen verspürte den Drang, es aufzuheben.
Dann sagte sie, daß sie müde sei und sich ausruhen müsse, sie drehte sich um und ging fort.
AN DIESEM TAG kamen noch mehr Fledderer und noch mehr Verwandte und Bewohner der Stadt, und außerdem trafen auch noch Touristen mit dem Zug ein. Die Luft war knochentrocken an diesem Julitag, die Hitze lag erbarmungslos unter der stechenden Sonne, und schon bald nach ihrer Ankunft mußten sich die Leute übergeben, wurden ohnmächtig und sanken kotzend neben den Toten zu Boden.
Er lief zwischen ihnen umher, auf der einen Schulter trug er eine Schaufel, über die andere baumelten mehrere Feldflaschenriemen. Das hohle Scheppern der Blechflaschen erinnerte ihn an das, was er noch zu erledigen hatte. Den Revolver hatte er hinten in die Hose geschoben, so daß er durch den Rockschoß verdeckt war, und in seinen neuen Stiefeln hatte er ein Messer stecken. Er beobachtete die Leute, die wie Hunde auf allen vieren krochen und würgten, bis nichts mehr herauskam. Dann ging er weiter, Mitleid oder Bedauern empfand er kaum noch.
Als er einen alten Mann mit Sombrero und Poncho auf einem großen Dreirad sitzen sah, mitten in einem Kreis von Toten, die noch nicht bestattet waren, blieb er unvermittelt stehen.
»Suchen Sie jemand Bestimmtes?« fragte er.
»Gott sei Dank nicht«, antwortete der alte Herr. »Aber gib mir bitte eine Schaufel, dann helfe ich dir bei dieser schrecklichen Arbeit. Das ist schlimm und einfach schändlich. Hier gibt es niemanden, der die armen Kerle wenigstens mit ein bißchen Laub bedeckt.«
»Es gibt hier schon Leute, die Gräber ausheben«, beruhigte er den alten Mann. »Die kommen sicher gleich.«
Er hatte keine Geduld für den Gram des alten Mannes, gab ihm die Schaufel und ging weiter, besorgte sich bald ein neues Werkzeug. Auch er war einmal unschuldig gewesen. Auch er hatte einmal geglaubt.
Nun hatte er auf seinen Streifzügen einen zweiten Orientierungspunkt. Der erste war die Baumgruppe gewesen, wo sein sterbender Vater zu Füßen des Glanzrappen lag, und jetzt war da noch der Kuhstall mit dem matt leuchtenden Dach, in dem das Mädchen namens Rachel wohnte. Er stellte sich vor, wie sie dort drüben mit dem Mann und der Frau zusammen war. Er vertraute darauf, daß sie sich Wiedersehen würden, daß sich ihre Lebenswege aus Gründen gekreuzt hatten, die er noch nicht verstand. Der Gedanke schien ihm nicht verwunderlich. Er würde sie Wiedersehen, weil er sie schon einmal gesehen hatte.
Die unerbittliche Hitze machte es schwierig, Wasser für den Rappen und für die Männer auf dem Feld der Sterbenden zu finden. In der ersten Nacht war es ihm gelungen, ein wenig Regen in Gummidecken aufzufangen, aber jetzt war es zu lange trocken gewesen. Er wußte von einem Brunnen, dessen Besitzer die Kurbel abgeschraubt hatte und nur den Leuten Wasser gab, die ihm einen hohen Preis dafür zahlten. An diesem Morgen hatte er beschlossen, den Mann zu erschießen, wenn er die Kurbel nicht herausrückte. So heiß war es. So durstig waren die sterbenden Soldaten.
Als er zu dem Brunnen kam, stand dort bereits ein Feldgendarm, der dem Besitzer gerade die Kurbel abgenommen hatte. Er drehte sie in der Hand und drohte dem Besitzer mit Verhaftung. Er könne seinen eigenen Anspruch natürlich geltend machen, dann würde ihn die Regierung für die Wassernutzung entschädigen. Der Gendarm schraubte die Kurbel wieder an und stellte einen Wachposten neben dem Brunnen auf, während der Besitzer ins Haus ging, um die Formulare für den Erstattungsantrag auszufüllen. Robey war der erste, der seine Feldflaschen füllen durfte, und er ging sofort zurück zu seinem Vater, mit dem er seit der letzten Nacht nicht mehr gesprochen hatte.
»ÜBERALL HIER«, sagte er stirnrunzelnd zu seinem Vater, »sind Neger, die die Offiziere begraben.«
»Sie sind mit ihnen in den Krieg gezogen«, sagte der Vater.
»Fast alle weinen. Manche sind alt, manche jung, aber alle vergießen Tränen.«
Robey hielt seinem Vater die Feldflasche an die Lippen, und das Wasser rann ihm in den offenen Mund, bis er fast erstickt wäre und es ihm aus Augen und Nase wieder herauslief. Er unterdrückte den Hustenanfall, und sein ganzer Körper verkrampfte sich, doch dann fing er sich wieder. Robey wischte ihm die Schweißperlen von Gesicht und Hals und die Tränen aus den Augenwinkeln und gab ihm noch einmal zu trinken.
»Und wer weint am meisten?« fragte der Vater.
»Ich würde sagen, es hält sich die Waage.«
»Es ist schlimm, wenn einer stirbt, den man liebt. Sie waren wie Brüder für die Männer, die dafür gestorben sind, daß sie weiter Sklaven bleiben. Wie kann man so was verstehen?«
»Ich hab einen gefragt: Wo willst du denn hin, wenn du in diese Richtung gehst? Er ist nach Süden gegangen, obwohl er genausogut hätte nach Norden gehen können.«
»Und was hat er geantwortet?«
»Er hat gesagt, er muß zurück dahin, wo er lebt, wo sein Zuhause ist. Ich hab gefragt, warum, und er hat gesagt, ich muß ihnen sagen, was hier passiert ist. Ich muß es seiner Mutter sagen. Da hab ich ihm etwas Brot gegeben, und er hat gesagt, er heißt Moses. Er schien ein guter Kerl zu sein.«
»Er war ein Sklave.«
»Er hat gesagt, er war der Sklave eines Hauptmanns, der tödlich verwundet wurde und noch nicht mal zweiundzwanzig war. Er hat ihn dahinten unter einem Apfelbaum begraben. Er hat gesagt, nach dem Krieg kommt er wieder und holt ihn heim. Ich hab gefragt, warum er das tun will.«
»Und was hat er gesagt?«
»Er hat gesagt, seine Mutter wird es wollen.«
»Du bist noch so jung und hast schon soviel Schreckliches gesehen«, sagte sein Vater und gab ein rasselndes Husten von sich.
Robey nahm die Hand des Vaters und drückte sie fest, um ihn zu beruhigen, er spürte, mit wieviel Kraft sein Händedruck erwidert wurde. Er erzählte ihm nicht, was er auf dem Weg hierher gesehen hatte: die eingefangenen, aneinandergeketteten Sklaven, die wie eine Viehherde nach Süden getrieben wurden, die Sklavenjäger in ihren grellbunten Kleidern, mit ihrem Federschmuck und den Kaltblütern, deren schwere Hufe wie Krebse im Sand scharrten, und den zusammengerollten Peitschen, die an den Sätteln baumelten.
»Ich hab heute ein paar Leuten geholfen, und sie haben mir ein bißchen Geld gegeben.«
»Wofür?«
»Dahinten bei den Felsen. Sie haben Fotos von den Toten gemacht und mich gebeten, ihnen zu helfen, und das hab ich gemacht.«
»Was hast du gemacht?«
»Ihnen geholfen, die Toten dahin zu tragen, wo sie sie haben wollten für ihre Fotos.«
»Das war gut, daß du ihnen geholfen hast«, sagte der Vater mit solcher Müdigkeit in der Stimme, daß Robey wußte, das Gespräch würde bald beendet sein.
»Ich hab die Fledderer wieder gesehen. Das nimmt kein gutes Ende, wenn die so weitermachen.«
»Halt dich von denen fern«, sagte der Vater, und sein Händedruck gab Robey zu verstehen, wie ernst er es meinte. Er erwiderte den Druck mit gleicher Kraft. So blieben sie sitzen, bis der Griff des Vaters schwächer wurde und er seine Hand losließ.
Dann sprach ihn der Vater mit seinem Namen an und fragte: »Robey, glaubst du, du kannst es schaffen?«
Es war, als hätten diese Worte einen Schleier gelüftet. In diesem Moment waren ihrer beider Leben im Gleichklang, und die Frage des Vaters brachte sie dazu, Furcht und Hoffnungslosigkeit hinter sich zu lassen und sich der Zukunft zuzuwenden. Ein lehrender Vater und ein lernender Sohn, zeitlos in ihrem Sein. Der Vater, der im Sohn weiterlebt, wie es der Großvater und der Vater vor ihm getan hatten, bis zurück zum allerersten Menschen. Das Leben des Vaters, das sich dem Ende nähert, und das Leben des Sohnes, das weitergeht, und, wie immer, nur das Unbekannte wertet den einen Daseinszustand höher als den anderen.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte er, »aber ich fühle, daß ich etwas tun muß.«
»Du mußt selbst darauf kommen«, sagte sein Vater. »Ich bin nicht mehr da, um dir zu helfen.«
»Ja, Vater«, sagte er. Dann drehte er ihn sanft auf die Seite und schob noch ein paar Briefe der Toten von Gettysburg unter ihn, damit er etwas weicher lag.
13 ALS SEIN VATER SCHLIEF,
zog es ihn wie magisch dorthin, wo er den nächsten Raubzug der Fledderer auf die toten und sterbenden Soldaten vermutete. Er kannte die Stelle gut, diese merkwürdige Ansammlung runder Felsbrocken unter einer Anhöhe, von der ein Bach herabstürzte, sich durch die Steine zwängte und weiter hinüber zu den Obstplantagen floß. Hier hatte er dem Fotografen geholfen, die Leichen in Position zu bringen, und ihnen dann das Gewehr an die Schulter gelehnt, als wären sie eben erst erschossen worden.
Er schlich sich fort und lief zu diesem tiefen Felsengewirr, weit weg von der Stadt und den Lazaretten. Der Boden war karg und zerklüftet, die Gesteinsbrocken sahen aus, als hätte irgend jemand sie hierher geschleudert, wo sie nun in seltsamen Positionen verharrten. Einige wirkten wie hingestreut, andere wie aus dem Boden gewachsen, und bei wieder anderen war völlig unverständlich, wie sie hier gelandet sein mochten. Tagelang war der Bach hier blutrot vorbeigeflossen, und noch immer war er nicht klar, sondern braun und trüb.
Es war unmöglich, in diesem steinigen Boden jemanden zu begraben, und auch die Lazarettzelte waren zu weit entfernt, außerdem stammten die Toten hier alle aus dem Süden und lagen deshalb noch genauso auf dem Schlachtfeld, wie sie gefallen waren. Die wenigen Überlebenden hatte man unter eine Plane auf Stroh gebettet. Sie wurden von barmherzigen Frauen und ihren Kindern versorgt, die tagsüber aus der Stadt herkamen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder nach Hause gingen.
Er schlich geräuschlos zu dieser Stelle und hielt oberhalb davon im Schatten eines großen Steinbrockens inne. In dem Gewirr von Felsen und schwarzen Bäumen konnte er die Fledderer nicht ausmachen. Aus dem Boden stieg weißer Dampf und trieb in zerrissenen Schwaden über das Gelände.
Er ging immer zehn Schritte, blieb dann stehen und lauschte. Er schlich weiter, lauschte wieder, und dann hörte er einen schwachen, klagenden Ruf, fast wie von einem Käuzchen, doch das war es nicht. Er sah einen Lichtschein und duckte sich, preßte sich flach auf den feuchten, modrigen Waldboden. Von hinten kam ein zweiter Lichtkegel, glitt über die Stelle, an der er eben noch gestanden hatte, zeigte hinab in eine Schlucht und kletterte dann hinunter. Robey sah, wie das Licht im Gleichklang mit einem dahinrennenden Menschen auf und ab hüpfte, und er prägte sich das Gelände ein, bevor wieder alles im Dunkel zwischen den Bäumen verschwand.
Der hüpfende Lichtschein stieg tiefer hinab in die Schlucht und verschmolz dort mit einem zweiten Lichtkegel.
»Verdammt«, stieß eine wütende Stimme hervor.
»Was ist los?«
»Der Scheißkerl hat mich in die Hand gebissen.«
»Einen Schlag auf den Kopf, und er ist tot.«
Es folgte eine kurze Pause, dann hörte er einen dumpfen Schlag und ein Knacken, als träfe ein flacher Gegenstand auf einen Schädel. Er kroch langsam auf die beiden zu und befand sich plötzlich am Rand der beiden Lichtkegel, die von den Köpfen der Fledderer ausgingen und sich auf einen Offizier konzentrierten, der zusammengekrümmt vor ihren Füßen lag.
»Ist er hin?« fragte der eine.
»Woher soll ich das wissen?« gab der andere zurück. Er hatte in einer Hand ein Beil, die andere preßte er sich an die Lippen.
»Was ist denn los?«
»Hab doch gesagt, der Scheißkerl hat mich gebissen.«
»Los, mach schon«, sagte der eine. »Wir müssen hier weg.«
»Ich mach, verdammt noch mal, was ich will.«
Der eine beugte sich über den Offizier, fuhr ihm mit zwei Fingern in die Nasenlöcher und riß ihm den Kopf so weit zurück, daß der Mund weit offenstand und vom gelben Licht der Stirnlampe überflutet wurde. Dann ließ er los, und der Offizier krümmte sich mit einem Stöhnen zusammen.
»Also«, sagte der eine, »ich war dir sehr dankbar, wenn du ihm jetzt die Goldplatte da rausnehmen könntest.«
Der andere setzte das Beil an der Wange des Offiziers an, um an die Goldplatte im Kiefer zu gelangen, an der eine Reihe falscher Zähne befestigt war. Er schwang das Beil hoch über den Kopf und ließ es durch das gelbe Licht hinabzucken. Mit einem Hieb durchschlug er die Wange, trennte den Unter- vom Oberkiefer, und der Mund des Soldaten war ein offener, blutiger Schlund.
»Übler Schurke, der da.«
»Jetzt soll er noch mal zubeißen«, sagte der eine.
»Der beißt keinen mehr«, meinte der andere. Er langte hinunter und schnitt dem Offizier mit einem Rasiermesser die Kehle durch. Die Hand mit dem Rasiermesser wühlte im gurgelnden Blut und zog schließlich die tropfende Goldplatte hervor.
Robey schlich die ganze Nacht hinter den Fledderern her, beobachtete sie bei ihrem blutigen Handwerk und folgte ihnen auch, als sie ihre Beute in eine kleine Hütte brachten, eine halbe Meile vom Schlachtfeld entfernt. Es war eine winzige Ziegelsteinhütte mit einem Blechdach darauf. Türen und Fenster fehlten, die Nordwand war eingefallen und bestand nur noch aus Schutt und Geröll.
Die beiden gingen von außen hinunter in einen kleinen niedrigen Kellerraum, nicht viel höher als einen Meter. Robey sah am Kellerboden ein Licht aufflackern und hörte das keuchende Geräusch eines Blasebalgs. Er dachte nicht daran, wegzugehen. Er dachte auch nicht über die Frage seines Vaters nach, ob er es schaffen konnte. Er hatte keine Wahl, und er machte sich deshalb keine Gedanken. Es war, als hätte jemand anders für ihn entschieden, und zu dieser Entscheidung gehörte auch, daß er keine Fragen stellte.
Das trübe gelbe Licht flackerte vom Boden hoch und begann durch die Risse im Fundament zu schimmern. Er entdeckte eine kleine Öffnung, wo die Grundmauer verrottet war, und kroch auf allen vieren zum Licht hin. Dann legte er sich flach auf den Bauch und spähte in das Kellerloch hinein, und auf einmal durchfuhr ihn ein bislang unbekanntes Gefühl. Es war nur der Hauch eines Gefühls, aber er war wie elektrisiert davon.
Die beiden saßen im Schneidersitz auf der Erde, ein Licht zwischen sich, so wie es Männer seit Tausenden von Jahren tun. Das Licht war eine winzige Schmiedeesse, in der sie einen kleinen Tiegel erhitzten, um nach und nach die Goldzähne und die Eheringe und auch die Zahnplatte des ermordeten Offiziers hineinzulegen. Stück für Stück zogen sie aus ihren Taschen die goldenen Andenken, Erinnerungen, Liebeserklärungen und Seelentröster, die sie erbeutet hatten.
»Ich bring nicht gern jemanden um«, sagte der eine und drückte auf den Blasebalg. »Aber was soll man machen?«
»Jetzt ist’s vorbei«, sagte der andere. »Morgen gehen wir mit der Armee nach Süden. Mir reicht’s hier. Der Gestank ist unerträglich.«
Robey beobachtete sie eine ganze Weile durch die Ritze im Mauerwerk, und er war nicht schockiert, sondern fasziniert von ihrem Tun. Als er hinter sich das nervöse Schnauben eines Pferdes hörte, drehte er sich zur Seite und griff nach dem Revolver. Drüben bei den Bäumen stand ein langbeiniger Rotschimmel mit zusammengebundenen Hinterläufen, und daneben ein zweites Pferd, eine Fuchsstute mit Blesse, das Blätter vom Baum zupfte.
Die Männer im Keller hatten das unruhige Pferd nicht gehört. Sie entkorkten eine Schnapsflasche, reichten sie sich gegenseitig und rauchten Zigarren, und als das Metall geschmolzen war, griff der eine nach einer Eisenzange und hob den kleinen Tiegel damit an. Der andere schob ihm ein Sandkistchen hin, das kaum Platz für ein Kartenspiel bot. Der mit der Zange goß das flüssige Metall hinein, und es entstand ein rechteckiger Lichtschein, gleißender als die Sonne, heller als alles Licht, das Robey je gesehen hatte.
Die beiden tranken weiter und zogen an ihren Zigarren, während das Licht an Intensität verlor, aber Robeys Erinnerung würde dieses Gleißen für immer festhalten. Mit blutverschmierten Händen schnippten sie sich den Schmutz von der Hose, prüften die Knöpfe und strichen die Revers glatt. Er schloß daraus, daß sie ihr Tagwerk vollbracht hatten. »Ich meine, wir sollten heut nacht noch nach Harrisburg, und dann nehmen wir den Zug zurück nach Philadelphia«, sagte der eine. »Ich meine, wir haben genug, wir müssen nicht gierig sein wie Mastschweine.«
»Warum nicht?« entgegnete der andere. »Mastschweine werden fett.«
»Aber wenn sie fett sind, werden sie geschlachtet.«
»Wo du recht hast, hast du recht.«
Im Lichtschein der abkühlenden Esse und des aushärtenden Metalls konnte er erkennen, daß der eine Mann Luchsaugen hatte und sein Gesicht völlig vernarbt war, wie nach einem Brand oder einer Explosion. Die Ohren wirkten gestutzt, sie sahen aus, als hätte jemand ein Stück abgeschnitten. Der andere packte mit der Zange ein Stück Glut, beugte sich vor und zündete sich noch eine Zigarre an.
»Sie stauen sich grad am Potomac«, sagte der andere.
»Was wollen sie dort?« fragte der eine. »Nicht besonders schlau.«
»Das Wasser ist zu hoch, sie können nicht rüber«, meinte der andere. Er zog genüßlich an der Zigarre, drehte sie zwischen den Fingerspitzen, tauchte das Mundstück in die Schnapsflasche und nahm einen Zug.
»Und wenn das das Ende ist?«
»Deshalb gehen wir ja auch nicht nach Philadelphia.«
»Ich denke, wir sollten die Pferde satteln«, sagte der eine, »und noch heute nacht verschwinden.«
»Ich denke, ich sattle die Pferde und dann geht’s nach Süden«, meinte der andere. »Wir sind noch lange nicht fertig. Am Fluß wird es noch eine Schlacht geben, und wenn alles vorbei ist, werden wir da sein.«
Dann stand er auf und klopfte sich den Hosenboden ab. Er verließ das Kellerloch, ging den kurzen, mit Geröll übersäten Weg entlang und verschwand in dem Dickicht, wo die Pferde in ihren Fußfesseln standen.
Robey beobachtete den, der noch immer im Kellerloch saß und sich mit einem Taschenmesser die Nägel schnitt. Dann zog er den Revolver heraus und spannte den Hahn. Um das Klicken zu dämpfen, krümmte er sich darüber. Er hielt den Lauf gerade nach oben und war überrascht vom Gewicht der Waffe.
Er kroch hinüber, bis er den anderen sehen konnte, der gerade die Pferde sattelte und ihnen die Trense ins Maul schob. Plötzlich riß eines der Tiere den Kopf hoch. Der Mann tat fluchend einen Schritt zurück, und als sich das Pferd wieder beruhigt hatte, boxte er ihm in die Flanke, so daß es fast in die Knie ging und nervös zitternd auf der Stelle hin und her trat.
Dann kam der Mann zur Hütte zurück. Er spuckte auf den Boden und stieg mit eingezogenem Kopf hinab in den Keller. Als sein Körper die Türöffnung ausfüllte und das Licht verdeckte, trat Robey neben ihn. Er legte den Revolver auf den abgewinkelten Unterarm, setzte den achteckigen Lauf an das Ohr des Mannes und drückte ab. Die Bleikugel bohrte sich hinter seinen Augen quer durchs Gehirn und trat am anderen Ohr wieder aus dem Schädel aus. Der Mann brach zusammen, stürzte beim Knall des Revolvers nach vorn und fiel dem anderen, der noch immer auf der Erde saß, vor die Füße.
Als Robey einen Schritt von der Kelleröffnung zurücktrat und den Hahn erneut spannte, erlosch unten das flackernde Licht. Dann war es ganz still, und er konnte das Zischen der Glut hören und seinen eigenen Atem. Er und der, der noch lebte, wußten beide, daß es nur einen Weg aus diesem Kellerloch gab, den durch die Öffnung, die Robey jetzt versperrte.
Er wartete, drückte sich eng an die Mauer. Wenn jemand den Schuß gehört hatte und nachschauen wollte, was los war, würde ihm Zeit genug bleiben, im Dunkel zu verschwinden, aber das war nicht sehr wahrscheinlich. Hier waren Schüsse in der Nacht nichts Ungewöhnliches. Jede Nacht ertönte der einsame Todesschrei eines Irren, dessen Echo über das Schlachtfeld hallte, gefolgt von einem absichtlich oder zufällig ausgelösten Schuß, gegen sich selbst oder einen anderen gerichtet, und dann war es wieder still. Dann noch ein Schuß, ohne Vorwarnung oder Nachhall. Das waffenstarrende Schlachtfeld war noch immer gefährlich. Der Krieg, der noch nicht genug hatte, lag immer noch auf der Lauer.
»Wer bist du?« ertönte die Stimme des Fledderers aus dem schwarzen Kellerloch. Aus dem hastig gelöschten Feuer stieg scharfer Rauch auf und mischte sich mit dem verbrannten Schießpulver.
»Keiner, den du kennst«, antwortete er.
Wieder Stille. Der Geruch von angesengtem Haar stieg ihm in die Nase. Bald würde er wissen, ob jemand vorbeigeritten kam, um dem Schuß nachzugehen, aber er bezweifelte es.
»Was willst du«, fragte der Fledderer.
»Weiß nicht. Hab grad jemand umgebracht.«
»Stimmt.«
»Ich wollt ihn auch umbringen«, ergänzte Robey. Er spürte kein Pochen, weder in der Brust noch im Kopf noch in den Beinen. Seine Arme waren nicht schwach geworden, sondern fühlten sich eher noch stärker an, und seine Entschlossenheit wuchs.
»Ist dir gelungen«, sagte der Fledderer.
»Er ist tot, oder?«
»Mausetot.«
»Es war gar nicht schwer.«
»Hm. Ich muß sagen, du hast richtig Talent.«
Er suchte den schwarzen Horizont nach Lichtern ab, die sich bewegten. Er horchte nach Hufgetrappel. Aber er hörte nichts. Da unten war es ganz ruhig.
»Wie heißt du?«
»Geht dich nichts an.«
»Sag deinen Namen, Freund. Jeder hat einen Namen.«
»Ich will nicht, daß du meinen Namen in den Mund nimmst.«
»Bist ganz schön bissig.«
Wieder erdrückende Stille. Sie hing in der Luft, als wäre das Dunkel aus Glasfäden gewebt.
»Ich mach dir ein Angebot.«
»Was hast du?«
»Ich hab hier in der Mauer ’n Sack Gold versteckt. Und Silber. Willst du’s haben? Wenn du willst, ist es deins, Freund.«
»Daran hab ich gar nicht gedacht.«
»Wenn jemand den Schuß gehört hat, kommt sicher ein Feldgendarm vorbei.«
»Mich wird er nicht kriegen.«
»Ich hab ’ne Idee.«
»Und?«
»Ich werf die Säcke zu dir rauf.«
»Nur zu.«
Die Säcke kamen aus dem Dunkel hochgeflogen, und im Mondlicht konnte er auf dem Boden vor sich ihre schwarzen Umrisse sehen. Als er sich bückte, um sie aufzuheben, kam aus dem Keller ein Schuß. Die Kugel des Fledderers verfehlte ihn um ein gutes Stück, und er drückte sich mit den schweren Säcken wieder gegen die Mauer.
»Getroffen?«
»Nein.«
»Ich mußte es einfach versuchen.«
»Schon klar.«
»Tut mir leid, aber er war mein Bruder.«
»Ich wollte niemandem den Bruder töten.«
»Na, er war nicht gerade der Hellste.«
»Er war ein übler Schurke.«
»Ach, er war schon in Ordnung, aber weißt du, was?«
»Was?«
»Ein Stück Scheiße kriegst du einfach nicht aufpoliert.«
Der Fledderer lachte über seinen Witz und sagte dann: »Und was machen wir jetzt?«
»Ich denk, ich nehm mir die Pferde und verschwinde.«
»Da bin ich dir dankbar.«
»Spar dir deinen Dank.«
»Dann wart ich noch ein bißchen, bis du weg bist.«
»Wie du meinst.«
»He, Junge. Und wenn du jetzt einfach da draußen abwartest, bis ich rauskomme, und mich dann abknallst?«
»Hab ich nicht dran gedacht.«
»Junge?«
14 ALS ROBEY ZU SEINEM
sterbenden Vater zurückkam, war der Glanzrappe unruhig und beleidigt. Er streichelte ihn besänftigend, und der Hengst schüttelte den Kopf und schnaubte heftig, als er den Geruch der Pferde der Fledderer an ihm wahrnahm. Den Rotschimmel und die Fuchsstute hatte er an den Mann verkauft, dem der Brunnen gehörte. Er hatte ihn aus dem Bett geholt und ihm gesagt, es wäre gut, wenn er die Pferde ins Hinterland bringen würde, damit sie sich erholen konnten, und der Mann hatte verstanden und ihm die Tiere ohne weitere Fragen abgekauft.
Er beruhigte den Rappen, streckte sich dann auf der warmen Erde aus und legte den Kopf an die Schulter des Vaters. Er spürte, wie der Vater den Arm hob und mit den Fingern an ihm herumtastete, bis er seinen Gürtel fand und sich einhakte. Schweigend lag er im Arm des Vaters, den eigenen Arm quer über seiner Brust. Er spürte, wie sich der Brustkorb des Vaters hob und senkte, und wünschte ihm, daß ihn der Schlaf übermannen und schmerzlos von hier forttragen würde. Ihm war jetzt klar, wenn er fortging, würde der Vater zurückbleiben.
Er fragte sich, ob er all das, was er gerade erlebte, in Erinnerung behalten würde. Das Unrecht, das er begangen hatte, die Tage unterwegs, die Suche nach dem Vater. Bei so furchtbaren, so gräßlichen Erinnerungen wie diesen war es um so wichtiger, daß er sie wieder vergaß, wenn er es konnte, daß er die Namen und die Gesichter vergaß, das Land und die Dinge auf dem Land, daß er alles vergaß, was er über den Krieg gelernt hatte.
»Wo warst du?« fragte der Vater, ohne ihm das Gesicht zuzuwenden. Er hatte gedacht, der Vater wäre eingeschlafen, doch dem war nicht so. »Ich war ein Pony und einen Karren suchen«, log er.
Der Vater gab einen rasselnden Husten tief aus der Kehle von sich. Ein unverkennbarer Geruch umgab ihn, und als er die Augen öffnete, schweifte sein Blick in die Ferne und sein Atem wurde flach. Robey befreite sich aus seiner Umarmung und nahm ihn selbst in die Arme.
»Eins mußt du wissen, mein Sohn. Was hier passiert ist, hat nichts mit Feindschaft oder Brutalität zu tun.«
»Ja, Vater«, sagte er. »Ich weiß. Ruh dich jetzt aus.«
»Das waren keine Verrückten. Das war nicht aus Liebe oder aus Habgier oder aus Dummheit. Hier geht es um wohlerzogene und kluge Menschen. So sind die Menschen. So ist das Leben, mein Sohn.«
»Ja, Vater«, sagte er, aber er fragte sich, was mit ihm selbst war. Würde er für das, was er getan hatte, geradestehen können? Hatte er nicht aus Stolz und Selbstgerechtigkeit gehandelt?
»Das ist das Wesen des Menschen, das ist die Welt, und wenn du in ihr leben willst, mußt du wissen, was zu tun ist.«
»Ja, Vater«, sagte er und dachte, laß die Vergangenheit los. Laß sie ruhen. Sei dein eigener Richter, und überlaß diese Aufgabe nicht einem anderen. Entscheide für dich selbst, denn jede Seite wird dich töten, und auch wer auf keiner Seite steht, wird dich töten, auch die Frauen und Kinder werden dich töten, all diese Werkzeuge des Krieges, und er hatte selbst getötet und wußte, er würde wieder töten, ohne innezuhalten oder zu zögern, ohne nachzudenken, ehe er es tat. In seinem Innern spürte er, daß er seine Lektion gelernt hatte und sie nie wieder vergessen würde. Das war etwas, was sich nicht mehr wegreden oder wegdenken ließ. Es war so alt wie die Sonne selbst.
»Du mußtest tun, was du heute nacht getan hast«, sagte sein Vater.
»Ich weiß, Vater.«
»Du weißt, daß ich nicht mitkomme, wenn du gehst.«
»Ich weiß.«
»Wenn du gehst, reite nach Süden. Such Moxley und Yandell und Tom Allen und Little Sandy. Sie sind bei der Artillerie am Potomac. Das Wasser ist zu hoch, sie können nicht rüber. Sie werden dich aufnehmen. Sie werden dir was beibringen. Sie werden sich um dich kümmern. Sag ihnen, du bist ich. Sag ihnen das.«
»Ich bin du«, sagte er.
»Mir ist so kalt«, sagte der Vater, und das waren die ersten Worte, die seinen Schmerz und seine Verzweiflung verrieten. »Ich glaube, so kalt war mir noch nie, und mir ist schon ganz schön kalt gewesen.«
Robey schlang die Arme um ihn und hielt ihn fest. Der Kopf des Vaters lehnte an seiner Brust, er war eine einzige faulige Wunde. Während er den Vater festhielt, dachte er nicht an das, was passiert war und was in den nächsten Stunden und Tagen noch passieren würde. Sie waren hier beieinander, und sie lebten, egal wie kurz die Zeit war, egal wie schnell der Moment sich näherte und verging.
Er hielt ihn die ganze Nacht im Arm, und der Vater, schwach und zerbrechlich, verlor weiter an Boden, als die Nacht fortschritt, aber Robey ließ ihn nicht los, als könnte er mit der Umklammerung die Gewißheit des Todes abwehren. Der Vater zitterte, sein Körper war kalt, Gesicht und Augen waren ausgetrocknet. Dann flüsterte er etwas, und er bat ihn, sag es noch mal, und beugte sich vor, um ihn besser zu verstehen.
»Wo warst du heute abend?« fragte der Vater, nun wieder mit klarer, kräftiger Stimme, als wäre es möglich, daß er sich doch noch erholte.
»Ich hab ein Pony und einen Karren gesucht, um dich nach Hause zu bringen.«
»Du bist ein guter Junge, aber ich denke nicht, daß ich noch von hier wegkomme.«
»Ich weiß.«
»Ich denke, das ist der letzte Tag in meinem Leben«, sagte er, und Robey hörte das Gurgeln, mit dem ein Lachen erstickt wird. »Deiner Mutter wird das gar nicht gefallen. Du mußt es ihr sagen, ich komme nicht mehr dazu.«
Dann klammerte er sich am Ärmel seines Sohnes fest, als ein heftiger Krampf mehrmals durch seinen Körper fuhr. Sein rasselnder Atem stockte, und er seufzte. Schwerer Tau hatte sich auf die Felder gelegt, die sich jetzt unter dem Mond vor ihnen hinstreckten wie ein breiter Pfad mit weißen Edelsteinen auf blauem Samt.
»Ah«, stöhnte der Vater, als wäre er von einem weiteren Teil seiner Sterblichkeit befreit.
Er hielt den Kopf des Vaters im Schoß, legte einen Arm über seine Brust. Der Vater ergriff den Arm und ließ ihn nicht mehr los. Robey spürte, wie sich seine Finger verkrallten und ihre Kraft auf ihn übertrugen.
»Ich bin sehr müde«, sagte der Vater, und wieder fuhr ein Zucken durch seinen Körper, ließ ihn sich aufbäumen wie ein Mann, der im Traum kämpft, und dann war er wieder ruhig.
»Es ist an der Zeit«, sagte er schließlich.
»Nein, Vater. Es ist noch nicht an der Zeit.«
»Doch.«
»Nein.«
»Heute ist es soweit.«
»Nicht heute, Vater. Bitte nicht.«
»Wir sehen uns auf den alten Feldern wieder«, sagte der Vater mit schnellen, flachen Atemzügen.
Er wußte, es war soweit, der Vater ging jetzt den Weg der Sterbenden. Er wußte jetzt, alles und jeder stirbt irgendwann, und er wußte, das Leben bedeutet wenig. Er wußte, alles, was war, war bereits gewesen. Er wußte, das Leben der Menschen war nichts als ein schwacher Hauch, egal was sie taten und sagten und was sie von sich selbst dachten. Er wußte, die Erde war von Zorn erfüllt, und das Böse war lebendig, so lebendig wie jeder Mann und jede Frau. Er wußte, das Leben bedeutete ihm nicht viel, aber hier ging es um das Leben seines Vaters.
»Jetzt werde ich zu dir«, sagte sein Vater, »und du bist schon ein alter Mann.«
Und dann sagte er: »Ich komme.«
So merkwürdig diese Verwandlung des Sohnes auch war, der seinen Vater in sich aufnahm, sie war greifbar und umfassend, und er spürte sie deutlich. Er fühlte, wie sie sich in ihm vollzog, während die Worte gesprochen wurden. Dann war es vorbei, und er war kein Junge mehr, denn sein Vater war tot.
Als er in dieser Nacht dem Vater eine Locke abschnitt, fühlte er sich merkwürdig ruhig dabei, denn er hatte den Schrecken erlebt, der einen Menschen ganz still zurückläßt. Wann genau es begonnen hatte, wußte er nicht. War es vor einer Woche oder vor einem Monat gewesen? Er wußte auch nicht, wie lange ihn diese dunkle Trauer verfolgen würde. Er fragte sich, wer eine Welt erklären konnte, in der die Worte der Menschen, ihre Beziehungen und Gedanken so wenig auszurichten vermochten. Er spürte eine unaufhaltsame Flut in sich aufsteigen. Seine Augen hatten schon so viel Tod so nah gesehen. Er hatte das Gefühl, nur ein hohler, hungriger Junge gewesen zu sein, festgehalten auf dem Berg, wo er wartete und wartete, bis der Ruf kam, bis er selbst an der Reihe war, einer dieser Menschen zu werden, die nichts auszurichten vermochten. Doch er hatte sich im Schutz des Berges nie hohl oder hungrig gefühlt. Er wußte nicht, warum, aber er hatte keine Angst mehr vor dem Tod. Er wußte, daß er sich jetzt nicht mehr wie die Hälfte von etwas Ganzem fühlte, sondern als etwas Ganzes und Vollkommenes, das gerade entstand.
15 ER STAND AM GRAB
seines Vaters und beobachtete, wie der Mond im Wald verschwand. Er hatte ihn in eine Gummiplane gewickelt, die Enden zusammengefaltet und mit einem Bindfaden verschnürt. Dann grub er ein tiefes Loch, trug den Vater dorthin und ließ ihn sachte hineingleiten. Die Säcke mit Gold und Silber und die Briefe der Toten legte er dazu. Er schaufelte alles mit Erde zu, legte die Grasnarbe wieder darauf und deckte die Stelle mit Ästen und Zweigen ab, damit ihn niemand fand, bis er irgendwann zurückkommen und ihn nach Hause bringen würde.
Nachdem er die Arbeit getan hatte, sattelte er den Glanzrappen, legte ihm das Zaumzeug an und packte seine Sachen zusammen. Ihm blieben nur noch ein paar Stunden, bis das Rot des Sonnenaufgangs den Horizont verfärbte. Dann würde die Luft drückend werden, und der dichte Nebel würde sich erst am späten Vormittag auflösen. Wenn man davon ausging, daß dieser Tag genauso werden würde wie der Tag davor, und seiner Erfahrung nach stimmte das beim Wetter meistens.
Sie waren die einzigen Lebewesen, die im offenen Gelände unterwegs waren, und die Größe, die Stärke und die Gelassenheit des Glanzrappen übertrugen sich auf ihn. Er ging an der nicht enden wollenden Reihe von Erdhügeln vorbei, die die Toten verschüttet und verschluckt hatten.
Er dachte daran, wo die Toten gelegen hatten, die Verstümmelten, die Kopflosen, die Untergegangenen, die Gebrochenen, die Männer, die einander fest umklammert hielten. Es machte ihm nichts aus, daß der Krieg so schrecklich war. Er hatte keine Wahl gehabt, und doch hatte er sich entschieden. In der einen Hand hielt er die Zügel und in der anderen Hand den geladenen und entsicherten Revolver. Das war seine Hand. Sein Arm. Wenn er an diesem Morgen jemandem begegnete, wußte er, was er tun würde.
Sie war im Kuhstall, hatte sie gesagt. Dort gab es kein Vieh mehr, aber Hafer und Stroh, und auf dem Boden verstreut lagen alle möglichen Gerätschaften. Die Holzwände waren von Einschüssen durchsiebt, doch zuerst sah er die Löcher gar nicht, denn im Dunkeln wirkten sie wie schwarze Astlöcher in den rauhen Kieferbrettern. Vorsichtig bahnte er sich einen Weg durch das Gerumpel, die Werkzeuge und Milchkannen, die Hocker, Eimer, Geschirre und Fässer, schlich an einem zerbrochenen Mistkarren vorbei und an der heißen Glut eines kleinen, erlöschenden Lagerfeuers.
Er fand den Mann. Er lag in einer der Viehbuchten, schlief tief und fest. Sein Körper war grau und zusammengefallen, aus dem offenen Mund entwichen Atemstöße, und beim Einsaugen der Luft ertönte ein schnarrendes Geräusch. Der breite Brustkorb hob und senkte sich, und mit ihm die Decke, unter der er lag, und auch die vereinzelten Strohhalme auf der Decke.
Robey nahm etwas Heu, einen Armvoll Futter für den Glanzrappen, und auch eine Schaufel Hafer. Das Pferd war unruhig geworden, bereit zur Flucht. Schon zu lange hatte es Rücksicht auf ihn genommen. Robey versprach, daß es nicht mehr lange dauern würde. Er ging zurück zum Stall und lief an der zersplitterten Wand entlang weiter.
In der nächsten Viehbucht entdeckte er die blinde Frau. Sie war noch dicker geworden, seit er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Sie lag auf der Seite, und der unförmige Bauch ließ Arme, Beine und Kopf winzig erscheinen. Ihr Gesicht war entstellt, zeugte von einer schweren inneren Krankheit. Er fragte sich, was Blinde wohl im Schlaf sahen. Er erinnerte sich an sein Mitgefühl für die Frau, damals vor vielen Wochen, in dem ausgebrannten alten Haus, bevor er dort dann alles beobachtet hatte, und auch noch danach, aber jetzt war sie für ihn einfach irgendein Lebewesen. Sie bedeutete ihm nichts, und er wußte, wenn er dieses Gefühl in sich zuließ, würde sie ihm sogar noch weniger bedeuten.
Er ging weiter, und als die Schatten im Mondlicht wanderten, konnte er sie durch einen Riß in der Bretterwand sehen. Sie lag auf einem Strohlager in einer leeren Viehbucht, eine Decke über sich gebreitet, das lose Haar wirr auf dem nackten Arm. Er sah ihr geduldig zu und wartete darauf, daß sie aufwachte und in seine Richtung schaute.
Sie spürte im Schlaf, daß da jemand war. Schließlich regte sie sich, setzte sich auf und öffnete die Augen, während das Mondlicht ihr über den Hals strich. Sie hob die Hand, hielt ein Messer darin, das sich mit ihrem Handgelenk langsam drehte, als käme die Bewegung nicht aus dem Arm, sondern aus dem Messer. Sie konzentrierte sich auf das vage Gefühl, das sie geweckt hatte. Sie wußte, da draußen vor der Bretterwand war etwas, ganz dicht bei ihr, und wenn es hereinkam, würde es ein Kampf auf Leben und Tod werden.
Er sah ihr zu, als sie sich erhob, eine schmale Mädchengestalt in einem schmuddeligen Unterhemd. Das Haar fiel ihr über die Schultern, und sie verschränkte die Arme vor der Brust; es war nur die Klinge des Messers zu sehen, wie ein gefährlicher Stachel, der aus ihrem Körper wuchs. Sie starrte auf die Bretterwand, durch die er hereinlugte, schien aber nicht zu merken, daß tatsächlich jemand auf der anderen Seite stand. Sie legte sich die Decke um die Schultern, trat auf den Gang hinaus und schaute nach den beiden anderen, die nebenan schliefen. Dann ging sie ins Freie, wo er stand. Sie war nicht erstaunt, ihn zu sehen, sondern wirkte, als hätte sie ihn erwartet. Sie ließ das Messer aus der Hand gleiten und ging zu ihm hin, und als sie sich gegen ihn lehnte, um ihm etwas zuzuflüstern, spürte er ihren warmen, verschlafenen Atem auf seinem Gesicht.
»Du hast mir beim Schlafen zugeschaut«, sagte sie.
»Ja.«
»Ich hab dich gespürt«, sagte sie, und ihr Blick glitt über sein Gesicht, suchte nach etwas, was ihr verriet, daß etwas nicht stimmte, denn sie war sich ganz sicher, daß etwas nicht stimmte.
»Mich?«
»Ja. Ich hab dich gespürt. Ich hab auf dich gewartet.«
»Du hast gewußt, daß ich komme?«
»Warum so ein Gesicht?« fragte sie und legte die Finger auf die Lippen. Sie sah über seine Schultern hinweg auf den pechschwarzen Hengst und wußte, was ihn hergeführt hatte.
»Ich mach kein Gesicht«, gab er zurück.
»Ich weiß, warum du gekommen bist.«
»Hast du geschlafen?« fragte er.
»Ich würd’s nicht Schlaf nennen.«
»Mein Vater ist tot.«
»Das tut mir leid«, sagte sie. Sie breitete die Decke aus, um auch ihn darin einzuhüllen. Er trat ohne Zögern auf sie zu, und sie schlang die Arme und die Decke um ihn. Da senkte er den Kopf an ihren Nacken, lehnte sich an sie und ließ sich in der Decke von ihr halten. Sie roch nach Schlaf und Schweiß, nach vielen Tagen ohne Wasser zum Waschen. Sie erklärte ihm, daß alles stirbt, und dann, irgendwann, kommt es zurück. Er spürte ihren warmen Atem an seinem Hals. Über ihnen beendete das Sternenrad langsam seine Runde. Der Morgen war nur noch wenige Stunden entfernt, und er hatte das Gefühl, daß es ein erster Morgen wurde, der Morgen eines neuen Anfangs.
»Er ist nicht mehr in dieser Welt«, sagte sie, als wäre das eine Erleichterung und ein Segen für ihn.
»Ja, das stimmt«, antwortete er.
»Gehst du weg?« fragte sie.
Er nickte, die Wange noch immer an ihren Hals gedrückt.
»Nimm mich mit«, sagte sie, »ich muß auch weg.«
»Ja«, sagte er.
Ihre Arme schlossen sich fester um seine Schultern, und er zog sie näher an sich. Er war hier, er würde fortgehen, und er würde sie mitnehmen.
Sie bat ihn, einen Augenblick zu warten, und als sie zurückkam, sagte sie, der Mann sei betrunken eingeschlafen. Dann brachte sie ihm eine Süßkartoffel aus der Asche des Lagerfeuers. Die Schale war verkohlt, aber als er sie abriß, war das orangefarbene Fruchtfleisch noch heiß.
Vom Hunger überwältigt, schlang er die Kartoffel sofort hinunter.
»Rühr dich nicht vom Fleck«, flüsterte sie und zeigte mit dem Finger auf ihn, als wollte sie ihn da festnageln, wo er stand. Als sie wieder auftauchte, hatte sie ihre ganze Habe in eine alte Reisetasche gepackt und trug außerdem ein kleines Bündel Kleider unter dem Arm. Sie legte alles auf dem Boden ab und hielt ihm dann eine Schere hin. Er nahm sie ihr aus der Hand, und sie beugte sich vor, raffte ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen und bat ihn, es abzuschneiden.
Die Schere war scharf. Er schnitt ihr den Haarschopf ab, und sie warf ihn weg. Dann bündelte sie das Haar erneut, und er schnitt es noch weiter ab. Jetzt richtete sie sich auf, und er ging um sie herum, schnitt ihr das Haar immer weiter ab, bis es ganz kurz war. Sie strich sich mit den Fingern über den Kopf und meinte, das würde fürs erste reichen.
Dann drehte sie ihm den Rücken zu, ließ die Decke fallen und schob sich das Unterhemd von den Schultern. Sie trug nichts darunter, und ihre weiße Haut schimmerte bläulich im Dunkel. Ihr Körper war zierlich und gelenkig, die Hüften schmal. Auf ihrem langen Rücken zeichneten sich die Knochen deutlich ab, die Schultern, die Rippen, die kaum wahrnehmbaren Konturen ihres Hinterteils, und zwischen den Beinen war eine Lücke, die davon zeugte, wie dünn und staksig sie geworden waren, und er dachte, wie viel mehr Glück er doch auf seinen Streifzügen nach Nahrung gehabt hatte. Doch ihre Bewegungen verrieten Stärke und Zielstrebigkeit.
Sie wollte so rasch wie möglich weg, sagte sie, und das würde sie jetzt auch tun.
Sie rollte das Bündel zu ihren Füßen auseinander, und zum Vorschein kamen eine Jungenhose, ein Leinenhemd und eine Baumwolljacke, ein breiter Ledergürtel, Socken und Schuhe und eine Feldmütze. Ehe sie die Kleider anzog, drehte sie sich um, stemmte die Hände in die Hüften und sah ihn an. In ihrer Haltung lag eine Verwegenheit, die ihm sagte, sieh ruhig her, wenn du willst. Es war, als forderte sie ihn mit ihrem Körper heraus, als stellte sie ihm unausgesprochen Fragen: Was wirst du mit mir tun? Wie wirst du zu mir sein?
Er antwortete ihr, indem er sich nicht rührte, aber auch nicht wegschaute. Dann blickte er nach Osten, wo bald die Sonne aufgehen würde, und dann hinüber zu seinem Pferd, das mit einem Huf scharrte, und dann sah er sie wieder an, als wollte er sagen, die Zeit drängt, beeil dich, wir müssen los.
Als er zum zweiten Mal in ihre Richtung sah, hatte sie sich gerade die Hose über die Hüfte gezogen und schnallte den Gürtel zu. Sie sagte, sie sei jetzt nicht mehr Rachel für ihn, sondern ein Junge wie er, zur Not auch sein Bruder. Sie sei jetzt Ray. Ihre Mutter habe sie immer so genannt, soweit sie sich erinnern könne. Dann zog sie auch das Hemd und die Jacke an.
Jetzt, wo sie die Entscheidung getroffen hatte und die Flucht bevorstand, konnte es ihr nicht schnell genug gehen. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu reden. Sie beschwor ihn, zu verstehen, wie wichtig das war, und er bedeutete ihr, daß er verstand.
Sie setzte sich auf den Boden, zog sich erst die Socken und dann die Schuhe an, und als sie sich gerade die Schnürsenkel zubinden wollte, hörten sie ein Rascheln im Stall und ein Stöhnen, und dann kam der Mann herausgestolpert. Er mußte sich so dringend erleichtern, daß er die beiden erst wahrnahm, als er die Hose schon aufgeknöpft hatte und der Urinstrahl auf dem Boden verdampfte.
»Keine Bange«, sagte er, als fände er die Situation belustigend.
Er erledigte sein Geschäft, schüttelte sich trocken und knöpfte die Hose wieder zu. Dann kam er auf das Mädchen zu, und als er ihr über das kurzgeschnittene Haar streichen wollte, schlug sie ihn auf die Hand und wich zurück.
»Was ist denn mit deinen Goldlöckchen passiert?« fragte er mit geheucheltem Interesse. »Du weißt doch, daß du nur einen Mann findest, wenn du gut aussiehst.«
Rachel war zur Salzsäule erstarrt, ihr fehlten die Worte. Auch Robey irritierten diese süßliche Stimme, die gekünstelten Gesten. Der Mann wuchs zu einer Gestalt heran, die seine körperliche Größe bei weitem übertraf. Er trat auf, als könnte er über andere Menschen verfügen, als müßten alle anderen sich ihm freiwillig unterordnen. Irgendwo krähte ein Hahn, und das Licht veränderte sich, als wäre ein erster Vorhang vor dem neuen Tag aufgezogen worden.
»Wir müssen gehen«, sagte Robey und hatte den Revolver schon aus dem Gürtel gezogen. Er richtete die Waffe nicht auf den Mann, aber der Winkel, in dem er sie hielt, signalisierte seine Entschlossenheit, sie auch zu gebrauchen.
»Wer zum Teufel bist du?«
»Geht Sie nichts an«, gab er zurück. Er hätte dem Mann gern gesagt, wer er war und was er gesehen hatte, was er durchlitten und verloren hatte, aber es gab keinen Grund, warum der oder irgend jemand anders ihn kennen sollte.
»Und du gehst mit?« sagte der Mann zu ihr, und seine Stimme verriet, wie unfaßbar dieser Gedanke für ihn war.
»Wir gehen«, sagte Robev.
»Ich werde sie finden«, sagte er, »das weißt du.«
»Das Land ist groß.«
»Nicht groß genug.«
»Kann sein.«
»Dann nimm das Pferd«, sagte der Mann zu ihr, als hätte ihn plötzlich Großmut übermannt.
»Ich will dein verdammtes Pferd nicht«, zischte sie zurück.
»Das ist nicht christlich«, sagte der Mann.
»Halt deinen verdammten Mund, du alte Pestbeule.«
Sie drückte sich die Hände auf die Ohren. Sie haßte ihn, wollte nicht hören, was er ihr sagte. »Du hast dich gegen mich versündigt«, schrie sie.
»Rachel«, schmeichelte er mit honigsüßer Stimme.
»Er hat Geld gestohlen und in seinem Gürtel versteckt«, sagte sie mit geschlossenen Augen, die Hände noch immer auf den Ohren. »Nimm’s ihm ab.«
»Wo ist es denn?« fragte Robey.
»Stell dich nicht so an«, antwortete sie. »Um den Bauch natürlich.«
»Ich werde dich finden«, sagte der Mann. »Du weißt, daß ich dich finden werde.«
»Halt dein Maul«, rief sie, und da wurde er mit einem Mal böse, denn ihm war klargeworden, daß seine Macht über sie schwand.
»Du wirst diesen Tag dein Leben lang bereuen«, sagte er. »Wenn ich dich finde, wird es dir leid tun, daß du mich so behandelt hast.«
»Und was hast du mir angetan?« gab sie zurück. »Womit habe ich das verdient? Du wirst dafür in der Hölle schmoren, nicht ich.«
Plötzlich ließ sich der Mann mit einer geübten Bewegung auf die Knie fallen. Er schloß die Augen und drückte die gefalteten Hände an die Brust, und seine geschürzten Lippen begannen zu pulsieren, als wäre sein stilles Gebet so aufwühlend, daß es ein Ventil nach außen brauchte. Dieser dramatische Auftritt ließ sie in ihrer Wut innehalten.
»Bitte vergib mir«, sagte er, und dann betete er laut, und es klang routiniert und leidenschaftlich, Gebete von den Sünden des Menschen und den Schwächen des Fleisches.
Sie sagte, er solle aufhören, er solle bitte aufhören auf sie einzureden, aber in dem Bemühen, den Bann über sie zu behalten, ereiferte er sich immer mehr.
»Hör auf«, schrie sie und trat nach ihm. »Der Teufel soll dich holen«, schrie sie, »ich hasse dich.«
Robey schaute dem Kampf zu, zwischen dem weinenden Mädchen, das zu entkommen suchte, und dem grausamen betenden Mann, der sie geschändet hatte. Er wußte, diese Szene hatte sich schon häufiger abgespielt, in Zelten, in Hütten, unter Baumkronen. Er ahnte die Vergangenheit, erkannte die Macht und die Verfluchungen des Mannes. Er spürte, wie sie das Mädchen zermürbten und dazu brachten, sich gegen sich selbst zu wenden, gegen die eigenen Wünsche, und zu vergessen, was er ihr angetan hatte.
Sie stampfte auf und schrie, er solle seinen betenden Mund halten und sich am besten umbringen wegen allem, was er angerichtet hatte in seinem Leben. Seine Worte flössen unbeirrt weiter, brachten sie zur Raserei. Er hörte einfach nicht auf, da konnte sie noch so viel schreien. Aus dem Stall ertönte Stöhnen. Die blinde Frau war aufgewacht und rief nach Hilfe.
»Sorg dafür, daß er endlich das Maul hält«, sagte Rachel zu Robey. »Mach ein Ende mit ihm.«
Sie griff nach dem Revolver in seiner Hand, aber er gab ihn nicht her. Er hatte dagestanden und zugesehen, wie der Mann sie schändete, und er hatte nichts getan, als er etwas hätte tun können. Nicht, daß er sich jetzt schuldig fühlte, weil er damals in dem ausgebrannten Haus nichts getan hatte. Damals war er noch anders gewesen. Damals war er noch ein Kind gewesen und hatte gedacht wie ein Kind. Er hatte Wut empfunden und Haß, aber er hatte gedacht, die Welt hätte eine Chance. Er hatte gedacht, alle hätten eine Chance. Irgendwo tief in seinem Innern ahnte er vielleicht bereits sein Schicksal, doch in jener Nacht in dem ausgebrannten Haus war die Zeit für ihn noch nicht reif gewesen, um die Vergangenheit zu verlassen und die Zukunft zu betreten, denn nur die Verdammten sehen ihre Zukunft und wissen nichts von ihrer Gegenwart.
Egal. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Was bedeutete ein anderer Mensch wie dieser hier für ihn? Der betende Mann wollte, daß sie ihm vergab. Aber manchmal muß man erst Rache nehmen, ehe man vergeben kann. Er hörte das vertraute, entschlossene Klicken an seinem Oberschenkel, als er den Hahn des Revolvers spannte.
Falls der betende Mann das Geräusch auch gehört hatte, verriet ihn seine Stimme jedenfalls nicht.
Er hob die Hand, richtete den Lauf auf die Stirn des Betenden und wollte gerade abdrücken, als das Mädchen dazwischentrat. Mit beiden Händen wuchtete sie ein langstieliges Gerät über ihre rechte Schulter und ließ es dann nach unten sausen, rammte dem Mann die drei dünnen Zinken der Mistgabel mit aller Kraft in den Unterleib.
Die Zinken drangen wie Vampirzähne in den Körper des Knienden ein, ein scharfes, gebogenes Blitzen, dem sich kein Knochen entgegenstellte. Sein Gebet verstummte, und er weitete vor brennendem Schmerz die Augen. Das Mädchen sprang hoch und drückte die Gabel mit ihrem Gewicht noch tiefer hinein, und dieser zweite Stoß ließ ihn den Schock überwinden und einen gellenden Schrei zum Himmel schicken.
Robey ließ den Hahn zurückschnappen, steckte den Revolver in den Gürtel, packte Rachel an den Schultern und zog sie zurück. Sie wehrte sich, wollte ein drittes Mal auf die Gabel springen, sie noch tiefer in den Schoß des Mannes bohren.
So viel Töten, so viel Gewalt. So viel Arglist und Täuschung. Er sah das alles. Er sah das Mädchen und den betenden Mann, und er sah sich selbst. Wie läßt sich erklären, daß Gewalt Gewalt auslöst? Ist das schon die Erklärung? Gewalt fordert Gewalt heraus. Das hier war keine vorchristliche Wiedergutmachung: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hier war das Gesetz, bevor das Gesetz geschrieben wurde. Das hier war Rache und Rebellion gegen das Gesetz. Wie läßt sich erklären, daß man das nicht verstehen kann, daß man nicht verstehen kann, daß es Dinge gibt, die nicht zu verstehen sind?
Letztlich gab es keine Antworten, das wußte er. Es gab keine Erleuchtung. Die Welt war Zufall, sie wurde uns nicht offenbart, sondern sie offenbarte uns unsere eigenen Gedankensplitter und unsere falsche Erinnerung und so uns selbst. Es gab weder Erkenntnis noch Weisheit. Wir haben nur etwas mehr gesehen, unser Unwissen ein wenig verringert. Die Sünde ließ sich nicht wegwaschen, und der Verstand heilt nicht, außer bei den Schuldigen und den Törichten. Unsere Bekenntnisse werden zu unserer Schwäche, unsere Weisheit zu unserer Eitelkeit, und beides zusammen zu unseren bösen Phantasien. Er schaute auf den betenden Mann und wußte nun eines: Wir haben uns selbst zu Auserwählten erwählt.
Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters, und er vergegenwärtigte sich das Mädchen, wie sie sich aus seinem Griff zu befreien versuchte, um noch einmal an die Mistgabel zu kommen. Er fürchtete, sie würde nie mehr zurückkehren von dort, wo sie sich jetzt befand. Er hatte gedacht, daß sie vielleicht eine andere Sicht der Welt hatte als er, der überhaupt keine mehr hatte, jedenfalls nicht daß er wüßte, und vielleicht würde sie auch einen Weg zurück für ihn bedeuten, aber das wußte er jetzt auch nicht mehr. Er wußte im Moment nur: Er konnte nicht zulassen, daß sie diesen Mann noch mehr tötete, als sie es schon getan hatte. Als er sie festhielt, hielt er das Leben in seinen Händen, sein eigenes Leben.
Er sah hinab auf den Mann, der immer noch aussah, als würde er mit flehend erhobenen Händen beten, den Mund weit offen und Tränen auf dem verzerrten Gesicht.
Um den überraschenden Schmerz zu bekämpfen, der in ihm brannte, war er bemüht, sich nicht zu bewegen, doch sein Körper konnte die Qual nicht ertragen und wollte die Ursache abschütteln, und der Griff der Mistgabel zitterte in der Luft, als er versuchte, den Fremdkörper abzustoßen.
Robey zog das Mädchen von dem Mann weg, hinüber zu seinem Pferd. Er nahm ihren Fuß, schob ihn in den Steigbügel und hob sie mit beiden Händen in den Sattel. Dann ging er los, und der Hengst folgte ihm.
SIE RITTEN AUF DEM GLANZRAPPEN nach Süden, ließen diesen Ort der Toten hinter sich. Sie hatte die Arme um seine Hüfte geschlungen, und er spürte ihren Körper an seinem Rücken. Als jemand sie verfolgte, klopfte sie mit den Fingerknöcheln an seinen Kopf, und er drehte das Ohr zu ihren Lippen hin. Sie sagte, er solle in den Nebel hineinreiten, doch der Hengst wußte selbst, was zu tun war, und verschwand bereits in einer riesigen grauen Wolke, die sich auf die Erde herabgesenkt hatte.
Auf diesem Ritt zum Fluß war alle Zeit Gegenwart. Es gab keine Vergangenheit, und es gab keine Zukunft. Sie waren auf der Flucht und trieben den pechschwarzen Hengst voran wie fliehendes Rotwild. Gleich würden sie vom Boden abheben und am Horizont entlangreiten, dachte er. Vielleicht würden sie für immer weiterreiten, bis alles hinter ihnen lag, bis alles vorbei war.
Woran er sich noch erinnerte, war die Stille, die herrschte, als sie aufgebrochen waren, diese absolute Stille. Er spürte, der Krieg hatte diese Männer, die Blut darboten und Blut vergossen, nicht vernichtet, er hatte sie mit all seinem Schmutz und dem Schwarzpulver lediglich vorbereitet auf ihren unwiderruflichen, unwiederbringlichen Tod. Die Wunden waren schrecklich, wenn auch unterschiedlich. Manche Männer hatten noch ihr Gesicht, andere nur noch einen Teil oder ganz wenig davon, und am Ende waren da Männer ganz ohne Gesicht, und er fand es erstaunlich, wie wenig man einem Menschen noch antun kann, wenn ihm alles, was man ihm antun kann, schon angetan wurde.
Er hatte den Schrecken erlebt, der einen ruhig und furchtlos werden läßt, aber bei Rachel war etwas im Innersten zerbrochen, und er wußte nicht, ob es je wieder heilen würde. Über ihr Leben, über ihren Schrecken wußte er nichts.
Als sie davonritten, dämmerte rosig und grün der Morgen, und die Sonne ging auf wie ein rotglühender Ball. Kein Windhauch regte sich in der Wärme des Morgens, und als ob das noch nicht genug wäre, sahen sie Frauen und Kinder, die über toten Pferden Holz auftürmten und diese Scheiterhaufen in Brand setzten.
Die Tiere waren hier zusammengebrochen, ihre schweren Körper, die eleganten Nacken, die wohlgeformten Köpfe und die gewölbten Brustkörbe lagen auf dem Boden. Meile für Meile lagen tote Pferde herum, und manchmal war der Boden schwarz von Talg, wo schon ein Tier verbrannt worden war. Er erinnerte sich auch an die beiden Frauen, die in der offenen Tür gesessen hatten und Wasser verkauften und lachten, als wäre nichts geschehen, und er dachte, wie seltsam die Welt geworden ist! Er konnte es nicht verstehen, hätte es nicht einmal erzählen können, wenn ihn jemand danach gefragt hätte.
Tage später und viele Meilen weiter südlich verlor die vom Regen rein gewaschene Luft allmählich den Todesgeruch, und sie erreichten das Ufer des Potomac, wo sie sich unter die Soldaten mischten. Dicht hinter ihnen rückten die Unionstruppen an, tauchten vor den Wachposten in den Feldern und Wäldern auf, als wären sie gerade hinter ihnen beiden her. Die Befestigungsarbeiten waren bereits im Gang, und die Pioniere hatten die Pontonbrücke zur Überquerung des Flusses fast fertiggestellt. Es war, als hätte sich ein verlorenes Volk an den trostlosen Ufern eines alten Flusses versammelt. Er fand Moxley und Yandell und auch Tom Allen. Sie waren bei der Batterie, von der sein Vater gesprochen hatte. Er sagte ihnen, daß er Robey Childs war, und sie erzählten ihm, daß sein Vater treu wie Gold gewesen war, und wann immer er gebraucht wurde, war er auf der Stelle da. Er sei der tapferste Mann gewesen, den sie je gekannt hatten.
Danach nannten sie ihn Captain, so wie sie den Vater genannt hatten, und in dieser Nacht schickte er einen Brief an seine Mutter, aber er brachte es nicht fertig, ihr von allem zu berichten, was er erlebt hatte.
Was Rachel betraf, sagte in der Batterie keiner ein Wort. Den Männern war nicht klar, was den Sohn ihres gefallenen Kameraden mit diesem Mädchen verband, das mit ihm ritt und sich als Junge ausgab, aber sie erlaubten sich kein Urteil und sprachen auch untereinander nicht darüber.
Hinter Gettysburg hatte es wieder heftig zu regnen begonnen, und grollender Donner erschütterte das Dunkel der Nacht. Eine Sintflut kam vom Himmel, und die grellen Blitze ließen alle für einen Moment erblinden. Sie saßen im strömenden Regen, der ihnen aus den Ärmelaufschlägen rann, und warteten darauf, endlich den Fluß überqueren zu können.
Schließlich kamen die nassen und Sternenlosen Nächte des 13. und 14. Juli, und da beschlossen sie, über die Pontonbrücke zu fliehen. Die Vorräte waren fast vollständig aufgebraucht. Vor lauter Hunger suchten die Männer schon im Pferdedung nach Maiskörnern.
Sie schützten die rauchigen Feuer aus bemoosten, knackenden Kiefernscheiten mit Zeltplanen, damit sie nicht ausgingen und den Eindruck erweckten, es wären noch Soldaten da, die sie schürten. Die größten Männer hatten den ganzen Tag über mit ineinander verhakten Armen eine Kette von Ufer zu Ufer gebildet, damit andere auf ihren Schultern hinübergelangen konnten. Dann hieß es, der Wasserpegel würde beständig fallen, und die schmale Pontonbrücke sei fertig.
In einer diesigen, regnerischen Nacht wurden Fackeln angezündet und Holzzäune verfeuert, um den Weg hinüber ans andere Ufer zu beleuchten. Robey und Rachel warteten im Kies am Flußufer und sahen zu, wie das Wasser hochschwappte und die Wellen sich kräuselten. Als sich das Wasser wieder zurückzog, führten sie den pechschwarzen Hengst auf die Brücke, schnitten die Vertäuung los und ließen sich durch den Sprühregen, der im Wasser kleine Kelche aufblühen ließ, hinüber nach Virginia treiben.
16 EIN SANFTER SCHATTEN
senkte sich auf sie herab wie eine lange schwarze Haarsträhne, von der Schulter bis zur sanften Wölbung ihres Bauches. Die Sonne schien von einem makellosen blaugrünen Himmel, schickte ihre Strahlen auf ihrem Weg von Ost nach West durch die Fensterscheiben herein.
Robey schlief, auf einem Stuhl sitzend, neben ihr, die Hände auf den Knien. Zu seinen Füßen auf dem Boden hatte er ein geladenes Springfield-Gewehr gelegt, daneben den Revolver. Rachel glaubte, sie hätte geträumt, vor Schreck fuhr sie hoch, konnte ihre Träume nicht von ihren Gedanken unterscheiden.
Sie ritten nachts und schliefen tagsüber, und mit Eintritt der Dunkelheit machten sie sich wieder auf den verschlungenen Weg nach Hause. Nach Hause. Die Dunkelheit bringt die Stille, in der sich die Jäger auf den Weg machen. Für Robey und Rachel brachte die Dunkelheit die Gelegenheit zur Flucht.
»Würdest du hier leben wollen?« fragte sie und drehte ihm langsam den Kopf zu.
»Nein«, gab er zurück, wie ein Schlafredner, der nicht aufwachte. »Hier wollte ich nicht leben.«
»Wo wolltest du denn leben?«
»Da, wo ich herkomme.«
»Es ist zu hell draußen«, sagte sie. »Können wir nicht nachts schlafen?«
Er hatte ihr schon oft erklärt, daß das nicht ging. Sie mußten am Tag schlafen und in der Nacht reiten, damit niemand sie sah. Sie zog sich die Decke über die Schultern und bewegte darunter die Arme, wirkte wie ein seltsamer Vogel, der mit den Flügeln flatterte, aber in diesem windstillen, luftleeren Raum nicht fliegen konnte.
»Es ist nicht sicher«, sagte er und streckte die Beine aus, knallte mit einem Stiefelabsatz auf den Boden. Es war schon Spätnachmittag, und jetzt, wo er wach war, würde er nicht mehr schlafen können, bis die Zeit zum Aufbruch kam.
»Ich hab geträumt, daß wir beieinander schlafen«, sagte sie.
Ihre Stimme klang nüchtern, und zuerst dachte er, sie meinte ihn, in ihrem Traum, zusammen mit ihr. Aber das konnte er nicht glauben, und er überlegte, von welchem Schlafgenossen sie ihm dann erzählte. Sie schleppte ihre Vergangenheit mit sich und konnte ihr nicht entfliehen, erst recht nicht in ihren Träumen. Sie wälzte sich hin und her und schrie im Schlaf auf. Sie bestand darauf, immer ein Messer neben sich zu haben, und er mußte dafür sorgen, daß die Klinge stets scharf war. Es war in ihr, drückte von innen gegen die Rippen und pulsierte in den Lungen, wie Flügel, die vor Schreck hektisch herumflatterten.
»Schlaf noch ein bißchen«, sagte er. Immer wieder sagte er ihr das, und langsam verstand er, daß sein Ratschlag, so gut er ihn auch meinte, sie ihrem Schrecken nur näher brachte.
»Was glaubst du, wo sie hingegangen ist?«
»Ich weiß nicht«, antwortete er, setzte sich auf und sah sich im Raum um, als wäre da noch eine dritte Person.
In dem Haus, wo sie Station machten, wohnte eine zerlumpte alte Frau mit einem sonnenverbrannten, durch einen Schlaganfall verzerrten Gesicht. Ihr eines Auge war blutunterlaufen und das andere weiß und rund wie eine Elfenbeinmurmel. Sie hatte ihnen ihr Haus geöffnet und mit einer Handmühle Mehl gemahlen und daraus Teigbälle geformt, so groß wie ihre knorrige Faust. Sie hatte ihnen Kartoffeln und Speck gebraten und ein Säckchen Proviant vorbereitet für ihren weiteren Weg. Sie ging im Haus umher, wie ein verirrter Geist, verbrannte sich mehrmals beim Kochen und brauchte ziemlich lange, bis sie es merkte. Da sie sich selbst nicht wirklich heimisch zu fühlen schien, fragten die beiden sie, ob es ihr Haus war, konnten es aber nicht in Erfahrung bringen.
Was sie herausfanden, war, daß ihre Ohren nicht besonders gut funktionierten und sie nicht auf beiden Ohren gleichzeitig hören konnte. Sie erfuhren auch, daß sie monatelang keine Menschenseele mehr gesehen hatte, nicht mal einen streunenden Hund, und daß sie einen Sohn namens Horace hatte, einen wunderbaren jungen Mann, der im Krieg umgekommen war. Von welcher Seite er getötet wurde, wußte sie nicht, es war auch egal. Sie sagte, es habe ihr das Herz gebrochen. Das wisse sie genau, sagte sie, aber sie brauche nichts als Liebe und Gebete im Leben. Sie sei eine treue Jüngerin Gottes, ganz egal, was er ihr angetan habe. Als sie das sagte, war ein Glanz um sie, sie strahlte förmlich.
»Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, wo sie ist«, sagte Rachel. »Meinst du, sie geistert noch herum? Sie macht mir richtig angst.«
»Versuch zu zählen«, empfahl er ihr. Er rieb sich die Wangen, als wollte er seine Gesichtszüge neu gestalten. Er wollte sie beruhigen, aber sie hatte um sich eine Mauer aus Wachsamkeit und Mißtrauen errichtet, hinter der sie nicht hervorkam. Seit sie ihn getröstet hatte nach dem Tod seines Vaters, war sie nicht mehr nett zu ihm gewesen.
»Eins, zwei, drei«, sagte sie, »es funktioniert nicht.«
Da sagte er ihr, daß er sie liebte.
»Warum?« fragte sie.
»Einfach so.«
Sie hob die Arme unter der Decke und schaute ihn an. Die Spitze ihres Messers drückte gegen den Stoff.
»Sei nicht so ein Dummkopf«, schimpfte sie.
Sie legte sich wieder zurück auf die Liege in diesem seltsamen Raum und zog die Decke hoch ans Kinn. Sie drehte sich von ihm weg und tat, als wäre sie eingeschlafen. Sie war erschöpft von der Last, die sie stets mit sich schleppte, und verstand nicht, warum sie nicht schlafen konnte und warum er sagte, daß er sie liebte.
»Ich lieb dich – fast«, sagte sie sanft und wollte weitersprechen, war aber schockiert von den eigenen Worten und schüttelte heftig den Kopf – nein, das hatte sie nicht sagen wollen. Sie schien sich ihres Mißtrauens zu schämen, oder ihrer Unfähigkeit, er konnte es nicht einschätzen. Sie war ihm mit der Zeit immer rätselhafter geworden. Er fragte sich, ob die Schuld, die er bezahlte, jemals ganz beglichen werden konnte und ob sie es überhaupt so sah, ob sie wußte, wie er darüber dachte.
»Wie lange noch?« fragte sie.
»Noch ein paar Tage«, sagte er leise. »Ruh dich noch ein bißchen aus, und dann machen wir uns wieder auf den Weg.«
Sie hatten sich nicht lange bei den Soldaten am Ufer des Potomac aufgehalten. Er besorgte ihr eine braune Stute, hart im Maul, eines der wenigen Pferde, die der Glanzrappe neben sich duldete, und nahm Proviant, Munition und das Gewehr mit. Die Versorgungslage der Armee war noch immer prekär, als er die Männer aus der Batterie seines Vaters fragte, wie weit es nach Hause sei und wie lange er brauchen werde. Zwei Tage, sagten sie, wenn er die Pferde zuschanden ritte und nicht schliefe, sonst fünf Tage. Er sollte sich auf Meilen Luftlinie einstellen, nur in der Nacht reiten und die Pferde jeden Tag sorgfältig striegeln.
Verkriech dich am Tag, hatten sie ihm zugeredet, leg dich hin, wenn die Sonne aufgeht, und wenn du fast da bist und nur noch fünf Meilen fehlen, dann schlitz den Pferden die Schultern auf, richtig tief, und schütte Schwarzpulver in die offenen Wunden. Jawohl, sagten sie, genauso würden sie es machen, wenn sie es eilig hätten, nach Hause zu kommen. Aber andererseits, diesen Glanzrappen zu Tode zu schinden, nur um nach Hause zu kommen, das war es nicht wert, denn wer zum Teufel brauchte ein Zuhause, wenn er einen solchen Hengst hatte?
Sie waren pausenlos geritten in den letzten Nächten, und in ihrer Vorstellung schien es, als wäre die ganze Welt hinter ihnen her. Sie schliefen unter Felsvorsprüngen und in hohlen Baumstämmen, und wenn sein Instinkt es ihm sagte, suchten sie sich einen neuen Unterschlupf, und im Morgengrauen machten sie wieder halt. Auf den Landstraßen wimmelte es von regulären Truppen und von Partisanen und Banditen. Hier gab es Gewinne einzustreichen und alte Rechnungen zu begleichen. Er hatte aus erster Hand erfahren, daß auch das Krieg war, eine Art von Krieg im Krieg. Das hier war genauso ein Teil des Krieges wie der Krieg selbst, und im Krieg wird man umgebracht, allein deshalb, weil man noch am Leben ist.
Der kürzeste Weg war in Richtung Westsüdwest, aber die Route verlief entgegen der natürlichen Richtung der Flüsse und Gebirgszüge. Sie überquerten Bäche und Flüsse, wateten durch tiefen Morast, bis er schließlich die grüne Anhöhe der Alleghenies erkannte, auf die sie hinaufsteigen mußten. Mit ihren sanften Ausläufern und den Felsklüften, durch die der Wind pfiff, wirkten sie wie ein riesiges, schlafendes Ungeheuer, das die Beine unter den Rumpf gezogen und die Vorderpfoten nach vorn gestreckt hat.
»Noch zwei, drei Tage«, sagte er.
»Nächte, meinst du wohl.«
»Ja, Nächte«, stimmte er zu.
Er war besorgt, ob sie durchhalten würde. Sie war so bitter geworden, war ihrer Bruchstelle so nahe gekommen. Es schien, als hätte sie überhaupt nicht mehr geschlafen, seit er mit ihr zusammen war. Sie klammerte sich an ihre Furcht, kam nicht von ihr los, sosehr sie sich auch bemühte, ihre Gedanken in eine andere Richtung zu lenken.
Sie fing an zu zittern, setzte sich auf und ließ zuerst die Decke und dann ihr schmutziges Nachthemd von den Schultern gleiten.
»Leg dich auf mich«, sagte sie und ließ das Messer zu Boden fallen. Dann legte sie sich auf den Rücken und öffnete die Arme, zeigte ihm ihren nackten Körper. Doch er rührte sich nicht vom Fleck.
Sie wiederholte, daß er kommen solle, sagte ihm, was er tun sollte, und als er sich immer noch nicht rührte, sagte sie, wenn er sie heiraten wollte, müßte er schon ein hißchen netter zu ihr sein.
Mit ungeschickten Bewegungen setzte er sich neben sie auf die Liege und beugte sich vor, ließ sich zu ihr hinabsinken, bis sie ihn mit den Armen umfing und ihn in einem Durcheinander von Armen und Decke und Nachthemd fest an sich zog.
»Beweg dich nicht«, sagte sie und preßte ihn an ihren bebenden Körper.
Er drückte das Gesicht an sie und sog den Geruch von Leder und Schweiß und Pferd und Holzfeuer ein, den sie teilten. Er wollte sein Gesicht an ihrer Haut ruhen lassen, es nie mehr wegnehmen. Er spürte, wie etwas aus seinem Innern gezogen wurde und sich ihr entgegenstreckte. Er wollte Worte finden, um ihr das zu sagen, aber er war sich seiner Gefühle nicht klar, und das würde noch lange so bleiben.
»Du bist nicht der Schlechteste«, sagte sie mit zärtlicher Resignation und zog ihn noch fester an sich. Sie strich ihm über den Rücken und küßte ihn auf die Wange und den Hals.
Als sie aufwachten, war von der alten Frau immer noch nichts zu sehen. Sie sprachen zunächst gar nicht von ihr, und je länger sie darauf warteten, daß der andere etwas dazu sagte, desto unwahrscheinlicher erschien es ihnen, daß sie überhaupt existierte. Er trat hinaus auf den Hof, das Gewehr in der Armbeuge, und ließ den Blick über den Horizont gleiten. Bald würde es dunkel werden. Im Westen, wo die sinkende Sonne die Erde in Brand setzte, wurde der Horizont von Sonnenfeuern erleuchtet.
Er lief im Hof umher, und noch immer kein Zeichen von der alten Frau. Dann fiel sein Blick durch das Verandageländer auf einen struppigen tiefhängenden Ast, der sich nach oben bog. Zuerst dachte er, es wäre das winzige Gesicht eines Kindes, das ihn aus den Büschen anstarrte, oder das Gesicht eines Waldkobolds, den er auf frischer Tat ertappt hatte.
Er ging auf die Veranda, legte den Kopf schräg und dann erkannte er, was es war: ein Büschel vertrockneter Nadeln, ohne jede Ähnlichkeit mit dem Gesicht eines Kindes oder eines Waldkobolds. Er bewegte den Kopf und versuchte erneut, mit den Augen einzufangen, was er gesehen hatte, und dann war es wieder da.
»Ich seh dich«, sagte er.
Er spielte dieses Spiel so lange, bis er das Gesicht wiederfand, und dann ging er zu den Pferden, um sie zu zäumen und zu satteln. Als er ins Haus zurückkam, stand Rachel am Vorratsschrank. Sie leckte an ihrem Zeigefinger, tauchte ihn in den Zucker und lutschte die süßen Kristalle ab. Er sah ihr zu, und als sie ihn bemerkte, bedeutete er ihr weiterzumachen, bis sie genug hatte.
»Das Essen ist fertig«, sagte sie dann und zeigte auf den Herd, wo Kartoffeln und Speck warteten. Er war hungrig, und da er kein Besteck sah, nahm er den Teller in die Hand und aß die heiße Mahlzeit mit den Fingern.
Als es dunkel geworden war, stiegen sie wieder auf die Pferde und ritten in die tintenschwarze Nacht, und als sie anhielten, um den Pferden eine Pause zu gönnen, sagte sie, jetzt fühle sie sich schon etwas besser, aber noch lange nicht so gut, wie sie es gern hätte.
»Ich hatte gehofft, daß es schneller geht«, sagte sie, »aber nein.«
Er wollte antworten, fand aber keine Worte. Er wollte ihr sagen, es sei nur eine Frage der Zeit, aber wußte er denn, ob das stimmte? Er trug an seinem eigenen Kummer und Haß, hielt sich daran fest und bezog daraus Kraft. Er wollte nicht vergessen, niemals. Wie konnte er ihr dann raten, ihre eigene Bürde abzuwerfen? Er begann zu gestikulieren, als ließen sich die Worte so leichter finden, doch schließlich gab er auf und seine Hände sanken in den Schoß.
Sie wartete ab, ob das alles war, und dann lachte sie ihn aus.
Er kramte eine Dose Kondensmilch hervor und öffnete sie mit der Spitze ihres Messers. Sie hockten sich in eine kleine Felsnische, in der sich eine Quelle befand, und teilten sich die Ration, während sich die Pferde unter einer Baumgruppe ausruhten. Er ließ den Blick über das Schattenmuster gleiten, das vom Licht der Sterne herrührte, und überlegte, wie weit sie heute nacht noch kommen würden, wägte die Vorteile einer weiteren Meile gegenüber der Anstrengung ab, die es für sie und für die Pferde bedeuten würde. Die Stute würde nicht mehr lange durchhalten, andererseits war es nicht mehr weit. Er kannte zwar diese Stelle nicht, wohl aber die Gegend, und er wußte, welchen Weg sie einschlagen mußten.
»Die Sterne sind näher gekommen«, sagte er und kauerte sich neben sie. Er harte seinen Entschluß gefaßt. Sie würden den Großteil der Nacht hier verbringen und vor Tagesanbruch ein Stück weiterreiten.
»Meinst du, sie war überhaupt da?«
Sie schien an die alte Frau zu denken, bei der sie den Tag verbracht hatten.
»Ich weiß nicht«, sagte er, »ich denke schon.« »Ist wohl auch egal«, meinte sie.
Plötzlich änderte er seinen Entschluß, und sie stiegen noch einmal in den Sattel. Er mußte nach Hause. Er mußte zurück zu seiner Mutter, mußte wissen, wie es ihr ging.
AM FRÜHEN MORGEN sahen sie, wie Truthahngeier im Aufwind segelten, majestätisch in der Luft schwebten, wie sie sich langsam in die Höhe schraubten und dann wieder fallen ließen. In den Kiefern hing noch der kalte Rauch von verbranntem Holz, einem langsam dahinsterbenden Herdfeuer. Er entdeckte eine alte Frau mit Schal und einem Regenschirm. Neben ihr stützte sich ein alter Mann auf seinen Gehstock. Die beiden standen auf einem Hügel und betrachteten den Sonnenaufgang, dann gingen sie weiter und verschwanden hinter der Kuppe. Ihm erschienen sie als zwei brave, freundliche Menschen, die ins Taumeln geraten waren, gebeutelt von der Spirale der Geschehnisse, die, einmal in Bewegung gesetzt, ihre ganz eigene schreckliche Kraft entwickelte.
Als sie an dem Ort ankamen, wirkte er, als hätte man ihn nun endgültig verlassen. Unwillkürlich fiel ihm die Geschichte ein, die ihm der Vater einmal erzählt hatte, von einem Athleten aus der Antike, der mit einem Bullenkalb auf den Schultern einen Berg hinauflief. Jeden Morgen F tat er das, in dem Glauben, wenn das Kalb wuchs, würde auch er mehr Kraft aufbauen und noch stärker werden.
Der Vater hatte gesagt, das sei ein Ding der Unmöglichkeit, aber der Gedanke gehe ihm nicht aus dem Kopf. Vielleicht seien Bullenkälber früher auch nicht so schnell gewachsen wie heute. Egal. Der Vater sagte, er habe den Gedanken an diesen Mann nicht mehr loswerden können, und trotz allem, was er über die Aufzucht von Kälbern wisse, frage er sich gelegentlich immer noch, warum es einfach nicht funktionieren konnte.
Mal abgesehen von den offensichtlichen Gründen, hatte sein Vater gesagt, warum eigentlich nicht? Ein Gedanke, um den das ganze Denken kreisen konnte. Vielleicht waren alle Menschen so. Vielleicht kämpften sie guten Willens für eine schlechte Idee, kämpften und kämpften, bis sie die Unmöglichkeit ihres Vorgehens einsehen mußten.
An der Tür der Hütte hing ein riesiges Vorhängeschloß, wie für ein Waffenlager, aber dieses hier schien nicht aus Gründen der Sicherheit angebracht worden zu sein, sondern eher als Bestrafung für ein schweres Vergehen. Auch die Fensterläden waren fest vernagelt, aber der kleine Küchengarten schien erst vor kurzem gejätet worden zu sein, und dort, wo einst jemand breite Beete angelegt hatte, wiegten sich noch immer bunte Blumen über dem nachwachsenden Unkraut. Wildrosen rankten an den Holzwänden empor. In ein Regenfaß flöß über eine Holzrinne bernsteinfarbenes Wasser. Alles wirkte so ordentlich, als würden die beiden Alten in ein, zwei Tagen zurückkommen.
Er rief laut, aber wie zu erwarten, erhielt er keine Antwort. Einzig die Pferde hörte man, die den Steinklee rupften und kauten, und das leise Plätschern des Wassers, das aus der Holzrinne flöß.
Der Pferch war leer und mit Disteln überwuchert, der Boden hatte sich gesetzt und war ausgetrocknet. In diesem Jahr gab es keine Schweine, und Rankgewächse hatten die abgeschabten Balken überwuchert. Orangefarbene trompetenförmige Blütenkelche hingen schlaff an grünen Stengeln.
Sie gingen zur Scheune, um nachzusehen, ob dort vielleicht jemand war. Im Innern der Holzbaracke roch es nach Schimmel und Lehm, gärendem Dung und Heu. Aus einer Ecke schlug ihnen der Gestank ungepflanzter Saatkartoffeln entgegen.
Hinter der Scheune sahen sie, wofür sich die kreisenden Geier interessierten. Da lagen im zertrampelten Gras eine junge Stute und ein neugeborenes Fohlen nebeneinander, als wären beide bei der Geburt gestorben. Die Stute hatte zusammen mit der Nachgeburt die Gebärmutter herausgepreßt, und das geschrumpfte, birnenförmige Organ lag schwarz verfärbt neben ihren Sprunggelenken, zwischen Wicken und Rutenhirse. Die Hufe des neugeborenen Fohlens waren aufgerieben und brüchig und mit einem Rand von weichem Hörn umgeben, woraus Robey schloß, daß es eine Frühgeburt war.
»Das war ein wunderschönes Pferd«, sagte er und deutete auf die Stute.
»Meinst du, sie sind woanders hingegangen?« fragte Rachel mit erstickter Stimme ob der grausigen Szene, die sich ihnen hier bot.
»Ja, gerade eben«, gab er zurück und erzählte ihr, daß er sie durchs Fernglas hatte weggehen sehen. Er dachte, der Tod einer Stute wie dieser reicht aus, um einem erschöpften Geist den Rest zu geben.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als sie sich mit dem Wasser aus dem Regenfaß wuschen und Speck zusammen mit den Zwiebeln anbrieten, die sie im Garten gefunden hatten. Auch Karotten und Tomaten gab es da.
Nachdem sie gegessen hatten, zog Rachel sich aus, wusch ihre Kleider im Regenfaß und beschloß dann, ganz hineinzusteigen und ein Bad zu nehmen. Sie gab ihm kein Zeichen, daß er wegschauen sollte, und als sie ins Wasser eintauchte, fand sie einen Moment friedlicher Ruhe. Sie lenkte das Wasser aus der Holzrinne auf ihr Haar, spritzte nach ihm und sagte, er solle auch ein Bad nehmen, weil er bis zum Himmel stinke.
Er schlenkerte sich die Stiefel von den Füßen und stieg zu ihr in das Faß, ohne die Kleider abzulegen. Sie fand das lustig, lachte ihn aus und brachte ihn dazu, ein Teil nach dem anderen auszuziehen. Alles, was er ihr gab, schrubbte sie sorgfältig und wrang es aus.
Seine Hände, sein Nacken und sein Gesicht waren von Sonne und Wind nußbraun getönt. Sie inspizierte die Wunde an seinem Kopf und meinte, sie sei hübsch vernarbt.
Sie verteilten die Kleider zum Trocknen auf niedrige Büsche und wickelten sich in Decken ein. Rachel wollte sich in den Schatten eines Baumes ins Gras legen, aber er bestand darauf, daß sie in der Scheune bei den Pferden schliefen. Erschöpft begaben sie sich dorthin, schoben das Tor zu und legten sich auf das Heu, um den Rest des Tages zu schlafen. Völlig dunkel war es in der Scheune nicht, durch die vielen schmalen Ritzen drang Sonnenlicht herein.
Er erklärte ihr, daß sich das Licht immer in gerader Linie bewege, nichts anderes in der Natur sei so gerade wie Lichtstrahlen.
Sie hob die Hand und führte sie durch die Luft, bis sie auf einen Lichtstrahl traf. Dann zuckte sie mit der Hand zurück, als hätte sie sich verbrannt oder geschnitten, und mußte über ihr merkwürdiges Spiel lachen. Sie streckte die Hand noch einmal aus, ließ das Licht auf der Handfläche tanzen und legte sie dann an ihr Gesicht, als wollte sie die Wärme der Sonne auf ihre Haut übertragen.
Auf ihr Drängen hin legten sie sich so dicht nebeneinander, daß sie nur zu flüstern brauchten und einander berühren konnten. Er fühlte ihren Atem leicht wie einen Lidschlag über sein Gesicht huschen, spürte die kühle Luft auf seiner Haut. Er schaute ihr in die Augen, und sie sah weg.
»Er ist nicht tot«, sagte sie.
»Nein, wahrscheinlich nicht.«
»Er wird mich suchen. So sicher wie das Amen in der Kirche. Sobald sie gestorben ist, wird er kommen.«
Während sie langsam sprach, spielte sie weiter mit dem Licht. Sie ließ es zu, daß sich ihre Blicke begegneten, und dann tat sie, als führte sie die Wärme des Lichts an sein Gesicht, seine Wangen, seine Augen und seine Stirn, preßte die Strahlen in ihrer Faust zusammen und öffnete diese auf seiner Haut.
»So einen wie ihn habe ich noch nie getroffen«, sagte er, »und ich hab schon viele komische Vögel gesehen.«
»Man kann ihm nicht zuhören, ohne daß etwas in einem passiert«, flüsterte sie, als wäre es ein tödliches r Geheimnis. »Er kann einen hypnotisieren. Er macht den Mund auf und fängt an zu predigen, und schon geraten die Leute völlig aus dem Häuschen und kommen in Scharen angelaufen.«
Sie fügte mit tiefer, pastoraler Stimme hinzu: »Wie kommt es, daß eine schwarze Kuh grünes Gras frißt und weiße Milch gibt, gelbe Butter und orangefarbenen Käse? Und du Ungläubiger meinst tatsächlich, es gibt keinen Gott? Halleluja!«
Er fragte, was sie mit dem Mann und der Frau zu tun hatte und warum sie zusammen unterwegs waren.
Sie erzählte, ihr Vater sei Prediger in Baltimore gewesen und für zwei Jahre in die Mission nach Afrika gegangen. Er sei ein wahrer Mann Gottes gewesen und habe immer gesagt, daß es einen himmelweiten Unterschied zwischen einem gangbaren und dem richtigen Weg gebe. Als sich ihre Eltern nach Afrika aufmachten, sollte sie bis zu ihrer Rückkehr bei dem Mann und der Frau in Pflege bleiben. Ihre Mutter und ihr Vater kamen jedoch in diesem fernen Land ums Leben.
»Ihr Boot kenterte, und sie sind ans Ufer geschwommen und wurden von einem Löwen angefallen.«
»Einem Löwen?« fragte er, als hätte er nicht gewußt, daß es die wirklich gibt.
»Von einem Löwen.«
»Gott, ich hab noch keinen gekannt, der von einem Löwen getötet wurde.«
»Das passiert auch nicht jeden Tag«, sagte sie.
Sie erzählte weiter, als könnte sie jetzt, wo sie einmal damit angefangen hatte, nicht mehr aufhören. Sie erzählte, an einem Tag habe er sie angeschrien und am nächsten um Verzeihung gebeten. Er habe ihr Leben bestimmt, sie konnte keine eigene Entscheidung treffen.
»Ich wollte immer weglaufen«, sagte sie, »aber ich fürchte, ich bin zu spät weggelaufen.«
»Man kann sich an fast alles gewöhnen, wenn es nur langsam genug geht«, sagte er.
»Daran nicht«, fauchte sie, und dann drehte sie ihm den Rücken zu und sagte nichts mehr, bis sie einschlief.
Später wurde er aus dem Schlaf gerissen, weil er keine Luft mehr bekam. Es war, als legten sich Hände auf seinen Brustkorb und um seinen Hals, und er konnte kaum atmen. Er drehte sich auf den Bauch und stemmte sich hustend und keuchend auf alle viere hoch. Seine Augen brannten, und das Gesicht fühlte sich aufgequollen an. Die Scheune war voller Qualm, die Pferde stampften und wieherten und stießen mit den Hufen gegen die Seitenwände der Boxen. Zuerst konnte er den Rauch und den Krach überhaupt nicht einordnen. Er brauchte eine ganze Weile, bis er klar denken konnte, aber dann begriff er: Die Scheune brannte.
Nackt und halb erstickt kroch er zum Tor, doch es ließ sich nicht aufschieben. Die Flammen waren bereits ganz nah. Er trat mit beiden Füßen gegen das Tor. Es gab bei jedem Tritt leicht nach, schloß sich aber sofort wieder, so daß er sich nicht hindurchzwängen konnte. Es war verriegelt oder verklemmt, er wußte es nicht.
Er scharrte die Erde unter dem Tor weg, fand dann eine kaputte Schaufel und arbeitete damit weiter, bis das Loch groß genug war und er sich durchquetschen konnte. Er rechnete damit, draußen sofort erschossen zu werden, doch nichts geschah. Er blieb am Boden liegen und atmete tief durch, und von dort, wo er lag, sah er, wie grauer Rauch aus den Fensteröffnungen quoll und zum Dach hinaufstieg. Die Führungsschiene über dem Tor hatte sich gelöst, und ein Rad war im Spalt festgeklemmt.
Er stand auf und rüttelte mit aller Kraft am Scheunentor, bis es mitsamt der Schiene herunterkrachte und die Öffnung freigab, und dann stand er vor einer Wand aus schwarzem Rauch.
Er kroch hinein, achtete darauf, nur die reine Luft dicht am Boden einzuatmen, und schließlich fand er sie, verloren und verzweifelt, packte sie und zog sie nach draußen, und auch der pechschwarze Hengst fand die Öffnung und preschte mit der braunen Stute im Schlepptau hinaus.
Von dem Augenblick an war die Panik in ihr wieder da und ließ sie nicht mehr los. Ihr zitterten die Hände, und Worte stürzten wirr aus ihr hervor oder, noch häufiger, fand sie gar keine Worte. Er überlegte, daß Scheunentore bei dauernder Benutzung immer wieder mal aus der Führungsschiene rutschen, und vielleicht war es nur das gewesen, aber für den Ausbruch des Feuers fand er keine Erklärung. Er versuchte sich genau zu erinnern, wann sie gegessen und wo sie das Feuer angeschürt hatten und ob er es auch wirklich ausgetreten hatte. Und wenn jemand absichtlich Feuer gelegt hatte, warum hat er ihn dann nicht erschossen, als er hinausgekrochen kam? Er fand keine Antwort auf diese Fragen, und als sich die Nacht über den Tag legte, kam er zu dem Schluß, daß er sie nie finden würde.
In den ersten Stunden danach hatten sie das Gefühl, vom Schicksal getrieben zu werden und es gleichzeitig in sich zu tragen. Sie durchlebten diesen Zustand des Aufruhrs bei gleichzeitig völliger Erschöpfung. Sie stoben davon, nebeneinander im Galopp, und die Hufe der Pferde wirbelten das Tal zu einer roten Staubwolke auf. Er hielt das Gewehr in der Hand, den Kolben auf den Schenkel gestellt, als sie sich einen Weg durch die dichten Wälder bahnten, die grün emailliert wirkten im feindseligen Tageslicht. Die Pferde tänzelten aufgeregt, und sie ritten weiter, in die Nacht hinein, schauten sich immer wieder um und warteten auf die Schüsse, die aber doch nicht kamen.
Er bestand darauf, daß sie die Route entlang der Waldpfade und unwegsamen Abkürzungen nahmen, und hin und wieder ruhten sie sich in einem Wäldchen aus, wo sie sich im kühlen Licht der Sterne in Sicherheit wähnten. Als er Hufgetrappel vernahm, verkrochen sie sich im Gebüsch und starrten in die Finsternis, und bald hörte er so viele Hufpaare, daß es schien, als wäre eine ganze Kavallerieeinheit hinter ihnen her. Er wußte wohl, daß niemand einen Grund hatte, sie zu jagen, aber er wollte niemandem begegnen, wollte nicht aufgehalten werden, wollte keines der Probleme bekommen, die man in diesen Tagen nach Gettysburg unterwegs bekommen konnte. Sie warteten ab und beobachteten alles, und der Krach wurde lauter und verhallte wieder, bis die Nacht in Schweigen fiel.
Er deutete hoch zu den Sternen und erklärte ihr den Weg, den sie wiesen, falls sie allein weiterreiten mußte. Im Nordwesten stand der Große Bär, und im Nordosten stiegen in diesem Monat die ersten Sterne des großen Vierecks des Pegasus über den Horizont. Dort ist Polaris, sagte er, der Nordstern.
»Wenn irgendwas passiert«, sagte er, »mach dir keine Gedanken um mich. Gib dem Pferd die Sporen.«
Sie versicherte ihm, daß er sich deshalb keine Sorgen machen mußte.
Sie warteten, bis sie ganz sicher waren, daß niemand kam. Dann überquerten sie den Weg und ritten weiter durch offenes Land, und dann war es schon fast wieder Morgen. Sie sahen einen schmalen Pfad, ein dünnes Band, das sich durch die Weiden schlängelte, und hier verloren sie die braune Stute. Sie lahmte am rechten Vorderbein so stark, daß sie den Huf nicht mehr aufsetzte. Ein Haarriß in der Hufwand hatte sich ausgedehnt, und auch der Strahl war gespalten und aufgerissen.
Er half Rachel in den Sattel des Glanzrappen und führte die beiden eine Zeitlang, dann stieg er hinter ihr auf, und unter der Sichel des abnehmenden Mondes ritten sie weiter nach Westen.
WO EINST DER KRÄMERLADEN des alten Morphew gestanden hatte, war alles niedergebrannt und nur noch ein schwarzer Flecken Erde zu sehen. Das Feuer hatte auch auf den Stallanbau übergegriffen, in dem der Glanzrappe gestanden hatte. Die Flammen waren die Felswand hinter dem Stall hochgezüngelt, und aus dem rußgeschwärzten Stein sickerten kleine Rinnsale von kupferfarbenem Wasser. Auch die Schmiede war abgebrannt, dort lag nur noch ein Haufen Eisenschrott und verkohltes Bauholz. In der Mitte jedoch stand noch immer der große Amboß, als hätte er den verbrannten Stumpf, auf dem er saß, in Grund und Boden geritten, um jetzt geduldig auf den nächsten wuchtigen Hammerschlag zu warten.
Von Morphew, von dem Deutschen mit dem Buckel und von dem Handstandjungen keine Spur. Es gab keinerlei Anzeichen, daß hier vor kurzem Menschen gelebt hatten, die eines Tages zurückkehren würden. Alles wirkte einsam und gespenstisch, an den Rändern begann bereits das Grün zu wuchern, und bald würde sich die Natur diesen Ort ganz zurückerobern.
Sie hielten sich dort nicht lange auf und ritten hinab in die Senke, auf dem umgekehrten Weg, den er damals, vor langer Zeit genommen hatte. Jetzt war er ein anderer. Er war älter geworden, hatte sich verändert und so viele Menschen überlebt, auch den Vater.
In dieser trockenen Jahreszeit war der Canaan River nicht viel mehr als eine Abfolge seichter Tümpel und Untiefen, nur von einigen winzigen Bächen gespeist.
Am Twelve Mile Creek war es ähnlich, nur dessen Wasser war kälter und schwärzer, das Ufer verwilderter und dichter mit robusten Schattenpflanzen bewachsen. Ins Wasser gekippte Bäume reckten ihr Wurzelgeflecht wie riesige Fächer in die Luft, und die knorrigen Wurzelfinger hielten kleine Felsbrocken umklammert. Die ausladenden Stämme des Berglorbeers überkreuzten sich und verflochten sich ineinander, alles erweckte den Eindruck, als hätte eine wilde Natur den Berg so lange abgeriegelt, bis Robey zurückkam.
Sie ritten weiter, immer höher hinauf, bis zu der Stelle, wo der Fluß Steine und Geröll angespült hatte und früher die Brücke gewesen war. Der pechschwarze Hengst stieg, ohne zu zögern, die Böschung hinab, glitt ins Wasser und durchquerte mit sicherem Tritt die sanfte, kühlende Strömung, die ihm bis an den Bauch reichte.
Kühle Luft umfaßte sie, als sie den Anstieg fortsetzten, und gegen Abend erreichten sie die alten Felder, wo Königskerzen und Scharfgarbe blühten, und dann kam, in die Berge geschmiegt und von Wacholderbüschen bekränzt, die hohe Wiese, deren nasses Gras im Sonnenlicht aufblitzte. Als sie die Felswände hinter sich ließen und die Wiese betraten, erschien sie ihnen wie das Dach der Welt.
Als er das Blockhaus endlich sah, kam es ihm kleiner vor als in seiner Erinnerung, und seitdem er weg gegangen war, mußte es heftigen Stürmen standgehalten haben. Die Holzbalken waren rissig und hatten einen silbrigen Glanz, die Dachschindeln waren verschoben und verrutscht, von widrigen Winden gebeutelt. Die Rundhölzer waren abgesplittert, Moos und Efeu wucherten überall. Nirgends sah man einen rechten Winkel. Zwar hatte die Natur es sich noch nicht vollständig zu eigen gemacht, aber insgesamt wirkte das Haus sehr instabil und wackelig.
Das Grün ringsum war so üppig, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Im Garten, auf den Feldern, auf dem Berg, überall blühte es. Am Hang sprangen Lämmer herum, und steifbeinige Kälber blökten nach ihrer Mutter. Eine Schar Welpen wuselte durch die Wiese. Es war, als hätte seine Mutter Tiere gezüchtet und die Natur vermehrt. Es war, als wäre er in das Reich der Träume zurückgekehrt.
Er stieg aus dem Sattel und betrat das Haus. Sie sah ihn im Spiegel, als er zur Tür hereinkam, zupfte gerade ihr widerspenstiges Haar zurecht, als erwartete sie Besuch, als hätte sie soeben etwas ganz Neues an sich entdeckt.
»Ja, wer ist denn da?« fragte sie liebevoll. Sie wußte schon, daß er es war. »Komm doch aus dem Schatten, damit ich dich anschauen kann«, sagte sie, und erst jetzt legten die Hunde die Ohren an und erhoben sich steifbeinig und mit gesträubtem Fell. Sie stießen ein tiefes, heiseres Bellen hervor, sabberten und klapperten mit den Kiefern und kratzten mit den Pfoten über den rauhen Boden, als sie versuchten, ihre schwerfälligen Körper zwischen ihr und ihm auszustrecken. Als sie ihn erkannten, wurden sie kleinlaut.
»Die wußten genau, daß du kommst«, sagte sie entschuldigend. »Sie wußten nur nicht, wann. Sie sind schon seit Tagen unruhig.«
Ihr Haar war weiß geworden, und ihr Gesicht war von einer Reinheit, wie man sie hei Kranken und Heiligen und auch vor einem Wetterumschwung am Himmel feststellen kann. Sie bewegte sich so umsichtig wie ein schwebender Naturgeist. Seit er weg war, hatte sie keine Menschenseele mehr gesehen. Sie hatte keine Stimme gehört und auch die eigene Stimme so lange nicht mehr erklingen lassen, außer für einen ganz leisen Ton, gerade laut genug, daß ihn die Tiere wahrnahmen, wenn sie sie zum Melken oder zum Füttern oder von einer Weide zur nächsten rief.
»Du warst sehr lange fort«, sagte sie. »Bist du wirklich wieder da?«
Sie berührte sein Gesicht, wie es Blinde tun.
»Hast du meinen Brief bekommen?« fragte er.
»Nein«, sagte sie, »er ist noch nicht angekommen, aber er kommt schon noch.«
In diesem Moment ließ sie die letzte Hoffnung fahren, daß ihr Mann, der Vater ihres Sohnes, noch am Leben war. In diesem Augenblick wußte sie, er würde nicht durch die Tür hereingestapft kommen, würde sie nicht in die Arme nehmen und hochheben.
Doch schon vor geraumer Zeit hatte sie den Raum des Verlustes und der anhaltenden Stille betreten, und jetzt würde grenzenloser Kummer ihr ständiger Begleiter sein. Viel später würde sie ihm sagen, daß sie schon geträumt hatte, sein Vater sei tot, und würde dann zugeben, daß es kein Schock für sie war, als er tatsächlich nicht mehr nach Hause kam. Sie hatte nur ganz einfach nicht gewußt, daß es wirklich stimmte. Aber von Robeys Tod hatte sie nie geträumt, und deshalb hatte sie jeden Tag Ausschau nach ihm gehalten, war ganz sicher gewesen, daß er zu ihr nach Hause zurückkehren würde.
»Du mußt müde sein«, sagte sie, den Blick an ihrem Sohn vorbei auf das Mädchen gerichtet.
»Ich muß mich hinlegen«, sagte Rachel. »Ich bin so müde, und die Schultern tun mir weh.«
Die Mutter bedeutete ihr, sich in den Poltersessel am Fenster zu setzen. Robey folgte seiner Mutter in die Küche, wo sie ruhig und beherrscht Fett in eine Bratpfanne gab.
»Wer ist sie?« fragte sie schließlich, als das Fett zu brutzeln begann und sie die aufgeschlagenen Eier hineingab. »Woher kommt sie?«
»Ich weiß nicht viel über sie«, antwortete er.
Als sie sich umdrehte und ihn anschaute, erkannte sie, daß er sich verändert hatte. Sie konnte sich nicht vorstellen, was er alles gesehen hatte, während er fort war. Sie konnte sich nicht vorstellen, wieviel Dunkel er in sich angesammelt hatte. Aber nein, er hatte sich nicht verändert. Er war ihr Sohn, nur war aus dem Kind ein Mann geworden, und das war zu erwarten gewesen.
»Was hat sie dir erzählt?«
»Wir haben nur wenig gesprochen.«
»Worüber?«
»Das frag ich mich manchmal auch.«
»Sprich doch«, sagte die Mutter, aber sie war nicht ernstlich an diesem Thema interessiert. Sie wollte lediglich die Stille ausfüllen.
»Sie hat erzählt, daß ihre Eltern in Afrika umgekommen sind.«
»Ein schrecklicher Ort zum Sterben.«
»Gibt es bessere?« fragte er.
»Also, ich würde das eigene Bett vorziehen, aber ich bin auch nicht so ein Weltenbummler, wie du es geworden bist.«
Er wurde rot vor Scham und wollte sich entschuldigen, brachte aber kein Wort über die Lippen. Er saß einfach bei ihr, während sie Eier und Speck briet und Brot im Ofen aufwärmte.
Sie erzählte von der Farm, wie sie vorankam und was alles gemacht werden mußte, jetzt wo er zurück war.
IN DIESER NACHT auf dem Berg saß er, während die Frauen schliefen, draußen in der kühlen Sommerluft, den Rappen an einer langen Leine angebunden. In der Ferne sah er einen schwachen Lichtschein und dann noch einen. Das Licht war Meilen weg, und es war ihm zuvor noch nie aufgefallen. Als die Mutter sich zu ihm gesellte, hatte sie einen Pullover über ihr Nachthemd gezogen und ihm einen Teller mit Broten mitgebracht. Er entschuldigte sich, weil er so vorlaut gewesen war, und sie nickte und nahm seine Entschuldigung an.
»Das ist ein herrliches Pferd«, sagte sie.
»Ich bin Mister Morphew noch was dafür schuldig«, erklärte er und erzählte, wie er zu dem Glanzrappen gekommen war; er sagte ihr aber nicht, daß der Krämerladen niedergebrannt war und die Schmiede ebenfalls. Statt dessen fragte er sie, was es mit den beiden Lichtern auf sich hatte, und sie sagte, daß die schon einen ganzen Monat brannten.
»Das müssen neue Siedler sein«, meinte sie, »die haben erst mal alles mögliche verbrannt.«
»Neue Siedler?«
Er wunderte sich. Der Gedanke erschien ihm unfaßbar. Wußten die nicht, was in der Welt los war?
Dann beantwortete er die Frage, von der er wußte, daß sie sie insgeheim stellte. »Es ist schwer, hier über das zu sprechen, was dort im Osten passiert ist.«
»Wir haben Zeit«, sagte sie, und ein Seufzen entfuhr ihr. »Wir haben jetzt viel Zeit.«
»Er hat mir gesagt, ich soll dir sagen, daß er dich mehr geliebt hat als alles auf der Welt.«
Bei diesen Worten verlor sie die Fassung, konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Er dachte an all die Frauen, die jetzt Tränen vergossen, die Mütter und Töchter, die um ihre Männer und ihre Söhne, ihre Brüder und ihre Liebsten weinten, um all die verlorenen Seelen, die nun keinen Körper mehr besaßen. Sie waren Gefangene der Träume, die ihnen bevorstanden und über die sie keine Macht hatten.
Er dachte an die Männer und die Jungen, die nach Hause kamen und nie mehr gesund wurden, an die Gebrochenen und die Verwundeten, an die, die überlebt hatten. An die, die nie mehr sehen würden, die nie mehr laufen, kauen oder sprechen konnten, die sich nie mehr aufsetzen oder allein anziehen konnten, an die, deren Kopf nie mehr einen klaren Gedanken fassen würde.
Was würden ihre Frauen tun? Würden sie die Männer und Jungen noch immer lieben? Was würde aus der Liebe werden? Er dachte, lieber tot und verloren als zerschunden und verkrüppelt.
Sie weinte, bis ihre Schultern heftig zuckten und sie keine Luft mehr bekam. Aber als er sie in den Arm nehmen wollte, stieß sie ihn weg. Er wußte, sie wollte jetzt für sich sein, und doch nicht ganz allein. Er setzte sich wieder, faltete die Hände und wartete ab.
Dann war es vorbei, sie hatte sich wieder im Griff und rieb sich mit dem Handrücken das Gesicht trocken. Es dauerte lange, ehe sie etwas sagte.
»Weißt du, daß sie ein Kind bekommt?«
»Nein«, sagte er und schüttelte den Kopf, »das hab ich nicht gewußt.«
»Ist es von dir?«
»Wenn sie es so will.«
In dieser Nacht blieben sie noch lange unter den Sternen sitzen, ignorierten die Müdigkeit, wollten nach so langer Zeit die Gesellschaft des anderen nicht missen. Sie sahen auf den fernen Lichtschein, der von den Siedlern herüberflackerte. Er überlegte, woher sie wohl wußte, daß Rachel ein Kind bekam, und dachte zurück an die Tage unterwegs, und dann kamen ihm Zweifel. Hatte womöglich sie die Scheune in Brand gesteckt? Sie war ihm ein Rätsel, und die Nachricht, daß sie ein Kind bekam, half ihm auch nicht weiter. Aber wenn sie versucht hatte, sich selbst anzuzünden, war das jetzt nicht egal?
Sie lauschten gemeinsam den Rufen der Nachtvögel und den Geräuschen der grasenden Tiere. Robeys Rückkehr war kein vollkommenes, freudiges Ereignis, doch sie nahmen dankbar an, was ihnen blieb, und sahen gemeinsam zu, wie der Mond hinter dem Horizont verschwand.
DANN WURDE DAS WETTER KÜHLER, und herbstliche Stille legte sich über das Land. Der Himmel war hoch und rauchfarben, das Viehfutter war am Morgen von Rauhreif bedeckt und dampfte, wenn man den Haufen aufbrach. Die Sonne stand tief, und ihr Licht wärmte nicht mehr, war hell und kalt. Meilen entfernt, wo jemand ein Stück Land durch Brandrodung urbar machte, sah man weißen Rauch aufsteigen. Wie angenehm der Sommer auch gewesen war, wie üppig die Pflanzen gediehen und die Tiere gewachsen waren, jetzt kamen die Vorboten der dunkleren Tage.
Er war nicht erstaunt darüber, wie die Mutter den Sommer über getrauert hatte, wie sie Mal ums Mal ihren Schmerz durchlebte. Frühmorgens, mittags und auch nach dem Abendessen erhob sie sich vom Eßtisch und verschwand verloren und mit gebrochenem Herzen, lief hinaus in die Felder, in den Wald, in die Dunkelheit. Er hörte sie in der Nacht aufstehen und folgte ihr in gebührendem Abstand, und immer war ihr seine aufmerksame Nähe ein Trost. Er hätte ihr gern etwas von ihrem Schmerz genommen, wenn er gekonnt hätte. Es war, als würde sie die Trauer mit der Nahrung aufnehmen, ihre Beine wurden schwer, und die Kraft in den Armen und den Schultern ließ nach, und ganz langsam und fast unbemerkt wurde die Mutter ein anderer Mensch.
Im Lauf des Sommers begann Rachels Bauch zu wachsen, und der Rest ihres Körpers schwand zusehends, als würde er verbraucht und aufgezehrt von dem neuen Leben, das in ihr entstand, und wenn das Kind zur Welt kam, würde von ihr selbst nichts mehr übrig sein.
Die Mutter sorgte dafür, daß Rachel immer etwas zu tun hatte, munterte sie auf, wenn sie Trübsal blies, hinderte sie mit ihrer schieren Willenskraft daran, in Schwermut zu versinken.
Er wußte nicht, was zwischen den beiden Frauen vor sich ging. Er wußte, es war kein friedliches Miteinander, sondern ein distanziertes, allem Anschein nach von Respekt geprägtes Verhältnis, und manchmal schien es, als teilten die beiden einen großen Kummer, die eine um das Verlorene, die andere um das Werdende.
Jeden Tag ging er allein hinaus auf die Felder, nicht nur zum Arbeiten, sondern auch, um zu sehen, wer die Copperhead Road heraufkam. Zuerst hatte die Mutter ihn dazu gedrängt, bei seiner täglichen Runde die Hunde mitzunehmen, aber er wollte ihr warnendes Gebell nicht, nicht für sich selbst und auch nicht für den, den er erwartete. Daß er kommen würde, wußte er von dem Moment an, als er ihm zum ersten Mal ins Gesicht gesehen hatte. Er hatte stets das Gewehr dabei, hatte schon vor langem beschlossen, nie mehr darauf zu warten, bis irgend jemand ihm etwas zurief, ihm einen Befehl erteilte, ihn hierhin und dorthin schickte.
An manchen Tagen hörte er, wie vom anderen Ufer des Twelve Mile Creek ein Donnergrollen den Berg heraufschallte, die ganze Copperhead Road entlang. Das Grollen kam aus den dunklen Wolken im Osten, es hielt den ganzen Tag an, und selbst als es aufgehört hatte, folgte noch Echo auf Echo. Damals verstand er nicht, woher all die Detonationen und Explosionen stammten, doch später sollte er etwas über das Phänomen des akustischen Schattens erfahren, wie sich Schall ausbreitet, der auf einem weit entfernten Schlachtfeld erzeugt wird. Aber damals wußte er noch nichts darüber und dachte, da unter ihm sei eine Schlacht im Gang, und er fühlte sich davon angezogen, fühlte sich dort hingerufen, und das beunruhigte ihn.
Wen er nicht erwartet hatte auf dem Weg hier herauf, war der zweite Fledderer, der Bruder des einen, den er mit einem Kopfschuß getötet hatte. An dem Morgen, als er ihn näher kommen sah, war es so still, als wäre bereits ein Mord geschehen.
Robey lag in einer Felsmulde, die der Wind blank gescheuert hatte, hoch oben am Südhang des Bergs. Er hatte sich in eine Decke gewickelt und die Wange auf die gefalteten Hände gelegt. In der Luft hing der Duft der knorrigen Wacholderbüsche. Das Gewehr lag neben ihm.
Es war Herbstwetter und gerade Mittag geworden. Am Morgen hatte er damit begonnen, die Futterplätze mit getrocknetem Mais zu füllen, und diese Arbeit wollte er am Nachmittag zu Ende bringen. Er hatte seinen Kaffee getrunken, aß gerade das Sandwich mit Schweinefleisch, das er sich als Proviant mitgenommen hatte, und leckte sich das Fett von den Fingern. Er machte eine Pause, richtete die Gedanken in die Unendlichkeit und überlegte, wie der Felsbrocken zu solch einer Mulde gekommen war. Oder war es gar nicht der Stein selbst, sondern die Kraft des Windes, der den Felsen ganz langsam an dieser Stelle abgeschabt hatte? Oder ein Relikt aus der Eiszeit, von der sein Vater erzählt hatte?
Er beobachtete den Weg, der sich aus dem breiten Tal den Berg hinaufwand, die einzige Möglichkeit, zu seinem Zuhause zu gelangen. Er lag hier oben an einem kleinen, geschützten Platz, der einen steilen Blick nach unten ermöglichte, bis zu einem gezackten Grat zweihundert Meter entfernt, der abrupt in eine undurchdringliche, von Lorbeergehölz überwucherte Schlucht abfiel.
Hier hatte er schon oft Rothirsche erlegt, die den Grat überquerten, und der Kitzel daran war, das Wild so rechtzeitig zu erschießen, daß es nicht mehr über den Grat kam und hinab ins Dickicht stürzen konnte. Sein Vater hatte ihn immer gewarnt, wenn du da einen Hirsch rausholst, wirst du es so bereuen, daß du es nie wieder tust.
Dieser Tag war irgendwie anders, auch wenn er es nicht beschreiben konnte. Rachel hatte nicht geschlafen, und er hatte die ganze Nacht neben ihr gesessen, während sie ein stilles Zwiegespräch mit dem neuen Wesen in ihr zu halten schien. Auch er fühlte sich anders an diesem Morgen, als er das Gewehr lud und den Revolver scharf machte, die Kanne mit Kaffee füllte und sich das Sandwich für später zubereitete. Er wußte nicht, warum, aber er spürte es in den Armen, im Rücken und vor allem in den Schulterblättern.
Er hob das Messingfernrohr noch einmal an die Augen. An jedem anderen Tag wäre er jetzt schon wieder bei der Arbeit, aber heute blieb er noch, um eine spannende Begegnung auf dem gezackten Bergkamm zu beobachten.
Beim letzten Blick durch das Fernrohr hatte er einen jungen Rehbock mit Knopfgeweih gesehen, und nicht weit von ihm einen Rotschwanzbussard, der auf dem Brustkorb eines verendeten Hirschs hockte. Der Hirsch war alt und mußte in der Nacht verendet sein, denn gestern war er noch nicht da gewesen. Es war komisch, daß der Hirsch keinen geschützteren Platz zum Sterben gefunden hatte, sondern hier auf dem Berggrat liegengeblieben war. Es ist nicht ungewöhnlich, daß Tiere einen Fehler machen. Oft berechnen sie den Sprung falsch und reißen sich den Bauch auf oder brechen sich die Beine. Tiere werden geboren und sie werden alt, genau wie Menschen. Manche sind klug und manche dumm. Sie machen Fehler. Sie haben Unfälle. Sie leben und sie sterben.
Aber das hier war irgendwie anders. Er kam vor lauter Grübeln ins Schwitzen und blieb noch dort, obwohl es längst Zeit gewesen wäre, wieder aufs Feld zurückzugehen. Er wußte nicht, warum er wußte, was er wußte. Er wußte nur, daß er weiter tun mußte, was er gerade tat.
Und so sah er weiter durchs Fernglas.
Der Bussard rupfte an den Innereien und schlang sie hinunter, als wären es zähe Würmer. Aus seiner Perspektive sah es aus, als stünde der Bock direkt neben dem Bussard und nicht ein gutes Stück davon entfernt. Als ein Windstoß kam, hob der Vogel die Flügel und spreizte sie wie ein Segel im Wind. Er stieß einen kehligen Schrei aus, und Robey mußte grinsen, als er sah, wie der Rehbock Angst bekam und das Weite suchte.
Jetzt war der Grat verwaist bis auf den zerrupften Tierkadaver. Es war Mittag, und der Fels war in gleißendes Licht getaucht, als wäre er ein Feuerstein und die Sonnenstrahlen aus Stahl. Zu gern hätte er den Rotschwanzbussard noch einmal gesehen, wie er fraß und dann losflog, wie er sich mit seinen kräftigen Schwingen durch die Lüfte schraubte, doch er war schon fort.
Dann entdeckte er durchs Fernglas einen Reiter, den er kannte. Sein Pferd kam in langsamem Schritt heran, und obwohl es nicht der Mann war, den er erwartet hatte, war es doch einer, den er kannte, und erst als er ihn sah, verstand er. Mitten in Robeys Blickfeld blieb der Mann stehen und schaute auf den Tierkadaver.
»Nur keine Eile«, flüsterte Robey. Er spuckte den Klumpen Brot aus, den er noch im Mund hatte, drückte sich eng an den Felsen und setzte mit ruhiger Entschlossenheit den Gewehrkolben an die Schulter. Er legte den Vorderschaft hinter der Öse des Gewehrriemens auf und zielte über Kimme und Korn, stellte seine Berechnungen dabei instinktiv an.
Als er schließlich seinen Platz verließ und hinunterging, fand er den Fledderer rücklings auf dem Berggrat liegen, wie vom Faustschlag eines Riesen hingestreckt. Sein Haar war schütter, die Nase gekrümmt. Die Augenpartie war eingefallen, die Haut bleich, und wo er auf dem Boden aufgeschlagen war, bildeten sich gelbe und violette Flecken. Noch im Sterben hatte er einen gierigen, listigen Blick.
»Wie sieht’s aus?« fragte der Mann und preßte die Zähne zusammen, um den Schmerz in seinem Körper zu beherrschen.
»Kein schöner Anblick«, entgegnete Robey. »Wenn du das meinst.«
»Du bist ein fieser Schuft«, murmelte der Fledderer.
»Ich denke, es gibt Leute, die sagen das gleiche über dich.«
»Ich glaube, ich habe dich schon mal nach deinem Namen gefragt?«
»Robey Childs«, antwortete er.
»Ich sag’s ihnen, wenn ich ankomme.«
»Sie werden’s wissen wollen.«
»Gott, tut das weh«, sagte der Fledderer. Er deutete nicht auf die Stelle, an der es weh tat, aber es war klar, daß er von dem Loch in seiner Brust sprach.
»Hättest besser aufpassen sollen«, sagte Robey.
Aus seiner Nase strömte Blut, und der entsetzte Mann schien nicht recht zu verstehen, was ihm geschehen war. Er hob die rechte Hand vors Gesicht, als wollte er seinen getrübten Blick wegwischen, doch dann ließ er den Arm wieder sinken.
»Wo ist mein Pferd?« fragte er.
»Weggelaufen.«
»Soll mir wohl eine Lehre sein«, sagte er müde und wiederholte Robeys Namen. »Robey Childs.«
»Was für eine Lehre denn?« fragte Robey, aber der Mann war schon tot und konnte nicht mehr antworten.
Er schnalzte mit der Zunge und sah hinauf zum Himmel.
Was passiert ist, ist passiert, dachte er, und was passieren wird, wird passieren, und wenn es passierte, würde er froh darüber sein, denn dann konnte er den nächsten Schritt tun.
Das Laub verfärbte sich jeden Tag mehr, wurde rot, orange und gelb. Staubbedecktes Wasser bahnte sich unter schwarzen Schatten seinen Weg, und die trockenen Maishülsen schüttelten sich in den Brisen, die den Berg umspielten. Die heißen, herrlichen Sommertage waren vorbei. Bald würde der Wind zunehmen, der prasselnde Regen sich in Schnee verwandeln und die Berge unpassierbar machen, und erst dann würde er in der Abgeschiedenheit zur Ruhe kommen.
Er blieb noch eine Weile neben dem toten Fledderer stehen. Warum, wußte er nicht, aber er spürte, er mußte es tun, ehe er ihm die Waffen und alles, was einen Wert besaß, wegnahm und ihn über den Grat hinabstieß. Dann würde er das entlaufene Pferd einfangen und nach Hause gehen.
»War es der, auf den du gewartet hast«, fragte die Mutter spät in der Nacht, als sie draußen saßen, zusammengekauert zum Schutz gegen die Kälte.
»Nein, der war es nicht.«
»Also jemand anders«, sagte sie.
»Ja, Mutter.«
»Wie viele sind es noch?«
»Nur einer«, sagte er. »Aber das habe ich auch vor dem da schon gedacht.«
»Ich hätte es bei den Hunden belassen sollen«, seufzte sie. »Die werden wenigstens in einem Jahr groß.«
Wenn ihre Stimme einen ironischen Unterton hatte, so konnte Robey ihn nicht erkennen.
ALS DIE ZEIT DES WARTENS auf den nächsten, der kommen würde, zu Ende ging, war es Monate später, und er saß auf dem Rücken seines Rappen. Er ritt die steinige Copperhead Road hinab. Eine Eisdecke hatte das träge Wasser überzogen, und über den schattigen Boden zogen sich Streifen von Schnee.
Frierend und müde war er von seinem heutigen Beobachtungsposten herabgestiegen, einem Vorsprung, der entstanden sein mußte, als sich die Felsen hier zusammengefunden hatten, zu einer Zeit, in der die Felsen noch nicht starr und empfindungslos gewesen waren, in der sie wie urzeitliche Pilger Rast gemacht hatten, erschöpft von der schweren Reise, zusammengesackt und ineinander verhakt. Unter ihm lag der alles verhüllende Schnee, und über ihm spannte sich das winterliche Universum, und immer, wenn er hier stand, konnte er dem Verlangen nicht widerstehen, die Hände auszustrecken, um es zu berühren.
Die Sonne war am Himmel verschwunden, war nicht mehr zu sehen in dem tiefen Einschnitt, durch den er ritt. Tagelang schon war das so, als könnte sich die Sonne in diesem Winter nicht mehr aus der Umklammerung des Dunkels lösen. Es war kalt und frostig, und die schwarzen Felswände waren mit gefrorenem Wasser überzogen.
Bislang war der Winter, wie er ihn sich gewünscht hatte, anhaltende Kälte mit Eis und Schnee, und schon am Nachmittag wurde es dunkel, und man war nie müde genug, um die lange Dunkelheit durchschlafen zu können. Es gab nichts als den langen Winter und den endlosen immergrünen Wald, der sich am Horizont verlor. Die Kühe im Stall, die gemolken und gefüttert werden mußten, und das Warten auf Rachel, die sich vor seinen Augen von Tag zu Tag veränderte, jetzt, da ihre Zeit unmittelbar bevorstand.
In den Monaten der Schwangerschaft war sie ihm gegenüber meist verschlossen gewesen, düster, wütend und unglücklich, und doch brauchte sie seine Nähe und mußte stets wissen, wo er war. Sie erzählte ihm von dem seltsamen Gefühl, als sich die Rippen spreizten, um Platz für den Bauch zu schaffen. Von dem Schmerz, der ihren Körper durchzuckte. Von den zarten Knochen, die sich in ihr dehnten. Von den Schwächeanfällen, von den Geistern, die sie quälten, und von ihren Sünden. Manchmal schien sie nicht mehr zu wissen, wo sie war oder wie sie hierher gekommen war oder welcher Wochentag war, und wenn sie es wußte, war es ihr egal. Er hatte wieder erfahren, was Angst ist, aber nicht Angst um sich selbst. Nun ging es um ihr Leben, das ihm so sehr ans Herz gewachsen war.
Letzte Nacht hatte sie ihm mit tränenerstickter Stimme gesagt, sie sei nun bereit zum Sterben und wolle es auch tun. Wenn sie nicht zum Anfang zurückkehren konnte, wollte sie Schluß mit diesem Leben machen und noch einmal geboren werden. Ein Schauder durchfuhr seine Knochen.
PLÖTZLICH SCHNAUBTE DER GLANZRAPPE, warf den Kopf hoch und scharrte mit dem Huf. Robey hatte nichts Auffälliges bemerkt, doch er zog sofort das Gewehr aus der Satteltasche, verließ den Weg und duckte sich hinter ein dichtes Gestrüpp.
»Das könnte für jemanden ein schlimmer Tag werden«, flüsterte er dem Pferd zu, das reglos dastand. Dann hörte er den schneegedämpften Galopp eines sich nähernden Reiters. Er wußte nicht, wie es ausgehen würde, und in diesem Augenblick war es ihm auch egal. Er wußte, er würde bekommen, worauf er gewartet hatte. Jetzt würde er Ruhe finden, so oder so.
Er schnalzte mit der Zunge, und der pechschwarze Hengst stieg hoch und stürmte zurück auf den Weg. Als er die Zügel fest anzog, drehte sich das Pferd einmal um die eigene Achse, vollführte im Sprung eine zweite Umdrehung und blieb quer zum Weg stehen. Er hielt den Hengst in dieser Position, so daß sie den Weg versperrten, und blieb, das Gewehr auf den Schoß gelegt, im Sattel sitzen.
Der Reiter, der ihm entgegenkam, ritt auf einer kleinen Fuchsstute mit weißer Mähne und weißen Fesseln. Hier kam das Ende seiner langen Suche, und es kam schneller, als er erwartet hatte. Der Mann hielt erst an, als sich die Fuchsstute auf gleicher Höhe mit dem pechschwarzen Hengst befand.
Außer einem milden Erstaunen war in den Augen des Mannes nichts zu erkennen, aber sein Gesicht erinnerte Robey an die Knochenberge auf dem Schlachtfeld, von dem er vor so vielen Monaten weggeritten war und wo er den Vater tot zurückgelassen hatte, begraben unter einem Baum. Das Gesicht erinnerte ihn an die Nacht in dem ausgebrannten Haus und an Rachel und die blinde Frau und daran, wie ihn der Gänsemann angeschossen hatte und wie er sich den Kopf mit den zerrissenen Kleidern der ermordeten Frau verband.
»Ich kenne dich«, sagte der andere und schien zuerst erfreut über diese unerwartete Begegnung. »Ich habe dich gesucht.«
Aber es brauchte keine Worte. Es gab nur einen Grund für ihn, hier auf diesem Weg zu sein, und daß er sich verirrt hatte, war unwahrscheinlich. Die Augen des Mannes wurden jetzt unruhig, bewegten sich ständig hin und her, und da erkannte Robey, daß es nicht die Augen eines Mörders waren, sondern die eines Menschen, der vor der Sünde und ihren Folgen und vor dem Tod flieht.
»Das ist ein gutes Pferd«, sagte der Mann. »Jeder, der das Pferd gesehen hat, würde dich wiedererkennen.«
»Fahr zur Hölle«, sagte Robey.
»Aber ich hab dich erwischt«, sagte der Mann und schob den Unterkiefer entschlossen vor. Dann lächelte er kalt, als wollte er die Herausforderung etwas zurücknehmen.
»Was habe ich mit deinem Leben zu schaffen?« fragte Robey.
»Deshalb bin ich hier. Genau darüber will ich mit dir reden.«
Bring ihn um, dachte er. Mach Schluß mit ihm, sagte er sich, und seine Gedanken waren schnell und klar, hell wie von Gott gesandt. Sein Urteil würde kein Abwägen kennen, keinen Ermessensspielraum und keine Verhältnismäßigkeit.
»Wir sind schon tot«, sagte der Mann, »du und ich«, öffnete weit die Arme und verwies auf die hohen Felswände, die sie wie ein Grab umschlossen. »Unsere Seelen sind die Seelen von Gescheiterten«, sagte er voller Entzücken.
Dann löste sich der Schuß an diesem sonnenlosen, sternlosen, zeitlosen Ort, und da war der Mann schon über dem Hals der Fuchsstute zusammengebrochen. Das Pferd stieg hoch, und der Reiter rutschte von seinem Rücken und schlug schwer auf dem Boden auf, als wäre er aus großer Höhe herabgeschleudert worden. Beim Fall auf den schneebedeckten Boden vollzog er eine Drehung und rollte sich ab, landete auf der Schulter und sackte mit einem Schmerzensschrei auf den Rücken.
Erst in diesem Augenblick war zu hören, wie der Schuß die Luft zerriß, den Robey abgegeben hatte.
Ehe er abstieg, lenkte er den Hengst einen Schritt nach vorn, und Roß und Reiter standen über dem am Boden liegenden Mann. Die Kugel war in seine Brust eingedrungen, aber nicht wieder ausgetreten. Sie hatte die Knochen durchschlagen und steckte in der Schulter fest. An der Stelle, wo sein Schädel auf dem steinigen Weg aufgetroffen war, lief ein dünnes Rinnsal aus Blut an seinem Gesicht entlang. Ein unablässiges Stöhnen war alles, was der Verletzte seinen unerträglichen Schmerzen entgegensetzen konnte. Er atmete schwer, ein Durcheinander gleichlautender Botschaften drang auf ihn ein. Im Todeskampf schwanden seine weltliche und geistige Macht, schwanden Düsternis und Bedrohung und die dunkle Energie, die sein Leben beherrschte.
»Volltreffer«, keuchte er und senkte den Blick auf die Blasen, die aus seiner Brust quollen.
»Glaubst du?« sagte Robey. Er stieg ab und beugte sich über ihn.
»Ja, das glaube ich.«
Blut füllte die roten Äderchen in seinen glasigen Augen. Seine bleichen Lippen versuchten Worte zu formen, aber er brauchte mehrere Anläufe. »Sollte ich nicht?«
»Doch.«
»Sag ihr, die Frau ist tot. Sie muß es wissen.«
»Gar nichts werde ich ihr sagen«, sagte Robey.
»Mein Kopf ist so schwer«, sagte der Mann. »Wie Blei.«
Dann folgten keine Worte mehr, und sie verharrten schweigend. Er überlegte, ob er seine Taten bereuen sollte. Hatte er nicht langsam genug Beiträge zum sinnlosen Töten in der Welt geleistet? Egal, wie gerechtfertigt seine Taten waren. Hatte er nicht das Leben von Menschen genauso beendet wie andere das Leben seines Vaters beendet hatten? Er dachte an Schuld, wollte sie auf sich laden, aber sie wollte weder seinen Verstand noch sein Herz erfüllen, blieb weiterhin an einem abgegrenzten Ort, irgendwo in ihm. Hatte er beim ersten Mal auch sich selbst getötet, und war er also bereits tot?
Als er sein Werk beendet hatte, schwang er sich auf den Glanzrappen, griff nach den Zügeln der Fuchsstute und ritt nach Hause. Auf dem engen, steinigen Weg hatte er das Gefühl, daß nun ein Stück Niedertracht verschwunden war, aber was sie hinterließ, konnte er nicht ungeschehen machen und auch nicht vergessen.
Er sah helles Licht aus den Fenstern vor sich scheinen. Er dachte, daß die Niedertracht auch in seinem eigenen Haus weiterlebte, und da man sie bei ihrer Geburt nicht töten konnte, mußte man sie bedingungslos lieben. Er wünschte sich, erschauern zu können. Er wünschte sich, seine Taten bedauern zu können, und klagen und weinen. Er wünschte sich die Vergangenheit zurück, als er noch ein Kind war und wie ein Kind lebte.
Aber nichts davon war möglich. Seine Vergangenheit war ein Schattenspiel erinnerter Szenen. Er hatte keine Vergangenheit, er war zu jung. Alles, was er hatte, war die Vergangenheit eines Kindes: Hunger und Zufriedenheit, Hitze und Kälte, Naß und Trocken, gelbe Vierecke aus Licht auf dem Holzboden, Tiere als Spielgefährten, die Liebe einer Mutter und eines Vaters. Da gab es keine Gewissensbisse und auch nicht den Wunsch, das Leben anzuhalten und es noch mal anders zu gestalten. Mit solch wirren Gedanken und Gefühlen wollte er nichts zu tun haben. Das war der Gemütszustand, in dem er durch den Abenddunst nach Hause ritt, fort von dem Mann, den er unter dem aufgehenden Mond getötet hatte.
In dieser Nacht kam sie barfuß ins Wohnzimmer, in dem er saß. Das einzige Licht war der schwache Schein der Talgkerze, die auf dem Eßtisch stand.
»Was ist los mit dir?« fragte sie.
»Kannst du nicht schlafen?« fragte er zurück.
»Meine Augen wollen nicht zugehen«, sagte sie.
Sie reckte sich, so weit ihr Körper sich dehnen ließ, dann stieß sie einen überraschten Laut aus und ließ locker. Sie kam auf ihn zu und klopfte ihm auffordernd auf die Knie, wollte sich darauf setzen. Sie sah aus wie ein Kind mit ihren langen Wimpern, die sich bei jedem Lidschlag miteinander verwoben und dann wieder voneinander lösten. Eingehend betrachtete sie die Innenfläche ihrer kleinen Hände und legte sie dann hilflos auf ihren runden Bauch.
»Du solltest Strümpfe anziehen«, sagte er. »Es ist kalt in der Nacht.«
»Das stimmt«, antwortete sie, und wie zur Bestätigung drückte eine Windböe einen Schwall Schnee gegen die Holzwände.
»Das ist die Kälte, die Wärme hervorbringt«, erklärte er, und sie erzählte ihm, daß seine Mutter ihr heute das gleiche gesagt hatte.
Er fragte sich, wie es ihr jetzt wohl ging. Sie schien sich beruhigt zu haben. Würde er es ihr sagen? Mußte er es ihr nicht sagen?
»Wie stellst du dir den Himmel vor?« fragte sie drängend. »Glaubst du, wir werden durch die Hoffnung erlöst?«
»Ich weiß nicht«, sagte er. »Ich hab heute nacht keine solchen Antworten, und auch keine solchen Fragen.«
»Betest du?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Also, falls du damit anfangen willst, tu es nicht an einem Ort, wo ich dich hören kann.«
»Ich werd’s mir merken.«
»Was ist los?« fragte sie. »Willst du’s mir nicht sagen?«
»Ich hab ihn gesehen«, sagte er, und sie schaute ihn mit großen, klaren Augen an.
»Du hast ihn gesehen?«
»Er hat mir gesagt, die Frau ist tot.«
»War es schlimm?«
»Er hat nichts gesagt, und ich hab nicht gefragt.«
»Wo hast du ihn gesehen?«
»Dahinten auf dem Weg. Er ist auch tot.«
Sie wandte den Blick ab, versenkte ihn in sich selbst. Er sah, wie ein innerer Sturm ihre Lider zucken ließ. Sie war voller Rätsel, die er nicht verstand.
»Bist du sicher, daß er tot ist?«
»Er ist tot«, wiederholte er mit fester Stimme und merkte doch, daß dieser Mann noch als Toter, leblos und bezwungen, sie verfolgen und nie mehr aus seinen Fängen lassen würde. Er fragte sich, ob es jemals genug Frieden geben konnte, damit die Wunde in ihr heilen würde.
Der Druck im Zimmer nahm zu, als würde die Luft durch die Ritzen und Laibungen hereingepreßt. Der Ofen begann wieder zu bollern, als das Feuer heißer wurde und Erinnerungen an Gettysburg auftauchten, das Tor, durch das die Vergangenheit in die Gegenwart gelangen konnte. Das Metall des Ofens dehnte sich mit einem leisen Ticken aus, und ein Holzbalken in der Wand knarrte in der Verzapfung. Draußen tobte der Wind, und am Morgen würden die Felder schneeverweht sein, der Boden an manchen Stellen nackt und seltsam grasgrün und an anderen Stellen mannshoch von Schnee bedeckt.
»Seine Seele war tiefschwarz«, sagte sie, als wäre ihr die Nachricht von seinem Tod schon vor langer Zeit überbracht worden.
Sie streckte die Hand vor und öffnete den Mund, doch es kamen keine Worte. Seit Tagen kämpfte sie darum, die Stärke zu finden, mit der sich der Schmerz ertragen ließ. Sie versuchte verzweifelt, ihn zum Verstummen zu bringen. Schon seit Tagen spürte sie, wie sich die winzigen Knochen verschoben und neue Positionen einnahmen. Sie betete um Kraft, um viel Kraft, aber die hatte sich noch nicht eingestellt. Plötzlich stöhnte und schrie sie auf, als ihr Bein von einem Krampf geschüttelt wurde. Sie streckte das Bein in die Luft, bis sich die Muskeln, die unter der Haut zuckten, schließlich beruhigten. Das Kind war jetzt bereit, auf die Welt zu kommen, und sie war die einzige, die das wußte.
»Wenn der Schmerz kommt, ist er schlimmer als Messerstiche«, sagte sie. »Ich will sterben.«
Dann bat sie ihn: »Heb mich hoch«, und als er es tat, sagte sie: »Komm ins Bett«, und er folgte ihr. Sie forderte ihn auf, sich hinter sie zu legen und die Handknöchel gegen ihren Rücken zu drücken.
»Nicht reiben«, sagte sie mit hauchdünner Stimme, »nur ganz fest drücken. Drück mit der Faust, so fest du kannst.«
Als der Schmerz nachließ, wollte sie, daß er sie in die Arme nahm und sanft schaukelte. Er drückte sein Gesicht an ihren Nacken und sog ihren verschlafenen Duft tief in sich ein. Sie drängte sich mit dem Rücken an seinen Brustkorb, zog seine Arme um sich und legte seine Hand auf ihre Brust. Es war so gut wie nichts mehr übrig von ihr, kein Rücken, keine Schultern und kein Brustkorb, sie war nur noch Bauch. Sie legte seine Hand darauf, auf die straffe, gespannte Haut, und ineinander verschlungen fielen sie beide in einen ermatteten Schlaf.
Er wußte nicht mehr, wann er eingeschlafen war, aber als er aufwachte, wollte er, noch im Halbschlaf, ihr automatisch wieder die Faust in den Rücken drücken. Doch seine Hand tastete ins Leere, und als er sich ganz vom Schlaf befreit hatte, fand er sie nicht, und das Bett war naß und kalt. Er stand auf und spülte mit einem ersten Schluck Wasser den Geschmack des Schlafes aus dem Mund und mit dem zweiten Schluck den Durst hinunter, den die trockene Hitze des Holzfeuers verursacht hatte. Er dachte, er würde sie hier im Dunkel rasch entdecken, doch er fand sie nicht.
Er rief nach ihr, zog die Decke vom Bett und rannte barfuß zur Tür.
Die Nacht war leuchtend blau und überzog die Welt mit einem Laken schneidenden Winterlichts. Er hörte, daß die Mutter aufgewacht war und nach ihm rief. Die Kiefern im Wald trugen Schneemäntel, und aus den Scheunen und Ställen drang eine seltsame, gelassene Stille. Er rief ihren Namen in die Nacht, und der Klang seiner Stimme verlor sich langsam auf dem Weg zur schneebedeckten Anhöhe.
»Rachel«, rief er. »Rachel!«
Er spürte das Stechen der Kälte in seiner Lunge. Sein Herz hämmerte in der Brust, doch sie antwortete nicht. Am Himmel sah er den Pegasus genau im Westen, und der Große Wagen stand aufrecht auf seiner Deichsel. Über sich sah er die Flugsilhouette einer Eule, ihren weit ausholenden Flügelschlag. Er blickte ihr nach in die Richtung, in der sie verschwand.
Dann sah er sie im schwachen Licht des Mondes, am Ufer des kleinen Bachs. Sie hatte sich zu einer Stelle geschleppt, die nicht gefroren war und über der Nebel aufstieg, wo heißes Wasser aus der Erde sprudelte. Sie zitterte und stöhnte, und er rannte auf sie zu. Als sie ihn kommen sah, stand sie auf, streckte eine Hand vor und rief: »Laß mich sterben«, aber Schmerzensschreie verzerrten ihre Worte. Er rannte weiter auf sie zu, im Schlepptau die Decke, die er vom Bett gezogen hatte. Sie hob abwehrend die Hände, wollte nicht, daß er näher kam, und als er es doch tat, drehte sie sich um und ließ sich in das warme Wasser fallen.
Er sah ihre Beine weiß schimmern. Er rannte über den gefrorenen Boden bis dicht zu der nebelverhangenen, dampfenden Quelle. Dann richtete sie sich wieder auf, und ihr nasses Hemd glänzte im Mondlicht. Sie setzte einen Fuß in den Strudel, wo der Bach um einen Felsbrocken wirbelte, einen kühlenden Bogen zog und schneller wurde, um schließlich in die Tiefe zu stürzen.
Hier ließ sie los, was sie festhielt, und er sah ein kleines weißes Bündel, das von der seichten Stelle weg in die Strömung gezogen wurde. Erst eins und dann noch eines, und die beiden tanzten im Wasser wie winzige Kürbisse, das zweite hinter dem ersten.
Als die Strömung die beiden auf und ab tanzenden Bündel auf den Wasserfall zutrieb, stürzte er sich in das seichte, von der Geburt befleckte Wasser. Er warf sich entschlossen hinein, so daß es hoch aufspritzte, das Wasser schloß sich hinter ihm rasch wieder, und die Strömung nahm ihn mit. Dann stand er auf, rannte ein paar Schritte und tauchte wieder ein, schwamm weiter und packte sie mit den Händen, erst das eine und dann das andere, die winzigen roten Gesichter stumm und verzerrt von dem unvorstellbaren Schrecken, zur Welt gekommen zu sein.
Als er sie trösten wollte, schien sie nichts von ihm wissen zu wollen. Sie drehte ihm den Rücken zu, und ihre Haltung war eine einzige Frage: Warum? Warum hast du das getan? Warum hast du sie gerettet? Wer hat dir das Recht gegeben, das zu tun?
Sie sagte: »Ich will dich hassen für das, was du getan hast, will dich genauso hassen wie den, der mir das angetan hat«, doch er gab keine Antwort.
In den ersten Tagen stellten sich keine Muttergefühle bei ihr ein, aber seine Mutter ließ nicht locker, und schließlich gab Rachel nach und ließ sie an ihren Brüsten saugen. Es waren zwei kleine Jungen, mit feinen, flauschigen Haaren am Rücken und an den Schultern und auf den seltsam geformten Köpfchen. Ihre winzigen Gesichter sahen aus wie die von alten Männern, und sie trommelten mit den Fäusten in die Luft und schrien aus voller Lunge und ganzem Herzen. Rachel weigerte sich, ihnen Namen zu geben, und auch ihnen war es egal, denn dafür war noch viel Zeit.
Dann wurde es noch kälter, und der eisige Regen ging in Schnee über, der tagelang liegenblieb. In diesem Jahr schien der Winter hier oben kälter und länger zu sein als jemals zuvor. Wie ein grenzenloses Meer hielten Schnee und Kälte die schlafende Erde umklammert, und die spitzen Kiefern schüttelten sich im johlenden Wind.
Am Himmel hing eine weiße Sonne, und er sah das verzweifelte Glitzern weit entfernter Sterne, das letzte Aufbäumen erkaltender Gestirne. Draußen vor den kerzenerleuchteten Fenstern lagen die Felder unter ihrer weißen Hülle in tiefem, erwartungsvollem Schweigen.
In diesen Tagen des schneeverhangenen Dunkels hielt ihn ein eiserner Schlaf im Griff, ein sinnloser, namenloser, friedlicher Schlaf, und erst später merkte er, daß der Strom der Zeit weitergeflossen war, spürte, daß sich sein Innerstes langsam entspannte. Er war einen ersten Tod gestorben und dann einen zweiten und einen dritten. Er wußte, daß er in diesem Leben noch nicht fertig war mit Tod und Töten.
Es war die Welt eines Schlafenden, eine überfrorene, stille Welt, dunkel und wunderschön, und er erinnerte sich an ein tiefes Gefühl von Ruhe und Frieden.
Er erinnerte sich an die Tage, als er auf dem Glanzrappen durch das Tal ritt. Daran, wie ihm das Pferd den Kopf zuwandte, als er die Zügel anzog, an den heißen Atem, der ihm entgegenschlug, an die Bäche von Schweiß auf dem schlanken schwarzen Hals und an die kleinen Schaumblasen vor den bebenden Nüstern.
Er erinnerte sich an seinen Vater und an die Toten. Daran, daß sich nichts regte im Dunkel dieser Nächte, nur einmal war er von lautem Geschrei aufgewacht und sah Rachel, die erst ein Baby in den Armen wiegte und es stillte und dann das andere, und als sie damit fertig war, legte sie sich neben ihn, drückte ihren Bauch an seinen Rücken und das Gesicht an seinen Nacken.
Er erinnerte sich, wie sie ihren Arm über seinen Brustkorb schob und wie er mit der Hand sanft ihr Handgelenk umschloß. Schlaf, hatte er gedacht, schlaf noch ein bißchen weiter.
ROBERT OLMSTEAD, geboren und aufgewachsen auf einer Farm in New Hampshire, unterrichtet Kreatives Schreiben an einem amerikanischen College, hat aber auch schon als Tellerwäscher, Teppichleger und Englischlehrer gearbeitet, Vieh gezüchtet und eine Baufirma betrieben. Außerdem ist er Autor zahlreicher, von der Literaturkritik hochgelobter Romane, von denen u. a. Spuren von Herzblut, wohin wir auch gehen (1994) und Geh nicht fort. Eine Erinnerung (1997) ins Deutsche übersetzt wurden.
DER GLANZRAPPE von Robert Olmstead ist im Juli als zweihundertdreiundachtzigster Band der ANDEREN BIBLIOTHEK im Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, erschienen. Die Originalausgabe erschien bei Algonquin Books of Chapel Hill, New York, unter dem Titel: Coal Black Horse.
Die Übersetzung ist Edith Nerke und Jürgen Bauer zu verdanken. Das Lektorat lag in den Händen von Palma Müller-Scherf.
Die Übersetzer danken Anthony Tranter-Krstev für seine wertvolle Hilfe.
DIESES BUCH wurde in der Lapture gesetzt und beim Memminger MedienCentrum auf 100g/m₂ holz- und säurefreies mattgeglättetes Bücherpapier der Papierfabrik Schleipen gedruckt. Den Einband besorgte die Buchbinderei Lachenmaier, Reutlingen. Typographie und Ausstattung: Christian Ide und Lisa Neuhalfen.
1.-6. Tausend Juli 2008
Dieses Buch trägt die Nummer:
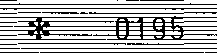
ISBN 978-3-8218-4592-0
Copyright © 2007 by Robert Olmstead
Copyright © für die deutsche Ausgabe:
Eichborn AG, Frankfurt am Main