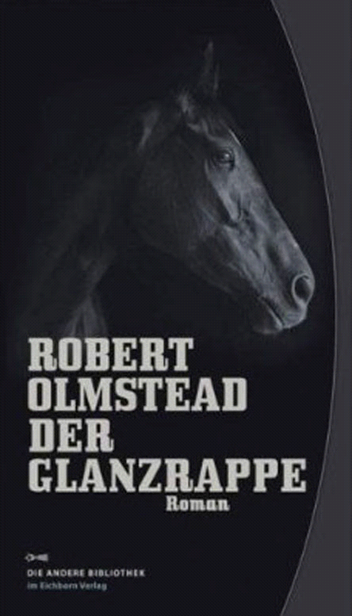

DIE ANDERE BIBLIOTHEK
Begründet von Hans Magnus Enzensberger
Herausgegeben von
Klaus Harpprecht und Michael Naumann
Robert Olmstead
DER GLANZRAPPE
Aus dem Amerikanischen übersetzt von
Jürgen Bauer und Edith Nerke

Eichborn Verlag
Frankfurt am Main
Hast du dem Roß Stärke verliehen
und seinen Hals mit der flatternden Mähne umhüllt?
Es scharrt den Boden mit Ungestüm ...
BUCH HIOB
1 AM ABEND DES 10. MAI 1863 ,
eines Sonntags, rief Hettie Childs ihren Sohn Robey zurück ins Haus. Er war bei den alten Feldern, strich auf der hohen Wiese am Weidezaun entlang, wo die Rinder standen und an den Halmen des frischen Frühlingsgrases zupften, das aus der Mahd am Rand der Weide hervorschaute.
Robey hatte einen schlurfenden Gang, breitbeinig und mit wiegenden Schultern. Seine Hände waren schon richtige Männerhände, kantig und mit langen Fingern, und sein Haar fiel weich auf die Schultern herab. Er war noch ein Junge, noch nicht ausgewachsen, aber in letzter Zeit hatte er wiederholt heftige Schübe gehabt, einmal mehr als zwei Zentimeter in einer Nacht. Am nächsten Morgen hatte er sich gefühlt, als käme er von der Streckbank; sein Körper hatte so geschmerzt, daß er einen Schrei ausstieß, als er sich aufsetzte.
Die Hunde rappelten sich hoch, und die Mutter fragte, was ihn quäle. In letzter Zeit fehlte ihr die Geduld für die unklaren Bedürfnisse von Jungen und Männern, für deren überstürztes Handeln bei Dingen, die sie weder verstehen noch benennen konnten. Für sie waren Männer nichts anderes als trockenes Wetter oder ein überraschend aufziehender Sturm ohne Regen. Sie kamen und gingen, sie erlitten Schmerzen, und sie verursachten Schmerzen. Männer lachten verhalten und weinten still, als folgten sie einem fernen Ruf. Sie blieben ihr Leben lang kindisch, waren lieb und unbeherrscht und nahmen Geräusche so wahr, wie Hunde es tun. Sie waren wie der Mond, zeigten alle acht Tage ein anderes Gesicht.
Robey kratzte sich am Kopf und wickelte sich eine Haarsträhne um den Finger. Ihm war, als wäre er in der Nacht von Phantomen gepackt und ein ums andere Mal herumgewirbelt worden, als hätte sich sein Körper in Krämpfen verzerrt.
Er wußte nicht, was mit ihm los war, und er verstand nicht, was sich in ihm abspielte, er glaubte aber, daß es nur ein Zustand war, etwas Vorübergehendes, nichts von Bedeutung, und daß es einfach etwas Geduld brauchte und schon wieder wegginge. So sagte er es seiner Mutter.
»Das denk ich auch«, erwiderte sie.
Als er an diesem seidig kühlen Frühlingsabend am Weidezaun entlanglief, klapperte er mit einem Walnußstecken gegen die silbrig grauen, rissigen Zaunlatten. Er dachte an seinen Vater, der in den Krieg gezogen war. Der Vater, immer nur ein Gedanke, ein Wort, eine Geste entfernt. Er sprach laut mit ihm, stellte ihm Fragen und erzählte ihm etwas. Er sagte ihm vor dem Einschlafen gute Nacht und nach dem Aufwachen guten Morgen. Er hätte sich nicht gewundert, ihn gleich hinter der Ecke auf einem Hocker sitzen zu sehen, vielleicht schon bald, vielleicht schon in diesem Augenblick. Robey war hier oben am Berg geboren, in dem Zimmer, in dem seine Eltern ihn gezeugt hatten, aber sein Vater hatte immer behauptet, er wäre nicht ihr Kind, sie hätten ihn gefunden. Ein Findelkind, das in der Zisterne schwamm, in der Krippe auf dem Stroh lag, hinter dem Kuhstall auf einem Kürbis saß.
In der Luft über seinem Kopf stand eine Wolke frisch geschlüpfter Eintagsfliegen, flüchtige flirrende Wesen, die mit ihren durchsichtigen Flügeln den Abendhimmel fältelten. Vor einer knappen Stunde hatte er sie aufsteigen sehen wie eine Engelsschar, deren Augenblick gekommen war. Sie waren aus dem Bach emporgestiegen, wo sich das Wasser sprudelnd unter einem Felsspalt sammelte, um dann in einem silbrigen Bogen zwischen den vielen Felsbrocken hindurch die Weide zu nässen und schließlich über eine Felskante hinabzustürzen. Da hörte er die sorgenvolle Stimme seiner Mutter.
Als er von der hohen Wiese herabkam, standen ihr die Hunde als Wachposten zur Seite, die schlanken Körper an sie gepreßt.
Sie sprach leise, und als er nicht zu verstehen schien, sagte sie noch einmal mit Entschiedenheit in der Stimme: »Thomas Jackson ist tot.«
»Es ist vorbei«, sagte sie, ohne ihn anzuschauen oder gar seinen Blick zu suchen; sie schien etwas weit in der Ferne Liegendes zu fixieren. Ihre Stimme war tonlos, verriet nichts von dem, was in ihr vorging. Ihre Gesichtszüge waren beherrscht wie bei einem Menschen, dem etwas Unwiderrufliches zugestoßen war. Jacksons Tod war eine unabänderliche Tatsache, mehr gab es dazu nicht zu sagen.
Er umfaßte sein knochiges Handgelenk und scharrte mit den Schuhen, als würde ihm das helfen zu begreifen. Er wartete geduldig, weil er wußte, wenn sie soweit war, würde sie es ihm erklären.
»Thomas Jackson ist tot«, wiederholte sie schließlich. »Es hat keinen Sinn mehr.«
Sie hielt inne und suchte nach Worten. »Es war ein Fehler, und wir haben lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber es war ein Fehler. Reite los und finde deinen Vater, hol ihn zurück nach Haus.«
Ihre Worte drangen wie durch den Wind der Zeiten an sein Ohr, Worte einer alten Mutter, einer alten Frau.
»Wo soll ich ihn suchen?« wollte er wissen, zog die Schultern zurück und nahm Haltung an.
»Reite nach Süden«, sagte sie. »Dann nach Osten ins Tal hinunter und flußabwärts weiter nach Norden.«
Sie hatte ihm eine leichte, enganliegende Offiziersjacke aus Leinen genäht, mit den Tressen eines Korporals und Knöpfen aus gebleichten Hühnerknochen. Sie sagte, er solle unbedingt noch in dieser Nacht losreiten und nicht herumtrödeln, damit er den Vater bis spätestens Juli fand.
»Bis Juli mußt du ihn gefunden haben«, sagte sie.
Er dürfe auf keinen Fall sein Pferd verlieren, und wenn er jemandem begegnete, solle er sagen, er sei ein Kurier, ganz hastig solle er das sagen, als müßte er dringend weiter. Ansonsten solle er den Mund halten und die Ohren aufsperren, wie jetzt auch. So würde er alles erfahren, was er wissen mußte. Dann sagte sie, daß es Männer gebe, welche die Erde, das Wasser und die Luft mit Schrecken erfüllten, und er würde diesen Männern auf seiner Reise begegnen, und sein Vater sei einer von ihnen. Sie hielt rasch inne, musterte ihn und sagte, ohne daß es wie ein Urteil klang, er werde vielleicht eines Tages auch einer von ihnen sein.
»Gib acht, von wem du Hilfe annimmst und von wem nicht«, riet sie ihm. Dann fügte sie mit kaltem Blick hinzu, aber wenn er ganz sicher gehen wolle, dürfe er von niemandem Hilfe annehmen.
»Trau niemandem«, sagte sie. »Keinem Mann, keiner Frau und keinem Kind.«
Die Jacke war auf einer Seite graubraun, mit Eisensulfat und Walnußschalen gefärbt. Als sie sie wendete, war sie blau und trug ähnliche Rangabzeichen. Sie sagte, damit solle er sich immer auf die richtige Seite schlagen und keiner von beiden trauen.
»Besorg dir so bald wie möglich ein Schießeisen, am besten mehrere«, sagte sie. »Und gib acht, daß sie immer geladen sind. Wenn du auf jemanden schießen mußt, ziel auf den Rumpf, und wenn deine Pistole leer ist, wirf sie weg, und nimm die von dem, den du erschossen hast. Wenn du denkst, daß jemand auf dich schießen will, überleg nicht lang: du mußt als erster schießen.«
Ihre Stimme wurde nicht lauter und verriet keine Panik. Sie gab ihm ruhig und bestimmt ihre Anweisungen, als wäre endlich der Augenblick dafür gekommen und sie spräche jetzt nur Worte aus, die sie sich schon vor langer Zeit zurechtgelegt hatte.
»Jawohl, Mutter, als erster schießen«, wiederholte er langsam ihre letzten Worte.
Die Hunde zitterten und winselten und klackten mit den Kiefern.
»Denk daran, wenn man der Gefahr ins Auge schaut, zieht sie an einem vorbei«, sagte sie und legte ihm ihre Hände auf die Schultern.
Er dachte auch an das, was sie ihm gesagt hatte, als er zwölf war. Er sei nun alt genug, um das Land zu bestellen, aber noch nicht alt genug, um dafür zu sterben. Um für sein Land zu sterben, müsse er mindestens vierzehn sein. Jetzt war er vierzehn.
Nachdem sie ihm ihre Anweisungen gegeben hatte, schöpfte er einen Eimer eiskaltes Wasser aus dem Brunnen und wusch sich damit den Oberkörper. Dann rieb er sich mit einem Handtuch ab und faltete ein sauberes Leinenhemd auseinander. Er zog eine schwarze Baumwollhose und die festen Lederschuhe seines Vaters an, die mit den flachen Absätzen, und schlüpfte in seine Offiziersjacke. Die Ärmel reichten nicht bis an seine Handgelenke, aber die Hosenbeine bildeten eine Ziehharmonika auf den Schuhen. Er zupfte an den Ärmeln und zog an den Knöpfen, um die Jacke über der Brust schließen zu können.
Seine Mutter meinte, er sei ganz schön in die Höhe geschossen, als wäre das etwas Rätselhaftes. Auf seinen Wangen erschienen rote Flecken, als er aus ihrer Stimme die Zärtlichkeit einer Mutter heraushörte, doch sie blieb reserviert und änderte ihre Meinung nicht, schlug auch nicht vor, daß er erst noch essen und schlafen und sich bei Tagesanbruch auf den Weg machen solle.
Nach einer langen, gefaßten Pause richtete sie den Blick auf ihn, schenkte ihm aber kein Lächeln. Sie reckte sich, und er beugte sich zu ihr hinab. Zögernd berührte sie sein Gesicht und strich ihm sanft über die Wange und den Hals, wie eine Blinde, die mit den Fingern sieht. Als sie einen Knopf in die Hand nahm und daran zog, hatte er das Gefühl, sie würde ihm etwas aus der Brust herausziehen.
In diesem Augenblick wurde ihm klar, wie traurig und sinnlos seine Reise sein würde. Seine Mutter schickte ihn dem eigenen Tod entgegen. Sie sah das sicher genauso, und doch konnte sie nicht anders. Selbst wenn er wiederkäme, würde sie sich nie verzeihen, daß sie das Leben ihres Sohnes aufs Spiel gesetzt hatte, um das des Vaters zu retten.
»Zieh die Jacke wieder aus«, entschied sie sich anders und half ihm, sie aufzuknöpfen und von den Schultern zu streifen. »Bleib ein Junge, so lange es geht. Das ist eh nicht mehr lange. Zieh sie an, wenn du merkst, daß es soweit ist.«
»Ja, Mutter.«
»Du wirst nicht sterben«, sagte sie, aber ihr Gesichtsausdruck blieb düster.
»Nein, Mutter.«
»Du wirst zurückkommen.«
Plötzlich glänzten ihre Augen wieder, als sähe sie hinüber in ein anderes Leben.
»Ja, Mutter, ich werde zurückkommen«, sagte er, den Blick durch die offene Tür hinaus ins Schwarze gerichtet.
»Versprich es mir«, sagte sie und zwang ihn zur Aufmerksamkeit.
»Ich verspreche es.«
»Dann warte ich hier auf dich«, sagte sie und hob die andere Hand an sein Gesicht, zog es an sich und drückte ihm einen Kuß auf die Lippen.
Dieser Kuß war der einzige Augenblick, in dem sie Zweifel an dem bekam, was sie von ihm verlangte. Es war, als hätte jemand seine segnende Hand auf sie gelegt. Er wartete darauf, daß sie noch etwas sagte, doch sie blieb stumm. Er spürte, wie ihre Tränen sein Gesicht benetzten.
Sie gab ihm einen weiteren, dringlicheren Kuß, und beide wußten, daß sie ihn jetzt gehen lassen mußte, und dann ließ sie ihn gehen. Er trat zur Seite, winkte ihr ein letztes Mal zu und ging zur Tür hinaus.
Draußen, in der wohltuend kühlen Bergluft, wandelte sich der Abend bereits zur Nacht. Die Berührung der Mutter lag noch wärmend auf seinem Hals, seine Lippen waren noch heiß von ihrem Kuß. Er zäumte ein stämmiges graues Pferd mit perlmuttfarbenen Augen, legte den Sattel auf und ritt davon, hinaus in das Dunkel, das die Copperhead Road einhüllte. Bei einem Blick zurück hätte er nicht seine Mutter gesehen, sondern die Hunde, die in der offenen Tür saßen und kaum wahrnehmbar ruhig und gleichmäßig atmeten.
Es dauerte die halbe Nacht, bis er sein Zuhause, die hohe Wiese und die alten Felder hinter sich gelassen hatte und hinabritt durch das hügelige Land in die kalte feuchte Talsenke und weiter durch die nächtlichen Flußnebel. Die Bäume und Felsvorsprünge, unter denen er durchritt, verdeckten das Licht der Sterne. Die Nacht war ungewöhnlich still, und das Licht des Mondes, der immer wieder hinter den dahintreibenden Wolken verschwand, wirkte unheimlich. Doch wenn das Mondlicht durchdrang und die Mulden erhellte, war Robey eine Zeitlang in weißes Licht gebadet, und das Gestein um ihn sah aus wie Spiegelglas. Dann war es so hell, daß er die Linien in seiner Hand und die Rillen auf den Fingerkuppen erkennen konnte.
Er war noch ein Junge, und wie alle Jungen war er fasziniert davon, wie das Licht ins Dunkel eindringt, wie das Wasser friert und das Eis schmilzt, wie das Leben weg sein kann und auf einen Schlag wieder da. Wie manche Dinge jahrelang da sind, ohne je zu existieren. Er dachte, wenn die Welt wirklich rund war, dann stand er immer genau in der Mitte. Er dachte, jetzt wird der Frühling zum Sommer, und ich reite nach Süden, dem Sommer entgegen. Er dachte, daß sein Vater immer gern gereist war, und auch er hatte schon als Kind davon geträumt, unterwegs zu sein, und jetzt war er unterwegs, unterwegs ins Ungewisse.
Er ließ die freie Hand durchs Dunkel schwingen, hob sie hoch zum Himmel und packte einen flackernden roten Stern. Der Stern war warm und pulsierte in seiner Hand wie das Herz eines Froschs oder eines Singvogels. Er streichelte den Stern, ließ ihn über seine Handfläche gleiten und führte ihn zum Mund, und er schmeckte nach Zucker, als er ihn hinunterschluckte.
AM NÄCHSTEN MORGEN
gab es keinen Sonnenaufgang. Der Himmel im Osten rötete sich nicht, nur das Dunkel verlor an Intensität, wurde nach und nach von Schwarz zu Grau. Die frühen Morgenstunden waren erfüllt vom Rufkonzert der Waldfrösche an den Teichufern. Ein pfeilförmiger Stärlingsschwarm auf dem Weg nach Norden zog über den Nachthimmel. Von den Felsvorsprüngen tropfte eisiges Wasser. Irgendwo tief im Schutz des Lorbeergestrüpps warnte ein Hirsch seine Herde.
Die tiefen Schluchten, durch die er jetzt ritt, erschienen mit ihren engen, hoch aufragenden Wänden wie Gräber, die sich bald schließen würden. Die Wege waren feucht und die Steine glitschig. Mehr als einmal rutschte die kräftige Stute ab, und er drückte die Beine fest gegen ihren Rumpf, um ihr ein wenig Sicherheit zu geben. Doch das verängstigte Pferd blieb steifbeinig stehen und tat keinen Schritt mehr. Als er geduldig im Sattel sitzen blieb und ihr beruhigende Worte in die zuckenden Ohren flüsterte, ging sie nach einer Weile schnaubend weiter.
Der Weg führte Meile um Meile hinab in üppiges Frühlingsgrün. Er ließ die Füße aus den Steigbügeln gleiten und lehnte sich weit zurück, den Kopf über der Kruppe des Tiers. Er hätte sich nicht vorstellen können, diesen Weg während der Schneeschmelze im Dunkeln herunterzukommen, aber in dieser Nacht hatte er genau das getan.
Als er am Morgen die Brücke erreichte, fühlte er sich, als käme er von einer langen Reise zurück, die außerhalb der Welt begonnen hatte. Nur noch eine verschwommene Erinnerung an seine Mutter und sein Zuhause begleitete ihn, und er war mit einem Mal besorgt, daß sie völlig verschwinden würde, sobald er die Brücke überschritten hätte. Er drehte sich im Sattel um und sah zurück zu dem Ort, von dem er kam, zornig darüber, wie weit entfernt, wie trutzig und abgeschieden er war. Wie konnten eine Nacht und ein paar Meilen plötzlich so lang sein? Wie konnte ein Ort so eigenartig und selbstherrlich sein, daß er einem die Erinnerung an ihn verweigerte, sobald man ihn verlassen hatte?
Seine Augen waren feucht, und in seiner Brust pochte es, ohne daß er wußte, warum. Er rieb seine brennenden Augen und schickte einen grundlosen Fluch in die Morgendämmerung, den Fluch eines Jungen, dem eine Aufgabe aufgetragen wurde. Auch wenn er diese Aufgabe insgeheim sogar erledigen will, flucht er doch unwillkürlich über diese Fremdbestimmung. War er zuvor Herr seiner Zeit gewesen, so gehörte sie ihm jetzt nicht mehr. Er wurde in die Welt hinausgeschickt, mit gerade einmal vierzehn Jahren und ohne wirklich zu wissen, wie es in der Welt zuging.
Als er über die Brücke ritt, öffnete sich das Land vor ihm wie ein flaches Band, das auf einem befestigten Weg ausgerollt wurde. Die Luft wurde dichter und war erfüllt vom Geruch verrottenden Laubs und aufbrechender Knospen. Wasserrauschen drang an seine Ohren, wurde schwächer und dann wieder stärker, als sich der Twelve Mile Creek nach einem Knick in den aufgewühlten Canaan River ergoß. Er ritt weiter nach Südosten, dem Tosen des Frühjahrshochwassers entgegen, das die Steine in dem engen Flußbett gegeneinanderstoßen ließ.
Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und nichts gegessen und fühlte sich schwach und zerschlagen. Die Landschaft wurde immer breiter, und das stämmige Pferd wurde müde, schnaufte schwer und zitterte. Der steinige Weg wurde für die unbeschlagenen Hufe immer schmerzhafter. Dann stolperte die Stute, verharrte und wollte nicht mehr weiter. Sie schnaubte und warf den Kopf zurück, schleuderte Schaum vom Maul in die Luft. Er stieß ihr die Hacken in die Seite und gab ihr einen Klaps auf den Rumpf, doch sie bewegte sich nicht. Plötzlich legte sie den Kopf schräg, richtete die Ohren ruckartig nach vorn und zog sie wieder zurück.
Dann hörte er, wonach sie lauschte – den hellen Klang eines Hammers auf einem Amboß. Vor ihnen befand sich ein kleines Dorf, auf dem Weg zu den Greenbrier Mountains gelegen, mit dem Krämerladen des alten Morphew. Robey drängte die Stute nicht weiter, sondern wartete ab, bis sich ihre zitternden Muskeln entspannt hatten und das Fell wieder glatt war. Erst dann stieg er aus dem Sattel. Er streichelte ihren weichen Kopf und blies ihr Luft in die bebenden Nüstern, bis sie sich schüttelte.
Ihr Maul blutete, war über Nacht von der Gebißstange wund gescheuert. Er beruhigte sie, sagte, daß sie schlimm dran sei, und er verstehe das gut, er sei ja auch schlimm dran, aber es werde schon wieder werden. Dann lehnte er sich gegen ihre linke Schulter, und als sie das Gewicht auf die andere Seite verlagerte, hob er ihren Fuß hoch. Er war heiß und empfindlich, und Blut lief an einem pfeilförmigen Schiefersplitter entlang, den sie sich eingetreten hatte. Nachdem er den Splitter mit seinem Klappmesser entfernt hatte, war sie erleichtert, doch eine Verletzung blieb. Er setzte ihren Huf wieder ab und brachte sie mit viel gutem Zureden dazu, sich von ihm weiterführen zu lassen.
Jetzt hörte er das Quietschen des Holzrahmens, in dem der Blasebalg hing, und das Klirren der Kette, wenn sich das Leder dehnte und wieder zusammenzog und fauchend Luft in die Esse pumpte. Auf dem Boden der Schmiede lagen Pflugschare und Sicheln. Unter der Werkbank wuchs ein Streifen Gras, und darauf lagen Hämmer, Meißel und Formeisen wild durcheinander.
Der Schmied stand über dem Feuer, den Blick unverwandt auf das Werkstück und die blaugelbe Flamme gerichtet, die aus der Esse an dem Metall züngelte. Dann drehte er sich um und schreckte das Metall mit kaltem Wasser ab, ließ zischenden Dampf aufsteigen. Der Schmied, ein buckliger Deutscher, hatte den Eisenhaken gefertigt, der bei ihnen zu Hause im Kamin hing. Er hatte ihren Pflug geschärft und die Stricknadeln seiner Mutter hergestellt.
Das eine Ende der Veranda war etwas zurückgesetzt und von Fliederbüschen umwuchert; am anderen Ende war ein langer Stall angebaut, und aus dem Kamin eines Räucherhauses stiegen graue Rauchwirbel auf. Ein Junge, nicht viel jünger als Robey, lief auf den Händen über die Veranda, und die losen Hosenträger seines Jeans-Overalls schleiften auf den Bodenbrettern. Aus einer Hosentasche, die falsch herum auf sein Hosenbein genäht war, ragten Lakritzestangen.
Das zischende Abschrecken der Metallteile machte die Luft stumpf, als der Schmied jetzt seine Zange noch einmal ins Abschreckbecken tauchte. Der Handstandjunge gab den Weg frei, als Robey die Veranda betrat, und folgte ihm ins Haus. Im Raum hing der intensive Geruch von Melasse und Kaffee und von geräuchertem Schinken und Speck.
Der alte Morphew blickte nur kurz von seinem Kassenbuch auf, als die Tür zufiel, reagierte aber mit keiner Geste der Begrüßung. Er war viel älter, als Robey ihn von ihrer letzten Begegnung in Erinnerung hatte, die Brust war eingefallen, und der Körper wirkte ausgemergelt. Morphew röchelte, als hätte er Tuberkulose. Sie blickten einander fest in die Augen.
»Mister Morphew, Sir«, begann Robey, und in der Art, wie er den Namen aussprach, lag die Frage: Erinnern Sie sich an mich? Wissen Sie noch, wer ich bin?
Morphew löste die Hand von dem Bohlentisch und stopfte sich eine Pfeife. Um den Schmerz in seiner entzündeten Schulter zu lindern, hob er den Arm hoch über den Kopf, streckte ihn vor und ließ ihn wieder sinken. Hier im Laden klangen die Schläge des Schmiedehammers so gedämpft wie das Ticken einer Uhr.
»Nimm dir von den Keksen, und setz dich in den Lehnstuhl«, forderte Morphew ihn auf und deutete mit dem Pfeifenstiel auf die Keksdose. Dann ließ er Melasse aus einem Fäßchen in eine Blechtasse fließen. Der schwarze Hahn an dem Faß leckte, und auf dem Boden unter dem Faß war ein großer dunkler Fleck zu sehen.
Robey nahm die Tasse, die Morphew ihm reichte, und tunkte einen Keks darein. Er hatte Hunger und verspürte ein Ziehen im Magen, das auch nicht aufhörte, als er einen zweiten Keks aß. Morphew schaute ihm über den Tisch hinweg zu, und als sich ihre Blicke trafen, erzählte Robey, was alles passiert war und warum ihn seine Mutter losgeschickt hatte, und fragte ihn, wo die heftigsten Kämpfe stattfänden.
»Ich bin sicher, daß mein Vater dort ist«, fügte er an.
»Hab noch gar nicht gewußt, daß Thomas Jackson tot ist«, sagte der alte Morphew und zupfte sich am Kinn. »Thomas Jackson tot? Kann ich kaum glauben. Ich weiß nicht, ob ich das in meinen Kopf reinkriege.«
»Mutter sagt, er ist tot.«
»Deine Mutter weiß so was«, meinte Morphew. »Sie hat die Gabe, Dinge zu sehen. Obwohl – eins muß ich da schon sagen.«
»Was denn?«
»Es gehört nicht viel dazu, vorherzusagen, daß ein Mann im Krieg stirbt.«
Morphew forderte ihn mit einem Nicken in Richtung Keksdose auf, sich weiter zu bedienen, und erzählte ihm, was er von den Kämpfen gehört hatte. Allerdings seien seine Informationen unzuverlässig, meinte er, und auch schon eine Woche alt. Er steckte den Finger ins Spundloch des Melassefäßchens und leckte ihn anschließend ab.
»Und wo finde ich jetzt die Armee?«
»Welche?«
»Wie viele gibt’s denn?« fragte Robey. Er spürte, wie er in dem behaglich warmen Raum immer schwerer wurde. Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, und das Ziehen in seinem Bauch kam wohl ebensosehr von der Müdigkeit wie vom Hunger. Wie von Gewichten gezogen ließ er sich tiefer in den gepolsterten Lehnstuhl sinken.
»Es gibt mehrere«, erklärte Morphew. »Mein letzter Stand ist, daß sie unten im Tal waren und dann direkt am Rappahannock. Da liegt ein Stapel Zeitungen. Du kannst alles nachlesen, aber verlaß dich nicht drauf. Wenn du mich fragst, stammt das alles aus zweiter, wenn nicht aus dritter Hand.«
»Meine Mutter hat gesagt, ich soll nach Süden reiten und dann nach Osten ins Tal hinunter und weiter flußabwärts.«
»Nicht daß ich deiner Mutter widersprechen wollte, aber so kommst du nicht zum Rappahannock.«
»Und wo ist der Rappahannock?«
Er hörte sich selbst diese Frage stellen. Das mit dem Fluß verstand er. Sein Vater hatte ihm gesagt, daß man einen Fluß immer am anderen Ufer verteidigen soll, nicht am eigenen, und wenn es doch mal nötig ist, dann ein Stück vom Ufer entfernt, nie direkt am Wasser.
»Reit nach Osten«, sagte Morphew und deutete mit der Pfeife so bestimmt dorthin, daß Robey den Eindruck hatte, es müsse ein Ort gleich draußen vor Morphews Laden sein. Gar nicht so weit, dachte er.
»Mutter hat gesagt, daß sie ihn schlagen wird und für immer hassen, wenn er in den Krieg zieht, aber er ist trotzdem gegangen.«
»Was einer im Blut hat, kannst du nicht aus ihm rausprügeln«, meinte Morphew.
»Er hat gesagt, es steckt auch in meinem Blut.«
»Ja, keiner treibt sich so gern in der Welt herum wie er.«
»Sie sollten sich einen neuen Spundzapfen für das Melassefaß schnitzen«, sagte Robey nach einer Gesprächspause, während sein Kinn langsam auf die Brust sank.
Wie lange er in dem Lehnstuhl geschlafen hatte, wußte er nicht. Es war ein kurzer traumloser Schlaf, der so schnell endete, wie er begann. Er konnte das Klingen des Hammers hören und den süßen Duft der Melasse riechen. Der Handstandjunge starrte ihn verkehrt herum an, die Unterschenkel nach hinten abgewinkelt.
Der alte Morphew saß, auf die Unterarme gestützt, noch immer über seinem Kassenbuch. Noch einmal sprach Robey seinen Namen aus, als wäre er eben erst angekommen.
»Du läufst jetzt aber nicht weg, um zu kämpfen, oder?« fragte Morphew mit ernster Miene.
»Nein, Sir«, sagte er und spürte sogleich den Drang, sich auf den Weg zu machen. Er wußte, er hätte hier nicht haltmachen dürfen. Er hatte seinen Ritt gerade erst begonnen, und schon machte er hier in Morphews Laden Rast. Es stand ihm nicht an, den Rat der Mutter in Zweifel zu ziehen, und es war auch nicht an ihm, die tieferen Gründe für ihre Voraussagungen zu bestätigen oder sie in Frage zu stellen.
»Du belügst mich doch nicht?« fragte Morphew.
»Nein, Sir.«
»Na, es wird schon stimmen.«
Er schob einen Beutel Tabak über den Tisch. »Der ist für deinen Vater. Er wird sich sicher drüber freuen, und über das da auch.«
Mit diesen Worten gab er ihm noch einen Beutel voll Kaffeebohnen. »Bezahlen kann er, wenn er zurückkommt.«
»Ich muß jetzt los«, sagte Robey und durchquerte langsam den Laden. »Ich hab noch einen weiten Weg vor mir und will bald wieder zurück sein.«
»Viel Glück«, wünschte ihm Morphew und stapfte ihm nach auf die Veranda, den Handstandjungen im Gefolge. Die Sonne stand schon recht hoch über dem Horizont, so lange hatte er geschlafen. Die stämmige Stute erwartete ihn schweißnaß und ließ kläglich den Kopf hängen. Am Wegrand war ein alter Karren abgestellt, der Fuhrmann brachte dem Ochsengespann gerade einen Eimer Wasser. Auf der Ladefläche war mit einem Seil ein zugenagelter Sarg aus weißgebleichtem Pappelholz festgebunden.
»Wen hast du da?« rief Morphew von der Veranda hinunter.
»Den kleinen Skagg«, antwortete der Fuhrmann, nachdem er sich suchend umgeschaut hatte, woher die Frage kam.
»Der hat doch hier in der Nähe gelebt«, sagte Robey.
»Jetzt nicht mehr«, meinte Morphew.
Sie sahen zu, wie der Fuhrmann noch einen Eimer Wasser zu seinen durstigen Ochsen schleppte. Er trug einen schwarzen Filzhut, ein leuchtendrotes Hemd und eine Hose, die an den Knöcheln ausgefranst war. Seine kaffeebraune Haut war faltenlos.
»Wo kommst du her?« rief ihm Morphew zu.
»Von Lynchburg hoch. Da ist der Kleine im Hospital gestorben, ich soll ihn nach Haus bringen.«
»Wie ist er denn gestorben?«
Der Fuhrmann zog den Filzhut vom Kopf und drückte ihn an die Brust. Er rieb sich verlegen am Kopf. »Weiß nicht, Sir. Er hat geschlafen, als es passierte. Hat nichts gesagt.«
»Alter Depp«, brummelte Morphew und wandte sich Robey zu. »Ich glaub nicht, daß dein Pferd noch lange mitmacht. Wie willst du dann ans Ziel kommen?«
»Wenn’s an der Zeit ist, geh ich eben zu Fuß weiter«, sagte er und bekam ein flaues Gefühl. Ein Blick auf die Stute verriet ihm, daß es bereits an der Zeit war.
»Es ist noch weit, und es sieht aus, als ob die Zeit drängt. Vielleicht kann ich dir helfen.«
Er betrachtete den Fuhrmann und den Weg hinab zur Schmiede und bedeutete Robey dann mit einer Handbewegung, ihm zu folgen. Aus dem Stallanbau hinter dem Laden war das heftige Schnauben eines Pferds zu hören, das mit den Hufen gegen die Wand trommelte. Morphew verschwand im Halbdunkel des Stalls und kam mit dem Pferd an der Leine wieder heraus. Es war ein Glanzrappe, ein pechschwarzer Hengst, größer als er selbst und offensichtlich alles andere als scheu.
»So ein tolles Pferd!« sagte Robey und konnte seine Bewunderung nicht verbergen.
»Ein Warmblut«, erklärte Morphew. »Ich sag dir, wenn er in Fahrt kommt, ist er nicht mehr zu bremsen.«
»Wem gehört er?«
»Der Mann, der ihn geritten hat, ist vor nicht mal einer Woche gestorben, hier in diesem Polsterstuhl. Ich hab ihn auf dem Friedhof begraben. Das Pferd hat sozusagen keinen rechtmäßigen Eigentümer mehr. Es ist praktisch in meinen Besitz übergegangen, also kann man sagen, daß es nun mir gehört.«
»So ein Pferd hab ich noch nie gesehen.«
»Der Deutsche sagt, es ist ein Hannoveraner. Ein feines Pferd, ein ausgeglichener Charakter, aber merk dir eins: Andere Pferde mag er nicht besonders.«
»Auf welcher Seite war er?«
»Der Hengst oder der Reiter?«
»Ist irgendwie egal, oder?«
»Jetzt, wo er tot ist, ist es ziemlich egal.«
Morphew kramte Zaumzeug, eine Satteldecke und einen Sattel mit Pistolenhalftern am Sattelknopf hervor. Dann griff er hoch in das dunkle Eck zwischen Balken und Dachsparren.
»Du weißt, was das ist?«
»Ja, Sir.«
»Und?«
»Das sind Armeecolts.«
»Richtig, das sind er Armeecolts. Kannst du damit umgehen?«
»Ja, Sir.«
»Zeig’s mir.«
Robey wiegte einen der Revolver in der Hand und prüfte kritisch, ob er nicht verbogen war. Er klopfte geschickt den Haltekeil los und nahm die Trommel heraus. Dann sah er zu Morphew, der eine Schachtel Patronen, Zündhütchen und Geschoßfett vor ihn hinlegte. Robey riß die Papierhülse einer Patrone auf, füllte Pulver in die Kammer und setzte die Kugel. Als er alle Kammern geladen hatte, fettete er die Kugeln ein und steckte auf jede Patronenkammer eine Messinghülse. Dann wiederholte er das Ganze bei dem zweiten Revolver.
»Nimm alles mit«, sagte Morphew. »Das Pferd und die Colts.«
»Das kann ich nicht annehmen«, entgegnete er. »Mutter hat gesagt, ich darf von niemandem Hilfe annehmen.«
Morphew schob die Unterlippe vor, musterte ihn skeptisch und sagte mit einer Stimme, die Ungeduld und Ärger verriet: »Das zeigt mir, daß du nicht Verstand genug hast für das, was du planst.«
Morphew verschluckte sich und mußte tief Luft holen. Er wurde rot im Gesicht, gab nur noch unverständliches Gebrabbel von sich, und sein rechtes Auge begann zu tränen. Ein zuckender Schmerz ließ seine Wangen erblassen. Als er schließlich weitersprach, klang es mühsam, als wäre seine Kehle eingeschnürt.
»Ich hab großen Respekt vor deiner Mutter. Sie ist eine besondere Frau, aber du kannst doch nicht einfach so durch die Gegend marschieren. Das Leben da draußen ist nicht mehr wie früher.«
»Was heißt das?«
»Früher konnte man den Menschen vertrauen.«
Morphews gedrängte Worte enthielten unausgesprochen die Botschaft: Dir vertrau ich auch noch.
»Jetzt sattel das Pferd, und leg ihm das Zaumzeug an, wir treffen uns vorm Laden. Ich schreib dir eine Bestätigung, daß es mein Pferd ist, was ja auch stimmt, und daß ich’s dir vorübergehend zur Verfügung gestellt hab.«
Morphew drehte sich um und stapfte das kurze zertrampelte Stück Weg vom Stall zurück.
Jetzt war er allein mit dem Rappen und besah ihn sich genau. Dabei merkte er, daß auch das Pferd eine Entscheidung über ihn fällte. Von einem Tier wie diesem hatte er noch nie gehört, und er fühlte sich ihm unterlegen. Es war ein junger, kraftvoller Hengst mit einem schmalen Kopf und weit auseinanderstehenden Augen. Er hatte einen hoch angesetzten Schweif und einen langen, zarten Hals, aber massive Schultern. Die Hinterhand war gut bemuskelt, die Beine hatten kurze Röhren, aber starke, elastische Gelenke. Er hatte steile Hufe, und der Strahl wurde durch die Trachten nicht eingeengt.
Er machte einen Schritt auf ihn zu und strich über seinen langen Kopf. Der Hengst ließ zu, daß er ihm über Backen, Hals und Maul fuhr; dann weiter über den Rücken und die Schultern und hinab bis zu den Beinen, wo Robey am Vorarm und am Unterschenkel den Druck seiner Hände verstärkte. Er blickte dem Pferd in die Augen und hatte den Eindruck, daß es ihn akzeptierte, vielleicht sogar mochte.
Nachdem er mit den Händen kräftig über den Körper des Glanzrappen gestrichen hatte, legte er ihm das Zaumzeug an und die Satteldecke auf. Er zog den Sattelgurt an und sagte dem Pferd, was er vorhatte. Dann stieg er in den Steigbügel und schwang sich in den Sattel. Er sagte dem Hengst, daß er jetzt bereit war, und der machte deutlich, daß es losgehen konnte.
Als er vors Haus geritten kam, saß der alte Morphew in einem Schaukelstuhl auf der Veranda. Der Handstandjunge lief so nah wie möglich an ihn heran, ohne mit den Händen unter den Stuhl zu geraten. Morphew hatte einen Leinenbeutel mit Dosen zurechtgelegt, die scharf gewürzten Schinken, Schweinefleisch und Bohnen und Kondensmilch enthielten. Er stand auf und kam mühsam von der Veranda herunter.
»Bild dir nicht zuviel darauf ein, daß du ihn reitest«, sagte er und zog die Steigbügelriemen fest. »Wer so ein Tier reitet, meint irgendwann, er wäre was ganz Besonderes.«
Dann trat der alte Morphew einen Schritt von dem Pferd zurück. Jugendliches Feuer funkelte plötzlich in seinen Augen. Er wirkte zufrieden wie ein Kaufmann, der ein gutes Geschäft zum Abschluß gebracht hat. Robey sah die Freude in seinem Gesicht und kam zu dem Schluß, daß der alte Mann vor kurzem etwas Schreckliches erlebt haben mußte, was ihn zutiefst berührt und verstört hatte, im Herzen und im Verstand, und daß er erst jetzt allmählich wieder zu sich kam.
»Rupert«, rief Morphew dem Deutschen zu, »bist ja heute gar nicht betrunken?«
Ohne sich bei der Arbeit stören zu lassen, streckte ihm der bucklige Mann den Mittelfinger der rechten Hand entgegen. Morphew lachte über ihr kleines spitzbübisches Spiel.
»Bucklige sind oft schlauer als wir«, sagte er, als wäre das eine Wahrheit für Eingeweihte.
»Läuft der Junge nie auf den Füßen?« fragte Robey.
»Nein«, antwortete Morphew mit einem Blick auf den Handstandjungen. »Er geht verkehrt herum durch die Welt. Ich wette, so was hast du noch nie gesehen oder gehört.«
»Nein, Sir, ich glaub nicht.«
»Du hast noch viel zu lernen, und ich hoffe, du lebst lange genug, daß du davon erzählen kannst.«
»Ganz bestimmt.«
»Gut so.«
Mit einer Handbewegung forderte er ihn auf loszureiten. »Jetzt such deinen Vater, und bring ihn nach Hause, dann rechnen wir ab.«
Nach diesen Worten ritt Robey auf dem Glanzrappen davon, die schweren Revolver in den Hüfthalftern. Als er aus seinem Blick verschwand, bemerkte Morphew, daß der Deutsche zur Veranda gekommen war und nun neben ihm stand. Der Schmied bewunderte die wunderschönen, fließenden Bewegungen des Hengstes und war erstaunt, daß das Pferd den Jungen offensichtlich mochte.
»Ein beeindruckendes Tier«, sagte Morphew.
»Die Art von Pferd, die einen auch das Leben kosten kann.«
»Hab ich auch schon gedacht.«
»Und was hast du weiter gedacht?«
»Eine ganze Menge. An seine Mutter. Daß er genauso ist wie sein Vater und alles tut, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Daß so einer leicht in Schwierigkeiten geraten kann und nur schwer wieder rauskommt.«
»Und vielleicht auch, daß bei dem, was er jetzt vorhat, das Pferd womöglich klüger ist als er?«
»Auch das hab ich gedacht.«
3 ES WAR HERRLICH,
auf dem Rücken des Glanzrappen zu sitzen, und in den ersten Tagen seiner Reise machte er keine einzige Pause. Als er ins Tal kam, traf er auf Gras und Kleewiesen von üppigem Grün. Die roten Lehmwege waren breit und fest gestampft, die Böschungen trocken und befestigt.
Er ritt über Felder und Weiden, durch Sümpfe und Obstgärten. Durchquerte Feuchtwiesen, in denen der Grundwasserspiegel nur wenige Spatenstiche unter der Erdoberfläche lag und über die hohe, mit Pfosten markierte Knüppelwege hinwegführten. Er ritt über frisch gepflügte, geeggte und neu eingesäte Äcker, grün durchwirkt von sprießendem Weizen, Roggen und Hafer. Er traf auf Kieferndickichte, die so undurchdringlich waren, daß er tagelang daran entlangreiten mußte, ehe er einen Durchgang fand. Und das waren oft Stellen, wo der Wind die Bäume umgeworfen und die Sonne die knorrigen Äste gebleicht hatte und nur noch die Baumstümpfe standen.
Da Robey es eilig hatte, gönnte er sich anfangs keinen Schlaf und hielt sich mit aller Gewalt wach, bis er nicht mehr konnte und lernte, im Sattel zu schlafen, denn der Rappe schien mit ihm einer Meinung zu sein, was die Richtung betraf. Von da an zog er sich, wenn er müde wurde, einfach eine Decke über den Kopf, ließ das Kinn auf die schaukelnde Brust sinken und schlief, und der Hengst schlief ebenfalls ein und legte trotzdem, ohne seinen Lauf zu unterbrechen, pro Stunde vier Meilen zurück. Mal waren seine Hufe vor Staub und flirrender Hitze unsichtbar, mal wurde er von Wetterleuchten umzuckt, das Robey mit elektrischem Knistern den Weg durch die sternlose Nacht wies.
Tage und Nächte vergingen; wie viele es waren, konnte er nicht sagen. Er hatte nicht gewußt, daß hinter den Schluchten noch so viel flaches und hügeliges Land liegen würde, so viele tiefe Bachbetten und undurchdringliche Heckenrosendickichte, so viele abrupt aufsteigende Berge. Zwar hatte auch er schon den Blick von einem Berggipfel in die Ferne geworfen, aber noch nie zuvor hatte er so weit ins Land geschaut, auf so grüne Wiesen, so saftige Weiden und so große Häuser.
Manchmal dachte er, eigentlich müßte er doch längst am Meer sein oder in einer der majestätischen Städte, von denen sein Vater immer erzählte. Eigentlich müßte er blitzblanke Eisenschienen überquert haben oder die von Bäumen gesäumten Boulevards entlangstreifen, die an großen Plätzen endeten, wo Behörden und Unternehmen ihren Sitz hatten. Sein Vater hatte ihm geschildert, wie groß und grenzenlos die Welt war, wie dicht und endlos die Wälder, wie steil die Anstiege und wie zerklüftet die felsigen Abhänge. Weiter im Westen, hatte sein Vater zu ihm gesagt, war die Natur noch nicht fertig mit ihrer Arbeit. Da suchten die Flüsse noch nach ihren Betten, schwollen dabei zu gewaltigen Dimensionen an, wie riesige Seen, die entstanden und wieder verschwanden. Die Berge waren hoch, ihre Gipfel ragten bis in die Wolken. Da gab es Wüsten und Canyons. Es gab Bäume, deren Stämme so dick waren, daß man sie nicht fällen konnte, an anderen Orten hingegen stand überhaupt kein Baum, so weit das Auge reichte. Westlich des Mississippi herrschte extremes, bösartiges Wetter, das wochenlang anhielt. Da war es entweder zu kalt oder zu heiß, und es gab entweder zu viel Wasser oder gar keines. Die Natur, das war: glitzernder Sand, windzerfurchtes und ausgebleichtes Gestein, überhängende Felswände, die den heranstürmenden Wind teilten. Da suchte die Nässe nach Trockenheit, der Wind nach den höchsten Bäumen, um sie niederzuwerfen, und die Blitze nach den flachsten Ebenen. Der Westen war das Bergwerk und der Steinbruch, der Garten und die Schmiede eines Schöpfers.
Anfangs sammelte er alles an Lebensmitteln und Waffen ein, was er vielleicht brauchen konnte, und er fand vieles. Doch dann ließ er das Horten und ritt weiter, nur mit Ölzeug, einer Decke, den geladenen Revolvern, einem Messer und einer Feldflasche ausgerüstet. Wenn er etwas zu essen brauchte, fand er immer irgendwo eine Handvoll gerösteten Mais, etwas Buttermilch, Ingwerkekse und ein Säckchen weiße Bohnen, und oft entdeckte er in den Überresten der bleifarbenen Armee-Planwagen so ungewöhnliche Kost wie Sardinen, eingelegten Hummer, Pfirsiche in Dosen und Kaffee. Früher hatte er gedacht, er würde lieber Hunger leiden als stehlen, doch das war, bevor er den Hunger kannte.
Nach einer gewissen Zeit lernte er, dem Duft von gebratenem Speck nachzugehen, oder er folgte den Wegen, auf denen frische Kuhfladen lagen. Wenn es sein mußte, klaute er den Mais aus den Viehkrippen oder ein streunendes Huhn, einen Kuchen, der zum Abkühlen im Freien stand, oder einen zum Räuchern aufgehängten Schinken, und wenn nichts von alledem zu finden war, ernährte er sich von Beeren und wildem Lauch, aß Brunnenkresse und trank Eicheltee.
Er verließ das Tal in östlicher Richtung und kam in eine Gegend, wo sich Berge auf Berge türmten und schreckliche Winde um die wolkenumkränzten Gipfel tosten, die ihn zu rufen schienen. Und er dachte, eines Tages würde er gern zu ihnen zurückkehren, sich einen Weg durch die luftigen Nebel suchen und auf der Bergspitze stehen.
Es gab wunderschöne Momente der Einsamkeit. Er folgte dem Rotwild in die Bergschluchten, wo dreißig oder fünfzig Stück davon wie Rinder grasten. Er sah Gewässer mit so vielen Fischen darin, daß sie einander im gleißenden Sonnenlicht auf den Rücken stiegen und ihre Brut ins Maul nahmen. Auf seinem Weg lagen Gutshäuser, die weder vom Krieg berührt worden waren noch von der Nachricht vom Krieg und deren beleuchtete Fenster die Nacht erhellten. Er sah winzige, in enge Täler eingebettete Dörfer, ordentliche Farmen und Häuser, die mit viel Aufwand herausgeputzt waren.
Eines Abends vernahm er im Zwielicht zwischen den Bäumen Orgelmusik und roch den schweren Duft aufgeplatzter Kiefernpollen. Irgendwo hatten sich Menschen zu einem Gottesdienst versammelt, und ihre Choralstimmen erfüllten das Dunkel. Seine Mutter war gläubig, doch sein Vater war Freidenker und sagte immer, wenn man ein Stück Seife habe, könnte eine Taufe ganz nützlich sein. Er vermutete, daß sein eigener Glaube zwischen dem seiner Mutter und dem seines Vaters lag. Neugierig dirigierte er das Pferd in Richtung des Gesangs und meinte schon fast, bei der Quelle angekommen zu sein, als der Gesang schwächer wurde und ebenso rätselhaft wieder verschwand, wie er zuvor an sein Ohr gedrungen war, und er fragte sich, was das wohl gewesen sein mochte.
Er ritt weiter, bis er zu einer Stelle kam, wo vor langer Zeit ein Pferd in einem Felsspalt hängengeblieben war. Auf seinen weißen Rippen wuchs Moos, um die Beine rankte Efeu, und der Schädel war von Kriechpflanzen mit weißen Blüten bekränzt. Das Pferd mußte in den Spalt gerutscht und nicht mehr herausgekommen sein, und wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung wehte, ertönte Musik aus seinen bleichen Knochen.
DAS GESICHT ABWECHSELND VOM WIND gegerbt und von der Sonne verbrannt, die Glieder gefühllos vor Kälte oder erschlafft vor Hitze, war er hinabgestiegen in das weite Grün des nordöstlichen Tals, hatte die Kette der Blue Mountains überquert und war wieder hinuntergeritten auf die mit Kiefern bewaldete Ebene, wo die Luft unter der Hitze und ihrem eigenen Gewicht zitterte und bebte. Seine Mutter hatte gesagt, er solle weiter das Tal hinaufreiten, aber nach allem, was er gehört hatte, würde er im Osten auf die Armee treffen.
Mittlerweile war er eins geworden mit dem Pferd, waren seine Kleider und seine Beine vom Schweiß des Tiers durchdrungen. Und auch seine Hände, mit denen er sich übers Gesicht strich oder durchs Haar fuhr, waren naß davon, und er konnte sich nicht vorstellen, sich jemals wieder von diesem Juwel zu trennen. Das Pferd hatte Macht über sein Wachen und seinen Schlaf. Er träumte von ihm, und wenn er schlief, wurden aus einem Pferd mehrere, so viele, daß er sie nicht mehr zählen konnte. Glanzrappen waren die ersten und einzigen Pferde überhaupt. Sie waren keine Pferde, sie waren anders, eine Art menschenfressende Tiere, wie Löwen oder Bären oder Wölfe, oder wie der Mensch selbst. Nur waren sie unverwechselbarer, von edlerem Geblüt, einzigartig in ihrem Willen und ihrer Entschlossenheit. Wenn sie rannten, dann in einem herrlichen Kranz aus Weiß, der mit jedem Federn ihrer Rippen die Erde unter ihnen und die Luft über ihnen zum Verschwinden brachte. Weder er noch das Pferd hatten dann noch Beine. Von den Knien abwärts war nichts mehr zu sehen, so daß sie erschienen wie ein reitender Lichtstrahl, wie ein von stürmischem Wind getriebenes Licht, und schaumgeboren wurde er dahingetragen von dem Pferd, das er ritt: dem geflügelten Pferd, dem Urpferd, dem Pferd, das den Sonnenwagen über den Himmel zog.
Er dachte daran, dem Pferd von diesen Dingen zu erzählen, die er im Traum sah, aber er brachte es nicht fertig, weil ihn dann Schwäche und Liebeskummer überkamen. Jedesmal, wenn er es versuchte, war ihm, als würde er gleich zusammenbrechen. Er befürchtete, wenn er es erzählte, würde er das wenige verlieren, das von ihm noch geblieben war. Etwas zu erzählen, wovon er annahm, daß das Pferd es schon wußte, würde bedeuten, daß er sich für immer in ihm verlor.
Das war die Zeit, als er beschloß, den Hengst zu behalten, ihn Morphew irgendwie abzukaufen, die Erben des Kavalleristen ausfindig zu machen, dem er vor Morphew gehört hatte, und auch ihnen den Preis zu bezahlen.
ER RITT WEITER durch die knorrigen Wälder in dem rauhen, flachen, verwilderten Land, durch weite, seltsam verbrannte Landschaften, und hier begegnete er dem Tod.
Schon lange bevor er bei dem zerstörten, verwüsteten Haus ankam, lange bevor er überhaupt von dessen Existenz wußte, zog ihn etwas in diese Richtung. Vielleicht war es die gespenstische Leere, die er in der Umgebung spürte. Er fühlte, wie sich etwas in ihm zusammenzog und ihm sagte, daß er einen weihevollen Ort betrat. Er sah einen Schwarm Geier und aus dem Schatten am Boden eine Bewegung zum Licht hin, und dann schlich eine Meute von Hunden vorbei, die einen unverkennbaren Geruch mit sich trug. Er kam aus ihren Mäulern und aus dem Brustfell und tränkte ihre beschämten Gesichter.
Hier waren ohne ersichtlichen Grund Menschen getötet worden, die verlorenen Seelen ausgesetzt und die Leichen wie verrottendes Holz in Gräben und hinter spitze Pfähle geworfen. An ihren Knochen hingen Fetzen von Fleisch und von Kleidern, und so wie sie hier aufeinandergestapelt lagen, war schwer zu erkennen, wie viele es genau waren. Da war niemand, der ihn durch diesen unheilvollen Ort führen konnte, und auch wenn er nicht wußte, wie viele Menschen überhaupt auf der Erde lebten, kam es ihm in diesem Augenblick so vor, als sei die Hälfte von ihnen unbestattet der Verwesung anheimgegeben. Der Geruch war wie frisches Gift, das sich mit dem Wind vermischte. Noch nie hatte er menschliche Leichen gerochen, aber diesen Geruch erkannte er instinktiv.
Aus einem vagen Gefühl von Pietät stieg er vom Pferd und ging zusammen mit dem Tier quer über das Schlachtfeld bis hinüber in den dunklen Wald. Als er wieder in den Sattel steigen wollte, versank sein Fuß im Boden, und er blieb mit dem Knöchel zwischen den Rippen eines Mannes hängen, der abseits von den anderen Toten in einem flachen, vom Regen freigespülten Grab lag. Seine Knochen waren kalkig, vertrocknet und gebrochen, ein Arm wie zum militärischen Gruß an den grauen Schädel gehoben und die Fingerknochen in einem schmerzhaften Todeskampf zur Faust geballt. Dieser Mann mußte lange vor allen anderen gestorben sein. Hatte hier schon einmal ein Krieg getobt? War das ein Ort, an dem der Krieg auf der Lauer lag wie ein wildes Tier?
Antworten auf diese Fragen hatte er nicht, und er dachte auch nicht lange darüber nach. Er wußte nur, daß er dem Krieg offensichtlich näher kam. Und er dachte, wenn hier so viele Tote lagen, die im Krieg gekämpft hatten, dann würde wohl der Krieg den Sieg davontragen.
IN DER NACHT GINGEN die meisten Menschen zu Bett, aber nicht alle. Immer wieder hörte er das Geräusch hämmernder Hufe, und er vermied es, den Banden bewaffneter Männer, die auf ihren Pferden an ihm vorbeihetzten, zu begegnen. Problematischer waren die einsamen Reiter, die sich lautlos durchs Dunkel bewegten. Solche Reiter traf er unterwegs häufig, von Gewalt geprägte Männer, unberechenbar und gefährlich. Sie ritten mit lockeren Zügeln, einen Karabiner oder eine doppelläufige Flinte auf den Oberschenkel gestellt.
Wenn einer solchen Begegnung nicht auszuweichen war, verlangsamte er den Ritt und hob den Arm zum üblichen Gruß, den einsame Reiter auf Nebenwegen austausehen. Meist waren die anderen ebenso mißtrauisch wie er und wollten mit ihm genauso wenig zu tun haben wie er mit ihnen. Sie hatten ihre Gründe und geheimen Ängste, nicht auf der Straße gesehen zu werden, waren in eigener Sache unterwegs. Aber wenn dann der pechschwarze Hengst aus dem Schatten auftauchte und immer größer wurde, drehten sie sich im Sattel, um ihn besser betrachten zu können, bis er ihren Blick in seinem Rücken spürte.
Es kam der Abend, an dem er einen tief eingeschnittenen, von Bäumen und Büschen gesäumten Weg entlangritt, der auf beiden Seiten von einem Balkenzaun begrenzt wurde. Die Luft war drückend und zu schwer, um Geräusche aus der Umgebung heranzutragen. Von vorn näherte sich ihm die Gestalt eines dunklen Reiters, an einem Knick im Weg zeichnete sich dessen Profil deutlich ab. Der Reiter hielt einen Augenblick inne und kam dann weiter auf ihn zu. Als sie dicht aneinander vorbeiritten, zügelte der andere sein Pferd und sprach ihn mit einem fremden Namen an. Von dieser angeblichen Verwechslung getäuscht, hielt Robey inne und wollte umdrehen, doch der Glanzrappe blieb nicht stehen, und Robey verstand sofort, als er das dumpfe Knacken hörte, mit dem der Reiter den Hahn seiner Flinte spannte. Robey trieb den Rappen an, doch das war gar nicht nötig. Das Pferd stürmte bereits auf die Wegbiegung zu, und er mußte sich festklammern, denn der Hengst entwickelte eine Kraft, die er noch nicht kennengelernt hatte.
Eng an den Hals des Pferdes geschmiegt, tat er alles, um nicht abgeworfen zu werden, und er hatte wenig Hoffnung, in der scharfen Wegbiegung im Sattel zu bleiben.
Er fürchtete, daß ihm der Boden rasch entgegenkommen, daß er sich nicht auf dem Pferd würde halten können. Doch der Hengst stürmte nicht in die Biegung, sondern geradeaus weiter, sprang im letzten Moment mit einem weiten Satz über den Rand des Hohlwegs und über den Zaun hinweg und durchbrach das dichte Gestrüpp dahinter. Robey wurde im Sattel hin und her geworfen, er konnte sich nur mit Mühe festhalten. Da ertönte ein Flintenschuß, und hinter ihnen erhob sich ein Schwarm Wachteln in die Luft. Eine ganze Weile peitschte das Dornengestrüpp heftig auf sie ein, bis sie in lichteres Unterholz kamen und dann über einen Graben setzten, um auf der anderen Seite wieder im Wald zu verschwinden.
Es war nicht die gefährliche Begegnung, die sich später in seinen Gedanken festsetzte, sondern die Souveränität seines Pferdes, sein Gespür für Menschen. Erlebnisse dieser Art sollte er noch einige haben, aber dann mußte er nicht mehr abwarten, bis der Hahn knackte oder ihn Pulverdampf umhüllte, sie verschwanden gleich um die nächste Wegbiegung. Es passierte immer wieder, und dann preßte er dem Hengst die Hacken in die Seiten, so daß er stieg, und mit wenigen Sprüngen waren sie auf und davon.
DIE TAGE VERGINGEN, und der drängende Auftrag seiner Mutter lastete zunehmend auf ihm. Ihm war die Verantwortung bewußt, die er mit dem Versprechen übernommen hatte. Er mußte seinen Vater finden und ihn nach Hause zurückbringen. Und er erinnerte sich daran, daß sie gesagt hatte, er solle unterwegs nicht herumtrödeln, sondern den Vater möglichst rasch finden, spätestens bis Juli. Warum bis Juli? Was sollte im Juli passieren? Oder war es schon passiert? Er überlegte, welcher Monat eigentlich war. Nein, sicher noch nicht Juli.
»Morgen«, sagte er sich ein weiteres Mal. Morgen würde vielleicht der Tag sein, an dem er den Vater fand. Aber die Tage kamen und gingen, und er hatte den Eindruck, daß er dem Fluß, an dem sich die Armee aufhalten sollte, nicht näher kam. Er hatte keine Vorstellung davon gehabt, wie groß das Land war und wie viele Wege sich darin kreuzten.
Jetzt war er in einem feuchtwarmen, von Fliegen heimgesuchten Landstrich unterwegs und wünschte, sich erheben zu können ins Reich der pfeilschnell dahinschießenden Vögel. Er wünschte sich, daß dem Glanzrappen Flügel wüchsen und er ihn durch die Lüfte trüge. Über die Ebene, die sich im Osten an das Tal anschloß, zog ein langer, wirbelnder Wind, und er hatte Heimweh, war erschöpft und aller Illusionen beraubt. Er war fast am Ende seiner Kräfte, und seine Glieder fühlten sich an, als wäre er hundert.
Als es dunkel geworden war, verließ er die Straße und folgte einem schmalen Pfad zwischen den Bäumen, dann verließ er auch diesen Pfad und drängte das Pferd, sich einen eigenen Weg durch den Wald zu suchen. So setzte er seine Reise fort, um Abstand zum Treiben der Menschen bemüht. Er sehnte sich nach einem abgelegenen Platz, wo er sich ungestört niederlassen konnte, entspannen und schlafen, denn sonst würde er irgendwann einfach aus dem Sattel rutschen und zu Boden fallen. Er mußte sich dringend hinlegen, auf die Erde, mußte seinem wunden Körper eine Pause gönnen und seine Kräfte sammeln.
Er sattelte den Rappen ab, damit dessen Rücken im Mondlicht abkühlen konnte, strich mit den Händen die Beine des Tieres entlang, hob einen Fuß nach dem anderen an und suchte nach Rissen in der Hufwand. Dann klaubte er die Kletten aus dem Schweif. Er fragte sich, warum das Pferd so unempfindlich gegen Schmerz war, so gewappnet gegen jede Schwäche. Längst war ihm klargeworden, daß das Tier ihm überlegen war, und er nahm es hin, ja er wußte es zu schätzen.
»Du bist zäh wie ein alter Ochse«, sagte er und fing sich einen schrägen Blick ein.
Als er die schweißbefleckte Satteldecke ausgeschüttelt hatte, legte er sich vor dem Rappen unter einen Baldachin aus Farnwedeln, deren Spitzen sich gerade entrollten, das Pferd hielt er locker an sein Handgelenk angeleint.
Er sah es an und bat es um Geduld, schließlich war er noch ein Junge und brauchte Schlaf, ehe sie weiterkonnten. Er wollte nicht von seinem Rücken fallen und sich im Dreck den Hals brechen.
»Ich bin müde«, sagte er, als wäre Müdigkeit ein Zustand, nach dem man sich sehnen konnte. Das Pferd versetzte ihm einen Nasenstüber gegen die Brust und prustete ihm sanft ins Gesicht.
»Ich bin dreckig wie ein Schwein«, sagte er. Das Pferd hob einen Fuß und setzte ihn schwer wieder ab. Schnaubend beugte es sich hinab zu einem Grasbüschel, packte es mit den Lippen und zog es aus dem Boden. Beim Kauen riß es den Kopf in die Höhe und richtete den Blick nach hinten.
Friß ruhig, dachte er. Ich brauche nur ein bißchen Schlaf, dann geht’s weiter.
Sein Schlaf war unruhig. Er hatte an diesem Tag Bilder gesehen, die ihm nicht aus dem Kopf gingen. Nicht wegen der Lebenden oder der Toten, nicht wegen der Verwundeten, Zerfetzten oder Entstellten. Doch dann ließen seine Gedanken davon ab, und ihm fielen die Augen zu, er atmete ruhig und lauschte auf das Pferd, das wieder an einem Grasbüschel rupfte und auf dem herumkaute, was es gefunden hatte, Augen, Ohren und Nase stets wachsam.
ALS ROBEY AUFWACHTE, fühlte er sich erfrischt. Er setzte sich auf und wischte sich die Maikäfer aus dem Gesicht und den Haaren. Als er wieder auf den Beinen stand, fiel helles Licht auf ihn, und er sah, daß hinter der kleinen Lichtung und dem Waldrand, an dem er geschlafen hatte, der Bogen eines flachen Flusses lag, über dem Schwalben durch die Luft tanzten. Das Sonnenlicht war kräftig und klar, und er nahm das Flimmern und Glitzern über dem Fluß wahr, obwohl er das Wasser nicht sehen konnte. Er führte den Glanzrappen in diese Richtung, bis zu einer Stelle, wo frisches Grün wuchs. Dort ließ er ihn grasen.
Er selbst stapfte durch hohen Farn und blühendes Dickicht zum Flußufer, hielt sich dabei eine Hand vor die Augen, weil das gleißende Sonnenlicht sich an der kräuselnden Wasserfläche spiegelte und ihn blendete. Er ging noch ein Stück weiter, setzte sich dann hin und rutschte auf dem Hosenboden die Uferböschung hinab bis zur Kante eines Felsvorsprungs, der ihm den Blick auf die Flußschleife freigab und von dem er die Beine hinabbaumeln ließ. Sein Vater hatte ihm gesagt, daß Flüsse schwer zu verteidigen seien. Sie schlängeln sich dahin, und alle Schleifen müssen besetzt werden, und dafür braucht man viele Soldaten.
Der Felsvorsprung war mit Kiefernnadeln gepolstert, und die Wasserfläche schimmerte karamelfarben in der Sonne. Er hätte die Füße gern ins Wasser getaucht, doch der Vorsprung lag zu hoch. Sein Vater hatte gesagt, daß Flüsse die Sichtverbindung unterbrächen und Truppenbewegungen behinderten. Flüsse bieten neue Möglichkeiten und machen andere zunichte.
Er blieb eine ganze Weile im kühlen Schatten auf dem Polster aus Kiefernnadeln sitzen. Er wußte, daß er weitermußte und bald wieder auf den Rappen steigen und nach Osten der Sonne entgegenreiten würde. Hinter sich hörte er das Pferd am Gras schnuppern und zupfen. Das erinnerte ihn daran, daß er seit Tagen nichts gegessen hatte und, auch wenn er dringend weiterreiten mußte, ebenso dringend Nahrung brauchte. In letzter Zeit drängelten sich auf den Nebenstraßen viele Flüchtende, fluchende Maultiertreiber und Männer, die ausgezehrte Zugpferde vorantrieben, vor schaukelnden Wagen, die hoch beladen waren mit großen Koffern, Haushaltsgegenständen und Möbeln. Da liefen Frauen mit Fellen an den Füßen und trieben Kühe und Schweine, und barfüßige, rutenschwingende Jungen und Mädchen rannten hinter Herden von herrischen Gänsen und watschelnden Enten her, die schnatterten wie übermütige Kinder. Er sah einen schäbig gekleideten Mann mit einem Zicklein über der Schulter und einen kleinen Jungen, der ein Kaninchen an den Ohren trug. Da wurden Karren mit Leinensäcken, Butterfässern und Werkzeugen geschoben und gezogen. Die meisten Menschen waren in Lumpen gekleidet. Sie wirkten dünn und verhärmt, ganz im Gegensatz zu ihren lebenden Nahrungsreserven, den Rindern, Schweinen und Milchkühen, die sie nach Süden und Westen trieben.
Und dann waren da die einsamen Fuhrleute mit ihrer Fracht von Toten und Verkrüppelten. Er fragte sich, ob das dieselben Männer waren, die er von seinem Aussichtspunkt über dem Twelve Mile Creek in der Ferne gesehen hatte, alte Männer mit primitiven Karren und ausgemergelten Pferden, welche die Kriegsopfer nach Hause brachten, um gleich wieder umzukehren und eine weitere Fuhre von Verwundeten und Verkrüppelten aufzuladen. Manchmal transportierten sie auch eine Kiste oder ein in Tücher gewickeltes Paket von den Ausmaßen eines Menschen. Einige der Männer winkten ihm zu, andere starrten ihn nur an wie einen Sonderling, der zufällig ins Land der Arm- und Beinlosen geraten war. Vielleicht waren diese Fuhrleute nur eine auserwählte Gruppe, deren Schicksal und Aufgabe darin bestand, die gebrochenen Opfer einer zerbrochenen Welt zu befördern. Vor zwei Tagen war er einem schwarzen Kutschwagen mit gläsernen Wänden begegnet, der von zwei gleichen Pferden gezogen wurde. Doch es war nichts anderes, der alte Mann auf dem Trittbrett, der Zügel und Peitsche in der Hand hielt, die Kiste hinter den Glasscheiben, es war trotzdem das gleiche.
Auf den Straßen und Nebenwegen waren noch andere Reisende, und anfangs verstand er nicht ganz, wer diese seltsamen Gruppen von Männern und Frauen waren, aber sie gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er hatte schon oft Schwarze in schlichter karierter Kleidung hinter Pferden hergehen sehen, auf denen Weiße ritten, und es erschien ihm auch nicht weiter ungewöhnlich, wenn hin und wieder ein Schwarzer zu Pferd saß. Aber noch nie hatte er einen Schwarzen mit einem Riemengurt um den Hals gesehen, der an einer Kette die Straße entlanggezogen wurde. Sein erster Gedanke war, daß es ein Verbrecher sein mußte, doch dann merkte er, daß das nicht stimmen konnte.
Diese Begegnungen waren immer häufiger geworden. Ihm war nicht klar, woran das Pferd spürte, daß da etwas Seltsames von Norden kam, aber es blieb stehen, hob den Kopf und richtete die Ohren nach vorn. Als er ihm mit dem linken Oberschenkel Druck gab und mit der Zunge schnalzte, trat der Hengst zur Seite in den Schatten eines Baums und wartete. Robey wollte sich gar nicht verstecken, er wollte nur von der eigenartigen Karawane nicht unbedingt gesehen werden, die jetzt geräuschlos auf sie zukam, kein klimperndes Pferdegeschirr oder klapperndes Zaumzeug, kein Husten und keine schweren Schritte oder trommelnden Hufe. Da war kein Stimmengewirr, keine quietschenden Radachsen, und es war auch kein lautlos sich nähernder einsamer Reiter, den er mittlerweile aus einem Winkel seines Gehirns automatisch wahrnahm. Da war kein Geräusch oder Gefühl, das er benennen konnte, nur ein gespenstischer Eindruck. Es war merkwürdig, als käme hier etwas Widernatürliches – wie eine Theatertruppe, erstarrt in Schweigen, die der Hölle entkommen war, scheinbar statisch, aber aufgeladen und dem Verbrennen nah.
Die Vorhut, die in Sicht kam, bestand aus den rauhbeinigsten Männern, die er je getroffen hatte, auf aller Herren Pferde mit allem möglichen an Sattelzeug. Es gab ausgemergelte Klepper mit Zaumzeug ohne Trense neben Warmblütern, die Kopfstücke mit Scheuklappen und Zaumzeug mit zwei Paar Zügeln trugen. Daneben wilde und knochige Pferde, die an kurzen Zügeln gehalten wurden und genaugenommen nicht gingen, sondern seitwärts trudelten, über den Boden tänzelten wie Insekten. Einige der Männer trugen kein Hemd und ritten ohne Sattel und Satteldecke. Sie hatten sich die Gesichter bemalt und das lange Haar mit Lederriemen zusammengebunden. Er wunderte sich über diese Eitelkeit der Männer. Einige von ihnen hatten sich einen Federbusch an den Schlapphut gesteckt und trugen rote, orientalische Halstücher. Andere hatten Muschelschnüre um den Hals und den rasierten Schädel blau und zinnoberrot geschminkt. Er sah auch einen Schwarzen mit tätowiertem Gesicht und Zylinder, den silbernen Kolben einer kurzläufigen Muskete auf dem Oberschenkel.
Ihnen folgten entlaufene Sklaven, die, in Gruppen zusammengetrieben, zurück nach Süden geführt wurden. Als die Ketten nicht mehr ausreichten, hatte man ihnen Joche aus Astgabeln aufgelegt und sie aneinandergebunden. Diese staubige, schweigende Prozession bot einen bizarren Anblick. Ihre Kleidung bestand meist aus Flanelloder Kattunflicken, Drillich oder zerschnittenen Decken, die zu Kitteln und in den Hüften hängenden Hosen zusammengenäht waren. Sie hatten sich aufgeschlitzte Bettüberwürfe über den Kopf gezogen und mit einem Gürtel um den Leib gebunden. Die Kinder trugen lange Kittel ohne Unterwäsche darunter. Die meisten hatten nur Lumpen an, doch ein paar waren besser gekleidet als die Reiter. Ein angeketteter Mann trug einen schicken schwarzen Anzug und eine flache Melone.
Die Nachhut bildeten eine weitere Gruppe von Menschenjägern und ein zweirädriger Karren mit geifernden Bluthunden unter dem hohen Fahrersitz. Die Hunde blickten mit ihren blutunterlaufenen Augen zu ihm herüber, gaben aber keinen Laut von sich. Sie waren auf ihre Beute abgerichtet, auf sonst nichts, und diese Beute lief vor ihnen auf der Straße, unters Joch gezwungen und aneinandergekettet.
Nach dieser Begegnung wollte er vor allem Abstand zu den Menschen und zu den Straßen, auf denen sie reisten. Er suchte tief im weglosen Gelände nach den alten, überwucherten Pfaden der Tiere. Er suchte nach Nebenwegen, die von den Viehhändlern genutzt wurden, von den Habenichtsen und den Entlaufenen.
4 DAS STILLE KONZERT
von Licht, Wind und Wasser bot ihm einen selten schönen Ruheort. Hier streckte er sich aus und wurde erst von einem heftigen Rascheln in der Laubschicht unter den Büschen wieder aufgeschreckt. Er mußte lächeln, als er feststellte, daß ein Eichhörnchen auf Futtersuche mehr Lärm machen konnte als ein Schwein, das nach Eicheln wühlt. Er wußte, daß er weitermußte, und er spürte an diesem Morgen schmerzlich die Schuld seiner Aufsässigkeit. Aber er wollte seine Zeit wiederhaben. Wollte, daß sie ihm gehörte. Träge warf er einen Stock in Richtung Rascheln. Es folgte eine lange Pause, dann ein Kratzen, und dann begann das Eichhörnchen von einem Ast aus hoch über ihm zu schimpfen, weil er hier am Ufer störte.
Bald wanderte die Sonne weiter, und ihr Licht traf auf die Stelle, an der er saß. Er dachte, wie herrlich man hier angeln könnte. Aus den Hartholzbüschen drang das Zwitschern von Singvögeln. Schwalben stürzten herab und bauten in dem überhängenden Ufer zu seinen Füßen ihr Nest. In den Wipfeln der turmhohen Bäume rauschte eine Brise, und dann war es wieder still, als hätte sich eine Hand unvermittelt gesenkt. Hinter sich hörte er sein Pferd Grasbüschel rupfen.
Er überlegte, ob er die Nacht durchgeschlafen hatte, konnte sich aber nicht erinnern.
Am anderen Ufer tauchte eine menschliche Gestalt auf, eine gebeugte kleine Frau. Unter ihrer Haube wurde eine Maiskolbenpfeife sichtbar. Langes, geflochtenes Haar fiel über ihren Rücken herab. Sie trug einen hölzernen Eimer, und eine Bambusangel schaukelte auf ihrer Schulter, kurios, aber harmlos. Als sie vom Gras herunter aufs Kiesufer trat, schauten ihre Schuhspitzen unter den Baumwollröcken hervor.
Er wollte schon in den Wald verschwinden, da sah er hinter ihr eine Herde wohlgenährter weißer Gänse auftauchen, eine mobile Essensreserve. Eine Ente war fünfundzwanzig Cent wert, eine Gans fünfzig.
Er beobachtete, wie sie zuerst flußabwärts blickte und dann flußauf am Kiesufer entlang weiterging. Die Gänse folgten ihren Bewegungen, stießen gegeneinander und versuchten watschelnd aufzuschließen. Er hatte kein Geld mehr. Womöglich würde sie sich auf ein Tauschgeschäft einlassen, aber was konnte er ihr anbieten? Er könnte ihr einfach eine Gans stehlen, aber bis jetzt hatte er sich noch nie etwas genommen, von dem er genau wußte, wem es gehörte.
Die kleine alte Frau schien kein großes Interesse am Angeln zu haben; nach einer Weile legte sie die Rute beiseite, setzte sich auf den Eimer und konzentrierte sich auf ihre Pfeife. Die Gänse spazierten scheinbar ziellos umher, bis die kleine Frau ausspuckte. Sofort kamen sie zu ihr herangewatschelt und inspizierten eine ganze Weile die Spucke. Dann fand eine Gans eine Larve und erregte damit das Interesse der anderen, die sich sogleich um sie scharten. Die Frau zog genüßlich an ihrer Pfeife, paffte unablässig graue Rauchwölkchen in die Luft. Über den Bäumen ertönte der rauhe Schrei fliegender Krähen, so überraschend wie das Knacken eines Asts. Eine aufgescheuchte Eule kam in Sicht, kreuzte über dem Fluß sein Blickfeld. Sie glitt über die Wasserfläche dahin und verschwand am Ufer im dunklen Unterholz.
Dann bemerkte er, daß sich das träge Wasser braun färbte und anzusteigen begann. Zuerst ganz langsam, so langsam, daß es ihm gar nicht aufgefallen war, bis es plötzlich schneller stieg. Die Strömung nahm zu, und er sah federweiße Schaumkringel herantreiben und um den Rand der Strudel wirbeln, die sie dann gurgelnd in die Tiefe zogen. Belaubte Zweige und Äste trieben vorbei, und schließlich ein verdorrter Stamm.
Weiter oben mußte es heftig geregnet haben, denn der Fluß schwoll immer weiter an, verwandelte sich in eine schwarze, schlammige Flut. Die kleine Frau stand auf, nahm ihren Eimer in die Hand und wich vor dem Wasser zurück, das ihr bei jedem Schritt an den Füßen leckte. Die Gänseschar watschelte nervös schnatternd um sie herum. Sie setzte sorgsam Fuß vor Fuß, und er wollte ihr schon zurufen, sie solle sich beeilen, doch da war sie bereits höher aufs Ufer gestiegen, wo Sand und Kies in rote, mit Grasbüscheln gesprenkelte Erde übergingen. Sie hüpfte hinauf, und als die Gänse es ihr gleichtaten, sah sie auf den Fluß hinab, der in gemächlichem Auf und Ab die Hochwassermarken am Ufer umplätscherte.
Es kam ihm vor, als würde das Wasser unaufhörlich steigen, so schnell und mächtig kam die Flut herangeströmt. Er vergaß seine Sorge um die kleine Frau und begann sich selbst im Krebsgang zurückzuziehen. Als das nicht schnell genug ging, stand er auf. In diesem Augenblick brach ein großes Stück vom unterspülten Ufer ab. Es gab unter seinen Füßen nach, und er sank auf einer Platte roter Erde dem bräunlichen Strom entgegen.
Sein Abstieg war unaufhaltsam, und sosehr er sich auch bemühte, sich an dem abbrechenden Ufer hinaufzuziehen, es war sinnlos. Er verschwand unter der schmutzigen Wasseroberfläche, doch als er sich vom Grund abstoßen wollte, um Luft zu holen, merkte er, daß das Wasser schon wieder zurückging und er Boden unter den Füßen hatte. Sein durchnäßter Körper kühlte sich rasch ab, und doch fühlte er sich in dem trägen, schäumenden Wasser heiß an wie ein Hornissenstich. Seine Kleider waren mit rotem Lehmschlick bedeckt, der ihm von den Fingerspitzen rann wie Milch oder Blut.
»He, Junge«, ertönte eine Stimme. Es war die kleine Frau mit der Bambusangel, sie kam vom trockenen Ufer herunter ans Wasser. Unter der Haube waren nur ihre Nase und der Pfeifenkopf zu sehen. »Wärst fast ersoffen, was?« erkundigte sie sich.
Er blies sich die brennenden Nasenlöcher frei und spuckte schmutziges Wasser aus. Dann schleppte er sich zu einer flachen Stelle, kämpfte sich durch das überflutete Gestrüpp und stapfte durch das schlammige Wasser weiter, bis er auf festen Untergrund kam. Er betastete noch einmal sein Gesicht und seine Augen und schüttelte die Ärmel aus, ließ Wasser durch die Luft wirbeln.
Die kleine Frau amüsierte sich über sein Unglück. Sie war eine eigenartige, häßliche Person mit schmalen Schultern und einer langen, gekrümmten Nase, die in einem fort tropfte. Sobald sie sie abwischte, bildete sich ein neuer Tropfen. An ihr hing der Gestank von altem Schweiß, der den Moder am Flußufer noch übertraf. Das Bild, wie sich die Gänse am Wasser dicht an sie drängten und ebenfalls zu ihm hinunterstarrten, fand er ziemlich komisch.
»Toll siehst du aus«, kicherte sie. »Sei bloß vorsichtig. Hier draußen ist einem schnell was passiert.«
»Ist das der Rappahannock?« fragte er, als er das Ufer hinaufkletterte. Sie hatte kein sehr freundliches Gesicht. Als er sie ansah, wurde ihm schwindlig, weil ihre Haut im Sonnenlicht zu zerfließen schien. Er erkannte, daß ihr Gesicht von Läusen bedeckt war, und bekam eine Gänsehaut. Die Tierchen wuselten über ihre Wangen, ihre Stirn und ihre Lippen, doch sie schien es gar nicht zu merken.
»Der Bach da?« fragte sie. »Stell dich nicht dumm.«
Und dann: »Was willst du denn am Rappahannock?«
»Sie sind gar keine Frau«, stieß er überrascht aus, konnte die Worte nicht zurückhalten. »Sie sind ein Mann.«
»Jeder Bettler hat seinen Stock, mit dem er die Hunde abwehrt«, meinte die kleine Frau.
Sie nahm ihre Haube ab und zog mit einem Ruck das geflochtene Haar vom Kopf, und tatsächlich, sie war ein Mann. Dann knöpfte der kleine Mann sein Kleid auf und streifte es von den Schultern. Ohne das Kleid wirkte er kauzig, ein mickriger Kerl mit dem Körperbau und der Muskulatur eines Knaben, aber die Haut in seinem Gesicht wirkte im Sonnenlicht wie fließendes Wasser. An seinem Hals und um die Haarbüschel am Nacken wimmelte es ebenfalls, und auch die nackten Arme und die Handrücken waren von Läusen befallen, doch so unglaublich das war, es schien ihm nichts auszumachen.
Er lachte. »Man sieht eben nie, was wirklich in einem Menschen steckt.«
Sein Gesichtsausdruck war unter der beweglichen Maske nicht zu erkennen. Der kleine Mann bohrte mit dem Finger im Ohr, als würde es jucken, dann zog er den Finger wieder hervor und betrachtete ihn.
Seine Stimme nahm einen strengen Ton an, und ohne den Blick vom Finger zu lösen, sagte er: »Du willst dich bei der Armee melden, oder?« Robey schüttelte den Kopf. Sein Magen rebellierte. Er konnte den Mann mit dem zerfließenden Gesicht nicht länger ansehen, aber er konnte den Blick auch nicht abwenden, so fasziniert war er davon. Er hatte keine Angst, aber er fühlte sich wohler, wenn er wußte, wo das Gesicht des kleinen Mannes war, genau wie bei einer Schlange, der man im Wald begegnet. Da ist einem auch wohler, wenn man weiß, wohin sie verschwunden ist.
»Nein«, sagte er.
»Ich war eine Zeitlang in der Armee«, meinte der kleine Mann wehmütig. »Hab die Tage mit Märschen durch schlammige Getreidefelder zugebracht. Jeder großmäulige Scheißkerl mit einem Pferd durfte mich umreiten und auf mir herumtrampeln. Mehr kann ich dazu nicht sagen.«
Nach einer kurzen Pause fügte er an: »Ich könnt’s nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen.«
Er fand den kleinen Mann sehr seltsam und bekam Mitleid mit ihm, denn jemand, der so klein war, mußte sich ziemlich verloren vorkommen in einer Welt, in der alle anderen so groß waren.
»Was ist mit Essen?« fragte der kleine Mann.
»Hab ich mir in letzter Zeit abgewöhnt«, sagte Robey.
»Du hast also Hunger, oder?«
»Ich bin ein Bauch auf Beinen«, antwortete er.
»Zu Fuß unterwegs?«
Er schüttelte den Kopf und bat ihn zu warten, bis er sein Pferd und seine Sachen vom anderen Ufer geholt hatte. Der kleine Mann war einverstanden, und Robey watete durchs Wasser. Der Rappe stand noch immer an der Stelle, an der er ihn zurückgelassen hatte. Er verhielt sich widerspenstig heute morgen und dachte nicht daran, den Fluß zu durchqueren. Robey legte ihm geduldig den Sattel auf und hängte seinen Brotbeutel an den Sattelknopf. Er steckte eine Pistole in den Gürtel und brachte das Pferd mit gutem Zureden dazu, mit ihm ans Ufer zu kommen, doch am Wasser scheute es wieder und trat aus, wollte offensichtlich nicht naß werden. Er strich ihm sanft über die Augen und das weiche Maul.
»Kommst du klar?« rief der kleine Mann zu ihm herüber, die Hände zum Trichter geformt.
Robey erklärte dem Hengst, daß sie sich beide erst stärken und dann weiterziehen würden, aber er brachte ihn nur mit äußerster Geduld dazu, den Fluß zu durchqueren.
»Junge, dein Rappe gefällt mir«, meinte der kleine Mann, als sie aus dem Wasser kamen.
»Ist ein gutes Pferd«, stimmte Robey zu.
»Ich hatte auch mal ein gutes Reitpferd«, sagte der kleine Mann. Und dann verschwand er im Gebüsch und bahnte sich einen Pfad durch das Gehölz, die Gänse im Gefolge.
Robey ging hinter dem Mann her bis zu einem Haus, wo durch die zerbrochenen Fensterscheiben noch mehr Gänse ihre langen Hälse herausstreckten. Andere watschelten über die breite Veranda, vorwitzig und neugierig auf alles, was ihnen wichtig erschien, auch wenn es für das menschliche Auge nicht zu erkennen war. Der kleine Mann befahl ihm, sich nicht von der Stelle zu rühren, während er ihnen etwas zu essen holte, und kein Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen, weil das Brunnenhaus nach einem Brand völlig verrußt war und noch immer vor feuchtem Rauch stank und das Wasser deshalb widerlich schmeckte.
Dann verschwand er im Haus und kam kurz darauf mit einer riesigen Platte mit aufgewärmtem Sauerkraut, gerösteten Zwiebeln, gepökeltem Schweinefleisch und kaltem Rindfleisch zurück. In der anderen Hand hielt er eine Kaffeekanne. Er setzte die Platte zwischen ihnen auf dem Boden ab und hockte sich davor. Nachdem er sich eine Handvoll Sauerkraut und eine Scheibe Fleisch genommen hatte, drängte er Robey, sich ebenfalls zu bedienen. Der war so hungrig, daß er sofort zugriff.
Sie aßen schweigend, schlangen alles gierig hinunter und schmatzten dabei wie Hunde. Robey tat es, weil er so hungrig war, der kleine Mann aber schien es gar nicht anders zu kennen.
Zwischendurch erzählte er Robey die lange Geschichte, wie er aus dem Krieg nach Hause gekommen war, den ganzen Weg von den Höllenhunden gejagt, und hatte feststellen müssen, daß Räuber und Halunken sein Haus heimgesucht hatten. Während er ihre Zerstörungswut schilderte, zuckten seine wimmelnden Lider, und seine Augen waren leer vor Haß.
»Von meiner Familie keine Spur, ich kann nur hoffen, daß sie in Sicherheit ist«, sagte er. Doch seine Stimme verriet keine Hoffnung, klang stumpf und schwermütig.
»Sie werden sie bestimmt finden«, sagte Robey mitfühlend.
»Ja, natürlich«, meinte der kleine Mann.
Er strich sich über den vollen Bauch und rülpste, bestand darauf, daß Robey es ihm nachmachte, und fand es furchtbar komisch, als der es dann tat. Er klopfte sich auf die Schenkel und forderte ihn auf, es noch mal zu machen. Dann legten sie sich ins Gras zurück, und während der kleine Mann sich eine Zigarette drehte, erklärte er Robey, der Krieg habe auch seine guten Seiten.
»Im Krieg«, sagte er, »bekommt man oft auch die besten schlimmen Sachen«, und er reichte ihm die Kaffeekanne, doch als Robey den Deckel anhob, strömte ihm Whiskey-Geruch entgegen, und er lehnte ab.
»Na, komm schon«, meinte der kleine Mann. »Nimm dir einen Schluck, wird dir nicht schaden. Hinter der Tür steht eine ganze Ballonflasche davon.«
Wie um den Beweis dafür anzutreten, nahm er selbst einen langen, gierigen Schluck.
Robey dachte, daß es der kleine Mann sicher auch nicht leicht gehabt hatte, so klein wie er war, und dann nach Haus zu kommen und alles zerstört, wofür er gearbeitet hatte, und die Familie verschwunden und vielleicht tot. Doch jetzt beobachtete er mißtrauisch, wie sich der Mann veränderte. Kaum hatte er den Whiskey getrunken, war etwas über ihn gekommen oder in ihm hochgestiegen. Jedenfalls kam es sehr schnell, und er wurde davon übermannt.
Robey sagte dem kleinen Mann, daß er noch nie Whiskey getrunken habe und daß er sich im Moment auch nicht dafür interessiere, er bedankte sich für das Essen und wollte sich wieder auf den Weg machen.
Der kleine Mann lachte, als wäre er zufrieden mit der Logik seiner Antwort, aber es war ein mißmutiges Lachen. Er nahm noch einen Schluck und versuchte Robey erneut zum Mittrinken zu bewegen, doch der lehnte wieder ab.
»Allein zu trinken macht aber keinen Spaß«, sagte der kleine Mann, als hätte ihm das schon mal jemand gesagt.
»Nein«, sagte Robey noch einmal. »Ich möchte keinen Whiskey.«
»Aber es ist guter Whiskey. Da rast die Zeit nicht so«, meinte der kleine Mann mit süßlicher, schmeichelnder Stimme. »Und er verscheucht alle Sorgen.«
Er nahm noch einen großen Schluck und dann noch einen, um schließlich mit dem Finger die letzten Tropfen aus der Kanne zu holen.
»Ich muß jetzt los«, sagte Robey und merkte, daß er rot wurde vor Ärger darüber, wie töricht er sich verhalten hatte. Plötzlich stieg eine dumpfe Angst in ihm auf. Er hatte sich von dem kleinen Mann in die Falle locken lassen.
»Verkauf mir dein Pferd, eh du gehst«, schlug ihm der kleine Mann vor und leckte sich die Finger. »Damit ich meine Familie suchen kann.«
»Es gehört mir nicht«, sagte Robey, bemüht, seiner Stimme nichts anmerken zu lassen. Er wußte, er konnte sich jetzt nicht länger leisten, ängstlich, zögerlich und nachgiebig zu sein. Er kannte diesen Mann nicht, ahnte nur, daß der einen Entschluß gefaßt hatte und auf keinen Fall von dem Pferd ablassen würde.
»Du hast es gestohlen«, sagte er, und als er sich plötzlich erhob, stand auch Robey auf.
»Ich hab es geliehen«, erwiderte er.
»Du bist begeistert von ihm, stimmt’s?«
Robey sagte nichts. Seine Hand bewegte sich zur Hüfte, wo der Knauf seiner Pistole aus dem Gürtel ragte.
»Nicht jeder Pferdefreund versteht, daß jedes Pferd irgendwann stirbt«, sagte der kleine Mann. Die Augen in seinem wimmelnden Gesicht hatten sich gerötet. Seine Stimme war schrill wie die eines Kindes.
»Es gibt noch andere Pferde auf der Welt«, meinte Robey.
»Verkauf es mir, und sag dem Besitzer, es war erschossen worden.«
»Das kann ich nicht.«
»Keiner verleiht so ein Pferd.«
»Mister Morphew hat es mir geliehen. Ich hab auch eine Bestätigung.«
Ihm brannte das Gesicht vor Scham, weil seine Ehrlichkeit in Frage gestellt wurde und er sich rechtfertigen mußte. Ihm war klar, den kleinen Mann interessierte gar nicht, daß er ein Dokument besaß, mit dem er alles beweisen konnte.
»Ich könnte das Pferd erschießen«, sagte der kleine Mann, zog den Revolver und zielte auf den pechschwarzen Hengst. Robey wußte, daß er das konnte, und nur der Wind und die Bäume wären seine Zeugen. »Gib mir das Pferd, oder ich jag ihm eine Kugel durch den Kopf.«
Später erinnerte er sich an einen betäubenden Schlag gegen den Schädel, dann konnte er den Schuß herausfiltern, und schließlich sah er vor seinem inneren Auge den kleinen Mann mit der Waffe in der Hand. Er wußte noch, daß er ungläubig den Kopf geschüttelt hatte, als sich der Revolver auf ihn richtete, daß er selbst eine Waffe in der Hand gehabt und damit einen Schuß in den Boden vor seinen Füßen gefeuert hatte und daß sich dann sein Gehirn verkrampfte. Sein Kopf war explodiert, und obwohl er kein Hell oder Dunkel wahrnahm, bemerkte er eine Verfinsterung, und dann war da nur noch pulsierendes Schwarz und schließlich nur noch Schwarz.
Als er wieder zu Bewußtsein kam, war es dunkle Nacht, und am Himmel funkelten die Sterne. Er verstand nicht, was mit ihm passiert war, wußte aber, daß er nichts tun konnte. Es mochten Tage vergangen sein, er konnte es nicht sagen, weil ihm jedes Zeitgefühl abhanden gekommen war. Und auch das Gefühl für den Ort fehlte ihm außer daß er wußte, daß über ihm der Himmel und unter ihm die Erde war. Sein Kopf schien zerbrochen, von den Schultern gehoben und vom Hals abgelöst, und doch verursachte er heftige Schmerzen, die seinen ganzen Körper in eisernem Griff hielten.
Die Kugel hatte eine Furche in seinen Schädel geschlagen, und die Kopfhaut blutete heftig. Alles war blutgetränkt, sein Haar, sein Nacken, seine Schultern, und noch immer sickerte Blut in den Boden unter ihm.
Mein Blut ist jetzt auf der anderen Seite meiner Haut, dachte er benommen.
Ihm war schwindlig, und er hatte keine Kontrolle über seinen Magen. In diesen panischen Momenten hoben und senkten sich seine Gedärme und drohten sein ganzes Leben auszustoßen. Und wirklich. Das Heben und Senken ließ nicht mehr nach, und sein Körper schüttelte sich in unwillkürlichen Krämpfen. Die Anfälle kamen regelmäßig, einer löste stets den nächsten aus. Selbst als sein Magen leer war, ging es weiter, bis er schließlich völlig ausgelaugt war. Er hatte bereits sein Leinenhemd zerrissen und so gut es ging um den verletzten Kopf gewickelt.
»Mehr kann ich nicht tun«, keuchte er, an niemanden Bestimmtes gerichtet.
Ihm wurde übel, und dann packte ihn ein starker Schwindel. Um nicht umzukippen, legte er sich zitternd zurück. Er wollte sich einrollen wie ein unschuldiges Kind, doch er wußte, daß er diesen Zustand nie wieder erreichen würde. Er legte sich flach auf den kühlen Boden, die Welt hörte auf, sich zu drehen, und er wartete darauf, erneut das Bewußtsein zu verlieren.
Als er schließlich aufstand, zur Veranda ging und die Schwelle der zerbrochenen Tür überschritt, war es taghell. Gänse watschelten hinter ihm her, verfolgten alle seine Bewegungen, als wäre er der Eindringling in ihr Haus.
Drinnen herrschte ein heilloses Durcheinander, das der kleine Mann hinterlassen hatte. Überall lagen Werkzeugteile, Stiefel, zerrissenes Papier und Kerzengießformen, als hätte ein Sturm sie aus den offenen Schränken und Schubladen gerissen. In der Mitte der beiden Räume befand sich ein Ofen, mit dem die große Küche und das Wohnzimmer gleichzeitig beheizt wurden. An der Wand hing ein Abreißkalender.
Im Wohnzimmer stand ein offener Kamin mit schwerem Eichensims. In der gemauerten Feuerstelle waren die verbrannten Reste einer aufgespießten Gans zu erkennen. Der Teppich war mit Daunen übersät und mit Gänsekot verschmiert, und überall lagen Scherben von zerbrochenem Geschirr. Bei jedem Schritt wirbelte er eine weiße Wolke auf, genug Daunen, um eine Bettdecke damit zu füllen. Die Gänse schauten jedes Mal auf und streckten ihre Hälse zu ihm hin, als erwarteten sie eine Erklärung.
Als er die Treppe hinaufging, strich er mit den Fingern über die geprägte Tapete. Als er oben angekommen war, verschwamm ihm alles vor Augen, und eine Woge von Schmerz durchfuhr ihn, zwang ihn, sich für einen Augenblick hinzusetzen. Er schaute nach unten und sah, daß sich die Gänse vor der Treppe versammelt hatten. Er schloß die Augen, öffnete sie wieder, und für kurze Zeit wurde sein Blick klar. Er stand auf und ging den Flur entlang.
Im Schlafzimmer standen ein einfaches Holzbett mit gedrechselten Bettpfosten und einem schweren Federbett auf einer dicken Strohmatratze und in der Ecke ein vollgestopfter Kleiderschrank. Aus den Türen, die schief aus den Angeln hingen, quollen Kleider, die den Sachen glichen, mit denen sich der kleine Mann verkleidet hatte. Jemand hatte die Schubladen der Kommode herausgezogen und den Inhalt über den Boden verteilt. Überall lagen Sachen, Schuhe und Kleider, mehr, als eine ganze Familie je besitzen konnte.
Auf dem Bett lagen ein Frauenstrohhut und ein Spitzentaschentuch, daneben eine Pfeifensammlung und ein Fächer aus Truthahnfedern. Auf der anderen Seite des Betts entdeckte er die Frau, der die Kleider gehört hatten. Sie saß am Boden, den Rücken an die Wand gelehnt. In ihrem Hals steckte ein Messer, der Griff ragte aus der Wunde, und die Gedärme quollen ihr über den Schoß und die gespreizten Beine. Sie war skalpiert, die Kopfhaut aufgeschnitten und vom Schädel gerissen. Was er sah, schockierte ihn nicht. Was hier geschehen war, erfüllte ihn nicht mit Grauen. Es erinnerte ihn an seine eigene Wunde, und er riß einige saubere Kleidungsstücke in Streifen, mit denen er sich in den nächsten Tagen den Kopf verbinden wollte.
In einem anderen Zimmer stieß er auf mechanisches Spielzeug. Bunt bemalte gußeiserne Kaninchen, die kleine Blechtrommeln schlugen, und Vögel, die mit den Flügeln flatterten und ein kleines blechernes Liedchen pfiffen, wenn man sie mit einem Schlüssel am Rücken aufzog. Ein Affe, der ein Messingbecken scheppern ließ, Kornett spielende Spielzeugsoldaten in leuchtendroten Mänteln und blauen Hosen, winzige Uhren mit Schlagwerk und Spieldosen, so klein, daß sie in eine Hand paßten. An der Wand zwei Bettchen, in denen sich noch die Umrisse der kleinen Körper abzeichneten, die darin gelegen hatten.
Als er wieder hinaustaumelte ins Freie, konnte er gar nicht genug frische Luft bekommen. Im Stall entdeckte er ein kleines dickes Pony mit schlammfarbenem Schweif. Er fand einen Eimer voll Achsenfett und schmierte eine Handvoll auf seinen Kopfverband. Dann betrachtete er die rußigen Reste des Brunnenhauses und überlegte, ob er ein paar Blumen pflücken und sie in den Schacht werfen sollte. Er wußte, was zu tun war, obwohl er so etwas noch nie gemacht hatte. Dann überlegte er, ob er noch mal ins Haus zurückgehen und ein paar Spielzeuge in den schwarzen Steinschlund fallen lassen sollte. Er fragte sich, warum ihn das nach allem, was er schon erlebt hatte, so bewegte. Warum hielt er inne und dachte über Gesten nach, die sein Mitgefühl für die tote Familie zum Ausdruck brachten? Er hatte diese Frau und ihre Kinder nicht gekannt. Er wußte nicht, zu wem sie gehörten und ob sie gute Menschen waren oder nicht. Die Kinder waren sicherlich keine schlechten Menschen gewesen, und auch die Frau nicht, doch was bedeuteten sie ihm? Wäre die Bleikugel besser gezielt gewesen, dann wäre er jetzt da, wo sie waren. Dann wäre er tot.
An diesem Morgen nahm er sich Zeit zum Essen, schlachtete eine Gans und riß ihr die Brusthaut auf. Er löste mit dem Messer ein Stück von der Brust und grillte es in der Feuerstelle. Die anderen Gänse sahen ihm dabei zu. Er fand eingelegtes Gemüse und einen Tontopf mit gepökeltem Schweinefleisch, und er entdeckte Zündhütchen und passende Kugeln, aber keine Waffe dazu.
Beim Essen wunderte er sich nicht über das, was alles passiert war, sondern er überlegte, wie er es einzuordnen hatte. Er wußte, was im Brunnen war, und auch, wie nah er selbst daran gewesen war, dort zu enden. Er hatte sich ziemlich dumm angestellt und nahm sich fest vor, in Zukunft besser aufzupassen. Er erinnerte sich daran, wie der alte Morphew zu ihm gesagt hatte, daß er noch viel zu lernen hätte und daß er hoffentlich lange genug leben würde, um davon zu erzählen.
Er beschloß weiterzuleben, ohne es wirklich beschließen zu können. Er wußte es einfach. Eine innere Stimme sagte ihm, daß es so sein würde. Irgend etwas in seinem Kopf zog sich zusammen. Er spürte Schmerz, und seine Mutter sagte immer, Schmerz ist Schwäche, die aus dem Körper entweicht. Er würde etwas essen und sich dann auf die Suche nach der Armee machen, und falls er den kleinen Mann und den Glanzrappen fand, wußte er genau, was er tun würde, und wenn er es getan hätte, würde er sich nicht bei dem Pferd entschuldigen. Das schwor er sich. Er würde sich nicht bei dem Pferd entschuldigen, auch wenn es hundertmal recht gehabt hatte mit seinem Mißtrauen gegenüber dem kleinen Mann.
Als er gegessen hatte, griff er in die Mähne des kleinen Pferds mit dem schlammfarbenen Schweif, des Ponys der Kinder, schwang das Bein über seinen Rücken und saß auf. Das Pony scheute und setzte sich fast auf die Hinterhand, so schlecht war es erzogen, aber mit seinen Händen und Beinen und mit Worten, die er ihm zuflüsterte, machte ihm Robey klar, daß es jetzt nicht mehr sich selbst gehörte. Es gehörte jetzt ihm. Er blieb sitzen und wartete ab, bis das Pony unter ihm sein Gleichgewicht fand. Er wünschte sich von ganzem Herzen, daß dieser Augenblick vorbeiging und der nächste kam und daß er bald wieder gesund wäre und klüger als zuvor. Er lernte seine Lektionen, er war noch am Leben und dachte sich, daß es etwas wert war.
»Los«, sagte er zu dem Pony. »Geh los.«
Wie faul das Pony auch sein mochte, als er ihm die Absätze in die Seiten bohrte, verstand es und marschierte gehorsam los, um dann in einen ungleichmäßigen Zockeltrab zu fallen.
In einem Sack hatte er ein Glas Melasse, getrocknete Pfirsiche, eine Rehkeule und schwarze Walnüsse mitgenommen. Er hatte Kaffeebohnen und Maismehl dabei. Hinter jedem Bein baumelte eine Gans am Hals. Er ritt nach Norden, den Hufspuren des Glanzrappen folgend.
5 HEUSCHRECKEN SIRRTEN
durch die heiße, trockene Luft, und die Landstraßen waren so staubig, daß er Probleme beim Atmen bekam. Er ritt den ganzen Tag durch das dünnbesiedelte Land, legte sich schlafen, stand bei Sonnenaufgang wieder auf und ritt weiter. Mit dem blutverkrusteten Stoffetzen um den Kopf sah er so elend aus, daß es ihm nicht mehr nötig erschien, den Menschen aus dem Weg zu gehen.
Er kam durch Städte, wo die Leute vors Haus traten und ihm nachsahen, als wäre er eine ganze Armee, anderswo blieb er hingegen völlig unbemerkt, weil die Menschen beschäftigt waren, zum Markt oder zur Kirche gingen oder beim Spiel und im Gespräch beieinandersaßen. Am Straßenrand standen Kinder, älter als er, und starrten ihm nach, und bis auf die Haut abgemagerte Hunde folgten ihm hechelnd durch die Hitze und den Staub. Das Pony erwies sich als störrisches, verschlagenes Tier, es war ständig beleidigt und ließ wie ein verzogenes Kind seine Launen an ihm aus. Wenn er nicht aufpaßte, trat es nach ihm und versuchte ihn ins Knie zu beißen, doch er blieb ruhig und war entschlossen, ihm mit Tritten in die Flanke möglichst viele Meilen abzuringen.
Sein Kopf pochte heftig in der trockenen Hitze. Schmerzen durchzogen ihn, liefen in Wellen vom Kopf über den Hals hinab bis in die Schultern, aber er war auf dem Weg der Besserung, das spürte er. Er wußte, es war normal, daß ihn Schmerz um Schmerz durchzuckte, diese Schmerzattacken immer heftiger wurden, um dann, nach ein paar Tagen, langsam abzuklingen. Hinter dieser Erfahrung des Schmerzes entdeckte er einen Zustand, in dem sein Verstand sich auf den Ratschlag der Mutter und die Existenz des Vaters besann und so zu neuer Klarheit fand. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er alle Ratschläge seiner Mutter in den Wind geschlagen hatte. Doch andererseits: Wäre er ihren Anweisungen gefolgt, dann hätte er knapp eine Meile hinter dem Laden des alten Morphew seinen Weg zu Fuß fortsetzen müssen. Er beschloß, aus den bisherigen Erfahrungen seine Lehren zu ziehen. Es war reiner Zufall, daß er noch am Leben war, und von jetzt an würde er alles neue Wissen rasch und begierig aufnehmen.
Der Boden enthielt mehr und mehr Kalkgestein, das Grün wurde dunkler, und dann quoll frisches Wasser zwischen den Steinen hervor, das er trinken und mit dem er sich waschen konnte. In den nächsten Tagen hielt er oft an, um seine Wunde zu säubern und frisch zu verbinden. Die Schmerzen in seinem Kopf zogen von dort bis in die Brust und den Rücken hinab, und beim Abnehmen der Binde fuhr er jedesmal zusammen, wenn er den Schorf und das verkrustete Blut auf der verheilenden Wunde abriß.
In Richtung Osten wurden die Straßen sumpfiger. Im Nordwesten lag eine Bergkette, die zu seiner Linken verblaßte, als er weiter in Richtung Sonnenaufgang ritt, aufs Meer zu. Als das Pony schlappmachte, band er es einfach irgendwo im Dunkeln an, drang in einen Stall ein und stahl zum ersten Mal ein Pferd, eine kupferfarbene Scheckstute, und führte es geräuschlos weg. Danach war es gar nicht mehr so schwer, und bald überkam ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Bedürfnis, sich ein neues Reittier zu besorgen. Die kupferfarbene Stute tauschte er gegen ein großes cremefarbenes Pferd ein und dieses gegen einen breitschultrigen Fuchsschimmel mit Überbiß und den dann, als er Spat bekam, gegen einen kräftigen raunen, der nicht mehr viel sah. So wurde er ein geschickter Pferdedieb.
Seine Wunde trocknete schnell, die Haut wuchs zusammen und bildete Narbengewebe, das an der Kopfhaut zog. Er war sehr lichtempfindlich, und sein Auge schloß sich von allein, obwohl er dagegen ankämpfte.
Mit seiner Verletzung, dem entstellten Gesicht und den unauffälligen Pferden kam er gut durch Gegenden, in denen Menschen lebten, diese Welt aus Frauen, kleinen Jungen und alten Männern. Man bot ihm etwas zu essen und zu trinken an, und offensichtlich sah er so jämmerlich aus, daß die Leute auch dann nichts sagten, wenn sie das Pferd wiedererkannten. Er nahm die Lebensmittel an und fragte nach den Armeen, und während er darauf widersprüchliche Informationen erhielt, erinnerte sich so mancher doch genau an den pechschwarzen Hengst, wegen seiner Schönheit und auch wegen der eigenartigen kleinen Frau mit der Maiskolbenpfeife, die auf ihm geritten war.
In diesen schmerzhaften Tagen konnte er den Mann erkennen, zu dem er sich entwickeln würde. Er ertrug seine Wunde und den Schmerz als Zeichen dafür, daß auch er von dem Wahnsinn erfaßt war, der das ganze Land schüttelte. Er schreckte nicht mehr vor den Menschen zurück, nicht vor den einsamen Reitern und auch nicht vor den eingefangenen Sklaven, die nach Süden getrieben wurden. Ihre Gegenwart auf den Straßen machte ihm keine Angst mehr, und diesen Wandel verstand er. Er hatte überlebt, war nicht gestorben. Er atmete. Und doch, das war erst der Anfang, er war noch nicht alt genug, um all die Veränderungen zu begreifen, konnte selbst diese Gedanken kaum verstehen.
Seit er der Frau mit den Gänsen begegnet war, wirkte das Land unheimlich auf ihn. Was neu und schön gewesen war, schien jetzt alt und seltsam, unvertraut und falsch. In einer kleinen Stadt setzte er sich auf ein Mäuerchen und sah zu, wie ein paar Jungen seines Alters in sauberen Leinenhemden mit steifen, gestärkten Kragen aus einem Picknickkorb Kupferkopfottern zogen und sie mit dem Schwanz an die Wand einer Scheune nagelten, auf die ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen gemalt war. Als der Junge mit dem Hammer und den Nägeln, der einen Kopf größer war als die anderen, den Befehl dazu gab, ließen alle ihre Schlangen los und rannten mit großem Gejohle davon.
Die Ottern zappelten an der Tür, baumelten herab, zogen sich wieder hoch und wanden sich umeinander. Sie rissen das Maul auf, entblößten ihre Giftzähne und bissen sich gegenseitig, in der Annahme, die Ursache ihrer Schmerzen zu treffen. Die Jungen klatschten sich lachend auf die Schenkel. Dann warfen sie aus sicherer Entfernung Steine nach den Schlangen.
Ein alter Mann mit grauen Haarbüscheln auf dem Schädel kam auf der Suche nach dem Grund für das dumpfe Krachen um die Ecke. In einer Hand trug er einen verzinkten Eimer, in der anderen einen Kautschukgehstock, den er drohend gegen die Jungen schwenkte, als wollte er sie für ihr groteskes Spiel bestrafen. Sie lachten ihn aus und begannen, die Steine in seine Richtung zu werfen. Der Alte zog den Kopf ein und trat stolpernd den Rückzug an, wobei die weiße Farbe im Eimer über den Rand auf sein Hosenbein schwappte.
Dann fand er sein Gleichgewicht wieder und humpelte davon, kam auf Robey zu und setzte sich neben ihn auf das Mäuerchen. Unvermittelt nahm er in der Art, wie es alte und verwirrte Menschen tun, einen Gesprächsfaden auf und erzählte Robey von seiner Frau, die vor kurzem gestorben war, und daß sein Herz jetzt voller Trauer sei, und in der Stadt würden ihn viele für verrückt halten, denn er hatte es an den Nerven, weil er jetzt allein war und er und seine Frau doch eigentlich gemeinsam sterben wollten.
»Ihre Augen haben immer so herrlich gestrahlt«, sagte er.
Der alte Mann besaß noch alle Zähne, was bemerkenswert war für sein Alter, aber sie schienen direkt aus dem Kiefer zu ragen und formten mit den dünnen Lippen eine Art Schnabel. Er mußte niesen, und als er die Hand wieder öffnete, waren die Finger von Schleim benetzt.
»Die Jungs sind wirklich ganz besonders dumm«, meinte er, aber Robey reagierte nicht, verharrte wortlos ohne jedes Nicken oder Schulterzucken. An der Stelle, an der sie saßen, waren die Steine warm von der Sonne und nicht sonderlich unbequem. Er hatte nichts gegen den Alten, und der schien ruhiger zu werden, weniger aufgeregt.
»Ihre Zeit kommt noch früh genug«, fuhr er fort. Die Worte quollen aus dem spitzen Mund, aher Robey sagte noch immer nichts. Er dachte, soll sich der Alte ruhig aussprechen.
Der alte Mann führte seinen Monolog weiter, plapperte vor sich hin und fragte hin und wieder, ob Robey ihm noch zuhöre. Er hielt ihn für einen jungen Soldaten und erzählte davon, wie er als junger Mann in Spanien unter Napoleon gekämpft hatte. Um zu überleben, hatte er Pferdefleisch gegessen und einmal sogar den Unterarm eines toten Menschen. Das Fleisch hatte ihm gut geschmeckt, und er hatte sich geschworen, nie mehr davon zu essen, weil er Angst hatte, er könnte Gefallen daran finden.
»Ich konnte gar nicht genug davon bekommen«, sagte er und spekulierte, daß er nach seinem Tod bestimmt in die Hölle käme, weil er Menschenfleisch gegessen und noch viele andere Sünden begangen hatte, und bei diesem Gedanken mußte er lachen.
Vom Scheunentor drang noch immer der dumpfe Klang der Steine herüber. Aus dem Stall waren das Quieken der Schweine und heftiges Rumpeln zu hören. Die Schlangen ließen eine nach der anderen den Kopf sinken, und die gebrochenen Körper hingen schlaff herab. Die Jungen bewarfen sie weiter mit Steinen, bis die blutleeren Fetzen auf den spreubedeckten Boden fielen.
»Hörst du mir noch zu?« fragte der alte Mann.
Nach einem tiefen Atemzug bejahte Robey die Frage.
»Du hast auch schlimme Dinge getan«, sagte der Alte. »Böse Menschen können miteinander reden. Böse Menschen verstehen sich. Das wissen wir seit Tausenden von Jahren, aber es ändert nichts.«
»Nein«, sagte Robey und bedauerte im selben Augenblick, daß er etwas gesagt hatte. »Ich hab nichts Schlimmes getan«, fügte er an und merkte, daß ihn seine Stimme Lügen strafte.
»Bis jetzt vielleicht noch nicht«, sagte der Alte. »Aber das kommt noch. Du lernst gerade eine der Lektionen des Lebens. Welche genau, weißt du noch nicht, aber du wirst es schon noch herausfinden.«
IN EINER ANDEREN STADT war ein Baseballspiel in Gang, und weil er noch nie eins gesehen hatte, hielt er an und schaute zu. Als man auf ihn aufmerksam wurde, ritt er weiter und war froh, daß nur geistlose Rinder und streunende Hunde seinen Weg kreuzten.
Unterwegs dachte er weiter über all das nach, was ihm der alte Mann so erzählt hatte. Daß er nichts mehr wert sei und niemandem mehr nütze, weil er voller Verzweiflung und Verzweiflung sinnlos sei in Zeiten wie diesen. Er hatte ihm gesagt, Robey solle seine Wut behalten, denn Wut sei nützlicher als Verzweiflung, sie würde ihn ans Ziel bringen. Wer verzweifele, würde mit Sicherheit scheitern und in einer Tragödie enden.
Es waren die Worte eines Verrückten, doch er konnte sich ihnen nicht versperren. Sie hatten sich in seinem Kopf festgesetzt, und er wurde sie nicht mehr los. Das war Schicksal, dachte er. Dann dachte er, wie gern die Menschen doch redeten und redeten. Das galt auch für ihn, und bei dem Eingeständnis, wie verwirrt sein eigener Verstand war, mußte er kichern. Erschreckt blieb sein Pferd stehen und warf den Kopf herum. Er beruhigte es und legte die Hand auf die Pistole mit dem langen Lauf, die in seinem Gürtel steckte. Dieses sonderbare Fabrikat hatte ihm der brabbelnde Alte geschenkt.
Er setzte seinen Weg fort, orientierte sich an den Gerüchten von großen Armeen, die angeblich weiter im Osten an den Ufern eines Flusses Stellung bezogen hatten. In den folgenden Tagen irrte er weiter durch diese Landschaft des Krieges, und als eines Nachts ein kalter Wind über das offene Land fegte, suchte er Zuflucht in einem ausgebrannten Haus.
Nachdem er sein Pferd angebunden hatte, trat er so vorsichtig ein wie jemand, der die Stabilität der Bodenbretter prüfen will. Draußen rauschten sanft die Bäume. Die Pumpe im Hof hatte er zunächst für die schwarze Silhouette einer menschlichen Gestalt gehalten, und auch als er seinen Irrtum erkannt hatte, warf er immer wieder einen mißtrauischen Blick hinaus auf den Hof und zu den Bäumen, wo der Braune angebunden war.
Er zündete die Talgkerze einer Stallaterne an und schlich von Zimmer zu Zimmer; und nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß niemand außer ihm im Haus war, machte er im Kamin ein kleines Feuer, das den Raum bald mit seinem warmen Schein erhellte. Er legte sich auf den Holzboden, und die Wärme ließ langsam die Schmerzen des Tages aus seinen Gliedern schwinden. Eine ausgebrannte Treppe führte hinauf in den ersten Stock, und von der verkohlten Decke hing ein herrlicher Kronleuchter mit Behang, der aussah wie geschliffene Diamanten.
Der Kronleuchter erschien ihm zuerst wie der Nachthimmel mit seinen funkelnden Sternen, dann wurde ihm klar, daß tatsächlich die Sterne durch die verbrannte Decke hereinleuchteten und das geschliffene Glas zum Funkeln brachten. Der Kronleuchter schien erst nach dem Brand aufgehängt worden sein, so rein und unberührt waren die Glasprismen, die das Licht reflektierten.
Als sich der Wind legte, erstarb auch das Rauschen in den Bäumen. Erst jetzt fiel ihm auf, daß dieses Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund gewesen war. In der neu entstandenen Stille war ein Ticktack, Ticktack zu hören. Er suchte den Raum ab, und dann erfolgte ein sauberer, mechanischer Ton, und er fand die Quelle des Geräuschs, als ein winziges Türchen aufging und ein Kuckuck herauskam.
Jemand hatte die Uhr aufgezogen und den Kronleuchter aufgehängt und mit diesen hilflosen Gesten versucht, eine Zeit zurückzuholen, die wohl niemals wiederkommen würde. Eine Zeit, das wurde ihm jetzt klar, die er in seiner Abgeschiedenheit zu Hause niemals erlebt hatte, die er erst jetzt inmitten von Chaos und Verwüstung kennenlernte. Wie war das Leben vorher gewesen? Was hatten die Menschen getan, und worüber hatten sie nachgedacht, ehe sie Krieg führten und nur noch an Krieg dachten? Er versuchte sich daran zu erinnern, was er getan hatte, bevor er vom Berg herunterkam, und was er dort gedacht hatte. Woran er sich erinnerte, waren Arbeit und Ruhe und Einsamkeit. Er wußte, das war nicht alles, aber mehr fiel ihm nicht ein, und dabei war es doch noch gar nicht so lange her. Er kramte in seinem Gedächtnis, wie er damals gewesen war, aber sosehr er sich auch bemühte, es kam nichts zurück.
Er legte das Anzündholz, das er gesammelt hatte, auf das kleine Feuer, und als rote und blaue Flammen aufzüngelten, erhellte sich das Zimmer und ließ weitere sehnsuchtsvolle Erinnerungen in ihm aufsteigen. Da stand ein Intarsienkästchen mit glänzenden Steinen, und daneben Dosen aus Zinn oder Kupfer und Lackkästchen aus Hölzern, die er noch nie gesehen hatte und deren Namen er nicht kannte. Sie enthielten Münzen und Knöpfe, Bänder, Murmeln, Stecknadeln, winzige Knochen und ein Puppenbein.
Er entdeckte eine angeschimmelte Sitzbank, aus der es nach Wolle und Lavendel roch, in der aber nichts lag außer einer Porzellanpuppe mit einem blauen Filzhut und langen Haaren aus strohfarbenem Garn. Ein Bein war abgerissen, aber als er mit dem Ärmel über das Gesicht der Puppe wischte, kam sie ihm vor wie neu. Das brennende Holz knackte und zischte in der Stille, und in der Luft sah er die schwarzen zuckenden Schatten der Fledermäuse, die den Raum mit ihrem geräuschlosen Flügelschlag füllten und durch die leeren Öffnungen der Fenster und Türen vor dem Licht nach draußen flohen.
Er stellte Kaffee auf und briet in einer Blechpfanne seinen letzten Speck. Dann knetete er aus Wasser und gesalzenem Maismehl einen dünnen Teig, um ihn über dem offenen Feuer auf dem Blatt einer zerbrochenen Hacke zu backen. Er stellte sich vor, wie er sich Kaffee eingießen und seinen Maiskeks hineintunken würde. Es würde schmecken und ihn wärmen bis zum Magen hinab. Sein Hunger nahm zu, und während er das Essen zubereitete, fiel sein Blick zufällig auf die Porzellanpuppe, die er an den Kamin gelehnt hatte. Dabei rieb er sich geistesabwesend am Kopf, an der Stelle, wo die Haut allmählich verheilte und sich manchmal anfühlte, als würden winzige Pfoten daran ziehen. Er hielt das Beinchen an die Hüfte der Puppe, es paßte.
Jetzt hätte er gern die Wut verspürt, die ihn erfüllte, als er sich blutend von der Erde hochstemmte. Die Wut, von welcher der alte Mann gesagt hatte, daß er sie zum Überleben brauchte. Er wollte sie in sich spüren wie einen eisernen Stachel, doch heute abend war da nichts. Heute war er zu müde, um wütend zu sein, und er hoffte, daß er am Morgen, wenn er ausgeruht war, wieder dazu fähig wäre.
»Was meinst du?« fragte er die Puppe mit dem Porzellangesicht, und da keine Antwort kam, flüsterte er: »Nichts.«
Als der Kaffee kochte, goß er ungeduldig eine halbe Tasse davon in die fettige Pfanne und verbrannte sich die Finger und den Mund, weil er vor Hunger nicht abwarten konnte. Er schob den Maiskuchen in die Brühe und aß das Ganze mit den Fingern, wischte auch die letzten Reste aus der Pfanne und leckte sie sich von den Fingern und vom Handrücken. Dann putzte er sich über den Mund und war fertig. Ihm war bewußt, daß er gefressen hatte wie ein ausgehungertes Tier und seine Mutter das sicher mißbilligt hätte, und er dachte, wie schön es wäre, seine Mahlzeiten eines Tages wieder anders zu sich zu nehmen.
»Bald wieder«, seufzte er und setzte sich dicht ans Feuer, erschöpft von diesem Akt des Heißhungers und zugleich erstaunt darüber, wie schnell das Essen verspeist war. Er wußte, daß er zum Schlafen nach oben klettern oder sich nach unten verkriechen sollte oder ins Freie gehen und bei seinem Pferd übernachten. Die Geräuschlosigkeit der plötzlichen Windstille machte ihn mißtrauisch.
Aber sein Magen war gefüllt, und er war müde und wollte nur noch schlafen, er war schon so lange wachsam. Als er die Augen schloß, zuckten feurige Pfeile vor seinen Lidern. Der Schlaf kam und senkte sich langsam auf ihn, überwältigte ihn wie ein erdrückendes Gewicht, gegen das er sich nach Kräften zu wehren versuchte. Es ließ ihn Schmerz und Niederlage spüren und dann Erleichterung, und schließlich kam er nicht mehr dagegen an und brach unter ihm zusammen.
Als ihm der Kopf auf die Brust fiel, nahm er wahr, daß das Feuer im Kamin ausgegangen war und nur noch die Asche glomm. Die Puppe mit dem Porzellangesicht war neben dem Feuer zusammengesunken, als hätte auch sie der Schlaf übermannt. Er setzte sie wieder aufrecht hin, und als er aufstand und seine schmerzenden Glieder reckte, konzentrierte er sich auf das schwache Geräusch, das ihn geweckt hatte. Ein Muskel in seinem Magen begann zu flattern. Dann hörte er, daß das Geräusch von draußen kam. Es waren ein Mann, der einen Ochsen antrieb, und dann das Kratzen einer Schleppbahre auf dem harten Boden und schließlich die dünne und wehleidige Stimme einer Frau, die ihre mißliche Lage beklagte. Robey stieß mit dem Fuß ins Feuer und trat die Funken aus. Dann raffte er, so schnell es ging, seine Sachen zusammen, und weil sie schon fast im Hof waren, konnte er nur noch an den verkohlten Stützbalken hinaufklettern in den ersten Stock.
6 AM OBEREN ENDE DER TREPPE
konnte er durch das offene Dach den Himmel sehen, während der verwüstete erste Stock im Schatten der Giebelmauern lag. Dort oben unter den Sternen war die Nacht nicht so dunkel, und er beobachtete von seinem Standpunkt im Schatten der Mauern aus, wie ein abgehärmter Ochse auf das Haus zutrottete. Neben dem Tier gingen ein Mann und ein Mädchen, und auf der ruckelnden Schleppbahre lag eine unförmige Frau, die sich auszuruhen schien. Als der Ochse anhielt, richtete sie sich mühsam auf. Sie schob die Hände unter ihren schweren Bauch und hob ihn an, als würde sie damit sich selbst anheben. Das Mädchen kam ihr zu Hilfe, und die Frau dankte ihr dafür. Der Mann sagte, er habe hier Rauch aufsteigen sehen und den Duft von Speck und Kaffee gerochen. Er schnupperte übertrieben in der Luft, und im nächsten Augenblick wurde er von einem schlimmen Hustenanfall geschüttelt, der tief aus seiner Brust kam. Er war stabil gebaut, hatte kräftige Handgelenke, einen Stiernacken und breite Schultern. Sein Bauch hatte die Form einer Trommel, und er schaute mit dem arroganten Blick eines Raubvogels um sich.
»Schür den Herd an«, befahl er dem Mädchen und schubste sie in Richtung Tür. Sie kam ins Stolpern und schickte ihm einen Fluch über die Schulter. Dann führte der Mann auch die Frau ins Haus, und Robey verfolgte vom ausgebrannten Obergeschoß aus, wie die gespenstischen Gestalten unter ihm umhergingen, als würden sie von etwas angetrieben.
Das Mädchen schaute prüfend auf die Glut, die er in der Feuerstelle hinterlassen hatte, und sah sich kurz um, sprach den Mann und die Frau aber nicht darauf an. Mit einem eisernen Schürhaken stocherte sie in der Glut, bis eine Flamme aufflackerte. Dann warf sie eines der Holzkistchen hinein. Im ersten Lichtschein, der sie umspielte, konnte er ihr Gesicht nicht erkennen, weil es von den Haaren verborgen wurde. Doch als sie ihr Haar raffte und es auf eine Seite warf, sah er, wie schmal und hohlwangig sie war.
»Ich fürchte, wir sind am Ende«, stöhnte die Frau. Sie streckte die Arme vor, als suche sie nach Halt, und bewegte sich auf die Wärme des Feuers zu. Ihre Hände fanden den Weg für sie, auf dem nackten Holzboden ging sie in die Knie, stützte sich ab und ließ sich auf die linke Hüfte sinken.
»Hol die Taschen«, forderte der Mann das Mädchen auf.
Es war ein schroffer Ton, und sie reagierte, als bestünde zwischen ihnen eine alte Feindschaft. Der Mann kramte in einem Rupfensack, zog eine grüne Flasche hervor und hielt sie vor das Feuer, um ihren Inhalt abzumessen. Dann zog er den Korken heraus und nahm einen Schluck. Im Feuerschein konnte Robey sein spärliches weißes Haar, den kraftvollen Nacken, die weißen Koteletten und die schwarze Livree erkennen. Sein eines Bein schien ihm Probleme zu bereiten, denn er kratzte in einem fort daran und klatschte dagegen. Nach einem zweiten Schluck aus der Flasche mußte er noch einmal husten und schien dann zufrieden.
»Hol sie doch selbst«, sagte das Mädchen und rührte sich nicht von dem Feuer, das sie gerade entfachte.
»Wenn ich sie holen muß, geht’s dir schlecht«, drohte er.
»Sind sowieso leer«, meinte das Mädchen, und die Frau berührte stöhnend ihren aufgequollenen Bauch.
»Werd mir bloß nicht frech«, knurrte der Mann, ging quer durch den Raum auf sie zu und versetzte ihr einen heftigen Schlag, nach dem sie zu Boden ging. Robey zuckte zusammen.
»Sie ist bald soweit«, sagte das Mädchen, das auf dem Boden kauerte.
»Noch lange nicht«, meinte der Mann und nahm einen weiteren Schluck. »Ich sag schon, wenn sie soweit ist.«
Robey drückte sich dichter an die Giebelmauer, während er verfolgte, was sich unter ihm abspielte. Er ließ die Hand vorsichtig zum Gürtel gleiten, an die Pistole, deren langer Lauf bis zum Oberschenkel hinabreichte. Ihr Griff war glatt, und die Kammern waren erst vor kurzem gefüllt worden. Auf ihn würde keiner mehr schießen. Dessen war er sich sicher.
»Wir werden Frost kriegen heute nacht«, sagte der Mann, und nach einem Blick durch den leeren Raum: »Wohin die Leute wohl verschwunden sind? Sie können noch nicht lange weg sein.«
»Wahrscheinlich sind sie abgehauen, als sie uns gehört haben«, sagte das Mädchen mißmutig. »Wir werden keinen Frost kriegen«, fügte sie an, als wäre das nur eine neue Schnapsidee von ihm.
»Hilf mir die Stiefel ausziehen«, sagte der Mann und setzte sich auf die Bank. »Oder du kriegst noch eins drauf.«
Das Mädchen stand auf und ging langsam auf ihn zu, zog ihm die Stiefel von den Füßen und ließ sie zu Boden fallen. Der Mann lief in Strümpfen durchs Zimmer und kratzte sich wiederholt am Bein. Er befahl dem Mädchen, alles aufzusammeln, was sie als Brennholz verwenden konnten, damit sie in dieser kalten Frühlingsnacht nicht erfrieren mußten.
»Es friert nicht«, sagte sie, als sie eine zweite Holzkiste fand. Sie betrachtete diese einen Moment lang und stellte sie dann, ohne sie zu öffnen, sachte ins Feuer. Dann sah sie die Kuckucksuhr und legte auch die in die flackernden Flammen.
»Die da auch«, sagte der Mann und deutete auf die Bank. »Die ist aus Holz. Brennt gut.«
Das Mädchen kippte die Bank um und trat dagegen, bis sich die Verzapfung lockerte und die Bank auseinanderfiel. Währenddessen stand der Mann mitten im Raum, trank aus der grünen Flasche und vergnügte sich damit, den Ruf von Nachtvögeln nachzuahmen. Dazu mußte er die Flasche in die Tasche stecken, um mit verschränkten Fingern in die hohle Hand blasen zu können. Er wartete, doch es kam keine Antwort auf seine dürftigen Imitationen.
Als ihn das langweilte, hob er eine Latte auf und schlug damit gegen den Kronleuchter, machte sich einen Spaß daraus, auch die winzigsten Glasprismen zu zerbrechen. Er blieb neben dem Mädchen stehen, das vor dem Kamin kniete und die Bank Teil für Teil ins Feuer warf. Er hob eine Locke von ihrem Nacken und flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin sie erstarrte.
»Du dreckiger Hund«, sagte sie, schwang herum und schlug ihm mit dem Schürhaken auf den Kopf. Er schrie auf und rannte, die Hände an den Kopf gepreßt, aus dem Haus.
»Was ist los?« rief die Frau und ruderte mit den Armen durch die Luft. »Was passiert hier?«
»Ach, nur ein dreckiger Hund«, sagte das Mädchen voller Abscheu. »Du mußt nicht immer gleich durchdrehen.«
»Ein Hund?« rief die Frau. »Was für ein Hund? Wie kommt ein Hund hier rein? Ich hasse Hunde.«
Im Schutz der Giebelwand sah Robey, wie der Mann durch den dunklen Hof schlich. Er ging in die Richtung, wo Robey sein Pferd angeleint hatte, blieb aber ein ganzes Stück davor stehen. Er hantierte an der Pumpe, und als der Griff in seiner Hand abbrach, trat er fest dagegen und geriet darüber ins Schwanken.
Das Mädchen versuchte währenddessen, es der blinden Frau am Feuer bequem zu machen. Die Blinde fragte immer noch nach dem Hund, doch das Mädchen sagte nichts mehr dazu und beruhigte sie.
Als der Mann zurückkam, schien es, als wäre nichts geschehen zwischen ihm und dem Mädchen. Er setzte sich auf den Boden, genau an die Stelle, wo Robey eingeschlafen war, und schien instinktiv zu spüren, daß vor kurzem ein anderer Mensch dort gesessen hatte. Doch er entspannte sich rasch. Dann zog er eine Handvoll harter Kekse aus der Tasche, brach Stück für Stück davon ab und schob sie sich schweigend in den Mund. Er zupfte die trockenen Krümel von seiner schwarzen Jacke und leckte sie penibel von den Fingerspitzen.
»Wenn’s nach mir ginge«, erklärte er, »hätte ich gerne Gans und Austern, Rührei und Nußkuchen.«
»Ja, wenn«, meinte das Mädchen spöttisch. »Wenn die Frösche Flügel hätten, würden sie nicht bei jedem Sprung auf den Hintern knallen.« Der Mann schlug sich prustend auf die Schenkel. Dann schnickte er ein Stück Keks über den Boden zum Feuer hin, und das Mädchen schnappte es sich und drückte es an die Brust.
»Was ist das?« fragte die Blinde, fast schon hysterisch, und tastete suchend den Boden ab.
»Gar nichts«, sagte das Mädchen und lutschte behutsam an ihrem Keks, um kein Geräusch zu machen.
»Erzähl mir nichts«, antwortete die Frau. »Ich bin doch nicht dumm. Ich weiß, daß hier Ratten sind.«
»Wir könnten das Hühnchen braten, das du versteckt hast«, sagte das Mädchen zu dem Mann.
»Welches Hühnchen?« fragte er.
»Das Hühnchen, das du versteckt hast.«
»Das ist mein Hühnchen«, entgegnete er gelassen.
»Aber ich hab’s gestohlen«, sagte das Mädchen.
»Ich hab Hunger«, stöhnte die Frau. »Macht doch bitte das Hühnchen.«
»Gib wenigstens deiner Frau was zu essen«, sagte das Mädchen.
»Bitte«, drängte die Blinde, und der Mann kratzte sich am Kopf, als müßte er gründlich über diesen Vorschlag nachdenken. Schließlich schien er einen Entschluß gefaßt zu haben, denn er knöpfte seine Jacke auf und zog das Huhn heraus, das er sich an einem Strick um den Hals gebunden hatte.
»Da hast du das verdammte Huhn«, brummte er und warf es dem Mädchen zu.
Robey sah, wie sie es rupfte und ausnahm und die Innereien auf die Steinplatten vor der Feuerstelle legte. Dann steckte sie das Huhn auf den Eisenspieß und hielt es über die Flammen. Als die Haut heiß wurde und Blasen warf, tropfte Fett ins Feuer, und es zischte und flackerte. Der Mann rückte näher heran, und sie sahen gemeinsam zu, wie das Hühnchen Farbe annahm.
Die Frau fragte, was gerade passierte, und er erklärte es ihr. Sie machte ihm klar, daß sie selber hören und riechen könne, nur sehen könne sie nicht. Er sah sie an, als wäre ihm das völlig neu, während das Mädchen hinter vorgehaltener Hand kicherte.
»Ich will nur wissen, ob es schon gar ist.«
»Es ist gleich fertig«, sagte er.
Als sie das Hühnchen verspeist hatten, entspannte sich die Stimmung im Raum. Ihr Bedürfnis, sich mit Wut und Gewalt zu begegnen, schien durch das Essen befriedigt. Die Blinde sagte etwas zu dem Mädchen, was Robey nicht verstand. Das Mädchen half ihr auf und führte sie durch den Schutt hinaus auf den Hof, wo sie ihre Röcke raffte und sich zum Wasserlassen hinkauerte. Dann hob das Mädchen ebenfalls ihre Röcke bis zur Hüfte und tat es ihr gleich.
Als sie zurück waren, bereitete der Mann seiner Frau am Rand der warmen Feuerstelle ein Schlaflager vor. Das Mädchen half der Frau, sich auf die Seite zu drehen, und deckte sie mit einer Wolldecke zu. Dann ließ sie sich selbst nicht weit davon nieder und zog ihre Decke bis ans Kinn hoch. Im selben Augenblick entdeckte sie die Porzellanpuppe und drückte sie eilig an ihre Brust, hielt sie unter der Zudecke verborgen.
Als sich alle zur Ruhe gelegt hatten, bestand der Mann darauf, daß sie vor dem Einschlafen beteten. Er sprach sein Gebet in der aufrichtigen, erfahrenen Art eines Geistlichen. Robeylauschte seinen frommen, dramatischen Worten. Ein seltsamer Diener des Herrn. Hoffentlich würden sie rasch einschlafen, wenn er mit dem Beten fertig war, denn Robey war müde, und die Beine taten ihm weh, weil er so lange reglos dagestanden hatte. Sobald sie schliefen, konnte er an dem Stützbalken hinunterklettern und im Dunkeln verschwinden.
Doch als der Mann sein Gebet beendet hatte, griff er erneut nach der grünen Flasche und trank weiter. Sein Bein bereitete ihm noch immer Probleme. Er schüttelte es unter der Zudecke, klopfte mit der Ferse auf den Boden. Dann stand er auf und stapfte hin und her, bis ihm schließlich ein Einfall kam und er die Hose herunterzog, um die juckende Stelle zu untersuchen.
»Verfluchte Zecke«, grummelte er.
Er schlurfte zur Feuerstelle, packte den Schürhaken und drückte die rotglühende Spitze an sein Bein. Der Geruch von verschmorten Haaren und verbranntem Fleisch stieg zu Robey hinauf, der an der Giebelwand stand und hinunterschaute auf den im engen Lichtkreis stehenden Mann, die Augen zwei schwarze Löcher, den Mund zu einer Grimasse verzerrt, als er das glühende Eisen an sein Bein hielt und die Zecke zwang, den Rückzug anzutreten.
Robey betrachtete durch den kaputten Fußboden hindurch den Mann, der immer noch von der Hüfte abwärts nackt war und den Kopf vor- und zurückwarf wie ein wütender Stier, der mit seinen Hörnern die Luft durchstößt. Dann setzte er die Flasche an und leerte sie bis auf den letzten Tropfen. Er zog die Hose hoch und ging auf und ab, hob hin und wieder das verbrannte Bein an und schüttelte es. Der Schmerz hatte anscheinend nachgelassen, doch jetzt schien ihn ein anderer Gedanke zu quälen. Er begab sich zurück auf sein Lager, war aber zu rastlos, um Schlaf zu finden.
Robey wartete geduldig ab, hoffte, der Mann würde wie die Frau und das Mädchen zur Ruhe kommen. Er hatte den wackeligen, gezackten Stützbalken im Blick, den er hinabrutschen mußte, schaute dann in die Richtung, in die er sich davonmachen wollte, und spähte wieder durch den Fußboden nach unten. Der Mann war noch wach. Er robbte langsam auf das schlafende Mädchen zu. Sie drehte sich im Schlaf um und wurde ebenfalls wach, legte die Hand vor den Mund, als sie sah, daß er näher kam.
»Schläfst du schon?« fragte er und kroch weiter auf sie zu. »Hast du schon geschlafen?«
Sie antwortete nicht, doch als er nah genug war, zog sie die Decke weg und trat nach ihm. Sie traf ihn am Kopf, aber er packte ihren Fuß und hielt ihn fest. Als sie mit dem anderen Fuß nach ihm trat, ergriff er auch den, zerrte sie von ihrem Lager und zog sie so schnell an sich, daß es aussah, als wäre sie unter ihm verschwunden.
Im ersten Moment wußte sie nicht, was sie tun sollte, aber dann wehrte sie sich, drehte und wand sich auf dem Holzboden hin und her. Sie schlug mit den Fäusten nach ihm und zerrte an seinem weißen Bart. Er wehrte sie ab, versuchte sie zum Verstummen zu bringen, doch als sie nicht nachgab, schlang er den Arm um ihren Hals und schlug sie mit der Faust ins Gesicht.
Als sie sich noch immer wehrte, schlug er noch einmal zu, bis sie stöhnend in seinem Arm zusammensackte. Nach einem letzten Schlag ließ er sie auf den Rücken sinken, wo sie reglos liegenblieb. Er wartete kurz ab, hob dann ihre Röcke und zog ihr die Unterwäsche herunter, bis auch sie von der Hüfte an nackt war. Doch als er sich zwischen ihre Beine schob, raffte sie sich noch einmal auf und trommelte erneut auf ihn ein. Sie trat ihm mit den Fersen ins Gesäß, wölbte sich auf und zerkratzte sein Gesicht. Er packte ihre dünnen Arme und verdrehte sie, bis sie vor Schmerz aufschrie, zog ihr die Arme dann hoch über den Kopf und hielt sie fest, während sie weiter um sich trat. Jetzt drückte er ihre Beine mit seinem Körper so weit auseinander, daß sie nicht mehr nach ihm treten konnte.
»Hilf mir«, rief er der blinden Frau zu. »Sie dreht durch.«
Die Frau fing an zu weinen und zu jammern, und als er ihr drohte, vergrub sie sich tief in ihr Bettzeug.
»Halt ihr die Beine fest«, rief er der Frau zu, aber die regte sich nicht.
»Du tust mir weh«, stöhnte das Mädchen.
»Das ist mir scheißegal«, sagte er und schlug sie auf die Wange.
Ihre Schmerzensschreie und ihr Flehen, er solle sie in Ruhe lassen, erfüllten den ganzen Raum. Der Mann drückte sich mit einem Arm nach oben und versetzte ihr mit der anderen Hand einen heftigen Schlag gegen den Kopf, und sie verstummte wieder. Er packte ihre Haare und zog ihr den Kopf so weit nach hinten, daß Robey ihren weißen Hals sah.
Dann verschwand der Mond hinter den Wolken, und alles war dunkel. Wind kam auf, und Robey hörte undeutliche Geräusche von unten, wo sich der Mann weiter an dem Mädchen zu schaffen machte, das wie ein kleines, angepflocktes Tier winselnd unter ihm lag. Robey ließ den Kopf nach hinten gegen die Wand fallen, hatte die Hand am Knauf der Pistole. Die Geräusche von unten klangen dumpf in ihm nach, verhärteten sich dort und zerbrachen in kleine spitze Splitter. Als er den Kopf noch einmal gegen die Wand schlug, platzte seine Wunde auf und Blut lief ihm den Nacken herunter. Er wußte, er mußte etwas tun, und er wußte zugleich, daß er nichts tun würde.
Als der Mann fertig war, sank er in sich zusammen und blieb reglos auf dem bebenden Körper des Mädchens liegen. Dann richtete er sich abrupt auf, als müßte er sich von ihr losreißen. Schwer atmend kroch er hinüber auf sein Strohlager und war nach einigem Niesen und Fluchen schließlich still. Er ließ seine Hand nach unten gleiten, legte sie zwischen seine Beine, und bald drang rauhes Schnarchen aus seiner Kehle.
Das Mädchen lag zusammengekrümmt im Mondlicht, die nackten Beine bleich wie Knochen. Dann zog sie die Knie hoch, bis die Beine unter ihren Röcken verschwanden, hielt sie umklammert und fest an den Brustkorb gedrückt.
Robey wartete, bis alle tief zu schlafen schienen, und glitt dann wie eine Katze an dem Balken hinab, verharrte kurz und musterte die Schlafenden einen nach dem anderen, die Pistole in der Hand, den Lauf nach vorn gerichtet.
Er stand neben dem Mädchen und sah, daß sie noch wach war, und er schaute in ein zartes, erschöpftes Gesicht. Zunächst wirkte sie, als hätte sie jeglichen Kontakt zur Welt verloren. Sie lag einfach da und starrte zu ihm hoch, starrte ins Nichts, ohne zu blinzeln oder zu atmen, ohne etwas zu sagen oder zu flüstern. Sie war zutiefst verletzt, vielleicht war sie innerlich gestorben.
Als sich ihre Blicke trafen, kam der Mond wieder heraus, erhellte den Boden ein wenig und schien ihr ins Gesicht. Ihre Lippen waren aufgerissen, und sie blutete aus der Nase. Als sie die Unterlippe zwischen die Zähne nahm, dachte er, sie kehrte eben erst unter die Lebenden zurück. Ihre Augen spiegelten geballten Haß, der sich in ihr abgespalten hatte und aus dem sie nicht mehr herausfand, nicht mehr zurückfand zu Trauer oder Schmerz oder zu irgendeinem anderen Gefühl. Der Haß war in ihr, und er würde in ihr bleiben.
Sie riß den Mund auf, als sie ihn anstarrte, doch ihr war das Herz so voll, daß ihr die Stimme versagte, und in dieser Welt aus Stein war nur das Klagen des Windes zu hören.
Beschämt legte er die Decke über ihren zusammengekrümmten Körper. Dann wich er eilig von ihrer Seite und schlich nach draußen, zu den Bäumen, wo er das Pferd festgebunden hatte. Die ganze Nacht ritt er die schwarze Straße entlang, folgte ihren Windungen im Licht der Sterne, bis die fahle Dämmerung den Osthimmel rötete und das Grün der Wiesen zurückkehrte. Die Straßen wurden weiß, und dann kam die goldene Sonne und mit ihr die Hitze, und erst viele Meilen weiter legte er sich schlafen.
7 IN EINEM BAHNEINSCHNITT GAB
plötzlich das Gleisbett nach, und sein Pferd, das so gut wie blind war, ging in die Knie, und er fiel aus dem Sattel. Als das Pferd stürzte, hörte Robey einen Knochen zerbrechen. Er hatte im letzten Augenblick den Kopf des Tiers zurückgerissen, und es hatte die Vorderbeine steif gemacht, um den Sturz zu verhindern, doch es war schon zu spät, um das Geschehen noch aufzuhalten.
An der Stelle, an der das Gleisbett locker war, hatte der Braune sein Hinterbein unter der Schiene eingeklemmt, schlug aber trotzdem um sich und versuchte, sich wieder aufzurichten. Die Hufeisen schlugen Funken aus der anderen Schiene und knallten heftig gegen die Schwellen. Das rechte Vorderbein sah aus, als hätte es zwischen Ellbogen und Fesselkopf ein zusätzliches Gelenk, und es schwang wild hin und her, als sich das Tier zum Stand aufrichtete. Schließlich durchstieß das zersplitterte Rohrbein die Haut und ragte scharf wie eine Spitzhacke hervor.
Er stand da und redete auf das Pferd ein, sagte ihm, es solle sich hinlegen, und als es nicht folgte, trat er näher, nahm den unruhigen Kopf des Tiers in die Arme und legte seine Hände auf die angsterfüllten Augen. Er ließ nicht einmal los, als ihn der kraftvolle Nacken des Tiers von den Füßen hob. Erst als sich der Braune hinlegte und vor sich hin schnaufte, lockerte er den Griff. Das Pferd streckte den Hals vor und schnupperte an ihm. Er strich dem Tier unentwegt über Backen und Stirn, nahm die Hand nicht mehr weg.
»Du hast dir das Bein gebrochen«, flüsterte er, das Gesicht dicht an seinem Ohr.
Das Pferd lag auf der Seite, den starren Blick auf ihn gerichtet. Es schnaubte, und sein Fell bebte, und Robey schloß daraus, daß es verstand. Er kniete nieder und drückte sein Gesicht an den weichen Pferdehals, hielt die Hand an das samtweiche Maul und sagte dem Tier, daß es keine Angst haben müsse. Erst jetzt spürte er, wie sein Knöchel im Schuh pochte, und er stieß einen leisen Fluch aus.
Das Pferd hob den Kopf und ließ ihn wieder ins Gleisbett sinken, wo sein feuchter Atem Sand und Schmutz aufwirbelte. Robey sagte ihm, daß es ein gutes Pferd war, ein treues und edles Tier, und daß er das auch dem Glanzrappen erzählen würde, wenn er ihn wiederfand, und wenn er nach Hause kam auch den anderen Tieren, und dann fühlte er sich wie ein Idiot, Tränen quollen ihm aus den Augen, Wut stieg in seiner Brust hoch, und die Augen begannen zu brennen.
Er stand auf und entschuldigte sich in aller Form bei dem Braunen, bat ihn um Verzeihung für seine kindischen Gedanken und Taten. Er bat ihn, ihm seine momentane Schwäche nachzusehen, schließlich waren sie gut miteinander ausgekommen, seit er ihn gestohlen hatte, und dann sammelte er sich und zog die Pistole aus dem Gürtel. Er setzte die Waffe hinter dem Ohr des Tiers an und betätigte, ohne zu zögern, den Abzug.
Jetzt hätte er sich gern ausgeruht, denn er war schrecklich müde und hatte Schmerzen, doch er schulterte lustlos seine Sachen, packte das Zaumzeug und stapfte los, lief den ganzen heißen Tag zu Fuß weiter durch das dünnbesiedelte Land. Der verstauchte Knöchel schmerzte stark, und bald war Robey von Straßenstaub bedeckt und hatte Blasen an den Füßen.
Er folgte weiter dem Bahngleis, bis der Abend ein bläuliches Zwielicht über das Land legte und er in der Ferne die Spitze eines Kirchturms und dann die schwachen Lichter einer Stadt entdeckte. Er kletterte eine grasbewachsene Böschung hoch und traf auf einen Bohlenweg, der parallel zu den Gleisen verlief. Die Stadt, jetzt in Reichweite, schimmerte ihm unter der Decke der Nacht trübe entgegen. Er ging auf dem Bohlenweg weiter, und nach einer Weile löste sich an einem Schuh die Sohle ein Stück und schlappte bei jedem Schritt. Irgendwie spürte er, daß er einen wichtigen Ort erreichen würde, egal wie düster die Aussichten waren. Er spürte es in der Luft, auf der Haut und auch in seinem Kopf, der sich langsam erholte. Er wußte, daß er ein neues Pferd brauchte.
Weiter hinten drängten sich sanfte Hügel, die in steile Berge übergingen, mit grünen Inseln von Weideland dazwischen. In der Luft hing die feuchte Kühle eines flachen Flusses, und in der Ferne, zwischen den grünen Inseln und den Bergen, war ein dunkler Waldstreifen zu sehen. Hier wurde das Land von wohlhabenden Bauern bestellt, und die Farmen bestanden aus niedrigen roten oder grauen Steingebäuden. Quer zum Weg verliefen Kalkadern, die sich zu Knoten verdickten, und er sah dünne Spalten, aus denen das Wasser artesischer Quellen an die Erdoberfläche sickerte. Er dachte, wie leicht es doch sein mußte, diesen fruchtbaren Boden zu bearbeiten. Ein warmer Regen hatte eingesetzt und fiel auf das trockene Land, und dann filterte er aus dem Dunkel den harten Klang rhythmischer Hufschläge, die sich auf dem Bohlenweg näherten.
Er verließ den Weg und lief auf dem weichen Boden am Rand weiter, stolperte über tiefe Furchen und gelangte dann durch ein Brombeerdickicht in den Halbschatten eines kleinen grauen Hauses. Zwei dunkle Reiter fegten durch die Dämmerung, dann kam die Kavallerie, immer zwei Reiter, dicht an ihm vorbei, und dann wurden die Holzbohlen von schweren eisenbereiften Rädern erschüttert, und eine Kutsche mit einem Gespann schweißnaßer Pferde kam angerumpelt.
Es war eine offene Kutsche mit Vierergespann, die Sitzbänke quer von Tür zu Tür, auf denen neun Männer in blauen Uniformen saßen, und dahinter folgte eine weitere Kutsche und dann noch zehn. Sofort zog er seine Jacke aus und kehrte die blaue Seite nach außen. Planwagen schlossen sich den Kutschen an, noch mehr Kavallerie und eine Batterie berittene Artillerie. Er kletterte die steile, von Kiefern verdunkelte felsige Böschung weiter hinauf.
Dort nahm er den Geruch von Rauch wahr, und ganz oben angekommen sah er vor sich die Stadt liegen, mit einem Fluß, der eine weite Schleife zog und zweimal von Eisenbahngleisen überquert wurde, die Robey im ersten Schleier der Nacht entgegenschimmerten. Er sah Lokomotivschuppen, Wassertürme und Kohlebansen. Unbefestigte Landstraßen, die sich auf die Stadt zuschlängelten und dann in schnurgerade Bohlenwege mündeten. Aus allen Richtungen strebten Kutschen und Soldaten in die Stadt, gespenstische schwarze Schemen vor dem letzten Streifen roten Lichts am westlichen Horizont. Ein kalter Nebel zog heran, hatte die leeren Felder bereits mit einer feinen Schicht überzogen.
In der Kühle der Nacht ließ der Schmerz in seinem Fußgelenk nach und machte ihm keine Sorgen mehr. Er wußte, er war jetzt ganz nah dran, bei einer Armee, einer Schlacht, einem Pferd. Er spürte, er stand direkt vor dem Ort des Krieges, der zermalmenden Gewalt, einem Ort, der stets in Bewegung war und in dessen Dunstkreis er schon seit Tagen umherirrte. Er hatte es am Fluß, an den Schienen und an der galoppierenden Kavallerie erkannt, aber er konnte noch nicht sagen, ob er schon mittendrin war oder immer noch davon entfernt. Doch ganz gleich, er hatte es so weit geschafft, und egal, was er schon durchgemacht hatte, er ahnte, daß er wieder einmal am Anfang stand.
Da er nicht wußte, was er tun sollte, setzte er sich hin, zog die Beine an und legte das Kinn auf die Knie. Während er zuvor immer getrieben worden war, zu immer törichteren Entscheidungen, so spürte er jetzt in sich eine Geduld, die er mühsam erlernt hatte. Der Regen wurde stärker und kälter, und auch die Luft war für die Jahreszeit zu rauh. Er hatte für einen Moment das Gefühl, zu erfrieren, doch er wußte, es waren die Anstrengung und der Hunger und die letzten Auswirkungen seiner Kopfverletzung, die ihm zu schaffen machten. Er fühlte die Last der Dunkelheit auf seinen Lidern, und für einen Moment verlor er das Bewußtsein.
Sein kurzer Traum war die wiederholte Erfahrung eines endlosen Falls. Jedesmal kämpfte er verzweifelt gegen den Absturz, konnte ihn aber nicht verhindern. Er wurde von einem Schuß getroffen und stürzte zu Boden. Er fiel von dem pechschwarzen Hengst an der Brunnenwinde vorbei hinab in den Schacht. Auch im Traum wußte er, daß er träumte. Er murmelte und schrie, aber er kam nicht zu Bewußtsein. Als er schließlich aufwachte, war er sich nicht sicher, ob er überhaupt geschlafen hatte, aber es war dunkel, und ein schwerer Schuh trat gegen seinen geschwollenen Knöchel.
»Wer bist du?« ertönte eine tiefe Stimme über ihm.
Sie drang aus großer Entfernung an sein Ohr, und er konnte nicht sehen, woher sie kam. Es war, als wäre er am Grund eines pechfinsteren Brunnens aufgewacht. Als er schließlich wieder ganz bei Sinnen war, dauerte es noch eine Weile, bis ihm klar wurde, daß die Stimme zu einem Soldaten gehörte, der ihm die Frage gestellt hatte und der jetzt mit dem Bajonett gegen sein Bein stieß. Als er die Frage nicht beantwortete, setzte der Soldat die Bajonettspitze auf seinen Oberschenkel und drückte leicht zu. Robey spürte vor Schreck keinen Schmerz. Dann drückte der Soldat fester, und sein Bein verkrampfte sich und zuckte, als die Klinge seine Haut durchbohrte.
»Hab doch gewußt, daß du nicht tot bist«, sagte der Soldat erfreut. »Was hast du hier zu suchen? Und erzähl keine Lügenmärchen.«
Als er aufsah und über sich einen Mann in einer blauen Uniform erkannte, wurde ihm kalt ums Herz. Der Soldat hatte einen dünnen schwarzen Bart und eine Brille mit Goldrand, und hinter ihm, am Horizont, ging gerade der Mond auf. Der Soldat trat einen Schritt zurück, damit er aufstehen konnte, dann zog er ihm mit dem Bajonett die Jacke auseinander, so daß die gefärbte Innenseite zu sehen war. Er nahm ihm die Pistole und das Messer ab, und kurz danach kam ein zweiter Soldat auf sie zu.
Die beiden Soldaten begannen sofort, sich über die richtige Parole zu streiten, und verwandten geraume Zeit auf diese Frage. Jeder von ihnen behauptete, er habe die neue Parole und der andere verwende noch die alte. Ohne daß sie zu einem befriedigenden Schluß kamen, wie nun zu verfahren sei, verloren sie schließlich das Interesse an der Sache und wandten sich Robey zu.
»Hast du Geld bei dir?« fragte der zweite Soldat. »Oder Tabak? Ihr Rebellen habt doch immer welchen dabei.«
Robey schüttelte den Kopf.
»Er spricht nicht?« fragte der zweite Soldat den ersten.
»Bis jetzt nicht, außer im Schlaf.«
»Und was hat er da gesagt?«
»Keine Ahnung, ich red nie im Schlaf.«
»Hat’s dir die Sprache verschlagen?« sagte der zweite Soldat zu Robey. Als der wieder nur den Kopf schüttelte, kicherte der Soldat.
»Vielleicht hat er ja nichts als Baumwolle im Hirn«, meinte der zweite Soldat. »Na, wenn sie ihm einen Strick um den Hals legen, wird er schon reden.«
»Er ist doch noch ein Kind«, entgegnete der erste.
»Ein Kind schießt uns genauso tot wie jeder andere«, sagte der zweite Soldat. Dann klappte er sein Taschenmesser auf und schlitzte Robeys Taschen auf.
»Er hat nichts«, meinte der erste Soldat voller Ungeduld, endlich abgelöst zu werden, der Verantwortung für den Gefangenen längst überdrüssig.
Sie beschlossen, daß er vielleicht doch nicht so etwas Besonderes war, wie sie gedacht hatten, aber die Jacke war verdächtig, und bewaffnet war er auch, deshalb sollte er dem Major vorgeführt werden. Der zweite Soldat befahl Robey, die Hände auf den Rücken zu legen, band ihm dann mit einer Schnur die Handgelenke zusammen und verdrillte sie mit einem Holzstöckchen fester. Der erste Soldat deutete nun mit dem Bajonett hinunter zur Stadt, wo Fackeln brannten und die Straßen hell erleuchtet und von Wagen gesäumt waren.
Bergab zu gehen war eine Qual mit dem geschwollenen Fußgelenk, das er jetzt wieder bewegen mußte. Er stolperte über Grasbüschel, und der Soldat, der mitging, stieß ihn erst und half ihm dann wieder, als könnte er sich nicht recht entscheiden, wie er ihn behandeln sollte.
Schließlich erreichten sie die Stadt, und als sie durch die engen Straßen gingen, wurden Vorhänge zurückgezogen, und aus den kleinen Rechtecken der Sprossenfenster drang mattes gelbes Licht. Überall sah man Soldaten und Wagen, die abgestellt waren, um die Seitenwege und Gassen zu blockieren. Auch an den Kreuzungen waren Soldaten postiert. Sie gingen auf und ab, redeten miteinander oder hockten am Boden, zum Schutz vor dem Regen in Ölzeug gehüllt.
Stallburschen und Rollkutscher saßen inmitten des Durcheinanders von Handwagen und umgekippten Karren, deren Deichseln hoch in die Luft ragten. Sie aßen Kekse mit Käse und kratzten Sardinendosen mit den Fingern aus, die sie dann sauber leckten, um sich eine Zigarette anzuzünden. Ein stattliches Mastschwein, dessen Blut aus der durchgeschnittenen Kehle aufs Pflaster strömte, wurde mit einer Axt zu Fall gebracht und mitten auf der Straße geschlachtet, und ein Dutzend Messer wühlten in seinem Fleisch. Soldaten stocherten auf der Suche nach Silbergeschirr, Goldmünzen und Schmuck mit ihren Bajonetten in Gemüsegärten herum. Viele von ihnen unterhielten sich in Sprachen, die er noch nie gehört hatte, und keiner schien sich an dem tobenden Chaos zu stören. Heute nacht war es diese Stadt, vor ein paar Tagen war es eine andere gewesen und bald würde wieder eine andere drankommen, und immer war es dasselbe.
In einem Garten sah er im unheimlichen Licht einer Öllampe Soldaten, die geknebelt waren und mit den Handgelenken an einen Ast gefesselt.
»Trunkenbolde«, erklärte ihm der Soldat, ohne daß er ihn gefragt hätte.
Ein Schrei aus einer Gasse ließ sie stoppen, und als sie in die Richtung schauten, sahen sie, wie eine Horde Soldaten einem Dienstmädchen die Röcke hob, um nachzuschauen, ob sie Schmuck oder Geld ihrer Herrin darunter versteckt hatte. Als sie nichts fanden, ließen sie sie trotzdem nicht in Ruhe, sondern begannen mit ihren Klappmessern die Rockfalten aufzuschlitzen.
»Das ist noch nichts für dich«, sagte der Soldat und schob ihn weiter.
Ständig kamen neue Kavalleristen an, sattelten ihre schweißnassen Pferde ab, rammten ihre Bajonette in den Boden und banden die Pferde daran fest. Der Soldat ließ ihn anhalten, drückte ihm sein Gewehr in die Hand und stützte sich auf seine Schulter, um sich ein paar Steinchen aus dem Schuh zu holen. Neben ihnen flog ein Fensterladen auf, und eine Frau streckte den Kopf heraus, füllte mit ihrem langen Haar die Fensteröffnung aus. An der hölzernen Treppe am Seiteneingang des Hauses drängten sich Soldaten. Vor der geschlossenen Tür saß ein Wachposten, der sich damit vergnügte, seinen Hut in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen. Ein Soldat meinte lachend zu einem anderen, nach dieser Nacht werde es in der Stadt wohl keine alten Jungfern mehr geben. Straßenhändler gingen zwischen den Soldaten umher oder standen vor den Haustüren Schlange und boten den Frauen Schreibpapier, Nähzeug, Süßigkeiten und Tabak an. Pulks von Fuhrleuten liefen unruhig auf und ab und vertrieben sich das lange Warten mit Rauchen, und die Zugpferde warteten ebenfalls unruhig im Geschirr. Vor ihnen zischten Laternen, die ihren Lichtkegel in den kalten Nieselregen warfen, auf Stapel von Holz und Fässer mit Nägeln und Hufeisen. Säcke voll Hafer, Kartoffeln und Mehl waren bereits auf die Wagen verladen. In Lattenkisten drängten sich Enten, Hühner und Puten aneinander, und Kälber schrien nach ihren Müttern.
In dem Licht, das sie umfing, war eine Gruppe in Lumpen gekleideter Schwarzer zu sehen, die still auf einem langen Bahnsteig standen. Die Männer am Rand mußten ein Seil halten, das die ganze Gruppe umschlang, und daneben standen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett, die Stahlspitzen auf die Brust der Schwarzen gerichtet.
Ein Soldat mit Megaphon drohte ihnen, falls auch nur ein einziger Neger das Seil losließ, so daß es unter Hüfthöhe absank, würden alle auf der Stelle erschossen.
Sie schlängelten sich weiter durch die Seitenstraßen und schienen sich schon in dem Labyrinth zu verlieren, als sie schließlich an einen großen Platz kamen, der von einem steinernen Springbrunnen ohne Wasser dominiert wurde. Ihr Ziel lag am Kopfende des Platzes hinter einem hohen schmiedeeisernen Zaun, ein riesiges, hell erleuchtetes Gebäude mit drei hohen Fenstern auf jedem Stockwerk. Eine kurze Granittreppe führte hinauf zu der zurückgesetzten Eingangstür, vor der mehrere Wachposten standen, und direkt unter der Treppe lag ein Dienstboteneingang. Sie betraten einen Vorraum, in den durch die Glasscheibe einer Zwischentür gedämpftes Licht fiel. Ein Wachposten öffnete kurz die Tür und befahl ihnen, davor zu warten. Dann kehrte er zurück und führte sie in einen Korridor, wo sie von einer alten Dame mit weißem Schleier und weißen Handschuhen begrüßt wurden. Um ihren Hals baumelte eine Perlenkette, jede Perle so groß wie eine Murmel. Hinter ihr stand ein Hausmädchen, und hinter dem Mädchen ein junger Offizier, der eine große Ledermappe mit Dokumenten vor sich hielt.
Die alte Dame erklärte ihnen, sie müßten warten, weil der Major noch nicht eingetroffen sei, aber er müsse jeden Augenblick kommen. Es seien noch andere Bittsteller hier, die mit dem Major sprechen wollten, und auch sie freue sich sehr darauf, ihn persönlich kennenzulernen. Sie sprach, als hätte sie es nicht mit Besatzern zu tun, sondern als wäre dies eine gesellschaftliche Veranstaltung. Robeys Begleiter und der junge Offizier mit der Ledermappe wechselten verständnislose Blicke, und der Offizier tippte sich entnervt an die Stirn.
»Ihr könnt weitergehen«, sagte der junge Offizier und paßte sich dem Ton der alten Dame an. »Es ist ihr Haus, wir sind hier nur Gäste.«
Angesichts dieser Bestätigung strahlte die alte Frau. Huldvoll geleitete sie sie den Flur entlang und führte sie durch eine Tür ins Kaminzimmer, wo Robey von der Mischung aus Tabak- und Whiskeyduft und der Hitze des Holzfeuers überwältigt wurde. Im Raum standen und saßen einige andere Männer, deren Blicken er auswich. Er fragte seinen Bewacher, ob er sich setzen dürfe, und der erlaubte es ihm.
Hier warteten sie in Gesellschaft weiterer Wachposten, gelangweilter hartgesottener Männer, die entspannt herumstanden und, etwas merkwürdig, von der Wachteljagd erzählten. Im Haus sah es aus wie in einem Chinaladen. Da standen silberne Uhren und Rosenholztische, lackierte Wandschirme und Porzellanvasen, auf denen Pfauenfedern prangten. Er stellte sich vor, daß alle Zimmer so waren: Kristallüster und düstere Gemälde mit prunkvollen Rahmen, geprägte Buchrücken und silberne Schnupftabaksdosen, Polstermöbel und schwere, klamme Vorhänge.
Seine Gedanken führten ihn weg aus dem geheizten Raum. War es das, wofür die Menschen kämpften – die vielen Dinge, die ihn hier umgaben? Diese Dinge mit so großem Wert und so wenig Nutzen? Er dachte, wie schnell sie doch zerbrechen können oder verbrennen, weggefegt mit einer Handbewegung oder vom Feuer verzehrt. Vielleicht war es gerade das Schwache, das Zerbrechliche und das Schöne, das einen um den Verstand brachte und bis zur Besinnungslosigkeit kämpfen ließ.
Vom Korridor her war zu hören, wie Türen aufgerissen wurden, und wütende Worte drangen ins Kaminzimmer. Robey war müde und hungrig, aber nicht beunruhigt.
Er wußte, er würde es schaffen. Er wußte nicht, warum, aber er war sicher, daß dies nicht das Ende seiner Reise war.
»Was wird hier gespielt?« ertönte eine Stimme vom Korridor. Es war der junge Offizier mit der Ledermappe.
»Er möchte eine Gebetsversammlung abhalten«, sagte die alte Dame, »und er ist hier, weil er den Major um Erlaubnis bitten möchte.«
»Ich kenne sonst niemanden, der so gottbesessen ist wie er«, sagte eine Frau mit eindringlicher Stimme. »Er betet auf den Knien, und manchmal verdreht er dabei die Augen, bis nur das Weiße zu sehen ist.«
»Das würde ich gerne erleben«, sagte die alte Dame ernst.
»Aber Madam«, wandte der junge Offizier mit aller ihm zur Verfügung stehenden Nachsicht ein, »wir wollen keine Gebetsversammlung.«
»Warum nicht?« insistierte die alte Dame. »Ich kann mir kaum etwas Angemesseneres vorstellen.«
»Seine Stimme ist so mächtig«, sagte die Frau. »Wenn er betet, ist er manchmal so gewaltig, daß er sich etwas vor das Gesicht halten muß.«
»Bringen Sie sie ins Kaminzimmer«, sagte der junge Offizier resigniert, und ordnete an, die Wachen dort zu verstärken.
Robey sah das Mädchen, das dem Mann mit der schwarzen Livree, den weißen Haaren und den buschigen weißen Koteletten folgte, und hinter ihnen schleppte sich müde und abgehärmt die blinde Frau. Der Mann hatte ein rosiges Gesicht und hängende Schultern, und er zog ein Bein nach, aber es schien keine schlimme Verletzung zu sein.
Als er mit seinen bösen kleinen Augen den Raum musterte, spürte Robey, wie sein Blick kurz an ihm hängenblieb. Das Mädchen hatte mit Kalkpuder ihre Haut ein wenig abgedeckt, doch gegen die aufgeplatzten Lippen konnte sie nichts tun.
Der Soldat, der Robey bewachte, beugte den Kopf vor und flüsterte anerkennend, daß sie nicht schlecht aussehe. Ein anderer Wachposten steckte den Finger in den Mund und ließ ihn in der Backe schnalzen. Dann lächelte er und küßte seine Fingerspitzen. Sie schaute verängstigt zu Robey, dann bekamen ihre Augen einen trüben und grauen Ausdruck.
8 ALS DER MAJOR EINTRAF,
das Ölzeug ablegte und mit der Uhr in der Hand das Kaminzimmer betrat, wurde Robey aufgefordert, sich zu erheben. Der Major hatte einen großen Kopf und ein flaches, bleiches Gesicht. Seine Augenbrauen glichen zwei weißen Flügeln, die dramatisch nach außen strebten, als wollten sie sich von der Stirn erheben. Mit seinen O-Beinen hatte er die typische Figur eines Reiters. Er überreichte einem der Wachposten seinen Säbel, nahm das Käppi ab und sagte zu der alten Dame, die ihm dicht auf den Fersen folgte, ja, ein gebratenes Huhn wäre großartig, falls sich um diese unchristliche Stunde eines auftreiben lasse.
»Muß das denn sein?« fragte er, den Finger auf Robeys gefesselte Handgelenke gerichtet.
»Er ist ein Spion«, erklärte der Soldat und zog die blaue Jacke auseinander, so daß die graue Innenseite zu sehen war.
»Bitte«, sagte der Major, »nehmen Sie dem jungen Mann die Fesseln ab. Das Risiko müssen wir eingehen.«
Dann gab er dem jungen Offizier mit der Ledermappe zu verstehen, daß dieser Krieg irgendwann vorbei sein würde, und dann mußten sie ohnehin alle wieder zusammen leben.
Die alte Dame wies das Hausmädchen an, sofort ein Huhn zu schlachten und für den Major zu braten. Dann sagte sie ihm, in der Bibliothek sei angeschürt und er solle sich doch ans Feuer setzen und sich wärmen, denn die Nacht werde kalt und feucht.
»Gerade Frühlingsnächte wie diese sind manchmal überraschend kalt«, erklärte sie, und er stimmte ihr zu. Sie war der Meinung, er solle sich ausruhen, denn der Zug habe Verspätung, werde aber sicher bald ankommen, und dann werde er mit dem Entladen alle Hände voll zu tun haben.
Der Major blickte auf die Uhr in seiner Hand und fragte die alte Dame, woher sie wisse, daß der Zug Verspätung habe.
»Man hat ja schließlich Ohren«, antwortete sie kapriziös.
»Ja, natürlich«, sagte er. Sein Blick suchte den des jungen Offiziers und sandte einen deutlichen Tadel aus. An die Dame gewandt sagte er, sie brauche sich nicht um den Zug zu kümmern. Das sei seine Aufgabe, es sei ja auch sein Zug. Mit diesen Worten verschwand er durch eine Tür, die tiefer ins Haus hineinführte.
Kurz danach kam der junge Offizier mit der Ledermappe ins Kaminzimmer und signalisierte ihnen, ihm zu folgen. Robey sah zu dem Mädchen hin, doch das saß ruhig da, die Hände im Schoß gefaltet, den Blick auf ein hohes Fenster gerichtet.
Der junge Offizier führte sie durch einen langen, von gelblich schimmernden Lampen beleuchteten Gang an vielen goldgerahmten Familienporträts vorbei bis in ein Zimmer, dessen Fenster auf den Platz hinausgingen. Die Wände waren voll mit Bücherregalen, und der Major saß rittlings auf einem Stuhl vor dem knisternden Kaminfeuer. Er hatte seine feuchte Uniformjacke ausgezogen und den Kragen aufgeknöpft. Die Arme ließ er über die Stuhllehne baumeln, und in einer Hand hielt er ein Glas mit bernsteinfarbenem Whiskey. Er kippelte hin und her, erst auf die Hinterbeine des Stuhls und dann auf die Vorderbeine, näher zu den Flammen, wobei er ins Schwitzen geriet, was ihm merkwürdigerweise großes Behagen bereitete.
In der Tür stand die alte Dame und flüsterte mit einer deutlich jüngeren Kopie ihrer selbst. Beide trugen ein enganliegendes, pfirsichfarbenes Kleid mit weitem Rock. Die Tochter, schloß Robey. Auch wenn das Flüstern dem Major galt, schien die Jüngere sich mehr für eine andere Person im Raum zu interessieren, einen schwarzhaarigen Kavallerieoffizier.
»Zu alt«, meinte die Dame, und Robey mußte ihr recht geben. Wie flink und kraftvoll der Major auf den ersten Blick auch gewirkt hatte, wie er jetzt so dasaß, war er eigentlich zu alt für eine Uniform. Sein lächelndes Gesicht thronte über einem steifen Kragen, die fleckigen Hände ragten aus den Manschetten hervor, und die roten Ohrmuscheln waren von Büscheln weißer Haare umkränzt, die den Augenbrauen ähnelten. Sein sorgenzerfurchtes Gesicht ließ jedoch noch erkennen, wie er als junger Mann ausgesehen hatte.
»Er ist ein sehr wichtiger Mann«, sagte die Tochter, beeindruckt von dem Major, seinen Leuten und deren Rangabzeichen.
»Nicht hier bei uns«, sagte die alte Dame, und ihre Stimme verriet, wie überzeugt sie davon war und wie verbittert.
Der Major wandte sich den Frauen zu und verzog den Mund zu einem breiten Grinsen, um ihnen deutlich zu machen, daß er ihr unüberlegtes Geflüster durchaus gehört hatte. Sie fühlten sich ertappt, und der Blick seiner klaren blauen Augen machte sie nervös.
»In diesem alten Körper schlägt ein junges Herz«, rief er den davoneilenden Frauen nach, und dann sah er Robey und seinen Bewacher und winkte sie herein.
In der Tür standen zwei Wachposten, und weiter hinten lümmelte ein Offizier in einem Lehnsessel, die Beine über eine Armlehne geschwungen. Er trug die Goldtressen der Kavallerie und schien von allen Männern im Raum das größte Selbstbewußtsein zu haben. Sein schwarzes Haar glänzte vor Öl, genau wie seine hohen Stiefel. Er hatte einen Handspiegel und eine Schere in der Hand, mit der er gerade seinen kunstvoll gezwirbelten Schnurrbart stutzte. Neben ihm auf dem Boden stand eine halbleere Schale Butter-Popcorn.
»Ich bin todmüde«, sagte der Major, an niemand Bestimmtes gerichtet, und wandte sich wieder dem Feuer zu, das sein Gesicht rötete.
Robeys Begleiter betrachtete das als Erlaubnis, wieder bequem zu stehen und ein Lächeln aufzusetzen. Der Major stützte die Arme auf die Stuhllehne und sagte nach einem Blick auf Robey zu dessen Bewacher: »Wer ist dieser junge Mann, den Sie da hereinbringen, und warum ist es so dringend?«
»Der hier ist was Besonderes«, sagte der Soldat und schob Robey mit dem Gewehrschaft vorwärts. »Ich glaub, ein Spion.«
Der Kavallerieoffizier konnte sich das Lachen nicht verkneifen. »So, so, ein Spion«, meinte er spöttisch und lachte weiter sein Spiegelbild an.
»Nur nicht so schüchtern«, sagte der Major zu Robey. »Kann ich dir bei diesem Wetter was zu trinken anbieten?«
»Da würde mir vielleicht wärmer werden«, antwortete Robey und schüttelte sich unwillkürlich, weil ihm auf einmal bewußt wurde, wie durstig und ausgekühlt er war.
»Er spricht«, sagte sein Bewacher, als würde sich damit sein Verdacht bestätigen.
»Er spricht«, äffte der Kavallerieoffizier nach und schnaubte abwertend.
»Er hat bisher noch nichts gesagt?« fragte der Major.
»Nein, kein Wort.«
»Woher wissen Sie dann, daß er ein Spion ist?« wollte der im Sessel lümmelnde Offizier wissen, den Blick weiter auf sein Spiegelbild gerichtet.
»Bist du ein Spion, mein Sohn?« fragte der Major und schaute erneut auf die Uhr in seiner Hand.
»Nein, Sir«, antwortete Robey.
Der Major setzte die Befragung fort, als müsse er in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Fragen stellen und als halte er den Inhalt der einzelnen Fragen nicht für sonderlich wichtig.
Schon auf die erste Frage wußte Robey keine rechte Antwort, und er legte die Hände ineinander und sprach nicht mehr viel.
Der Major sah von seiner Uhr auf und schien von Robeys Gesicht angetan. Er lächelte ihn an und ließ den Blick nicht mehr von ihm. Er schaute ihm geradewegs in die Augen, und Robey hielt seinem Blick stand, wandte sich nicht ab, und bald schien es, als wären beide nicht mehr in diesem Raum. Es war weder Nacht noch Tag, noch Krieg. Der Major war irgendwo anders – an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit, und dorthin hatte er Robey mitgenommen.
»Bist du zur Schule gegangen?« fragte der Major freundlich, und als Robey nicht antwortete, sagte er, er sei vor dem Krieg in Connecticut Lehrer gewesen und habe Jungs in seinem Alter unterrichtet, und es bedrücke ihn sehr, daß sie jetzt Uniformen trugen und Blankwaffen und Gewehre und daß sie im Kampf fielen.
Robey überlegte einen Moment, was er diesem Mann sagen sollte, der so tief in seinen Erinnerungen versunken war. Er beugte sich vor und senkte respektvoll den Blick. Als er nach unten schaute auf den abgetretenen Teppich vor seinen Füßen, bemerkte er, daß seine Hosenaufschläge verschlissen und ausgefranst waren. Es war ihm noch gar nicht aufgefallen, wie zerlumpt er mittlerweile aussah, und plötzlich kam ihm die Idee, daß er sich als nächstes eine neue Hose besorgen müßte. Er lernte gerade, daß es sich mit der Angst so verhielt wie mit der Gefahr: Wenn man ihr ins Auge schaut, zieht sie an einem vorbei. Die fixe Idee ließ ihn nicht mehr los: eine neue Hose. Es war zugleich der Gedanke, daß dieser Tag nicht sein Ende bedeuten würde. Er beschloß, daß er von diesen Männern hier nichts zu befürchten hatte, und hob den Blick. Unbeeindruckt von seiner sentimentalen Anwandlung betrachtete er den Major.
»Gut«, fuhr dieser fort, leerte sein Whiskeyglas und setzte es auf dem Steinboden vor dem Kamin geräuschvoll ab. »Sei dem, wie es sei. Was hast du vorzubringen? Nichts?«
»Ich suche meinen Vater«, sagte Robey jetzt.
»Er lügt«, meinte der Soldat, und der Major zuckte die Schultern, den Blick immer noch auf die Uhr gerichtet, die er an der kurzen Kette hin und her baumeln ließ.
»Na?« sagte der Major.
»Ich muß meinen Vater finden und ihn nach Hause bringen.«
Seine Stimme wurde zu einem Flüstern, als er ergänzte: »Ich bin angeschossen worden, hier am Kopf, und mir wurde mein Pferd gestohlen.«
»Scheißkerle«, sagte der Kavallerieoffizier, der noch immer mit seinem Schnurrbart beschäftigt war. »Die klauen dir noch das Weiße aus dem Auge.«
Als der Soldat, der Robey bewachte, ihn daraufhin wieder zum Lügner erklärte, sagte der Major zu ihm, daß er ihn nicht länger brauche. Empört und längst des Dienstes müde schulterte der Soldat sein Gewehr und stapfte aus dem Raum.
»Setz dich«, forderte der Major Robey auf und steckte seine Uhr ein. »Laß uns reden.«
»Es stimmt«, flüsterte Robey reglos.
»Du nimmst mich nicht auf den Arm?«
»Nein, Sir.«
»Erzähl mir, was passiert ist.«
»Ein mickriger kleiner Kerl irgendwo unterwegs. Seine Haut hat vor Ungeziefer gewimmelt, und er trug Frauenkleider. Er hat sie einer Frau abgenommen, die er umgebracht und skalpiert hat. Mich hat er in den Kopf geschossen« – Robey zeigte auf seine Verletzung – »und mir das Pferd gestohlen. Ein herrliches Pferd, schwarz wie Pech.«
»Himmel, es ist sein Pferd«, rief der Major aus und schlug sich mit der Faust in die offene Hand. »Wir haben den Kerl gefunden, der dein Pferd gestohlen hat. Er sitzt schon im Bau. Es ist einer von den Unseren, und ich garantiere dir, wir werden uns um ihn kümmern.«
»Woher sollen wir wissen, daß es sein Pferd ist?« fragte der Kavallerieoffizier. Bei der Beschreibung des Pferdes hatte er Spiegel und Schere beiseite gelegt und war aufgesprungen. »Nein«, sagte der Major und hob den Zeigefinger. »Der Junge sagt die Wahrheit, und Sie, Herr Offizier, rauben mir den letzten Nerv. Ich glaube, Sie mögen dieses launische Pferd lieber als die Menschen. So eine Geschichte denkt man sich nicht aus. Sie geben dem Jungen das Pferd zurück.«
»Das werd ich nicht tun.«
»Sie geben dem Jungen das gottverdammte Pferd auf der Stelle zurück, und damit Schluß.«
Was sich da zwischen dem Major und dem Kavallerieoffizier abspielte, war eine sehr persönliche Angelegenheit, die lange geschwelt hatte und jetzt lichterloh brannte. Dem Major bereitete es sichtlich Genugtuung, seine Autorität so herauszukehren. Beleidigt schüttelte der Offizier seine Hosenbeine aus und richtete, die Hände hinter dem Rücken gefaltet, den Blick zur Decke, als erflehe er göttliche Hilfe. Nach einer langen Pause, mit der er deutlich machte, daß letztlich er allein die Entscheidung zu fällen habe, ging er unter dem boshaften Kichern der Wachposten zur Tür hinaus.
»Ich schreibe dir einen Brief, der erklärt, weshalb du unterwegs bist, von mir unterzeichnet«, sagte der Major.
»So einen Brief hatte ich schon mal«, meinte Robev, »und er hat mir nicht viel genützt.«
»Mehr kann ich leider nicht für dich tun«, meinte der Major, und auf seinen Wink trat der junge Offizier mit der Dokumentenmappe näher, öffnete sie und zog ein weißes Blatt Papier, einen Federhalter und ein Tintenfäßchen heraus. Dann hielt er dem Major die Mappe als Schreibunterlage hin, und der tauchte den Federhalter ein und legte in schwungvoller Handschrift Robeys Angelegenheiten und sein Verhältnis zu dem Glanzrappen dar. Gelegentlich quoll zuviel Tinte aus der Feder. Dann fluchte er leise und hob die Hände, damit ein Helfer Löschpapier auf das Blatt drückte.
»Nur noch einen Moment, mein Sohn«, sagte der Major, den Blick beim Schreiben auf die Ledermappe gerichtet. »Du kannst dich bald wieder auf den Weg machen.«
Während sie noch immer am Feuer saßen, führte die Dame des Hauses einen Mann und eine Frau herein. Sie sagte, draußen habe heftiger Regen eingesetzt und das Kaminzimmer sei voll, ob der Major denn damit einverstanden wäre, diesen Raum mit den Neuankömmlingen zu teilen, und er stimmte zu.
»Braucht mein Hühnchen noch lange?« fragte er und schrieb weiter.
»Bei dem Wetter zieht der Herd nicht richtig«, erklärte die Dame, da sei das Feuer ganz unberechenbar, aber es war klar, daß sie sein Abendessen völlig vergessen hatte.
Sie ließ den Mann und die Frau an der Tür Platz nehmen, wo sie traurig und schweigsam verharrten. Die Beine des Mannes waren bloß, und er trug ein großes Bündel auf dem Rücken. Die Frau hielt ein Kind von einem Jahr in eine Decke gewickelt, und die Kleine schien den Major milde zu stimmen. Er war wohl selbst ein liebevoller Vater, und Robey konnte nur vermuten, daß er seine Kinder schon lange nicht mehr gesehen hatte.
Das Baby lag still und friedlich in den Armen der Frau, die in einem fort leise auf es einredete und immer wieder seinen Namen nannte. Beide waren naß, und sie froren, und hungrig sahen sie auch aus. Der Major ließ einen Krug heißen Apfelwein kommen und fing eine Unterhaltung mit ihnen an. Dabei schrieb er weiter an dem Brief für Robey.
Der Mann stand sofort auf, als ihn der Major ansprach. Er erzählte, daß er von Beruf Weber sei und seine Frau die Urenkelin von Reverend Lamb, dem früheren Pfarrer von Baskenridge. Ihr Haus war abgebrannt, und sie waren unterwegs nach Westen, um den Kämpfen zu entgehen.
»Ihr habt einen langen Weg hinter euch«, meinte der Major.
»Ja, Sir.«
»Und eure Tochter heißt Emily?« fragte der Major mit einem Blick auf die Uhr, die er nun wieder in der Hand hielt, während der junge Offizier den Geleitbrief für Robey zusammenfaltete und in einen Umschlag steckte.
»Jawohl, Sir«, antwortete der Weber.
»Ein schöner Name«, sagte der Major. »Ich habe auch eine Emily.«
»Gott segne sie«, sagte die Frau.
»Der Satan interessiert sich ja vor allem für die Frauen«, meinte der Major mit einem übertriebenen Augenzwinkern.
Dann zog er seine Geldbörse hervor, gab der Frau einen Silberdollar und sagte, der sei für die Kleine, was die Eltern mit großer Dankbarkeit erfüllte. Er rief das Hausmädchen und ordnete an, ihnen Kaffee, Brot, Butter und Honig zu bringen, falls etwas davon da sei. Dann ging er quer durchs Zimmer und zog die Vorhänge zurück, kniete sich mit einem Bein aufs Fensterbrett und schaute hinaus auf die Straße.
»Warum kämpfst du nicht als Soldat für dein Land?« fragte er den Weber, den Blick noch immer nach draußen gerichtet.
»Sie wollen mich nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich hab ein schwarzes Herz.«
»Um Gottes willen«, murmelte ein Wachposten und ließ den Gewehrkolben auf den Boden knallen.
»Woran merkt man, daß jemand ein schwarzes Herz hat?« fragte der Major ohne großes Interesse, und als Antwort ertönte das klagende Pfeifen eines näher kommenden Zuges.
»Er ist nicht ganz richtig im Kopf«, sagte die Frau mit Panik in der Stimme.
Dann ertönte ein weiteres langes Pfeifen und das laute Zischen von Abdampf. Die Männer im Raum erwachten plötzlich zu neuem Leben. Gleich darauf hallte das Echo von den umgebenden Hügeln wider, und als wäre ein Vulkan ausgebrochen, zogen dicke Rußwolken durch die Nacht, während der Zug schwungvoll die letzte Steigung nahm und in die Stadt einfuhr.
Im selben Augenblick flog die Eingangstür auf, und ein Soldat rief in den langen Flur: »Der Zug kommt!«
Donnernder Lärm erfüllte die Straßen, drang in das rauchiggelbliche Licht des Hauses. Der Major machte schwungvoll kehrt und eilte zur offenen Tür, dicht gefolgt von den Wachsoldaten, die seine Uniformjacke und den Säbel trugen.
Robey blieb erwartungsvoll stehen, doch es schien sich niemand mehr für ihn zu interessieren. Die Frau ging mit dem Baby ans Fenster, konnte aber durch die Scheiben nichts sehen und öffnete das Fenster. Sie rief hinaus: »Der Zug ist da!«, und als sie vom Fenster zurücktrat, ergriff der Wind die Vorhänge und ließ sie heftig flattern. Der Lärm wurde unerträglich, der ganze Raum war plötzlich in gleißendes Licht getaucht, und Robey dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, zu verschwinden und seinen Glanzrappen zu suchen. Aber irgend etwas stimmte nicht. Er spürte es.
»Geh nicht da raus«, zischte ihm der Weber zu, der sich über die Fensterbank hinausgebeugt hatte.
»Bleib hier, Junge«, sagte die Frau, nahm ihr Baby in den anderen Arm und ließ einen Revolver aus der Decke gleiten.
Er ging trotzdem den Flur entlang zur offenen Eingangstür, in der die alte Dame stand und mit ihrer Perlenkette spielte und zusammen mit dem Hausmädchen hinüber zum Bahnhof schaute, während der Major und die Wachsoldaten in den Sattel stiegen und davonritten.
»Geh nicht da raus!« warnte ihn auch die alte Dame, und als er an ihr vorbeiging, versuchte sie ihn am Kragen festzuhalten. Er entwand sich ihrem Griff und spürte ihre Fingernägel an seinem Hals.
Schon war er draußen vor der Tür, mitten im Durcheinander von Pferden und Fuhrleuten, Offizieren, die Befehle brüllten, und Kavalleristen, die schneidig über das Straßenpflaster donnerten. Menschen standen in ihren Hausern und spähten zwischen Vorhängen und den Lamellen der Fensterläden hinaus. Männer kamen mit wehenden Hemdschößen aus der Tür gerannt, stiegen eilig in die Stiefel und zogen sich die Hosenträger über die Schultern.
Er überquerte den Platz und ging die Straße entlang, auf die glitzernde Lokomotive mit ihren sich langsam hebenden und senkenden Treibstangen zu. Zischender Dampf erfüllte das schwarze Nachtgewölbe. Pferde bäumten sich erschreckt auf und mußten beruhigt werden. Noch immer spaltete der weiße Lichtstrahl eines Reflektors das nasse Dunkel, und rotgefärbte Dampfwolken wehten vorbei.
Ein Kavallerist schrie ihn an, und er sprang zurück, als Reiter und Pferd an der Stelle vorbeipreschten, wo er eben noch gestanden hatte. Inmitten des Lichts war der rote Stern des Spitzensignals zu sehen, und der Eisenklöppel schlug unentwegt gegen die Bronzewand der Glocke, als wollte er ihm ein ums andere Mal zurufen: Komm her, und schau dir etwas an, was du in deinem jungen Leben noch nicht gesehen hast.
Robey starrte auf das rhythmisch pulsierende Ungetüm aus Stahl und Kupfer. Den naß glänzenden Dampfkessel entlang zog sich ein goldgeränderter roter Streifen. Die Männer mit den schwarzen Gesichtern wurden langsam vorwärts getrieben, setzten zögerlich Fuß vor Fuß, als fürchteten sie, der Maschine zum Fraß vorgeworfen zu werden.
Geräuschvoll öffneten sich die Türen der Wagen, in denen Laternen angezündet wurden, so daß man verfolgen konnte, wie die Männer begannen, Kisten aus den Waggons in die Pferdewagen zu tragen. Die schwarze Haut ihrer Arme war naß und glitzerte silbrig im Licht, und ihre Gesichter waren verschmiert, als würden sie endlos stumme Tränen vergießen. Hin und wieder öffnete sich ein roter Mund, oder das Licht erfaßte das Weiße eines Auges, und sofort regte sich ein Soldat und hob brüllend sein Gewehr, ein zweiter tat es ihm gleich, und das Brüllen setzte sich den ganzen Zug entlang fort.
Robey wandte sich ab, und in diesem Moment entdeckte er hinter der weißen Wolke, die aus dem Zylinderhahn zischte, zwischen den breiten Stahlkanten des Gleisräumers den zerfetzten Kopf seines Braunen, dessen große perlmuttfarbene Augen für immer starr in die Ferne gerichtet waren. Ihm drehte sich der Magen um, und er spürte, wie sich sein Kiefer verkrampfte. Er empfand Haß und dachte daran, daß Wut nützlicher war als Verzweiflung. Aber daß ein Pferd so ein Ende nehmen mußte! Er dachte mit Erstaunen, wieviel Kraft die Lokomotive haben mußte, daß sie den Kopf des Pferdes glatt vom Körper abgetrennt hatte. Ihn überkam ein seltsames Gefühl. Schließlich faßte er sich wieder und beschloß, nun den Glanzrappen zu suchen und einen Revolver aufzutreiben, und dann wollte er auch den von Läusen wimmelnden kleinen Mann finden.
Da hörte er, wie ein Soldat »Allmächtiger Gott!« schrie und zu Boden stürzte, und von den Mauern und den Pflastersteinen ertönte ein Geräusch wie brutzelndes Fett. Die Luft explodierte. Ein zweiter Soldat wurde von dem Druck weggeschleudert, und ein Reiter kam in Sicht und rief, eine große Streitmacht habe die Vorposten überrannt. Dann stürmten die Angreifer von allen Seiten in die Stadt, und im selben Augenblick zerriß das Feuer der Artillerie die Nacht. Es war, als wollte die Welt zerspringen.
9 FUNKENSPRÜHENDES GEWEHRFEUER
kam aus dem Dunkel. Kugeln prallten von den Hauswänden und landeten zischend in einer Pfütze, oder sie pfiffen durch das Laub des Hartriegels und das Grün der Nadelbäume und fielen dann als bleierner Regen zu Boden. Er beobachtete einen blutjungen Soldaten, der aus großer Entfernung in die Hand getroffen wurde. Die Wucht der Kugel schien ihm die Hand wegzureißen, er drehte sich um sich selbst, bis er zu Boden sank und stumm auf seine Hand starrte, überrascht von dem plötzlichen Schmerz.
Die angeschirrten Pferde hielten den Kopf in die Höhe, und ihre verschwitzten Flanken hoben und senkten sich bei jedem Atemzug. Sie tänzelten und stampften schwer auf, und dann setzten sie sich auf die Hinterhand oder legten sich auf die Seite, nachdem sich acht oder zehn Kugeln in sie hineingebohrt hatten, in das naß glänzende Fell, in den Widerrist, den langen Hals und den Brustkorb, in die Kruppe und in das kraftvolle Herz. Dabei zielte niemand auf die Tiere, in den ersten Minuten des Chaos war das Gewehrfeuer einfach ungeheuer dicht.
Er sah, wie eine Kanonenkugel über das Kopfsteinpflaster hüpfte, langsamer wurde und auf ihn zurollte. Er sprang zur Seite, aber ein anderer Soldat, der den vor Erstaunen weit aufgerissenen Mund voller weißer Kekse hatte, hob sein Gewehr über den Kopf, als wollte er in einen Fluß steigen, und streckte den Fuß vor, um die Kugel zu stoppen. Im nächsten Augenblick war der Fuß ab, und Blut schoß aus dem Beinstumpf auf das Pflaster, das glitzerte wie rotes Glas. Eine weitere Kanonenkugel trennte erst einem Soldaten den Kopf glatt vom Rumpf und zerschmetterte dann einen zweiten Soldaten. Der kopflose Soldat ging noch drei Schritte, ehe er zu Boden fiel und, schon tot, noch eine Weile wie ein Fisch zuckte.
Robey stellte sich auf die Zehenspitzen, um das Beben unter seinen Füßen weniger stark zu spüren, und plötzlich packte ihn die Angst, sickerte ihm wie Sirup durch die Glieder. Seine Eingeweide flatterten, und sein Unterleib zuckte. Das war der Krieg, diese Nacht, dieser Regen, dieser einförmige Mond, die Erde, auf der sie standen, und der Himmel darüber. Er mußte sich zusammenreißen, um nicht in die Hose zu machen, und als der Drang nachließ, nahm er einem Toten den Revolver ab und dann noch einem und schob sich die Waffen in den Gürtel. Als hätte er das allein zu entscheiden, beschloß er, auf dieser kleinen Welt niemanden mehr so nah an sich heranzulassen, daß auf ihn geschossen werden konnte, solange er selbst die Chance hatte, als erster abzudrücken. Ihn würde der Krieg nicht töten.
Die Pferde bäumten sich wiehernd auf, als das Getöse erneut zunahm und sich schließlich selbst übertraf. Sie traten um sich und verfingen sich mit den Hufen in den Zügeln. Ein Eselhengst stürmte mit angelegten Ohren, den Schwanz steil in die Luft gereckt, wild schreiend über den Platz, und dahinter stolperte der Maultiertreiber, den gerissenen Führstrick noch in der Hand. Dem Tier strömte Blut aus den Nüstern und tränkte sein Fell. Der Esel rannte geradewegs durch einen Eisenzaun und gegen eine Mauer, wobei er sich das Genick brach, und verendete dann in einem Blumenbeet. Im Licht der Laterne sah Robey einen Soldaten, dem eine Granate den Brustkorb zerfetzt und das pochende Herz freigelegt hatte und der im Delirium von einer Frau sprach, bevor auch sein Lebenslicht erlosch.
Die Kartätschen und Miniegeschosse schlugen auf dem harten Kies Funken. Der Major brüllte vom Sattel aus seine Befehle und kam jetzt mit seinem schweißnassen Pferd direkt auf Robey zugeritten, hielt unmittelbar vor ihm an. Robey spürte die Hitze des keuchenden Pferdes, das beinahe gestürzt wäre und sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte.
»Runter!« brüllte der Major, und als Robey einen Schubs von hinten bekam, ging er eilig im nassen Gras hinter dem gußeisernen Zaun in Deckung.
Scharfschützen nahmen die Fuhrleute und die Soldaten auf dem Bahnhof und in den engen Straßen ins Visier und zerfetzten ihnen die Leiber. Der Major schrie auf, als eine Kugel erst seinen schwarzen Stiefel durchbohrte und dann in seinem Pferd steckenblieb. Ein herbeieilender Arzt zog ihm den Stiefel vom Fuß und wollte auf der Stelle amputieren, doch der Major hielt ihn mit gezogenem Revolver in Schach, ließ sich die Wunde verbinden und erteilte vom Sattel aus weiter nun zusammenhanglose Befehle. Eine zweite Kugel traf ihn am Handgelenk, und sein Handschuh füllte sich mit Blut, bis er ihn abzog und zu Boden fallen ließ, wo er wie eine aufgedunsene Wurst liegenblieb.
Vor einer unbeleuchteten Gasse jenseits des großen Platzes mit dem Springbrunnen lud sich die Atmosphäre auf, bevor die anrückende große Truppe selbst in Erscheinung trat. Ein beeindruckendes, furchterregendes Bild, und er hörte die Befehle des Offiziers und das stählerne Geräusch, als die Säbel gezogen wurden.
»Viererreihe! Blankziehen! Attacke!«
Dann erfüllte ein Brausen die Luft, und Reiter kamen angestürmt, durchbrachen die Hecken oder tauchten aus den Gassen auf und sammelten sich in den Parallelstraßen, aus denen sie anschließend hervorstürzten wie die Fluten eines gebrochenen Damms. Und dann waren sie mitten unter ihnen, schleuderten krachende Salven in alle Richtungen. Pferde wieherten und gingen stöhnend zu Boden. Ein Tier spuckte Blut, drehte sich auf den Hinterbeinen und stürmte davon. Eine Klinge sauste herab und trennte eine Hand sauber vom Arm. Eine zweite Klinge zuckte, schnitt den Kopf eines Mannes fast vollständig vom Körper ab, und helles Blut spritzte in die Nacht.
Jetzt waren an die hundert Pferde auf der Straße, bäumten sich auf und vermischten Rauch und Feuer mit dem Blut und dem Nieselregen. Ein Soldat ließ sein Gewehr fallen, hob die Hände und wurde sofort erschossen. Einige Männer hatten sich erhoben und versuchten, die Blutung aus ihrem aufgerissenen Brustkorb zu stillen. Ein Pferd hatte die Hinterbeine gebrochen und saß auf dem eigenen Schweif. Die Angreifer zerfetzten mit ihren Säbeln das graue Segeltuch der Planwagen und töteten alle, die sie darin entdeckten.
Aus den zerbrochenen Fenstern in den oberen Stockwerken hallten noch immer Schüsse, und die Getroffenen sackten auf dem Zimmerboden zusammen oder stürzten kopfüber auf die Straße.
Der Major kämpfte weiter, wurde am Kopf und an den Armen von Säbeln verletzt, und die Hufe seines Pferdes trommelten in der Luft. Der Major entriß einem Mann, der gerade auf ihn zielte, die Flinte und erschoß ihn mit dessen eigener Ladung, richtete die Waffe dann gegen einen zweiten und durchschnitt gleich darauf einem dritten die Kehle.
»Aufschließen!« brüllte er grimmig. »Mein Gott, schließt auf!«
Aber Schlachten werden von den Soldaten entschieden, die sie ausfechten, und nicht durch Befehle von oben. Der Major saß kerzengerade im Sattel, als ein Miniegeschoß herangepfiffen kam und ihn tödlich am Kopf traf. Die gußeisernen Zaunpfähle hielten ihn auf, stoppten seinen abrupten Sturz. Der Körper des Majors baumelte zwischen den schwarzen Eisenstäben und sah aus wie ein aufgespießter Fisch. Das bleiche Gesicht wurde blutrot und sank weiter hinab. Die Schußwunde am Kopf des Majors rauchte noch, und seine Augen waren starr wie aus Glas.
Dann war alles vorbei, und eine unheimliche Stille trat ein, doch sie hielt nicht lange an, wurde bald wieder von Zischen und Donnern, von Stöhnen und Schreien abgelöst, von den permanenten Hintergrundgeräuschen des Krieges. Die Stille hatte nicht so lange gedauert, daß das Gehör hätte Zuflucht finden können vor dem Schlachtgetöse, vor den zeitlosen menschlichen Lauten von Schmerz und Todeskampf.
Rings um ihn ertönte das Röcheln und Stöhnen der verwundeten und sterbenden Männer, die dort angelangt waren, wo jedes Leben zu Ende geht. Pferde hatten sich losgerissen und galoppierten reiterlos umher, als hätte eine merkwürdige Geisterkavallerie zum Manöver geblasen. Robey fragte sich, was man tun sollte, wenn ein Mann mit Bauchschuß nach Wasser rief, es aber kein Wasser gab. Dann entdeckte er das Gesicht des jungen Offiziers mit der Ledermappe; er saß in sich zusammengesunken da und starrte stumm auf die roten Bläschen, die aus dem Loch in seiner Brust schäumten, als verfolgte er, wie das Leben aus ihm schwand, als verstünde er, daß es nicht mehr lange dauern würde und sein wacher Geist nichts dagegen tun konnte.
Sie zogen den Kavallerieoffizier mit dem kunstvoll gezwirbelten Schnurrbart näher ins Licht, wo sein schwarzes Haar immer noch vor Öl glänzte. Die Goldtressen der Kavallerie trug er nicht mehr, sondern war in Zivil gekleidet. Er war verwundet worden, als er gerade zur Hintertür eines Hauses hinaus verschwinden wollte.
»Mach ihn alle«, sagte einer von ihnen, die Stimme von Whiskey beschwert, und dennoch willens weiterzumachen mit dem, was hier begonnen hatte.
»Der tut doch keinem mehr was.«
»Sicher ist sicher«, entgegnete der erste, zog seine Pistole und jagte dem Offizier eine Kugel in die Stirn.
»Der ist tot«, stellte der zweite fest, nachdem er sich hinuntergebeugt und mit leerem Blick auf die Leiche gestarrt hatte, dann nahm er Stiefel und Sporen an sich.
»Allerdings«, meinte der erste und fügte wie selbstverständlich an, in der Hölle sei schon ein Platz für den hier reserviert. Er gratulierte sich selbst zu diesem sicheren Schuß und ritt davon.
»Er knallt sie gerne ab«, sagte der zweite.
Die Soldaten, die das Gemetzel überlebt hatten, wurden zum Bahnhof gebracht und mußten sich dort zwischen den Verstümmelten und Sterbenden auf den Boden kauern. Wer geflohen war, dem setzten bewaffnete Spähtrupps nach, und es hallten einzelne Schüsse durch die dunkle Nacht, wenn ein Jäger auf Beute traf.
Das Blut wurde schon schwarz, als die Hausierer wiederkehrten und ihre Waren feilboten. Die Berittenen schossen ununterbrochen weiter, bis sie sich den Armeewagen zuwandten, in denen sie Wurst, harte Kekse und Biskuits entdeckten. Sie drehten das Rohr eines Geschützes herum, richteten es auf die Lokomotive und feuerten Löcher in den Dampfkessel. Der Wasserbehälter riß, und Dampf zischte hoch in die Luft. Die nächsten Schüsse durchbohrten den Dampfzylinder, zerstörten Kurbelzapfen und Treibrad und ließen Wasserschleier auf die Schwellen regnen.
Kurze Zeit nach der Schlacht hörte er bereits wieder das Klappern von Würfeln in Keksdosen, und es gab auch wieder etwas zu essen: Milch, Butter, Eier und Hühnchen, die aus Verstecken geholt und in die Küchen und auf die Veranden gebracht wurden. Die Herde wurden angeschürt und Töpfe zum Kochen aufgestellt. Dann öffneten sich Türen und Fenster, und die Leute auf der Straße wurden zum Essen hereingerufen, währenddessen ertönte aus einer Kapelle der himmelwärts steigende Gesang eines Chors, gefolgt von anschwellenden Orgelklängen.
Als er die Straßen nach dem Glanzrappen absuchte, hoffte er, auch auf das Mädchen zu treffen. Er überquerte Straße um Straße, schob sich dabei einen Bissen in den Mund und warf die Hühnerknochen in den Rinnstein, doch er fand weder das Pferd noch das Mädchen.
Von den Männern, zwischen denen er jetzt umherlief, ging eine unmittelbare Gefahr aus. Sie wirkten skrupellos, als könnten sie sich auch jederzeit gegeneinander wenden, ja sogar gegen sich selbst. Sie waren unrasiert, ihre Haare waren lang, und sie trugen flache, breitkrempige Hüte und von Fett und Rauch verschmierte Hemden. An den grauen Hosen zeichneten sich dunkle Flecken vom Schweiß der Pferde ab. Ein jeder hatte drei oder vier Navy Colts im Gürtel und eine Flinte auf dem Rücken. Sonne und Schießpulver hatten ihre Gesichter dunkel gefärbt, und ihr Gang glich dem Schnüren von Wölfen.
»Mörder«, rief die alte Dame mit dem weißen Schleier und der Perlenkette einem vorbeilaufenden Mann mit Gewehr zu, der eine goldene Kordel um seinen schwarzen Schlapphut gewickelt hatte.
»Alles Mörder, Madam, jeder einzelne«, entgegnete dieser, ohne innezuhalten und ohne sie anzusehen.
IN EINEM SCHUPPEN fand Robey sein Nachtlager, und er fiel in einen unruhigen Schlaf. In der Nähe heulte immer wieder ein Hund auf. Unterwegs hatte er erfahren, daß eine Armee, vielleicht die seines Vaters, bei Front Royal zurück ins Tal verlegt worden war, und als er nachfragte, stellte sich heraus, daß er nur wenige Tage davon entfernt war. Eine Stimme erfüllte plötzlich die Stille, jemand rief dem Hund zu, mit dem Gekläffe aufzuhören, doch der bellte weiter, bis ein gedämpfter Schuß sich löste und dann wieder Stille eintrat. Der Morgen nahte, als er aufwachte und wieder einschlief, es war immer noch dunkel, und die Spähtrupps machten sich davon, verschwanden so geräuschlos, wie sie aufgetaucht waren.
Als er zu sich kam, war die Morgenluft feucht, Nebel lag über den Getreidefeldern. Während die Stadt noch schlief, eilte er im grauen Morgenlicht durch die Gassen. Die Rinnsteine waren trocken, doch von den Wänden und den Zäunen perlte Feuchtigkeit, als wäre es der letzte Frühjahrstau. Ein scharfer Nordostwind fegte über das Pflaster, blies ihm an jeder Ecke feuchtwarm entgegen. Er war gut bewaffnet und verspürte weder Hunger noch Durst. Auf seinen Kleidern bildete sich Schimmel, sie vermoderten ihm auf dem Körper, doch das störte ihn nicht. Sein geschwollener Knöchel tat weh, schmerzte bis zur Hüfte hinauf. Sein dünner Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen, aber er scherte sich auch darum nicht.
Im hinteren Teil des ausgebrannten Bahnhofsgebäudes standen die Lokomotive, daneben Güterwaggons und verbogene Drehgestelle, und alles war in beißenden, feuchten Rauch gehüllt. Die Straßen waren von Trümmern und Kleiderfetzen übersät und mit schwarzen, geronnenen Rinnsalen überzogen, und er wußte, das war das Blut der gefallenen Soldaten. Er brauchte ein Pferd, und er fand eines, ein cremefarbenes Arbeitspferd mit knotigen Schultern, das einen zertrampelten Gemüsegarten abweidete. Es trug noch sein Kummet, und das zerrissene Geschirr hing von seinem Hals herab und schleifte am Boden. Es war ein verletztes, bedauernswertes Tier, von den Stallknechten gehetzt und im Stich gelassen, aber es war robust, hatte klare Augen und atmete gleichmäßig.
Er stieg auf, klatschte dem Pferd auf die Hinterhand und drückte ihm die Hacken in die Flanken. Das Tier verstand zwar allmählich, was es tun sollte, blieb aber zunächst störrisch und steif wie ein Holzklotz. Er zerrte an dem behelfsmäßigen Zaumzeug, das er zusammengebastelt hatte, und fluchte laut, und das verstand das Tier, und es setzte sich in Bewegung. Als es die Schienen überquerte, knirschten die breiten Hufe auf dem Schotter zwischen den Schwellen. Jenseits des Bahndamms war ein tiefer Graben, und als sie hineinrutschten, ging das Tier instinktiv auf die Hinterhand und kletterte auf der anderen Seite wieder hoch. Sie erreichten das Ödland hinter dem Bahnhof und dem Gleisbett, das mit Dornengestrüpp und Brennesseln zugewuchert war, und das cremefarbene Pferd zeigte weder Angst noch Scheu, sondern preschte geradewegs hindurch.
Hier senkte sich das von Nebelschwaden bedeckte Land hinab zum Fluß, und der Wind blies in heißen Böen über seinen Kopf hinweg. Das Pferd verlangsamte den Schritt und setzte behutsam Huf vor Huf, als es bis zur Brust in der weißen Watte verschwand. Er gab ihm einen Tritt in die Flanke, doch das Tier ging nicht schneller auf dem unsichtbaren, unebenen Grund. Am Osthimmel tauchte ein breiter blaßsilberner Streifen auf, der den Anbruch des neuen Tags erahnen ließ. Dann stieg plötzlich mit einem Schwall feuchter Luft der süßliche Geruch frischer Leichen in seine Nase.
Sein Magen hob sich, und er erbrach eine klare Flüssigkeit. Er beugte sich zwar zur Seite, aber trotzdem beschmutzte er Knie und Hosenbein. Als er die Augen wieder öffnete, sah er zwischen den Nebelschwaden den Soldaten mit dem dünnen Bart und der Goldrandbrille, und dann auch den freundlichen alten Major mit seiner Wachmannschaft. Sein Gesicht war grau, und der große Kopf wirkte durch die verschobenen Knochen mißgebildet. Rings um ihn lagen Männer in Blau, die zur Bestattung hierher gekarrt worden waren und Robey so abstrus erschienen wie am Strand verendete Fische. Sie waren tot, lagen reglos da, das Gesicht himmelwärts und die Augen offen, als wollten sie ihn fortreiten sehen, als hätten sie eigens deshalb an diesem Ort eine Pause eingelegt, ehe sie ihre Reise in die Ewigkeit antraten. Er wußte jetzt, wenn er einmal tot war, durfte er die Augen nicht schließen, auf keinen Fall, denn so machten es die Toten.
Als er das Leichenfeld verließ, führte ihn das cremefarbene Pferd auf einem schmalen Pfad in einen Wald, und kurz darauf vernahm er von weitem zwischen den Bäumen ein Wiehern und hielt an. Der Nebel war so dicht, daß er nichts erkennen konnte, und er beugte sich vor, reckte den Hals und versuchte, mit den Händen den Nebel vor den Augen beiseite zu fächeln.
Das Wiehern ertönte erneut, diesmal näher, und jetzt bekam es Gestalt, und er sah, daß es der Glanzrappe war. Der Hengst hatte gespürt, daß er auf ihn zukam, und jetzt schnaubte er und scharrte mit den Hufen. Er warf den Kopf zurück und gab einen Laut von sich, der ungeduldig, fast strafend klang. Robey sprach ihn ungläubig an, und als der Rappe noch einmal den Kopf hochwarf, sah er neben ihm zwei Beine aus einem Kleid baumeln. Darunter auf dem Boden lagen ein Strohhut und ein Sonnenschirm. Es war der kleine Mann mit den Gänsen, der hier mit gebrochenem Hals hing, sich mitten im Ritt an einer niedrigen Astgabel erhängt hatte. Seine violette Zunge quoll aus dem Mund und hing ihm übers Kinn hinab. Die Augen traten ihm wie Hühnereier aus dem Kopf, und er stank nach Urin und Kot.
Robeys erster Gedanke war, sich bei dem Tier zu entschuldigen, und er hätte es auch getan, aber er befürchtete, daß der Hengst die Entschuldigung nicht annehmen würde. Er glitt vom Rücken des cremefarbenen Pferdes, sprach mit brennenden Tränen der Selbstbeherrschung in den Augen sanft auf den Rappen ein und führte ihn von dem Erhängten weg. Sie gingen langsam ein Stück weiter, doch dann hielt er an und zog sich hinauf in den Sattel. Er drängte das Pferd vorwärts, und nach einigem Zögern reagierte es, als wollte es anerkennen, daß sein Reiter seine Lektion gelernt und eine Belohnung verdient hatte.
Sie entfernten sich vom Fluß und ritten weiter in den Wald hinein. Dann stießen sie auf Schienen, überquerten diese und stiegen auf der anderen Seite eine Böschung hinunter. Es ging langsam, aber stetig auf felsigem Boden bergab. Manchmal wußte der Hengst nicht mehr, wohin er sich wenden sollte in dem wilden, trostlosen Land, fand dann aber doch einen Weg und folgte ihm entschlossen. In dem hügeligen Gelände trafen sie immer wieder auf frische Quellen, wo klares Wasser aus Kalkgestein quoll. Da standen mächtige Bäume, die Wälder waren voll dichtem Unterholz, abgeknickten Ästen und Felsbrocken, und mehr als einmal fand der Rappe einen Durchgang, bei dem es Robey aus dem Sattel gehoben hätte, wenn er nicht die Beine angezogen oder sich tief hinab auf den Hals des Tiers gebeugt hätte. Aber das war egal. Jetzt, wo sie nach Norden ritten, um die Armee zu finden, war alles egal.
10 TAGE SPÄTER,
als Robey seinem Ziel schon nahe war, dem breiten flachen Fluß, an dem sich die Armee seines Vaters aufhalten sollte, kamen neue Gerüchte von einer Truppenverschiebung in Richtung Nordosten auf, und es war, als wäre die Bewegung von fünfundsiebzigtausend Männern, die auf den staubigen Landstraßen marschierten, im Boden zu spüren. Er war nur wenige Tagesreisen hinter ihnen, als er ihre Richtung einschlug und dem Beben folgte, das von ihnen ausgelöst wurde.
Viel später erinnerte er sich daran, daß er fünfzig Meilen weiter Kanonendonner durch die Blue Mountains hatte rollen hören – wie er später erfahren sollte, der Widerhall des Artilleriefeuers, der den letzten Angriff der schicksalhaften Schlacht anzeigte.
Am nächsten Nachmittag ritt er durch strömenden Regen, der alle Julifarben aus der Landschaft spülte, und traf nach Einbruch der Dunkelheit auf die durchnäßte Vorhut der Grauen, die sich nach Süden zurückzogen.
Am Morgen brach ein weiteres, noch schlimmeres Unwetter los. Die ihm entgegenkommende Woge von Männern und Pferden, von Viehtreibern und Herden schreiender Rinder wurde von der Sintflut gezwungen, wie Schweine durch den zähen Schlamm zu waten, der die Räder verstopfte und sie blockierte, so daß sie durchdrehten und über den Boden rutschten. Wie benommen ritt er dieser Flut von Marketendern und Ambulanzwagen, von Kutschen und Munitionswagen entgegen, dieser langen Parade von Angeschossenen und Schlammbeschmierten, von Blutverkrusteten und Ausgeweideten, dieser rollenden Armee von Toten und Sterbenden auf Rädern. Zwanzig Meilen lang war dieser Strom, eine nicht nachlassende Flut von Getriebenen und Gebrochenen. Ihr Anblick war ein düsteres Omen, und ihr gequältes Schweigen verwies auf das unermeßliche Töten und Sterben, das dort stattgefunden hatte, woher sie kamen. Sie waren auf dem Schlachtfeld gestorben und starben nun neben der Straße und auf der Straße, und wer hier zusammenbrach, wurde unter den eisenbereiften Rädern, den trampelnden Pferdehufen und den barfuß marschierenden Männern zu Brei zerquetscht.
Am Ende dieses Weges schien das Böse herabgestiegen und in den Menschen gefahren zu sein, hatte ihn dazu gebracht, einen Veitstanz aufzuführen, sich Kugel und Klinge zu nehmen, und der Mensch konnte nichts tun, als dem Metall das eigene Fleisch als Schild entgegenzuhalten. Denn ehe der Mensch dort ankam, hatte er jeden Willen aufgeben müssen außer dem Bestreben, zu töten oder getötet zu werden, und dies überlebt zu haben bedeutete, um den Tod betrogen worden zu sein. Robey wußte, am Ende dieses Weges wartete sein Schicksal.
Er rief den Männern, die ihm auf dem Rückzug entgegenkamen, nicht den Namen seines Vaters zu, fragte die Gestalten mit den trüben Augen und eingesunkenen Wangen nicht, wo er ihn finden könne. Er wollte ihr Leid nicht verstärken, vor allem aber wollte er nicht, daß sie ihn hörten oder sahen. Er wollte durch die murmelnden Reihen gehen, als gäbe es ihn gar nicht, als wäre er etwas Flüchtiges und in der Lage, die Zeit aufzutrennen und entlang der Nahtstellen unbekannte und unsichtbare Orte aufzuspüren. Das hatte er schon früher getan, war lautlos zu den Orten der Hirsche und Bären geschlichen, hatte sich einem Kaninchen genähert und es im Nacken gepackt, als es ihn kommen sah. Er wußte einfach, daß er seinen Vater finden würde, weil er dort sein würde, wo er nach ihm suchte.
Als er sich der Stadt näherte, fiel sein Blick erneut auf den Unrat des Krieges. Überall klebte das regennasse Papier der Patronenhülsen, überall waren Fetzen von Kleidern, Decken und Säcken verstreut, dazwischen zersprungene Uhren, zerbrochene Teller und andere Scherben. Er sah einen Stiefel, und dann einen Stiefel mit einem Fuß darin, er sah einen Ärmel und dann einen Arm in einem Ärmel, einen Handschuh und dann eine Hand in einem Handschuh. Tote Pferde, zersplitterte Munitionskisten, Abfälle von Maiskolben und Reste von Messinggeschützen, die weißen Eichenlafetten zerschlagen und die rußgeschwärzten Kanonenrohre ausgebeult und geborsten. Ein Schimmel ohne Vorderbeine lag auf der Seite und zupfte still an einem zertrampelten Roggenbüschel.
Die Bäume glitzerten bleich wie Knochen, wo die knorrige Rinde weggeschossen war, und Menschen lagen steif und verrenkt am Boden, während andere so friedlich ruhten, als wären sie bei einem Picknick eingeschlafen.
In den leblosen Wäldern, in denen der Kugelhagel niedergeprasselt war und die Luft noch immer vor Hitze knisterte, hingen Scharfschützen an ihren Ledergürteln von den Bäumen. Sie schwebten in der Luft wie große Raubvögel, die sich auf ihre Beute stürzen wollten und mitten im Flug erstarrt waren. Sie waren tot, zu keiner Bewegung mehr fähig, und doch schien es, als könnten sie jeden Moment zu raschen, wilden Bewegungen erwachen, und wer immer unter ihnen vorbeiging, hätte den sicheren Tod zu gewärtigen.
Das waren nur einige wenige Bilder, die Robey in sich aufnahm, während auf den Maisfeldern fünfzigtausend Opfer der Schlacht lagen, fünfzigtausend gefallene oder verwundete Männer, die nun in den Truppenlisten fehlten. Manche waren in Stücke zerfetzt. Andere schienen unversehrt herumzulaufen, dem eigenen Tod entgegen, und wieder andere waren nichts als fettiger Dunst, Fleischfetzen und zermahlene Knochen. Über mehrere hundert Morgen verteilt lag hier alles, was ein Mann in und an sich trug. Da lagen genug Organe und Gliedmaßen, Köpfe und Hände, Füße und Rippen, um einen Körper nach dem anderen wieder zusammenzunähen. Alles, was fehlte, waren Nadel und Faden und eine himmlische Näherin.
In der feuchten Luft zog das klebrige, verklumpte Blut die Fliegen an. Hier lagen Männer mit gebrochenen und verrenkten Beinen, so verdreht, daß es praktisch unmöglich war, ihnen wieder eine menschliche Gestalt zu geben. Er wurde Zeuge schrecklicher Szenen, mit flehentlichem Bitten um Wasser und Hilfe, während die stummen Toten, in rätselhafter Ruhe verharrend, die Arme zum Himmel reckten. Von diesem Tag an war er überzeugt, daß ein Gott, der solche Verzweiflung auf Erden zuließ, ein herzloser Gott sein mußte oder, wie sein Vater immer sagte, ein Gott, der zu müde war, seine Arbeit zu erledigen.
An einigen Stellen war ein Wimmern und Zappeln, als ob die Seelen zu entfliehen versuchten, doch er wußte, an diesem Ort waren selbst die Seelen tot. Das wußte er jetzt, obwohl seine Mutter immer gesagt hatte, auch wenn der Körper stirbt, die Seele ist unsterblich. Dann hob sich ein Kopf, und ein vom Tod gezeichnetes Gesicht erregte seine Aufmerksamkeit, lächelte ihn mit aufgerissenen Augen an und rief ihm einen Namen zu. Robey trat näher, und als er sich hinabbeugte, griffen zwei Hände nach ihm und versuchten ihm die Augen auszukratzen, so daß ihm nichts übrigblieb, als dem Mann einen Tritt gegen den Kopf zu versetzen, um von ihm loszukommen, und er dachte, im Krieg bringen einen sogar die Toten noch um.
Er ging weiter von Gesicht zu Gesicht, gefolgt von seinem pechschwarzen Hengst, der behutsam über die Leichen stieg und sich vom Eisengeruch des erkaltenden Bluts nicht betäuben ließ. Auf einem Feld, unter einer Anhöhe, entdeckte er eine Reihe von Toten in walnußbraunen Uniformen. Den Männern waren die Hände auf den Rücken gebunden worden, und dann hatte eine einzige Kugel ihr Gehirn durchbohrt.
Er wußte nicht, was hier geschehen war, konnte sich nur vorstellen, daß sie versucht hatten wegzulaufen. Einem hatte man ein Taschentuch vor den Mund gebunden, vielleicht, damit man sein Schreien nicht ertragen mußte. Auch er war durch einen Kopfschuß gestorben. Vielleicht war er auch durchgedreht. Oder er hatte das einzig Vernünftige getan. Egal, jetzt war er tot.
Robeys Blut begann zu kochen und pulsierte in seinen Adern, und er sagte sich, daß er vor diesem gräßlichen Anblick nicht zurückschrecken durfte, sondern die wichtige Erfahrung, die darin lag, annehmen mußte. Das war etwas, was er lernen mußte, worauf er sich verlassen mußte, ein weiteres Gesetz des Chaos. Es ließ ihn noch mehr Abstand zu allem gewinnen, was er aus den Bergen mitgebracht hatte. Er sah, daß selbst die Toten noch töten, und wenn das so ist, dann kann einen jeder töten, und diese Erkenntnis erleichterte ihn, denn er verstand immer mehr, was für eine simple Gleichung der Krieg war.
In einem Wäldchen lagen in einer langen, traurigen Reihe, unruhig stöhnend und zuckend, die Sterbenden auf dem nackten Boden. Sie waren sich selbst überlassen. Männer mit schweren Kopfverletzungen befanden sich darunter, einigen waren beide Augen ausgeschossen. Alle hatten tödliche Wunden und waren an diesen Ort gebracht worden, um hier, ohne jede Hoffnung, möglichst rasch zu sterben.
Nicht weit davon stand ein langer Tisch, an dem die Chirurgen vom ersten Tageslicht an bis zum Einbruch der Dämmerung und selbst in der Nacht mit raschen Bewegungen ihrer Knochensägen Arme und Beine amputierten. Pferdewagen brachten die blutigen Gliedmaßen fort und kamen leer zurück, feucht glänzend im Licht der Laternen, um erneut beladen zu werden.
Es waren viele, und es wurden immer mehr. Noch nie in seinem Leben hatte er so viele Menschen auf einmal an einem Ort gesehen, und allen fehlten Gliedmaßen, sie waren tot oder im Sterben. In der Luft hing ein übler Geruch wie in einer eingeschlossenen Bucht, in die seit Tagen keine Flut mehr gelangt ist und die von keinem Lufthauch bewegt wird. Er wußte, daß das hier nicht der brüchige Rand der Welt war. Nein, das war die Welt selbst.
Hier, in diesem Wäldchen, im fliehenden Licht der verschleiert hinabsinkenden Sonne fand er seinen Vater. Hier lag er, auf diesem Feld der Sterbenden, unter einem purpurnen Himmel. Er erkannte ihn und ergriff seine Hand, und der Vater starrte ihn an, als hätte sich eine Erwartung endlich erfüllt.
Eine Kugel hatte seine Wange durchbohrt und ein schwarzes Loch hinterlassen. Sie hatte eine Bahn durch den Schädel gezogen und war am Hinterkopf wieder ausgetreten. Robey konnte erkennen, wie die Kugel auf ihrem Weg den Knochen zerfetzt hatte, bevor sie den Schädel wieder verließ. Der Vater wollte etwas sagen, doch Robey bedeutete ihm zu schweigen. Während sie einander umschlungen hielten, machte sich ringsum das Murmeln der Sterbenden breit; sie erteilten noch immer Befehle, führten den Kampf fort, flüsterten Gebete und riefen die Namen von Frauen und Kindern, röchelten, gurgelten und keuchten.
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte«, sagte er und versuchte die panische Angst hinunterzuschlucken, die in seiner Stimme mitschwang.
»Gut, daß du so lange gebraucht hast«, flüsterte der Vater.
»Ich hab alles versucht«, sagte Robey, er hielt den Kopf des Vaters in seinem Schoß.
»Ich weiß.«
Ein leises Stöhnen gärte tief in seiner Brust, ließ sich nicht unterdrücken.
»Pst«, flüsterte Robey. »Still jetzt.«
Das Stöhnen wurde lauter und überwältigte Robey. Es griff nach seinem Körper, seinem Herz, seiner Lunge und seinem Rückgrat, und er tat alles, um nicht in tausend Stücke zu zerfallen wie ein Junge, der durch die Luft geschleudert wird, hoch in den Himmel und wieder hinab, tief in die Erde.
Sein Gesicht brannte nach dieser Entdeckung, die er am Ende des Weges gemacht hatte. Er hätte sich niemals vorstellen können, was er vorfand, konnte nicht ertragen, wie schrecklich er gescheitert war. Sein Verstand ergriff die Flucht, und sein Körper schmerzte in dem verzweifelten Versuch, ihn festzuhalten – wenn nicht im Schädel, dann wenigstens in den Händen, in den Armen oder in den Beinen. Das tiefe Gefühl der Bedrohung streifte Wirbel für Wirbel das Rückgrat entlang wie eine Messerspitze. Dann war es vorbei und die Panik verschwunden.