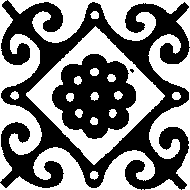
Kapitel 1
Auf dem Höhepunkt der Geburtstagsfeier begab es sich, daß sich Graubart der Zauberer mitsamt seinem Feuerwerk in die Luft sprengte, und alle waren ganz hingerissen von diesem Schauspiel.
Die Zuschauer spendeten begeisterten Beifall. Noch ahnte keiner, daß dies keine von Graubarts beliebten Gaukeleien war. Doch auch später, als die schlimme Kunde vom unrühmlichen Heimgang des Zauberers die Runde gemacht hatte, wollte niemand so recht um ihn trauern. Sicher, da war der eine oder andere, der meinte, man würde ihn wohl bei künftigen Festlichkeiten vermissen. Die meisten aber waren immer noch viel zu beeindruckt von den bunten Feuerrädern, Glutwolken und Springflammen, mit denen der Zauberer den Geburtstag des Königs versüßt hatte, als daß sie ernsthaft die Folgen hätten abwägen können.
Eine dieser Folgen war, daß Kriemhild, des Königs schöne Schwester, sich aufmachte, ihre Unschuld zu verlieren.
Um der Vollständigkeit genüge zu tun: Graubarts Tod hatte mehr als nur eine Folge, und nicht wenige waren sonderbar, ja geradezu grotesk (tatsächlich entfachten sie abermals den Streit um des seligen Zauberers magische Macht).
Doch nichts von all dem, was das mißglückte Feuerwerk an jenem Tag heraufbeschwor, war so wundersam wie Kriemhilds Reise durch das Pestland, ihre unglückliche Begegnung mit den Göttern und das vermeintliche Opfer ihrer königlichen Jungfräulichkeit.
So geschah es also, daß sich Graubarts Asche mit dem Sand des Burghofs mischte, und selbst Jahre später behauptete noch mancher, in lauen Vollmondnächten merkwürdige Verwehungen im Sand entdeckt zu haben, sternförmige Anhäufungen, farbige Muster und sprühende Quellen, aus denen kein Wasser, sondern Staub hervorschoß, als wollte der Sand des Burghofs das letzte Feuerwerk des Toten nachahmen.
Die Geburtstagsfeier des Königs fand ihr Ende erst am späten Abend, nach dem großen Bankett im Thronsaal, und die Anwesenden taten ihr Bestes, sich vom Elend, das der Stadt von Osten entgegenrückte, abzulenken. Denn dies war der wichtigste der Gründe, die Gunther bewogen hatten, zur Feier seines Jubeltages ganz Worms zu laden, vom niedersten Bettler bis zum tapfersten Kämpen: Er wollte die Menschen vergessen machen, was östlich der Stadttore näherrückte – die Plage, die Pest, der Schwarze Tod.
Und während im Thronsaal der Adel seinen Vergnügungen nachging und auf dem Burghof die Bürger ihren eigenen frönten (wobei es zwischen beiden keine nennenswerten Unterschiede gab, abgesehen vom Münzwert des Gesöffs), saß Kriemhild, sechzehn Lenze jung, in ihrer Kammer und dachte nach. Dachte nach, wie sie noch heute Nacht aus der Königsburg entfliehen und den Weg nach Osten einschlagen könnte. Dachte nach, wie es sein würde, auf eigene Faust ein ganzes Volk zu retten.
Sie hatte sich früh vom Bankett zurückgezogen, unter dem Vorwand, die Festlichkeiten hätten sie ermüdet. Jetzt aber legte sie ihr langes Kleid ab, schlüpfte statt dessen in die ledernen Hosen, die sie bei langen Ausritten zu tragen pflegte, zog sich ein dunkles Hemd mit weiten Ärmeln über und packte ihre hohen Reitstiefel in ein Bündel aus Tuch. Anschließend legte sie erneut ihr Kleid an, in der Hoffnung, es würde das, was sie darunter trug, leidlich gut verhüllen. Einen Moment lang erwog sie, auch den goldenen Zierdolch, ihre einzige Waffe, einzustecken, entschied sich dann aber dagegen; es würde sich ein besseres Werkzeug zu ihrer Verteidigung finden.
Mit wehendem Kleid und dem Bündel unterm Arm, das ihre Stiefel verbarg, verließ sie ihre Gemächer. Den beiden Männern, die draußen Wache standen, sagte sie, sie habe es sich anders überlegt und wolle noch einmal hinab zu den Feiernden gehen.
Hinter der nächsten Ecke wurde sie schneller, eilte mit klappernden Schritten durch die menschenleeren Flure der Burg. Fackeln spendeten Licht in Schwefeltönen, gelb und ungesund. Durch die Mauern drang der Lärm vom Hof: die Musik der Spielleute, das Lallen der Betrunkenen, das Klirren leerer Krüge auf den langen Holztafeln. Allzu vergnügt klangen Lachen und Gesang in Kriemhilds Ohren, als wollten die Menschen die drohende Seuche allein durch ihren Frohsinn bezwingen.
Noch hatte es in Worms keine Opfer gegeben, noch trug niemand die tückischen Male der Plage.
Dennoch, die Nachrichten aus dem Osten, überbracht von Brieftauben, die gleich nach der Ankunft verbrannt wurden, machten deutlich, daß es kein Entrinnen gab. Die Pest breitete sich mit der Geschwindigkeit eines Laubfeuers aus; schwelend, fast unbemerkt, kreiste sie ihre Opfer ein, um dann, von einem Augenblick zum nächsten, hochlodernd über sie herzufallen.
Kriemhild betrat den Gang, an den die Gemächer ihrer Brüder Gernot und Giselher grenzten. Beide feierten unten im Thronsaal, Seite an Seite mit Gunther, dem ältesten der Geschwister und König aller Burgunden.
Vor Gernots Tür standen zwei Wachen und tranken Wein aus einem großen Krug. Als sie Kriemhild bemerkten, vertrieb die Scham den Glanz der Trunkenheit aus ihren Augen. Der Krug verschwand hinter dem Rücken des einen, beide strafften sich, bemühten sich schwankend um Haltung. Als sie Kriemhild grüßten, war nicht zu überhören, daß sie dem Wein schon geraume Zeit zugesprochen hatten.
»Mein Bruder schickt mich«, sagte Kriemhild und setzte ihr lieblichstes Lächeln auf. »Er hat mich gebeten, ein Schwert aus seinen Gemächern zu holen.«
»Ein Schwert?« Benebeltes Erstaunen erschien auf den Gesichtern der Männer.
»Er und der König wollen sich einen Schaukampf liefern, und Gernot wünscht dafür seine Waffe.«
»Aber, Prinzessin«, meinte der linke Wächter vorsichtig und wischte sich nervös über die rote Nase, »Ihr wißt doch, daß wir Order haben, niemandem Eintritt zu gewähren, solange Euer Bruder nicht den Befehl dazu gibt.«
Zorn blitzte in Kriemhilds Augen. »Ist es denn nicht sein Befehl, den ich Euch überbringe, Dummkopf?«
Die beiden Männer, verdiente Krieger in so mancher Schlacht, zuckten unter der Schelte des Mädchens zusammen. Kriemhild war hochangesehen bei allen in Worms, und kaum einen Mann gab es, der sie nicht im Traum bereits gefreit, sie gar für sich gewonnen hatte. Von ihr zurechtgewiesen zu werden war schmählicher als eine Schelte vom König persönlich; zumal der Wein die Sinne der beiden Wächter berauschte und ihnen die Maid um so herrlicher erschien.
Bald schon erlahmte ihr Widerspruch, und Kriemhild wurde eingelassen. Sie bat um eine Fackel, bevor sie den Wächtern die Tür vor der Nase zuwarf. Der Schein des Feuers zuckte über die Einrichtung des Schlafgemachs, erhellte prachtvolle Wandteppiche, Kerzenleuchter und zahlreiche Truhen. In einer davon verwahrte Gernot seine Waffen, wie Kriemhild wußte.
Als sie wenig später wieder hinaus auf den Gang trat, trug sie das schmucklose Schwert ihres Bruders offen in beiden Händen, tat gar, als ziehe sie die Last der Waffe leicht vornüber. Einer der Wächter erbot sich, an ihrer Statt hinab in den Thronsaal zu gehen, doch Kriemhild lehnte ab und drückte ihm die Fackel in die Hand. Keiner der beiden bemerkte, daß das Bündel unter ihrem Arm an Gewicht gewonnen hatte; zwischen den Stiefeln steckten jetzt zwei von Gernots schärfsten Dolchen.
Ein Besuch in Giselhers Kammer erübrigte sich. Kriemhild hatte jetzt alles, was sie benötigte. Durch lange Korridore eilte sie zu einer hohen Doppeltür, die den Wohntrakt der Burg mit dem Wormser Münster verband. Die mächtige Kathedrale bildete den Südflügel des hufeisenförmigen Burgkerns; in der Mitte lag der dreigeschossige Wohntrakt, im Norden Thronsaal und Burgkapelle. Um ungesehen über den Hof zu einer der Stallungen zu gelangen, mußte Kriemhild einen Weg wählen, der nicht durch die Menge der Feiernden führte.
Im Inneren der Kathedrale roch es nach kaltem Weihrauch, nach Holz und uraltem Stein. Niemand hielt sich hier auf, die Priester feierten mit dem Adel im Thronsaal. Es war stockdunkel, bis auf einen schwachen Abglanz der Hoffeuer, der durch die hohen Fenster hereinfiel. Kriemhild packte ihr Bündel fester und blickte stur geradeaus. Den tiefschwarzen Schatten in Winkeln und Nischen schenkte sie keine Beachtung.
Sie atmete erleichtert auf, als sie das Südportal erreichte und hinaus auf den Johannes-Friedhof huschte. Ein schmaler Weg führte zwischen den Gräbern zum Burgwall, einem kreisrunden Ring aus Häusern, Türmen und Stallungen, der nur vom Haupttor im Osten und dem kleineren Bürgertor im Süden durchbrochen wurde. Obgleich sich überall auf dem Burggelände feiernde Menschen herumtrieben, lag doch der Friedhof still und verlassen da. Lediglich an seinem Rand saßen ein paar Betrunkene am Boden und schmetterten ein Lied, das Kriemhild die Schamröte ins Gesicht trieb. Niemand beachtete sie, als sie zu einem der Ställe eilte, in dem Lavendel, ihr Lieblingspferd, untergebracht war. Die prachtvolle Schimmelstute schnaubte aufgeregt, als Kriemhild aus den Schatten trat, ihr Bündel ins Stroh warf und das Kleid ablegte. Die enganliegende Reithose knirschte leise, als Kriemhild prüfend in die Knie ging, um das selten getragene Leder zu dehnen. Dann streifte sie ihre Schuhe ab und schlüpfte in die Stiefel. Ihr langes blondes Haar faßte sie straff mit einem Band zu einem Pferdeschwanz zusammen, den sie am Hinterkopf zu einem Knoten feststeckte. Zuletzt schob sie die beiden Dolche in die Stiefel, eine Klinge in jeden Schaft, sattelte Lavendel und befestigte Gernots Schwert am Sattelknauf.
Augenblicke später trug der Schimmel sie zum Stall hinaus. Die letzte Hürde waren die Wachen am Bürgertor. In dieser Nacht aber, da ganz Worm die Erlaubnis hatte, im Burghof den Geburtstag des Königs zu feiern, waren die Kontrollen vereinzelt und oberflächlich. Kriemhild hatte sich eine Decke aus dem Stall um die Schultern geworfen und die Ränder so weit über Lavendels Rücken gezogen, daß sie auch das Schwert bedeckten. Sie senkte den Kopf und tat schläfrig, als forderten Wein und Bier ihren Tribut. Sie wagte nicht aufzublicken, als sie die Wachen passierte, und so sah sie nicht, ob man ihr überhaupt Aufmerksamkeit schenkte. Ohne Zwischenfälle verließ sie die Burg und schaute erst wieder auf, als die hohe, zinnengekrönte Ummauerung hinter ihr zurückblieb.
Die Stadt lag südlich der Burg und bildete am Westufer des Rheins ein dichtes Knäuel aus verschlungenen Gassen, spitzgiebeligen Fachwerkbauten und kleinen, verwunschenen Plätzen. Auch hier wurde gefeiert, und mehr als einmal erntete das junge Mädchen auf seinem weißen Roß unflätige Zurufe betrunkener Kerle. Kriemhild war mehr als erleichtert, als sie die Stadtgrenze unbeschadet hinter sich ließ und zum Ufer des Rheins hinabritt. Der alte Fährmann, der sie schon ungezählte Male zur anderen Seite gebracht hatte, war auch in dieser Nacht auf seinem Posten.
»Wenn das nicht –«, entfuhr es ihm verblüfft, doch Kriemhild schnitt ihm mit einem Wink das Wort ab.
»Schweig«, verlangte sie und setzte freundlicher hinzu: »Ich bitte dich, schweig still. Und stell mir keine Fragen. Bring mich hinüber zum Ostufer.«
»Aber, Prinzessin«, flehte der Alte, »das kann nicht Euer Ernst sein. Niemand will in diesen Tagen dort hinüber. Im Osten wütet die Pest.«
Sie gab keine Antwort und lenkte Lavendel auf die Fähre. Die Hufe der Stute hämmerten lautstark über das Holz.
Der alte Fährmann öffnete den Mund, um weiter auf sie einzuwirken, dann aber bemerkte er den entschlossenen Ausdruck auf Kriemhilds Gesicht. Er war weise genug, um zu wissen, daß junge Mädchen ihres Alters auf ihren eigenen Willen beharrten, und er erkannte auch, daß jeder Widerspruch ihren Entschluß nur gefestigt hätte.
»Ich sah ein herrliches Feuerwerk am Himmel«, sagte er statt dessen, während er die Fähre vom Ufer löste. Das breite Floß bot Platz für zehn Pferde und war an zwei Seilen verankert, die quer über den Strom führten. Mit Hilfe einer mächtigen Kurbel, die ihrerseits eine komplizierte Mechanik aus hölzernen Zahnrädern antrieb, brachte der Alte die Fähre in Bewegung. Unter seinem Wams schwollen Muskeln, die manchen Jüngling mit Neid erfüllt hätten. Schon glitt die Fähre hinaus auf den Rhein. Das Wasser spülte schwarz und eisig um den hölzernen Rumpf, als verlangten die Flußgeister Einlaß.
Als Kriemhild schweigend zum anderen Ufer starrte, sagte der Alte noch einmal: »Ich sah ein Feuerwerk, das schönste, das mir je vor die Augen gekommen ist. Graubart ist ein Meister seines Fachs.«
»War«, verbesserte Kriemhild düster.
»Wie meint Ihr das?«
»Graubart ist tot. Die schönste Flamme, die du gesehen hast, die hellste Sonne, der gleißendste Stern- das war Graubart Ungestüm, Graubart Himmelsglut, Graubart der Narr.«
»Ihr redet schlecht von einem Toten.«
Sie schüttelte den Kopf, als gelte es, ein Schreckgespenst aus ihrem Schädel zu vertreiben. Zum ersten Mal sah sie den Fährmann an und lächelte. »Verzeih mir, mein Freund. Das wollte ich nicht. Es ist nur …« Und sie verstummte erneut.
»Sprecht, wenn Ihr mögt, Prinzessin. Von mir erfährt niemand ein Wort, und hier draußen auf dem Fluß ist keiner sonst, der Euch hören könnte.« Sie sah ihm an, daß er es ehrlich meinte.
»Es ist nur«, begann sie noch einmal, »daß ich Angst habe.« Plötzlich kicherte sie, aber es klang gereizt, nicht fröhlich. »Ich könnte nicht vom Pferd steigen, selbst wenn ich wollte. Meine Beine würden mich kaum tragen, so zittern sie.«
Der Fährmann verharrte und hielt die Kurbel fest. Die Strömung wollte das Floß nach Norden zerren; die Wellen brausten und tobten vor Wut. »Wenn es die Pest ist, die Euch ängstigt, warum wollt Ihr dann –«
»Weil ich es muß, verstehst du?« Sternenlicht brach sich in ihren Augen, und der Fährmann fragte sich betrübt, ob es Tränen waren, die da blitzten. »Ich muß es tun.«
Und fortan sprach Kriemhild kein Wort mehr. Nicht, während die Fähre weiterglitt zur anderen Seite; nicht, als der Rumpf über Uferkies knirschte.
Traurig blickte der Fährmann ihr nach, als sie die Rampe emporritt, ihrem Roß die Stiefel in die Flanken hieb und eilig davongaloppierte, dem Heerweg nach Osten, den Wäldern, der Plage entgegen.
»Prinzessin!« rief er ihr nach, als sie nur noch ein vager Fleck in der Finsternis war. »Ich wünsche Euch –«
Aber da war sie schon fort, und der Fluß übertönte den Ruf mit Strudeln und Wispern, mit dem glucksenden Lachen der Strömung.
Sie folgte der Heerstraße nach Osten, tiefer ins Dickicht des Odenwaldes. Die Pest hatte selbst Räuber und Wegelagerer vertrieben. Niemand begegnete ihr in dieser Nacht, keiner hielt sie auf. Kriemhild war nicht wohl dabei, die bucklige, gepflasterte Straße zu benutzen, aber sie wußte auch, daß dies ihre einzige Möglichkeit war, ans Ziel zu gelangen. Sie kannte sich in dieser Gegend nicht aus, weniger noch, je tiefer sie in die Wälder ritt. Die Straße würde irgendwann in Würzburg enden, doch die Stadt wollte Kriemhild umgehen; dort sollte die Pest besonders übel wüten. Zudem galt: Um so weniger Menschen ihrer angesichtig wurden, desto besser für sie.
Sie überließ den Rhythmus der Reise gänzlich ihrem Roß. Der Schimmel sollte verschnaufen, wenn ihm danach war. Lavendel war eines der besten Tiere im königlichen Stall, Erschöpfung und Hunger waren ihm fremd, und so ritten sie die Nacht hindurch und auch den ganzen Tag. Erst als die Dämmerung hereinbrach, wurde der Trab des Pferdes langsamer. Kriemhild ließ das brave Tier an einem Waldsee trinken und vom Gras am Wegesrand fressen, so lange es nur mochte. Dann legte sie sich abseits der Straße, hinter einem schützenden Kiefernhain, zur Ruhe.
Ehe sie einschlief, dachte Kriemhild, daß es seltsam war, wie prächtig sich doch die sommerliche Landschaft rund um sie erstreckte, der tiefe, kühle Odenwald auf seinen sanften Bergrücken und in düsteren, einsamen Tälern. Von den Boten der Plage, die das Land heimsuchte, war nirgends etwas zu entdecken. Sie hatte Schwärme schwarzer Krähen erwartet, Rattenrudel überall, auch wildes Getier, das sich an Toten labte, doch da war nichts dergleichen. Selbst von Leichen keine Spur. Das machte ihr ein wenig Hoffnung, und als der Schlaf sie endlich übermannte, hatte sie zum ersten Mal seit ihrer Abreise ein wenig von der nagenden Angst verloren.
Der Morgen kam schnell und mit Sonnenschein, der die Wipfel der Wälder mit Gold übertünchte. Nach einem Frühstück aus Beeren wischte Kriemhild den Tau von Lavendels Fell und machte sich erneut auf den Weg. Der zweite Tag ihrer Reise hatte begonnen, sie fühlte sich ausgeruht und frisch.
Bis zum Mittag hatte sie bereits ein gutes Stück zurückgelegt, und Kriemhilds Laune besserte sich mit jeder Hügelkuppe, die hinter ihr zurückblieb. Sie dachte an Worms und an den Aufruhr, den ihr Verschwinden erregt haben würde. Sie hatte einen kurzen Brief auf dem Schreibpult am Kammerfenster zurückgelassen, in dem sie weder Ziel noch Sinn ihrer Reise angegeben hatte; nur daß sie bald zurückzusein hoffe, stand darin geschrieben, zusammen mit den besten Wünschen an ihre drei Brüder und ihre Mutter Ute.
Sie wußte natürlich, daß Günther toben würde und daß Gernot und Giselher zur Suche nach ihr aufbrechen würden. Freilich würde niemand auf die Idee kommen, sie habe sich ausgerechnet ins Herz der Pestepidemie aufgemacht. Vielleicht würde man den Fährmann befragen, und sicher würde er dann die Wahrheit erzählen, doch bis dahin war ihr Vorsprung viel zu groß.
Wie es aussah, war sie vor Verfolgern vorerst sicher. Zumindest, so lange sie ihre Reise zügig und ohne unnötige Unterbrechungen fortsetzte. Und, immerhin, sie war bereit, ihr Leben für das eines ganzen Volkes zu geben, für das gesamte Reich von Burgund. Ihre Sache, dessen war sie gewiß, war eine gerechte, die jedes Opfer wert war. Auch jenes, das sie selbst zu bringen gedachte. Sie hatte nie einer Menschenseele davon erzählt, und wenn es nach ihr ging, sollte auch in Zukunft niemand davon erfahren. Sie folgte nur ihrem Instinkt, nicht dem Verstand, aber etwas sagte ihr, daß sie das Richtige tat. Und das einzig Mögliche.
Es war am frühen Nachmittag, als sie aus der Ferne am Wegrand ein Anwesen entdeckte. Im Näherkommen erkannte sie, daß es ein Gasthaus war, mit einem Pferdestall als Anbau. Ein wettergegerbtes Holzschild schaukelte knirschend im warmen Sommerwind. Tür und Fenster waren geschlossen, weit und breit war kein Mensch zu sehen. Ein zäher, süßlicher Geruch lag in der Luft, ein wenig wie von gekochten Rüben.
Erst als sie auf einer Höhe mit dem Haus war, sah sie den schwarzen Stoffetzen, der am Knauf des Eingangs angebracht war. Das Zeichen, daß in diesen Mauern die Pest umging.
Kriemhild stieg nicht vom Pferd und lenkte Lavendel auf die andere Straßenseite.
»Ist da wer?« rief sie so laut sie konnte zum Gasthaus hinüber.
Nichts regte sich.
»He da!« versuchte sie es noch einmal. »Eine Reisende erbittet Auskunft!«
Die Antwort war Schweigen. Nur das Schild über der Tür knarrte leise, als eine neuerliche Brise es schräg stellte.
Kriemhild war drauf und dran, den Schimmel weiterzutreiben, doch ihre Neugier überwog. Wie konnte sie etwas besiegen, das ihr nie von Angesicht zu Angesicht begegnet war?
Sie sprang aus dem Sattel und band Lavendel an einen Baum. Dann überquerte sie die verlassene Straße und näherte sich zögernd dem Gasthaus. Der Rübengeruch wurde stärker. Noch einmal blieb sie stehen, zweifelte an ihrem Tun. Dann trat sie entschlossen an ein Butzenfenster rechts der Tür und preßte das Gesicht ans Glas. Im Inneren herrschte düsteres Zwielicht. Sie konnte nur zwei oder drei Schritte weit sehen, bis zu den vorderen der langgestreckten Tische. Darauf lag etwas, reglos und still.
Kriemhild zuckte zurück. Der Geruch schien ihr schlagartig durch jede Pore zu dringen, verklebte ihren Mund, ihre Augen, ihre Nase. Einen Augenblick lang hatte sie das Gefühl, sie würde nie wieder atmen können.
Es waren Kinder. Die Leichen von Jungen und Mädchen, mindestens ein halbes Dutzend allein auf den vorderen Tischen. Die Menschen aus den umliegenden Wäldern, Holzfäller, Köhler und Wilddiebe, mußten ihre Kinder hierhergebracht haben, vielleicht, weil sie geglaubt hatten, sie seien hier sicherer als draußen im einsamen Tann. Vielleicht hatten sie gehofft, hier würden die Kleinen alle Hilfe bekommen, die sie nötig hatten.
Jetzt aber lebte hier niemand mehr. Irgendwer mußte die Körper auf den Tischen aufgebahrt haben. Wahrscheinlich war er selbst längst tot.
Kriemhild warf sich herum, löste Lavendel vom Baumstamm und zog sich hinauf in den Sattel. In rasendem Galopp sprengte das Tier mit ihr von dannen, schnell, immer schneller. Es war, als würde der Geruch ihr folgen, eine giftige Wolke Verwesungsgestank, der sie über die Heerstraße jagte wie ein hungriges Ungetüm. Kriemhild fürchtete, jetzt, wo ihr der Gestank einmal bewußt geworden war, würde er sie nie wieder loslassen. War es möglich, daß bereits das ganze Land so roch, und sie es nur nicht bemerkt hatte?
Unermüdlich trug Lavendel sie weiter, die Hügel hinauf und hinunter, bis es ihr vorkam, als läge das halbe Burgundenreich zwischen ihr und dem Gasthaus der toten Kinder. Schließlich riß sie an den Zügeln des Schimmels und übergab sich aufs Pflaster, brach Beeren und Galle hervor und hoffte, der entsetzliche Gestank des Todes würde mit ihrem Mageninhalt zu Boden prasseln.
Doch der Geruch blieb, ganz wie sie befürchtet hatte. Er durchzog die Wälder, füllte die Täler und umwogte die Bergspitzen wie Wolkenringe. An manchen Stellen wurde er schwächer, doch niemals verschwand es gänzlich. Kriemhild hatte das Gefühl, als hätte der Geruch sich in ihrer Kleidung verfangen, doch es war die einzige, die sie hatte. Sie verfluchte sich für ihr Ungeschick, nichts zum wechseln eingepackt zu haben.
Gegen Abend, die Sonne stand tief hinter den Tannenspitzen, kam sie an ein Ufer. Sie versuchte, sich die Karten in Erinnerung zu rufen, doch die meisten waren ungenau und Kriemhild hatte sie nie so eingehend studiert, wie ihre Lehrer es von ihr verlangt hatten. Mochte sein, daß dies schon der Fluß Tauber war, eher aber wohl eines der schmaleren Gewässer, die diese Gegend von Süden nach Norden durchzogen. Die Strömung schien nicht allzu stark, und das gegenüberliegende Ufer war nicht fern. Doch im Dämmerlicht war schwer auszumachen, wie tief der Fluß war; schon wenige Armlängen vom Rand entfernt konnte sie keinen Grund mehr erkennen.
Die Heerstraße endete an einigen Holzpflöcken, die aus dem dunklen Wasser ragten. Jetzt, bei genauem Hinsehen, entdeckte Kriemhild auch weitere Bretter und Latten, die die Oberfläche durchbrachen oder sich treibend zwischen einigen der Pfählen verfangen hatten. Hier mußte einst eine Brücke gewesen sein. Wahrscheinlich hatten Menschen aus dem Osten, auf der Flucht vor der nachrückenden Plage, sie zerstört, um zu verhindern, daß Kranke diese Seite des Flusses erreichten. Wie erfolg-, reich dieser Plan gewesen war, hatte das Gasthaus gezeigt. Vermutlich hatten die Flüchtlinge selbst die Seuche eingeschleppt.
Bald darauf fand Kriemhild unweit der Straße den Leichnam eines Mannes. Sommerwärme und die Tiere des Waldes hatten bereits ihre Spuren hinterlassen, er mußte schon Tage hier liegen. Der Brückenwächter, nahm sie an und wandte sich angewidert ab. Sie hatte früher schon Tote gesehen, sogar ihren eigenen Vater, König Dankrat, und auch häßliche Krankheiten hatte es gelegentlich im Schloß gegeben. Trotzdem war ihr Leben weitgehend wohlbehütet verlaufen, und der Anblick des Todes, mehr noch der Verwesung, traf sie zutiefst.
Eine Weile blickte sie ratlos übers Wasser und überlegte, wie sie auf die andere Seite gelangen könnte. Ihr Ziel lag nordöstlich, falls ihr Orientierungssinn sie nicht täuschte. Es blieb ihr keine andere Möglichkeit, als am Ufer des Flusses entlangzureiten und eine Furt zu suchen.
Die Sonne war gerade hinter den Wäldern verschwunden, und ein goldroter Schein floß über den Himmel, als sie jenseits einer Flußkehre Stimmen vernahm. Alarmiert lenkte sie Lavendel dichter an den Waldrand, ließ das Tier aber nicht anhalten. Der weiche Uferboden dämpfte die Geräusche der Hufe. Außerdem verriet die Lautstärke der Stimmen und die Aufregung, die daraus sprach, daß die Leute anderes zu tun hatten, als nach Reisenden Ausschau zu halten.
Noch fünfzig Schritte bis zur Flußkehre. Der Boden stieg dort leicht an, ein niedriger Hügel, der seitlich steil zum Fluß hin abfiel. Was immer dort vorne vorging, es spielte sich auf der anderen Seite der Erhebung ab.
Kriemhild brachte den Schimmel erst unterhalb der Kuppe zum Stehen. Dort führte sie ihn einige Schritte in den Wald hinein und band ihn fest. Das Schwert ließ sie am Sattel hängen, sie konnte ohnehin nicht allzugut damit umgehen. Statt dessen zog sie einen von Gernots Dolchen aus dem Stiefel. Ihr Bruder hatte sie gelehrt, wie man einen Gegner damit in Schach hielt, und sie hatte sich als geschickte Schülerin erwiesen. Sie würde es nicht mit einem ausgebildeten Kämpfer aufnehmen können, doch einen frechen Bauernlümmel, vielleicht auch den einen oder anderen Räuber, vermochte sie durchaus in die Flucht zu schlagen.
Geduckt, Muskeln und Nerven gespannt, huschte sie durchs Dickicht, über die Erhebung hinweg und auf der anderen Seite zum Waldrand. Hinter einem Brombeerbusch verharrte sie, erhob sich vorsichtig und spähte über Blätter und Geäst hinweg zum Ufer.
Dort unten, keine zwanzig Schritte von ihr entfernt, war der baumlose Uferstreifen ein wenig breiter. Vier, fünf Mannslängen, schätzte sie. Mindestens zwei Dutzend Menschen hatten sich dort versammelt, einige hielten lodernde Fackeln. Die meisten standen im Halbrund um etwas, das sich am Rand des Gewässers abspielte, etwas, das Kriemhild von hier aus nicht erkennen konnte. Sie würde noch näher heranschleichen müssen.
Wenig später hatte sie sich der Menge so weit genähert, wie es gerade eben möglich war, ohne entdeckt zu werden. Hier gab es keine Sträucher mehr, nur Bäume, hinter denen sie Schutz suchen konnte. Sie entschloß sich, auf einen hinaufzuklettern und das Geschehen von oben zu beobachten.
Flink erklomm sie den Stamm einer Eiche, bis sie zwei Mannslängen über dem Boden auf einer Astgabel hockte. Dichtes Blattwerk schützte sie vor zufälligen Blicken. Schräg unter ihr stand eine Gruppe von sieben Frauen, offenbar die Weiber der Männer am Ufer. Sie betrachteten die Ereignisse am Wasser aus einigen Schritten Entfernung, stachelten die übrigen aber durch Rufe zur Eile auf.
Im Halbrund der Fackelträger, nur eine Armlänge vom Fluß entfernt, lagen zwei Männer am Boden. Der eine, ein junger Kerl mit kurzem, hellem Haar, angetan wie ein Waldbewohner in Grün und Braun, wehrte sich erbittert gegen drei Gestalten, die ihn brutal in den Uferschlamm drückten. Der zweite Mann wehrte sich nicht, ja, er bewegte sich nicht einmal. Etwas an seiner sonderbaren Lage, die Arme und Beine achtlos abgewinkelt, verriet, daß er tot war.
Die Männer und Frauen, die um die beiden am Boden herumstanden, schienen keineswegs Räuber zu sein, wie Kriemhild befürchtet hatte. Mit Ausnahme einiger Knüppel und Dreschflegel waren sie unbewaffnet. Kriemhild hielt sie für Bauern, einfache Dorfbewohner, die aus irgendeinem Grunde Blut geleckt hatten. Vielleicht hatte der Junge sie bestohlen oder sich an einem der hübscheren Mädchen vergriffen.
Kriemhild war schon Zeugin so mancher Hinrichtung geworden – im Burghof zu Worms, beinahe gleich vor ihrem Fenster –, doch eine so sonderbare wie diese hier hatte sie noch nie gesehen.
Der strampelnde Junge wurde mit Hilfe zahlreicher Schläge und Tritte auf den Bauch gerollt und festgehalten. Erstaunt sah Kriemhild, daß der Junge einen Buckel hatte; deutlich hob er sich am linken Schulterblatt unter seinem Lederwams ab.
Zwei andere Männer zerrten jetzt den Toten heran, banden ihn mit Seilen auf den Körper des Jungen, Rücken an Rücken. Als ein Mann mit einer Fackel sich zu dem verschnürten Bündel herabbeugte und höhnisch auf den Wehrlosen einbrüllte, erkannte Kriemhild im zuckenden Feuerschein, daß der Tote mit schwarzen Flecken übersät war. Entsetzen verschlug ihr den Atem. Allmächtiger, diese Menschen berührten ein Pestopfer, als ginge keinerlei Gefahr von ihm aus! Sie mußten wahnsinnig sein – oder bereits angesteckt!
Im selben Moment begriff sie, daß sie von hier verschwinden mußte. Doch als sie nach unten blickte, entdeckte sie voller Grausen, daß sich die Gruppe der Frauen einige Schritte zum Waldrand hin zurückgezogen hatte. Die aufgebrachten Weiber standen nun genau unter Kriemhilds Baum. Wenn eine von ihnen nach oben blickte, war es um Kriemhild geschehen. Schlimmer noch: Es war unmöglich geworden, unbemerkt hinabzuklettern. Sie mußte in den Ästen ausharren, bis alles vorbei war.
Der schreiende Junge und der Tote wurden in einen Kahn geworfen. Einige Männer ruderten ihn geschwind zur Mitte des Flusses. Schwankend stellten sich zwei von ihnen auf, packten den Toten an Armen und Beinen und hoben damit zugleich auch den Jungen von den Planken. Zweimal holten sie Schwung, dann schleuderten sie das armselige Bündel über die Reling ins Wasser. Sogleich verstummten die Schreie des Jünglings; die Leiche schwamm oben, er aber trieb unter Wasser. Jetzt erst begriff Kriemhild, wie perfide diese Art des Tötens tatsächlich war. Es war fraglich, ob der Junge es überhaupt schaffen konnte, sich mitsamt dem Toten im Wasser zu drehen, um dadurch selbst an die Oberfläche zu gelangen. Fraglicher noch war, wie lange er sich so würde halten können, denn die Strömung spielte ihr eigenes Spiel mit ihm. Kriemhild hatte Mitleid mit ihm, ganz gleich, was er verbrochen hatte. Doch sie wußte auch, daß sie nicht das geringste unternehmen konnte, um ihn zu retten.
Hätte man sie in diesem Augenblick gefragt, so hätte sie wohl bestätigt, daß es kaum noch schlimmer hätte kommen können. Doch, freilich, auch das erwies sich als frommer Wunsch.
Denn plötzlich ertönte ein Knacken, und die Astgabel, auf der sie saß, neigte sich nach unten – ganz langsam, unmerklich fast, aber doch unaufhaltsam. In blinder Panik griff Kriemhild nach einem anderen Ast, irgendwo über ihr. Sie hatte Glück … etwa drei Herzschläge lang. Dann brach die Gabel vollends ab, und obgleich Kriemhild mit beiden Händen an dem oberen Ast baumelte, polterte das geborstene Holz in die Gruppe der Frauen am Fuß der Eiche. Zwei, die getroffen wurden, schrien vor Schmerz und Überraschung auf, während die Blicke der anderen nach oben zuckten.
Kriemhild schenkte ihnen ein unschuldiges Lächeln – dann trafen sie schon die ersten Steine, die die empörten Weiber nach ihr schleuderten. Einige der Männer am Ufer wurden aufmerksam, und bald schon stand die keifende Menge unterhalb der Eiche, traktierte Kriemhild mit Wurfgeschossen und schrie nach ihrem Blut.
Ein tückischer Wurf traf sie am Kopf, ein anderer am rechten Arm. Ihre Finger gaben nach, dann fiel sie. Stürzte mitten in die brüllende Meute.
Jeder Ansatz von Gegenwehr, jedes Wort der Vermittlung, sogar jeder Schmerzensschrei ging im Tumult der Rasenden unter. Hiebe und Tritte prasselten auf Kriemhild ein, ohne daß sie verstand, was sie diesen Leuten angetan hatte. Manche zerrten an ihren Armen, ihrer Kleidung, dann auch an ihrem Haar. Brüllend wurde sie ans Ufer geschleift. Sie hörte, was die Menschen riefen, aber es machte keinen Sinn. Sie vernahm Bruchstücke von Sätzen, dann nur einzelne Wörter, Silben. Die Angst vor der Plage mußte sie alle um den Verstand gebracht haben.
Hände und Füße preßten Kriemhild mit Bauch und Gesicht in den weichen Schlamm. Feuchtigkeit und Dreck drangen in ihre Ohren, und einen seltsamen, unwirklichen Augenblick lang herrschte Stille – dann bekam sie keine Luft mehr, riß den Kopf zurück und fand sich gleich wieder inmitten des tobenden Gekeifes. Kriemhild spürte, wie Seile um ihren Körper geschlungen wurden, und ihr dämmerte, was ihr bevorstand. Noch einmal bäumte sie sich voller Verzweiflung auf, und da sah sie, daß man den Jungen und den Toten zurück an Land gezogen hatte. Alles weitere aber verblaßte angesichts neuerlicher Schläge und Schreie, als man Kriemhild zurück in den Schmutz drückte. Etwas wurde auf ihren Rücken gebunden, fest angezurrt. Das Etwas bewegte sich schwach, halb ertrunken, völlig erschöpft. Der Jüngling!
Hände rissen sie hoch, schleuderten beide gemeinsam wie verwachsene Mißgeburten in den Kahn, ruderten sie hinaus auf den Strom.
Dann – Wasser!
Kriemhild strampelte in wilder Panik, und der Junge tat es ihr gleich. Herzschläge lang trieb er an der Oberfläche, dann gelang es Kriemhild, ihn mit einem Ellbogenstoß in die Rippen zu überraschen. Er gab nach, sie drehten sich, und Luft strömte in Kriemhilds Lungen. Doch nur einen Augenblick lang. Dann wurde sie selbst schon wieder zur Seite gerissen. Sie rotierten um sich selbst, und abermals geriet Kriemhild unter Wasser, während der Junge über ihr durchatmen konnte.
Das Brausen und Gurgeln des Flusses war ohrenbetäubend. Luftblasen umwirbelten sie wie ein Insektenschwarm. Panisch schlug und trat Kriemhild um sich, und irgendwie gelang es ihr – vielleicht mit Hilfe der Strömung –, erneut nach oben zu kommen. Hustend und sich krümmend hing der Junge wie ein Anhängsel an ihrem Rücken. Und während sie selbst wieder durchatmen konnte, dachte sie: Er ertrinkt, wenn ich ihm nicht helfe!
Noch einmal schnappte sie verzweifelt nach Luft, dann drehte sie sich freiwillig zur Seite, wurde unter die Oberfläche gerissen und hoffte, daß ihre Hilfe für den Jungen nicht zu spät kam. Sie betete, daß er das gleiche Mitleid mit ihr zeigen würde! Wenn sie sich abwechselten, wenn es ihnen trotz aller Panik und Angst gelang, einen klaren Kopf zu behalten, dann konnten sie überleben. Zumindest eine Weile. Vielleicht, bis sie ans andere Ufer geschwemmt wurden. Vielleicht bis –
Das Gewicht des Jungen riß sie herum, und nun war sie es, die oben trieb. Er hat es begriffen! jubelte sie in Gedanken. Er ist freiwillig untergetaucht! Sie holte Luft, einmal, zweimal, dann rollte sie sich zur Seite, gab ihm Gelegenheit zum Atmen. So machten sie es vier- oder fünfmal, dann bemühte sich Kriemhild neben dem Atemholen um einen Blick ans Ufer. Verschwommen sah sie eine Ansammlung heller Punkte, sehr klein, fast wie Glühwürmchen – Fackeln, die schnell in der Ferne zurückblieben. Ja, bei Gott, der Fluß trug sie stromabwärts, fort von den Wahnsinnigen!
Die Anstrengung des ständigen Drehens, Luftholens, Untertauchens drohte Kriemhild zu überwältigen. Lange würde sie nicht mehr durchhalten. Sie hätten ihre Bewegungen besser aufeinander abstimmen müssen, doch so lange sie sich untereinander nicht verständigen konnten, war das unmöglich. Sie konnten nur darauf vertrauen, innerhalb der nächsten Augenblicke ans Ufer gespült zu werden.
Sie hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als ihre Knie über harten Stein schrammten. Dann wurde sie auch schon wieder herumgerissen, schnappte nach Luft und sah durch einen Wasserschleier die riesenhaften Silhouetten hoher Bäume vor dem goldenen Abendhimmel. Unter ihr bäumte sich der Junge auf, und ein Schmerzensschrei drang durch das Wasser empor. Fester Grund, endlich!
Wenig später lagen sie im seichten Uferwasser, beide auf der Seite, immer noch gefesselt, und atmeten tief und lange durch.
Der Junge brachte als erster ein paar zusammenhängende Worte hervor. »Wer … wer bist du?«
Kriemhild hustete, Wasser lief ihr aus dem Mund.
»Wer, zum Teufel, bist du. Und warum hast du uns das eingebrockt?«
»Uns?« Er verrenkte sich fast den Hals bei dem Versuch, sie anzusehen. Vergeblich. Die Fesseln saßen zu eng, und beide keuchten schmerzerfüllt auf.
»Bleib gefälligst ruhig liegen!« fauchte Kriemhild ihn an. »Oder willst du uns beide erdrosseln?«
Ihre Kratzbürstigkeit verwirrte ihn. »Hab ich dich vorher schon mal gesehen?«
»Du siehst mich ja nicht einmal jetzt!« Mittlerweile hatte sie ihre Sinne so weit beieinander, daß sie vorsichtiger wurde. Niemand durfte erfahren, wer sie wahr. Zu leicht konnte sie Spitzbuben in die Hände fallen, die sich ein schönes Lösegeld für sie ausrechnen mochten. »Warte«, sagte sie dann, als sie sich an den verbliebenen Dolch in ihrem Stiefel erinnerte; den anderen hatte sie beim Gerangel mit der aufgebrachten Meute verloren. »Ich will versuchen –«
Beide stöhnten vor Schmerz, als Kriemhild das Bein anzog und mit den Fingern nach dem Stiefelschaft tastete. Die Seile schnürten ihnen Brust und Bauch ab.
»Ich hab ihn!« preßte sie schließlich triumphierend hervor. Als er nicht reagierte, fragte sie: »He, lebst du noch?«
»Nein.«
Das Abendrot brach sich auf der blanken Dolchklinge, als Kriemhild vorsichtig die Seile über ihrem Oberkörper durchtrennte. Augenblicke später waren sie frei, rollten voneinander fort und blieben erschöpft auf dem Bauch im seichten Wasser liegen.
Als Kriemhild zu dem Jungen hinüberschaute, bemerkte sie, daß er sie eingehend musterte.
»Was glotzt du so?« zischte sie empört.
»Wenn du mir schon deinen Namen nicht verrätst, muß ich mir wenigstens merken, wie du aussiehst, meinst du nicht?«
»Hast du mir denn deinen verraten?«
»Jodokus.« Und nach einer Pause setzte er hinzu: »Jodokus der Sänger.«
»Was für ein Name ist das?« entfuhr es ihr amüsiert.
Seine Augenbrauen stellten sich schräg. »Hast du einen besseren?« fragte er gereizt.
»Fine«, sagte sie zögernd. Das war der Name einer ihrer Kammerzofen, und der einzige, der ihr ohne nachzudenken einfiel. »Ich heiße Fine.«
Einen Moment lang war da etwas wie Mißtrauen im Blick seiner braunen Augen, dann aber rappelte er sich auf alle viere hoch. »Gut, Fine. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet.« Zweifelnd fügte er hinzu: »Irgendwie, zumindest.«
Auch Kriemhild setzte sich im Schlamm auf, taumelte dann auf die Füße. »Ich hab’s nicht gern getan, das darfst du mir glauben.«
»Wie liebenswürdig.«
Sie schenkte ihm ein giftiges Lächeln und schob sich die feuchten Strähnen ihres Goldhaars aus dem Gesicht.
Wieder starrte er sie eingehend an. Ihr nasses Hemd klebte durchscheinend an ihren Brüsten. Als sie es bemerkte, raffte sie zornig ihre Weste zurecht.
Jodokus wurde rot und lachte leise, sagte aber nichts.
Kriemhild schaute sich um. »Wir sind am anderen Ufer, oder?«
»Ansonsten hätten sie uns längst wieder eingefangen.«
»Dann sind wir hier sicher?«
»Nicht lange, fürchte ich. Das Dorf dieser Leute liegt an der einzigen Furt weit und breit, ein wenig weiter nördlich. Kann sein, daß sie uns über den Fluß folgen werden.«
Kriemhild suchte das andere Ufer ab, konnte aber weit und breit keinen Fackelzug erkennen. »Warum wollten sie dich überhaupt umbringen?«
»Aus dem gleichen Grund wie dich.«
»Der da wäre?«
»Sie sind verrückt. Schlicht und einfach.«
Kriemhild musterte ihn abschätzend, während sich beide ins Trockene schleppten. »Wer sagt mir, daß du kein gesuchter Verbrecher bist? Ein Mörder, vielleicht. Möglicherweise hatten sie ja recht mit dem, was sie vorhatten.« In Wahrheit aber glaubte sie nicht daran. Jodokus entsprach nicht gerade dem Bild jener Mordbuben, die sie während der Hinrichtungen bei Hofe zu Gesicht bekommen hatte. Abgesehen von dem leichten Buckel auf seinem Rücken, war er eigentlich recht ansehnlich, sogar jetzt noch, da das Wasser aus seiner Kleidung triefte. Tropfen glitzerten wie Diamanten in seinem kurzgeschorenen Haar, und das schalkhafte Blitzen in seinen Augen war frech und anziehend zugleich. Kriemhild schätzte ihn grob auf siebzehn Jahre, nicht viel älter als sie selbst. Eine kleine Narbe zog sich von seinem linken Mundwinkel Richtung Wange, als hätte jemand versucht, ihm ein bleibendes Lächeln zu verpassen.
»Du glaubst also, ich bin ein Halunke, ja?« fragte er, als sie sich matt gegen einen Baumstamm lehnten und in entgegengesetzte Richtungen blickten.
Kriemhild unterdrückte ein Lächeln. »Sagen wir, der Gedanke liegt mir nicht allzu fern.«
Er verzichtete, näher darauf einzugehen, und fragte statt dessen: »Was verschlägt ein Mädchen wie dich in diese Gegend?« Er senkte seine Stimme ein wenig. »Weißt du nicht, daß hier die –«
»Die Pest wütet?« ergänzte sie. »O doch.«
»Fürchtest du dich nicht davor?«
»Nicht mehr als du.«
»Ich mache mir fast in die Hosen vor Angst.«
»Welch bezaubernde Vorstellung.«
»Was hast du hier zu suchen? Bist du auf der Flucht?«
»Ich will nach Osten.«
»Aber alle Flüchtlinge ziehen in westliche Richtung.«
»Dann bedeutet das wohl, daß ich kein Flüchtling bin, nicht wahr?«
»Wer war der andere Mann, der Tote?«
Jodokus hob die Schultern. »Jemand aus dem Dorf, nehme ich an. Sie wollten wohl, daß ich mich bei ihm anstecke.« Er rückte am Baumstamm zu ihr herum, bis sich ihre Schultern fast berührten. Eingehend betrachtete er ihr feines Profil. »Du bist zu schön für eine einfache Herumtreiberin. Deine Haut ist zu glatt und ebenmäßig. Du hast nie in deinem Leben mit den Händen gearbeitet, deine Finger sind zu zart und unversehrt. Du stammst aus gutem Hause. Laß mich raten: Eine Ausreißerin, stimmt’s?«
Sie war überrascht und auch ein wenig besorgt. Wenn er sie so mühelos durchschaute, würde das wahrscheinlich jedem anderen genauso gelingen. »Kann schon sein«, erwiderte sie vage, weil sie ahnte, daß es wenig Sinn hatte, ihn zu belügen. »Da du anscheinend alles über mich weißt, ist es jetzt wohl an dir, etwas über dich zu erzählen.«
»Ich hab nur geraten. Versuch du es doch auch.«
Sie beugte sich vor und schaute ihn über die Schulter hinweg an. Sie hatte angenommen, daß er sie nur necken wollte, doch jetzt erkannte sie den Ernst in seinen Zügen. »Gut«, meinte sie widerwillig, wenn auch nicht vollkommen abgeneigt. »Du bist Sänger, hast du gesagt. Wahrscheinlich ein schlechter, sonst wärest du nicht hier, sondern bei Hofe oder in einer Stadt. Außerdem hast du kein Instrument dabei.«
»Die Leute am Fluß haben es mir abgenommen.«
»Wollten sie dich deshalb töten?« fragte sie verschmitzt. »Weil dein Gesang so grauenvoll war?«
Sie fürchtete einen Moment lang, das sei eine Spitze zuviel gewesen, doch dann grinste er breit. »Mag schon sein, daß ihnen mein Gesang mißfallen hätte. Aber soweit ist es gar nicht erst gekommen. Sie haben mich vom Pferd gezerrt, als ich durch ihr Dorf ritt, und dann schleppten sie mich gleich zu dieser Stelle am Ufer. Hier ist er tiefer als anderswo, glaube ich.«
»Dann muß ihnen einiges daran gelegen haben, daß du auch wirklich ersäufst.«
»Sieh an, sieh an: Die kleine Prinzessin spricht wie eine Räuberbraut.«
Bei der Anrede »Prinzessin« zuckte sie zusammen. Eine Redensart, nichts sonst. Sie fragte sich, ob er ihre heftige Reaktion bemerkt hatte. Falls ja, so zeigte er es nicht.
»Und du behauptest, du wüßtest wirklich nicht, warum sie es auf dich abgesehen hatten?«
»Genausowenig wie du.«
So kamen sie nicht weiter. Vorerst saßen sie gemeinsam in diesem Schlamassel. Lavendel wartete auf der anderen Seite des Flusses, und obgleich es Kriemhild traurig stimmte, die Stute zurückzulassen, war das Wagnis, die Furt zu benutzen, viel zu groß. Andererseits: Wie sollte sie ohne Pferd ihr Ziel erreichen, bevor die Plage nach Worms vorrückte?
Als er sah, daß sie plötzlich Verzweiflung überkam, ergriff er zögernd ihre Hand. »Du hast es eilig, nicht wahr?«
»Ich …«, begann sie zögernd, sagte dann aber nur: »Ja. Ich muß nach Osten, und zwar so schnell wie möglich.« Warum hätte sie das leugnen sollen? »Mein Pferd ist am anderen Ufer, und ohne es …«
Er drückte ihre Hand, um sie aufzumuntern, aber sie zog ihre Finger geschwind zurück.
»Wir besorgen dir ein neues«, sagte er, um ihr Mut zu machen. »Und mir auch. Wenn du willst, reiten wir zu zweit, wo immer du auch hinwillst.«
»Du willst mitkommen?« Sie lachte auf, aber es war ein bitterer, verletzender Laut. »Ich kenne dich ja nicht einmal.«
»Du wirst mich schon kennenlernen.«
»Wenn du mich anrührst –«
»Niemals. Versprochen!«
Sie suchte in seinen Augen nach einem Hinweis, ob er das ernst meinte. »Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann.«
»Natürlich weißt du das nicht. Aber wer sagt mir denn, ob ich dir trauen kann?«
»Ich werde wohl kaum bei Nacht über dich herfallen, dessen sei versichert.«
Strahlend sprang er auf. »Dann brauchen wir voreinander ja keine Angst zu haben. Komm, laß uns aufbrechen. In den Wäldern laufen eine ganze Menge Pferde herum. Sie sind aus ihren Stallungen ausgebrochen, als niemand mehr kam, um sie zu füttern. Mittlerweile gibt es in dieser Gegend mehr freilaufende Pferde als Menschen.«
»Die Leute aus dem Dorf schienen mir recht lebendig zu sein.«
»Die wenigen, die übrig waren. Aber ich habe das Dorf gesehen. Die vielen Totenfeuer, die schwarzen Fetzen an den Türen. Die zwanzig oder dreißig am Ufer waren nur der armselige Rest.«
»Glaubst du, sie waren schon krank?«
»Einige gewiß.«
»Und wir?«
Er zuckte mit den Achseln. »Warten wir’s ab.«
»Du nimmst den Tod nicht allzu schwer.«
»Noch leben wir, oder? Außerdem fürchte ich den Tod nicht. Die Pest, ja, sicher. Die Krankheit, das Siechtum. Aber nicht das Ende.«
Kriemhild warf noch einen betrübten Blick zum anderen Ufer, aber Lavendel war nirgends zu sehen. Dann trat sie Seite an Seite mit dem buckligen Jungen in den Wald, auf der Suche nach einem Pfad Richtung Osten.
»Warum?« fragte sie nach einer Weile.
»Warum was?«
»Weshalb hast du keine Angst vor dem Tod?«
Da verdüsterte sich sein Blick, und als er sprach, da klang es, als habe sie eine böse Erinnerung in ihm geweckt. »Ich kenne ihn viel zu gut, um ihn noch zu fürchten.«
»Niemand kennt den Tod. Keiner weiß, was einen erwartet, auch du nicht.«
»Ich schon. Ich war da.«
»Du mußt ein fürchterlicher Sänger sein, wenn deine Lügen alle so schlecht sind wie diese.«
Abrupt blieb er stehen. Sein Gesicht war bleich geworden. »Ich war einem Tod so nah wie kein anderer.«
»Einem Tod?« fragte sie verwundert. »Glaubst du denn, es gibt mehrere?«
»Es gibt einen leichten und einen schweren Tod, und wahrscheinlich noch einige dazwischen.«
Kriemhild grinste. »Dann ist dir gewiß der allerschwerste über den Weg gelaufen«, bemerkte sie scharfzüngig. Sie konnte ihn immer noch nicht ernst nehmen.
»Ja.«
»Das dachte ich mir.«
Kopfschüttelnd wollte sie weitergehen, doch er legte ihr eine eiskalte Hand auf die Schulter. Kriemhild schauderte und streifte die Finger eilig ab, wie die Beine einer besonders ekelhaften Spinne.
»Kein Tod«, sagte er leise, »ist so schrecklich wie der, den die Götter selbst einem wünschen.«