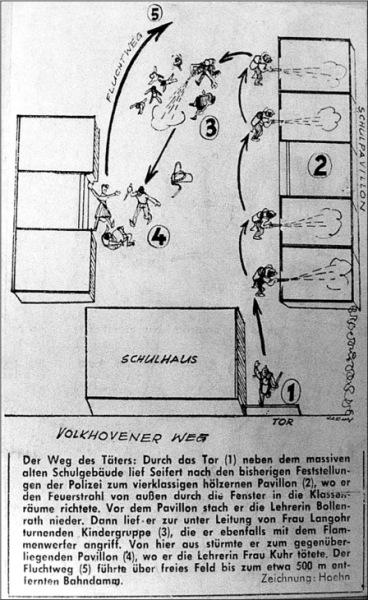
Nun waren zwei weitere Schulklassen unmittelbar hinter dem Eingang eines Pavillons bedroht, da sie ebenerdig lagen. Die beiden dort unterrichtenden Lehrerinnen versuchten geistesgegenwärtig, die vor den beiden Klassenräumen liegende Flurtür zuzuhalten. Das gelang ihnen aber nicht, da Seifert die Tür mit einem einzigen, kräftigen Ruck aufriss. Eine der Lehrerinnen stürzte dabei über eine nur zweistufige Treppe auf den Schulhof. Dort trafen sie zuerst zwei Speerstiche in die Oberschenkel, bevor Seifert die sich windende Frau, wieder mit einem einzigen Stich – dieses Mal in den Rücken – tötete.
Der mordende Seifert wusste nicht, dass der Nagelkeil unter der Hoftür mittlerweile entfernt worden war. Er glaubte daher, dass er sich eingesperrt hätte, und lief deshalb zum anderen Ende des Schulhofs. Dort kletterte er mit seiner Stichwaffe über den Zaun und floh über ein brachliegendes Gelände in Richtung eines Bahndamms.
Gleichzeitig war die Feuerwehr angerückt und begann, die brennende Baracke zu löschen. Es hatten sich auch zahlreiche Schaulustige eingefunden, von denen der Hinweis kam, wohin der Täter gelaufen war. Zwei Schutzleute der Funkstreife rannten Seifert hinterher und stellten ihn. Der wehrte sich allerdings, und die Polizisten mussten seinen gut gezielten Speerstichen ausweichen. Erst ein Oberschenkelschuss der Ordnungshüter sorgte für Ruhe.
Rasch war auch die Mordkommission zur Stelle. Die Beamten versuchten noch vor Ort, Seifert eine Aussage abzuringen. Das Protokoll dieser ersten Befragung ist erhalten:
Frage: Können Sie mich verstehen, können Sie sprechen?
Antwort: Ja.
Frage: Wie heißen Sie?
Frage: Wann sind Sie geboren?
Antwort: 19. Juni 1921 in Köln.
Frage: Welchen Beruf haben Sie?
Antwort: (unverständlich)
Frage: Wo wohnen Sie?
Antwort: Volkhovener Weg (Hausnummer wurde
unverständlich angegeben, Nr. 54 verstanden).
Frage: Warum haben Sie das getan?
Antwort: Man wollte mich töten!
Frage: Wer wollte Sie umbringen?
Antwort: Der Obermedizinalrat … wollte mich töten!
Frage: Kannten Sie eine der Lehrerinnen?
Antwort: Nein, ich kannte keine!
Frage: Hatten Sie Ärger mit der Schule?
Antwort: Nein!
Seifert sprach so wirr, wie seine Gedanken waren. Er war fest davon überzeugt, dass die behandelnden Ärzte im Jahr 1961 den Tod seiner Frau Ulla sowie seines neugeborenen Kindes verschuldet hatten. In Wahrheit war das Kind aber ein Frühchen, was damals noch eine medizinische Herausforderung darstellte, und seine Gattin hatte im Wochenbett einen tödlichen Aderverschluss erlitten. Seitdem ging Seifert fast jeden Tag mit frischen Blumen zum Grab der beiden. »Er muss seine Frau sehr geliebt haben«, meinte die Blumenverkäuferin später gegenüber der Polizei.
Der nun am Bahndamm eingetroffene Notarzt wies Seifert sofort ins Krankenhaus ein. Dort ging es dem Täter zunehmend schlechter. Neben der Feuerspritze war ein Fläschchen mit dem damals weit verbreiteten Pflanzenschutzgift Parathion (E 605) gefunden worden. Hatte Seifert das Gift geschluckt?
Die Kripo ließ nicht locker und setzte nach der ersten ärztlichen Behandlung die Befragung fort.
Frage: Können Sie mich verstehen?
Antwort: Ja.
Frage: Warum haben Sie das gemacht?
Antwort: ----
Frage: Können Sie mich sehen?
Antwort: Ja.
Frage: Warum haben Sie das getan?
Antwort: ----
Frage: Kannten Sie eine der Lehrerinnen?
Antwort: Nein.
Frage: Kannten Sie eine der Lehrerinnen?
Antwort: Nein.
Frage: Kannten Sie ein Kind?
Antwort: Nein.
Frage: Kannten Sie die Schule?
Antwort: Nein.
Frage: Wissen Sie, warum Sie es getan haben?
Antwort: Ja. Es ist eine böse Sache, alles.
Frage: Warum ist das eine böse Sache?
Antwort: Ja, es ist eine böse Sache.
Frage: Wann haben Sie den Plan dazu gefasst?
Wann haben Sie sich Gedanken darüber gemacht?
Schon seit langem oder seit kurzem?
Antwort: Schon lange.
Frage: Warum haben Sie das gemacht?
Antwort: ----
Frage: Warum haben Sie das gemacht?
Sagen Sie mir den Grund.
Antwort: Differenzen mit Ärzten.
Frage: Mit welchen Ärzten, wer hat Sie geärgert?
Sagen Sie den Namen.
Antwort: Dr. M.
Frage: Kannten Sie eine der Lehrerinnen?
Frage: Welcher Arzt noch?
Antwort: Dr. C.
Frage: Warum, wegen der Rente?
Antwort: Das auch, aber weniger.
Frage: Was hatten Sie für Differenzen?
Frage: Warum gerade die Kinder?
Antwort: Das ist zu langatmig.
Frage: Erzählen Sie es mir denn morgen?
Antwort: Ja, morgen.
Frage: Bereuen Sie es, schämen Sie sich?
Antwort: Dazu muss ich später Stellung nehmen.
Das muss ich alles verantworten.
Frage: Warum gerade die Kinder?
Mögen Sie Kinder nicht?
Antwort: Doch.
Frage: Warum denn?
Antwort: Es ist vielleicht eine verderbte Idee.
Frage: Warum denn die drei Lehrerinnen?
Antwort: Die kamen auf mich zu.
Frage: Wissen Sie, was Sie gemacht haben?
Antwort: Doch, ich weiß es.
Frage: Was haben Sie denn gemacht?
Antwort: Ich habe einen Flammenwerfer gemacht.
Frage: Was haben Sie damit gemacht?
Antwort: Menschen angegriffen.
Frage: Warum?
Haben Sie nur mit einem Flammenwerfer
Menschen angegriffen oder sonst noch womit?
Antwort: Mit einem Speer.
Frage: Was haben Sie damit getan, wissen Sie das noch?
Antwort: Damit habe ich eine Lehrerin erstochen.
Frage: Wie viele Menschen haben sie damit erstochen?
Antwort: Drei.
Frage: Zwei oder drei?
Antwort: Drei. [Es waren zwei; M. B.]
Frage: Warum gerade diese Menschen,
diese Kinder, diese Schule?
Antwort: Zufall.
Frage: Tut es Ihnen Leid, was soll ich Ihrer Mutter sagen?
Antwort: Wie es ist.
Frage: Und dem Bruder? Der war bei uns.
Antwort: Wie es war.
Frage: Wie lange hatten Sie schon den Plan?
Seit gestern, vorgestern? (Kopfschütteln).
Frage: Haben Sie eine Zeitungsfrau vor einem Jahr angefallen?
Antwort: Nein.
Frage: Wie lange hatten Sie schon den Plan dazu?
Seit einem Tag, einer Woche, einem Monat?
Antwort: ---
Frage: Wann haben Sie den Speer gemacht?
Antwort: Acht Wochen so rum.
Frage: Wann haben Sie den Flammenwerfer gemacht?
Antwort: Kurze Zeit vorher.
Mehr war aus Seifert nicht herauszubringen: Um 20.30 Uhr starb er an einer E-605-Vergiftung.
In den folgenden Tagen fassten sich die Polizisten noch mehrmals an den Kopf. Wie so oft bei besonders grausamen und unvorhersehbaren Morden beschrieben die Nachbarn Seifert als unauffällig, hilfsbereit und vor allem kinderlieb.
Wie oberflächlich solche Einschätzungen unter Nachbarn sein können, zeigt der Vergleich dieser Aussagen mit dem, was Seiferts sechs Jahre jüngerer Bruder, von Beruf Fernmeldesekretär, über den Täter berichtete. »Bevor [mein Bruder 1955] heiratete, hatte ich einen Krach mit ihm. Er hatte einen Plan, den ich für vollkommen verrückt hielt.«
Dieser Plan war mehr als verrückt, und er war der Vorbote dessen, was später zum Tod von zehn Schülern und zwei Lehrerinnen führte. Denn der ältere Seifert-Bruder plante, in einem Kellerloch Mädchen zu horten, »um diese nach Bedarf zu gebrauchen«. Er wollte die Opfer »in das Haus schaffen«, indem er ihnen an Feldwegen auflauerte, sie betäubte und dann mit dem Mofa abtransportierte.
»Ich hatte jedenfalls den Eindruck«, sagte der jüngere Seifert, »dass mein Bruder diese Sache ernst meinte. Man kann es an seinem Gesicht sofort sehen.« Er konnte Walter aber zweimal von diesen Entführungsvorhaben abbringen.
Motiv und Planung
»[Ein Streit mit Kanalarbeitern] war der einzige Ärger gewesen, den ich meinem Bruder gestern angesehen habe«, gab der jüngere Bruder weiter zu Protokoll. »Wir unterhielten uns noch etwas über das Fernsehen. Sonst habe ich meinem Bruder nicht angemerkt, dass er eine solche Tat vorhatte.«
Doch auch das war nur eine rosa gefärbte Beschreibung von Walter Seiferts Innerem. Denn schon seit Jahren hatte er sich in ein scheinbar logisches Wahnsystem verstiegen. Seine irre Gedankenkette begann damit, dass zwei Ärzte seine Frau und das neugeborene Kind auf dem Gewissen haben mussten. In einer über hundertseitigen Schrift, die er an Behörden, Ärzte und Pharmafirmen verschickte, ging Seifert dieser Sache weiter auf den Grund.
»Der Arzt ist der größte Armen-Massenmörder in der Geschichte der Menschheit … Was also tun? An das ›Gewissen‹ appellieren – sinnlos. Wer das tut, hat kein Gewissen. Die von mir erkannte Wissenschaft vor irgendein Gericht? Nein, nun setzt die Selbstjustiz, der Terror der Gruppe Arzt im pluralistischen Verbrecherchaos ein. Terror aber kann nur durch Gegenterror beseitigt werden, und wer mir den Schutz des Gesetzes verweigert, zwingt mir die Keule in die Hand.«
Der von solcher Erkenntnis Durchdrungene meinte daher, gegen das System kämpfen zu müssen. Dazu wählte er dieselben Methoden, die auch der Feind der Gesellschaft, nämlich »die Gruppe Arzt«, gewählt hatte: wahlloser Terror gegen Schwache. Seine Rachewerkzeuge baute sich Seifert aus dem zusammen, was er als gelernter Bohrer und Dreher im Schuppen fand.
Dass seine Taten so wahllos waren, wie er es während der kurzen Befragung andeutete, konnte man ihm fast glauben. Die von ihm überfallene Volksschule lag in der Nähe seiner Wohnung. Jenseits aller Tiefenpsychologie war sie wohl wirklich ein zufälliges, weil bequem erreichbares Ziel. Seifert hatte vielleicht wirklich nichts gegen Kinder. Sie wurden aber Opfer seines Anschlags, weil ein Racheplan, der über Gesetzen und Regeln stand, es ihm so befahl.
Walter Seifert hatte aber auch vorher schon gegen die Mächte gefochten. Der in Köln geborene Handwerker war im Alter von 20 Jahren als Soldat zum Kriegsdienst verpflichtet worden. Bereits nach einem Jahr wurde er wegen Tuberkulose wieder entlassen. Die Krankheit wurde zwar nicht auskuriert, verschlimmerte sich aber auch nicht. Trotzdem konnte Seifert nie mehr körperlich arbeiten und blieb arbeitslos.
Der verbitterte Mann glaubte, dass seine Krankheit ein Kriegsleiden sei: Er habe sich bei anderen Soldaten angesteckt. Seit 1955 war Seifert wegen der Lungenkrankheit in ärztlicher Behandlung, und 1960 wurde er zum »Invaliden« erklärt, das heißt zur arbeitsunfähigen Person mit entsprechenden Sozialansprüchen. Trotzdem kämpfte er um eine höhere Kriegsrente. Die bekam er aber nicht. Also schickte Seifert dem Leiter des Gesundheitsamtes sowie dem Kölner Oberstadtdirektor Max Adenauer immer neue Anträge und Beschwerdebriefe.
Mittlerweile hatte ein medizinischer Obergutachter dem Amtsarzt bestätigt, dass Seiferts Erkrankung schon vor dem Krieg bestanden habe. Den Kranken ärgerte nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem, dass das erneute Gutachten ohne Rücksprache mit ihm, nur aus den Akten heraus erstellt worden war. Als Seifert wenige Tage vor seiner unfassbaren Tat von diesem Gutachten erfuhr, sagte er seinen Schwiegereltern, dass es auf der Welt offensichtlich keine Gerechtigkeit gäbe. Die alten Leute bestürzte dabei, dass Seifert in diesem Zusammenhang wieder damit anfing, von seiner toten Frau zu sprechen. »Was könnte das schön sein, wenn die Ulla noch hier wäre«, sagte er. Das war zwei Tage vor der Tat. »Nach dem Tod seiner Frau und seines Kindes dachte ich sowieso, der Walter wird verrückt«, erinnerte sich der Schwiegervater.
Was blieb, war Fassungslosigkeit
In der Presse herrschte große Aufregung, Entsetzen und Mitgefühl machten sich breit. »Die Eltern«, schrieb der Kommentator des Kölner Stadt-Anzeigers auf Seite eins, »und jeder, der ihre Sorge um die verletzten Kinder teilt und sich angerührt fühlt von der unfassbaren Tat … können nur schaudernd sehen, wessen ein Mensch fähig ist und wie hilflos wir alle einem von ihnen ausgeliefert sein können.« Sogar französische Zeitungen brachten das Feuerattentat auf ihren Titelseiten.
Dennoch, die Schwiegermutter konnte das alles nicht glauben. »Ich kann es gar nicht fassen, das ist doch unmöglich!«, redete sie auf den Journalisten Erich Schaake ein, als sie von der Tat erfuhr. »Unser vernünftiger Walter soll das getan haben? Der kann doch keiner Fliege etwas zuleide tun! Wenn Sie mir gesagt hätten, der Himmel über Volkhoven wäre zusammengestürzt, das hätte ich eher geglaubt. Er war so ein guter Junge.«
Als Seifert am Abend des Überfalls starb, war für die wirtschaftlich gerade wieder auf die Beine gekommenen Nachkriegsdeutschen etwas geschehen, das zu fürchterlich war, um darüber nachzudenken. Sie blendeten die Tat in den folgenden Jahren einfach aus. Das gesamte Geschehen lag für sie jenseits des Verstehbaren. Nur eine Erklärung hörte man hin und wieder: Eine der Lehrerinnen soll Seiferts Frau ähnlich gesehen haben. Hätte der Täter sich auch nur ansatzweise zu den wahren Motiven seiner Tat geäußert, hätte das Grauen vielleicht eher Gestalt angenommen und verarbeitet werden können. So aber herrscht seit fast 40 Jahren Schweigen in Volkhoven, wenn das Gespräch auf Walter Seifert und seine Tat zu kommen droht. Er war ebenso wenig ein »guter Junge«, wie die Welt in den Sechzigerjahren rein und gut war. Doch darüber wollte damals erst recht niemand nachdenken.
Der vergessene Serientäter (Vater Denke)
Täter wie Walter Seifert, die nicht über ihre Motive sprechen, versetzen die Menschen in Angst und Schrecken. Andererseits haben die Medien dann kaum etwas Spannendes zu berichten. Ein weiteres Beispiel dafür ist der Fall von Vater Denke. Sein Name wie seine Taten sind trotz ihres unfassbaren Ausmaßes so gut wie vergessen, während gesprächige Mörder wie Jeffrey Dahmer, Ed Gein oder Charles Manson bei ihren Fans Kultstatus genießen und von Tassen, T-Shirts und Websites herabblicken.
Die stummen Täter machen es uns hingegen schwer, ihre Taten zu deuten. Doch so, wie wir die heutige Quantenphysik hinnehmen müssen, ohne sie mit unserer Alltagswahrnehmung in Einklang bringen zu können, müssen wir auch damit leben, dass es Taten gibt, deren Gründe wir nicht verstehen. Vor allem eine Grundfrage ist bis heute nicht gelöst: Was macht den einen Menschen zum Verbrecher, den anderen mit vergleichbarem Lebensschicksal aber zum Krankenpfleger, Polizisten, Schreiner oder Staatsanwalt? Solange wir darauf keine Antwort haben, wollen wir auch geistig herausfordernde Fälle so betrachten, wie sie uns rein kriminalistisch entgegentreten. Das gilt auch für Vater Denke.
Serienmord
Filmemacher, Psychiater und Kriminalisten haben den Fall Denke wenig beachtet. Deshalb sollen die Taten hier so wiedergegeben werden, wie sie damals gesehen und verstanden wurden. Obwohl Denke lange vor dem Serientäter Ed Gein (verhaftet 1957) sein Unwesen trieb, dessen Taten Filme wie Psycho oder Das Schweigen der Lämmer anregten, hätte Denke mit größerem Recht als Vorlage für die Psycho-Horror-Welle im Kino dienen können. Doch Denke blieb stumm, und so konnte man noch nicht einmal darüber erschrecken, wie abgestumpft er gewesen sein musste.
Der Rechtsmediziner Pietrusky aus Breslau stellte den Fall 1925 auf dem Kongress für gerichtliche und soziale Medizin in Bonn vor, und im Jahr darauf veröffentlichte ihn die Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin. Hier ist Pietruskys Bericht:
über kriminelle
leichenzerstückelung.
der fall denke.
Die Taten des Massenmörders Haarmann hatten noch nicht ihre Sühne gefunden, da wurde ein Verbrechen in Münsterberg bekannt, das womöglich noch grauenhafter ist als das von diesem begangene. Karl Denke hat in den letzten 21 Jahren über 31 Menschen gemordet, ihr Fleisch zum Teil selbst genossen, zum Teil es anderen zum Essen vorgesetzt und menschliche Leichenteile zu Gebrauchsgegenständen verarbeitet. Der Fall, der in seiner Art einzig dasteht, lehrt uns, dass das für unmöglich Gehaltene Ereignis werden kann.
Die im Folgenden angeführten Tatsachen stützen sich auf die Untersuchung des gesamten Materials, das dem hiesigen Gerichtsärztlichen Institut übersandt wurde, auf die Ergebnisse meiner Ermittlung an Ort und Stelle wie auf den Inhalt der Akten, die mir in liebenswürdiger Weise zum Teil durch den Herrn Oberstaatsanwalt und den Herrn Bürgermeister von Münsterberg, als Leiter der dortigen Polizei, zugänglich gemacht worden sind.
Münsterberg, im Regierungsbezirk Breslau, ist ein kleiner Ort von etwa 9000 Einwohnern mit den mehr oder weniger angenehmen Eigentümlichkeiten einer kleinen Stadt ohne Industrie. Die Peripherie des Ortes hat den Charakter eines Dorfes. Kleine Häuser, von Gärten umgeben, stehen etwa 20 bis 50 Meter voneinander entfernt an der Straße. Zu beiden Seiten des Hauses, in dem Denke wohnte, finden sich in der oben genannten Entfernung andere Gehöfte. Neben dem Wohnhaus, weiter von der Straße zurückliegend, mit der Front nach dieser, steht ein Holzschuppen, der zum Teil zu seiner Wohnung gehört und von ihm benutzt worden ist. Hinter dem Hause, in einer Entfernung von etwa 80 Metern, liegt ein kleiner, etwa drei Meter tiefer Tümpel, den er vor drei Jahren gegraben hat. Einige 100 Meter entfernt von dem Gehöft fließt die Ohle.
In dem Hause wohnten drei Parteien. Den vorderen Teil hatte ein Lehrer mit seiner Familie, der aus Oberschlesien durch die Polen vertrieben worden ist, im Besitz, den hinteren Teil bewohnte im Erdgeschoss Denke und im ersten Stock, der durch denselben Flur und dieselbe Tür wie seine Behausung zu erreichen ist, ein Arbeiterehepaar. Der Mann ist schwerhörig und macht einen etwas beschränkten Eindruck. Die Frau dagegen erscheint sehr geweckt.
Die Wohnung des Denke besteht aus einem Zimmer von etwa vier mal vier Metern und liegt fast zu ebener Erde. Hier schlief, aß und arbeitete er, mordete und zerteilte Menschen. Die Unsauberkeit in diesem Raum spottet jeder Beschreibung … Auf die einzelnen Gegenstände, die mit den Morden in Beziehung stehen, komme ich später zurück, hervorgehoben sei jedoch die sehr große Menge Salz, die er vorrätig hatte, wie sehr viele Kleidungsstücke seiner Opfer und mehrere gut brauchbare Hosenträger.
Die Gründe, die zur Hausdurchsuchung und damit zur Aufdeckung des Verbrechens geführt haben, waren folgende: Ein Handwerksbursche, der bei Denke bettelte, wurde von diesem aufgefordert, ihm einen Brief zu schreiben, da er selbst, wie er sagte, sehr kurzsichtig sei und ihm das Schreiben schwer fiele. Er versprach ihm für diesen Dienst 20 Pfennig. Der Mann, den ich später im Gefängnis befragte, gab an, dass Denke den Brief scheinbar zu diktieren begann mit den Worten: »Du dicker Wanst.« Da ihm diese Worte merkwürdig vorkamen, drehte er sich um und vermochte gerade noch dem Schlage einer Spitzhacke auszuweichen, der gegen seinen Kopf geführt war. An der rechten Schläfe wurde er trotzdem verletzt. Als Denke seine Absicht vereitelt sah, stürzte er sich auf den Mann. Diesem wäre es trotz seiner bedeutenden Körperkräfte kaum möglich gewesen, sich des Mordbuben zu erwehren. Er rief um Hilfe. Bald erschienen Hausbewohner, die ihn nur mit Mühe aus den Händen Denkes befreien konnten, der sich mit wilder Verbissenheit an ihm festgekrampft hatte. Befragt über die Ursache des Kampfes, gab Denke keine Auskunft. Er saß mit gerötetem, verzerrtem Gesicht und stierem Blick da, knirschte mit den Zähnen und wurde ab und zu von Zuckungen, die über den ganzen Körper liefen, geschüttelt.
Bei dem Handwerksburschen war an der rechten Schläfe eine etwa acht Zentimeter lange bis zwei Zentimeter breite, horizontal von vorn nach hinten zielende Blutunterlaufung festzustellen, deren Form der Spitze des später zu beschreibenden Mordinstrumentes entspricht. Der Aufforderung, den Vorfall der Polizei zu melden, wollte der Mann zunächst nicht nachkommen. Er wollte sich, da er scheinbar kein reines Gewissen hatte, unerkannt drücken. Auf wiederholtes Drängen gab er schließlich nach. Er wurde zunächst festgenommen, da seine Angaben nicht sehr glaubwürdig erschienen, zumal Denke den besten Ruf in der Stadt genoss. Auf seine wiederholten Beteuerungen hin wurde schließlich auch dieser verhaftet.
Darüber regte sich der Unwille bei zahlreichen Bürgern, die es unerklärlich fanden, dass die Polizei auf die Aussagen eines Landstreichers hin einen ruhigen Bürger festsetzen konnte. In der Zelle beging Denke Selbstmord, indem er sich mit einem Taschentuch etwa einen halben Meter über dem Erdboden an den Ringen, die zur Fesselung bestimmt waren, eine offene Schlinge machte und sich in liegender Stellung erhängte. Um festzustellen, ob genügend Geld für die Beerdigung vorhanden war, wurde, da die Angehörigen die Übernahme der Kosten für diese ablehnten, am übernächsten Tage eine Hausdurchsuchung zur Feststellung des Nachlasses abgehalten, die dann Teile von Menschen usw. zutage brachte.
Erwähnen möchte ich hier Beobachtungen, die nachträglich bekannt geworden sind und die zur Entdeckung des Treibens des Denke hätten führen müssen. Schon vor etwa zwei Jahren kam eines Tages ein Handwerksbursche blutüberströmt aus der Wohnung und lief, ohne sich aufzuhalten, fort. Einige Zeit später beklagte sich ein Landstreicher bei Bewohnern des gegenüberliegenden Hauses darüber, dass Denke ihn zum Schreiben eines Briefes aufgefordert hatte und, als er sich niedersetzte und dies tun wollte, ihm plötzlich eine Kette um den Hals warf und ihn zu erdrosseln versuchte. Da seine Körperkräfte aber größer waren, gelang es ihm zu entkommen. Vor eineinhalb Jahren war den Bewohnern ein besonders penetranter Geruch, der aus Denkes Wohnung kam, aufgefallen. Die über dem Zimmer Wohnende beklagte sich deshalb bei den anderen Mitbewohnern darüber. Denke wurde gestellt, worauf die Belästigung aufhörte. Weiter wird nachträglich bekannt, dass er stets, auch in der schwersten Zeit der Inflation, über massenhaft Fleisch verfügte. Er trug dieses in einem Topf unbedeckt aus dem Stall über den Hof in das Zimmer. Da die Mitbewohner annahmen, dass es sich um Hundefleisch handele – sie wollten einmal vor der Wohnung ein Hundefell bemerkt haben –, schenkten sie dem Vorgang keine Beachtung. Dass das Schwarzschlachten von Hunden verboten war, berührte sie ebenso wenig wie die Frage, woher Denke Hunde in so großer Zahl haben sollte. Auch fiel es damals nicht auf, dass er sehr häufig Eimer mit blutigem Wasser oder mit Blut in den Hof schüttete, dass häufig nächtelang in seinem Zimmer gehämmert und gesägt wurde. Man nahm an, er arbeite an Schüsseln, die er herstellte und verkaufte.
Nachträglich wird es als merkwürdig angegeben, dass er nachts oder abends mit einem Paket fortging und erst spät in der Nacht ohne dieses wiederkam, öfter auch mehrmals nachts seine Wohnung verließ. Alte Kleider und Schuhe soll er zum Kauf angeboten haben und diese auch in seinem Garten verbrannt haben. Hin und wieder hier gefundene Knochen hielt man für solche von Tieren.
Die ersten Funde, die bei der Hausdurchsuchung gemacht wurden, waren Knochen und Fleischstücke. Letztere lagen in einem Holzschaff in einer Salzlösung [um sie haltbar zu machen]. Es waren 15 Stücke mit Haut. Zwei Teile sind von der Brust, die stark behaart ist. Der Schnitt liegt in der Mittellinie und geht bis drei Finger oberhalb des Nabels. Die seitliche Begrenzung ist die vordere Achsellinie. In dem Stück der vorderen Bauchwand ist in der Mitte der Nabel zu sehen. Die übrigen Teile gehören den seitlichen Partien und dem Rücken an. Das größte ist etwa 40 mal 20 Zentimeter groß. Besonders auffallend war, dass die Afteröffnung sehr sauber mit doppelt handbreiten Teilen von beiden Gesäßhälften präpariert war.
Das Fleisch ist braunrot und macht nicht den Eindruck, als wenn der Körper vorher viel Blut verloren hätte. Auf den Teilen des Rückens sind zart bläuliche Verfärbungen sichtbar, die für Totenflecke angesprochen werden und den Schluss zulassen, dass die Zerlegung des Körpers erst einige Stunden nach dem Tode vorgenommen wurde.
An den Schnittflächen ist keine Stelle vorhanden, die als vitale Reaktion aufgefasst werden kann, also als Beweis dafür angesehen werden konnte, dass dieser oder jener Schnitt zu Lebzeiten gemacht wurde. Doch fanden sich Haut- und Muskelpartien des Halses nicht unter den vorhandenen Fleischstücken, ebenso wenig wie auch Extremitäten, Kopf und Geschlechtsteile fehlten. Veränderungen im Gewebe oder Verletzungen, die auf die Art des Todes oder des einwirkenden Werkzeuges irgendwelche Schlüsse erlaubten, waren nicht festzustellen.
In drei mittelgroßen Töpfen fand sich in einer Sauce, die das Aussehen von Sahnesauce hatte, gekochtes Fleisch, zum Teil mit Haut bedeckt, an welcher menschliche Haare nachgewiesen werden konnten. Innen war das Fleisch zart rosa. Die Stücke schienen aus der Gluteal-Gegend [Gesäßbereich; M. B.] geschnitten. In einem Topf war nur noch die halbe Portion vorhanden. Den übrigen Teil soll Denke kurz vorher gegessen haben.
Ich möchte hier erwähnen, dass keinerlei Anhaltspunkte vorhanden sind, die darauf schließen lassen, dass er das Fleisch seiner Opfer verkauft hat. [Man vermutete, dass Haarmann dies getan hatte, konnte es aber nicht beweisen, da das von ihm verkaufte Fleisch schon verbraucht war; M. B.] Dagegen scheint es sicher zu sein, dass er es seinen Gästen, das heißt den Landstreichern, zum Essen vorgesetzt hat. Im dritten Topf lagen in einer gallertartigen Masse zahlreiche Hautstücke von Menschen und Teile der großen Körperschlagader.
In einer Schüssel auf dem Tisch seines Zimmers stand Fett von Bernsteinfarbe, das große Ähnlichkeit mit Menschenfett hatte. Der biologische Nachweis ergab ein schwach-positives Resultat für das Vorhandensein menschlichen Eiweißes.
Im Stalle, in welchem die Fleischstücke gefunden worden waren, lagen in einem Fasse massenhaft Knochen, die sauber von Sehnen, Muskeln und so weiter befreit waren und mit hoher Wahrscheinlichkeit vorher gekocht worden sind. Die Untersuchung dieser uns zunächst übersandten Knochen ließ an dem Vorhandensein von sechs oberen Teilen der Elle feststellen, dass sie wenigstens drei Menschen angehören. Außerdem wurden noch massenhaft Hand- und Fußwurzelknochen an dieser Stelle gefunden. Ein weiterer Fund wurde hinter dem Schuppen gemacht. In dem Tümpel, der vor Jahren von Denke gegraben worden war, lag ein Unterschenkelteil, im Stadtwald freiliegend zahlreiche andere Skelettstücke. Uns sind im Ganzen übersandt worden: 16 untere Oberschenkelteile, von denen ein Paar auffallend kräftig, zwei Paare sehr schmächtig waren, sechs Paare und zwei linke obere Oberschenkelteile, 15 mittlere Stücke der langen Röhrenknochen, vier Paare obere Ellenteile, sieben Speichenköpfe, neun untere Teile der Speiche, acht untere Teile der Elle, ein Paar obere Schienbeinenden, ein Paar untere Ellen- und Speichenenden, die noch zusammenhingen und stark verschimmelt waren, ein Paar untere Oberarmteile, ein Paar Oberarmköpfe, ein Paar Schlüsselbeine, zwei Schulterblätter, acht Fersen- und Sprungbeine, 120 Zehen- und Fingerglieder, 65 Mittelfuß- und Mittelhandknochen, fünf erste Rippen und 150 Teile von Rippen. Alle Knochen, mit Ausnahme von einigen wenigen, waren sehr leicht, porös und fettlos.
Im Stadtwald wurden außerdem noch Teile einer Wirbelsäule wie vier Teile eines sauber präparierten männlichen Beckens, die an einer Seite eine deutliche Sägefläche zeigten, gefunden. Von Kopfknochen ist nur ein einziger Teil festgestellt. Es ist dies ein Stück der linken Felsenbeingegend, das an der vorderen Seite zackig, wie gebrochen, aussieht und am oberen Ende eine scharfe Sägefläche zeigt, die etwa in der Gegend liegt, an welcher der bei Sektionen gemachte Schnitt sich findet. An diesem Knochenstück fällt ein mit Tinte gezeichnetes Kreuz auf.
Nach den Größenverhältnissen der Knochen kann gesagt werden, dass ein Individuum besonders kräftig, zwei von schmächtigem Knochenbau waren, ein anderes litt an einer Coxa vara [Hüftfehlstellung; M. B.]. Über die Zeit, die nach dem Tode verflossen ist, lässt sich unter Berücksichtigung, dass die meisten Knochen wohl vorher gekocht worden sind, Näheres nur über die Knochen, die im Stadtwald gefunden worden sind, sagen. Unter Beachtung der Temperatur und der Witterung haben wir angenommen, dass etwa ein bis zwei Monate seit dem Tode verstrichen sind, was auch dem Alter der oben erwähnten Fleischstücke entsprechen könnte, bei aller Vorsicht unter Berücksichtigung der fehlenden Erfahrung des Alters eingepökelten Menschenfleisches.
Die Trennungsflächen an den Knochen sind zackig, wie durch stumpfe Gewalt, etwa das stumpfe Ende einer Axt oder eines Hammers, gebrochen, zum Teil sind deutliche Sägeflächen vorhanden. An einzelnen Stellen sind auch Spuren eines scharfen Werkzeuges, mit hoher Wahrscheinlichkeit solche einer Axt, festzustellen. Ebenso finden sich solche Spuren in den Gelenkflächen, die wahrscheinlich von einem Messer herrühren.
Aufgrund der erhobenen Befunde konnten wir erklären, dass die uns übersandten Knochen wenigstens acht Menschen angehörten.
Wesentlich mehr sagte uns die Zahnsammlung Denkes. Uns sind im Ganzen 351 Zähne übersandt worden. Diese fanden sich in einer Geldtasche, in zwei Blechschachteln, auf denen »Pfeffer« und »Salz« geschrieben stand, in drei Papierbeuteln, die für Pfeffer bestimmt waren. Sie sind zum Teil nach ihrer Größe geordnet. So waren die Backenzähne in der Geldtasche, die übrigen, nach ihrem guten bzw. schlechteren Zustande, in den beiden Schachteln und in einem Papierbeutel. In einem anderen Papierbeutel waren Zähne, die nach ihrem Aussehen mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Menschen angehören, in einem dritten schließlich fanden sich drei untere Schneidezähne, die stark atrophisch [verkümmert; M. B.] sind und wohl von einem alten Individuum stammen. Alle Zähne, mit Ausnahme von sechs, waren gut erhalten.
Die Untersuchung hat der Direktor des hiesigen zahnärztlichen Instituts, Herr Professor Dr. Euler, vorgenommen, der mir in liebenswürdiger Weise sein Gutachten wie die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Die Fragen, die aufgrund der Befunde an den Zähnen beantwortet werden sollten, waren: nach der Zahl der Opfer, nach Alter, Geschlecht und Beruf der betreffenden Individuen, nach der Art der Entfernung der Zähne und der Zeit, die nach der Extraktion verflossen ist.
Die Untersuchungen haben uns sehr beachtenswerte Resultate geliefert. Nach den Knochen, bzw. den Resten von solchen, waren mit Bestimmtheit wenigstens acht Opfer anzunehmen, wenn es auch nach den sonstigen Umständen des Falls wahrscheinlich war, dass die Zahl eine wesentlich größere ist. Die Befunde an den Zähnen ließen mit Sicherheit auf wenigstens 20 Menschen schließen, da 20 linke, untere Eckzähne vorhanden sind …
Die Tatsache, dass die Opfer größtenteils an Erkrankungen des Parodontiums [Zahnhaltegewebe; M. B.] gelitten haben, die eben erwähnten Zähne aber durch diese Krankheiten besonders gefährdet sind, unterstützt noch die Annahme einer wesentlich größeren Zahl von Opfern. Dafür spricht auch weiter das Fehlen jeder festgestellten Zahnbehandlung wie die Berechtigung, bei den Personen ein hohes Alter anzunehmen. Bei vorsichtiger Schätzung glaubt Professor Euler, dass sie wenigstens 25 Individuen angehörten.
Die Gewinnung geschah auf verschiedene Weise. Zum Teil waren die Zähne durch senile Atrophie [Rückbildung; M. B.] und durch Erkrankung gelockert, bei den fester sitzenden wurde Gewalt angewandt. An vielen haften noch Teile der Alveolarwand [Kieferbereich, in dem die Zähne sitzen; M. B.] an. Einzelne zeigen charakteristische Schmelzfrakturen [Brüche im Zahnschmelz; M. B.], besonders die Molaren [Mahlzähne; M. B.] und Prämolaren [Backenzähne; M. B.], die zu Lebzeiten nicht schon bestanden haben konnten. An manchen fanden sich Spuren einer angelegten Zange mit sehr scharfen Rändern. Das Aussehen mancher Wurzeln scheint die Vermutung zu rechtfertigen, dass der Kiefer vorher gekocht worden ist. Einzelne Zähne, die wahrscheinlich bei der Extraktion zerbrochen worden sind, hat Denke mit Pech wieder zusammengeklebt.
Besonders interessant ist die Beantwortung der Frage nach dem Alter. Aus der später zu erwähnenden Liste [s. S. 317; M. B.] sind wir darüber bei fast allen Opfern orientiert. Jugendliche Individuen sind nicht darunter. Nun wurde bei vier Weisheitszähnen, die einwandfrei von demselben Menschen stammten, festgestellt, dass diese Eigentümlichkeiten hätten, wie wir sie bei den Zähnen von etwa 15-jährigen Individuen finden. Die Untersuchung der anderen Zähne ergab, dass mindestens vier Fünftel der Besitzer in höherem Alter standen. Professor Euler erklärt zusammenfassend, dass sich unter den Opfern mit Bestimmtheit eine Person befand, die nicht älter als 16 Jahre war, dass die meisten erheblich älter als 40 Jahre waren, zwei vermutlich zwischen 20 und 30 und eine zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr stand.
Die Versuche, das Geschlecht der Personen zu bestimmen, ergaben keine befriedigenden Resultate, ebenso wenig waren bestimmte Anhaltspunkte für den Beruf dieses oder jenes Zahnträgers vorhanden. – Aus nahe liegenden Gründen konnte auch nichts Bestimmtes über die Zeit gesagt werden, die nach dem Tode verflossen ist. Sicher ist nur, dass einige Zähne schon vor Jahren extrahiert worden sind. Das Herausreißen der Zähne der jugendlichen Personen liegt eine größere Zahl von Wochen zurück.
Jedenfalls hat die Begutachtung der Zähne, was Zahl und Alter der Opfer anbelangt, wesentlich mehr gebracht, als aus den Knochen allein geschlossen werden konnte, wobei allerdings berücksichtigt werden muss, dass von diesen nur verhältnismäßig wenige und diese auch nur teilweise vorhanden sind. Dass aber nur ein Wissenschaftler und Fachmann zu diesen Resultaten kommen konnte, wird Ihnen noch verständlicher, wenn Sie die in der Originalarbeit ausführlich gebrachten Untersuchungsmethoden, auf die ich hier nicht eingehen konnte, lesen werden.
Von Hosenträgern Denkes hat man drei Paare aus Menschenhaut gefunden. Sie sind etwa sechs Zentimeter breit und 70 Zentimeter lang. Die Haut ist nicht geschmeidig und an einzelnen Stellen gebrochen, sie scheint also nicht gegerbt, sondern lediglich vom Unterhautgewebe befreit und getrocknet worden zu sein. An einem Teil ist deutlich zu sehen, dass er über beide Brustwarzen, die gut sichtbar sind, geschnitten worden ist. Vier sind geflickt, und zwar, wie festzustellen war, mit Menschenhaut aus der Schamgegend. Die hier vorhandenen Haare entsprechen nach dem Aussehen wie den Maßen den dieser Gegend angehörenden. Mikroskopisch waren an einigen von ihnen Nissen von Filzläusen zu erkennen. Alle Paare zeigen Spuren des Gebrauches, eines von ihnen trug Denke bei seinem Tode.
Außer Hosenträgern hat Denke auch Riemen aus Menschenhaut geschnitten, diese als Schuhriemen benutzt und zum Teil dazu gebraucht, zahlreiche Wäschestücke und Lumpen zusammenzubinden. An vielen dieser Schnüre sind Menschenhaare vorhanden, so an einer ein Zentimeter langen, grauweißen, die nach den Untersuchungen für Kopfhaare angesprochen werden. Aus welcher Gegend die übrigen Stücke geschnitten sind, lässt sich nicht sagen.
Neben verschiedenen alten Kleidern, die in der Wohnung lagen, fanden sich im Bett auch 41 große und kleine Bündel von Lumpen, die durch die erwähnten Riemen zusammengehalten wurden. Die Untersuchung ließ in einem Gebund völlig wertlose Reste eines alten, abgenutzten Läufers erkennen, im anderen solche eines Fenstervorhanges. Bei den übrigen war irgendeine Zugehörigkeit zu einem Kleidungsstück oder Gebrauchsgegenstand nach der Form nicht festzustellen. Es waren zum größten Teil einzelne Reste aus Leinwand, Wolle oder Baumwolle. Beachtenswert erscheint, dass ganz wertlose Lumpenstückchen von drei mal fünf Zentimeter Größe sorgfältigst aufgehoben und gebündelt waren. An den meisten war deutlich festzustellen, dass sie vorher auseinander getrennt und gewaschen worden waren. Viele zeigten die Eigentümlichkeit, dass ihr Rand sauber umgeschlagen und so geplättet bzw. fest angepresst worden ist. In einem größeren Bündel fanden sich zum Beispiel 20 dieser kleinen einzelnen Stückchen, die alle von demselben Stoff waren und an den Rändern umgeschlagen waren. Dass sie etwa dazu benutzt worden sind, ein schadhaftes Kleidungsstück – in diesem Falle dürfte es sich um ein Hemd gehandelt haben – auszubessern, erscheint bei ihrer Menge sehr unwahrscheinlich. Der Gedanke liegt nahe, dass es sich bei dem Sammeln und der Art des Aufhebens dieser völlig nutzlosen Stoffreste um eine Spielerei handelt.
Ebenso eigenartig ist die Münzensammlung Denkes. Diese besteht aus runden, platten, ungebrannten Tonstücken von der Größe eines Pfennigs bis zu der eines Fünfzig-Pfennig-Stückes, welche auf einer Seite die Zahlen der Geldstücke von einem bis 50 Pfennig eingekratzt zeigen.
Unter einer großen Zahl von Ausweispapieren und Privatpapieren verschiedener Personen wurden im Zimmer Denkes Kontobücher über Einnahmen aus dem Garten, über Arbeitsstunden und so weiter, die verhältnismäßig sauber geführt waren, gefunden. Mehr Beachtung aber verdienten einige lose Blätter, auf denen 30 Namen von Männern und Frauen verzeichnet sind. Vor jedem Namen steht ein Datum, das wohl den Todestag der betreffenden Person angeben soll. Bei Nr. 31 ist nur dieses vermerkt. Die Aufzeichnung ist chronologisch geordnet. Eine Nummerierung ist erst von elf ab erfolgt. Bei den Frauen ist nur der Vorname vermerkt, die Notizen bei den Männern sind viel eingehender, gewöhnlich mit Geburtsdatum, Ort und Stand des Betreffenden. Die Annahme, dass diese Liste die Namen der Opfer enthält, ist berechtigt. Einmal spricht dafür, dass Ausweispapiere von Personen in der Wohnung gefunden wurden, die hier aufgeführt sind und deren Aufenthaltsort nicht zu ermitteln war, dann, dass verschiedene Kleidungsstücke von Leuten als solche ihrer Angehörigen identifiziert wurden, die verschwunden sind und deren Namen gleichfalls in der Liste stehen. Nach dem Aussehen der Schriftstücke scheint das Verzeichnis auch nicht an einem Tage angelegt zu sein.
Auf einer Seite finden sich die Anfangsbuchstaben der Namen und dahinter eine Zahl. Diese dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gewicht der betreffenden Personen bezeichnen. Auf einem anderen Zettel ist nämlich neben einem Namen vermerkt: »tot 122, nackend 107, ausgeschlachtet 83«. Diese letzte Zahl findet sich wieder neben dem Namen des Betreffenden in der letzten Tabelle.
Weiter sehen wir hier dreimal je zehn Zahlen untereinander gestellt und addiert. In der ersten Reihe handelt es sich um die Gewichte der letzten zehn, in der mittleren um die vorletzten und in der letzten um die der ersten zehn. In jeder Reihe sind die Zahlen nach der Größe ansteigend geordnet. Unter Nr. 31 sind weder Namen noch nähere Angaben vorhanden, doch dürfte die Zahl ohne nähere Bezeichnung in der Tabelle wohl das Gewicht der betreffenden Person angeben.
Nur bei dem zweiten Namen der Liste, der Emma, fehlt das Gewicht. Wegen Tötung einer Frau mit diesem Vornamen, die zerstückelt in Münsterberg im Jahr 1909 aufgefunden wurde, war ein gewisser T. zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt worden, die er auch abgesessen hat. K. hat jetzt eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, der auch stattgegeben wird. Im Wiederaufnahmeverfahren ist der Mann inzwischen freigesprochen worden.
Von Werkzeugen, die für die Morde und für die Zerstückelungen in Betracht kommen, sind drei Äxte, eine große Holzsäge und eine Baumsäge, eine Spitzhacke und drei Messer beschlagnahmt worden, die uns mit Ausnahme der Äxte und der Baumsäge zur Untersuchung auf Menschenblut überwiesen worden sind. Die Säge ist ein großes Instrument, mit dem, wie die mikroskopische Untersuchung ergab, auch Holz gesägt worden ist. Der Nachweis von Menschenblut gelang. Wir nehmen aber an, dass die sehr glatten Sägeflächen am Becken und am Kopf mit einem anderen Werkzeug, und zwar mit einem viel feineren, ausgeführt sein müssen, wahrscheinlich mit der Baumsäge. An der Spitzhacke, die bei dem letzten Mordversuch gebraucht wurde, konnte ebenfalls Menschenblut nachgewiesen werden. Sie hat eine Länge von 40 Zentimetern und läuft vorn spitz zu. An den Messern vermochten wir nichts Auffallendes festzustellen.
Über die Persönlichkeit des Täters habe ich durch Nachforschung bei Verwandten und Bekannten und aus den Akten Folgendes in Erfahrung bringen können:
Karl Denke ist als dritter Sohn eines kleinen Stellenbesitzers im Jahr 1860 geboren. In der Familie mütterlicherseits und väterlicherseits sind angeblich weder Geisteskrankheiten, Trunksucht, Selbstmorde noch Krämpfe vorgekommen. Sein Vater soll etwas pedantisch gewesen sein. Seine Geschwister sind kleine, ländliche Besitzer bzw. haben solche geheiratet, stehen im hohen Alter und sind gesund.
Über die Geburt war Näheres nicht zu erfahren. Als Kind hat Denke sich sehr schlecht entwickelt, insbesondere lernte er sehr schwer und sehr schlecht sprechen, sodass seine Eltern annahmen, »er werde wohl stumm bleiben«. Erst im sechsten Jahre brachte er einige Worte hervor.
Nach Vollendung des sechsten Lebensjahres kam er zur Schule. Hier gelang es erst nach Wochen, aus ihm einige lang gedehnte, zerrende Laute herauszubringen. Nach den Angaben des Lehrers hat dieser ihn stets für einen Idioten*gehalten. Er war maulfaul und sehr langsam in seinen Bewegungen. Auf Fragen gab er kaum Antwort. Wenn man ihm die Hand zum Gruß hinstreckte, erhob er seine Rechte kaum merklich, sodass man nach unten greifen musste, um sie zu fassen. In den ersten Schuljahren lernte er sehr schlecht und wurde viel bestraft. Später ging das Lernen besser. Seine Schulzeugnisse aus dieser Zeit lauten auf »gut« und »befriedigend«. Über sein Betragen ist vermerkt: »Ist sehr verstockt und nicht zu loben«.