 Sportfachmann/
frau
Sportfachmann/
frau
Dieser Beruf ist ein Beispiel dafür, wie die Gestaltung einer Ausbildung sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert. Ausbildungen wachsen ja nicht auf den Bäumen, sondern sie werden konzipiert, weil Leute mit ganz bestimmten Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt fehlen. In diesem Fall fehlten Leute im Sportbereich, die praktische Trainingserfahrung mitbrachten. Die Sport- und Fitnesskaufleute (siehe unten) hatten damals noch keine sportpraktischen Inhalte in ihrer Ausbildung und wurden dahingehend auch nicht geprüft. Sie waren also am Ende ihrer Ausbildung hervorragende Verwaltungsfachkräfte, die auf einer Trainingsfläche verloren herumstanden, wenn sie nicht während der Ausbildung zusätzlich und in Eigeninitiative Trainerlizenzen erworben hatten. Also wurde der Ruf laut nach einer praktisch orientierten Ausbildung mit weniger Inhalten aus der Verwaltung und der Sportfachmann wurde geschaffen. Der lernt während seiner Ausbildung, alles was man im Training gebrauchen kann und erhält nur ein sehr „abgespecktes“ Paket an Verwaltungsinhalten.
Etwa zur gleichen Zeit erkannte man aber die Unausgewogenheit der Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau und beschloss, mehr praktische Inhalte in den Ausbildungsplan aufzunehmen, sodass die Azubis nun ihre Trainerlizenzen während der Ausbildung erwarben und auch eine praktische Abschlussprüfung zu erwarten hatten. Den Sportfachmann schaffte man deshalb natürtlich nicht wieder ab. So existiert nun beides.
Leider ist durch diese Entwicklung die „Nische“ für die Sportfachkraft relativ eng geworden. Von der einen Seite bekommt sie Konkurrenz durch Trainer, die ihre Lizenzen ohne dreijährige Ausbildung gemacht haben und somit dem Arbeitsmarkt als kompetente Sportler und Pädagogen zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite wird sie durch die Sport- und Fitnesskauffrau bedrängt, die in der Praxis ebenso gut einsetzbar ist und darüber hinaus noch eine breite Zusatzqualifikation mitbringt, mit der sie beispielsweise ein Studio eigenverantwortlich führen kann.
Sie sollten also diesen Beruf nicht „einfach so“ wählen, sondern von vornherein eine Nische im Auge haben, die Sie später ausfüllen möchten – oft gibt es solche eher im Vereins- und Leistungssport als im Fitnesstudio um die Ecke.
WAS? Sportfachleute haben im Allgemeinen drei große Aufgabengebiete: Verwaltung, Organisation und Training.
In der Verwaltung erledigen sie den Schriftverkehr, erstellen Statistiken (zum Beispiel über die Auslastung der Sportstätte zu verschiedenen Tageszeiten), halten den Kontakt zu Lieferanten oder anderen Dienstleistern und holen Angebote ein, wenn etwas repariert werden muss. Tiefer einsteigen werden sie aber hier nicht, weil ihnen dazu der kaufmännische Hintergrund fehlt.
Organisatorische Aufgaben fallen an, wenn beispielsweise Wettkämpfe ausgetragen werden. Auch Werbemaßnahmen fallen in diesen Bereich: Ein „Schnuppertag“, von dem niemand etwas weiß, wird ins Wasser fallen. Wie bringt man also die Information breitenwirksam unter die Leute? Oder: Was macht die Konkurrenz? Gibt es innerhalb der Sportart neue Strömungen, die man nutzen sollte, am besten, ehe alle anderen es auch tun? Was kann man tun, wenn die Statistik zeigt, dass die Mitgliederzahlen rückläufig sind? Die Sauna heizt nicht, der Wasserhahn tropft, der Rasen auf dem Gelände müsste dringend gemäht werden? Als Sportfachfrau müssen Sie nicht zwangsläufig selbst Hand anlegen. Sie müssen aber wissen, wo Sie anrufen, um das Problem beheben zu lassen.
Im Bereich Training überschneiden sich die Aufgaben einer Sportfachfrau mit denen einer Trainerin. Sie berät die Sportler hinsichtlich Training und Ernährung, leitet Übungen an, ist auf dem Platz oder der Trainingsfläche präsent und steht für Fragen zur Verfügung. Auch das Leiten von Kursen fällt in dieses Aufgabengebiet. Zu diesem Zweck erwerben Sportfachleute als Teil der Ausbildung auch entsprechende Trainerlizenzen. Die Gewinnung von Neukunden ist ein wichtiges Feld: Probetrainings und Beratungstermine sollen so gestaltet sein, dass aus einem interessierten Neuling ein begeistertes Mitglied wird.
WO? Sportfachleute werden für den Einsatz in Vereinen und in der Organisation von Leistungs- und Spitzensport ausgebildet. Auch Betreiber großer Sportanlagen kommen als Arbeitgeber in Frage: Golfplätze, Kletterhallen, Schwimm- und Freizeitbäder, Hotelanlagen mit sportlichem Schwerpunkt oder große Sportstadien. Auch in Reha-Einrichtungen arbeiten Sportfachleute – hier in einem Team zusammen mit Ärzten, Physiotherapeuten und Pflegepersonal.
WER? In diesem Beruf sind kommunikative Bewerber gefragt. Wichtiger als eine sportliche Spitzenleistung sind ein freundliches Auftreten, Teamgeist und ein mitreißendes Temperament, durch das andere Menschen sich begeistern lassen. Die Orientierung am Kunden ist oberstes Gebot. Gute Sportfachleute können freundlich und offen auf Menschen zugehen und die Bedürfnisse ihres Gegenübers schnell erfassen. Sie sind geduldig, auch wenn ihnen nicht überall die gleiche Freundlichkeit begegnet. Sie können motivieren und ein „gutes Gefühl“ verbreiten – denn was ihr Arbeitsplatz ist, ist gleichzeitig der Freizeitort der Kunden.
Für die Aufgaben in der Verwaltung sind Lernbereitschaft und genaues Arbeiten gefragt. Auch wenn die kaufmännischen Inhalte nicht in der größtmöglichen Vertiefung, sondern eher in der Breite vermittelt werden, sollten Sie Spaß an diesem Teil des Berufes haben, denn Sie werden einen Teil Ihrer späteren Arbeitszeit damit verbringen. Um einen Ausbildungsplatz zu finden, ist ein mittlerer Bildungsabschluss (Real- oder Wirtschaftsschule oder vergleichbar) sinnvoll.
WIE? Zur Sportfachfrau führt eine klassische duale Ausbildung, die drei Jahre dauert. Sie pendeln zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule: Im Betrieb werden Sie in die täglichen Abläufe eingewiesen und im Umgang mit den Kunden geschult. In der Berufsschule vermittelt man Ihnen den kaufmännischen Hintergrund.
 TIPP
TIPP
http://www.netzeitung.de/arbeitundberuf/717090.html
http://www.bewerbung-forum.de/sportfachmann/sportfachmann-ausbildung.html
http://www.planet-beruf.de/Job-inside-Sportfac.10270.0.html
http://www.kischuni.de/ausbildung/Wie-werde-ich-Sportfachmann-41.html
 Sport- und Fitnesskaufmann/ frau
Sport- und Fitnesskaufmann/ frau
Wenn Sie weiter oben den Artikel zur Sportfachfrau gelesen haben, werden Sie feststellen, dass dieser Beruf von den Rahmenbedingungen her relativ ähnlich ist. Hier tritt allerdings der kaufmännische Charakter noch stärker in den Vordergrund.
WAS? Sport- und Fitnesskaufleute sind diejenigen, die einen Fitnessbetrieb wirtschaftlich am Laufen halten. Sie werden in allen Bereichen der Organisation eingesetzt. In der Verwaltung kümmern sie sich um Lohnabrechnung und Faktura, um Personaleinsatzplanung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Falls nötig, suchen sie neue Mitarbeiter für den Betrieb und stellen diese ein. Sie kümmern sich auch darum, dass auf der Trainingsfläche alle Sicherheitsnormen eingehalten werden.
Auch für das Marketing sind Sport- und Fitnesskaufleute zuständig. Sie tüfteln an Werbestrategien und Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Wenn es, wie bei Fitness-Ketten üblich, eine Marketing-Abteilung in einer Hauptniederlaassung gibt, die die Werbung für alle Filialen konzipiert, arbeiten sie mit dieser zusammen und setzen die Werbemaßnahmen vor Ort um.
Nicht zuletzt sind Sport- und Fitnesskaufleute für die Kunden da. Sie übernehmen „Thekendienst“ und Arbeiten am Empfang, beraten Neukunden und betreuen die Sportler. Das Erstellen von Trainingsplänen gehört manchmal zu ihren Aufgaben – oft übernimmt das aber auch ein Fitness-Trainer.
Die sportpraktische Komponente war bis vor einigen Jahren im Ausbildungsplan nicht vertreten. Man konnte also auch als einigermaßen dynamische Couchkartoffel diesen Beruf erlernen. Von den Arbeitgebern wurde das allgemein als Mangel beklagt, weshalb sich zunächst der ähnliche Beruf „Sportfachmann/ frau“ entwickelte. Hier sind Trainerlizenzen im Ausbildungsumfang enthalten. Mittlerweile wurde aber auch der Ausbildungsplan zur Sport- und Fitnessfachfrau entsprechend abgeändert: Kaufmännische Inhalte wurden zugunsten einer sportpraktischen Ausbildung gekürzt.
Damit sind die beiden Berufe noch näher aneinander gerückt. Die Sport- und Fitnessfachfrau hat allerdings immer noch leicht die Nase vorn, wenn es um vertiefte kaufmännische Inhalte geht.
WO? Sport- und Fitnesskaufleute werden überall eingesetzt, wo Sport und Verwaltung zusammentreffen. Das können Fitness-Studios sein, aber auch Sportvereine oder Betreiber von Schwimmbädern, Golfanlagen, Indoor-Kletterhallen, Sommer-Rodelbahnen oder Sportstadien. Manche finden ihre Aufgabe auch in der Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
WER? Natürlich sollten Sie Sport in all seinen Ausprägungen mögen. Sie müssen aber kein Leistungssportler sein, um sich in diesem Beruf wohl zu fühlen.
Denn Sie sind vor allem eine Verwaltungsfachkraft. Genaues Arbeiten sollte Ihnen liegen, ebenso Organisation und das gelegentliche Jonglieren mit Zahlen. Sie verbringen viel Zeit am Computer und am Telefon.
Die meisten Arbeitgeber wünschen sich neben gewissenhaftem und planvollem Arbeiten auch ein echtes Kommunikationstalent. Sowohl für die internen Abläufe als auch für die Kundenkontakte ist es wichtig, dass Sie aus sich herausgehen können, gut mit Menschen umgehen und auch freundlich bleiben, wenn Ihnen jemand mal muffelig kommt.
Bezüglich Ihrer Arbeitszeiten sollten Sie flexibel sein, denn die richten sich auch nach den Öffnungszeiten Ihres Ausbildungsbetriebes. Arbeiten am Abend und am Wochenende sind keine Seltenheit – eben immer dann, wenn andere frei haben, um Sport zu treiben.
WIE? Zu diesem Beruf führt eine klassische duale Ausbildung, wie man sie aus anderen kaufmännischen Bereichen kennt. Sie haben einen Ausbildungsbetrieb, in dem Sie die täglichen Abläufe kennen lernen und besuchen regelmäßig die Berufsschule, an der Ihnen die fachlichen Hintergründe vermittelt werden: Buchführung, Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Marketing und Marktanalyse.
Besonders im dritten Ausbildungsjahr steigen Sie richtig tief in die wirtschaftlichen Inhalte ein und erhalten fundiertes Wissen in Lohn- und Finanzbuchhaltung, Controlling und Personalwesen. Gleichzeitig erwerben Sie die für Ihr Arbeitsgebiet sinnvollen Trainerlizenzen.
Um die Ausbildung erfolgreich zu bewältigen, ist ein mittlerer Schulabschluss nicht Pflicht, aber zu empfehlen.
http://www.planet-beruf.de/Kurzfilm-Sport-und.2108.0.html
http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Sport-u.13443.0.html?&type=20
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/ich-machs/im-sport-fitnesskaufmann100.html
Interview mit einer Sport- und Fitnesskauffrau:
Die Autorin Susanne Pavlovic im Gespräch mit Anja Häusler
Warum hast Du dir gerade diesen Beruf ausgesucht?
Mein bisheriger Beruf war eine Sackgasse und hat mich nicht zufrieden gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich beruflich noch nicht am Ziel bin. Als ich dann arbeitslos wurde, habe ich beschlossen, mich ganz neu zu orientieren – in eine Richtung, die mich wirklich begeistert.
Ich bin ein extrem kommunikativer Mensch. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich bin sehr sportlich, habe auch schon verschiedene Trainerlizenzen. Da war meine Berufswahl eine klare Sache.
Dass ich auch ein echter Sturkopf bin und Dinge, die ich mir vorgenommen habe, auch in jedem Fall durchziehe, hat mir geholfen. Die Ausbildung in ihrer verkürzten Form hat mich echt an meine Grenzen gebracht.
Wie lief deine Ausbildung?
Ich habe eine Umschulung über die Arbeitsagentur gemacht. Die lief wie eine klassische duale Ausbildung, nur verkürzt auf zwei Jahre, allerdings mit dem gleichen Stoffumfang wie die dreijährige Ausbildung. Man kann sich vorstellen, was das für ein riesiger Stress war – ich habe ja noch eine Familie, um die ich mich „nebenbei“ kümmern musste. Ohne die Mithilfe meiner Mutter und meiner Schwestern wäre das gar nicht möglich gewesen. Bevor ich die Umschulung bewilligt bekam, musste ich einen Eignungstest machen. Die Arbeitsagentur will auf diese Weise ungeeignete Bewerber aussortieren, denn so eine Umschulung kostet das Amt ja richtig Geld. Der Test war wirklich nicht ohne, aber ich habe ihn zum Glück gut bestanden.
Die Ausbildung in ihrer jetzigen Form existiert ja erst seit 2002. Wo siehst du die Perspektiven im Beruf?
Ich denke, Prävention wird immer wichtiger. Zum einen, weil wir immer mehr Menschen mit Beeinträchtigung haben: Übergewicht, Diabetes, Gelenkprobleme, Bandscheibenprobleme. Zum anderen aber auch, weil die Leistungen der Krankenkassen immer weiter zurückgeschraubt werden und die Leute stärker selbst in der Verantwortung sind, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Deshalb ist das Studio, in dem ich arbeite, auch nicht rein sportlich ausgerichtet, sondern bietet auch viele Maßnahmen zur Rehabilitation an. Wir arbeiten mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammen. Patienten, die ihre Reha abgeschlossen haben, kommen zu uns und trainieren weiter, um ihre neu gewonnene Gesundheit zu festigen. Und weil wir einen super Service bieten, werden sie zu Stammkunden und empfehlen uns im Freundeskreis weiter. Wir haben derzeit mehr Anfragen, als wir Kunden aufnehmen können.
Wie sieht denn dein Alltag aus?
Die Berufsbezeichnung verrät es ja schon. Ich habe viel mit Sport und Sportlern zu tun, aber auch ebenso viel mit kaufmännischen Inhalten. Das darf man nicht unterschätzen: Die Ausbildung führt zu einem vollwertigen kaufmännischen Beruf, wie man ihn auch in der Industrie oder im Einzelhandel findet. Wenn man nicht fit in Rechnungswesen ist, wird man es echt schwer haben. Auch die Buchhaltung verschlingt einen großen Teil der Zeit.
Mehr Spaß macht mir der Kontakt mit den Kunden. Sich einfach mal Zeit nehmen, ein bisschen plaudern, den persönlichen Kontakt stärken – so mache ich aus einem Kunden einen Stammkunden.
Wir haben auch viele Senioren, die wir neben dem persönlichen Kontakt natürlich auch kompetent beraten und denen wir zeigen, wie sie ihre Gesundheit unterstützen können. Vor einiger Zeit habe ich einen Mann beraten, der 73 Jahre alt war und einen Arm amputiert hatte. Auch für ihn haben wir ein Trainingsprogramm ausgearbeitet, das er einarmig bewältigen konnte und das ihm gut tat. Das sind meine Erfolgserlebnisse.
Was würdest du jungen Leuten raten, die sich für den Beruf interessieren?
Sie sollten unbedingt zuerst ein Praktikum machen, am besten in dem Betrieb, in den sie gerne als Azubi gehen würden. Man muss den Betrieben gut auf den Zahn fühlen – leider benutzen viele immer noch ihre Azubis als billige Thekenkraft. Da lernt der Azubi nichts, wird vom Betrieb nicht übernommen und hat auf dem Arbeitsmarkt schlechte Chancen, weil ihm Wissen und Berufspraxis fehlen. Hier ist also sorgfältige Prüfung gefragt.
Am besten sucht man sich für den Anfang ein Studio, das ein breites Angebot hat, um in möglichst viele Bereiche hineinschnuppern zu können. Ist ja klar: Ein Studio, das nur einen Maschinenpark hat und sonst nichts, kann einfach nicht auf so breiter Basis ausbilden wie ein Studio mit Kraft- und Ausdauergeräten, verschiedenen Kursen, physiotherapeutischem Begleitprogramm, Sauna und so weiter. Außerdem sollten die Jungs und Mädels sehen, wie der Beruf wirklich ist, und sich von ihren falschen Vorstellungen verabschieden.
Welche sind das?
Na ja, viele glauben, wir stehen den ganzen Tag nur auf der Trainingsfläche herum, passen ein bisschen auf, plaudern ein bisschen und das war‘s. In der Realität werden wir in allen Abläufen eingesetzt: Büro, Organisation, Trainingsfläche, Theke, Kinderbetreuung, und wenn es irgendwo nicht sauber ist, muss man auch mal den Putzlappen schwingen. Und natürlich arbeiten wir auch am Abend und an den Wochenenden. Üblich ist ein rotierendes Schichtsystem, sodass jeder mal die Randzeiten abdecken muss. Und das alles zu einem nicht gerade üppigen Gehalt, zumindest in der Festanstellung.
Das heißt...?
Wenn man eine Festanstellung hat, was übrigens lange nicht alle Sportund Fitnesskaufleute haben, sollte man die finanziell eher als Basis betrachten. Als Grundsicherung. Deutlich mehr lässt sich als Freelancer verdienen, also wenn man mit den Studios einzelne Kurse abrechnet. Die meisten, die ich kenne, geben nebenher noch Kurse an der Volkshochschule oder in Vereinen.
Hier steckt wiederum mehr Arbeit dahinter, als man vermutet. Zum einen die Vorbereitung der Kurse. Man muss sich ein sinnvolles Programm überlegen und das dann auch draufhaben. Zum anderen aber fängt die Arbeit schon weit vorher an: Um überhaupt Aufträge zu bekommen, muss ich mich mit Marketing auskennen und die passenden Marketinginstrumente bedienen können. Ich muss Werbung machen, Kontakte knüpfen und natürlich inhaltlich auf dem neuesten Stand bleiben. Auch der Sport ist ja im Wandel. Die Aerobic, wie man sie in den 80er Jahren praktiziert hat, gilt heute schon fast als Körperverletzung.
Unter‘m Strich – würdest Du den Beruf empfehlen?
Ja – wenn es genau das ist, was man will. Der Beruf ist enorm vielseitig. Während der Ausbildung erwirbt man Trainerlizenzen, die einem verschiedene Möglichkeiten eröffnen, durch Kurse Geld zu verdienen. Mit der kaufmännischen Ausbildung könnte man später auch in einen anderen Bereich wechseln, der mit Sport nichts zu tun hat.
Aber die Ausbildung ist hart und ohne ein großes Maß an Eigeninitiative wird man später im Berufsleben nicht weit kommen. Es ist kein Beruf, bei dem man sich zur Ruhe setzen kann und sagen kann, so, das habe ich nun geschafft. Man ist sozusagen lebenslang in Ausbildung.
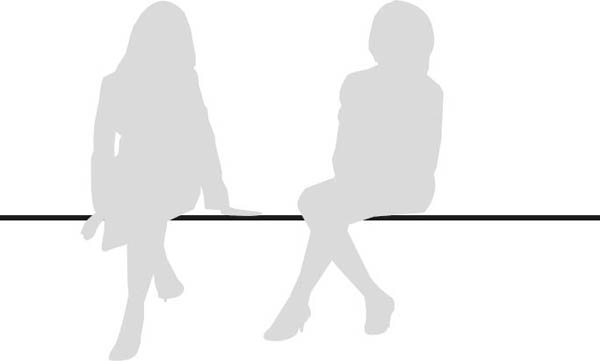
 Sportlehrer/ in im
Schuldienst
Sportlehrer/ in im
Schuldienst
Eines vorweg: Die Berufsbezeichnung „Sportlehrer“ ist mehrdeutig. Sie hat letztlich so viele Bedeutungen, wie es unterschiedliche Sportlehrer gibt. Während Sie im außerschulischen Bereich mit vielen verschiedenen (Trainer-)Qualifikationen Sportunterricht erteilen können, ist zum Unterrichten an öffentlichen Schulen das Staatsexamen zwingend vorgeschrieben. Wenn Sie also Sportlehrerin beispielsweise am Gymnasium werden möchten, führt Ihr Weg Sie an die Universität.
WAS? Zum Thema „Schulsport“ haben wir alle so unsere Erinnerungen – Ihre ziemlich frisch, meine schon etwas verstaubt. Wir haben Völkerball gespielt, sind mit hängender Zunge die Aschenbahn entlang gehetzt, über Böcke und in wenig einladende Sandgruben gehüpft. Wir haben Fußball gespielt und Gymnastikreifen geschwungen. Wir sind an Seilen hinauf geklettert (oder auch nicht). Schulsport – das war immer so eine Sache. Letztlich ist es die Kunst, einer gemischten Gruppe aus Naturtalenten und völlig Unbegabten etwas zu bieten, das allen Spaß macht. Dabei ist es die Situation der unmittelbaren Öffentlichkeit, die schwierig zu handhaben ist: Kassiert jemand in Mathe eine Fünf, kann er/sie die Arbeit einpacken und so tun, als wäre nichts. Strandet jemand mit hochrotem Gesicht auf dem Bock, statt sich elegant darüber hinweg zu schwingen, hat das doch einen ganz anderen Peinlichkeitsgrad.
Sportpädagogen haben es deshalb immer auch mit ängstlichen, unsicheren Schülern zu tun, für die Schulsport einfach die Hölle ist. Sie müssen eine Stimmung erzeugen, die Ängstliche ermutigt und gleichzeitig den Spottdrosseln den Wind aus den Segeln nimmt. Eine pädagogische Höchstleistung, dazu noch in einem Fach, das nicht wie Mathe oder Deutsch zu den vorrückungsrelevanten Kernfächern gehört (obwohl man, unter Umständen, auch wegen Sport sitzenbleiben kann) und deshalb von Schülern gerne mal nicht sonderlich ernst genommen wird.
Im Laufe eines Schuljahres arbeiten Sportpädagogen sich und ihre Klassen durch verschiedene Aspekte des Breitensports: Ballsportarten, Geräteturnen, Schwimmen und Leichtathletik und einige mehr. Je nach Klassenstufe sollen hier Grundfertigkeiten vermittelt werden. Gleichzeitig soll der Schulsport dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich mehr bewegen und in eine bessere körperliche Verfassung gelangen, was ein erklärtes Ziel aller Kultusministerien ist. Dass dafür in der Praxis immer noch viel zu wenig Stunden auf das Fach Sport entfallen, hat andere Gründe, über die ich ein eigenes Buch schreiben könnte (Stichwort: Einsparungen im Bildungswesen).
In höheren Klassenstufen gehört auch das Vorbereiten, Durchführen und Korrigieren von schriftlichen Arbeiten zum Lehreralltag. Hier wird sporttheoretisches Wissen abgefragt, das natürlich vorher vermittelt werden muss. Das, und auch die praktischen Übungen, erfordert ein pädagogisches Konzept, das von der Lehrerin zuvor ausgearbeitet werden muss.
Darüber hinaus fällt ein gewisses Maß an Verwaltungsarbeit an: Notenlisten führen, Beurteilungen schreiben, an Sitzungen und Besprechungen teilnehmen sind Aufgaben, die oftmals als lästig empfunden werden, an denen aber keine Lehrkraft vorbeikommt.
WO? Ihr Arbeitsumfeld im Schulsport sind natürlich in erster Linie öffentliche Schulen – von der Grundschule bis zur Berufsschule. Natürlich können Sie mit dieser Ausbildung auch im außerschulischen Bereich tätig werden, aber Ihr Ziel sollte die Schule sein – sonst lohnt sich die langwierige, aufwendige Ausbildung nicht.
WER? Als Sportlehrerin sollten Sie eine echte Führungskraft sein. Die Trillerpfeife wird nicht alle Ihre Probleme lösen – meistens sind persönlicher Einsatz und Autorität gefragt, damit so eine dreißigköpfige Chaostruppe beherrschbar bleibt.
An der Vermittlung von Bewegungsfreude sollten Sie ebenso viel Spaß haben wie an der Bewegung selbst. Dabei ist ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl nötig. Sportlich sollten Sie ein Allrounder sein, denn Sie werden im Sportunterricht alle möglichen Fachrichtungen abdecken. Überhaupt ist Vielseitigkeit unverzichtbar: Sport studiert sich nicht alleine, sondern nur in Kombination mit einem oder mehreren anderen Fächern, die Sie dann womöglich auch unterrichten. Ob oder ob nicht suchen Sie sich nicht aus. Das hängt vom Bedarf Ihrer Schule ab und kann sich schuljährlich ändern.
Sie sollten also in erster Linie Spaß am Lehrerberuf haben und erst in zweiter Linie am Sport. Gerade als Berufsanfänger brauchen Sie außerdem die Bereitschaft, Ihr Privatleben nach Ihrem Beruf auszurichten. Wenn Ihr Bundesland Ihnen nach bestandener zweiter Lehramtsprüfung eine Stelle anbietet, heißt es „Take it, or leave it“. Ob Sie lieber in Metropol-City oder hinter den sieben Bergen eingesetzt werden wollen, spielt keine Rolle. Das wird planmäßig vom Ministierium entschieden. Späterer Wechsel ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht garantiert.
WIE? Um Sportlehrerin an öffentlichen Schulen zu werden, absolvieren Sie ein Studium an einer Universität. Dabei wird nach dem späteren Einsatzort unterschieden: Sie können Lehramt fürs Gymnasium studieren, für die Grundschule, für die Realschule oder für berufliche Schulen. Die Kombinationsmöglichkeiten von Sport mit anderen Fächern sind unterschiedlich. Während in der Grundschule Sport ein Fach von vielen ist, haben Sie am Gymnasium ein bis maximal zwei weitere Fächer.
Ihre Studienzeit teilt sich zwischen Sport, Ergänzungsfach und den sogenannten Erziehungswissenschaften auf. Letzteres ist ein Fächerblock, in dem Pädagogik, Fachdidkatik, allgemeine Didaktik, Soziologie und noch einige andere enthalten sind. Nach acht Semestern Regelstudienzeit legen Sie das erste Staatsexamen ab. Es schließen sich zwei Referendariate an: Sie sind „Lehrerin in Ausbildung“ mit einem reduzierten Stundenvolumen. An bestimmten Wochentagen besuchen Sie Ihre „Seminarschule“– in Wirklichkeit mehr Seminar als Schule, wo Sie ein intensives Coaching zu allen Fragen rund um den Unterricht erhalten. Das Referendariat schließt mit dem zweiten Staatsexamen ab. Danach sind Sie mit der Ausbildung fertig und können sich um eine Stelle im Schuldienst bewerben.
 TIPP
TIPP
Informationen zur Lehrerausbildung in Ihrem Bundesland können Sie auf den Webseiten der Kultusministerien abrufen.
 Sportmanagement
Sportmanagement
Wie fit sind Sie wirklich?
Vermutlich deutlich fitter als ich – ob das allerdings schon zum Bestehen einer Sporteingangsprüfung ausreicht, sei dahingestellt.
Tatsache ist, dass für die meisten Studiengänge im Bereich Sport nicht nur die Abiturnote stimmen muss. Sie müssen darüber hinaus noch eine Eignungsprüfung bestehen, in der Ihre sportlichen Fähigkeiten getestet werden. Wenn ich mir hier den Anforderungskatalog durchlese, werden Erinnerungen an meinen eigenen Schulsport-Zeiten wach, die ich sorgfältig verdrängt hatte – meine Güte, Hut ab vor jedem von Ihnen, der/die so eine Prüfung bewältigt.
Das Bundesland Bayern hat die Sporteingangsprüfung für alle Hochschulen und alle Studiengänge zentral geregelt. In allen anderen Bundesländern organisiert jede Uni ihre Eingangsprüfung selbst und somit ist Ihre Wunsch-Uni zugleich Ansprechpartner für Ablauf und Anforderungen.
Allen gemeinsam ist, dass Sie in verschiedenen Disziplinen bestimmte Noten erreichen oder Bestzeiten knacken müssen. Schwimmen ist vertreten, ebenso Leichtathletik, Geräteturnen, eine Mannschaftssportart und eine so genannte Rückschlagssportart (also Tennis, Badminton o.ä.). Je beliebter die Uni, desto härter die Auswahlkriterien: Die Unis erlauben sich durch diese Maßnahme, die besten aus vielen guten Sportlern herauszusieben.
WAS? Das Studium „Sportmanagement“ kommt in vielerlei Gestalt daher und heißt mal Sportmanagement, mal Sportökonomie („Spöko“), mal Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Management, mal Medien-, Sport- und Eventmanagement. Gemeinsam ist allen die Verbindung von sportwissenschaftlichen und betriebswissenschaftlichen Inhalten. Der Charakter des Studiums wird durch die Fakultät geprägt, der es zugeordnet ist. Sie können also Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt oder Erweiterungsfach Sport studieren oder Sport mit Erweiterungsfach BWL. Im ersten Fall haben Sie eher nicht mit einer Sporteingangsprüfung zu rechnen, im zweiten Fall geht es kaum ohne.
Sportökonomie ist eines der ältesten Studienfächer auf diesem Gebiet. 1985 an der Uni Bayreuth ins Leben gerufen, waren die „Spökos“ damals Exoten (und berühmt-berüchtigt für ihre Partys). Vor allem in den Neunzigerjahren, als die Sport- und Fitnessbranche boomte wie keine zweite, entwickelten sich viele weitere Studienangebote, die heute alle zur Vielfalt des Angebots beitragen.
Allen Studienfächern gemeinsam ist, dass sie auf ein Berufsfeld vorbereiten, das zwar mit Sport zu tun hat, in dem Sie Ihr Geld aber überwiegend vor dem Computer, in Meetings oder auf der Reise von A nach B verdienen. Aktives Sporttreiben gehört weiterhin in Ihre Freizeit.
Sportökonomen oder -manager befassen sich mit der wirtschaftlichen Seite des Sports. Ein Manager zu sein, heißt letztlich zu organisieren und zu entscheiden und das tun Sie für Ihren Arbeitgeber. Als Sportmanager wissen Sie viel über Sponsoring und Marketing, also darüber, wie man das nötige Geld von außen beschafft. Intern kennen Sie sich mit Finanzbuchhaltung und Personalmanagement aus, und Sie werden sowohl rechtlich als auch rhetorisch geschult.
WO? Sportmanager gibt es überall, wo Sport ab einer gewissen Größe professionell betrieben wird. Das können größere Vereine sein (die Manager der Fußball-Erstligisten kennt man ja sogar aus dem Fernsehen), aber auch Sportartikelhersteller, Interessensverbände wie die FIFA oder Dachorganisationen wie das IOC oder IPC (International Olympics bzw. Paralympics Committee). Hier nenne ich nur einige, die Ihnen vermutlich ein Begriff sind. Es gibt auch jenseits der medienpräsenten Organisationen viele spannende Einsatzfelder für Sportmanager, so zum Beispiel in größeren Verbänden, kommunalen Sportorganisationen oder in Freizeiteinrichtungen, die eine gewisse überregionale Bedeutung haben.
WER? Die „Spökos“, die ich in meiner Studienzeit kannte, waren allesamt sehr sportliche, sehr ehrgeizige junge Männer, die überwiegend hart im Nehmen waren. Männlich müssen Sie bestimmt nicht sein, um zum Erfolg zu kommen obwohl immer noch um die 75 Prozent aller „Entscheiderposten“ mit Männern besetzt sind[1]. Sportlich müssen Sie sein, nicht nur für die möglicherweise fällige Sporteingangsprüfung, sondern auch, um den sportlich-praktischen Inhalt des Studiums gut zu bewältigen. Ehrgeiz schadet nicht: Sie starten in ein Berufsfeld, in dem es überwiegend sehr dynamisch zugeht. Ein „Nine-to-five-Job“ ist unwahrscheinlich; Reisebereitschaft wird umso mehr vorausgesetzt, je höher Sie sich arbeiten. Und hart im Nehmen müssen alle Manger sein, egal ob sie nun Sportvereine oder Großbäckereien betreuen.
Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse werden umso wichtiger, je weiter oben Sie einsteigen wollen. Dabei zählt nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch und/ oder Französisch. Wer während des Studiums ein bisschen Zeit übrig hat, investiert sie gut in einen Sprachkurs. Das ist jedenfalls stressfreier als sich später im Berufsleben durch einen Crashkurs die nötigsten Brocken anzueignen.
WIE? Der Studiengang Sportmanagement und alle seine Verwandten, führt zum Bachelor-Abschluss und dauert somit im Regelfall sechs Semester. Ich rate Ihnen, gleich noch einen Master-Studiengang von vier Semestern anzuhängen – Sie sind sowieso schon an der Uni. Sie sind bereits in die Thematik eingearbeitet und der Bachelor ist, was universitäre Bildung anbelangt, wirklich nur die Einstiegsstufe. Gerade für Führungspositionen wird später oft ein Mastergrad verlangt. Den können Sie zwar theoretisch jederzeit nachholen – praktisch ist der Schritt aus dem Berufsleben und zurück an die Uni mit vielen technischen Problemen verbunden.
Ich schreibe „Uni“, als wären alle Unis gleich – sind sie aber nicht. Neben den Universitäten bieten auch Fachhochschulen den Studiengang Sportmanagement an. Auch hier nennt sich der Abschluss Bachelor bzw. Master und vom Grad der Qualifikation her unterscheidet er sich kaum von dem universitären Abschluss. Ein Studium an der FH ist allerdings stärker an der Praxis orientiert und zeigt mehr Möglichkeiten, das Wissen im Berufsleben anzuwenden. Universitäten bilden eher nach wissenschaftlichen Kriterien aus, den Praxisbezug erarbeiten Sie sich in diesem Fall selbst.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Zugangsberechtigung: Während Sie für die Aufnahme an einer Universität die Allgemeine Hochschulreife, also Abitur, benötigen, genügt für eine FH die Fachhochschulreife – das ist ein Abschluss, den Sie z.B. an einer Fachoberschule erwerben. Aber auch die Mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung zählen als Fachhochschulreife und eröffnen Ihnen den Weg zu einem Studium.
Neben den Vollzeit-Varianten besteht die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren. Hier unterscheiden wir, vereinfacht gesprochen, zwei Varianten: Das ausbildungsbegleitende und das berufsbegleitende Studium. Im ersten Fall wechseln Sie, meist im Drei-Monats-Rhythmus, zwischen Ihrem Ausbildungsbetrieb und der Uni. Sie erwerben dabei gleichzeitig den Bachelor-Abschluss und einen nicht-akademischen Beruf, oft den Sport- und Fitnesskaufmann oder die A-Lizenzen für den Trainerberuf.
Der zweite Fall, das berufsbegleitende Studium, ist für Sie interessant, wenn Sie bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben. Es handelt sich dabei um ein Teilzeitmodell, das es Ihnen erlaubt, Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, während Sie nebenberuflich studieren. Inhaltlich unterscheidet sich so ein Studium kaum von der „regulären“ Variante. Nur die Laufzeiten sind natürlich anders.
 TIPP
TIPP
www.sportmanagement-studieren.de (sehr informative Seite, auch zu anderen Sport-Studiengängen; man muss nur die aufdringliche Werbung tolerieren)
Interview mit einer Sportmanagart:
Die Autorin Susanne Pavlovic im Gespräch mit Matthias Knoll, Gründer und Geschäftsführer der Firma Powerslide
Powerslide ist ein Spezialist für Skates, Zubehör und Ersatzteile, der nicht nur mit der Masse schwimmt, sondern vor allem in Nischen- und Spezialmärkten erfolgreich ist. Die Firma wurde 1994 gegründet und hat sich aus einem „Kofferraum-Unternehmen“ zu einem der drei führenden Anbieter entwickelt. Dabei sind den Unternehmern Qualität und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis besonders wichtig.
Man gründet ja nicht mal so eben eine Firma. Wie kamst du dazu?
Ich war schon als Schüler im Leistungssport aktiv und bin ganz erfolgreich bei Wettkämpfen gestartet, damals noch mit Rollschuhen. Sehr früh habe ich dann die Vorteile der damals neuen Inlineskates gegenüber den herkömmlichen Rollschuhen erkannt. Ich bin umgestiegen – und habe mehr Rennen gewonnen als zuvor. Daher kommt die Faszination für dieses Sportgerät.
Um nebenher Geld zu verdienen, habe ich bei Wettkämpfen aus dem Kofferraum heraus Skater-Zubehör und Ersatzteile verkauft. Damit habe ich eine Marktlücke entdeckt. Das Geschäft lief gut und so haben mein guter Freund und heutiger Geschäftspartner Stefan Göhl und ich beschlossen, Powerslide zu gründen. Ich bin also in den Sport hineingewachsen, und damit auch ins Geschäft. Nach der Schule habe ich dann in Bayreuth Sportökonomie studiert und mir das Wissen angeeignet, das mir noch fehlte.
Um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, ist besonderes Engagement wichtig. Wo siehst du die Schwerpunkte?
Zum einen muss natürlich die Qualität stimmen. Wir hatten damit einige Zeit kleine, aber ärgerliche Probleme. Schließlich haben wir uns entschlossen, unsere eigene Fabrik aufzubauen, in der nach unseren Qualitätsstandards gearbeitet wird. Das ist auch eine gewisse Konsequenz, die man an den Tag legen muss. Zum anderen muss ich natürlich wissen, was die Skater-Szene will und wo die Trends hingehen. Wir pflegen sehr gute Kontakte zu Fahrern weltweit und wir sind bei wirklich jedem wichtigen Event präsent, sprechen mit den Skatern und beobachten den Markt.
Du kommst viel herum. In welche Länder hauptsächlich, und was machst du dort eigentlich?
Ich bin vor allem in Europa und Asien unterwegs. In Europa besuche ich unsere Kunden – Großkunden und Ketten für Sportzubehör. Hier hat der Verkauf Vorrang. Nach Asien reise ich, um die Produktion zu überwachen und um bei der Entwicklung neuer Produkte dabei zu sein. In China bin ich mindestens vier Mal im Jahr für ungefähr zwei Wochen.
Einmal im Jahr besuche ich noch unseren Vertrieb in den USA. Natürlich dürfen wir auch bei den großen Events nicht fehlen, wie der Weltmeisterschaft im Speedskaten. Über das Jahr gesehen bin ich etwa 150 Tage im Ausland.
Macht das Reisen dir Spaß? Hast Du die Gelegenheit, mehr zu sehen und zu erleben als nur die jeweiligen Flughäfen?
Ich sehe jedenfalls mehr als nur die Flughäfen... Ich habe ja auch viel mit Menschen zu tun und lerne ihre jeweiligen Sitten und Gebräuche kennen. Leider habe ich nie die Zeit, an so einen Aufenthalt mal ein paar Tage Urlaub dranzuhängen, weil daheim schon wieder Arbeit wartet und ich natürlich auch Zeit mit meiner Familie verbringen will.
Welche Rolle spielt der aktive Sport derzeit in Deinem Leben? Kommst Du überhaupt noch dazu?
Als ich mit der Firma begonnen habe, hatte ich kaum mehr Zeit für aktiven Sport, was ich sehr bedauert habe. Seit einigen Jahren hat sich das gebessert und ich nehme mir wieder mehr Zeit für Sport, natürlich vor allem für‘s Skaten. Seit 2011 bestreite ich sogar gelegentlich wieder Rennen, was jetzt fast noch mehr Spaß macht als früher: Es ist der gleiche Kick, der gleiche Adrenalinschub. Es macht einen Haufen Spaß, und ich habe nicht mehr diesen Druck wie früher, wo ich fast jede Woche ein Rennen hatte. Zur Zeit versuche ich, mindestens drei Mal die Woche zu trainieren, wenn möglich auch mehr. Oft komme ich gerade wegen der Reisen nicht dazu, was dann aber die Vorfreude auf das nächste Training sehr steigert.
Dein Tipp für alle, die frisch aus der Schule kommen und „Irgendwas mit Sport“ machen wollen?
Egal was du machst, du musst hundertprozentig dahinter stehen. Auch im Bereich Sport ist es wichtig, dass du nicht nur „irgendwas“ machst, sondern dass der Beruf absolut zu dir passt und dich begeistert. Sport kann helfen, die Startschwierigkeiten in die Berufswelt zu meistern. Im Sport lernt man viel Disziplin, Verantwortung, man lernt, ein hartes Training durchzuhalten und Prioritäten zu setzen.
Das kann man alles brauchen, vor allem in der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist wie ein Rennen, man versucht, der Beste zu sein und muss dazu sehr genau über seine Stärken und Schwächen Bescheid wissen – die Stärken versucht man zu verbessern und die Schwächen auszugleichen – durch Lernen, Fortbildung und Erfahrung.
Auf die richtige Auswahl kommt es an. Was kannst Du am besten? Wo hast du dein Talent? Worin bist du nicht so gut? Eine realistische Einschätzung von dir selbst und echte Begeisterung für deinen Beruf sind wichtige Schritte, um erfolgreich zu werden.

 Sportpädagogik
Sportpädagogik
Hier stelle ich Ihnen eine Ausbildung vor, die sich inhaltlich mit einigen anderen überschneidet. Zunächst einmal: Alle Lehrer sind Pädagogen, aber nicht alle Sportpädagogen sind Lehrer! Zumindest nicht im Schuldienst.
WAS? Wie der Name schon sagt, spezialisieren Sie sich während dieser Ausbildung auf die pädagogisch-erzieherische Seite des Sports. Sie lernen, wie man sportliche Inhalte vermittelt. Als Sportpädagogin erteilen Sie später Sportunterricht, nicht nur an öffentlichen Schulen, sondern auch in Vereinen oder anderen Freizeiteinrichtungen. Dabei wissen Sie nicht nur, wie man die technische Seite Ihrer Sportart vermittelt, sondern kennen sich auch in Bereichen wie Ernährungslehre, Rehabilitation und Psychologie aus. Ihnen geht es darum, einen Lernprozess zu lenken und zu begleiten. Spitzenleistungen im rein sportlichen Bereich sind schön, aber nicht das erklärte Ziel Ihrer Arbeit. Sie sind im Grunde eine Erzieherin. Es ist Ihnen wichtig, Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Selbstvertrauen und Teamgeist zu vermitteln.
Je nach Arbeitsumfeld fallen Ihnen auch Aufgaben im Management oder in der konzeptionellen Arbeit zu. Hier entwickeln Sie Trainings- oder Bewegungsprogramme und entwerfen Leitfäden für Sportkurse. Unter Umständen übernehmen Sie auch das Marketing, sorgen also dafür, dass Ihre „Zielgruppe“ auch von dem neuen Sportangebot erfährt.
WO? In manchen Bundesländern können Sie mit einem Master-Abschluss in Sportpädagogik, kombiniert mit bestimmten Nebenfächern, in den Sportunterricht an Schulen starten. In Bayern wird immer noch das klassische Staatsexamen bevorzugt. Gerade die zwei Jahre zwischen erstem und zweitem Staatsexamen, die Zeit des sogenannten Referendariats, bereitet Sie umfassend auf die Schulwirklichkeit vor – etwas, das Bachelor-Studenten entgeht. Ich kann also nur empfehlen: Ist der Schulunterricht Ihr Ziel, studieren Sie auf Staatsexamen. Ist die freie Wirtschaft Ihr Ziel, sind Sie auch in einem Bachelorstudiengang gut aufgehoben.
Als Sportpädagogin mit Bachelor- oder Masterabschluss stehen Ihnen Vereine, Sportveranstalter oder Sporthotels als Arbeitgeber offen. Auch in Rehabilitationseinrichtungen können Sie eine Aufgabe finden.
WER? Für Lernprozesse sollten Sie sich mehr interessieren als für individuelle Spitzenleistungen. Die Bereitschaft, sich auf ziemlich theoretischer Ebene mit dem Thema Sport auseinander zu setzen, ist unverzichtbar, damit Sie das Studium „überleben“. Außerdem sollte das breit gefächerte Spektrum Ihrer beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium Sie eher reizen als abschrecken: Wenn es Ihnen nur um die Vermittlung von sportlichen Inhalten geht, sind Sie mit einem Staatsexamen an der Schule doch besser aufgehoben.
Als Sportpädagogin mit Bachelor- oder Masterabschluss bewegen Sie sich in der „freien Wildbahn“, also der freien Wirtschaft. Dafür sollten Sie kommunikativ sein, strukturiert arbeiten können und auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen. Konzeptionelles Arbeiten, also die Planung vom Schreibtisch aus, sollte kein notwendiges Übel für Sie sein, sondern Ihnen genauso viel Spaß machen wie das Unterrichten.
WIE? Sportpädagogik ist ein Bachelor-Studiengang mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern. Mit vier weiteren Semestern erwerben Sie den Master-Abschluss. Im Master-Studiengang suchen Sie sich ein Fachgebiet aus Ihren bisherigen Studieninhalten aus und steigen in dieses noch tiefer ein: Durch Spezial-Seminare und Vorlesungen und durch das Abfassen einer Master-Arbeit, in der Sie zeigen, dass Sie nicht nur in der Lage sind, sich wissenschaftliche Erkenntnisse anzueignen und diese in einen Zusammenhang zu setzen, sondern dass Sie auch selber forschen und zu eigenen Erkenntnissen kommen können.
In der Regel können Sie Sportpädagogik nicht als einziges Fach studieren, sondern müssen es mit einem zweiten Studienfach kombinieren (sogenannte Zwei-Fach-Bachelors). Zweite Fächer sind üblicherweise ebenfalls pädagogisch orientiert und richten sich an Studierende, die auf den Schuldienst zielen (Beispiel: Mathematik und ihre Vermittlung).
Um für das Studium zugelassen zu werden, müssen Sie ein Abitur mit entsprechendem Notenschnitt haben, der je nach Universität unterschiedlich ausfällt. Außerdem müssen Sie die Sport-Eingangsprüfung bestehen.
 Sportpublizist/in
Sportpublizist/in
WAS? Der Name verrät es schon: Dieses Studium macht Sie zum Experten für einen Bereich, in dem Sport und Medienlandschaft sich überschneiden. Sportpublizisten sind also nicht diejenigen, die dem Ball hinterherhetzen, sondern sie kommentieren das sportliche Geschehen für Fernseh- oder Radiosender oder schreiben für die Printmedien. Sie sind also Sportreporter, aber nicht nur. Ihre Ausbildung befähigt sie auch, Managementaufgaben in Vereinen wahrzunehmen oder in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit den gesamten Außenauftritt einer sportlichen Institution zu gestalten. Auch als Redakteur bei Tageszeitungen oder Produktionsfirmen, die für Hörfunk oder Fernsehen arbeiten, sind sie gefragt.
Sie kennen die Medienlandschaft und ihre Mechanismen. Sie wissen, wie man die allgemeine Aufmerksamkeit auf ein Thema lenkt und Inhalte vermittelt. Deshalb werden sie auch gerne in Bereichen eingesetzt, die einen hohen Anteil von Marketing beinhalten. Die nächste Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums, „Esst mehr Äpfel, treibt mehr Sport!“ oder so ähnlich, wäre ein ideales Betätigungsfeld für Sportpublizisten.
WO? Es ist bereits angeklungen: Sportpublizisten können in vielen komplexen und interessanten Bereichen arbeiten. Als Moderatoren bei Fernsehsendern oder Radiostationen, als Medienberater oder PR-Chefs bei sportlichen Institutionen jeder Art (ab einer gewissen Größe; das Fitness-Studio um die Ecke wird sich nur in seltenen Fällen einen Sportpublizisten „leisten“).
Auch die Redaktionen von Medienanstalten oder Internetportalen bieten sich an. Manche finden ihren Wirkungskreis auch bei großen Sportartikelherstellern oder bei Organisationen aus dem Profisport.
WER? Neben sportlicher Begeisterung und Leistungsfähigkeit sollten Sie eine hohe Affinität zum geschriebenen und gesprochenen Wort aufweisen, denn damit verdienen Sie Ihre Brötchen. Teamgeist ist wichtig, denn auch Moderatoren, die alleine vor der Kamera stehen, erarbeiten ihre Texte und ihr Hintergrundwissen im Team.
Recherchearbeit sollte Ihnen Spaß machen und Sie sollten in der Lage sein, sie mit der nötigen Genauigkeit und Struktur durchzuführen.
Gerade bei Funk, Fernsehen und Printmedien gelten sogenannte „deadlines“ für Beiträge, also ein festgelegter Zeitpunkt, zu dem ein Beitrag fertig produziert sein muss, und der keinesfalls überschritten werden darf. Diese „deadlines“ sind nicht immer komfortabel. Eigentlich meistens nicht. Unter Druck gute Arbeit zu leisten, sollte Ihnen deshalb möglich sein.
Natürlich sollten Sie durch und durch kommunikativ sein, gerne aus sich herausgehen und Interesse an anderen Menschen haben. Wenn Sie dann auch noch eine kreative Ader haben, sind Sie perfekt für den Job.
WIE? Derzeit bietet nur die Uni Tübingen diesen Studiengang an. Mit vollem Namen heißt er „Sportwissenschaft mit dem Profil Sportpublizistik“. Es gibt einige ähnlich gelagerte Studiengänge von privaten Hochschulen. Der Bachelor-Abschluss ist der gleiche und Sie erwerben sicher auch vergleichbare Kompetenzen. Man muss allerdings auf den Internetseiten einiger privater Hochschulen lange herumklicken, bis man die Gebührenordnung findet. Dann sitzt man hoffentlich gut, damit es einen vor Schreck nicht umhaut. Machen Sie sich also ruhig selbst ein Bild.
Vorteil der privaten Anbieter ist, dass sie in der Regel keine Sporteingangsprüfung abhalten, die Uni Tübingen aber schon. Während des Studiums ist allerdings der sportpraktische Anteil bei den Privaten näherungsweise Null, während Sie an der Uni Tübingen einen guten Teil Ihrer Studienzeit mit Sport verbringen und auch leistungsmäßig benotet werden.
Im Fach Sportwissenschaft erwarten Sie Module wie Theorie und Praxis verschiedener Sportarten, geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen und Einführung in die Arbeitsweisen der Wissenschaft (letzteres nennt sich „Propädeutik“).
In Ihrem Erweiterungsfach Publizistik befassen Sie sich mit Medienwissenschaften, EDV, Fremdsprachen und den Grundlagen des Journalismus und der Kommunikation. Das Erweiterungsfach beansprucht in etwa die Hälfte Ihres Stundenplanes.
Zugangsberechtigt ist, wer eine Allgemeine Hochschulreife vorweisen kann und die Sporteingangsprüfung besteht.
 Sport und Technik / Sports
Engineering
Sport und Technik / Sports
Engineering
Wer „Sport“ studieren will, wird schnell merken, dass dies eher ein Oberbegriff ist als ein konkreter Studiengang. Sport an der Uni gibt es in den verschiednesten Ausrichtungen. Stellvertretend möchte ich Ihnen hier eine fächerübergreifende Variante vorstellen: eine Kombination aus Ingenieursund Sportstudium.
WAS? Der Markt für Fitness- und Sportgeräte ist hungrig. Die Inline-Skates von heute haben nicht mehr viel mit den Rollschuhen zu tun, mit denen ich als Kind auf die Knie gefallen bin. Es gibt ultraleichte Fahrradhelme mit Fahrtwindbelüftung und Sportschuhe, die beinahe schon von selber laufen. All diese Neuerungen, mit denen Umsatz generiert werden soll, werden von Ingenieuren entwickelt, die gleichzeitig Experten für Sport und Bewegung sind.
Doch auch wenn bei den Paralympics ein Skifahrer ohne Beine die Piste hinunter rast oder Radrennfahrer ihre Räder mit den Armen statt den Beinen antreiben, steckt dahinter die Entwicklungsarbeit eines Sportingenieurs.
Und wenn wir gerade beim Leistungssport sind: Mann muss nicht in die Formel 1 schauen, um zu sehen, dass Leistungssport auch immer eine Materialschlacht ist. Nur wer den besten Schuh hat, kann optimal abspringen und Körbe werfen. Nur wenn das Gewehr gleichzeitig leicht und präzise ist, kann der Biathlet einer Strafrunde entkommen. Fahrräder, Turnschuhe, Bälle, Rodelschlitten: alles High-Tech. Sie ersetzen natürlich nicht die Leistung des Athleten, aber sie können optimieren und unterstützen.
Auch in der Wettkampfvorbereitung kommt Technik zum Einsatz, die so hoch entwickelt ist, dass der Normalverbraucher vermutlich davor stehen würde wie vor einem Ufo. Diagnosegeräte messen und analysieren Bewegungsabläufe oft genauer als das menschliche Auge und liefern Hinweise auf den weiteren Trainingsverlauf. Hinter dieser Hard- und Software steckt eine Menge Entwicklungsarbeit.
Damit haben wir das Arbeitsfeld eines Sportingenieurs schon weitgehend umrissen. „Sportingenieur“ ist die handliche Bezeichnung des Diplom-Studienganges, der mittlerweile vom Bachelor-Studiengang „Sport und Technik“ bzw. „Sports Engineering“ abgelöst wurde. Inhaltlich hat sich bei der Umwandlung nicht viel verändert (abgesehen von der üblichen Straffung des Stoffes, wenn ein Studiengang von acht Semestern Regelstudienzeit auf sechs verkürzt wird). Nach wie vor verwenden Sie die Hälfte Ihrer Studienzeit auf die „klassischen“ Sportwissenschaften: Sport und Gesellschaft, Fragen der Bewegungswissenschaften, Trainingstheorie, Sporttheorie und -praxis. Während der restlichen Zeit befassen Sie sich mit den klassischen Disziplinen der Ingenieure: Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Beide „Studienhälften“ sind so miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt, dass ein sinnvolles Ganzes entsteht.
WO? Studieren lässt sich Sport und Technik derzeit an den Universitäten in Magdeburg und Chemnitz. Arbeit finden Studienabsolventen überwiegend in der Entwicklungsabteilung großer Herstellerfirmen im In- und Ausland. Auch Zentren für Leistungssport wie Olympiastützpunkte oder Bundesleistungszentren beschäftigen Sportingenieure.
Wenn neue Geräte auf den Markt kommen (gerade Fahrräder, Laufbänder und andere Ausdauergeräte), durchlaufen sie eine Sicherheitsprüfung. Bekanntestes Prüfinstitut ist der TÜV. Auch solche Prüfungen auf Funktionalität und Materialfestigkeit werden von Sportingenieuren durchgeführt.
WER? Um das Studium erfolgreich zu absolvieren, sollten Sie nicht nur sportlich sein, sondern auch eine technische Begabung haben. Sie müssen sich jedenfalls ein Ingenieurs-Studium zutrauen, denn wenn auch die Inhalte nicht so in die Breite gehen wie bei einem reinen Ingenieursstudium, so gehen sie doch ebenso in die Tiefe. Einfacher ist es deshalb also nicht.
WIE? Zugangsvoraussetzung ist, wie bei allen Studiengängen, das Abitur. An der Universität Magdeburg kommt noch eine bestandene Sport-Eingangsprüfung hinzu. Die fällt bei der TU Chemnitz weg. Die verlangt allerdings vor Studienantritt ein sechswöchiges Vorpraktikum, in dem Sie die wichtigsten Fertigungstechniken und Grundlagen der Werkstoffbearbeitung kennenlernen.
Dieses Praktikum kann bis zum Ende des dritten Studiensemesters nachgereicht werden. Ich empfehle aber dringend, vor Studienantritt damit fertig zu werden. Zum einen verschaffen Sie sich damit einen Einblick in Ihr späteres Arbeitsfeld und können klären, ob es tatsächlich Ihren Wünschen entspricht. Zum anderen ist für heutige Bachelor-Studenten kaum mehr nachvollziehbar, woher die Semester-“Ferien“ ihren Namen haben, denn sie sind vollgepackt mit Projekten, Prüfungen und wissenschaftlichem Arbeiten. Ein sechswöchiges Praktikum mal eben locker einzuschieben, ist kaum möglich. Nutzen Sie also dafür am besten die Zeit zwischen Abitur und Studienantritt.
Die Universität Magdeburg hat in den vergangenen Jahren als zusätzliche Zulassungsbeschränkung einen NC (Numerus Clausus) eingeführt, also eine Mindestnote, die im Abitur erreicht werden muss, um sich überhaupt bewerben zu dürfen. Viele Universitäten picken sich auf diese Weise die besten Studenten aus einer Überzahl an Bewerbern. Erkundigen Sie sich rechtzeitig nach dem aktuellen NC, wenn Sie in Magdeburg landen wollen.
UND WEITER? Wenn Sie den Bachelor in der Tasche haben, sollten Sie ein weiterführendes Master-Studium in Erwägung ziehen. Das dauert noch einmal vier Semester und spezialisiert Sie zusätzlich, im Idealfall in die Richtung, in der Sie später auch arbeiten wollen. Gerade in Forschung und Entwicklung sind Master-Absolventen im Vorteil, weil sie noch tiefere Einblicke in wissenschaftliche Forschungsarbeit gewonnen haben.
 TIPP
TIPP
http://studiengaenge.zeit.de/studiengang/g9205/sport-und-technik
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/sport-und-technik-hoeher-schneller-sicherer-1967749.html Hier wird noch auf den Diplom-Studiengang Bezug genommen. Dieser wurde inzwischen in einen Bachelor-Studiengang umgewandelt. Die Informationen sind trotzdem noch relevant.
 Sporttherapeut/ in
Sporttherapeut/ in
Für dieses Berufsbild ist „Sporttherapeut“ die gängige, wenn auch nicht einzige Bezeichnung. Nicht einmal der Studiengang muss immer so heißen. Manchmal nennt er sich auch „Sportwissenschaft mit vertieftem Schwerpunkt Gesundheitsförderung“. Andere Bezeichnungen sind „Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation“, „Bewegung und Gesundheit“ oder „Gesundheitsförderung“ (Sportwissenschaften mit Nebenfach Sportmedizin).
Sporttherapie, die auch tatsächlich diesen Namen trägt, gibt es als Nebenfach eines Sportwissenschaft-Studiums an der Uni Freiburg.
Insgesamt sind Sporttherapeuten immer Sport- oder Bewegungswissenschaftler, die im Nebenfach Gesundheitsaspekte behandelt haben. Dass sie das Nebenfach später zum Hauptfach ihres Berufes machen, ist kein Widerspruch. Gesundheitliche Aspekte des Sports lassen sich nicht betrachten, ohne zuvor ein grundlegendes Verständnis des Faches aufzubauen. Kurz: Wer sich mit Sport für kranke Menschen auskennen will, muss sich erst einmal mit Sport für Gesunde befassen.
WAS? Sporttherapeuten arbeiten überwiegend auf den Gebieten der Prävention und Rehabilitation. Im ersten Fall haben sie es mit gesundheitlichen Risikogruppen zu tun: stark Übergewichtigen, Diabetikern oder Menschen mit hohem Blutdruck. Ihnen helfen sie, durch ein individuell angepasstes Sportprogramm, ihren Zustand zu verbessern und damit auch mehr Lebensqualität zu erfahren. Auf dem Gebiet der Rehabilitation unterstützen sie Menschen dabei, die Folgen einer Krankheit oder eines Unfalles zu überwinden und wieder in ein Leben mit normaler Leistungsfähigkeit zurückzukehren. Sie betreuen hier Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten genauso wie Menschen, die unter motorischen Einschränkungen leiden.
In beiden Fällen ist es mit einem angepassten Sportprogramm nicht getan. Wenn Sie mal bei einer Krankengymnastik waren, kennen Sie vielleicht den Effekt: Man zeigt Ihnen Übungen, die Ihre Beschwerden lindern sollen und die Sie bitte auch nach Ablauf der fünf, acht oder zehn Therapiestunden regelmäßig durchführen sollen. Manche von Ihnen tun das, zumal Sie ja ein sehr sportbegeistertes Publikum sind – bei manchen werden die guten Vorsätze aber auch vom Alltag geschluckt. Die Übungen werden immer seltener und irgendwann erinnert man sich gar nicht mehr so genau, was man da machen sollte und wie das ging.
Aufgabe der Sporttherapeutin ist es daher vor allem, den Patienten anzuleiten, aus eigenem Antrieb Gewohnheiten zu ändern und beispielsweise ein regelmäßiges Bewegungsprogramm langfristig in die Lebensplanung aufzunehmen. Sie motivieren ihre Patienten also nicht nur – eine Motivation, die allein vom Therapeuten ausgeht, ist ja nach Abschluss der Beratung nicht mehr verfügbar.
Vielmehr zeigen sie ihren Patienten, wie diese sich selbst immer wieder motivieren können, um dauerhaft eine gesündere Lebensweise zu pflegen.
Zu dieser gehört nicht nur Bewegung, sondern auch gesundheitsfördernde Verhaltensweisen wie vernünftiges Essen, ausreichend Schlaf und die Vermeidung von Giftstoffen wie Alkohol oder Zigaretten. Die Sporttherapeutin stößt also eine Wandlung in vielen Bereichen an und muss sich dementsprechend auch auf vielen Gebieten gut auskennen. Dabei hat sie es oft mit Menschen zu tun, die bisher keine „Sportbiographie“ vorweisen können.
Außerdem sind Sporttherapeuten in der Lage, durch spezielle Untersuchungsmethoden herauszufinden, welche Beeinträchtigungen in der Muskulatur oder Beweglichkeit eines Patienten genau vorliegen. Diese Informationen fließen in den Behandlungsplan ein.
WO? Viele Sporttherapeuten betreiben eine eigene Praxis – allein oder mit Kollegen. Andere arbeiten in Krankenhäusern oder Reha-Einrichtungen. Auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, wie Kurkliniken, Gesundheitszentren oder als Berater bei Krankenkassen können sie tätig werden.
Bezogen auf die Ausbildung, liefert die Frage nach dem „Wo?“ eine Reihe von Universitäten, die einen entsprechenden Studiengang anbieten, beispielsweise in Freiburg, Bochum oder Chemnitz. Viele Universitäten bieten die Fachrichtung als Masterstudiengang für Bachelor-Absolventen der Sportwissenschaften, was, siehe oben, ein sinnvoller Weg ist. Wer direkt in die Fachrichtung einsteigen möchte, kann sich an der Uni Potsdam über „Sporttherapie und Prävention“ als Bachelor-Studium informieren. Auch die Uni Gießen hat ein interessantes Angebot im Programm. Hier können Sie „Bewegung und Gesundheit“ zum Bachelor studieren und dann ein Master-Studium „Klinische Sportphysiologie und Sporttherapie“ dranhängen.
WER? Die Uni bietet einen vergleichsweise theoretischen Zugang zum Thema. Sich fundiertes Hintergrundwissen anzueignen, sollte Ihnen also Spaß machen, ebenso das wissenschaftliche Arbeiten, damit Sie die Ausbildung ohne allzu große Frustschübe überstehen. Für den Beruf selbst sind Einfühlungsvermögen und eine pädagogische Ader unverzichtbar. Auch Geduld gehört dazu: Ihre Patienten haben ihr bisheriges Leben möglicherweise nach Churchills Devise „Sport ist Mord“ verbracht und wären im Leben nicht von selbst auf die Idee gekommen, sich freiwillig zu bewegen. Eine Krankheit zwingt sie nun dazu, etwas zu ändern – aber Gewohnheiten sind, nun ja, Sie wissen es selbst, eben Gewohnheiten. Als Sporttherapeutin müssen Sie hier behutsam vorgehen, ermuntern und Spaß an der Sache vermitteln, denn nur wenn Ihre Patienten „auf den Geschmack kommen“, werden Sie die Verhaltensänderungen langfristig beibehalten.
WIE? Wenn Sie bis hierher gelesen haben, wissen Sie es bereits: Sporttherapie ist ein spezialisierter Master-Studiengang, den Sie an ein Bachelor-Studium der Sportwissenschaft oder Bewegungswissenschaft anhängen. Eine Ausnahme bietet die Uni Potsdam, an der sich das Fach „grundständig“, also ab dem ersten Semester, studieren lässt. Auch hier bietet sich natürlich die Möglichkeit, ein Master-Studium anzuschließen, und das empfehle ich auch jedenfalls: Viele Sportterapeuten haben den Master und als Bachelor haben Sie später auf dem Arbeitsmarkt einen Wettbewerbsnachteil.
 Sportwissenschaften
Sportwissenschaften
Liebe Leserin, lieber Leser – willkommen zu einem Studienfach, das es als solches eigentlich gar nicht gibt.
WAS? Nur keine Schnappatmung – und bitte keine Drohbriefe von akkreditierten Sportwissenschaftlern! Was es nicht gibt, ist ein Studienfach Sportwissenschaft, das mit überall den gleichen Abläufen und Schwerpunkten zu überall den gleichen Qualifikationen führt. Sportwissenschaft ist die Basis für ungefähr jeden Studiengang, der Ihnen in diesem Berufsführer begegnet. Hinzu kommen fachliche Spezialisierungen in Richtung Gesundheit, Technik und Entwicklung, Pädagogik oder Management, die Ihnen eine grobe berufliche Richtung vorgeben.
Sportwissenschaft ist eine sogenannte interdisziplinäre Wissenschaft, weil sich in ihr viele unterschiedliche Fachrichtungen treffen: die Geisteswissenschaften, Sozial- und Verhaltenswissenschaften, Naturwissenschaften und die Medizin. Vertreten werden die Disziplinen durch Fächer wie Sportgeschichte, Sportpsychologie, Trainingswissenschaft und Sportmedizin. Üblicherweise besteht ein Institut für Sportwissenschaft auch aus verschiedenen Fakultäten (Abteilungen, sozusagen), wo die jeweiligen Fachrichtungen gelehrt werden.
Im Studium ist der Praxisanteil durchgängig recht hoch. Hier werden also auch Ihre sportlichen Fähigkeiten gefordert. Dabei sind die Sportarten, die geprüft werden, oft aus Fächergruppen wählbar: Ballsportarten beispielsweise, eine oder mehrere Disziplinen der Leichtathletik, aber auch, wenn Ihnen das liegt, tänzerische und gymnastische Fächer.
Das Basisfach Sportwissenschaft behandelt Fragestellungen wie diese: Wie kann man Erkenntnisse der Trainingswissenschaften dazu benutzen, um die Leistungen von Spitzensportlern zu verbessern? Und lassen sich Beobachtungen aus dem Spitzensport auf den Breitensport übertragen? Was passiert im Gehirn, wenn ein Mensch eine neue Bewegung erlernt? Und wie wirkt sich regelmäßiger Sport auf die psychosoziale Entwicklung eines Menschen aus?
WO? Sportwissenschaft, manchmal auch im Plural gebraucht, lässt sich an über 60 Hochschulen in Deutschland studieren. Unter www.dvs-sport-studium.de können Sie eine Liste aller Unis von A bis Z, beziehungsweise von Bayreuth bis Wuppertal, einsehen und sich auch über die jeweiligen Fächerschwerpunkte informieren.
Wo Sie später arbeiten werden, hängt maßgeblich von dem gewählten Schwerpunkt ab. Sportwissenschaften auf Lehramt führt Sie in die Schule, der Schwerpunkt Ökonomie ins Management, der Schwerpunkt Therapie ins Gesundheitswesen. Das heißt, Sie sollten schon bei der Wahl der Uni Ihre späteren Berufswünsche berücksichtigen. Klären Sie bitte hier vor allem folgende Fragen ab: Möchten Sie später lieber mit Amateuren oder mit Profis arbeiten? Mit Erwachsenen oder Jugendlichen bzw. Kindern? Soll die praktische Ausübung Ihrer Sportart später beruflich einen breiten Raum einnehmen oder ist es für Sie okay, wenn Sport eher eine Freizeitbeschäftigung ist?
WER? Die Frage ist hier kaum zu beantworten. Pädagogisch veranlagte Menschen sind in der Sporttherapie gut aufgehoben, ehrgeizige Menschen, die Lust auf Karriere und evtl. Arbeit im Ausland haben, im Management. Schüchterne Tüftler entwickeln vielleicht ein innovatives Sportgerät für einen großen Hersteller, während extrovertierte Kommunikationstalente die Geschicke eines Vereines mitbestimmen. So verschieden die Fachrichtungen, so unterschiedlich sind auch die Menschen, die sich dort gut aufgehoben fühlen.
WIE? Sportwissenschaft mit all ihren Schwerpunkten ist ein Bachelor-Studium an Universitäten. Um zugelassen zu werden, benötigen Sie das Abitur und in den meisten Fällen eine bestandene Sport-Eingangsprüfung. Oftmals können die Universitäten das Interesse am Fach gar nicht bedienen: iIn Bayreuth beispielsweise, bewerben sich jedes Jahr auf‘s Neue um die 400 Kandidaten auf 90 Studienplätze. Hier muss naturgemäß ausgesiebt werden, was durch einen NC und die berüchtigte Sporteingangsprüfung geschieht[2].
 TIPP
TIPP
http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=33
www.sportmanagement-studieren.de (hier auch ein Artikel über Sportwissenschaft)
http://www.studienwahl.de/de/thema-des-monats/studienfeld-sport-wellness-und-rehabilitation01102.htm