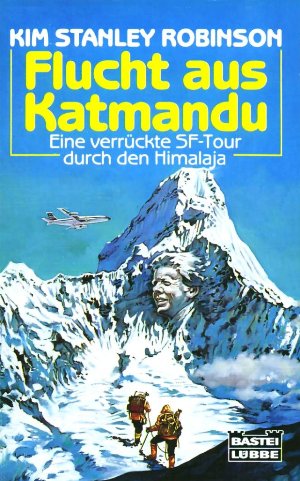
Kim Stanley Robinson
Mutter Göttin der Welt
1
Mein Leben nahm an jenem Abend wieder seltsame Züge an, als ich Freds Fredericks in der Nähe von Chimoa und der Schlucht des Dudh Kosi über den Weg lief. Ich führte damals einen Trek und freute mich sehr, Freds zu sehen. Er reiste mit einem anderen Bergsteiger, einem Tibetaner namens Kunga Norbu, der sehr wenig Englisch zu sprechen schien, abgesehen von »Hallo« und »Guten Morgen«, was er beides zu mir sagte, als Freds uns miteinander bekannt machte, wenngleich gerade die Sonne untergegangen war. Meine Trekking-Gruppe hatte es sich schon für die Nacht in den Zelten bequem gemacht, und so strebten Freds und Kunga und ich den Teehäusern entgegen, die neben dem Trail am Waldrand standen. Wir sahen in sie hinein; die beiden ersten waren für die Trekker gewienert, doch das dritte war ein Teehaus alten Stils, das nur von Trägern besucht wurde. Wir verschwanden darin.
Es bestand aus einem einzigen niedrigen Raum; wir mußten uns nicht nur unter den Balken bücken, die das Schieferdach trugen, sondern auch unter der Rauchschicht. Die Häuser auf dem Land in Nepal haben traditionell keine Kamine, und der Rauch von ihren Holzöfen steigt einfach zur Decke hinauf und sammelt sich dort in einer sehr dicken Schicht, die sich senkt, bis sie durch die Dachtraufe sickert. Warum die Nepali keine Kamine benutzen, die ich eigentlich für eine ziemlich grundlegende Erfindung halte, ist eine Frage, die niemand beantworten kann; ein weiteres großes Geheimnis von Nepal.
Fünf Holztische waren von Rawang- und Sherpa-Trägern besetzt, die sich auf den Bänken ausgestreckt hatten. Am einen Ende des Raumes knisterte der Ofen. Flammen vom Ofen und eine zischende Coleman-Lampe spendeten das Licht. Wir sagten Namaste zu den Nepali, die uns anstarrten, und tauchten unter dem Rauch hinweg, um am Tisch neben dem Ofen Platz zu nehmen.
Wir ließen Kunga Norbu bestellen, da er mehr Nepalesisch sprach als Freds oder ich. Als er fertig war, kicherten die Rawang-Ofenhüter, gingen zum Ofen und kamen mit drei großen Bechern tibetanischen Tees zurück.
Ich beschwerte mich mit eindeutigen Worten bei Freds darüber. »Verdammt, ich dachte, er wollte Chang bestellen!«
Sie müssen wissen, daß tibetanischer Tee kein gewöhnlicher Lipton’s ist. Man macht ihn aus einer schwarzen Flüssigkeit, die gar nicht aus Teeblättern gebraut wird, sondern aus irgendeiner Wurzel, und die so bitter ist, daß man Wunden damit desinfizieren könnte. Dann schüttet man eine Menge Salz in dieses Gebräu, rührt kräftig um und gießt schließlich noch großzügig ranzige Yakbutter hinzu, die schmilzt und nach oben treibt.
Es schmeckt schlimmer, als es klingt. Ich habe eine Strategie für den Umgang mit diesem Zeug entwickelt, wann immer mir ein Becher angeboten wird. Ich sehe aus dem nächsten Fenster und begieße die Pflanzen damit. Solange ich das nicht zu schnell mache und man mir keinen zweiten Becher anbietet, komme ich damit klar. Aber hier war das unmöglich, da uns über zwanzig lachende Augenpaare anstarrten.
Kunga Norbu saß über den Tisch gebeugt, schlurfte aus seinem Becher und machte »Ooh!« und »Ahh!« und bedachte die Ofenhüter mit Komplimenten. Sie nickten und betrachteten Freds und mich genauer, wobei sie sich ein breites Grinsen nicht verkneifen konnten.
Freds ergriff seinen Becher und trank einen großen Schluck vom Tee. Er schmatzte wie ein Weinprüfer mit den Lippen. »Ausgezeichnet«, sagte er, leerte den Becher und hielt ihn unseren Gastgebern hin. »Mehr?« sagte er und zeigte in den Becher.
Die Träger heulten geradezu. Unser Wirt füllte Freds’ Becher neu, und er machte sich wieder darüber her und schmatzte nach jedem Schluck. Ich gab aus einer Tropfflasche, die ich immer bei mir habe, etwas Jodlösung in meinen Becher, rührte um und hielt mir die Nase zu, um einen Schluck zu trinken, und auch das fanden sie komisch.
Also verstanden wir uns jetzt ganz gut mit den Teehausgästen, und als ich Chang bestellte, brachten sie gleich einen ganzen Krug. Wir gössen es in die kleinen angeschlagenen Teehausgläser und machten uns darüber her.
»Was habt ihr also vor, Kunga Norbu und du?« fragte ich ihn.
»Na ja«, sagte er, und ein seltsamer Ausdruck legte sich auf sein Gesicht. »Das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte.«
»Dann erzähl’ sie mir.«
Er schaute unsicher drein. »Sie ist zu lang, um sie heute abend zu erzählen.«
»Wie bitte? Eine Geschichte, die zu lang ist, als daß Freds Fredericks sie erzählen könnte? Unmöglich, Mann. Ich hab’ mal gehört, wie du für Laure die Bibel zusammengefaßt hast, und das dauerte nur eine Minute.«
Freds schüttelte den Kopf. »Sie ist länger als die Bibel.«
»Ich verstehe.« Ich beließ es dabei, und wir drei tranken wieder Chang, was ein Weißbier ist, das aus Reis oder Gerste gebraut wird. Wir tranken eine Menge davon, eine in verschiedener Hinsicht gefährliche Angelegenheit, aber das kümmerte uns nicht. Während wir tranken, sanken wir immer tiefer auf den Tisch, um unter der Rauchschicht zu bleiben, und außerdem erschien uns es ganz natürlich, allmählich unter den Tisch zu rutschen. Schließlich lagen wir da wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
Freds unterhielt sich mit Kunga Norbu weiterhin auf Tibetanisch, und ich wurde neugierig. »Freds, du sprichst kaum ein Wort Nepalesisch, wie kommt es da, daß du so gut Tibetanisch kannst?«
»Ich habe ein paar Jahre in Tibet verbracht. Ich studierte in den buddhistischen Lamaklostern.«
»Du hast in buddhistischen Lamaklostern in Tibet studiert?«
»Na klar! Sieht man das nicht?«
»Na ja …« Ich machte eine nichtssagende Handbewegung. »Ich glaube, das erklärt es wohl …«
»Dort habe ich übrigens auch Kunga Norbu kennengelernt. Er war mein Lehrmeister.«
»Ich dachte, er sei Bergsteiger.«
»Ist er auch! Er ist ein kletternder Lama: Es gibt übrigens ziemlich viele davon. Weißt du, als die Chinesen in Tibet einfielen, schlossen sie alle Klöster, zerstörten die meisten sogar. Die Mönche mußten jetzt arbeiten, und die Lamas gingen entweder nach Nepal oder zogen zu den Berghöhlen hinauf. Später wollten die Chinesen dann zu Propagandazwecken mit dem Bergsteigen anfangen, um zu zeigen, wie richtig die Gedanken des Vorsitzenden Mao gewesen waren. Die Höhe des Himalaja machte ihnen aber ziemlich zu schaffen, und so benutzten sie hauptsächlich Tibetaner, die sie als Chinesen ausgaben. Und als Tibetaner mit der größten praktischen Bergerfahrung erwiesen sich die buddhistischen Mönche, die ziemlich viel Zeit in wirklich hochgelegenen, abgeschiedenen Schlupfwinkeln verbracht hatten. Acht der neun sogenannten Chinesen, die 1975 den Gipfel des Everett bezwangen, waren in Wirklichkeit Tibetaner.«
»War Kunga Norbu einer davon?«
»Nein. Obwohl er gern dabeigewesen wäre, das kann ich dir sagen. Aber er kam bei der chinesischen Expedition 1980 ziemlich weit die Nordwand hinauf. Er ist ein wirklich starker Kletterer. Und auch ein großer Guru, ein echter Heiliger.«
Kunga Norbu hatte mitbekommen, daß wir über ihn sprachen, und betrachtete mich über den Tisch. Er war klein und drahtig, hatte langes schwarzes Haar und sah sehr zäh aus. Wie viele Tibetaner wirkte er fast wie ein Indianer vom Stamm der Navajos oder Apachen. Als er mich ansah, stellte sich ein seltsames Gefühl bei mir ein: Es war, als würde er glatt durch mich hindurch in die Unendlichkeit sehen. Oder zu einem anderen, genauso weit entfernten Ort. Die Lamas haben diesen Blick zweifellos kultiviert.
»Und was macht ihr beiden also hier oben?« fragte ich; mir war etwas unbehaglich zumute.
»Wir wollen mit meinen englischen Freunden den Lingtren besteigen. Müßte toll werden. Und danach unternehmen Kunga und ich vielleicht noch was auf eigene Faust.«
Wir stellten fest, daß wir den Krug Chang geleert hatten, und bestellten noch einen. Wenn wir so weitermachten, würde man uns nicht einmal mehr mit einem Schluck Wasser in der Kurve vergleichen können.
Plötzlich sagte Kunga Norbu etwas zu Freds und deutete auf mich. »Wirklich?« sagte Freds, und sie wechselten noch ein paar Worte. Schließlich wandte Freds sich an mich. »Tja, das ist eine ziemlich große Ehre, George. Kunga möchte, daß ich dir sage, wer er wirklich ist.«
»Sehr nett von ihm«, sagte ich. Ich stellte fest, daß ich den ganzen Kopf bewegen mußte, um zu sprechen, da ich mit dem Kinn auf dem Tisch lag.
Freds senkte die Stimme, was mir unnötig vorkam, da wir die beiden einzigen Menschen im Raum waren, die Englisch sprachen. »Weißt du, was ein Tulku ist, George?«
»Ich glaub’ schon«, sagte ich. »Einige der buddhistischen Lamas hier oben sollen Reinkarnationen früherer Lamas sein, und sie werden Tulkus genannt, nicht wahr? Der Abt von Tengboche soll einer sein.«
Freds nickte. »Das stimmt.« Er schlug Kunga Norbu auf die Schulter. »Na ja, unser Kunga hier ist auch ein Tulku.«
»Ich verstehe.« Ich überlegte, wie man sich in solch einer Situation zu verhalten hatte, doch mir fiel wirklich nichts ein, und so hob ich schließlich mühsam das Kinn vom Tisch und streckte die Hand aus. Kunga Norbu ergriff und schüttelte sie mit einem bescheidenen Lächeln.
»Ich meine es ernst«, sagte Freds.
»He!« sagte ich. »Habe ich behauptet, du würdest es nicht ernst meinen?«
»Nein. Aber du glaubst es nicht, oder?«
»Ich glaube, daß du es glaubst, Freds.«
»Er ist wirklich ein Tulku! Ich meine, ich habe Beweise gesehen, wirklich! Sein Ku kongma, also seine erste Inkarnation, war Tsong Khapa, ein sehr wichtiger tibetanischer Lama, 1555 geboren. Man hat das Kloster Kum-Bum an seiner Geburtsstätte errichtet.«
Ich nickte, da ich keine Worte fand. Schließlich füllte ich unsere kleinen Gläser auf, und wir sprachen einen Toast auf Kunga Norbus Alter. Er schüttete das Chang wirklich in sich hinein, als hätte er mehrere Leben Übung darin. »So«, sagte ich und rechnete nach. »Dann ist er etwa 431.«
»Genau. Und ich kann dir sagen, er hat ein schweres Leben gehabt. Die Chinesen rissen Kum-Bum nieder, kaum, daß sie das Land übernommen hatten, und bis das Kloster dort wieder aufgebaut ist, muß Tsong Khapa ein Jünger bleiben. Verstehst du, obwohl er ein großer Tulku ist …«
»Ein großer Tulku«, wiederholte ich; mir gefiel der Klang der Worte.
»Ja, obwohl er ein großer Tulku ist, ist er immer der Jünger eines noch größeren namens Dorjee gewesen. Dorjee Lama ist so ziemlich der wichtigste überhaupt — nur der Dalai Lama steht noch über ihm —, und Dorjee ist ein strenger, strenger Guru.«
Mir fiel auf, daß Kunga Norbu bei der Erwähnung von Dorjees Namen die Stirn gerunzelt und sein Glas aufgefüllt hatte.
»Dorjee ist so hart, daß der einzige Jünger, der es je bei ihm ausgehalten hat, unser Kunga hier ist. Dorjee — wenn man sein Student werden will und ihn fragt, schlägt er einen mit einem Stock. Er macht das ein paar Jahre lang, um sich zu vergewissern, daß man ihn wirklich als Lehrer haben will. Und dann nimmt er einen echt durch die Mangel. Anscheinend benutzt er die Methoden der Ts’an-Sekte aus China, die ziemlich grob sind. Um einem den Kurzen Weg zu zeigen, schlägt er einen mit seinem Schuh auf den Kopf.«
»Jetzt, da du es erwähnst … er sieht wirklich ein wenig aus wie ein Bursche, dem man mit einem Schuh auf den Kopf geschlagen hat.«
»Was kann er dafür? Er ist seit über vierhundert Jahren Dorjees Schüler, und es ist immer dasselbe. Also hat er Dorjee gefragt, wann er ein Guru aus eigenem Recht sein würde, und Dorjee sagte, erst, wenn das Kloster auf Kungas Geburtsstätte wieder aufgebaut sei. Und er sagte, daß das niemals geschehen würde, wenn es Kunga nicht gelänge, eine … na ja, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Ich kann dir noch nicht genau sagen, was das für eine Aufgabe ist, aber glaub’ mir, sie ist schwer. Und Kunga war früher mein Guru, verstehst du, und so kam er zu mir und hat mich um Hilfe gebeten. Und deswegen bin ich also hier.«
»Ich dachte, du hättest gesagt, du würdest mit deinen englischen Freunden den Lingtren erklettern?«
»Das werde ich auch.«
Ich war mir nicht sicher, ob es am Chang oder dem Rauch lag, aber ich war etwas verwirrt. »Na ja, was auch immer. Das klingt nach einem echten Abenteuer.«
»Darauf kannst du wetten.«
Freds sprach auf Tibetanisch mit Kunga Norbu, anscheinend, um ihm zu erklären, was er mir gesagt hatte. Schließlich antwortete Kunga ausführlich.
»Kunga meint, du könntest ihm auch helfen«, sagte Freds zu mir.
»Ich glaube, ich passe«, sagte ich. »Weißt du, ich habe meine Trekking-Gruppe.«
»O ja, ich weiß. Außerdem wird es ziemlich hart werden. Aber Kunga mag dich — er sagt, du hättest den Geist von Naropa.«
Kunga nickte nachdrücklich, als er den Namen Naropa hörte, und sah mit diesem in die Ferne gerichteten Blick durch mich hindurch.
»Das freut mich zu hören«, sagte ich. »Aber ich glaube, ich passe trotzdem.«
»Wir werden ja sehen, was passiert«, sagte Freds und schaute nachdenklich drein.
2
Viele Gläser Chang später taumelten wir in die Nacht hinaus. Freds und Kunga Norbu zogen ihre Jacken an und wanderten mit einem »Gute Nacht!« und einem »Guten Morgen!« zu ihrem Zelt davon. Ich kehrte zu meiner Gruppe zurück. Es kam mir schon sehr spät vor, war aber erst halb neun.
Als ich dort stand und unser Zeltdorf betrachtete, sah ich, wie ein Licht den Trail von Lukla hinabholperte. Der Mann, der die Taschenlampe trug, kam näher — es war Laure, der Sirdar meiner Gruppe. Er hatte Kunden nach Lukla zurückgeführt und war nun auf dem Rückweg. »Laure!« rief ich leise.
»Hallo, George«, sagte er. »Warum spät jetzt?«
»Ich habe getrunken.«
»Ah.« Obwohl er die Taschenlampe auf den Boden gerichtet hatte, konnte ich leicht sein breites Grinsen ausmachen. »Gute Idee.«
»Ja, du solltest dir auch ein Chang gönnen. Du hast einen langen Tag gehabt.«
»Nicht lang.«
»Klar.« Er hatte den ganzen Tag über verärgerte Kunden nach Lukla zurückgeführt und mußte also mindestens fünfmal so weit marschiert sein wie der Rest von uns. Und jetzt kam er im Licht der Taschenlampe zurück. Dennoch war es für den Sherpa Laure Tenzing wohl kein besonders schwerer Tag gewesen. Als Führer und Yakhirte war er schon sein ganzes Leben in diesen Bergen gewandert, und seine Waden waren so dick wie meine Oberschenkel. Einmal hatten er und drei Freunde aus Jux einen Rekord aufgestellt, indem sie in vier Tagen vom Everest Base Camp nach Katmandu gewandert waren; das sind etwa dreihundert Kilometer, hauptsächlich über sehr unebenes Land. Verglichen damit war das heutige Pensum wohl eher ein Spaziergang zum nächsten Briefkasten.
Das größte Problem waren zweifellos die Kunden gewesen. Ich erkundigte mich danach, und er runzelte die Stirn. »Leute in Hotel gehen, nicht glücklich. Sehr, sehr nicht glücklich. Sie zurückfliegen Katmandu.«
»Gut, daß wir sie los sind«, sagte ich. »Warum trinkst du nicht ein Chang?«
Er lächelte und verschwand in die Dunkelheit.
Ich schaute zu den Zelten hinüber, in denen meine schlafenden Kunden lagen, und seufzte.
Bislang war es ein typischer Videotrek gewesen. Wir waren von Katmandu nach Lukla geflogen. Meine Kunden, die von Hochglanzanzeigen nach Nepal gelockt worden waren, die ihnen versprochen hatten, auf Teufel komm raus Videoaufnahmen machen zu können, hatten im Flugzeug verrückt gespielt, waren durch den Gang gelaufen, hatten sich gegenseitig mit ihren Zoom-Linsen beworfen und so weiter. Sie waren unbändig, bis sie die Landepiste von Lukla sahen, die aus der Luft aussieht wie das Spielzeugmodell einer Skischanze. Ziemlich rasch saßen sie dann auf ihren Plätzen, schnallten sich an und schauten drein, als wollten sie ihr Testament machen — alle bis auf einen molligen kleinen Burschen namens Arnold, der weiterhin wie eine Kegelkugel den Gang auf und ab rollte und sich schließlich ins Cockpit drängte, um den Piloten über die Schultern filmen zu können. »Wir landen in Lukla«, sprach er mit tiefer, betont pathetischer Stimme ins Mikro seiner Kamera, wie der Erzähler eines schlechten Reiseberichts. »Sieht unmöglich aus, aber unsere Piloten sind ganz ruhig.«
Trotz seiner Anwesenheit landeten wir sicher. Leider versuchte dann einer aus unserer Gruppe zu filmen, wie er das Flugzeug verließ, und stürzte schwer die Treppe hinunter. Als ich dann den Schaden begutachtete — ein verstauchter Knöchel —, war Arnold wieder da und beugte sich über uns, um jedes Zucken und Heulen des Opfers für die Ewigkeit festzuhalten.
Eine zweite Maschine flog den Rest unserer Gruppe ein, begleitet von Laure und meiner Assistentin Heather. Wir machten uns auf den Weg. Ein paar Stunden lang ging alles gut — der Trail ist hier gleichzeitig die Hauptverkehrsstraße der Gegend und problemlos zu bewältigen. Und die Aussicht ist ehrfurchtgebietend — das Dudh Kosi-Tal sieht aus wie ein bewaldeter Grand Canyon, nur größer. Unsere Gruppe war beeindruckt, und mehrere Kunden filmten den ganzen Tag über.
Dann senkt sich der Trail zum Ufer des Dudh Kosi, und wir erlebten eine Überraschung. Anscheinend hatte der letzte Monsun den Eisdamm eines flußaufwärts liegenden Gletschersees zerstört, und das Wasser war als alles vernichtende Flut hinabgeströmt und hatte die Brücken, Steige, Bäume, einfach alles, mit sich gerissen. So endete unsere schöne Hauptverkehrsstraße abrupt an einer Klippe über dem zerwühlten Flußbett, und die örtlichen Träger, für die der Trail eine tägliche Notwendigkeit war, hatten sich auf den Hosenboden gesetzt und einen neuen Pfad gebahnt. Sie waren dabei ziemlich clever vorgegangen, doch es gab wirklich keine gute Alternative zu der alten Strecke; und so wand sich der neue Trail über verstreute weiße Felsbrocken im Flußbett, führte über unstabile neue Sandbänke und hob und senkte sich über schlammige Hänge, die man auf den dicht bewaldeten Felswänden freigehauen hatte. Es war eine schwierige Strecke, und selbst erfahrene Trekker hatten ihre Probleme damit.
Unsere Gruppe war entsetzt. Davon hatte nichts in den Anzeigen gestanden.
Die Träger liefen barfuß zur nächsten Teestube voraus, und die Kunden blieben im Schlamm stecken. Sie rutschten aus und heulten. Mehr als einmal wurde die Höhenkrankheit erwähnt, obwohl wir in Wirklichkeit nicht viel höher als Denver waren. Heather und ich liefen hin und her und ermutigten die Müden. Ich trug schließlich drei Videokameras. Laure trug neun.
Als wir schließlich die erste neue Brücke erreichten, sahen wir aus wie beim Rückzug von Moskau. Diese Brücken sind ziemlich hübsche Beispiele hinterwäldlerischer Baukunst; da es in dieser Gegend keine Baumstämme gibt, die lang genug sind, um den Fluß zu überbrücken, nehmen sie vier Stämme, schieben sie in den Fluß und verankern sie mit einem großen Stapel runder Steine. Dann schieben sie vier weitere Stämme von der anderen Seite heran, bis ihre Enden auf denen der ersten vier liegen. Es funktioniert, aber die Brücken wirken nicht gerade vertrauenseinflößend.
Unsere Gruppe musterte diese erste Brücke furchtsam. Arnold tauchte hinter uns auf und kaute auf einer nicht angezündeten Zigarre, während er die Szene filmte. »Die Todesbrücke«, sprach er ins Mikro seiner Kamera.
»Arnold, bitte«, sagte ich. »Verpiß dich.«
Er ging zu dem grauen Gletscherwasser des Flusses hinab. »He, George, glaubst du, ich könnte ins Wasser, um die Überquerung besser filmen zu können?«
»NEIN!« Ich stand schnell auf. »Ein Schritt in den Fluß, und du ertrinkst. Sieh dir die Fluten doch mal an!«
»Na schön, schon gut.«
Jetzt starrte der Rest der Gruppe mich entsetzt an, als sei ihr nicht schon auf den ersten Blick klar gewesen, daß ein Sturz in den Dudh Kosi in der Tat ein sehr fataler Fehler sein würde. Ziemlich viele von ihnen krochen schließlich auf Händen und Knien über die Brücke. Arnold hielt sie alle für die Nachwelt fest und filmte seine eigene Überquerung, indem er sich immer wieder im Kreis drehte, wobei ich jedesmal zusammenzuckte. Insgeheim verfluchte ich ihn; ich war mir ziemlich sicher, daß er genau gewußt hatte, wie gefährlich der Fluß war, und nur sichergehen wollte, daß auch alle anderen es erfuhren. Und kurz darauf — bei der nächsten Brücke, um genau zu sein — forderten die ersten Kunden, nach Lukla zurückgebracht zu werden. Nach Katmandu. Nach San Francisco.
Ich seufzte, als ich daran dachte. Und daran, daß das nur der Anfang war. Eben ein typischer Want To Take You Higher Ltd.-Videotrek. Plus Arnold.
3
Früh am nächsten Morgen erlebte ich Arnold wieder in Aktion, als ich sehr verkatert im Herzhäuschen, dem hinter dem Teehaus der Trekker liegenden Klosett, über dem ungesund feuchten Loch im Boden hockte. Ich hatte gerade mein Geschäft dort erledigt, als ich aufschaute und das große Glasauge einer Zoomlinse sah, das mich über die hölzerne Tür hinweg betrachtete.
»Nein, Arnold!« rief ich, während ich versuchte, meine Hand auf die Linse zu legen und gleichzeitig die Hosen hochzuziehen.
»He, ich will doch nur etwas Lokalkolorit reinbringen«, sagte Arnold und trat zurück. »Weißt du, die Leute sollen sehen, wie es wirklich ist, alle Einzelheiten und so weiter, und diese Klosetts sind schon wirklich toll. Exotisch.«
Ich bedachte ihn mit einem finsteren Stirnrunzeln. »Dann hättest du über Jiri anreisen sollen. In den Tieflanddörfern gibt es überhaupt keine Scheißhäuser.«
Seine Augen wurden rund, und er schob eine nicht angezündete Zigarre vom einen Mundwinkel in den anderen. »Und was macht man denn da?«
»Na ja, man geht einfach raus und sieht sich um. Sucht sich ein schönes Fleckchen aus. Da haben sie meistens ein Scheißfeld unten am Fluß. Richtig exotisch.«
Er lachte. »Du meinst, überall Haufen?«
»Ja, sowas in der Art.«
»Klingt ja toll! Vielleicht marschiere ich lieber zurück, anstatt zu fliegen.«
Ich musterte ihn und rümpfte die Nase. »Ein ernsthafter Filmemacher, was, Arnold?«
»Oh, ja. Hast du noch nie von mir gehört? Arnold McConnell? Ich drehe Abenteuerfilme für die PBS. Und manchmal für die Fremdenverkehrsämter der Skigebiete, Videoverleihe und so weiter. Skifahren, Hanggleiten, Kajakfahren, Parachuting, Bergsteigen, Skateboardfahren — das hab’ ich alles schon gemacht. Hast du nie Der Mann, der den Sambesi hinabschwamm gesehen? Nein? Ach, der gilt schon als Klassiker. Einer meiner besten.«
Also hatte er gewußt, wie gefährlich der Dudh Kosi war. Ich sah ihn verächtlich an. Schwer zu glauben, daß er Abenteuerfilme drehte; er sah eher aus wie die Art von Hollywood-Produzent, über die man sich schlechte Witze erzählt. »Also drehst du wirklich einen Film über diesen Trek?«
»Ja, klar. Immer bei der Arbeit, höre nie auf damit. Bin ein Workaholic.«
»Brauchst du keine größere Crew?«
»Na, normalerweise schon, aber das hier ist eine andere Sache, einer meiner ›Persönlichen Tagebuch-Filme‹, wie ich sie nenne. Ich hab’ ein paar an die PBS verkauft. Mache alle Arbeit allein. Das ist eben meine Version des Solokletterns.«
»Schön. Aber schneid’ den Teil raus, wie ich scheiße, ja?«
»Klar, mach’ dir keine Sorgen. Ich muß nur alles aufs Band kriegen, was ich kann, verstehst du, damit ich hinterher möglichst viel Material zur Verfügung habe. Und ich weiß mit allem etwas anzufangen. Deshalb habe ich auch diese Linse. Nur die neueste Ausrüstung für mich. Du wirst nicht glauben, was ich alles für Sachen habe.«
»Ich glaub’s dir.«
Er kaute auf seiner Zigarre. »Nenn’ mich einfach Mr. Abenteuer.«
»Werd’ ich.«
4
Ich sah Freds und Kunga Norbu in Namche Bazaar nicht mehr und vermutete, daß sie schon mit Freds’ englischen Freunden aufgebrochen waren; wahrscheinlich würde ich sie erst in der Nähe ihres Basislagers wiedersehen, denn ich wollte mit meiner Gruppe ein paar Tage in Namche bleiben, damit sie sich akklimatisieren und die Stadt genießen konnte. Namche ist die Hauptstadt der Sherpas, und eine dramatisch gelegenere Stadt kann man sich kaum vorstellen; sie kauert auf einem Vorgebirge über dem Zusammenfluß des Dudh Kosi und des Bhote Kosi, und die Flüsse liegen etwa anderthalb Kilometer tiefer in steilen grünen Schluchten, während weiße Gipfel sich überall um sie herum fast zwei Kilometer hoch auftürmen. Die Stadt selbst ist ein hufeisenförmiger Ring aus steinernen Gebäuden und steinernen Straßen, auf denen sich Sherpas, Trekker, Bergsteiger und Händler drängen, die zum wöchentlichen Markt kommen.
Hier kann man einiges erleben, und ich war vollauf beschäftigt; ich vergaß Freds und die Engländer völlig und war daher ziemlich überrascht, als ich ihnen in Pheriche über den Weg lief, einem Hochgebirgsdorf der Sherpas.
Die meisten dieser hochgelegenen Dörfer sind nur im Sommer bewohnt; die Einheimischen pflanzen dort Kartoffeln an und weiden Yaks. Pheriche jedoch liegt an der Trekkingroute zum Everest, und so ist es fast das ganze Jahr über bewohnt, und man hat dort ein paar Lodges errichtet und die einzige Hilfsstation der Himalayan Rescue Association. Es sieht noch immer wie ein Sommerdorf aus: niedrige Felswände trennen Kartoffelfelder voneinander ab, und ein paar Steinhäuser mit Schindeldächern sowie die Lodges und Baracke der Hilfsstation mit ihrem Blechdach. Das alles drängt sich am Ende eines flachen Gletschertals zusammen, auf einer einhundertundfünfzig Meter hohen Seitenmoräne. Ein Fluß schlängelt sich daran vorbei, und der Boden ist mit Gräsern und dem hellen Herbstrot der Berberitzensträucher bedeckt. Auf allen Seiten türmen sich die phantastischen weißen Spitzen einiger der eindrucksvollsten Gipfel der Erde auf — Ama Dablam, Taboche, Tramserku, Kang Taiga; und alles in allem ist es schon ein toller Ort. Meine Kunden überschlugen sich, um alles zu filmen.
Wir errichteten unser Zeltdorf auf einem unbenutzten Kartoffelfeld, und nach dem Abendessen taten Laure und ich uns dadurch, um im Himalaya Hotel ein paar Chang zu trinken. Ich betrat die kleine Küche der Lodge und hörte Freds »He, George!« rufen. Er saß mit Kunga Norbu und vier Touristen zusammen; wir gesellten uns zu ihnen und drängten uns um einen kleinen Tisch. »Das sind die Freunde, mit denen wir klettern.«
Er stellte sie vor, und wir schüttelten uns die Hände. Trevor war ein großer, schlanker Bursche mit einer Brille mit runden Gläsern und einem ziemlich irren Grinsen. »Mad Tom«, wie Freds ihn nannte, war klein, hatte einen Lockenkopf und sah ganz und gar nicht verrückt aus, obwohl etwas an seiner ruhigen Art einen schon glauben machen konnte, daß er es war. John war klein und kompakt, mit einem schon angegrauten Bart und einem kräftigen Händedruck. Und Marion war eine große und ziemlich attraktive Frau, obwohl sie wahrscheinlich errötet wäre oder einen freundlich geknufft hätte, wenn man es ihr gesagt hätte — attraktiv auf eine grobe, ungestüme Art, mit einem starken, strengen Gesicht und dichtem braunem, zurückgekämmtem und geflochtenem Haar. Sie waren Engländer, was man auch sofort an ihrem Akzent merkte: Marion und Trevor ziemlich elegant — Privatschule —, und John und Mad Tom sehr breit und aus Nordengland.
Wir bestellten Chang, und sie erzählten mir von ihrer Kletterpartie. Der Lingtren, ein steiler Gipfel zwischen dem Pumori und dem westlichen Ausläufer des Himalaja, ist ein ziemliches Stück Arbeit, von welcher Seite man ihn auch angeht, und sie waren auf ihre eigene Art ganz aus dem Häuschen: »War schon ein ganz schöner Brocken, um die Wahrheit zu sagen«, meinte Trevor fröhlich.
Wenn englische Bergsteiger über das Bergsteigen sprechen, muß man wissen, wie man ihre Worte zu übersetzen hat. »Ein ganz schöner Brocken« bedeutet: meidet den Berg.
»Ich meine, wir sollten statt dessen den Pumori ersteigen«, sagte Marion. »Der Lingtren ist ein perfekter Hügel.«
»Also wirklich, Marion.«
»Kommt sowieso nicht gegen den Preis für den Lingtren an«, sagte John.
Er bezog sich auf die Gebühr, die die nepalesische Regierung von den Bergsteigern für das Recht erhebt, den Gipfel zu besteigen. Diese Gebühren richten sich nach der Höhe des zu besteigenden Gipfels — die wirklich hohen Berge sind überaus kostspielig. Sie berechnet einem für den Everest zum Beispiel über fünftausend Dollar, und trotzdem wetteifern jede Menge Leute darum, auf die lange Warteliste zu kommen. Aber einige der schwierigsten Gipfel in Nepal sind im Vergleich zu den Riesen nicht besonders hoch und kommen ziemlich billig. Anscheinend gehörte der Lingtren dazu.
Wir beobachteten die Sherpani, die in der Küche der Lodge Abendessen für fünfzig Personen kochte, und zwar unter den starren Blicken der Gäste, die hungrig jede ihrer Bewegungen verfolgten. Dazu hatte sie einen kleinen Holzofen zur Verfügung (mit Kamin, Gott sei dank), einen Berg Kartoffeln, Nudeln, Reis, ein paar Eier und Kohlköpfe und mehrere changtrunkene Träger als Helfer, die abwechselnd Geschirr spülten oder große Brocken Yakmist für das Feuer zerbrachen. Auf den ersten Blick eine schwierige Aufgabe, doch die Sherpani war ganz gelassen: sie kochte die ganze Liste der Bestellungen aus dem Gedächtnis, schnitt Kartoffeln in Scheiben und warf sie in eine Pfanne, legte Holz nach, warf zwanzig Pfund Nudeln durch die Luft, als seien sie nur ein Pfannkuchen — und das alles mit der Sicherheit und Großtuerei eines erfahrenen Jongleurs. Sie hatte eine geniale Begabung.
Als zwei Stunden später die Gäste, die die Gerichte bestellt hatten, die in ihrer strengen Reihenfolge zum Schluß kamen, ihre Kohlomelettes auf Pommes frites bekamen, leerte sich die Küche bereits; die ersten Gäste gingen zu Bett. Wir anderen machten es uns bei mehr Chang und Geplauder gemütlich.
Dann kam ein Trekker in die Küche zurück, damit er sein Kurzwellenradio hören konnte, ohne die Schläfer im einzigen Schlafsaal der Lodge zu stören. Er sagte, er müsse die Nachrichten hören. Wir alle starrten ihn ungläubig an. »Ich muß wissen, was der Dollar macht«, erklärte er. »Habt ihr gewußt, daß er letzte Woche um acht Prozent gefallen ist?«
Man trifft alle möglichen Leute in Nepal.
In der Tat ist es im Himalaja sehr interessant, die Kurzwelle zu hören, denn je nachdem, wie es um die Ionosphäre steht, bekommt man fast alle Sender herein. An diesem Abend hörten wir zum Beispiel die Stimme des Syrischen Volkes und ein paar Popsängerinnen aus Bombay, die die Träger wirklich anmachten. Dann schaltete der Radiobesitzer die BBC-Weltnachrichten ein, was nicht ungewöhnlich war — sie kamen vielleicht aus Hongkong, Singapur, Kairo oder sogar London selbst.
Im statischen Rauschen war die gebildete Stimme des Sprechers kaum verständlich. »… britische Everest-Expedition von 1986 ist jetzt auf dem Rongbuk-Gletscher in Tibet und wird im Verlauf der beiden nächsten Monate der historischen Route folgen, die die Expeditionen der zwanziger und dreißiger Jahre eingeschlagen haben. Unser Korrespondent der Expedition berichtet …« Und dann war die Stimme kaum noch verständlich und ertrank im Rauschen: «… wichtigstes Ziel der Expedition, die Leichen von Mallory und Irvine, die 1924 zum letzten Mal in der Nähe des Gipfels gesehen wurden … knister, summ … Chancen beträchtlich verbessert durch Gespräche mit einem Teilnehmer der chinesischen Expedition, die angeblich 1980 auf der Nordwand eine Leiche gesehen hat … bzzzzkrkrkr! … Beschreibung des Fundortes sssssssss … Schneegrenze dieses Jahr sehr tief, und alle Betroffenen halten die Erfolgsaussichten für sssskrkssss.« Die Stimme ging in einem ohrenbetäubenden Rauschen unter.
Trevor musterte uns mit gerunzelter Stirn. »Habe ich richtig gehört, daß sie nach Mallorys und Irvines Leichen suchen wollen?«
Ein Ausdruck tiefen Schreckens legte sich auf Mad Toms Gesicht. Marion rümpfte die Nase, als ob das Chang sich in tibetanischen Tee verwandelt hätte. »Ich kann es nicht glauben.«
Ich wußte es damals noch nicht, aber das erwies sich für Freds als unerwartete Gelegenheit, seinen Plan vorzeitig in die Tat umzusetzen. »Habt ihr nicht davon gehört?« sagte er. »Kunga Norbu ist genau wegen der Besteigung hier, von der sie gesprochen haben, wegen der, die 1980 auf der Nordwand eine Leiche gesehen hat.«
»Ach ja?« sagten wir alle.
»Ja, ehrlich. Kunga hat an der chinesischen Expedition 1980 zum Nordsattel teilgenommen und suchte nach einem direkten Weg zur Nordwand, als er eine Leiche sah.« Freds sprach auf Tibetanisch mit Kunga Norbu, und Kunga nickte und antwortete ausführlich. Freds übersetzte für ihn: »Er sagt, es sei ein Abendländer gewesen, und er hätte eindeutig schon lange dort gelegen. Hier, er sagt, er kann es auch auf einem Foto zeigen …« Freds holte seine Brieftasche hervor und zog ein Papierknäuel hervor. Auseinandergefaltet erwies es sich als mitgenommenes Schwarzweiß-Foto des Everest, von der tibetanischen Seite aus gesehen. Kunga Norbu betrachtete es lange, sprach mit Freds darüber, ließ sich — dann von Freds einen Kugelschreiber geben und malte sorgfältig einen Kreis auf das Foto.
»Warum hat er die halbe Nordwand eingekreist?« fragte John. »Das ist doch völlig sinnlos.«
»Nee«, sagte Freds. »Sieh doch, es ist ein ganz kleiner Kreis.«
»Es ist auch ein kleines Foto, oder?«
»Na ja, er kann die Stelle genau beschreiben — sie ist da oben auf der Spitze des Schwarzen Rings. Auf jeden Fall ist es jemandem gelungen, eine Expedition zusammenzustellen, die nach den Leichen suchen soll. Nun ist Kunga letztes Jahr nach Nepal geflohen, so daß diese Expedition mit Informationen aus zweiter Hand von seinen Kletterfreunden auskommen muß. Aber das könnte reichen.«
»Und wenn sie die Leichen finden?«
»Ich glaube, sie haben vor, sie mit runterzunehmen, nach London zu verschiffen und in der Winchester Cathedral zu begraben.«
Die Engländer starrten ihn an. »Du meinst, Westminster Abbey?« fragte Trevor.
»Ach ja, richtig, die beiden verwechsle ich immer. Auf jeden Fall haben sie das vor, und sie wollen einen Film daraus machen.«
Ich stöhnte bei dem Gedanken auf. Noch mehr Video.
Die vier Engländer stöhnten lauter als ich. »Das ist wirklich abscheulich«, sagte Marion.
»Widerlich«, pflichteten John und Mad Tom ihr bei.
»Eine Travestie, nicht wahr?« sagte Trevor. »Ich meine, wenn überhaupt jemand dort oben hingehört, dann diese beiden. Das ist nichts anderes als Grabschändung!«
Und seine drei Gefährten nickten. Auf einer Ebene scherzten sie und täuschten ihren Zorn nur vor; doch darunter meinten sie es todernst. Sie meinten, was sie sagten.
5
Um zu verstehen, wieso die Vorstellung sie dermaßen aufbrachte, muß man wissen, welche Bedeutung die Geschichte von Mallory und Irvine für die englische Seele hat. Das Bergsteigen war dort immer viel wichtiger als in Amerika — man könnte sagen, daß die Engländer diesen Sport in viktorianischen Zeiten erfunden und seitdem immer wieder hervorragende Leistungen darin gebracht haben, sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg, als bei ihnen ziemlich viel auseinanderfiel. Man könnte sagen, daß Bergsteigen der Rolls Royce des britischen Sports ist. Whymper, Hillary, das brillante Team, das in den siebziger Jahren mit Bonington kletterte: das alles sind Volkshelden.
Aber Mallory und Irvine sind die größten überhaupt. Damals in den zwanziger und dreißiger Jahren hatten die Engländer einen Alleinanspruch auf den Everest, da Nepal für Ausländer verschlossen war und Tibet für alle bis auf die Briten, die sich 1904 mit Younghusbands Feldzug ins Land gedrängt hatten. Also war der Berg ihr privater Spielplatz, und während jener Jahre machten sie vier oder fünf Versuche, die alle scheiterten, was durchaus verständlich ist: sie waren ausgerüstet wie die Pfadfinder, mußten sich an Ort und Stelle die Höhentechnik aneignen und hatten schreckliches Pech mit dem Wetter.
Der Versuch, der einem Erfolg am nächsten kam, fand 1924 statt. Mallory, schon berühmt von zwei vorherigen Versuchen, war der Expeditionsleiter. Wie Sie vielleicht wissen, war er der Bursche, der antwortete: »Weil er da ist!«, als man ihn fragte, warum jemand das Ding besteigen wollte. Das ist entweder eine sehr tiefgründige oder eine sehr dumme Antwort, je nachdem, was man von Mallory hält. Sie können sich die Ihnen genehme Interpretation aussuchen: Der Bursche ist in Grund und Boden psychoanalysiert worden. Auf jeden Fall wurden er und sein Partner Irvine zuletzt gesehen, als sie sich kaum vierhundert Meter unter dem Gipfel befanden — und um ein Uhr mittags an einem Tag, an dem abgesehen von einem kurzen Sturm und Nebel, der den Gipfel vor den Blicken der Beobachter unten verbarg, gutes Wetter herrschte. Also haben sie es entweder geschafft oder auch nicht; aber irgend etwas ging irgendwo auf dem Weg schief, und sie wurden nie wieder gesehen.
Eine glorreiche Niederlage, ein unergründliches Geheimnis: das ist die Art von Geschichte, die die Engländer einfach lieben, wie wir alle anderen auch. Die ganzen Internatstugenden in eine heroische Erzählung eingehüllt — kein Schriftsteller könnte sie sich besser ersinnen. Bis zum heutigen Tag findet diese Geschichte in England ungebrochenes Interesse, und das gilt erst recht für die Bergsteigergemeinschaft, die mit ihr aufwuchs und noch immer in Zeitschriftenartikeln, Stammtischgesprächen und so weiter zahlreiche Spekulationen über das Schicksal der beiden Männer betreibt. Sie lieben diese Geschichte einfach.
Dort hinaufzuklettern, die Leichen zu suchen, dem Geheimnis ein Ende zu bereiten und die Leichen nach England zu schaffen… Jetzt wissen Sie, warum das meinen Trinkgenossen an diesem Abend wie ein Sakrileg vorkam. Es war wieder so ein moderner Werbegag, ein von einer Werbeagentur ersonnener Plan, Geld zu scheffeln — eine Entweihung des Großen Geheimnisses. Es erinnerte mich in der Tat ein wenig an Videotrekking. Nur noch schlimmer. Also fühlte ich in gewisser Weise mit ihnen.
6
Ich versuchte, mir einen Themenwechsel einfallen zu lassen, um die Engländer abzulenken. Doch Freds schien entschlossen, ihrem Trübsal noch Zunder zu geben. Er stach mit dem Finger auf das zusammengefaltete Wrack eines Fotos ein. »Wißt ihr, was ihr tun solltet?« sagte er leise zu ihnen. »Ihr habt gesagt, ihr wolltet den Pumori besteigen? Mann, Scheiße, verzieht euch lieber in die andere Richtung, seid vor der anderen Expedition da und versteckt den alten Mallory. Ich meine, hier habt ihr den eigentlichen Augenzeugen, der euch zu ihm führen könnte! Unglaublich! Ihr könntet Mallory im Eis und Schnee vergraben und euch dann wieder runterschleichen! Wenn ihr das tut, werden sie ihn nie finden!«
Alle Engländer starrten Freds aus weit aufgerissenen Augen an. Dann sahen sie einander an und senkten die Köpfe tief auf den Tisch. Ihre Stimmen wurden leise. »Das ist ein Genie«, flüsterte Trevor.
»Äh, nein«, warnte ich sie. »Er ist kein Genie.« Laure schüttelte den Kopf. Selbst Kunga Norbu schaute zweifelnd drein.
»Was ist mit dem Lho La?« fragte John. »Müssen wir den nicht erklettern?«
»Ein Kinderspiel«, sagte Freds sofort.
»Nein«, protestierte Laure. »Kein Kinderspiel! Paß! Sehr steiler Paß!«
»Ein Kinderspiel«, beharrte Freds. »Ich habe ihn vor ein paar Jahren mit dieser Gruppe erklettert, die die direkte Westroute suchte. Wenn man ihn bestiegen hat, schlägt man sich einfach auf den Westsattel und hat dann direkt zur Linken die ganze Nordwand vor sich.«
»Freds«, sagte ich und versuchte ihm klarzumachen, daß er seine Gefährten nicht zu solch einer gefährlichen und überdies illegalen Kletterpartie verleiten sollte. »Ihr würdet viel mehr Hilfe bei den Hochlagern brauchen, als ihr habt. Dieser Kreis hier ist verdammt hoch oben auf dem Berg.«
»Stimmt schon«, sagte Freds augenblicklich. »Ziemlich hoch oben. Verdammt hoch oben. Man kann nicht mehr viel höher kommen.«
Natürlich hätte ich wissen müssen, daß so eine Bemerkung Leute wie die Engländer nur noch zusätzlich anspornte.
»Man müßte es machen wie damals Woody Sayres«, fuhr Freds fort. »Das war 1962, oder? Sie brachten Sherpas dazu, ihnen über Cho Oyo auf den Nup La zu helfen, und schlugen sich dann zum Everest, wo sie den Gyachung Kang besteigen wollten. Sie nahmen ein einziges Lager den ganzen Weg zum Everest mit hinauf und kehrten auf dieselbe Art zurück. Sie waren nur zu viert und hätten ihn fast erklettert. Und der Nup La ist dreißig Kilometer weiter vom Everest entfernt als der Lho La. Der Lho La liegt praktisch direkt darunter.«
Mad Tom schob seine Brille die Nase hinauf, zog einen Kugelschreiber hervor und stellte auf dem Tisch Berechnungen an. Marion nickte. Trevor füllte all unsere Gläser mit Chang. John sah über Mad Toms Schulter und murmelte ihm etwas zu; anscheinend waren sie für die Vorräte verantwortlich.
Trevor hob sein Glas. »Na schön«, sagte er. »Machen wir mit?«
Sie alle hoben ihre Gläser. »Wir machen mit.«
Sie toasteten ihrem Plan zu, und ich starrte sie entsetzt an, als ich hörte, wie die Tür knarrte, und sah, wer die Küche verließ. »He!«
Ich sprang auf und zerrte Arnold McConnell in den Raum zurück. »Was hast du hier zu suchen?«
Arnold versteckte etwas hinter seinem Rücken. »Gar nichts. Weißt du, ich wollte mir nur mein abendliches Glas Milchteeholen …«
»Er ist es!« rief Marion. Sie griff hinter Arnold und zog seine Kamera hinter seinem Rücken hervor; er versuchte, sie festzuhalten, doch Marion war stärker als er.
»Spionierst mich wieder aus, was? Filmst uns aus irgendeiner dunklen Ecke?«
»Nein, nein«, sagte Arnold. »Ich kann im Dunkeln doch gar nicht filmen.«
»Filmt in Zelt«, sagte Laure prompt. »Nachts.«
Arnold funkelte ihn an.
»Hör mal, Arnold«, sagte ich. »Weißt du, wir haben hier nur einen draufgemacht, ein kleines privates Gespräch über ein paar Bechern Chang. Nichts Ernstes.«
»Oh, ich weiß«, versicherte Arnold mir. »Ich weiß.«
Marion stand auf und sah auf Arnold hinab. Sie ergaben ein ulkiges Paar — sie so groß und schlank, er so klein und stämmig. Marion drückte auf ein paar Knöpfe auf der Kamera, bis die Videokassette hinaussprang, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Sie konnte einen wirklich furchterregend anfunkeln. »Das ist wohl derselbe Film wie heute morgen, als du mich aufgenommen hast, wie ich geduscht habe, oder?« Sie sah uns an. »Ich war in der kleinen Duschkabine, die sie da aufgebaut haben, und der Blechkübel mit dem heißen Wasser war irgendwie verklemmt. Ich mußte die Tür einen Spalt öffnen, um hinaufzugreifen und ihn zu lösen, und da merkte ich plötzlich, daß dieser Perverse mich filmte!« Sie lachte wütend. »Ich wette, du warst ziemlich zufrieden mit dem Material, was, du Vojeur?«
»Ich wollte gerade aufbrechen, um Yaks zu filmen«, erklärte Arnold schnell und sah mit einem bewundernden Blick zu Marion hinauf. »Dann standest du vor mir, und was sollte ich tun? Ich bin Filmemacher, ich filme schöne Dinge. Ich könnte dich in den Staaten zu einem Star machen«, sagte er ernst. »Du bist wahrscheinlich die schönste Bergsteigerin auf der ganzen Welt.«
»Und das bei der Konkurrenz«, warf Mad Tom ein.
Ich behielt recht, was Marions Reaktion auf ein derartiges Kompliment betraf: Sie errötete bis zu den Haarwurzeln und überlegte, ob sie ihm einen Knuff versetzen sollte — und hätte es wohl auch getan, wenn sie allein gewesen wären.
»… Abenteuerfilme in den Staaten, für die PBS und die Skigebiete«, fuhr Arnold fort, kaute auf seiner Zigarre und rollte mit den Augen, als Marion mit der Kassette zum Ofen ging.
Die Sherpani hielt sie zurück. »Stinken«, sagte sie.
Marion nickte und nahm die Videokassette in beide Hände. Ihre Unterarme spannten sich, und man konnte plötzlich jeden Muskel sehen. Und da waren ziemlich viele; sie sahen aus wie dünne gebündelte Drähte unter der Haut. Wir alle sahen hin, und instinktiv hob Arnold die Kamera auf die Schulter, bevor ihm einfiel, daß sie ja leer war. Diese Tatsache ließ ihn zusammenzucken, und er fummelte in seiner Jackentasche nach einem Ersatz, als die Kassette in der Mitte zerbrach und das Videoband herausfiel. Marion gab sie der Sherpani, die sie grinsend in eine Kiste mit Kartoffelschalen fallen ließ.
Wir alle sahen Arnold an. Er kaute auf seiner Zigarre und zuckte die Achseln. »Auf die Art kann ich dich nicht zum Star machen«, sagte er und bedachte Marion mit einem lüsternen Blick. »Wirklich, du solltest mir eine Chance geben. Du wärest toll.«
»Ich würde es vorziehen, wenn du jetzt gehst«, sagte Marion zu ihm und deutete auf die Tür.
Arnold ging.
»Dieser Bursche könnte uns Ärger machen«, sagte Freds.
7
Freds sollte recht behalten.
Aber Arnold war nicht die einzige Ursache für Ärger. Meines Erachtens benahm sich Freds selbst etwas eigenartig. Doch wenn ich an die verschiedenen Schrullen dachte, die er in letzter Zeit an den Tag legte — seine Erklärung, sein Freund Kunga Norbu sei ein Tulku, und nun sein plötzliches Eintreten für die Rettet-Mallorys-Leiche-Kampagne —, konnte ich es mir einfach nicht zusammenreimen. Es ergab keinen Sinn.
Als Freds’ Trupp und meine Trekkinggruppe also am selben Morgen von Pheriche talaufwärts aufbrachen, ging ich eine Weile mit Freds zusammen. Ich wollte ihm einige Fragen stellen. Doch es waren eine Menge Leute auf dem Trail, und es war nicht einfach, einen Augenblick unter vier Augen mit ihm sprechen zu können.
Als Eröffnung sagte ich: »So, jetzt hast du also eine Frau in deinem Team.«
»Ja, Marion ist toll. Sie ist wahrscheinlich die beste Kletterin von uns allen. Und unglaublich stark. Du kennst doch diese Wände in Hallen, die sie in England zum Üben haben?«
»Nein.«
»Na ja, das Wetter ist so schlecht da, und die Kletterer sind so fanatisch, daß sie diese zehn oder zwölf Meter hohen Wände in Turnhallen aufgebaut haben, mit Mörtel überzogen und kleinen Handgriffen.« Er lachte. »Es sieht scheußlich aus — kleine alte Turnhallen mit schlechter Beleuchtung und ohne Heizung, und die ganzen Leute ziehen sich da Betonwände hoch, als sei das eine neue Foltermethode … Auf jeden Fall war ich mal in so einer Halle und hab’ mich zu einem Wettrennen mit Marion überreden lassen, die beiden steilsten Wände hinauf. Die Leute wetteten auf uns, und die Regel besagte, daß einer von uns ganz nach oben mußte, wollten die Leute die Wetteinsätze kassieren. Aber wegen einem Loch in der Decke war die Wand feucht, und ich kam etwa bis zur Hälfte hinauf. Also hatte sie gewonnen, aber wollten die anderen den Wetteinsatz kassieren, mußte sie ganz hinauf. Mit dem Leck war es wirklich unmöglich, aber alle, die auf sie gewettet hatten, riefen ihr zu, sie sollte es versuchen, und so biß sie einfach die Zähne zusammen und fing an, diese Bewegungen zu machen, Mann« — Freds ahmte sie mit der Hand in der Luft nach, während wir marschierten — »und sie machte sie ganz langsam, damit sie nicht runterfiel. Sie hing an den Fingerspitzen und Zehen da oben, und ich schwöre bei Gott, sie muß drei Stunden da gehangen haben. Alle anderen hörten mit dem Klettern auf, um ihr zuzusehen. Ein paar Jungs gingen nach Hause, ein paar baten sie, wieder runterzukommen, ein paar hatten Tränen in den Augen stehen. Schließlich kam sie dann doch noch ganz rauf und kroch zu der Leiter, um wieder runterzukommen, und die Leute haben sie auf die Schulter genommen. Sie hätten sie fast zur Königin gekrönt. Eigentlich ist sie schon Königin, zumindest, was die englischen Kletterer betrifft — wenn die echte käme, und Marion wäre da, würde niemand auf Lisbeth achten.«
Dann drängte sich Arnold zwischen uns und schaute verschwörerisch drein. »Ich halte diesen Mallory-Plan für eine tolle Idee«, flüsterte er uns mit zusammengebissenen Zähnen zu. »Ich stehe völlig hinter euch, und das wird einen tollen Film geben.«
»Du hast was übersehen«, sagte ich zu ihm.
»Wir besteigen nur den Lingtren«, sagte Freds zu ihm.
Arnold runzelte die Stirn, ließ das Kinn auf die Brust fallen und kaute auf seiner Zigarre. Stirnrunzelnd ging Freds schneller, um seine Gruppe einzuholen, und sie verschwanden bald vor uns außer Sicht. Also hatte ich meine Chance vertan, mit ihm zu sprechen.
Wir kamen zum oberen Ende des Pheriche-Tals, wandten uns nach rechts und stiegen zu einem noch höher gelegenen hinauf. Das war das Tal des Khumbu-Gletschers, einer massiven Eisfläche, bedeckt mit einem Chaos aus grauem Geröll und milchigblauen Schmelzwasserteichen. Wir zogen am Rande des Gletschers entlang und folgten einem Weg über seine Seitenmoräne hinauf nach Lobuche, einem Ort, der aus drei Teehäusern und einem Zeltplatz besteht. Am nächsten Tag marschierten wir talaufwärts nach Gorak Shep.
Nun ist Gorak Shep (›Tote Krähe‹) nicht der Ort, den man auf Plakaten in Reisebüros sieht. Es liegt etwa fünftausendeinhundert Meter hoch, und da oben hat das Pflanzenleben so ziemlich aufgegeben. Der Ort besteht aus zwei zerlumpten kleinen Teehäusern unter einem monströsen Geröllhügel, direkt neben einem grauen Gletscherteich, und sieht alles in allem aus wie die Rückstände einer außergewöhnlich großen Kiesgrube.
Doch Gorak Shep hat Berge. Hohe, schneebedeckte Berge auf allen Seiten. Wie hoch? Nun ja, die Nuptse-Wand erhebt sich zum Beispiel volle zweitausend Meter über Gorak Shep. Wir sahen eine Lawine, die unter ohrenbetäubendem Donnern einen winzigen Teil dieser Wand hinabglitt und etwa doppelt so hoch wie das World Trade Center war und trotzdem winzig wirkte.
Kameras können diesen gewaltigen Anblick niemals einfangen, doch man muß es unwillkürlich versuchen, und meine Gruppe versuchte es in den Tagen, da wir dort kampierten, auf Teufel komm raus. Diejenigen, die gut mit der Höhe fertig wurden, trotteten sogar auf den Gipfel des Kala Pattar (»Schwarzer Hügel«) hinauf, einem beliebten Aussichtspunkt mit hervorragendem Blick auf die Südwestwand des Everest. Am darauffolgenden Tag führten Heather und Laure den größten Teil dieser Leute den Gletscher zum Everest Base Camp hinauf, während sich die anderen von uns ausruhten. Das Everest-Basislager, das das indische Heer am Anfang der Saison aufgebaut hatte, war praktisch ein Zeltdorf wie das unsere, aber auf dem Weg dorthin gibt es einige schöne Eisnadeln und -türme zu sehen, und als die Kunden zurückkamen, machten sie einen zufriedenen Eindruck.
Also war auch ich zufrieden. Niemandem hatte die Höhenkrankheit übermäßig zugesetzt, und wir würden uns am nächsten Morgen auf den Rückweg machen. Ich fühlte mich hervorragend, saß am Spätnachmittag auf dem Hügel über unseren Zelten und tat einfach nichts.
Doch dann kam Laure den Trail vom Base Camp hinabgeeilt, und als er mich sah, kam er direkt zu mir. »George, George«, rief er dabei lauthals.
Als er mich erreicht hatte, stand ich auf. »Was ist los?«
»Ich bleiben sprechen Freunde Träger Indisches Army Base Camp, Freds mich finden, Freds sagen sein Basislager bitte kommen du. Klettern Lho La finden Mann mit Kamera kommen mieten Sherpas fertig mit Freds, sehr schlecht folgen Freds.«
Nun ist Laures Englisch nicht sehr gut, wie Sie vielleicht festgestellt haben. Doch schließlich waren wir alle in seinem Land und sprachen meine Sprache — und für ihn kam Englisch nach Sherpa, Nepalesisch, ein paar Brocken Japanisch und Deutsch. Und wie viele Sprachen sprechen Sie?
Außerdem verstehe ich immer den Kern dessen, was Laure sagt, was man nicht unbedingt von allen Einheimischen behaupten konnte. Also rief ich: »Nein! Arnold folgt ihnen?«
»Ja«, sagte Laure. »Sehr schlimm. Freds sagen kommen bitte holen.«
»Arnold hat ihre Sherpas angeheuert?«
Laure nickte. »Sherpas fertig Träger, Arnold mieten.«
»Verdammt! Wir müssen da raufsteigen und ihn holen!«
»Ja. Sehr schlecht.«
»Wirst du mit mir kommen?«
»Was immer du wollen.«
Ich eilte zu unseren Zelten, um meine Kletterausrüstung zusammenzusuchen, und erzählte Heather, was passiert war. »Wie ist er dorthin gekommen?« fragte sie. »Ich dachte, er sei den ganzen Tag mit dir zusammen gewesen.«
»Mir hat er gesagt, er würde mit dir gehen! Er ist euch wahrscheinlich hinauf gefolgt und dann weitergegangen. Mach dir keine Sorgen, es ist nicht deine Schuld. Führe die Gruppe morgen nach Namche zurück, und wir holen euch dann später ein.« Sie nickte, wirkte aber besorgt.
Laure und ich brachen auf. Selbst bei Laures Tempo erreichten wir Freds’ Basislager erst, als der Mond schon aufgegangen war.
Ihr Lager bestand jetzt nur noch aus einem einzigen Zelt auf einem flachgetretenen Schneestreifen, direkt unter dem steilen Hang des Khumbu-Tals — der Schlucht, die Nepal von Tibet trennt. Wir öffneten den Reißverschluß des Zeltes und weckten Freds und Kunga Norbu.
»Hervorragend!« sagte Freds. »Ich bin froh, daß ihr hier seid! Echt froh!«
»Erzähl mir, was passiert ist«, sagte ich.
»Na ja, dieser Arnold hat sich anscheinend hier raufgeschlichen.«
»Das weiß ich auch.«
»Und unsere Sherpas waren fertig, und wir hatten sie bezahlt, und ich glaube, er hat sie von der Stelle weg angeheuert. Sie haben jede Menge Kletterausrüstung dabei, und wir ließen Leitseile bis zum Lho La hinauf zurück, und so haben sie uns gefunden. Ich kann dir sagen, daß mir der Mund ziemlich weit aufstand, als sie im Paß auftauchten! Die Engländer wurden wütend und sagten Arnold, er solle wieder hinabsteigen, doch er weigerte sich, und, na ja, wie kann man hier oben jemanden zwingen, etwas zu tun, was er nicht will? Wenn man ihm einfach eins vor den Kopf gibt, hat er vielleicht Schwierigkeiten, wieder hinabzusteigen! Also kehrten Kunga und ich um, um dich zu holen, und wir fanden Laure im Basislager, und er sagte, er würde dich holen, während wir die Stellung hielten.«
»Arnold hat den Lho La bestiegen?« sagte ich erstaunt.
»Ich schätze, er ist ein ziemlich zäher Bursche. Hast du nicht den Film gesehen, den er von der Kajakfahrt den Baltoro hinab drehte? Ein echt radikaler Film, Mann, in der gleichen Kategorie wie Der Mann, der den Everest mit Skiern hinabfuhr, was die Radikalität betrifft. Und er hat auch ein paar andere verrückte Sachen angestellt, ist mit einem Hanggleiter vom Grand Teton geflogen und hat dabei die ganze Zeit gefilmt. Er ist zäher, als er aussieht. Ich glaube, er täuscht nur vor, so ein schlaffer Hollywood-Produzent zu sein, damit man ihn unterschätzt. Auf jeden Fall hat er ein paar ausgezeichnete Sherpas dabei, und mit ihnen und den Leitseilen kam er problemlos hinauf. Und ich glaube, er akklimatisiert sich gut; er ging rum, als sei er auf einem Strand.«
Ich seufzte. »Das nenne ich einen entschlossenen Filmemacher.«
Freds schüttelte den Kopf. »Der Bursche ist ein Parasit. Wenn wir seinen Arsch nicht wieder runterschleppen, wird er die Engländer in den Wahnsinn treiben.«
8
Also schickten wir vier uns am nächsten Tag an, den Lho La zu besteigen, und hatten es schnell mit einer der gefährlichsten Klettertouren zu tun, die ich je mitgemacht habe. Sie war nicht in technischer Hinsicht so schwierig — die Engländer hatten an den härtesten Stellen Leitseile zurückgelassen, was die Sache beträchtlich vereinfachte. Aber es war trotzdem gefährlich, denn wir stiegen einen Eisfall hinauf, das heißt, einen steil geneigten Gletscher.
Nun ist ein Gletscher ein Eisbach, wie Sie wissen, und fließt wie seine flüssigen Vettern immer abwärts. Er fließt wesentlich langsamer, aber vernachlässigen darf man diesen Faktor nicht, besonders nicht, wenn man auf einem steht. Dann hört man oft ein Krachen und Stöhnen, einen plötzlichen Knall oder ein Donnern, und man kommt sich vor, als stünde man auf dem Rücken eines Lebewesens.
Wenn so ein Gletscher einen Hügel hinabrollt, beschleunigt sich das alles noch; aus dem Lebewesen wird ein Drache. Das Eis des Gletschers bricht in gewaltige Blöcke und Scherben auf, die sich gleichmäßig bewegen, dann auf einem Kamm oder einer Klippe zu liegen kommen, hinabstürzen und zerbrechen oder aufreißen und tiefe Spalten enthüllen. Als wir uns den Weg durch das Labyrinth des Lho La-Eisfalls hinaufbahnten, bewegten wir uns ständig unter Eisblöcken, die schon ewig dort zu liegen schienen, in Wirklichkeit aber sehr unstabil waren — sie würden irgendwann im nächsten oder übernächsten Monat hinabstürzen. Ich bin kein Experte, was die Wahrscheinlichkeitstheorie betrifft, aber mir gefiel es trotzdem nicht.
»Freds«, beklagte ich mich, »du hast gesagt, das sei ein Kinderspiel.«
»Ist es auch«, sagte er. »Sieh doch, wie schnell wir vorankommen.«
»Aber nur, weil wir eine Todesangst haben.«
»Ach ja? He, das sind doch höchstens fünfundvierzig Grad oder so.«
Steiler kann ein Eisfall nicht werden, denn sonst würde das Eis sofort und geschlossen bergabwärts stürzen. Selbst der berühmte Khumbu-Eisfall, auf den wir nun zu unserer Rechten eine phantastische Aussicht hatten, ist nur etwa dreißig Grad steil. Der Khumbu-Eisfall ist ein unvermeidlicher Teil der Standardroute zum Everest und der bei weitem gefürchtetste Abschnitt; dort sind mehr Menschen gestorben als irgendwo sonst auf dem Berg. Und der Lho La ist schlimmer als der Khumbu!
Also fand ich ein paar angemessene Worte über unsere Lage, während wir in der Tat sehr schnell weiterkletterten, und mit den meisten davon wußte Laure nichts anzufangen. »Toll, Freds«, rief ich ihm zu. »Wirklich ein echtes Kinderspiel!«
»Auf jeden Fall jede Menge Zuckerguß«, sagte er und kicherte. Und das unter einer Wand, die ihn plattmachen würde wie Wile E. Coyote aus diesen Zeichentrickfilmen, falls sie fallen sollte. Ich schüttelte den Kopf.
»Was meinst du?« sagte ich zu Laure.
»Sehr schlecht«, sagte Laure. »Sehr schlecht, sehr gefährlich.«
»Und was sollten wir deiner Meinung nach tun?«
»Was immer du wollen.«
Wir beeilten uns.
Nun mag ich das Bergsteigen fast so sehr wie alle anderen hier auch, aber ich will nicht behaupten, daß es eine besonders vernünftige Tätigkeit ist. Besonders an jenem Tage hätte ich diese Behauptung nicht erhoben. Nun ja, es gibt solche und solche Gefahren. In der Tat treffen Bergsteiger eine Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Gefahren. Objektive Gefahren sind zum Beispiel Lawinen, Steinschlag und Stürme, Ereignisse, an denen man nichts ändern kann. Subjektive Gefahren sind jene, denen man sich durch menschliche Fehler aussetzt — man schlägt ein schlechtes Loch, vergißt, ein Seil zu sichern, und so weiter. Sie verstehen — wenn man absolut vorsichtig vorgeht, kann man alle subjektiven Gefahren vermeiden. Und wenn man die subjektiven Gefahren eliminiert hat, hat man es nur noch mit den objektiven Gefahren zu tun. Sie sehen also, daß Bergsteigen eine sehr rationale Angelegenheit ist.
An diesem Tag befanden wir uns jedoch inmitten einer ganzen Wand objektiver Gefahren, und das machte mich nervös. Wir verfuhren wie üblich in solch einem Fall, was heißt, daß wir uns höllisch beeilten. Wir vier stürmten praktisch den Lho La hinauf. Freds, Kunga und Laure waren äußerst stark und schnell, und ich war auch einigermaßen in Form; außerdem verfügte ich über den Vorteil eines höheren Adrenalinausstoßes, als ihn weniger phantasievolle Menschen haben. Also stellten wir einen neuen Rekord auf.
Dann passierte es. Freds war neben mir, hing mit Kunga Norbu an einem Seil, und Kunga war die volle Länge des Seils entfernt — etwas zwanzig Meter — und führte uns um einen Quergang herum, der unter einer riesigen Eiszacke verlief, wie man die blauen Eisvorsprünge nennt, die, oft in Gruppen, aus einem Eisfall hervorragen. Kunga war direkt unter dieser Eiszacke, als sie ohne die geringste Warnung abbrach, hinabstürzte und in tausend Stücke zersplitterte.
Ich hatte instinktiv tief eingeatmet und wollte gerade schreien, als Kunga Norbu gegen meinen Ellbogen prallte und mich fast hinabgestoßen hätte. Er war zwischen Freds und mir eingekeilt, und das Seil, das sie zusammenhielt, schlug zwischen unseren Beinen hin und her.
Beim Versuch, meinen Schrei zu ersticken, würgte ich, rang nach Atem und würgte erneut. Freds schlug mir auf den Rücken, um mir zu helfen. Kunga war eindeutig da, stand vor uns, greifbar und körperlich. Und doch war er unter der Eiszacke gewesen! Die zerbrochenen Eisstücke lagen frisch und glänzend in der Nachmittagssonne vor uns verstreut. Der Block war ohne das geringste Zittern, ohne jede Warnung, abgebrochen und hinabgestürzt — Kunga war einfach keine Zeit geblieben, um noch unter ihm hervorzukommen.
Freds sah meinen Gesichtsausdruck und grinste schwach. »Der alte Kunga Norbu ist ziemlich schnell, wenn es sein muß.«
Aber das reichte mir nicht. »Ga gor nee«, sagte ich — und dann zogen Freds und Kunga mich hoch. Laure eilte zu uns hinauf, die Augen groß vor Besorgnis.
»Sehr schlecht«, sagte er.
»Gar«, versuchte ich und kam nicht weiter.
»Schon gut, schon gut«, sagte Freds und umfaßte mein Gesicht mit seinen Handschuhen. »He, George. Entspanne dich.«
»He«, bekam ich heraus, deutete auf die Überreste der Eiszacke und dann auf Kunga.
»Ich weiß«, sagte Freds stirnrunzelnd. Er wechselte einen Blick mit Kunga, der mich ungerührt beobachtete. Sie sprachen auf Tibetanisch miteinander. »Hör zu«, sagte Freds. »Steigen wir über den Paß, und dann erkläre ich es dir. Es wird eine Weile dauern, und es bleibt uns nicht mehr so viel Tageslicht. Außerdem müssen wir einen Weg um diese Eiswürfel finden, damit wir den Leitseilen folgen können. Komm schon, Kumpel.« Er gab mir einen Klaps auf den Arm. »Konzentriere dich. Bringen wir’s hinter uns.«
Also kletterten wir weiter, und Kunga führte so schnell wie zuvor. Ich stand jedoch noch immer unter Schock und sah ständig vor mir, wie die Eiszacke mit Kunga darunter zusammenbrach. Er konnte ihr einfach nicht entkommen sein! Und doch war er dort oben vor uns und kletterte die Leitseile hinauf wie ein Affe eine Palme.
Es war ein Wunder. Und ich hatte es gesehen. Ich hatte verdammte Schwierigkeiten, mich den Rest des Tages über auf das Klettern zu konzentrieren.
9
Kurz vor Sonnenuntergang hatten wir den Lho La überwunden und unser Zelt auf dem flachen Ausläufer des Passes auf tiefem hartem Schnee aufgeschlagen. Es war eine der geräumigsten Lagerstätten, die ich je errichtet hatte: auf dem Grat des Himalaja, auf einem breiten Sattel zwischen den höchsten Bergen der Erde und dem sehr spitzen und wunderschönen Lingtren. Unter uns war auf der einen Seite der Khumbu-Gletscher, auf der anderen der Rongbuk-Gletscher in Tibet. Wir waren etwa sechstausendsechshundert Meter hoch, und so hatten Freds und seine Freunde noch ein gutes Stück vor sich, wenn sie zum alten Mallory wollten. Aber nichts über uns würde so willkürlich gefährlich sein wie der Eisfall. Solange das Wetter hielt, heißt das. Bislang hatten wir Glück gehabt; dieser Oktober erwies sich als einer der trockensten seit Jahren.
Es war keine Spur vom englischen Team oder von Arnolds Crew auszumachen, abgesehen von Spuren im Schnee, die um die Seite des Westsattels führten und dann verschwanden. Also waren sie auf dem Weg zum Gipfel. »Verdammt!« sagte ich. »Warum haben sie nicht gewartet?« Jetzt mußten wir noch höher klettern, um Arnold zu erwischen.
Ich saß auf dem festgetretenen Schnee vor dem Zelt. Ich war müde. Und ich war sehr besorgt. Laure kümmerte sich um den Gaskocher. Kunga Norbu saß ein Stück abseits im Schnee und meditierte anscheinend beim Anblick Tibets.
Freds ging umher und sang »Wooden Ships«; er war eindeutig im Himmel. »Talkin’ about very free … and eeeasy … Ich meine, das ist doch ein tolles Lager, oder was?« rief er mir zu. »Sieh dir diesen Sonnenuntergang an. Das ist einfach zuviel. Hätten wir nur noch was Chang mitgenommen. Ich hab aber etwas Hasch. George, jetzt ist an der Zeit für ein Pfeifchen, oder?«
»Noch nicht, Freds«, sagte ich. »Du kommst jetzt her und erklärst mir, was, zum Teufel, da unten mit deinem Kumpel Kunga passiert ist. Du hast es mir versprochen.«
Freds stand da und sah mich an. Wir waren im Schatten — es war kalt, aber windstill, und der Himmel über uns war klar und sehr dunkelblau. Das dünne Zischen des anspringenden Gaskochers war das einzige Geräusch.
Freds seufzte, und sein Gesichtsausdruck wurde so ernst, wie es bei ihm überhaupt möglich war: ein Auge völlig zugekniffen, die Stirn gerunzelt und die Lippen zusammengepreßt. Er sah zu Kunga hinüber, der dort saß und uns beobachtete. »Hör zu«, sagte er nach einer Weile. »Du erinnerst dich doch, wie wir uns vor ein paar Wochen in Chimoa einen angesoffen haben?«
»Ja und?«
»Und ich habe dir gesagt, daß Kunga Norbu ein Tulku ist.«
Ich schluckte. »Freds, verschone mich mit diesem Unsinn.«
»Na ja«, sagte er. »Entweder das, oder ich muß dir irgendwas vorlügen. Und ich bin kein so guter Lügner, mein Gesicht oder irgendwas verrät mich immer.«
»Freds, werde ernst!« Aber als ich zu Kunga Norbu hinübersah, der dort mit diesem leeren Gesichtsausdruck und den unheimlichen schwarzen Augen im Schnee saß, mußte ich mich unwillkürlich fragen, ob er nicht doch recht hatte.
»Es tut mir leid, Mann, wirklich«, sagte Freds. »Ich will dir da nichts vormachen. Aber du mußt eingestehen, daß ich schon versucht habe, es dir zu sagen. Und es ist die reine Wahrheit. Bei Gott, er ist ein echter Tulku. Die erste Inkarnation des berühmten Tsong Khapa, 1555 geboren. Und seitdem weilt er unter uns.«
»Also hat er George Washington kennengelernt, und so weiter?«
»Soweit ich weiß, ist Washington nie in Tibet gewesen.«
Ich starrte ihn an. Er verlagerte unbehaglich sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. »Ich weiß, es fällt einem nicht leicht, das zu schlucken, George. Glaub mir, ich hatte zuerst auch meine Schwierigkeiten damit. Doch wenn man eine Weile unter Kunga Norbu studiert, sieht man, wie er so viele wunderbare Dinge tut, daß man es einfach glauben muß.«
Ich starrte ihn sprachlos weiterhin an. »Wenn man zum ersten Mal sieht, wie er seine Wunder wirkt, ist es ein echter Schock. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal. Ich marschierte mit ihm von dem verborgenen Rongbuk nach Namche. Wir gingen direkt über den Lho La, wie heute auch, und direkt hinter dem Basislager stießen wir auf diesen indischen Trekker, der schon blau anlief. Er würde eindeutig an der Höhenkrankheit sterben, und so trugen Kunga und ich ihn zwischen uns nach Pheriche hinab, was schon ein hartes Stück Arbeit ist, wie du weißt. Wir brachten ihn zur Rettungsstation, und ich nehme an, sie haben ihn in den Drucktank gelegt, den sie da haben. Hast du den schon mal gesehen? Sie haben im Hinterzimmer einen Tank, der wie ein kleines U-Boot aussieht, und wenn man einen Burschen mit Höhenkrankheit da reinlegt und den Druck auf den der Meereshöhe senkt, geht’s ihm wieder besser. Eine tolle Idee, aber es stellte sich raus, daß die Station diesen Tank von einem Krankenhaus in Tokio gestiftet bekommen hatte, und die Gebrauchsanweisung dafür ist auf Japanisch, und keiner auf der Station kann Japanisch lesen. Außerdem ist das nur eine Experimentaltechnik, niemand weiß genau, ob sie funktioniert oder nicht, und keiner da beabsichtigt, mit kranken Trekkern Experimente anzustellen. Also waren wir wieder ganz am Anfang, und diesem Burschen ging es schlechter denn je, und so brachen Kunga und ich nach Namche auf, aber ich wurde müde, und wir kamen nur echt langsam voran, und plötzlich hob Kunga Norbu ihn hoch und warf ihn sich über die Schulter, und dann lief er einfach den Trail mit ihm hinab! Ich rief ihm nach und versuchte, mit ihm Schritt zu halten, und ich sage dir, ich raste den Trail runter, und Kunga war trotzdem so schnell, daß ich ihn bald aus den Augen verlor. Er machte große, lange Schritte, als wolle er jeden Augenblick abheben! Ich konnte es einfach nicht glauben!«
Freds schüttelte den Kopf. »Das war das erste Mal, daß ich sah, wie Kunga Norbu in den Lunggom-Seinszustand fiel. Das bedeutet mystischer Langstreckenlauf und war früher mal echt beliebt in Tibet. Ein Adept wie Kunga wird Lung-gom-pa genannt, und wenn man es erst mal beherrscht, kann man echt schnell echt weit laufen. Sogar ein bißchen levitieren. Du hast es heute ja selbst gesehen — unter diesem Eisblock legte er eine Lung-gom-Bewegung vor.«
»Ich verstehe«, sagte ich ziemlich benommen. »He!«, rief ich Laure zu, der noch immer mit dem Gaskocher beschäftigt war. »Laure! Freds sagt, daß Kunga Norbu ein Tulku ist!«
Laure nickte lächelnd. »Ja, Kunga Norbu Lama sehr guter Tulku!«
Ich atmete tief ein. Drüben im Schnee saß Kunga Norbu mit überkreuzten Beinen und blickte auf sein Land hinaus. Oder sonstwo hin. »Ich glaube, jetzt wäre ein Haschpfeifchen nicht schlecht«, sagte ich zu Freds.
10
Wir brauchten zwei Tage, um Arnold und die Briten einzuholen, zwei Tage mühsamer Plackerei den Westsattel des Everest hinauf. Hier gab es keine komplizierten Hindernisse: eine weitläufige Steigung aus hartem Schnee, und wir mußten nur die Steigeisen einschlagen und uns an ihnen hochziehen. Es war eine mörderische Arbeit. Das schien allerdings nicht für Freds, Laure und Kunga Norbu zu gelten. Es mag ja seine Vorteile haben, den Everest mit einem Tulku, einem Langstreckenmeister der Sherpas und einem amerikanischen Raumkadett zu besteigen, aber längere Rasten sind bei ihnen nicht gerade beliebt. Diese drei marschierten den Berg wie zu einem Tubamarsch hinauf, und ich schleppte mich keuchend und schnaubend hinterher und verdammte Arnold mit jedem Schritt.
Spät am zweiten Tag kämpfte ich mich auf die Kuppe des Westsattels hinauf, eine lange, schneebedeckte Wasserscheide unter dem eigentlichen Westgrat. Als ich dort oben eintraf, hatten Freds und Laure bereits das Zelt aufgeschlagen und sicherten es mit einem Netzwerk aus Kletterseilen im Schnee, während Kunga Norbu daneben saß und meditierte.
Weiter unten den Sattel hinab lagen die Camps zweier anderer Teams, ziemlich eng beeinander, als gäbe es hier nicht jede Menge flachen Grund, auf dem man die Zelte aufschlagen konnte. Nachdem ich mich ausgeruht und mehrere Becher heißer Zitrone getrunken hatte, sagte ich: »Dann wollen wir mal herausfinden, wie die Dinge stehen.« Freds ging mit mir hinüber.
Wie es sich herausstellte, standen die Dinge nicht so gut. Die Engländer waren in ihrem Zelt, bis zu den Hüften in ihren Schlafsäcken, und tranken Tee. Und sie waren keiner guten Laune. »Der Mann ist absolut verrückt«, sagte Marion. Sie litt unter leichtem Höhenhusten, und jede Silbe, die sie zu betonen versuchte, verschwand völlig. »Wir haben ups versucht, ihn abzuhängen, aber die Sherpas sind gut, und er ist ups stark.«
»Ein verdammter Blutsauger ist er«, sagte John.
Trevor grinste grimmig. Seine untere Gesichtshälfte war ziemlich sonnenverbrannt, und seine Lippen sprangen schon auf. »Wir zählen darauf, daß du ihn wieder runterbringst, George.«
»Ich will sehen, was ich tun kann.«
Marion schüttelte den Kopf. »Bei Gott, wir haben es versucht, aber es hat überhaupt keinen Sinn. Er hört einfach nicht zu und plappert nur davon, daß er mich zu einem Staa machen will. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm fertig werden soll.« Sie errötete. »Und keiner dieser tapferen Jungs da ist einverstanden, daß wir einfach rübergehen und seine verdammte Kamera nehmen und sie nach Tibeee werfen!«
Die Männer schüttelten die Köpfe. »Wir müßten mit den Sherpas fertig werden«, sagte Mad Tom geduldig zu Marion. »Was sollen wir denn tun, uns mit ihnen prügeln? Das kann ich mir nicht mal vorstellen.«
»Und wenn Mad Tom es sich nicht vorstellen kann«, sagte Trevor.
Marion knurrte nur.
»Ich werde mit ihm sprechen«, sagte ich.
Aber ich mußte dafür nirgendwo hingehen, denn Arnold war herübergekommen, um uns zu begrüßen. »Hallo!« rief er fröhlich. »George, was für eine Überraschung! Was führt euch denn hierher?«
Ich ging aus dem Zelt. Arnold stand vor mir; er hatte zwar einen Sonnenbrand, schien ansonsten aber in Ordnung zu sein. »Du weiß, was mich hierher führt, Arnold. Komm, gehen wir ein Stück beiseite. Ich bin sicher, daß diese Leute nicht mit dir sprechen wollen.«
»Oh, nein, ich habe jeden Tag mit ihnen gesprochen! Wir haben uns richtig gut unterhalten. Und heute habe ich eine tolle Nachricht.« Er sprach ins Zelt. »Ich habe mit meinem Zoom zur Nordwand gesehen, und da hat jemand ein Lager aufgeschlagen! Glaubt ihr, daß das die Expedition ist, die nach Mallorys Leiche sucht?«
Aus dem Zelt kamen Flüche.
»Ich weiß«, rief Arnold. »Das setzt uns ziemlich unter Druck, meint ihr nicht auch? Jetzt bleibt uns nicht mehr viel Zeit.«
»Verpiß dich!«
Arnold zuckte die Achseln. »Na ja, ich hab’s auf Band, wenn ihr es euch ansehen wollt. Sieht so aus, als würden sie Helly-Hansen-Jacken tragen, wenn euch das was sagt.«
»Du willst mir doch nicht erzählen, daß du aus dieser Entfernung die Etiketten lesen kannst?« fragte ich.
Arnold grinste. »Es ist eine verdammt, gute Zoom-Linse. Wenn ich wollte, könnte ich von ihren Lippen ablesen.«
Ich musterte ihn neugierig. Es schien ihm wirklich gut zu gehen, selbst nach vier Tagen harter Kletterei. Er wirkte eine Spur schlanker, und unter seinen Bartstoppeln hatte er einen ziemlich schlimmen Sonnenbrand — aber er kaute noch immer auf einer weiß gewordenen Zigarre zwischen zinkoxydierten Lippen und legte noch immer diesen großäugigen, verwunderten Ausdruck zu Tage, daß sich überhaupt jemand für seine Filmarbeit interessierte. Ich war beeindruckt; er war eindeutig wesentlich zäher, als ich gedacht hatte. Er erinnerte mich an Dick Bass, den amerikanischen Millionär, der sich in den Kopf gesetzt hatte, die höchsten Berge eines jeden Kontinents zu besteigen. Wie Bass war Arnold ein Mann mittleren Alters, der Profis bezahlte, damit sie ihn hinaufbrachten; und wie Bass akklimatisierte er sich gut und hatte verdammt starke Nerven.
Da stand er also vor mir und dachte gar nicht daran, aufzugeben. Ich mußte mir etwas anderes einfallen lassen. »Arnold, komm’ mal mit mir da rüber und laß diese Leute in Frieden.«
»Gute Idee«, rief Marion aus dem Zelt.
»Diese Marion«, sagte Arnold bewundernd, als wir außer Hörweite waren. »Sie ist wirklich schön. Ich meine, stehe echt auf sie.« Er warf sich in die Brust, um zu zeigen, wie verknallt er war.
Ich funkelte ihn an. »Arnold, es spielt keine Rolle, ob du auf sie stehst oder was, denn sie wollen dich bei dieser Klettertour eindeutig nicht dabei haben. Wenn du sie filmst, zerstörst du alles, worauf es bei diesem Unternehmen ankommt.«
Arnold ergriff meinen Arm. »Ist doch Quatsch! Das versuche ich ihnen doch schon die ganze Zeit zu erklären. Ich kann den Film so schneiden, daß niemand erfahren wird, wo Mallorys Leiche liegt. Man wird nur wissen, daß er hier oben in Sicherheit ist, weil vier junge englische Bergsteiger unglaubliche Risiken auf sich genommen haben, um sie vor den Pressefritzen zu retten, die sie nach London schleppen wollten. Eine tolle Sache, George. Ich bin Filmemacher und weiß, wann ich einen Stoff für einen tollen Film habe, und das wird ein toller Film werden.«
Ich runzelte die Stirn. »Vielleicht, aber das Problem ist, daß diese Besteigung illegal ist, und wenn du darüber einen Film drehst, kommt das raus, und diese Leute werden von den nepalesischen Behörden verbannt werden. Sie dürfen dann nie wieder nach Nepal einreisen.«
»Na und? Sind sie nicht bereit, dieses Opfer für Mallory zu geben?«
Ich runzelte die Stirn. »Für deinen Film, meinst du. Ohne den Film könnten sie die Sache durchziehen, ohne daß jemand davon erfährt.«
»Na schön, aber ich könnte doch ihre Namen weglassen oder so. Ihnen Künstlernamen verpassen. Marion Davies, wie wäre das?«
»Das ist ihr echter Name.« Ich dachte nach. »Hör mal, Arnold, du weißt ja, daß du dieselben Probleme bekommen wirst. Vielleicht lassen sie dich nicht mal aus Nepal raus.«
Er machte eine abfällige Handbewegung. »Damit werde ich schon fertig. Ich besorge mir einen Anwalt. Oder verteile Bakschisch, eine Menge Bakschisch.«
»Aber diese Leute haben nicht das Geld dafür. Du solltest wirklich vorsichtig sein. Wenn du sie zu sehr bedrängst, werden sie zu drastischen Schritten greifen. Zumindest werden sie dich ein Stück höher aufhalten. Wenn sie die Leiche finden, werden zwei umkehren und dich festhalten, und die beiden anderen begraben sie, und du bekommst überhaupt kein Filmmaterial.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe doch diese Linsen, habe ich dir das nicht gesagt? Mann, ich habe jeden Morgen gefilmt, was die vier zum Frühstück gegessen haben. Von Marion zum Beispiel habe ich mehrere Stunden Material« — er seufzte — »und mein Gott, ich könnte sie zum Star machen. Auf jeden Fall könnte ich das Begräbnis notfalls von hier aus filmen; also geh’ ich das Risiko ein. Mach’ dir um mich keine Sorgen.«
»Ich mache mir keine Sorgen um dich«, sagte ich. »Nimm mein Wort darauf. Aber ich wünschte, du würdest mit mir umkehren. Sie wollen dich hier oben nicht haben, und ich will dich hier oben nicht haben. Es ist gefährlich, besonders, wenn das Wetter sich verschlechtert. Außerdem brichst du den Vertrag mit deiner Reiseagentur, der besagt, daß du meinen Anweisungen auf dem Trek Folge zu leisten hast.«
»Verklag mich doch.«
Ich atmete tief ein.
Arnold legte freundlich eine Hand auf meinen Arm. »Mach’ dir nicht so viel Sorgen, George. Sie werden mich lieben, wenn sie erst Stars sind.« Er sah den Ausdruck auf meinen Gesicht und trat zurück. »Und du versuche ja keine Tricks mit mir, oder ich hänge dir eine Entführungsklage an den Hals, und du wirst nie wieder einen Trek führen.«
»Bring’ mich ja nicht in Versuchung«, erwiderte ich und kehrte zum Lager der Engländer zurück.
Ich ging in ihr Zelt. Laure und Kunga Norbu hatte sich zu ihnen gesellt; es war ziemlich eng. »Kein Glück«, sagte ich. Es überraschte sie nicht.
»Ein Superblutsauger«, bemerkte Freds fröhlich.
Wir saßen da und starrten die blauen Flammen des Gaskochers an.
Dann, wie es unter solchen Umständen meistens passiert, sagte ich: »Ich habe einen Plan.«
Da uns nicht viele Möglichkeiten blieben, war er relativ einfach. Wir würden alle zum Lho La zurückkehren, und vielleicht sogar zum Basislager, damit Arnold dachte, wir hätten aufgegeben. Dort unten könnten die Engländer und Freds und Kunga Norbu dann in den Teehäusern von Gorak Shep neue Vorräte kaufen, und Laure und ich würden versuchen, Arnold aufzuhalten, indem wir ihm zum Beispiel seine Stiefel stahlen. Dann könnten sie an den Leitseilen wieder hinaufklettern und es noch einmal versuchen.
Trevor schaute zweifelnd drein. »Es ist schwierig, hier hinaufzukommen, und wir haben nicht mehr viel Zeit, falls die andere Exepedition schon auf dem Nordgrat ist.«
»Ich habe einen besseren Plan«, erklärte Freds. »Schaut mal, Arnold folgt euch Briten, aber nicht uns. Wenn wir vier vorgeben würden, wieder umzukehren, während ihr vier direkt den Westgrat angeht, würde Arnold euch folgen. Dann könnten wir vier uns den Diagonalgraben hinaufschleichen und euch überholen, indem wir die Hombein-Schlucht nehmen, was ja viel schneller geht. Ihr würdet uns nicht sehen, und wir wären vor euch oben bei der Leiche.«
Niemand war von diesem Plan übermäßig angetan. Die Briten hätten Mallory gern selbst gefunden, das spürte ich deutlich. Und ich hatte nicht die geringste Absicht, noch höher zu steigen, als ich schon war. Ich war in der Tat sogar entschieden dagegen.
Aber mittlerweile hatten sich die Briten fest darauf versteift, Mallory vor dem Fernsehen und der Westminster Abbey zu retten. »Das könnte klappen«, stimmte Marion zu.
»Und wir könnten den Blutsauger auf dem Grat abschütteln«, fügte Mad Tom hinzu. »Das ist ein schwieriges Stück.«
»Genau!« sagte Freds glücklich. »Laure, machst du mit?«
»Was immer du wollen«, sagte Laure und grinste. Er hielt es für eine gute Idee. Dann fragte Freds auf Tibetanisch Kunga Norbu und erklärte uns, Kunga habe dem Plan seinen Segen gegeben.
»George?«
»Oh, Mann, nein. Ich würde ihn lieber irgendwie anders abschütteln.«
»Ach, komm schon!« rief Freds. »Es gibt keine andere Möglichkeit, und du willst uns doch nicht im Stich lassen, oder? Hast du etwa kalte Füße?«
»Er ist dein verdammter Klient«, stellte John klar.
»Oh, Mann … Na schön.«
Ich kehrte mit dem Gefühl zu unserem Zelt zurück, daß die Dinge wirklich außer Kontrolle gerieten. In der Tat war ich im Griff anderer Menschen Pläne gefangen, Pläne, die ich keineswegs billigte und die von Leuten geschmiedet worden waren, deren geistige Ausgeglichenheit ich bezweifelte. Und das alles auf einem Berg, auf dem über fünfzig Menschen gestorben waren. Es stank zum Himmel.
11
Doch ich machte trotzdem mit. Am nächsten Morgen brachen wir das Lager ab und erweckten alle Anstalten, wieder umzukehren. Die Engländer gingen zum Westgrat und warfen Arnold düstere Drohungen zu, als sie an ihm vorbeizogen. Arnold und seine Sherpas hatten bereits gepackt; sie ließen den Engländern einen kurzen Vorsprung und folgten ihnen dann. Arnold war an ihrem Führer Ang Rita angeseilt und konnte es, die Kamera in einer Tasche auf der Brust, gar nicht abwarten, ihnen nachzugehen. Eins mußte ich ihm lassen — er war ein verdammt hartnäckiger Voyeur.
Wir winkten zum Abschied und blieben auf dem Sattel, bis sie über uns und kurzzeitig außer Sicht waren. Dann eilten wir ihnen nach und bogen nach links in den sogenannten Diagonalgraben ab, der zur Nordseite führt.
Wir folgten nun der Strecke, die zum ersten Mal im Jahre 1963 Tom Hornbein und Willi Unsöld genommen hatten. Ein wirklicher Bergsteiger-Klassiker, der durch die Hornbein- Schlucht führt, wie man sie nun nennt. Besorgen Sie sich ein gutes Foto der Nordseite des Everest, und Sie sehen sie — eine große vertikale Spalte auf der rechten Seite. Es ist eine steile Rinne, doch man kommt etwas schneller hinauf als an der Westseite.
Also kletterten wir. Es war eine schwierige Strecke, aber keineswegs so furchteinflößend wie der Lho La. Mein größtes Problem an diesem Tag war eine das Wetter betreffende Paranoia. Auf dem Everest nimmt man das Wetter nicht auf die leichte Schulter. Man sagte nicht einfach: »Wenn es jetzt schneit, ist der ganze Tag im Eimer.« Ziemlich viele Leute sind auf dem Everest von Stürmen überrascht worden und darin umgekommen, darunter auch die Burschen, nach denen wir suchen wollten. Wann immer ich also Wolkenstreifen über den Gipfel treiben sah, drehte ich beinahe durch. Und der Wind peitscht fast ständig ein Wolkenband vom Gipfel des Everest hinüber. Ich schaute immer wieder nach oben, sah die Wolken und stöhnte. Freds hörte mich.
»He, George, du klingst ja ganz danach, als war’ dir auf dieser Höhe nicht ganz wohl zumute.«
»Beeil’ dich, ja?«
»Du willst schneller gehen? Na schön, aber ich muß dir sagen, daß ich schon so schnell gehe, wie ich kann.«
Das glaubte ich ihm unbesehen. Kunga Norbu trieb mit seinem Eispickel in der Mitte der Schlucht Steigeisen in den hohen Schnee, und Freds war dicht hinter ihm; sie sahen aus wie zwei Dachdecker auf einer Leiter. Ich tat mein Bestes, um ihnen zu folgen, und Laure bildete die Nachhut. Sowohl Freds als auch Laure grinsten ununterbrochen so breit, daß man glauben konnte, sie wären auf einem Trip. Es gefiel ihnen so sehr, daß sie sich noch einen Sonnenbrand an den Zähnen holen würden. Mittlerweile schnappte ich nach Luft und zerbrach mir den Kopf über diese Gipfelfahne.
Es war einer der schönsten Klettertage meines Lebens.
Warum, fragen Sie jetzt? Na ja … es ist nicht leicht zu erklären. Aber es verhält sich in etwa so: Wenn man sich an einer Felswand befindet und ein paar hundert Meter Luft unter sich hat, nimmt das schon die Aufmerksamkeit in Anspruch. Natürlich sagt ein Teil von einem: Oh, mein Gott, jetzt ist alles aus. Warum habe ich das bloß getan? Aber ein anderer Teil sieht ein, daß man die Ruhe bewahren muß, wenn man nicht sterben will, und verstrickt einen in halbtheoretische Gymnastikübungen, die einen den Berg hinaufbringen sollen. Man achtet auf die Übungen, wie man noch nie zuvor auf etwas geachtet hat. Schließlich findet man sich auf irgendeinem flachen Fleckchen wieder — achtzig mal hundertzwanzig Zentimeter tun’s schon. Man sieht sich um und begreift, daß man nicht gestorben ist, daß man noch lebt. Und zu diesem Zeitpunkt wird diese Tatsache ziemlich anregend. Man schätzt es wirklich, noch zu leben. Es ist eine gewisse Macht, oder ein Privileg, das einem gewährt wurde; auf jeden Fall fühlt man sich ganz hervorragend, als habe man kurzzeitig eine höhere Bewußtseinsstufe erreicht. Einfach, weil man noch lebt! Und in der Rückschau hält man auch dieses Achten auf die Übungen für eine höhere Bewußtseinsstufe.
Man kann von solchen Gefühlen ganz schön abhängig werden; sie stellen die ultimate Bewußtseinsveränderung dar. Drogen kommen nicht an sie heran. Ich will nicht behaupten, daß das ein vernünftiges Verhalten ist; ich sage nur, daß es passiert.
Zum Beispiel am Ende dieses besonders eindringlichen Tages in der Hornbein-Schlucht, als wir vier nach einer Blitztour im alpinen Stil, die wir hauptsächlich Kunga Norbus inspirierter Führung verdankten, oben angelangten. Wir schlugen das Lager auf einem kleinen flachen Buckel auf, der kaum groß genug für unser Zelt war. Und sahen uns dann um — was für ein Gefühl! Es war wirklich unbeschreiblich. Es gibt nur vier oder fünf Berge auf der Erde, die höher sind als diese Lagerstätte, und das sah man auch. Es hatte den Anschein, daß wir bis nach Tibet sehen konnten. Nun sieht Tibet hauptsächlich aus wie ein gefriergetrocknetes Nevada, doch von unserer Höhe aus bestand es aus einer schneebedeckten Gipfelkette nach der anderen, auf ewig Weiß auf Schwarz, alles von der Nachmittagssonne rötlich gefärbt. Die Welt schien nur noch aus Bergen zu bestehen.
Freds ließ sich, noch immer mit einem iditotischen Grinsen auf dem Gesicht, neben mir auf den Boden fallen. Er hielt einen dampfenden Becher mit heißer Zitrone in der einen Hand, seine Haschpfeife in der anderen, und sang »›What a looong, stränge trip it’s been.‹« Er nahm einen Zug aus der Pfeife und gab sie mir.
»Bist du sicher, daß wir hier oben rauchen sollten?«
»Klar, das hilft dir beim Atmen.«
»Jetzt hör’ aber auf.«
»Nein, wirklich. Das Nervenzentrum, das deine unwillkürliche Atmung regelt, arbeitet nicht mehr, wenn es kein Kohlendioxyd gibt. Und hier oben gibt es kaum welches, aber der Rauch verschafft es dir.«
Ich kam zum Schluß, seinem Beispiel aus medizinischen Gründen lieber zu folgen. Wir reichten die Pfeife hin und her. Hinter uns saß Laure im Zelt, summte etwas vor sich hin und holte seinen Schlafsack hervor. Kunga Norbu saß im Lotussitz auf der anderen Seite des Zeltes und befaßte sich mit seinen eigenen Reichen. Die Welt, alle Berge, gingen unter der Sonne unter.
Freds atmete glücklich aus. »Das muß der schönste Ort auf Erden sein, meinst du nicht auch?«
Das ist das Gefühl, von dem ich gesprochen habe.
12
Wir konnten den Ort eine lange und rastlose Nacht genießen, denn es ist verteufelt schwer, in solch einer Höhe zu schlafen. Die Müdigkeit scheint aus dem geistigen Repetoire herausgefallen zu sein, und wenn sie sich dann doch einmal einstellt, fällt man in das, was man die Cheyne-Stokes-Atmung nennt. Der Körper läßt sich ständig narren, wieviel Sauerstoff er bekommt, und so hyperventiliert man eine Weile und hört dann bis zu jeweils einer Minute ganz zu atmen auf. Das ist kein beruhigendes Muster, wenn es einen schlafenden Menschen überkommen hat, der neben einem liegt; Freds fiel zum Beispiel wirklich hinein, und ich lag die ganze Zeit während seiner wirklich langen Schweigephasen völlig wach und machte mir Sorgen, daß er gestorben sein könnte. Er hatte anscheinend die gleichen Befürchtungen bei mir, jedoch nicht meine Geduld, und wenn ich wirklich einmal einschlief, riß Freds mich normalerweise wieder ins Bewußtsein zurück, indem er mich am Arm zerrte und sagte: »George, verdammt, atme! Atme!«
Doch der nächste Tag dämmerte wieder klar und windstill herauf, und nach dem Frühstück marschierten wir am Schwarzen Ring entlang.
Unsere Route war ungewöhnlich, vielleicht sogar einzigartig. Der Schwarze Ring, härter als die Felsschichten darüber und darunter, erhebt sich als brüchiger Wall aus der im allgemeinen glatten Felswand. Also hatten wir praktisch eine Art Straße, auf der wir gehen konnten. Obwohl sie uneben und aufgerissen war, erreichte sie stellenweise eine Breite von sechs Metern, und eine leichtere Stelle für eine Überquerung konnte man sich nicht vorstellen. Hier hätten sich zahlreiche Lagerstätten geboten.
Natürlich ist man normalerweise, wenn man sich achttausendvierhundert Meter hoch auf dem Everest befindet, daran interessiert, ziemlich schnell entweder höher oder tiefer zu gelangen. Da dieser Wall eben verlief und auch keinerlei Route folgte, wurde er nicht häufig begangen. Da Freds sagte, daß Kunga Norbu nur von oben auf ihn hinabgesehen hatte, waren wir vielleicht die ersten überhaupt, die ihm folgten.
Also wanderten wir diesen Hochweg entlang und machten uns auf die Suche. Freds stieß einen Felsbrocken vom Rand hinab, und wir beobachteten, wie er in den Rongbuk-Gletscher stürzte, bis er unsichtbar wurde, wenngleich wir ihn noch hören konnten. Danach trotteten wir etwas vorsichtiger weiter. Dennoch hatten wir den Grat ziemlich schnell überquert und schauten dann die gewaltige, glatte Rinne der Großen Schlucht hinab. Hier endete der Ring, und der weitere Aufstieg zur berühmten Nordwand, an der man Mallory und Irvine zum letzten Mal gesehen hatte, wäre ein häßliches Stück Arbeit gewesen. Außerdem hatte Kunga Norbu die Leiche gar nicht an dieser Stelle gesehen.
»Wir müssen sie verpaßt haben«, sagte Freds. »Wir trennen uns, marschieren auf den Seiten und sehen auf dem Rückweg in jedem Winkel und jeder kleinen Spalte nach.«
Das taten wir dann auch; wir gingen sehr langsam und näherten uns dem Ende des Ringes, soweit wir es wagten.
Wir waren etwa auf halber Strecke zur Hornbein-Schlucht zurückgekehrt, als Laure sie fand. Er rief, und wir liefen zu ihm.
»Ich glaub, mein Schwein pfeift«, sagte Freds und glotzte erstaunt.
Die Leiche steckte in einem Spalt, bis zur Brust in hartgefrorenem Schnee. Sie lag auf der Seite, so zusammengekauert, daß sie sich auf einer Ebene mit dem Fels auf beiden Seiten des Spaltes befand. Ihre Kleidung war durchgescheuert und verfaulte auf ihr; sie schien aus Strickwolle zu bestehen. Die Art, wie man sie beim Golf in Schottland trägt. Ihre Augen waren geschlossen, und unter einer zerfallenden Kapuze wirkte seine Haut papierdünn. Sechzig Jahre draußen in Sonne und Sturm, doch immer unter dem Gefrierpunkt, hatten ihn auf seltsame Art und Weise erhalten. Ich hatte das unheimliche Gefühl, daß er nur schlief und jeden Augenblick aufwachen und aufstehen würde.
Freds kniete neben ihm und grub etwas im Schnee. »Seht mal — er ist angeseilt, aber das Seil ist gerissen.«
Er hielt ein paar Zentimeter ausgefasertes Seil hoch — Naturfasern, schrecklich dünn. Ich erschauderte, als ich es sah. »So eine primitive Ausrüstung!« rief ich.
Freds nickte kurz. »Die waren plemplem. Ich glaube nicht, daß er eine Sauerstofflasche dabeihat. Die gab’s damals schon, aber er benutzte sie nicht gern.« Er schüttelte den Kopf. »Sie sind wahrscheinlich gleichzeitig gestürzt. Vielleicht durch eine Schneewächte gebrochen. Dann fielen sie hier runter, und der hier blieb im Spalt hängen, während der andere über den Rand stürzte und das Seil riß.«
»Also liegt der andere unten im Gletscher«, sagte ich.
Freds nickte langsam. »Und sieh mal …«Er deutete nach oben. »Wir sind fast direkt unter dem Gipfel. Also müssen sie es geschafft haben. Oder verdammt kurz vor dem Ziel abgestürzt sein.« Er schüttelte den Kopf. »Und sie haben nur so eine Jacke getragen! Erstaunlich!«
»Also haben sie es geschafft«, flüsterte ich.
»Sieht jedenfalls so aus. Also … wer von den beiden ist das?«
Ich schüttelte den Kopf. »Kann ich nicht sagen. Anfang Zwanzig oder Mitte Dreißig?«
Unbehaglich betrachteten wir die mumifizierten Gesichtszüge.
»Dreißig«, sagte Laure. »Nicht jung.«
Freds nickte. »Meine ich auch.«
»Dann ist es Mallory«, sagte ich.
»Hm.« Freds stand auf und trat zurück. »Das wäre es dann wohl. Das Geheimnis ist gelöst.« Er sah uns an und sprach kurz mit Kunga Norbu. »Er muß die meisten Jahre unter Schnee gelegen haben. Aber verstecken wir ihn den Briten zuliebe unter Felsen.«
Das war leichter gesagt als getan. Da er in der Spalte steckte, mußten wir nur ein paar Steine über ihn legen. Doch wir fanden schnell heraus, daß es hier kaum irgendwelche losen Steine gab; der Wind hatte sie hinabgerollt. Also mußten wir paarweise arbeiten und und große flache Platten heranschaffen, die schwer genug waren, um gegen den Wind bestehen zu können.
Diese sammelten wir noch immer, als Freds plötzlich nach hinten deutete und sich auf zutageliegenden Fels des Rings setzte. »He, die Briten sind über uns auf dem Westgrat! Sie sind fast auf gleicher Höhe mit uns!«
»Arnold kann nicht weit zurück sein«, sagte ich.
»Wir haben hier noch eine Stunde zu tun«, rief Freds. »He, Laure, hör zu — geh zu unserem Lager zurück und pack unsere Sachen. Und dann gehst du den Briten entgegen und sagst ihnen, sie sollen langsamer werden. Verstanden?«
»Langsamerwerden«, wiederholte Laure.
»Genau. Erkläre ihnen, daß wir Mallory gefunden haben und sie diese Gegend meiden sollen. Verschaffe uns Zeit. Du bleibst bei ihnen und steigst mit ihnen hinab. George und Kunga und ich folgen euch dann, und wir treffen euch bei Gorak Shep.«
Gorak Shep? Das schien tiefer zu liegen, als es nötig war.
Laurenickte. »Langsamerwerden, hinabsteigen, wirtreffen euch bei Gorak Shep.«
»Du hast’s kapiert, Kumpel. Wir sehen euch dann da unten.«
Laure nickte und ging los.
»Also schön«, sagte Freds. »Decken wir den Burschen zu.«
Wir errichteten eine kleine Mauer um ihn und legten dann die größte Platte von allen als Grabstein über seinen Kopf. Nur zu dritt konnten wir sie hochheben, und wir taumelten herum, um sie in Position zu bringen, ohne seine Ruhe zu stören; danach hatten wir wirklich kaum noch Luft.
Als wir fertig waren, war die Leiche vollständig abgedeckt, und die meiste Zeit über würde Schnee unser Hügelgrab bedecken, und es würde aussehen wie eine kleine Erhebung unter tausenden. Also hatten wir es geschafft. »Sollten wir nicht etwas sagen?« fragte Freds. »Du weißt schon, ein Gebet oder so?«
»He, Kunga ist der Tulku«, sagte ich. »Sag’ ihm, er soll es machen.«
Freds sprach mit Kunga. Auf seiner Schneebrille konnte ich kleine Abbilder von Kunga sehen, der wie ein Marsianer aussah. Seit Mallory hatte sich die Bergsteigerkleidung doch ziemlich verändert!
Kunga Norbu stand am Ende unseres Grabes und steckte die in Fäustlingen steckenden Hände aus; er sprach eine Weile auf Tibetanisch.
Danach übersetzte Freds seine Worte für mich. »Geist von Chomolungma, Mutter Göttin der Welt, wir sind hier, um die Leiche von George Leigh Mallory zu begraben, des ersten Menschen, der deine geheiligten Hänge erstieg. Er war ein Bergsteiger mit großem Mut, der niemals aufgab, und wir lieben ihn dafür — er zeigte uns sehr rein etwas, das wir alle in uns selbst schätzen. Ich möchte auch hinzufügen, daß aus seiner Kleidung und Ausrüstung ersichtlich wird, daß er ein kompletter Idiot war, überhaupt hier hinaufzusteigen, und möchte mich in besonderer Ehrfurcht auch vor dieser Eigenschaft verneigen. Und so stehen wir hier, drei Schüler deines heiligen Geistes, und ergreifen diesen Augenblick, um diesen Geist hier und in uns und überall auf der Welt zu ehren.« Kunga neigte den Kopf, und Freds und ich folgten seinem Beispiel und gedachten seiner schweigend; und wir hörten nur den Wind, der über die Mutter Göttin nach Tibet pfiff.
13
Na schön. Wir hatten unsere Mission vollbracht, Mallory ruhte für alle Zeiten sicher auf dem Everest, wir hatten eine überraschend bewegende Andacht gehalten, und zumindest ich war sehr zufrieden. Doch als wir wieder im Lager waren, benahmen Freds und Kunga sich plötzlich sehr seltsam. Laure hatte das Zelt und unsere Rucksäcke ausgepackt und für uns zurückgelassen, und nun packten Freds und Kunga schnell alles wieder zusammen.
Ich sagte etwas dahingehend, daß man von Mallorys letzter Ruhestätte doch eine hervorragende Aussicht habe, und Freds sah mich an und meinte: »Na ja, es gibt noch eine Aussicht, die ein klein wenig besser ist.« Und er fuhr damit fort, fieberhaft zu packen. »Ich wollte sowieso mal mit dir darüber sprechen«, sagte er dabei. »Ich meine, nun sind wir schon mal hier, oder? Ich meine, hier sind wir nun.«
»Ja«, sagte ich. »Hier sind wir nun.«
»Ich will damit sagen, hier sind wir fast auf achteinhalbtausend Metern auf dem Everest. Und wir haben erst Mittag, und es ist ein parfekter Tag. Ja, wirklich, ein absolut perfekter Tag. Man könnte sich keinen schöneren Tag vorstellen.«
Ich begriff, worauf er hinauswollte. »Nichts da, Freds.«
»Na, komm schon! Jetzt sei nur nicht vorschnell, George! Wir haben alle schweren Teile hinter uns, und von hier aus bis zum Gipfel ist es nur noch ein Spaziergang!«
»Nein«, sagte ich entschlossen. »Wir haben keine Zeit. Und wir haben nicht genug Vorräte. Und wir können dem Wetter nicht vertrauen. Es ist zu gefährlich!«
»Zu gefährlich! Die ganze Bergsteigerei ist zu gefährlich, George, aber mir ist noch nie aufgefallen, daß dich das schon mal gestört hat. Denk doch mal nach, Mann! Das ist kein gewöhnlicher Berg, das ist kein Rainier oder Denali, das ist der Everest. Sagarmatha! Chomolungma! Der große E! War es nicht schon immer dein geheimer Wunsch, den Everest zu besteigen?«
»Naja … nein. Ist es nie gewesen.«
»Ich glaube dir nicht! Meiner ist es ganz bestimmt, das kann ich dir flüstern! Und deiner ist es auch.«
Die ganze Zeit über, während wir uns stritten, ignorierte Kunga Norbu uns, wühlte in seinem Rucksack und warf verschiedene überflüssige Gegenstände heraus.
Freds setzte sich neben mich und zeigte mir den Inhalt seines Rucksacks. »Ich habe unsere Schlafsäcke, den Gaskocher, einen Topf, Suppe, Zitronenkonzentrat, genug Vorräte, und hier ist meine Schneeschaufel; wir können also überall unser Zelt aufschlagen. Alles, was wir brauchen.«
»Nein.«
»Sieh her, George.« Freds nahm seine Schneebrille ab und sah mir in die Augen. »Es war ja ganz nett, Mallory zu begraben und so, aber ich muß dir sagen, daß Kunga Lama und mich ein … hm … tieferliegender Grund hierher geführt hat. Wir haben uns den Engländern bei ihrer Lingtren-Besteigung angeschlossen, weil ich von dieser Mallory-Expedition aus dem Norden gehört hatte. Ich hatte von Anfang an vor, ihnen davon zu erzählen, unser Foto zu zeigen, zu behaupten, daß Kunga der Bursche sei, der 1980 Mallorys Leiche gesehen habe, und vorzuschlagen, daß sie ihn verstecken.«
»Du meinst, Kunga hat Mallorys Leiche gar nicht gesehen?« fragte ich.
»Nein, hat er nicht. Das habe ich erfunden. Der chinesisehe Bergsteiger, der hier oben eine Leiche gesehen hat, starb ein paar Jahre später. Also ließ ich Kunga nur das grobe Gebiet einzeichnen, wo der Chinese ihn gesehen haben wollte. Deshalb war ich so überrascht, als wir den Burschen tatsächlich fanden! Obwohl es einem ja schon der gesunde Menschenverstand verraten müßte, wenn man sich die Nordwand ansieht — nur der Schwarze Ring hätte ihn aufhalten können.
Ich habe also gelogen und auch vorgeschlagen, wir sollten die Hornbein-Schlucht hinauf und die Leiche suchen, als Arnold sich an die Engländer hängte, weil ich hoffte, wir würden Zeit und Gelegenheit finden, zum Gipfel hinaufzusteigen, wenn das Wetter mitspielt. Wir beide haben einfach darauf gehofft, Mann, und hier sind wir nun. Wir haben alles geplant, Kunga und ich haben alles vorbereitet — wir haben alle Vorräte, die wir brauchen, und wenn wir nach der Gipfelbesteigung unser Zelt auf dem Südgipfel aufschlagen müssen, können wir über den Südöstlichen Sattel hinabsteigen, uns zum indischen Armeeteam durchschlagen und zum Basislager bringen lassen. Das ist die Yakroute, und die ist völlig problemlos.«
Er atmete ein paar Mal durch. »Und hör zu. Kunga Lama hat mystische Gründe, um dort hinaufzusteigen. Es hat mit seinem langjährigen Guru Dorjee Lama zu tun. Weißt du noch, daß ich dir in Chimoa erzählt habe, Dorjee Lama habe Kunga Norbu eine Aufgabe gestellt, die er lösen müsse, bevor das Kloster bei Kum-Bum wieder aufgebaut werde und Kunga endlich selbst ein Lama werden kann? Nun — die Aufgabe lautete, den Chomolungma zu besteigen! Dieser alte Mistkerl hat zu Kunga gesagt, besteige den Chomolungma, und alles kommt in Ordnung! Er hat sich wohl gedacht, daß er damit einen Schüler haben würde, der auf dieser Seite vom Nirwana noch mal soviele Reinkarnationen durchlaufen muß. Aber er hat nicht damit gerechnet, daß sich Kunga Norbu mit seinem alten Schüler Freds Fredericks und dessen Kumpel George Fergusson zusammentut!«
»Augenblick mal«, sagte ich. »Ich verstehe ja, daß es dir wirklich ernst damit ist, und das respektiere ich auch, aber ich komme nicht mit.«
»Wir brauchen dich, George! Außerdem steigen wir auf jeden Fall hinauf, und wir können dich wirklich nicht allein die Westseite hinabsteigen lassen — das wäre gefährlicher, als wenn du mit uns kommst! Und wir besteigen den Gipfel, also mußt du mitkommen, so einfach ist das!«
Freds hatte so schnell und nachdrücklich gesprochen, daß er völlig außer Atem war; er deutete mit der Hand auf Kunga Norbu. »Sprich du mit ihm«, sagte er zu Kunga und sagte dann etwas auf Tibetanisch, zweifellos eine Wiederholung seiner Bitte.
Kunga Norbu zog seine Schneebrille hoch und sah mich sehr ernst an. Er wirkte etwas traurig; es war jener Ausdruck, wie man ihn sieht, wenn man sich weigert, für die Heilsarmee zu spenden. Seine schwarzen Augen sahen wie immer direkt durch mich hindurch, und im strahlenden Sonnenlicht in dieser Höhe pulsierten seine Pupillen irgendwie, hin und her, hin und her, hin und her. Und ich will verdammt sein, wenn dieser alte Mistkerl mich nicht hypnotisiert hat. Doch, ich glaube schon.
Aber ich kämpfte dagegen an. Ich stellte plötzlich fest, daß ich meinen Rucksack packte und meine Steigeisen überprüfte, ob sie auch wirklich fest waren, und gleichzeitig rief ich Freds zu: »Freds, sei vernünftig! Niemand steigt ohne Unterstützung einfach so den Everest hinauf! Das ist zu gefährlich!«
»He, Messner hat’s getan. Messner kletterte in zwei Tagen vom Nordsattel hinauf, und nur seine Freundin wartete unten im Basislager auf ihn.«
»Du kannst Reinhold Messner nicht als Beispiel nehmen«, rief ich. »Messner ist verrückt.«
»Nee. Er ist nur zäh und schnell. Und das sind wir auch. Es wird kein Problem sein.«
»Freds, eine Everestbesteigung wird allgemein als Problem angesehen.« Aber Kunga Norbu hatte den Rucksack geschultert und ging den Hang über unserem Lager hinauf, und Freds folgte ihm, und ich folgte Freds. »Und ein ganz großes Problem ist«, rief ich, »daß wir keinen Sauerstoff haben.«
»Heutzutage wird er ständig ohne Sauerstoff bestiegen.«
»Ja, aber man muß teuer dafür bezahlen. Man bekommt da oben nicht genug Sauerstoff, und es sterben unglaublich viele Gehirnzellen ab! Wenn wir da raufgehen, werden wir bestimmt Millionen von Gehirnzellen verlieren!«
»Na und?« Er sah die Berechtigung des Einwandes nicht ein.
Ich stöhnte auf. Wir stiegen weiterhin den Hang hinauf.
14
Und so kam es, daß ich mit einem tibetanischen Tulku und einem Verrückten aus Arkansas den Mount Everest bestieg. Ein vernünftiger Mensch hätte bei so einem Unternehmen niemals mitgemacht, und als ich hinter Freds und Kunga hertrottete, konnte ich in der Tat kaum glauben, daß es geschah. Aber ein jeder qualvolle Atemzug überzeugte mich vom Gegenteil. Und da es sich nun einmal nicht ändern ließ, kam ich zum Schluß, daß es angebracht sei, mich in den richtige Geisteszustand dafür zu bringen; sonst würde es nur um so gefährlicher sein. »Ich wollte das schon immer tun«, sagte ich und verbannte den übermächtigen Eindruck, dazu hypnotisiert worden zu sein, aus meinen Gedanken. »Wir besteigen den Everest, und das wollte ich schon immer mal.«
»Das ist die richtige Einstellung«, sagte Freds.
Ich ignorierte ihn und dachte weiterhin bei jedem zweiten Schritt: »Das wollte ich schon immer.« Nach ein paar hundert Schritten mußte ich mir eingestehen, daß ich mich halbwegs überzeugt hatte. Ich meine, der Everest! Denken Sie doch mal drüber nach! Wie jeder andere auch hatte ich wohl schon immer insgeheim diesen Wunsch verspürt.
Ich will Sie nicht mit den Einzelheiten unserer Route langweilen; wenn es Sie interessiert, können Sie sie in meinem anonymen Artikel im American Alpine Journal, Ausgabe 1987, nachlesen. In der Tat ging es ziemlich glatt; wir stiegen von der Hornbein-Schlucht quer zum oberen Westsattel auf und nahmen von dort aus den Gipfel in Angriff.
Ich tat dies in jeweils zehn Schritten auf einmal; die Höhe machte mir nun endgültig zu schaffen. Ich akklimatisiere mich so gut wie kaum ein anderer, den ich kenne, doch niemand akklimatisiert sich noch bei über achteinhalbtausend Metern Höhe. Es kommt schließlich nur noch darauf an, wie schnell man erschöpft ist.
»Versuche, so langsam wie nötig zu gehen, und vermeide Ruhepausen«, riet mir Freds.
»Ich gehe schon so langsam, wie ich kann.«
»Nein, tust du nicht. Versuche einfach, bergaufwärts zu schleichen. Leg wirklich den ersten Gang ein. Dann fällst du in einen ganz bestimmten Rhythmus.«
»Na schön. Ich versuch’s.«
Wir hatten uns gerade gesetzt, um unsere Steigeisen abzunehmen, die nun überflüssig waren. Freds behielt recht, was den Schwierigkeitsgrad unserer Klettertour betraf. Der Grat war breit, nicht sehr steil und ziemlich aufgerissen, so daß überall unregelmäßige Felstreppen darauf lagen. Hätte er sich auf Meereshöhe befunden, hätte man ihn buchstäblich hinauf laufen können. Es war so einfach, daß ich Freds Vorschlag ausprobieren konnte, und ich folgte ihm und Kunga mit Zeitlupenbewegungen hinauf. Bei dieser Geschwindigkeit konnte ich etwa zehn oder fünfzehn Minuten gehen, bevor ich mich ausruhen mußte — wie lange genau, ließ sich nur schwer sagen, da mir jedes Intervall wie ein Nachmittag vorkam.
Doch bei jeder Rast waren wir ein Stück höher. Es ließ sich nicht abstreiten, daß man vom Westgrat eine erstklassige Aussicht hatte: zu unserer Rechten alle Berge Nepals, zu unserer Linken alle Berge Tibets, und Sikkim und Bhutan waren zur Abwechslung auch noch da. Das einzige, was sich noch über uns befand, war die Pyramide des letzten Gipfels des Everest, der sich strahlendweiß vor einem schwarzblauen Himmel erhob.
Bei jeder Rast stellte ich fest, daß Kunga Norbu ein seltsames buddhistisches Lied summte; er sah auf unterschwellige Art und Weise immer glücklicher aus, während Freds’ Grinsen immer breiter wurde. »Kannst du glauben, daß wir einen so perfekten Tag erwischt haben? Wunderschön, was?«
»Hmm.« Der Tag war wirklich schön, doch ich war zu müde, um ihn zu genießen. Doch bei jeder Rast floß ein Teil ihrer Energie in mich hinein, und das war nur gut so, denn sie gingen wirklich schnell voran, und ich brauchte ihre Hilfe.
Schließlich lag wieder Schnee auf dem Grat, und wir mußten uns setzen und die Steigeisen wieder anlegen. Mir fiel dieser überaus einfache Vorgang so schwer, daß ich es fast nicht schaffte. Meine Hände hinterließen rosafarbene Nachbilder in der Luft, und ich zischte und stöhnte bei jedem Zug an den Riemen. Als ich fertig war und aufstand, wäre ich beinahe umgekippt. Die Felsen verschwammen vor mir, und selbst mit der Brille war der Schnee schmerzhaft weiß.
»Das letzte Stück«, sagte Freds, als wir den Berg hinaufsahen. Wir machten uns auf den Weg, und die Steigeisen drangen tief in festen Schnee ein. Kunga legte ein unglaubliches Tempo vor. Freds und ich marschierten Seite an Seite im Gleichschritt, um besser mit der geistigen Anstrengung fertig zu werden.
Freds wollte sprechen, obwohl er keine Atemluft zu verschwenden hatte. »Der alte Dorjee Lama. Wird ziemlich. Überrascht sein. Wenn sie Kum-Bum. Wieder aufbauen. Ha!«
Ich nickte, als glaubte ich die ganze Geschichte. Das war eine Übertreibung, doch es spielte keine Rolle. Nichts spielte mehr eine Rolle, abgesehen davon, in blendend weißem Schnee einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Ich habe gelesen, daß sich der Everest genau an der Grenze des Machbaren befindet, was das Bergsteigen ohne Sauerstoffflaschen betrifft. Das wissenschaftliche Team, das nach einer Besteigung, bei der Luft- und Atemproben genommen wurde, zu dieser Schlußfolgerung gelangte, hat sogar erklärt, theoretisch sei es überhaupt nicht möglich. Aber theoretisch kann eine Hummel auch nicht fliegen. Ein Wissenschaftler stellte die Theorie auf, daß es wirklich nicht möglich sei, wenn der Everest auch nur hundert Meter höher wäre.
Ich glaube ihr. Mit Sicherheit waren die letzten paar Schritte diese Schneepyramide hinauf die schwersten, die ich jemals getan habe. Meine Brust hob und senkte sich mit sinnlosen Atemzügen, und ich konnte hören, wie die Gehirnzellen zu Tausenden zersprangen, knack, knister, plop. Wir näherten uns dem Gipfel, einer dreieckigen Kuppel aus reinem Schnee; doch ich mußte langsamer gehen.
Kunga war uns vorausgeeilt und hatte auf den letzten Metern noch an Geschwindigkeit zugelegt. Als ich auf den Schnee hinabblickte, verlor ich ihn aus den Augen. Dann kamen seine Stiefel in mein Blickfeld, und ich begriff, daß wir es fast geschafft hatten, nur noch ein paar Schritte unter dem höchsten Punkt waren.
Der eigentliche Gipfel war eine zerklüftete Schneekuppe von etwa zweieinhalb Metern Länge und einem Meter Breite. Es war keine Berg, aber auch keine breite Hügelspitze; man hätte darauf kein kleines Tänzchen abhalten wollen.
»Tja«, sagte ich. »Da sind wir.« Irgendwie konnte ich mich nicht darüber begeistern. »Zu schade, daß ich keine Kamera mitgenommen habe.« In Wirklichkeit empfand ich gar nichts.
Neben mir rührte sich Freds. Er schlug mir auf den Arm und deutete zu Kunga Norbu hinauf. Wir waren noch unter ihm; unsere Köpfe befanden sich etwa auf gleicher Höhe wie seine Stiefel. Er summte und hatte die Arme ausgestreckt und gehoben, als dirigiere er im Osten ein Symphonieorchester. Ich sah in diese Richtung. Mittlerweile war es Spätnachmittag, und der Schatten des Everest dehnte sich bis zum Horizont und sogar darüber hinaus aus. Im Osten müssen Eispartikel in der Luft gehangen haben, denn plötzlich sah ich über dem Dunkel des Everest-Schattens einen großen Eisbogen. Es war fast ein vollständiger Farbkreis, viel durchsichtiger als ein Regenbogen und am unteren Ende vom dreieckigen Schatten des Berges abgeschnitten.
In diesem schwach gefärbten runden Bogen, über der dunklen Luft des Schattengipfels, befand sich ein von Licht umgebenes Schattenkreuz. Es war ein Brockengespenst-Phänomen, verursacht durch niedrigstehendes Sonnenlicht, das die Schatten von Gipfeln und Bergsteigern auf feuchte Luft wirft und ein helles Halo um sie herum entstehen läßt. Ich hatte schon mal eins gesehen.
Dann breitete Kunga Norbu ruckartig die Hände aus, und die ganze Vision verschwand augenblicklich.
»Mann«, sagte ich.
»Allerdings«, murmelte Freds und führte mich die letzten qualvollen Schritte auf den Gipfel selbst hinauf, so daß wir neben Kunga Norbu standen. Er hatte den Kopf zurückgelegt, und auf seinem Gesicht stand ein Lächeln aus reiner, kindlicher Freude.
Ich weiß nicht mehr, was wirklich dort oben geschah. Vielleicht wurde ich ohnmächtig und sah eine Sekunde lang Farben, dachte, es sei ein Eisbogen gewesen, und dann blinzelte ich und sah wieder klar. Aber ich weiß, daß ich in diesem Augenblick, als ich Kunga Norbus entrücktes Gesicht betrachtete, sicher war, daß er seine Freiheit gewonnen und sich dies oben im Himmel abgezeichnet hatte. Die Aufgabe war vollbracht, er hatte die Arme vor Freude ausgebreitet … Ich glaubte es auf einmal. Ich schluckte und hatte einen Kloß im Hals.
Nun fühlte ich es auch; ich fühlte, wo wir waren. Wir hatten Chomolungma erstiegen. Wir standen auf dem Dach der Welt.
Freds atmete ein paar Mal ein und aus. »Tja«, sagte er und schüttelte Kunga und mir die Hand. »Wir haben es geschafft!« Und dann schlugen wir uns gegenseitig auf den Rücken, bis wir bald vom Berg gefallen wären.
15
Wir waren noch nicht lange oben, als ich schon wieder das Problem des Abstiegs in Betracht zog. Es war nicht mehr viel vom Tag übrig, und wir waren von jedem trauten Heim weit entfernt. »Was nun?«
»Ich glaube, wir steigen besser zum Südgipfel hinab und graben uns für die Nacht eine Schneehöhle. Weiter schaffen wir es nicht, und das haben Haston und Scott 1975 auch getan. Es hat bei ihnen geklappt, und auch bei ein paar anderen Gruppen.«
»Na schön«, sagte ich. »Dann mal los.«
Freds sagte etwas zu Kunga, und wir machten uns an den Abstieg. Augenblicklich stellte ich fest, daß die südöstliche Seite nicht so breit oder flach wie die westliche war. In der Tat stiegen wir eine Art schneebedeckten, messerscharfen Grat hinab, aus dem häßliche graue Felsen hinausstachen. Das also war die Yakroute! Wir brauchten eine verdammt harte Stunde, um auf den Südgipfel hinabzusteigen, und wir schafften es nur, weil wir ununterbrochen bergab kletterten.
Der Südgipfel ist ein großer Vorsprung im südöstlichen Grat, der aus einer Art Höcker — dem Nebengipfel — und einem flachen Stück besteht. Hier fanden wir einen breiten Hang aus sehr tiefem, festem Schnee — perfekte Bedingungen für eine Schneehöhle.
Freds holte seine kleine Aluminiumschaufel aus dem Rucksack und machte sich wie ein Hund, der einen Knochen sucht, ans Graben. Ich begnügte mich damit, mich zu setzen und ihm zuzusehen. Kunga Norbu stand da und betrachtete die schier unendliche Ausdehnung der Gipfel; er wirkte etwas benommen. Ein- oder zweimal brachte ich die Kraft auf, Freds abzulösen. Nachdem wir einen körpergroßen Einstieg gegraben hatten, gaben wir uns mit einer Höhle zufrieden, die gerade groß genug war, um uns drei aufzunehmen. Sie erinnerte mich etwas an einen Sarg für Drillinge.
Die Sonne ging unter, Sterne kamen hervor, das Zwielicht wurde mitternachtsblau; dann war Nacht. Und es wurde sehr, sehr kalt. Freds erklärte, die Höhle sei fertig, und ich kroch zu ihm und Kunga hinein und fühlte dabei, wie Schneekörner unter mir knirschten. Wir schlugen mit den Köpfen zusammen und ordneten unsere Schlafsäcke so an, daß wir in einem kleinen Kreis saßen, auf einem groben Sims über unserem Eingangstunnel, in einer fast kreisrunden Kammer. Wenn ich vornübergebeugt saß, blieben mir über dem Kopf noch drei Zentimeter Platz. »Na schön«, sagte Freds müde. »Machen wir eine Party.« Er nahm den Gaskocher aus seinem Rucksack, hielt ihn eine Weile in den Fäustlingen, um das Gas darin zu erwärmen, stellte ihn dann in der Mitte zwischen uns auf den Schnee und zündete ihn mit seinem Feuerzeug an. Der blaue Schimmer war blendendhell, das Zischen ohrenbetäubend. Wir zogen unsere Fäustlinge aus und legten unsere Hände darüber, so daß kaum noch Platz zwischen der Flamme und unserer Haut blieb. Allmählich erwärmte sich unsere Höhle etwas.
Ihnen kommt es vielleicht seltsam vor, daß sich eine Schneehöhle überhaupt erwärmen kann, doch vergessen Sie nicht, daß wir hier von relativen Temperaturen sprechen. Draußen war es etwa fünfundzwanzig Grad unter Null. Dazu der Wind und die Höhe, in der es so wenig Sauerstoff gibt, und man stirbt. In der Höhle jedoch gab es keinen Wind. Der Schnee selbst ist gar nicht so kalt, und er ist ein hervorragender Isolator: er erwärmt sich, wird an der Oberfläche sogar feucht, und auch das Wasser hält die Wärme hervorragend. Dazu noch einen auf Hochtouren laufenden Gaskocher und drei Körper, die ihre sechsunddreißig Grad Körpertemperatur abgeben, und selbst mit dem Loch nach draußen steigt die Temperatur leicht auf über null Grad. Das ist noch kälter als in einem Eisschrank, aber im Vergleich zu den fünfundzwanzig Grad minus draußen ist es das reinste Strandwetter.
Also waren wir zuerst richtig zufrieden in unserer kleinen Höhle. Freds scharrte etwas Schnee von den Wänden in seinen Topf und kochte heiße Zitrone. Er bot mir Mandeln an, doch ich hatte nicht den geringsten Appetit; und wenn ich Mandeln aß, hatte ich sowieso immer den Eindruck, einen Kaffeetisch zu verspeisen. Wir waren jedoch fürchterlich ausgetrocknet und tranken die heiße Zitrone, als sie kochte, was in dieser Höhe schon etwa bei Badetemperatur der Fall war. Sie schmeckte himmlisch.
Doch damit war für Freds die Party keineswegs erledigt. Sein Feuerzeug scharrte, und in dessen Licht sah ich, wie er ein Loch in die Wand grub und eine Kerze darin aufstellte. Er zündete sie an, und ihr Licht wurde von den glatten weißen Wänden unseres Heims reflektiert. Er unterhielt sich kurz mit Kunga Norbu.
»Na schön«, sagte er, als er fertig war; sein Atem breitete sich weiß in die Luft aus. »Kunga wird jetzt etwas Tumo machen.«
»Tumo?«
»Das ist die Kunst, sich ohne Feuer im Schnee selbst zu erwärmen.«
Das erregte mein Interesse. »Noch eine Lama-Fähigkeit?«
»Darauf kannst du dich verlassen. Sie kommt nackten Einsiedlern im Winter ganz gelegen.«
»Das sehe ich ein. Sag ihm, er soll es uns vorführen.«
Mit einigem Knirschen nahm Kunga die Lotusposition ein, mit den großen Schneestiefeln an seinen Füßen eine beeindruckende Leistung.
Er zog seine Fäustlinge aus, und wir folgten seinem Beispiel. Dann sah er ins Nichts und begann in einem regelmäßigen, tiefen Rhythmus zu atmen. Das ging fast eine halbe Stunde so weiter, und ich befürchtete schon, wir würden alle erfrieren, bevor ihm warm wurde, als er seine Hände zu Freds und mir ausstreckte. Wir nahmen sie in die unseren.
Sie waren so warm, als hätte er schreckliches Fieber. Ängstlich berührte ich sein Gesicht — es war warm, aber nichts im Vergleich zu den Händen. »Mein Gott«, sagte ich.
»Wir können ihm jetzt helfen«, sagte Freds leise. »Du mußt dich konzentrieren, die Energie nutzbar machen, die immer in dir ist. Mit jedem Atemzug stößt du Stolz, Ärger, Haß, Neid, Trädheit und Dummheit von dir. Mit jedem Atemzug nimmst du Buddhas Geist, die fünf Weisheiten und alles Gute in dich auf. Wenn du ganz klar und ruhig bist, stellst du dir einen goldenen Lotus in deiner Magengrube vor … Alles klar? In diesem Lotus stellst du dir die Silbe mm vor, die Feuer bedeutet. Dann mußt du sehen, wie eine kleine Flamme — etwa von der Größe eines Ziegenköttels — im ram entsteht. Jeder Atemzug danach ist wie ein Blasebalg, der diese Flamme auffächert, die durch die Tsas im Körper gleitet, die mystischen Nerven. Stell dir den Prozeß in fünf Stadien vor … Zuerst siehst du das Uma tsa als Feuer, das mehr oder weniger dein Rückgrat hinaufkriecht … Zweitens, der Nerv hat den Durchmesser deines kleinen Fingers … Drittens, er ist so groß wie ein Arm … Viertens, dein Körper ist das Tsa selbst und wird als Feuerröhre wahrgenommen … Fünftens, das Tsa verschlingt die Welt, und du bist nur eine Flamme in einem Feuermeer.«
»Mein Gott.«
Wir saßen da und hielten Kunga Norbus heiße Hände, und ich stellte mich als Feuerröhre vor; und die Wärme ergoß sich in mich, meine Arme hinauf, durch meinen Oberkörper — sie taute sogar meinen erfrorenen Hintern und meine Füße auf. Ich sah Kunga Norbu an, und er sah direkt durch die Wand unserer Höhle in die Ewigkeit, oder wohin auch immer, und seine Augen glühten schwach im Kerzenlicht. Es war unheimlich.
Ich weiß nicht, wie lange das anhielt — es schien endlos zu währen, obwohl es vermutlich nur etwa eine Stunde dauerte. Doch dann hörte es auf — Kungas Hände wurden kälter, und unsere Körper ebenfalls. Er blinzelte mehrere Male und schüttelte den Kopf. Dann sagte er etwas zu Freds.
»Tja«, sagte Freds. »Länger kann er es dieser Tage nicht durchhalten.«
»Was?«
»Tja …« Er biß sich bedauernd auf die Zunge. »Es ist ungefähr so. Tulkus neigen dazu, im Verlauf ihrer verschiedenen Inkarnationen ihre Kräfte zu verlieren. Anscheinend verlieren sie bei jedem Prozeß etwas, genauso, als ob man ein Band von einer Kopie zieht, oder so. Es gibt einen Namen dafür.«
»Übertragungsfehler«, sagte ich.
»Genau. Na ja, das erwischt sie auch. Man sieht in Tibet sogar jede Menge Tulkus, die völlige Trottel sind. Kunga ist besser dran, aber er erinnert mich etwas an Paul Revere. Ein kleines Licht im Glockenstuhl, du weißt schon. Ein großer Lama, und ein toller Bursche, aber bei den mystischen Disziplinen nicht mehr besonders mächtig.«
»Zu schade.«
»Finde ich auch.«
Ich erinnerte mich an Kungas heiße Hände und ihre Wärme, die in mich drang. »Also … ist er eigentlich gar kein Tulku, oder?«
»Oh, ja! Natürlich! Und jetzt hat er sich auch vom alten Dorjee Lama befreit und ist selbst ein Lama und niemandes Schüler mehr. Es muß ein tolles Gefühl sein.«
»Darauf gehe ich jede Wette ein. Aber wie genau funktioniert das überhaupt?«
»Wie man ein Tulku wird?«
»Ja.«
»Es kommt darauf an, seine geistigen Kräfte zu konzentrieren. Die Tibetaner glauben, daß es gar kein übersinnliches Phänomen ist, sondern nur eine Ausnutzung der natürlichen Kräfte, die wir alle haben. Tulkus haben ihre psychischen Energien unglaublich konzentriert, und wenn man diese Ebene erreicht hat, kann man seinen Körper verlassen, wann immer man will. Wenn Kunga wollte, könnte er in etwa zehn Sekunden sterben.«
»Sehr nützlich.«
»Ja. Und wenn sie sich also dazu entscheiden, springen sie ins Bardo. Das Bardo ist die andere Welt, die Welt des Geistes, und ein sehr verwirrender Ort — Halluzinationen sind nichts dagegen! Zuerst geht vor deinem Gesicht ein Licht an, wie das Blitzlicht von Gottes Kamera. Dann sind es nur ein Haufen farbiger Wege, Erscheinungen und so weiter. Wie Kunga es beschreibt, klingt es echt unheimlich. Wenn man nur ein ganz gewöhnlicher Geist ist, kann man leicht die Orientierung verlieren und wird als Schnecke oder als Showmaster einer dieser Spielshows im Vorabendprogramm oder als irgend etwas wiedergeboren. Doch wenn man konzentriert bleibt, wird man in dem Körper wiedergeboren, den man sich ausgesucht hat, und macht von da ausweiter.«
Ich nickte einfältig. Mir war müde und kalt, und der Sauerstoffmangel beschleunigte meine Gedankengänge nicht gerade; ich konnte Freds’ Ausführungen nicht den geringsten Sinn entnehmen, wenngleich das an allen anderen Orten vielleicht genauso gewesen wäre.
Wir saßen da. Kunga summte etwas vor sich hin. Es wurde kälter.
Die Kerze tropfte und erlosch.
Es war dunkel. Es wurde noch kälter.
Nach einer Weile war nur noch die Dunkelheit da, unser Atmen und die Kälte. Ich fühlte meinen Hintern und die Beine unterhalb der Knie nicht mehr. Ich wußte, daß ich auf etwas wartete, hatte jedoch vergessen, worauf. Freds bewegte sich und sprach auf Tibetanisch mit Kunga. Sie schienen weit, weit entfernt zu sein. Sie sprachen mit Menschen, die ich nicht sehen konnte. Eine Weile zappelte Freds hin und her und stieß gegen die Wände der Höhle. Kunga rief heiser Worte wie »Hak!« und »Phut!«
Schließlich raffte ich mich auf. »Was macht ihr da?« fragte ich.
»Wir wehren Dämonen ab«, erklärte Freds.
Ich war, als ich meine Gefährten beobachtete, schon zu der Schlußfolgerung bereit, daß der Sauerstoffmangel einen in den Wahnsinn treiben kann; aber als ich daran dachte, wer sie waren, stellte ich mein endgültiges Urteil noch etwas zurück. Vielleicht lag es doch nicht am Sauerstoff.
Eine unbestimmbare Weile später fing Freds an, Schnee aus dem Tunnel zu schaufeln. »Wirfst du die Dämonen raus?« fragte ich.
»Nein, ich will wieder warm werden. Versuch’s doch auch mal.«
Ich hatte nicht die Kraft, mich zu bewegen.
Dann schüttelte er mich von einer Seite zur anderen, wechselte ins Englische und erzählte mir Geschichten. Eine Geschichte nach der anderen, mit trockener, heiserer, tiefer Stimme. Ich verstand keine davon. Ich mußte mich darauf konzentrieren, gegen die Kälte anzukämpfen. Und auf das Atmen. Freds wurde ganz aufgeregt; er erzählte mir eine Geschichte von Kunga, etwas darüber, wie er mit einem Freund durch Tibet lief, irgendein Lung-gom-pa-Test, und der Freund schleppte Ketten mit sich, um nicht ganz davonzutreiben. Dann begegneten sie nachts einem frischgebackenen Ehemann, ließen die Ketten in ein Lagerfeuer fallen … »Die Träger wußten vom Lung-gom, und am nächsten Morgen müssen sie versucht haben, es den Engländern zu erklären. Kannst du dir das vorstellen? Träger, die erklären, wie diese Ketten aus dem Nichts kommen … daß Leute sie benutzen, die durch Tibet laufen, damit sie nicht in den Orbit abzischen? Mann, diese Engländer müssen gedacht haben, sie würden das Land Oz erforschen. Meinst du nicht auch? He, George? George? … George?«
16
Doch schließlich ging die Nacht vorbei, und ich war noch da.
Wir krochen noch vor dem ersten Licht der Dämmerung aus unserer Höhle, stampften mit den Füßen, bis wieder etwas Gefühl in sie zurückkehrte, und waren sehr mit uns zufrieden. »Guten Morgen!« sagte Kunga Norbu höflich zu mir. Und damit hatte er recht. Hochstehende Wolken färbten sich über uns rosa, und ein Meer aus blauen Wolken trieb weit unter uns über Nepal dahin. Die höheren Gipfel stachen wie Inseln daraus hervor und färbten sich ebenfalls langsam rosa. Ich hatte nie einen überirdischeren Anblick wahrgenommen; es war, als wären wir aus der Höhle auf einen anderen Planeten gekrochen.
»Vielleicht sollten wir einfach den Südpaß hinab und uns zu diesen indischen Soldaten durchschlagen«, krächzte Freds. »Ich habe keine Lust, wieder auf den Gipfel zu klettern, um die Westseite hinabzusteigen.«
»Du meinst es ernst«, sagte ich.
Also stiegen wir die Südseite hinab.
Peter Habeier, Messners Partner bei der ersten Besteigung des Everest ohne Sauerstofflaschen im Jahre 1979, ist den Grat vom Gipfel bis zum Südpaß in einer Stunde hinabgerast. Er hatte Angst vor Gehirnschäden; meines Erachtens ist die Geschwindigkeit seines Abstiegs der beste Beweis dafür, daß sie schon eingetreten waren. Wir gingen, so schnell wir konnten, was beunruhigend schnell war, und brauchten fast drei Stunden dafür. Einen Schritt nach dem anderen, einen steilen, verschneiten Grat hinab. Ich weigerte mich, in die tiefen Schluchten zu meiner Rechten und Linken hinabzuschauen. Die Wolken unter uns schwollen an wie die Flut in der Fundy-Bai; unser schönes Wetter würde bald ein Ende finden.
Ich kam mir völlig losgelöst von meinem Körper vor, beobachtete einfach, wie er marschierte. Unter mir sang Freds »›I get up, I get dow-wow-wown‹« aus dem Lied »Close to the Edge« von Yes. Wir gelangte an eine große, schneegefüllte Rinne und rutschten sie achtlos hinab, glitten bei jedem verträumten Schritt acht oder zehn Meter weit. Wir alle drei taumelten mittlerweile. Wolken strömten hinauf, und wie durch Zauberei erschien überall um uns herum Nebel, aber wir waren schon unmittelbar über dem Südpaß, und es spielte keine Rolle mehr. Ich sah, daß man im Paß ein Lager aufgeschlagen hatte, und seufzte erleichert auf. Ansonsten wären wir verloren gewesen.
Die Inder sicherten noch ihre Zelte, als wir hineinmarschierten. Eine Woche perfektes Wetter, und sie waren nur bis zum Südpaß gekommen. Sehr langsam, dachte ich, als wir näher kamen. Eine Besteigung im Belagerungsstil, eine logistische Pyramide, völlig auf Nummer Sicher — und so langsam wie der Bau der anderen Art von Pyramide.
Als wir den Paß überquerten und uns den Zelten näherten, wobei wir Abfallhaufen von vorherigen Expeditionen ausweichen mußten, stellten sich die ersten Sorgen bei mir ein. Sie müssen wissen, daß die indische Armee auf dem Everest unglaubliches Pech gehabt hat. Sie haben mehrmals versucht, den Berg zu besteigen, und sind, soweit ich weiß, immer gescheitert. Hauptsächlich wegen der Stürme, doch die Menschen neigen dazu, dies zu ignorieren, und die Inder haben von der Bergsteigergemeinde in Nepal ziemliche Kritik abbekommen. Man hat sie sogar ›schreckliche Bergsteiger‹ genannt. Sie waren also ziemlich empfindlich in dieser Hinsicht, und mir kam sehr langsam in den Sinn, daß sie nicht allzu erfreut sein würden, im Südpaß von drei Bergsteigern begrüßt zu werden, die gerade auf der Nordseite vom Gipfel hinabkamen.
Dann sah uns einer. Er ließ den Holzhammer in seiner Hand fallen.
»Hallo«, krächzte Freds.
Schnell versammelten sich einige von ihnen um uns. Der Wind wehte nun heftiger, und wir alle waren ihm ungeschützt ausgeliefert. »Wer sind Sie?« rief der älteste Inder dort verdrossen, wahrscheinlich ein Major.
»Wir haben uns verirrt«, sagte Freds. »Wir brauchen Hilfe.«
Ah, gut, dachte ich. Freds hat auch daran gedacht. Er wird ihnen nicht sagen, woher wir kommen. Freds hat noch alle Gedanken beisammen. Er wird dieses Problem richtig angehen.
»Woher kommen Sie?« brüllte der Major.
Fred deutete auf die Westseite. Gut, dachte ich. »Unsere Sherpas haben gesagt, wir sollten uns rechts halten. Und das haben wir seit Jomosom auch getan.«
»Woher kommen Sie, bitte?«
»Jomosom!«
Der Major richtete sich auf. »Jomosom«, sagte er scharf, »liegt im westlichen Nepal.«
»Oh«, sagte Freds.
Und wir alle standen da. Anscheinend hatten wir das Freds’ Erklärung zu verdanken.
Ich stieß ihn zur Seite. »In Wahrheit haben wir uns gedacht, wir könnten Ihnen etwas helfen. Wir haben nicht gewußt, worauf wir uns einlassen.«
»Ja!« sagte Freds und machte sich diese neue Taktik dankbar zu eigen. »Vielleicht könnten wir ein paar Lasten für Sie runtertragen?«
»Wir steigen noch hinauf!« bellte der Major. »Wir brauchen niemanden, der Lasten nach unten trägt.« Er deutete auf den Grat hinter uns, der allmählich im Nebel verschwand. »Das ist der Everest!«
Freds blinzelte ihn an. »Sie machen Witze.«
Ich stieß ihn wieder an. »Wir brauchen Hilfe«, sagte ich.
Der Major betrachtete uns eindringlich. »Gehen Sie ins Zelt«, sagte er schließlich.
17
Nun ja, schließlich reimte ich eine halbwegs zusammenhängende Geschichte über uns zusammen: Wir wollten freiwillig Lasten für eine Everest-Expedition tragen, obwohl ich niemanden kannte, daß der so dumm sein würde, diesen Wunsch zu verspüren. Freds war mir nicht die geringste Hilfe — er vergaß meine Version immer wieder, kehrte zu seiner ersten Geschichte zurück und sagte Sätze wie »Wir müssen ein falsches Flugzeug erwischt haben.« Und in beide Versionen paßte Kunga Norbu nicht so recht hinein; ich behauptete, er sei unser Führer, doch wir verstanden seine Sprache nicht. Klugerweise blieb er stumm.
Trotz alledem gab das indische Team uns zu essen und Wasser, damit wir unseren quälenden Durst stillen konnten, und sie begleiteten uns an ihren Leitseilen zu den tieferliegenden Lagern hinab, um auch ganz sicher zu gehen, daß wir ihnen wirklich nicht mehr im Weg standen. Im Verlauf der nächsten paar Tage führten sie uns das westliche Cwm, das vergletscherte Tal der Stille, und den Khumbu-Eisfall zum Basislager hinab. Ich wünschte, ich könnte Ihnen eine minutiöse Schilderung des berühmten Khumbu-Eisfalls geben, doch leider erinnere ich mich kaum daran. Er war groß und weiß und unheimlich, und ich war müde. Das ist alles, was ich noch weiß. Und dann waren wir in ihrem Basislager, und ich wußte, daß es vorbei war. Die erste illegale Besteigung des Everest.
18
Nun ja, nach dem, was wir durchgemacht hatten, sah Gorak Shep wie Irland aus, und Pheriche wie Hawaii. Und die Luft war die reinste Sauerstoffsuppe.
Wir erkundigten uns nach den Engländern, nach Arnold und Laure und hörten immer wieder, daß sie vielleicht einen Tag unter uns waren. Wie es sich anhörte, jagten die Engländer Arnold, dem es unter äußersten Anstrengungen gelang, seinen Vorsprung zu halten. Also eilten wir ihnen nach.
Auf unserem Abstieg kehrten wir jedoch im Kloster Pengboche ein, einem dunklen, unheimlichen alten Gemäuer in einem kleinen Hain schwarzer Kiefern, bei denen es sich angeblich um den Backenbart des ersten Abtes handelte. Dort ließen wir Kunga Norbu zurück, der ziemlich mitgenommen wirkte. Die Mönche im Kloster machten ein großes Getue um ihn. Er und Freds verabschiedeten sich überschwenglich, und er bedachte mich mit einem breiten Grinsen, als er mich zum letzten Mal mit diesem allumfassenden Blick seiner schwarzen Augen durchbohrte. »Guten Morgen!«, sagte er, und wir waren wieder unterwegs.
Und so trotteten Freds und ich nach Namche hinab, das mich stark an Manhattan erinnerte, und stellten dort fest, daß unsere Freunde, noch immer auf der Jagd nach Arnold, gerade nach Lukla aufgebrochen waren. Unterhalb von Namche beeilten wir uns wirklich, sie einzuholen, doch das gelang uns erst in Lukla selbst. Und dort erwischten wir nur die Engländer — sie standen an der Landepiste und beobachteten, wie das letzte Flugzeug des Tages über das schiefe Gras brummte, während Arnold McConnel, wie wir schnell herausfanden, an Bord eben jenes Flugszeugs war, nachdem er einem Passagier der Maschine einen beträchtlichen Stapel Rupien für dessen Ticket bezahlt hatte. Arnolds Sherpas standen an der Piste und winkten ihm zum Abschied; wie sich herausstellte, hatten sie alle mit dieser einen Klettertour etwa ein Jahreseinkommen verdient und den alten Arnold ziemlich in ihr Herz geschlossen.
Die Engländer hatten das keineswegs. Im Gegenteil, sie schäumten geradezu vor Wut.
»Wo seid ihr gewesen?« fragte Trevor.
»Wir haben den Gipfel bestiegen«, erklärte Freds entschuldigend. »Kunga mußte es aus religiösen Gründen.«
»Nun ja«, meinte Trevor verdrossen. »Das haben wir ebenfalls in Betracht gezogen, aber wir mußten deinen Kunden den Berg hinab verfolgen und versuchen, seinen Film zu bekommen. Den Film, der dafür sorgen wird, daß wir alle endgültig aus Nepal rausgeworfen werden, sollte er jemals aufgeführt werden.«
»Macht euch lieber schon mal mit dem Gedanken vertraut«, sagte Mad Tom düster. »Er ist nach Katmandu unterwegs, und wir sind es nicht. Jetzt holen wir ihn nie mehr ein.«
Nun hat man von Lukla keine außergewöhnlich gute Aussicht, verglichen mit dem, was man höher sehen kann; aber es gibt dort die riesigen grünen Wände der Schlucht, und im Norden sieht man einige der großen weißen Gipfel dahinter; und wenn man das alles sieht und denkt, man dürfe es nie wieder sehen …
Ich deutete nach Süden. »Vielleicht haben wir auch mal Glück.«
»Was?«
Freds lachte. »Chopper! Da, seht ihr? Ein Trekking- Unternehmen hat Hubschrauber angemietet, um seine Gruppe einzufliegen.«
Es stimmte. Das ist eine ziemlich übliche Praxis, ich habe es selbst schon oft genug gemacht. Die täglichen Flüge der RNAC nach Lukla reichen mitten in der Trekking-Saison nicht aus, und so vermietet die nepalesische Luftwaffe freundlicherweise — und zu exorbitanten Preisen — ihre Hubschrauber. Natürlich ziehen sie es vor, nicht leer zurückzufliegen, und nehmen jeden mit, der dafür bezahlt. Oft — und so auch an diesem Tag — stritt eine beträchtliche Menge lautstark darum, für den Rückflug bezahlen zu dürfen, und die Konkurrenz ist groß, obwohl ich für meinen Teil niemals verstanden habe, warum die Menschen so besessen darauf sind, nach Katmandu zurückzukehren.
Auf jeden Fall war es an diesem Tag wie an den meisten anderen auch, und eine ganze Schar Trekker saß um die Ladezone neben der Landepiste herum und verhandelte mit den Sherpa- und Sherpani-Unterhändlern, die den Flughafen beherrschen und Flüge für die Leute besorgen können. Die Hierarchie unter diesem halben Dutzend Unterhändlern ist — sogar für sie selbst — völlig obskur, und an diesem Tag hatte wie immer jeder von ihnen eine Liste von Leuten, die bis zu einhundert Dollar für einen Rückflug bezahlt hatten; und bis die Unterhändler mit der Hubschrauberbesatzung gesprochen hatten, wußte niemand, wer diesmal den Zuschlag erhalten würde, seine Leute an Bord bringen zu dürfen. Die Leute hielten diese Vorgehensweise bestenfalls für zweifelhaft, und als sie die Hubschrauber sahen, meckerten sie lauthals und warfen ihren Unterhändlern üble Dinge an den Kopf.
Das war also keine besonders günstige Situation für uns, denn obwohl wir in einer verzweifelten Lage waren, behaupteten alle anderen, die einen Rückflug wollten, ebenfalls in einer verzweifelten Lage zu sein, und niemand würde freiwillig auf seinen Platz verzichten. Doch gerade, als die beiden Puma-Hubschrauber laut und unter beträchtlichem Wind landeten, sah ich Heather auf der Landepiste, und ich lief zu ihr und erfuhr, daß sie für unsere Expedition bei Pemba Sherpa, einem der mächtigsten Unterhändler dort, Plätze gebucht hatte. »Gute Arbeit, Heather!« rief ich. Ich erklärte ihr schnell einige Aspekte der Situation, und sie musterte uns mit großen Augen und nickte, daß sie verstanden habe.
Und in der Tat, im Chaos der Trekker, die sich um die Hubschrauber drängten, bei all dem Gestöhne und Ächzen und Geschrei und Gemeckere, an Bord gelassen zu werden, war es Pemba, der die Oberhand über die anderen Unterhändler behielt. Und die ›Video-Expedition zum Everest Base Camp‹ der Firma Want To Take You Higher Ltd. stieg — einschließlich vier englischer und eines amerikanischen Bergsteigers — unter großem Jubel an Bord der beiden Hubschrauber. Mit einem Thukka-thukka-thukka starteten wir.
»Aber wie wollen wir ihn in Katmandu finden?« sagte Marion über den Lärm.
»Er rechnet nicht mit euch«, sagte ich. »Er glaubt, die letzte Maschine des Tages erwischt zu haben. Also würde ich anfangen, im Kathmandu Guest House, in dem wir wohnen, nach ihm zu suchen.«
Die Engländer nickten und schauten grimmig wie Sturmtruppensoldaten drein. Arnold kriegte Probleme.
19
Wir landeten eine Stunde später auf dem Flughafen von Katmandu, und die Briten stürmten hinaus und nahmen sich ein Taxi. Freds und ich nahmen uns ebenfalls eins und versuchten, sie nicht aus den Augen zu verlieren, doch die Engländer mußten ihrem Fahrer die dreifache Summe angeboten haben, denn ihr kleiner Toyota schoß wie bei einem Motocross-Rennen über die staubige Straße zwischen dem Flughafen und der Stadt dahin. Also fielen wir zurück, und als wir auf dem Hof des Kathmandu Guest House ausstiegen, war ihr Taxi schon fort. Wir bezahlten unseren Fahrer, gingen hinein und fragten einen hochnäsigen Portier nach Arnolds Zimmernummer, und als er sie uns nannte, eilten wir zu dem Zimmer hinauf; es befand sich im zweiten Stock, mit Blick auf den Garten.
Als wir dort eintrafen, war schon die Hölle los. John und Mad Tom und Trevor hatten Arnold auf einem Bett in der Ecke in die Enge getrieben; sie standen über ihm und sorgten dafür, daß er sich nicht erhob. Marion hatte die eigentliche Arbeit übernommen; sie warf auf der anderen Zimmerseite eine Videokassette nach der anderen zu Boden und zertrat sie unter ihrem Stiefel. Es herrschte ein lautstarkes Geschrei, das hauptsächlich von Marion und Arnold stammte. »Das ist die, wo ich dusche«, sagte Marion. »Und das ist die, wo ich in meinem Zelt mein Hemd wechsle. Und das ist die, wo ich auf achttausend Metern Höhe pinkeln mußte!« und so weiter, während Arnold schrie: »Nein, nein!« und »Doch nicht die, mein Gott!« und »Ich verklage euch vor jedem Gericht in Nepal!«
»Ausländer können sich in Nepal nicht verklagen«, sagte Mad Tom zu ihm.
Aber Arnold schrie und drohte und jammerte weiterhin; sein sonnenverbranntes Gesicht wurde ganz blaß, sein viel schmaler gewordener Körper hüpfte auf dem Bett auf und ab, seine großen runden Augen wölbten sich so weit vor, daß ich schon Angst hatte, sie würden aus den Höhlen springen oder wie an Federn hinausschießen. Er nahm seine frische Zigarre, die ihm aus dem Mund gefallen war, und warf sie auf Trevor und John; sie verfehlte die beiden jedoch und traf Marion an der Brust.
»Lüstling«, sagte sie und rieb sich vor Zufriedenheit die Hände. »Das sind sie also alle.« Sie packte das Durcheinander aus Plastik und Videoband in einen Rucksack. »Und die hier nehmen wir auch noch mit. Und vielen Dank, übrigens.«
»Diebe«, krächzte Arnold.
Die drei Männer traten von ihm zurück. Arnold saß wie erstarrt auf dem Bett und betrachtete Marion mit verdutzten, großen Augen. Er sah aus wie ein Ballon, den man mit einer Nadel durchstochen hatte.
»Tut mir leid, Arnold«, sagte Trevor. »Aber wie du eingestehen mußt, hast du dir das selbst zuzuschreiben. Wir haben dir die ganze Zeit über gesagt, daß wir nicht gefilmt werden wollen.«
Arnold starrte sie sprachlos an.
»Nun ja«, sagte Trevor. »Das wäre also erledigt.« Und sie gingen.
Freds und ich musterten Arnold auf dem Bett. Langsam nahmen seine Augen ihren üblichen glotzenden Ausdruck an, doch er wirkte noch immer untröstlich.
»Diese Engländer sind schon harte Burschen«, sagte Freds. »Sie sind wirklich nicht sehr mitfühlend.«
»Na, komm, Arnold«, sagte ich. Nun, da ich nicht mehr für ihn verantwortlich war, und, da wir in Katmandu zurück waren und ich ihn nie mehr sehen mußte — nun, da ich sicher war, daß sein Videoband, das Freds und mir genauso beträchtliche Probleme wie den Engländern einbringen konnte, zerstört war — nun tat er mir ein bißchen leid. Nur ein ganz kleines bißchen. Man konnte ihm deutlich anmerken, daß er wirklich eine Menge durchgemacht hatte, um dieses Band zu bekommen. Außerdem verhungerte ich allmählich. »Na komm, duschen wir, rasieren wir uns und ziehen uns um, und dann lade ich dich zum Abendessen ein.«
»Ich auch«, sagte Freds.
Arnold nickte stumm.
20
Katmandu ist eine seltsame Stadt. Wenn man aus dem Westen dort eintrifft, scheint es sich um den heruntergekommensten und ungesundesten Ort zu handeln, den man sich vorstellen kann: Die Gebäude sind schlecht und recht aus alten Ziegelsteinen zusammengeschustert, und auf den Dächern sprießt das Unkraut; die Hotelzimmer sind kahle Gruben; das gesamte Essen, das man hier findet, schmeckt nach Pappe, und man wird oft krank davon; und hier und da auf den schlammigen Straßen, auf denen Hunde und Kühe streunen, liegen große Unrathaufen.
Dann geht man für einen oder zwei Monate in die Berge, auf einen Trek oder eine Klettertour. Und wenn man nach Katmandu zurückkehrt, hat sich der Ort völlig verwandelt. Die einzig mögliche Erklärung dafür ist die, daß man die Stadt während der Abwesenheit niedergerissen und durch eine neue ersetzt hat, die äußerlich genauso aussieht, sich aber im Wesen von der alten grundlegend unterscheidet. Die Unterkünfte sind unglaublich luxuriös; das Essen ist hervorragend; die Menschen sehen wohlhabend aus, und ihre Stadt scheint ein Wunder der architektonischen Ausgeklügeltheit zu sein. Katmandu! Was für eine Metropole!
So kam es auch Freds und mir vor, als wir uns in meiner Heimat fern der Heimat eintrugen, dem Hotel Star. Als ich mich unter den hüfthohen Warmwasserhahn unter dem Duschkopf setzte, ertappte ich mich dabei, wie ich in sinnloser Verzückung kicherte, und ich hörte, wie Freds im Nebenzimmer »Going to Kathmandu« bellte: »K-k-k-k-Kath-Man-Du!«
Eine Stunde später trafen wir, das Haar noch naß, die Haut rosig geschrubbt, Arnold auf der Straße und gingen durch das abendliche Thamel. »Wir sehen wie Kleiderständer aus!« stellte Freds fest. Unsere Stadtkleidung schlotterte um uns herum. Freds und ich hatten jeweils etwa zwanzig Pfund verloren, Arnold etwa dreißig. Und es war nicht nur Fett. In solch einer Höhe schmilzt alles dahin.
»Wir gehen lieber ins Old Vienna und sehen zu, daß wir wieder was auf die Rippen bekommen.«
Ich sabberte schon bei dem bloßen Gedanken daran.
Also gingen wir ins Old Vienna Inn und entspannten uns in der warmen, feuchten Athmosphäre des kaiserlichen Österreich- Ungarn. Nach großen Portionen Gulasch, Pariser Schnitzel und Apfelstrudel mit Schlagsahne setzten wir uns gesättigt zurück. Sinnesüberlastung. Selbst Arnold ging es etwas besser. Er hatte während des Abendessens geschwiegen, aber das hatten wir andererseits alle; wir waren vollauf beschäftigt gewesen.
Wir bestellten eine Flasche Rakschi, ein starkes örtliches Getränk unbestimmbarer Herkunft. Als sie kam, machten wir uns darüber her.
»He, Arnold«, sagte Freds, »du siehst schon besser aus.«
»Ja, ich fühle mich gar nicht so schlecht.« Er wischte sich den Mund mit einer an zahlreichen Stellen rot befleckten Serviette ab; wir alle hatten unsere von der Sonne mitgenommenen Lippen mehr als einmal aufgerissen, als wir versuchten, das Essen zu schnell hineinzuschaufeln. Dann schickte er sich bedächtig an, auf einer neuen Zigarre zu kauen, die er sehr langsam auspackte. »Ganz und gar nicht so schlecht.« Und dann grinste er; er konnte einfach nicht anders, er grinste so breit, daß er wieder nach der Serviette greifen und sich das Blut von den Lippen abtupfen mußte.
»Na ja, es ist eine Schande, daß diese Burschen auf deinem Film herumgetrampelt haben«, sagte Freds.
»Ja, sicher.« Arnold winkte großzügig ab. »So ist nun mal das Leben.«
Ich war erstaunt. »Arnold, ich kann nicht glauben, daß du da sprichst. Diese Burschen haben deine Videobänder genommen, die du unter solchen Mühen gedreht hast, und trampeln darauf rum, und du sagst, ›so ist nun mal das Leben‹.«
Er nahm einen großen Schluck Rakschi. »Na ja«, sagte er und runzelte ein paarmal die Stirn, was ihm ein geradezu teuflisches Aussehen verlieh. Er beugte sich über den Tisch zu uns. »Sie haben zumindest eine Kopie davon bekommen.«
Freds und ich sahen einander an.
»Bänder im Wert von ein paar hundert Dollar haben sie zerstört. Das sollte ich ihnen wohl in Rechnung stellen. Aber ich will mal großzügig sein und es ihnen durchgehen lassen.«
»Eine Kopie?« sagte ich.
»Ja.« Er tippte sich mit dem Finger an die Schläfe. »Habt ihr in der Ecke meines Zimmers im Guest House nicht diesen Kasten gesehen, der so ähnlich wie ein Koffer aussieht?«
Wir schüttelten die Köpfe.
»Die Briten auch nicht. Nicht, daß sie ihn erkannt hätten. Es ist eigentlich eine Videoklebepresse. Aber auch ein Kopierer. Man steckt eine Kassette rein und drückt auf einen Knopf, und sie zieht eine Kopie der Kassette, und dann kann man das Original schneiden und kleben. So erstellt man den Endschnitt. Tolles Maschinchen. Die meisten freiberuflichen Videofilmer haben jetzt eine, und diese tragbaren Babys sind wirklich der neueste Schrei. Und in diesem Fall haben sie meinen Arsch gerettet.«
»Arnold«, sagte ich. »Du wirst diese Burschen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen! Und uns auch!«
»He«, warnte er uns. »Ich habe den Kopierer unter Verschluß, also kommt nicht auf dumme Ideen.«
»Du wirst dafür sorgen, daß wir auf immer aus Nepal verbannt werden!«
»Nee. Ich gebe euch Künstlernamen. Habt ihr da irgendwelche Vorlieben?«
»Arnold!« protestierte ich.
»He, hört mal«, sagte er und trank noch einen Schluck Rakschi. »Der größte Teil der Strecke führte doch durch Tibet, oder? Die Chinesen werden sich einen Dreck darum scheren. Außerdem kennt ihr doch das nepalesische Tourismusministerium — glaubt ihr wirklich, daß diese Jungs sich meinen Film überhaupt nur ansehen, geschweige denn die Namen daraus abschreiben und die Leute dann aufspüren, wenn sie sich wieder um ein Visum bemühen? Macht euch doch nicht lächerlich!«
»Hm«, sagte ich und schmierte meine Gehirnzellen mit einem Schluck Rakschi.
»Was hast du also auf Band?« fragte Freds.
»Alles. Ich habe ein paar gute Bilder mit dem Teleobjektiv gedreht, wie ihr da oben die Leiche findet — ha! Ihr habt wohl gedacht, ich hätte das nicht mitbekommen, was? Ich kann euch sagen, ich habe da oben sogar eure Gedanken gefilmt! Das habe ich, und dann, wie die Briten den Grat raufklettern — einfach alles. Ich werde Stars aus euch machen.«
Freds und ich wechselten einen erleichterten Blick. »Du kannst die Künstlernamen ruhig vergessen«, sagte ich.
»Meinetwegen. Und nachdem ich den Film geschnitten habe, kann keiner mehr sagen, wo auf dem Berg die Leiche lag, und wenn ich die Namen und so weiter belasse, wird es Marion und den anderen bestimmt gefallen. Meint ihr nicht auch? Sie waren einfach schüchtern. Altmodisch! Ich werde ihnen Kopien des fertigen Films schicken, und er wird ihnen bestimmt gefallen. Marion ganz besonders. Sie sieht wirklich toll aus.« Er wedelte mit der Zigarre, und ein Ausdruck wiederkäuerischer Sehnsucht legte sich auf sein Gesicht. »Ich will euch sogar ein kleines Geheimnis verraten. Dieses Band werde ich persönlich überbringen, und dann mache ich ihr einen Heiratsantrag. Ich glaube, sie mag mich wirklich gern, und ich wette, daß sie einwilligen wird, mich zu heiraten, wenn sie den Film sieht. Glaubt ihr nicht auch?«
»Klar«, sagte Freds. »Warum nicht?« Er dachte darüber nach. »Und wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten.«
Arnold betrachtete ihn mit einem seltsamen Blick. »Ich werde ihr den Antrag auf meiner nächsten Reise machen, die mich wohl nach China und Tibet führen wird, wie es jetzt aussieht. Wißt ihr, daß die Chinesen die tibetanischen Religionen in letzter Zeit wieder etwas lockerer handhaben? Der Portier im Guest House hat mir ein Telegramm gegeben, als ich ging — mein Agent hat mir gekabelt, daß sich die Behörden in Lhasa entschlossen haben, eine ganze Reihe der buddhistischen Klöster wieder aufzubauen, die sie während der Kulturrevolution abgerissen haben, und es sieht so aus, als bekäme ich die Erlaubnis, den Neuaufbau zu filmen. Das ist doch ein toller Stoff für eine herzzerreißende Schnulze, und ich wette, Marion würde sie liebend gern sehen, meint ihr nicht auch?«
Freds und ich grinsten uns an. »Ich würde sie auch gern sehen«, erklärte Freds. »Ein Prosit auf die Klöster, und auf ein freies Tibet!«
Wir sprachen einen Toast aus und bestellten eine neue Flasche. Arnold wedelte mit der Zigarre. »Aber diese Mallory-Sache ist das reinste Dynamit. Das wird ein verteufelt guter Film werden.«
21
Deshalb kann ich Ihnen auch davon erzählen — die Geheimniskrämerei ist absolut überflüssig, sobald erst Arnolds Film läuft: ›Neun gegen den Everest: Sieben Männer, eine Frau und eine Leiche.‹ Sowohl die PBS als auch die BBC haben ihn gekauft, und er müßte jetzt jeden Tag gesendet werden. Achten Sie doch mal in Ihrer Fernsehzeitschrift darauf.