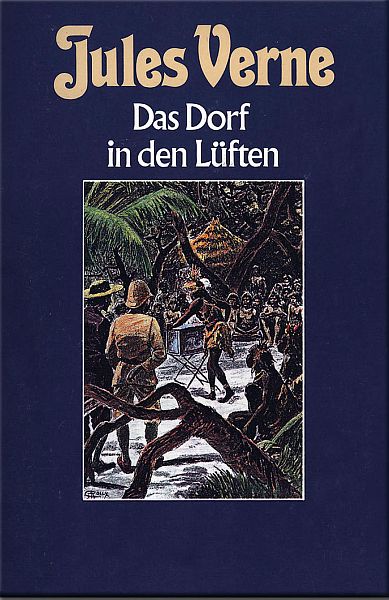
Erstes Capitel.
Nach einem langen Wege
»Und der amerikanische Congo, fragte Max Huber, von dem verlautet wohl noch keine Silbe?
– Wozu auch, lieber Max? antwortete John Cort. Fehlt es uns denn in den Vereinigten Staaten an fast grenzenlosen Landstrecken? Wie viele unbekannte und wüste Gebiete sind zwischen Alaska und Texas noch heute zu erforschen! Nein, ehe wir auswärtige Colonialpolitik treiben, meine ich, ist es besser, zu Hause zu colonisieren…
– Ja, mein bester John, die europäischen Mächte werden aber, wenn das so wie heute weiter geht, ganz Afrika unter sich theilen; bedenke nur, eine Fläche von dreitausend Millionen Hektaren! Sollen die Amerikaner denn diese ganz und gar den Engländern, den Deutschen, den Holländern, Portugiesen, Franzosen, den Italienern, den Spaniern und den Belgiern überlassen?
– Die Amerikaner berührt das ebenso wenig wie die Russen, erwiderte John Cort, und aus dem gleichen Grunde…
– Aus welchem?
– Ist es beiden unnütz, die Beine anzustrengen, wenn man nur die Arme auszustrecken braucht.
– Schön, lieber John, die Unionsregierung wird also früher oder später, meinst Du, ihren Antheil an dem afrikanischen Kuchen beanspruchen. Jetzt giebt es einen französischen Congo, einen belgischen und einen deutschen Congo, ohne den noch unabhängigen Congo, der aber offenbar auch nur darauf wartet, seine Unabhängigkeit einzubüßen. Und dann das weite Land, durch das wir in den letzten drei Monaten gekommen sind…
– Als Neugierige, Max, als einfache Neugierige, nicht als Eroberer…
– Der Unterschied ist im vorliegenden Falle nicht allzu groß, Du würdiger Bürger der Vereinigten Staaten, erklärte Max Huber. Ich wiederhole Dir: aus diesem Theile Afrikas könnte sich die Union noch eine prächtige Colonie herausschneiden.
Hier fehlt es nicht an fruchtbaren Gebieten, die nur ihre Ergiebigkeit zu beweisen verlangen, zu beweisen unter der Wirkung einer reichlichen Bewässerung, wofür schon die Natur alle Kosten trüge. Hier giebt es ein ganzes Netz von Wasserläufen, die niemals versiegen…
– Nicht einmal bei dieser abscheulichen Hitze, fiel John Cort ein, während er den Schweiß von der sonnengebräunten Stirn abwischte.
– Bah, lassen wir uns diese nicht anfechten! erwiderte Max Huber. Sind wir denn nicht schon acclimatisiert, ich möchte sagen: »negrisiciert«, wenn Du, lieber Freund, nichts dagegen hast? Jetzt haben wir ja erst März, wie soll es denn da im Juli, im August werden, wenn die Sonnenstrahlen uns gleich glühenden Pfeilen die Haut durchbohren!
– Zugegeben, Max, es wird uns aber doch einige Mühe kosten, mit unserer leichten französischen und amerikanischen Haut zu Pahuins oder Sansibariten zu werden. Ich leugne ja nicht, daß wir eine hübsche, interessante und vom Glücke auffallend begünstigte Reise hinter uns haben, trotzdem verlangt es mich doch danach, wieder in Libreville zu sein und in unseren Factoreien etwas von der Ruhe und Erholung zu finden, worauf Reisende nach einer solchen dreimonatigen Fahrt wohl berechtigten Anspruch haben.
– Ganz recht, Freund John; die abenteuerliche Reise hat uns ja so manches Interessante geboten, dennoch gestehe ich, daß sie meine Erwartungen nicht vollständig befriedigt hat.
– Wie, Max, mehrere hundert Meilen durch ein gänzlich unbekanntes Land, kein Mangel an Gefahren, denen wir inmitten wenig gastfreundlicher Volksstämme zu trotzen hatten, bei mancher Gelegenheit Schüsse gewechselt, gegen drohende Zagaien und Wolken von Pfeilen, Jagden, die der numidische Löwe und der lybische Panther mit ihrer Theilnahme zu beehren geruhten, Hekatomben von Elefanten geschlachtet zum Nutzen unseres Chefs Urdax, eine Ernte von Elfenbein erster Güte, hinreichend, die Tasten der Pianos der ganzen Welt damit zu belegen… und Du erklärst Dich noch immer für unbefriedigt?
– Ja und nein, John. Was Du da aufzählst, ist die gewöhnliche
Speisekarte der Forschungsreisenden in
Mittelafrika… Das findet der Leser schon alles in den Berichten eines Barth, Burton, Speke, Grant, eines Chaillu, Livingstone und Stanley, eines Serpo Pinto, Anderson, Cameron und Mage, eines Brazza, Gallieni, Dibowsky, Lejean, Massari, Wißmann, Buonfanti, eines Maistre…«
Da unterbrach ein Stoß, den der Vordertheil des Wagens an einem mächtigen Steine erlitt, die Aufzählung der Erforscher Afrikas aus Max Huber’s Munde. John Cort machte sich den Zwischenfall zu nutze und sagte:
»Du hofftest also, auf unserer Fahrt noch etwas anderes zu finden?
– Ja freilich, lieber John.
– Etwas unerwartetes?
– Mehr als das, denn daran, das geb’ ich zu, hat es uns nicht gefehlt.
– Also etwas ganz außerordentliches?…
– Das ist das richtige Wort, lieber Freund! Nicht einmal, nicht ein einziges Mal hab’ ich Gelegenheit gehabt, damit das Echo des alten Lybiens zu wecken, der portentosa Africa, wie die klassischen Aufschneider des Alterthums sich ausdrückten.
– Na, Max, ich sehe schon, daß eine französische Seeleschwerer zufrieden zu stellen ist…
– Als eine amerikanische, das bestätige ich, John, wenn die Erinnerungen, die Du von dieser Reise mit heimbringst, Dir schon genügen…
– Vollkommen, Max!
– Und wenn Du zufrieden zurückkehrst…
– Vor allem zufrieden, daß wir auf der Rückkehr sind.
– Und Du meinst, daß die Leute, die vielleicht einen Bericht über diese Reise lesen, rufen könnten: »Sapperment, das muß merkwürdig gewesen sein!«
– Sie verlangten gar zu viel, wenn sie das nicht riefen.
– Meiner Ansicht nach verlangten sie zu wenig.
– Du hättest recht, entgegnete John Cort, wenn sie verlangten, daß wir unsere Fahrt im Magen eines Löwen oder im Bauche eines Menschenfressers von Ubanghi hätten abschließen sollen!
– O, nein, John, nein, ohne bis zu dieser Art der Lösung zu gehen, die übrigens eines gewissen Interesses der Leser und selbst der Leserinnen nicht entbehrt hätte, würdest Du auf Ehre und Gewissen, vor Gott und den Menschen zu beschwören wagen, daß wir mehr entdeckt und beobachtet hätten, als was unsere Vorläufer in Centralafrika bereits beobachtet und entdeckt hatten?
– Nein, das freilich nicht, Max.
– Nun also; ich aber hoffte, vom Schicksal mehr begünstigt zu werden.
– Du Nimmersatt, der aus seiner Unersättlichkeit gar noch eine Tugend machen möchte! erwiderte John Cort. Ich für meinen Theil erkläre mich für befriedigt und erwartete von unserer Fahrt nicht mehr, als sie geboten hat…
– Das heißt: so viel wie nichts, John.
– Uebrigens, Freund Max, ist die Reise noch nicht zu Ende, und in den fünf bis sechs Wochen, die die Fahrt bis Libreville noch beanspruchen wird…
– Ach, geh’ mir doch! rief Max Huber. Eine einfache Karawanenpromenade… die abgetretene Heerstraße… eine Spazierfahrt im Postwagen und bei schönem Wetter obendrein…
– O, wer weiß?…« sagte John Cort nachdenklich.
Jetzt hielt der Wagen für den Abend und die Nacht an, und zwar am Fuße einer leichten, von fünf oder sechs prächtigen Bäumen bekrönten Bodenerhebung. Diese Bäume, die jetzt von den Strahlen der untergehenden Sonne zauberisch beleuchtet wurden, waren bis weithin die einzigen in der sich ringsum ausdehnenden Ebene.
Es war jetzt sieben Uhr abends. Infolge der stets nur kurzen Dämmerung unter niedrigen Breitengraden – hier befand man sich unter dem neunten Grade nördlicher Breite – mußte die Nacht bald heran kommen. Sie versprach sehr dunkel zu werden, da ein dichter Wolkenschleier den Glanz der Sterne verhüllte und die Sichel des zunehmenden Mondes schon am westlichen Horizonte herabsank.
Der nur zur Beförderung von Reisenden bestimmte Wagen enthielt weder Waarenballen noch Mundvorräthe. Man denke sich einen auf vier massiven Rädern ruhenden Wohnwagen, der von sechs Ochsen gezogen wurde. Am Vordertheile hatte er eine Thür, an den Seiten kleine Fenster, und im Innern war er durch eine Scheidewand in zwei gleichgroße Räume getheilt. Der hintere Raum beherbergte zwei junge Männer von fünfundzwanzig bis sechsundzwanzig Jahren: einen Amerikaner Namens John Cort, und einen Franzosen Namens Max Huber. Den vorderen Raum bewohnte ein portugiesischer Händler mit Namen Urdax, und ein sogenannter »Foreloper« Namens Khamis. Dieser Foreloper – d. i. der Mann, der eine Karawane gewöhnlich anführt – war ein Eingeborner von Kamerun und hatte viel Uebung und Erfahrung als Führer durch die brennend heißen Gebiete von Ubanghi.
Selbstverständlich ließ die Bauart des Wagens hinsichtlich der Haltbarkeit nichts zu wünschen übrig. Jetzt, nach einer langen und beschwerlichen Fahrt, befand sich sein Kasten im besten Zustande, seine Räder erschienen am Felgenkranze kaum abgenützt, die Achsen waren weder gesprungen noch verbogen – kurz, man hätte gemeint, er käme nur von einer fünfzehn bis zwanzig (englische) Meilen langen Spazierfahrt heim, während die von ihm durchmessene Strecke doch über zweitausend Kilometer betrug.
Vor drei Monaten hatte dieses Gefährt Libreville, die Hauptstadt des französischen Congogebiets, verlassen. Die Richtung nach Osten einhaltend, war es über die Ebenen von Ubanghi hinweg bis über den Lauf des Bahar-el-Abiad, eines der Zuflüsse des im Süden gelegenen Tchadsees, hinausgekommen.
Die Gegend verdankt ihren Namen einem der bedeutendsten Nebenflüsse am rechten Ufer des Congo oder Zaïre. Sie liegt im Osten von Deutsch-Kamerun, dessen Gouverneur gleichzeitig das Amt eines deutschen Generalkonsuls für Westafrika verwaltet, ihre Grenzen sind aber auch auf den neuesten Landkarten noch nicht mit voller Bestimmtheit eingetragen. Ist das Gebiet auch nicht gerade eine Wüste –höchstens eine solche mit dem üppigsten Pflanzenwuchs. also ohne jede Aehnlichkeit mit der Sahara – so bildet es doch eine ungeheuere Landstrecke, auf der die einzelnen Dörfer stets sehr weit von einander entfernt liegen. Unter den hier siedelnden Volksstämmen herrscht ein unausgesetzter Krieg, sie machen einander zu Sklaven oder tödten sich gegenseitig, ja sie nähren sich sogar vielfach noch von Menschenfleisch, wie z. B. die Mubullus zwischen dem Nil und dem Congobecken. Noch abscheulicher erscheint es, daß gewöhnlich Kinder zur Befriedigung ihrer kannibalischen Gelüste dienen müssen. Die Missionäre sind deshalb eifrig bemüht, die kleinen Wesen zu retten, indem sie diese entweder gewaltsam entführen oder sie von den Siegern zurückkaufen, wonach sie die Kleinen in den längs des Sirambaflusses gelegenen Missionen im christlichen Sinne erziehen. Diese Missionen müßten übrigens alle aus Mangel an Mitteln über kurz oder lang eingehen, wenn sie von den europäischen Staaten, vorzüglich von Frankreich, nicht in hochherziger Weise unterstützt würden.
Hier sei auch daran erinnert, daß in Ubanghi die Kinder der Eingebornen bei vorkommenden Handelsgeschäften geradezu als Münze betrachtet werden. Man bezahlt mit kleinen Knaben und kleinen Mädchen die Bedarfsgegenstände, die von reisenden Kaufleuten bis ins Herz des Landes gebracht werden.
Der reichste Eingeborne ist hier also der, dessen Familie die zahlreichste ist.
War der Portugiese Urdax nun auch nicht aus Handelsinteresse durch diese weiten Ebenen gezogen und mit den Uferbewohnern in Ubanghi nicht in näheren Verkehr getreten, da er keinen anderen Zweck verfolgte als den, sich durch die gerade hier noch sehr ergiebige Elefantenjagd eine gewisse Menge Elfenbein zu verschaffen, so konnte ihm doch nicht jede Berührung mit den wilden Völkerschaften des Congobeckens erspart bleiben. Wiederholt hatte er die Angriffe feindseliger Horden abweisen und zu Vertheidigungszwecken die Feuerwaffen gebrauchen müssen, die ursprünglich nur zur Jagd auf Pachydermen bestimmt waren. Im ganzen war der Jagdzug jedoch glücklich abgelaufen und hatte unter den Leuten der Karawane kein einziges Opfer gefordert.
Am Rande eines Dorfes in der Nähe der Quellen des Bahar-el-Abiad war es nun John Cort und Max Huber gelungen, ein Kind dem es erwartenden, schrecklichen Lose zu entreißen, indem sie den Knaben um den Preis einiger Glaswaaren loskauften. Der glücklich Befreite war etwa zehn Jahre alt, von kräftigem Körperbau und von ansprechendem, freundlichem Gesicht, das kaum den Negertypus erkennen ließ. Wie es bei manchen Stämmen vorkommt, hatte der Knabe eine fast ganz helle Haut, blondes Haar statt des krausen Wollkopfes der Neger, mehr eine Adler- als eine aufgeworfene Nase und seine, nicht wie gewöhnlich wulstige, Lippen. Aus seinen Augen leuchtete eine angeborene Intelligenz, und er empfand für seine Retter bald eine Art kindlicher Liebe.
Das arme, seinem Stamme, nicht seiner Familie entrissene Kind – denn es kannte weder Vater noch Mutter – führte den Namen Llanga. Nachdem es kurze Zeit von Missionären unterrichtet worden war, die ihm auch ein wenig Französisch und Englisch gelehrt hatten, war es durch unglücklichen Zufall feindlichen Denkas in die Hände gefallen, und welches Schicksal seiner hier wartete, kann man ja leicht errathen.
Eingenommen von seiner herzlichen Zuneigung und der ungeheuchelten Dankbarkeit, die er ihnen bezeugte, empfanden die beiden Freunde eine immer wachsende Theilnahme für den Knaben; sie ernährten ihn, kleideten ihn und ertheilten ihm Unterricht, der sich bei der guten Veranlagung ihres Schützlings recht erfolgreich gestaltete. Doch wie anders war auch die Lage Llangas gegen früher geworden! Statt eine lebende Waare zu sein, wie die unglücklichen kleinen Eingebornen, sollte er später als Adoptivkind Max Huber’s und John Cort’s in den Factoreien von Libreville leben. Die beiden jungen Männer hatten sich seiner einmal angenommen und würden ihn auch niemals verlassen. Trotz seiner großen Jugend hatte er dafür schon Verständniß, er wußte sich geliebt, und eine Thräne des Glückes perlte ihm allemal aus den Augen, wenn Max Huber oder John Cort ihm die Hände auf das Haupt legten.
Als der Wagen Halt gemacht hatte, lagerten sich die von dem langen Wege in der verzehrenden Hitze erschöpften Zugochsen auf der Prairie. Sofort eilte auch Llanga, der eine Strecke, bald vor, bald hinter dem Gespann einhergetrottet war, auf seine Beschützer zu, als diese eben den Wagen verließen.
»Bist doch nicht zu sehr ermüdet, Llanga? fragte John Cort, indem er die Hand des Knaben ergriff.
– Nein, nein!… Gute Beine… liebe es, ein Stück zu laufen, versicherte Llanga, der John Cort und Max Huber unbefangen anlächelte.
– Jetzt ist’s aber Zeit, etwas zu essen, sagte der Franzose.
– Essen… ja… mein Freund Max!«
Schnell küßte Llanga noch die ihm entgegengestreckten Hände und mischte sich dann unter die Träger bei den großen Bäumen des Hügels.
Während der Wagen ausschließlich dem Portugiesen Urdax, ferner Khamis und deren zwei Begleitern vorbehalten war, befand sich das Gepäck und die Elfenbeinlast in der Obhut der Leute der Karawane – in der von etwa fünfzig Männern, meist aus Kamerun gebürtigen Schwarzen. Diese hatten sich bereits der schweren Stoßzähne der Elefanten entledigt und die Kisten und Kasten abgeladen, die den täglichen Proviant enthielten, Vorräthe, die durch die Jagd in den wildreichen Gegenden von Ubanghi immer erneuert werden konnten.
Diese Schwarzen sind alle an ihre Beschäftigung gewöhnte Miethlinge und werden gern ziemlich hoch entlohnt, was ja der reiche Ertrag solcher Jagdzüge leicht gestattet. Man kann sogar sagen, daß sie nie »ihre Eier ausgebrütet haben« – ein dort zu Lande gebräuchlicher Ausdruck zur Bezeichnung der seßhaften Eingebornen. Von Kindheit an, an das Tragen gewöhnt, werden sie Lasten schleppen, so lange ihre Beine den Dienst nicht versagen. Dieser »Beruf« ist anstrengend genug, wenn er in einem solchen Klima ausgeübt werden muß. Die Schultern mit dem schweren Elfenbein oder großen Proviantbehältern beladen, wodurch die Haut nicht selten durchgescheuert wird, und oft mit blutenden Füßen, und der Körper von Stachelgräsern verletzt, denn sie sind fast ohne jede Bekleidung, so wandern sie zwischen dem Sonnenaufgang und der elften Vormittagsstunde dahin und nehmen, wenn die größte Tageshitze vorüber ist, ihren Marsch bis zum Abend wieder auf. Es liegt jedoch im Interesse der Händler, diese Leute gut zu bezahlen, und sie thun das denn auch, sie gut zu ernähren, und sie ernähren sie auch gut, sie nicht übermäßig anzustrengen, und sie vermeiden das auch stets. Die mit den Elfenbeinjagden verbundenen Gefahren sind schon nicht gering, ohne von dem immer möglichen Zusammentreffen mit Löwen und Panthern zu reden, und der Herr der Karawane muß sich da auf sein Personal verlassen können. Ist die Ernte an kostbarer Beute beendigt, dann gilt es immer noch, glücklich und womöglich schnell nach den Factoreien an der Küste zurückzukehren. Für die Karawane ist es allemal wichtig, weder durch Versäumniß infolge übermäßiger Anstrengung der Leute aufgehalten zu werden, noch etwa durch Krankheiten, unter denen die gefährlichen Blattern am meisten zu fürchten sind. Von diesen Grundsätzen erfüllt und durch lange Erfahrung gewitzigt, hatte der Portugiese Urdax, der auf seine Leute die sorgsamste Rücksicht nahm, bisher mit seinen Fahrten bis ins Herz des Schwarzen Erdtheiles auch immer die besten Erfolge erzielt.
Dasselbe konnte auch von dem jetzt ausgeführten Zuge gelten, denn dieser hatte ihm eine beträchtliche Menge sehr schönes Elfenbein eingebracht, das in den Gebieten jenseits des Bahar-el-Abiad, fast an der Grenze von Darfur, erbeutet worden war.
Jetzt wurde nun im Schatten prächtiger Tamarinden ein Lager aufgeschlagen, und als John Cort, nachdem die Träger mit dem Auspacken des Proviants begonnen hatten, den Portugiesen fragte, was er von der Stelle halte, antwortete Urdax in dem ihm völlig geläufigen Englisch:
»Ich denke, Herr Cort, die Haltestelle ist für uns ganz passend, und auch für unsere Zugthiere bietet sie einen reichbesetzten Tisch.
– Ja freilich, sie finden hier hohes fettes Gras in Ueberfluß, sagte John Cort.
– Das verzehrte man selbst mit Vergnügen, setzte Max Huber hinzu, wenn man den Organismus eines Wiederkäuers und drei Magen zum Verdauen hätte!
– Danke schön, erwiderte John Cort, ich bevolzuge aber doch ein über Kohlen gebratenes Antilopenviertel, den Zwieback, womit wir ja reichlich versehen sind, und unsere Tönnchen Cap-Madeira…
– Dem man einige Tropfen aus dem klaren Rio, der durch die Ebene verläuft, zusetzen könnte,« bemerkte der Portugiese.
Er zeigte dabei nach einem Wasserlaufe, jedenfalls einem Nebenflusse des Ubanghi, der sich etwa einen Kilometer weit vom Hügel entfernt dahinschlängelte.
Die Lagereinrichtung wurde bald vollendet. Das Elfenbein hatte man in großen Haufen dicht neben dem Wagen niedergelegt. Die Zugochsen tummelten sich in der Umgebung der Tamarinden. Da und dort flammte aus herabgefallenem, dürrem Holze schon ein Feuer auf. Der Foreloper überzeugte sich, daß es den verschiedenen Gruppen der Leute an nichts fehle. Elch- und Antilopenfleisch, frisches sowie gedörrtes, gab es in Ueberfluß, die Jagd lieferte mehr, als man brauchte. Bald verbreitete sich nun ein angenehmer Bratengeruch, und alle entwickelten dann einen tüchtigen Appetit, den der letzte Halbtagesmarsch gewiß rechtfertigte.
Waffen und Munition waren natürlich im Wagen gelassen worden. Dieser enthielt mehrere Kistchen mit Patronen, verschiedene Jagdgewehre, Karabiner und Revolver, lauter vortreffliche Erzeugnisse der modernen Waffentechnik, die dem Portugiesen, Khamis, John Cort und Max Huber im Nothfalle zur Verfügung standen.
Eine Stunde später war die Mahlzeit beendet. Den Magen befriedigt und tüchtig ermüdet, mußte die Karawane bald in tiefen Schlaf fallen.
Der Foreloper vertraute ihre Bewachung einigen seiner Leute an, die sich alle zwei Stunden ablösen sollten. In jenen entlegenen Gebieten muß man eben stets gegen zwei- und vierfüßige Uebelthäter auf der Hut sein. Urdax unterließ es auch niemals, alle von der Vorsicht gebotenen Maßregeln zu treffen. Bei seinen fünfzig Jahren noch sehr kräftig und vertraut mit Zügen dieser Art, erfreute er sich einer außerordentlichen Ausdauer; doch auch der fünfunddreißigjährige Khamis, der ebenso gewandt und geschmeidig wie kräftig, ebenso kaltblütig wie muthig war, bot jede erwünschte Garantie für die Führung von Karawanen durch Afrika.
Am Fuße einer der Tamarinden hatten die beiden Freunde und der Portugiese sich zum Abendessen niedergesetzt, das der kleine Knabe gebracht und einer der Eingebornen, der als Koch für die Gesellschaft waltete, zubereitet hatte.
Bei der Mahlzeit rasteten die Zungen ebensowenig wie die Kiefer. Das Essen hindert ja nicht am Sprechen, wenn man sich dabei nicht zu sehr beeilt. Wovon war denn nun die Rede?…
Von den Erlebnissen der Reisegesellschaft auf dem Wege nach Nordosten?… O nein, Zwischenfälle, die sich noch auf dem Rückwege ereignen konnten, boten ein mehr actuelles Interesse. Bis zu den Factoreien von Libreville war es noch ein weiter, über zweitausend Kilometer langer Weg, dessen Zurücklegung recht wohl neun bis zehn Wochen beanspruchen konnte. Bezüglich dieses zweiten Theiles der Reise hatte John Cort auch sein »Wer weiß?« gegen seinen Begleiter geäußert, der nicht nur Unerwartetes, sondern auch etwas Außerordentliches zu erleben verlangte.
Bis nach dem jetzt erreichten Punkte war die Karawane von den Grenzen Darfurs an nach Ubanghi zu heruntergezogen, wobei sie die Furten des Aukadebe und seiner zahlreichen Nebenflüsse passiert hatte. Heute rastete sie nahe der Stelle, wo der zweiundzwanzigste Längen- und der neunte Breitengrad einander kreuzen.
»Von jetzt an, sagte Urdax, werden wir aber in südwestlicher Richtung weiter ziehen…
– Und das erscheint um so mehr geboten, als der Horizont –wenn meine Augen mich nicht trügen – durch einen Wald abgeschlossen ist, dessen Ende man weder im Osten noch im Westen erkennen kann.
– Jawohl, durch einen ungeheueren Wald! bestätigte der Portugiese. Wären wir gezwungen, ihn nach der Ostseite zu zu umwandern, so würden Monate vergehen, ehe wir ihn hinter uns hätten.
– Im Westen dagegen…
– Im Westen, fiel Urdax ein, treffen wir, wenn wir seinem Rande folgen, ohne besondere Verlängerung unseres Weges in der Nähe der Stromschnellen des Zongo auf den Ubanghi.
– Würde es unsere Reise nicht abkürzen, wenn wir quer hindurch zögen? fragte Max Huber.
– Ja freilich, um etwa vierzehn Marschtage.
– Nun, warum sollen wir das denn nicht thun?
– Weil jener Wald ganz undurchdringlich ist.
– Oho… undurchdringlich! erwiderte Max Huber mit dem Ausdrucke des Zweifels.
– Für Fußgänger vielleicht nicht, fuhr der Portugiese fort, und doch bin ich mir dessen nicht sicher, weil es noch keiner versucht hat; sich aber mit den Zugochsen hinein zu wagen, wäre ein Unterfangen, das mißglücken müßte.
– Sie sagen, Urdax, daß es noch niemand versucht hat, durch diesen Wald zu kommen?
– Ob versucht, das weiß ich nicht, Herr Huber, doch ausgeführt hat es noch keiner, und in Kamerun wie im Congogebiete wird es niemand einfallen, es zu unternehmen.
Wer getraute sich auch wohl, da hindurchzudringen, wo es nur stachlige Dickichte und dorniges Strauchwerk, doch keine Spur von einem Pfade giebt? Ich glaube, kaum mit Feuer und Axt könnte man sich dort einen Weg bahnen, von den umgestürzten Bäumen gar nicht zu reden, die fast unüberwindliche Hindernisse bilden müssen…
– Unüberwindliche, Herr Urdax?…
– Ich bitte Dich, lieber Freund, nahm John Cort jetzt das Wort, gieb den Gedanken, Dich in jenen Wald zu wagen, getrost auf. Ein Glück für uns, daß wir nur um ihn herumzufahren brauchen. Ich gestehe, daß es mir nie einfallen könnte, mich in ein derartiges Labyrinth von Bäumen zu verirren.
– Nicht einmal, um zu sehen, was sich darin findet?
– Ja, was in aller Welt soll sich denn da finden, Max?… Etwa unbekannte Königreiche, verzauberte Städte, mythologische Eldorados, bisher nie gesehene Geschöpfe, vielleicht Raubthiere mit fünf Füßen oder menschliche Wesen mit drei Beinen?
– Warum denn nicht, John! Man braucht ja nur hinzugehen, um darüber klar zu werden.«
Llanga, der mit weit offenen Augen und gespannter Aufmerksamkeit dem Meinungsaustausche gefolgt war, schien sagen zu wollen, daß er nicht davor zurückschrecken werde, Max Huber gegebenen Falles in den unheimlichen Wald zu folgen.
»Da nun Urdax, fuhr John Cort fort, bestimmt davon absieht, ihn zu durchkreuzen, um nach dem Ufer des Ubanghi zu gelangen…
– Ja, ja, sicherlich, bekräftigte der Portugiese; hinein können wir wohl, doch nimmer wieder heraus.
– Nun also, lieber Max, machen wir es kurz: Dir mag es gestattet sein, die Geheimnisse dieses Waldes zu ergründen, Dich in seine undurchdringlichen Dickichte zu wagen, doch…
selbstverständlich nur im Traume, und selbst das halte ich noch für etwas unklug.
– Lache Du nur, John, lache mich aus, wie Du willst. Ich erinnere mich aber, daß einer unserer Dichter – ich weiß nicht gleich, welcher – gesagt hat: Das Unbekannte aufsuchen, um das Neue zu finden!
– Wirklich, Max?… Und wie heißt denn die Verszeile, die sich mit dieser reimt?
– Wahrhaftig… die hab’ ich vergessen, John!
– So vergiß auch die erste, wie Du die zweite vergessen hast, und laß uns nun endlich ruhig schlafen gehen.«
Das war wohl das Klügste, was sie thun konnten, und zwar ohne dazu den Wagen aufzusuchen.
Eine Nacht am Fuße der Anhöhe unter den breitästigen Tamarinden, deren Frische die noch nach Sonnenuntergang sehr starke Wärme der Luft milderte, das war für Stammgäste des »Hôtels zum freien Himmel« ja nichts Besonderes, wenn die Witterung es nur irgend erlaubte. Heute Abend, wo kein Regen drohte, obwohl die Sterne von dichten Wolken verdeckt waren, empfahl es sich ganz besonders, in freier Luft zu schlafen.
Der junge Eingeborne brachte Decken herbei. Gut eingehüllt, streckten die beiden Freunde sich zwischen den Wurzeln einer Tamarinde, wie auf einer richtigen Cabinenlagerstatt aus, und Llanga sachte sich, wie ein Wachhund, ein Plätzchen neben ihnen.
Ehe Urdax und Khamis das Gleiche thaten, wollten sie noch einmal um den Lagerplatz herumgehen, sich überzeugen, daß die gefesselten Ochsen sich nicht auf der Ebene verlieren könnten, daß die Träger auf ihrem Wachposten und daß die Feuer sorgsam gelöscht wären, denn hier hätte ein einziger Funke genügt, das dürre Gras und das abgestorbene Holz in der Umgebung in Brand zu setzen. Dann kamen auch die beiden Männer nach dem Hügel zurück.
Bald hatte alle der Schlaf umfangen… ein Schlaf, bei dem sie Gottes Donner nicht gehört hätten. Und vielleicht schliefen gar auch die bestellten Wächter ein?… Ja, wirklich; nach zehn Uhr gab es keinen mehr, der da hätte melden können, daß sich am Saume des großen Waldes eine Anzahl verdächtiger Flammen unablässig hin und her bewegte.
Zweites Capitel.
Wandelnde Flammen
Eine Entfernung von zwei Kilometern trennte den Hügel von dem tiefdunkeln Waldesdickicht, an dessen Rande sich qualmende und flackernde Flammen hier- und dorthin bewegten. Es mochten ihrer gegen zehn sein, die jetzt vereinigt, dann wieder vereinzelt aufleuchteten und manchmal so heftig hin und her schwankten, wie es die Ruhe der Atmosphäre nicht zu rechtfertigen schien. Man konnte wohl vermuthen, daß eine Rotte Eingeborner sich dort gelagert habe, um an dieser Stelle den Tag abzuwarten. Eigentliche Lagerfeuer waren die Flammen jedoch nicht, dafür irrten sie viel zu launisch auf etwa hundert Toisen weit weg und wieder zurück, ohne einen einzigen Feuerherd für Sicherung eines Nachtlagers zu bilden.
In der Nähe des Ubanghi schwärmen übrigens ziemlich häufig nomadisierende Stämme umher, die meist von Adamaua oder Barghimi im Westen, oder selbst von Uganda im Osten kommen. Eine Händlerkarawane wäre nicht so unklug gewesen, ihre Anwesenheit durch so viele, sich im Dunkeln umherbewegende Feuerbrände zu verrathen. Nur Eingeborne konnten sich da drüben zum Ausruhen niedergelassen haben.
Und wer weiß, ob diese nicht feindliche Absichten gegen die unter der Krone der Tamarinden schlummernde Karawane hegten.
War diese aber auch von großer Gefahr bedroht, wenn vielleicht mehrere hundert Pahuins, Fundjis, Chiloux, Baris, Denkas und andere nur den Augenblick abwarteten, sie in erdrückender Menge zu überfallen, so hatte hier – mindestens bis halb elf Uhr – noch niemand die geringste Vorbereitung zu einer Abwehr getroffen. Im Lager schliefen eben alle, Herren und Diener, und das Schlimmste, auch die Träger, die sich auf ihrem Wachposten ablösen sollten, waren in tiefen Schlaf versunken.
Zum Glück erwachte einmal der junge Eingeborne. Ohne Zweifel hätten sich seine Augen aber sofort wieder geschlossen, wenn die Blicke des Knaben nicht nach dem südlichen Horizonte zu gerichtet gewesen wären. Unter den halbgeschlossenen Lidern hatte er zuerst die unbestimmte Empfindung von einem Lichtschein, der die finstere Nacht durchdrang. Er reckte die Glieder, rieb sich die Augen und schaute aufmerksamer hinaus. Nein, das war keine Täuschung: am Saume des Waldes bewegten sich vereinzelte Flammen hin und her.
Llanga kam der Gedanke, daß die Karawane angegriffen werden könnte. Dabei leitete ihn mehr ein gewisser Instinct als eine wirkliche Ueberlegung, denn Raubgesellen, die ein Gemetzel und eine Plünderung im Schilde führen, wissen doch recht gut, daß ihre Aussichten auf Erfolg steigen, wenn ihnen eine Ueberraschung der Gegenpartei gelingt. Sie suchen sich also vorher versteckt zu halten, und diese hier sollten sich geradezu angemeldet haben?
Der Knabe wollte Max Huber und John Cort nicht sogleich wecken und schlich sich deshalb lautlos nach dem Wagen. Als er den Foreloper gefunden hatte, legte er ihm die Hand auf die Schulter, weckte ihn auf und wies mit dem Finger nach den Feuerpunkten am Horizonte.
Khamis richtete sich auf, beobachtete einen Augenblick die wandelnden Flammen und rief dann mit gellender Stimme:
»Herr Urdax! Herr Urdax!«
Der Portugiese, von jeher gewöhnt, sich schnell aus dem Schlafe zu reißen, war augenblicklich auf den Füßen.
»Was giebt es, Khamis?
– Sehen Sie dorthin!«
Mit ausgestrecktem Arme wies er nach dem erleuchteten Waldsaume am Ende der Ebene.
»Alle auf!« rief der Portugiese mit der vollen Kraft seiner Lungen.
Binnen wenigen Secunden war das ganze Personal der Karawane auf den Füßen, alle aber von dem Ernste der Lage so sehr ergriffen, daß es keinem einfiel, den pflichtvergessenen Wächtern jetzt Vorwürfe zu machen. Ohne Llanga wäre das Lager jedenfalls überrumpelt worden, während Urdax und seine Begleiter in friedlichem Schlummer lagen.
Selbstverständlich hatten sich Max Huber und John Cort, die eiligst von ihrer Lagerstatt aufgesprungen waren, dem Portugiesen und dem Foreloper angeschlossen.
Es war jetzt ein wenig über halb elf Uhr. Tiefe Finsterniß bedeckte die Ebene auf drei Viertel ihres Umkreises im Norden, Osten und Westen. Nur im Süden funkelten die seltsamen Flammen und warfen aufflackernd lange Lichtstreifen vor sich her. Jetzt konnte man ihrer etwa fünfzig zählen.
»Da draußen müssen sich Eingeborne angesammelt haben, begann Urdax, und wahrscheinlich sind das Budjas, die meist an den Ufern des Congo und des Ubanghi umherschwärmen.
– Natürlich, meinte Khamis, von allein werden sich jene Fackeln nicht entzündet haben.
– Und daneben, bemerkte John Cort, sind auch Arme da, die sie halten und umhertragen.
– Diese Arme aber, fuhr Max Huber fort, müssen an Schultern sitzen, und die Schultern wieder zu Menschenkörpern gehören, doch inmitten des Lichtscheins erblickt man davon keinen einzigen…
– Sie halten sich jedenfalls ein wenig jenseit des Waldesrandes, hinter den Bäumen, ließ sich Khamis vernehmen.
– Man erkennt überdies auch, nahm Max Huber wieder das Wort, daß die Rotte da draußen nicht auf dem Wege um den Wald herum ist, denn die Lichtpunkte entfernen sich einmal nach rechts oder links hin, vereinigen sich dann aber immer aufs neue…
– Gewiß an der Stelle, wo sich das Lager der Eingebornen befindet, bemerkte der Foreloper.
– Und was ist Ihre Ansicht? wendete sich Urdax an John Cort.
– Ich glaube, daß uns ein Angriff droht, versicherte dieser, und daß wir uns sofort zur Vertheidigung rüsten müssen…
– Warum sollten uns die Eingebornen aber nicht überfallen haben, bevor sie sich zeigten?
– O, Neger sind eben keine Weißen, erklärte der Portugiese.
Fehlt es ihnen auch an kluger Vorsicht, so sind sie wegen ihrer Zahl und ihrer Wildheit doch nicht minder zu fürchten.
– Reine Panther, die unsere Missionäre große Mühe haben werden, in Lämmer zu verwandeln, antwortete Max Huber.
– Halten wir uns bereit!« schloß der Portugiese.
Ja, jetzt galt es, sich auf alles bereit zu machen, sich bis zum Tode zu vertheidigen. Von den wilden Völkerschaften Ubanghis darf man kein Erbarmen erwarten. Wie grausam sie sind, kann man sich kaum vorstellen; selbst die wildesten Stämme Australiens, der Salomonsinseln, der Hebriden und Neuguineas würden mit ihnen schwerlich den Vergleich aushalten. Im Herzen des hiesigen Landestheiles giebt es nur Kannibalendörfer, und die Väter der Missionen, die dem schrecklichsten Tode furchtlos ins Antlitz schauen, wissen das auch sehr wohl. Man wäre wirklich versucht, diese Wesen, ein Raubzeug mit Menschenangesicht, hier im äquatorialen Afrika unter die Thiere zu rechnen, und ihnen gegenüber ist Schwäche ein Verbrechen und nur die Gewalt berechtigt. Selbst im reisen Mannesalter haben diese Schwarzen nicht einmal soviel Kenntnisse, wie bei uns ein fünf- bis sechsjähriges Kind.
Man darf auch behaupten – Beweise giebt es in Ueberfluß und die Missionäre sind oft genug Zeugen von entsetzlichen Auftritten gewesen – daß hierzulande Menschenopfer noch vielfach im Schwange sind. Man ermordet die Sklaven auf dem Grabe ihres Herrn, und ihre an einen elastischen Zweig gehängten Köpfe werden weit fortgeschleudert, sobald der Fetischdiener sie abgeschnitten hat. Im Alter von zehn bis zu sechzehn Jahren dienen Kinder als Nahrung bei größeren Festen, und manche Häuptlinge sollen sich ausschließlich von solchen nähren.
Zu ihren Kannibalengelüsten gesellt sich noch eine ungezähmte Raubgier. Diese führt sie oft auf die Straßen der Karawanen, die sie überfallen, ausplündern und vernichten.
Sind sie auch weniger gut bewaffnet als die Händler und deren Begleitmannschaft, so haben sie doch den Vortheil der größeren Zahl, und einige tausend Eingeborne nehmen es allemal mit ein paar hundert Trägern auf. Die Forelopers wissen das recht gut; sie hüten sich auch sorgsamst, Negerdörfern wie Ngombe Dara, Kalaka Taimo und andern in der Umgebung des Aukadepe und des Bahar-el-Abiad zu nahe zu kommen, wo noch keine Missionäre thätig gewesen sind, wohin diese aber auch noch vordringen werden. Keine Furcht vermag deren Feuereifer zu dämpfen, wo es sich darum handelt, zarte Menschengeschöpfe vor dem Tode zu retten und jene wilden Rassen durch christliche Civilisation aus ihrer Versunkenheit emporzuheben.
Vom Anfang seines Zuges an hatte der Portugiese Urdax nicht immer Angriffen durch Eingeborne aus dem Wege gehen können, dabei war es ihm jedoch stets gelungen, ohne größeren Schaden davonzukommen, und er führte sein Personal jetzt in unverminderter Zahl heim. Die Rückkehr versprach eigentlich in vollster Sicherheit zu verlaufen. Nach Umgehung dieses Waldes an der Westseite, gelangte man an das rechte Ufer des Ubanghi und längs dieses Flusses gedachte man bis zu seiner Einmündung am rechten Congouser hinzuziehen. Vom Ubanghi aus trifft man dann häufig auf reisende Händler und auf Missionäre. Hier ist auch weniger zu fürchten von einer Begegnung mit eingebornen Stämmen, die durch das Eingreifen Frankreichs, Deutschlands, Englands und Portugals immer weiter nach den Gebieten von Darfur zurückgedrängt werden.
Sollte die Karawane jetzt, wo einige Marschtage genügten, den Fluß zu erreichen, auf ihrem Wege aufgehalten werden oder einer so starken Anzahl mordgieriger Gesellen vielleicht gar zum Opfer fallen?… Das war leider zu befürchten.
Jedenfalls sollte sie nicht, ohne sich vertheidigt zu haben, zu Grunde gehen, und entsprechend dem Aufruf des Portugiesen wurden alle Maßregeln zu einer kräftigen Abwehr getroffen.
Im Handumdrehen waren Urdax, der Foreloper, John Cort und Max Huber bewaffnet und hatten ein Gewehr bereit, einen Revolver im Gürtel und eine wohlgefüllte Patronentasche daran befestigt. Der Wagen enthielt überdies ein Dutzend Flinten und Pistolen, die an einige, bezüglich ihrer Treue erprobte Träger vertheilt wurden.
Gleichzeitig befahl Urdax seinen Leuten, sich immer in der Nähe der großen Tamarinden zu halten, um leicht besseren Schutz gegen Pfeile finden zu können, deren vergiftete Spitzen meist tödtliche Verletzungen erzeugen.
Jetzt wartete alles voller Spannung. Kein Geräusch unterbrach die Stille der Umgebung. Es schien nicht so, als ob die Eingebornen vom Walde her über die Ebene vorgedrungen wären. Noch sah man wie vorher den feurigen Schein und da und dort wirbelten lange Säulen gelblichen Rauches empor.
»Was dort an den ersten Baumreihen hin und her getragen wird, müssen sehr harzhaltige Fackeln sein.
– Ganz gewiß, stimmte Max Huber ein. Ich begreife nur nicht, was die Kerle dort anfangen, wenn sie wirklich einen Angriff auf uns beabsichtigen.
– Und ich begreife es ebensowenig, fügte John Cort hinzu, wenn sie diese Absicht nicht haben.«
Die Sache war in der That unerklärlich, doch worüber hätte man überhaupt erstaunen können, wenn solche verthierte Gesellen vom obern Ubanghi in Betracht kamen? Eine halbe Stunde verrann ohne Veränderung der Sachlage. Das ganze Lager blieb unausgesetzt auf der Hut. Alle Blicke durchforschten die dunkle Ferne im Osten und im Westen.
Während die Feuer im Süden weiter brannten, konnte sich ja ein Theil der Wilden von der Seite heranschleichen und die Karawane unter dem Schutze der Finsterniß überfallen.
Nach jenen beiden Seiten blieb die Ebene jedoch völlig verlassen. So dunkel die Nacht auch war, hätten hier doch keine Feinde den Portugiesen und seine Begleiter überraschen können, ohne daß diese von ihren Waffen Gebrauch gemacht hätten.
Kurz nachher, gegen elf Uhr, rief Max Huber, der von der aus Urdax, Khamis und John Cort bestehenden Gruppe einige Schritte vorwärtsgegangen war:
»Wir werden selbst nachsehen müssen, mit wem wir es hier zu thun haben!
– Könnte das etwas nützen, warf John Cort dagegen ein, und empfiehlt es sich nicht weit mehr, bis zum Tagesanbruch auf der Wacht zu bleiben?
– Warten… noch warten, entgegnete Max Huber, wo unser Schlaf so abscheulich unterbrochen worden ist, noch sechs Stunden, die Hand am Gewehrabzuge, warten! Nein, da ist es doch besser, zu sehen, woran man ist. Hegten die Eingebornen übrigens keine schlechten Absichten gegen uns, so wäre ich gern bereit, mich wieder bis zum Morgen in mein Wurzelbettgestell niederzulegen, wo ich schon so angenehm träumte.
– Was meinen Sie dazu? fragte John Cort den Portugiesen, der sich bisher ganz still verhalten hatte.
– Vielleicht verdient der Vorschlag Beachtung, antwortete dieser; er muß nur mit der größten Vorsicht ausgeführt werden.
– Ich erbiete mich zu dem Versuche, rief Max Huber eifrig, und verlassen Sie sich darauf…
– Und ich werde Sie begleiten, meldete sich der Foreloper, wenn Herr Urdax dem zustimmt.
– Es würde jedenfalls besser sein, meinte der Portugiese.
– Und ich kann mich auch noch anschließen, erklärte John Cort.
– Nein, bleib’ Du zurück, lieber Freund, bat Max Huber. Zu Zweien sind wir genug. Uebrigens werden wir nicht weiter als nöthig hinausgehen. Erspähen wir einen Trupp, der sich von dieser Seite nähert, so kommen wir schleunigst zurück.
– Ueberzeugt Euch auch, daß Eure Feuerwaffen gut in stand sind, mahnte noch John Cort.
– Das ist schon geschehen, erwiderte Khamis, ich hoffe jedoch, daß sie auf unserem Streifzuge nicht in Thätigkeit kommen. Das Wichtigste für uns ist doch, selbst unentdeckt zu bleiben.
– Das meine ich auch«, erklärte der Portugiese.
Neben einander hingehend, hatten Max Huber und der Foreloper den Tamarinden-Hügel bald hinter sich gelassen.
Weiterhin war die Ebene weniger dunkel, obwohl man auf hundert Schritte hin einen Mann noch kaum hätte wahrnehmen können.
Beide hatten kaum fünfzig Schritte gemacht, als sie Llanga hinter sich bemerkten. Ohne ein Wort zu sagen, war der Knabe ihnen vom Lager aus gefolgt.
»Warum bist Du denn gekommen, Kleiner? sagte Khamis.
– Jawohl, Llanga, fuhr Max Huber fort, warum bist Du denn nicht bei den anderen geblieben?
– Vorwärts… trolle Dich zurück, befahl der Foreloper.
– O, Herr Max, murmelte Llanga, ich bei Ihnen… ich bei Ihnen sein…
– Du weißt aber doch, daß Dein Freund John Cort dort hinter uns ist.
– Ja, dafür mein Freund Max… hier sein!
– Wir brauchen Dich aber nicht! sagte Khamis schon mit weniger strengem Tonfall.
– Lassen wir ihn hier, da er einmal da ist, meinte Max Huber.
Er wird uns nicht im Wege sein, Khamis, und vielleicht entdeckt er mit seinen Katzenaugen sogar, was wir noch nicht erkennen können.
– Ja, ja, ich werde ausschauen… weit hinaus! versicherte das Kind.
– Nun gut; so halte Dich neben mir, sagte Max Huber, und halte hübsch die Augen offen!«
Alle drei gingen weiter. Nach einer Viertelstunde befanden sie sich in der Mitte zwischen dem Lager und dem großen Walde.
Die Flammen verbreiteten noch immer ihren Schein am Fuße der Bäume, leuchteten aber, aus größerer Nähe gesehen, um so heller. So scharf aber auch der Gesichtssinn des Foreloper und so gut das Fernrohr Max Huber’s war, das dieser eben aus dem Etui gezogen hatte, so durchdringend die Blicke der jungen
»Wildkatze« ohne Zweifel waren: es erwies sich doch noch immer unmöglich, jemand, der die Fackeln trüge, gewahr zu werden.
Das bestätigte die Ansicht des Portugiesen, wonach diese Feuerpunkte sich zum Theil verdeckt durch die Baumstämme und hinter dichtem Strauchwerk bewegten. Offenbar hatten die Eingebornen die Grenze des Waldes nicht überschritten und dachten vielleicht gar nicht daran, es zu thun.
Wahrlich, die Geschichte wurde immer unerklärlicher.
Befand sich hier nur ein Ruheplatz von Schwarzen und beabsichtigten diese, am nächsten Morgen weiter zu ziehen, wozu dann die seltsame Beleuchtung des Waldsaumes? Hielt vielleicht eine nächtliche Feier die Leute um diese Stunde noch wach?
»Ich frage mich sogar, äußerte Max Huber, ob sie von unserer Karawane überhaupt etwas bemerkt haben und ob es ihnen bekannt ist, daß diese am Fuße der Tamarinden lagert.
– Ja freilich, antwortete Khamis, es ist ja möglich, daß sie selbst erst hierher gekommen wären, als die Nacht schon auf der Ebene lag, und da unsere Feuer zeitig ausgelöscht wurden, wissen sie vielleicht gar nicht, daß wir uns in so geringer Entfernung von ihnen befinden. Morgen mit Tagesgrauen wird sich’s ja zeigen…
– Wenn wir bis dahin nicht selbst schon abgezogen sind, Khamis.«
Max Huber und der Foreloper setzten schweigend ihren Weg fort.
In dieser Weise wurde noch ein halber Kilometer zurückgelegt, wonach die Strecke bis zum Walde nur noch einige hundert Schritte lang war.
Bisher war auf dem Wege, der zuweilen vom Fackelschein etwas mehr beleuchtet wurde, nichts verdächtiges beobachtet worden. Weder im Süden, noch im Osten oder Westen waren die Umrisse einer Menschengestalt zu entdecken gewesen. Ein Angriff schien wenigstens nicht unmittelbar zu drohen. So nahe sie jetzt auch dem Waldessaume waren, konnte weder Max Huber, noch Khamis oder Llanga etwas von den Wesen wahrnehmen, die ihre Gegenwart durch die zahlreichen Feuerbrände verriethen.
»Wollen wir noch näher hinangehen? fragte Max Huber, nachdem alle einige Augenblicke Halt gemacht hatten.
– Wozu könnte es nützen? antwortete Khamis. Es könnte sogar unklug sein. Nach allem erscheint es nicht ausgeschlossen, daß unsere Karawane unbemerkt geblieben ist, und wenn wir noch im Laufe der Nacht aufbrechen…
– Ich möchte aber gar zu gern Gewißheit haben! erwiderte Max Huber. Die Geschichte sieht gar so seltsam aus.«
Es gehörte kaum so viel dazu, die lebhafte Einbildungskraft des Franzosen anzustacheln.
»Kommt, wir wollen nach dem Hügel zurückkehren,«
mahnte der Foreloper.
Dennoch mußte er mit Max Huber, den Llanga einmal nicht verlassen wollte, noch ein Stück weiter mitgehen. Alle drei wären auch beinahe bis zum Saume des Waldes selbst vorgedrungen, da rief Khamis aber halblaut:
»Keinen Schritt weiter!«
Wichen der Foreloper und sein Begleiter jetzt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr zurück?… Hatten sie eine Gruppe Eingeborner gesehen?…
Stand ihnen ein Angriff durch diese bevor?… Das wäre nicht sofort zu entscheiden gewesen, jedenfalls aber hatte sich in der Vertheilung der Flammen am Waldrande eine auffallende Veränderung vollzogen.
Einen Augenblick verschwanden die Fackeln gänzlich hinter den ersten Baumreihen, die nun in tiefer Dunkelheit lagen.
»Achtung! flüsterte Max Huber.
– Zurück!« setzte Khamis hinzu.
Vielleicht erschien es geboten, angesichts eines gefährlichen Ueberfalles zurückzuweichen, doch durfte das nicht geschehen, ohne jeden Augenblick schußfertig zu sein. Die Gewehre wurden also bereit gehalten, während die »Patrouille« sich noch immer bemühte, zu erkennen, was hinter den ersten Bäumen vorginge.
Plötzlich tauchte aber der Lichtschein von etwa zwanzig Fackeln aufs neue auf.
»Alle Wetter, rief Max Huber, jetzt geht nicht nur etwas außerordentlich, sondern etwas unbegreiflich Fremdartiges vor sich!«
Dieser Ausruf war dadurch begründet, daß die Fackeln, die bisher nahe über dem Erdboden aufgeleuchtet hatten, plötzlich fünfzig bis hundert Fuß über diesem aufblitzten.
Von den Wesen aber, die die Fackeln theils in den unteren Aesten, theils nahe der Krone der Bäume schwangen, als ob ein Flammenstrom sich durch das dichte Laubwerk ergösse, konnte weder Max Huber, noch der Foreloper oder Llanga auch nur ein einziges erspähen.
»O, rief Max Huber, sollten das nur Irrlichter sein, die auf den Bäumen umherhüpfen?«
Khamis schüttelte den Kopf; diese Erklärung der Erscheinung genügte ihm nicht. Eine Ausströmung von Wasserstoffgas, das sich entzündet hätte, oder ein Viertelhundert jener Strahlenbündel, die bei schweren Gewittern ebenso an den Aesten von Bäumen wie am Takelwerk von Schiffen auftreten, konnte das unmöglich sein, mit dem merkwürdigen Sanct Elmsfeuer waren diese leuchtenden Kreise nicht zu verwechseln. Mit Elektricität war die Luft offenbar nicht geschwängert, die Wolken drohten sich vielmehr in einem der furchtbaren Platzregen aufzulösen, die den mittleren Theil des Schwarzen Erdtheils so häufig überschwemmen.
Immerhin blieb es unerklärlich, warum die erst am Fuße der Bäume umherschwärmenden Eingebornen jetzt theils nach der ersten Astgabelung, theils nach den höchsten Zweigen der Bäume hinaufgeklettert wären, und ebenso, warum sie die flackernden, harzigen Fackeln, deren Prasseln und Knacken ziemlich weit hörbar war, so unablässig hin- und herbewegen möchten.
»Vorwärts… weiter! drängte Max Huber.
– Das ist unnöthig, entgegnete der Foreloper. Ich glaube nicht mehr, daß unserem Lager diese Nacht eine Gefahr droht, und dann ist es besser, wir beeilen uns, die anderen darüber zu beruhigen.
– Dazu werden wir desto besser im stande sein, Khamis, wenn wir erst wissen, woran wir uns bezüglich dieser Erscheinung zu halten haben.
– Nein, nein, Herr Huber, weiter vor wagen wir uns nicht.
Gewiß ist, daß sich hier ein Stamm von Eingebornen aufhält.
Sie könnten ja die Feuerbrände schwingen und sich auf die Bäume geflüchtet haben, um sich vor gefährlichen Raubthieren zu schützen.
– Vor Raubthieren? wiederholte Max Huber. Panther, Hyänen und wilde Ochsen würde man aber heulen oder brüllen hören, hier ist dagegen das einzige Geräusch, das wir vernehmen, das Knistern der Flammen, die den ganzen Wald in Brand zu setzen drohen. Nein, ich muß alles wissen!«
Max Huber that einige Schritte vorwärts, und Llanga, den Khamis vergeblich zu sich zurückrief, folgte ihm treulich nach.
Der Foreloper überlegte noch, was er in seiner Ohnmacht gegenüber der Ungeduld des Franzosen beginnen sollte. Da er ihn aber nicht allein der Gefahr trotzen lassen wollte, entschloß er sich, ihm bis zum Waldrande nachzugehen, obgleich das seiner Ansicht nach auf eine unverzeihliche Tollkühnheit hinauskam.
Plötzlich blieb er stehen, im nämlichen Augenblicke, wo auch Max Huber und Llanga Halt machten. Alle drei drehten sich schnell um… Der Lichtschein war es nicht mehr, der ihre Aufmerksamkeit erregte. Wie durch den Athem eines losbrechenden Sturmes waren alle Fackeln verlöscht und tiefe Finsterniß herrschte am Himmel und auf der Erde.
Von der entgegengesetzten Seite her drang ein Geräusch zu ihnen her, eine Art langgezogenen Rauschens, ein Dröhnen und Schnarren, als ob die Tonwellen einer Riesenorgel über die Ebene herflutheten.
War es ein Unwetter, das von jener Seite des Himmels aufzog und dessen erstes Donnergrollen die Atmosphäre erschütterte?
Nein, wenigstens zeigte sich keines der Meteore, die Centralafrika so häufig von einer Küste bis zur anderen verwüsten. Jenes charakteristische Geräusch rührte offenbar von Thieren her, nicht aber von Blitzen, die sich am Himmel zwischen den Wolkenmassen entluden. Auch in den niedrigen Schichten zeigte sich keiner der blendenden Zickzackstreifen, die einander sonst in kurzen Zwischenräumen folgen. Kein Blitz leuchtete am Horizonte im Norden auf, dieser erschien vielmehr ebenso dunkel wie der im Süden. Die Cirruswolken, die wie abgegrenzte Dampfmengen aneinander geschichtet lagen, durchzuckte kein einziger Feuerstrahl.
»Was mag das bedeuten, Khamis? fragte Max Huber.
– Zurück nach dem Lager… lautete nur die Antwort des Foreloper.
– Sollten es vielleicht gar…?« rief noch Max Huber.
Gespannt in der betreffenden Richtung hin lauschend, vernahm er jetzt deutlicher eine Art Trompeten, das zuweilen schrill wie die Pfeife einer Locomotive ertönte und in dem wüsten Lärmen mit dessen Annäherung unheimlich zunahm.
»Nun aber schnell hinweg, rief der Foreloper, schnell… was uns die Füße tragen!«
Drittes Capitel.
Versprengt
Max Huber, Llanga und Khamis durchflogen in zehn Minuten die fünfzehnhundert Meter, die sie vom Lagerplatze trennten.
Nicht ein einziges Mal hatten sie sich dabei umgesehen, unbekümmert darum, ob die Eingebornen, die ihre Fackeln gelöscht hatten, sie verfolgten oder nicht. Auf der Seite nach diesen hin herrschte übrigens vollkommene Ruhe, während von der entgegengesetzten her ein wüster Lärm mit erschreckenden Tönen dazwischen auf der Ebene hörbar war.
Als die beiden Männer und der Knabe im Lager anlangten, war hier alles eine Beute des Schreckens… eines Schreckens, der gerechtfertigt erschien durch das Drohen einer Gefahr, gegen die Muth und Klugheit so gut wie nichts vermochten. Ihr zu trotzen… unmöglich!… Ihr zu entfliehen?… Das war vielleicht zu spät.
Max Haber und Khamis hatten sich sofort John Cort und Urdax angeschlossen, die etwa fünfzig Schritt weit vor dem Hügel standen.
»Eine Herde Elefanten! rief der Foreloper.
– Ja, bestätigte der Portugiese, und vor Ablauf einer Viertelstunde werden sie über uns gekommen sein.
– Wir sollten im Walde Schutz suchen, meinte John Cort.
– Der Wald wird sie auch nicht aufhalten, wendete Khamis dagegen ein.
– Wie steht es denn mit den Eingebornen? erkundigte sich John Cort.
– Wir haben keinen einzigen davon sehen können, antwortete Max Huber.
– Sie können doch den Wald unmöglich verlassen haben.
– Nein, gewiß nicht!«
In der Entfernung etwa einer halben Lieue bemerkte man jetzt eine große Menge schwankender Schattengestalten, die sich in einer Ausdehnung von hundert Toisen heranwälzte, ähnlich einer mächtigen Fluth, deren Wellen donnernd über die Ebene hereinbrachen. Der Erdboden erzitterte schwach unter einem schweren Stampfen, eine Erschütterung, die sich bis zu den Wurzeln der Tamarinden fühlbar machte. Das verwirrte Geräusch nahm schnell in beängstigender Weise zu. Gellende Laute, untermischt mit metallenen Tönen, drangen aus Hunderten von Rüsseln… wie von ebensoviel scharf angeblasenen Trompeten.
Die Reisenden in Afrika haben das schauerliche Concert ganz treffend mit dem Getöse verglichen, das auf dem Schlachtfelde eine mit größter Schnelligkeit dahinziehende Artillerieabtheilung hervorbringt. Das stimmt wenigstens unter der Voraussetzung, daß dazu Trompeten ihre ohrzerreißenden Töne in die Luft schmettern. Das Entsetzen des Personals der Karawane bei dem Gedanken. bald von einer Herde Elefanten elend zertreten zu werden, kann man sich dann wohl leicht vorstellen.
Eine Jagd auf die mächtigen Thierkolosse ist allemal mit ernster Gefahr verknüpft. Diese vermindert sich nur, wenn es gelingt, sie zu überraschen, ein einzelnes der Pachydermen von der Herde, wozu es gehört, zu trennen und auf dieses unter Verhältnissen zu schießen, die einen Erfolg erwarten lassen.
denn nur, wenn den Elefanten eine Kugel zwischen Auge und Ohr trifft wird das große Thier fast auf der Stelle getödtet.
Selbst wenn eine Herde gelegentlich nur aus einem halben Dutzend der mächtigen Rüsselthiere besteht, ist die allergrößte Vorsicht nöthig. Fünf bis sechs Paaren wüthender Elefanten gegenüber, ist schon an keinen Widerstand mehr zu denken, da ihre Waffe – würde ein Mathematiker sagen – sich im Verhältniß des Quadrats ihrer Geschwindigkeit vergrößert.
Stürzen sich die furchtbaren Thiere gar zu Hunderten auf ein Lager, so kann man ihren Ansturm ebensowenig aufhalten, wie eine Lawine oder wie eine Springfluth, die die Schiffe kilometerweit vom Ufer aufs Land schleudert.
So zahlreich diese Thierart jetzt noch ist, wird sie doch endlich verschwinden. Da ein Elefant wenigstens für tausend Francs Elfenbein liefert, stellt man ihm mit zähester Hartnäckigkeit nach.
Nach der Berechnung Foa’s werden – meist im Herzen Afrikas jährlich nicht weniger als vierzigtausend Elefanten erlegt. Diese liefern etwas siebenhundertfünfzigtausend Kilogramm Elfenbein, das nach England verschiffen wird.
Nach einem halben Jahrhundert dürfte es, trotz der Langlebigkeit diese Thiere, kein einziges davon mehr geben.
Wäre es nicht empfehlenswerther, aus der Züchtung und Zähmung der kostbaren Thiere Nutzen zu ziehen, da ein Elefant dieselbe Last tragen kann, wie zweiunddreißig Menschen, und einen viermal längeren Weg zurückzulegen vermag, als ein Fußgänger? Gezähmt würden sie auch, wie in Indien, reichlich doppelt so viel werth sein, als der Ertrag, der man durch ihre Abschlachtung gewinnt.
Der afrikanische Elefant bildet mit dem asiatischen die zwei einzigen noch vorkommenden Arten, die sich mehrfach unterscheiden. Die ersten sind kleinen, haben eine braunere Haut, eine mehr vorgewölbte Stirn, dazu größere Ohren und längere Stoßzähne, als ihre asiatischen Genossen, sie sind auch weit wilde als diese und kaum einigermaßen zu zähmen.
Während seines jetzigen Jagdzuges war der Portugiese entschieden von Glücke begünstigt worden, und auch die beiden Liebhaber dieses Sports konnten sich wohl für befriedigt erklären. In Lybien sind die Dickhäuter, wie erwähnt noch in großer Zahl zu finden. Die Gebiete von Ubanghi bieten ihnen, was sie suchen: Wälder und bei ihnen vorzüglich beliebte sumpfige Ebenen. Hier leben sie truppweise, gewöhnlich angeführt von einem alten männlichen Thiere.
Inder Urdax und seine Begleiter sie auf fest umplankte Plätze lockten, ihnen Falle stellten oder vereinzelt angetroffene unmittelbar angriffen, hatten sie, ohne Unfälle wenn auch nicht ohne Gefahren und Mühseligkeiten, eine reiche Beute zusammen gebracht. Jetzt auf dem Rückwege schien es freilich, als ob die ganze Karawane von der aufgeregten Horde, die dahertrabend die Luft mit ihrem Getöse erfüllte mit Stumpf und Stiel vernichtet werden sollte.
Hatte der Portugiese noch Zeit genug gehabt, Vertheidigungsmaßregel gegen den vermutheten Angriff der am Rande des Waldes umherschwärmende Eingebornen zu treffen, so war gegen den jetzt drohenden Ueberfall so gut wie nichts zu thun. Von dem ganzen Lager würden bald nur Trümmer und Staub übrig sein. Nur eine einzige Frage galt es noch: die, ob es dem Personen gelingen werde, sich zu retten, indem es sich auf der Ebene zerstreute. Man vergesse hierbei nicht, daß die Geschwindigkeit des Elefanten eine wunderbar ist und ein Pferd im Galopp ihn nicht zu überholen vermag.
»Wir müssen fliehen… augenblicklich fliehen! rief Khamis dem Portugiesen zu.
– Fliehen… das geht nicht!« antwortete Urdax halb von Sinnen.
Der unglückliche Händler begriff recht wohl, daß er damit sein Material, den ganzen Gewinn seines Zuges einbüßen werde.
Blieb er im Lager zurück, so konnte er freilich auch nichts davon retten, und es war ja überhaupt eine Tollheit, an einen, hier unmöglichen Widerstand zu denken.
Max Huber und John Cort warteten auf eine Entscheidung, der sie sich auf jeden Fall unterwerfen wollten.
Inzwischen wälzte sich die furchtbare Masse weiter heran, und das mit einem solchen Lärm, daß man kaum noch sein eigenes Wort verstand.
Der Foreloper wiederholte, daß man schleunigst hinwegeilen müsse.
»In welcher Richtung? fragte Max Huber.
– Nach dem Walde zu.
– Und die Eingebornen?…
– Von denen droht uns weniger Gefahr als hier,« erklärte Khamis.
Ob das so sicher war, konnte freilich niemand wissen. Auf keinen Fall konnte man jedoch hier auf der Stelle bleiben. Um dem Untergange zu entgehen, gab es nur ein Mittel: die Flucht in den Wald.
Ob es dazu aber noch Zeit war?… Zwei Kilometer zurücklegen, wo die Horde kaum noch halb so weit von ihnen entfernt war?
Alle harrten auf einen Befehl von Urdax, der sich zu einem solchen doch nicht ermannen konnte.
Endlich rief er:
»Den Wagen… den Wagen! Bringt ihn schnell hinter den Hügel, vielleicht bleibt er da unversehrt!
– Zu spät! antwortete der Foreloper.
– Thue, was ich Dir sage! stieß der Portugiese hervor.
– Ja… doch wie?« versetzte Khamis.
Nach Sprengung ihrer Fesseln waren die Zugochsen nämlich, ohne daß jemand sie aufhalten konnte, davon gestürmt und liefen jetzt in ihrer Verwirrung unmittelbar vor der gewaltigen Herde her, die sie bald wie Fliegen zerstampfen mußte.
Da wollte Urdax die Begleitmannschaft der Karawane zu Hilfe ziehen.
»Hierher… die Träger hierher! rief er aus Leibeskräften.
– Die Träger? antwortete Khamis. Holen Sie die Kerle nur, die längst entflohen sind.
– Diese elenden Schurken!« stieß John Cort hervor.
Die Schwarzen waren in der That in westlicher Richtung vom Lager nicht nur davongelaufen, sondern hatten dabei auch noch kleinere Waarenballen und verschiedene Vertheidigungsmittel mitgenommen. Sie ließen ihren Herrn gewissenlos als Feiglinge und als Diebe einfach im Stiche.
Auf diese Leute war also nicht zu rechnen, denn zurück kamen sie sicherlich nicht. Wahrscheinlich fanden sie sogar Unterschlupf in Dörfern von Eingebornen. Von der Karawane waren nun blos noch der Portugiese und der Foreloper, der Franzose, der Amerikaner und der kleine Knabe übrig.
»Den Wagen… den Wagen!« schrie Urdax, der sich darauf versteifte, ihn hinter dem Hügel in Sicherheit zu bringen.
Khamis konnte nicht umhin, mit den Schultern zu zucken. Er gehorchte jedoch, und dank der Unterstützung Max Huber’s und John Cort’s wurde das Gefährt bis an die Bäume herangeschleppt. Vielleicht blieb es hier verschont, wenn die Herde, bei den Tamarinden angelangt, sich theilte.
Die Sache hatte immerhin einige Zeit gekostet, und als sie abgethan war, lag es auf der Hand, daß es für den Portugiesen und seine Begleiter zu spät war, den Wald noch erreichen zu können.
Khamis sah das zuerst ein und brach nur in die drei Worte aus:
»Auf die Bäume!«
Nur ein Ausweg bot sich jetzt noch: zwischen die Aeste der Tamarinden zu klettern, um wenigstens dem ersten Anprall der Dickhäuter auszuweichen.
Max Huber und John Cort waren noch einmal in den Wagen gestürmt. Sich hier mit Patronenpacketen zu beladen, um wenigstens Munition für die Gewehre zu haben, wenn sie sich dieser gegen die Elefanten bedienen müßten, und nach der früheren Stelle zurückzueilen, das war das Werk eines Augenblickes. Der Foreloper hatte sich nur noch eine Axt und seine Feldflasche geholt. Wenn sie die unteren Gebiete von Ubanghi durchwanderten, konnte er mit den übrigen doch vielleicht noch die Factoreien an der Küste erreichen.
Welche Zeit war es denn jetzt?… Genau siebzehn Minuten nach elf, wie John Cort angab, der seine Uhr mit einem angezündeten Streichhölzchen beleuchtet hatte. Seine Kaltblütigkeit war ihm geblieben, und das ermöglichte ihm, die Sachlage zu beurtheilen, die seiner Ansicht nach schon höchst gefährlich war, aber ganz aussichtslos wurde, wenn die Elefanten am Hügel Halt machten und nicht nach der Ost- oder Westseite der Ebene weiter trabten.
Der nervöse und sich der Gefahr ganz ebenso bewußte Max Huber lief neben dem Wagen hier und dort hin und beobachtete die ungeheure wogende Masse, die, noch dunkler als der Himmel sich von diesem abhob.
»Da müßte man freilich Kanonen zur Hand haben!«
murmelte er.
Khamis ließ nichts von dem merken, was er etwa empfand.
Er hatte die erstaunliche Ruhe des Afrikaners mit arabischem Blute, dem Blute, das dicker ist als das des Weißen, das auch weniger roth ist, die Empfindung abzustumpfen scheint und auch den physischen Schmerz weniger fühlen läßt. So stand er wartend da mit zwei Revolvern im Gürtel und hielt das Gewehr immer im Anschlag.
Der Portugiese, der seine Verzweiflung nicht verhehlen konnte, dachte offenbar mehr an den unersetzlichen Verlust, den er erleiden sollte, als an die Gefahren dieses Ueberfalles.
Er wetterte, seufzte und stieß die gräßlichsten Flüche in seiner Muttersprache hervor.
Llanga hielt sich neben John Cort und sah Max Huber dabei an. Er verrieth keine Furcht, denn er hatte keine, so lange er sich bei seinen beiden Freunden befand.
Je mehr sich die entsetzliche Dickhäuterschaar näherte, desto betäubender wurde der Höllenlärm, der von ihr ausging. Das Trompeten der mächtigen Rüsselthiere verdoppelte sich. Man fühlte ihren Athem schon wie einen Wind, der über die Erde strich. Bei der jetzigen Entfernung von vier- bis fünfhundert Schritten gewannen die Pachydermen im Dunkel der Nacht scheinbar eine unheimliche Größe. Man hätte von einer Apokalypse furchtbarer Ungeheuer reden können, deren Rüssel, gleich Tausenden von Schlangen, sinnlos durcheinander fuchtelten.
Nun war es die höchste Zeit, in die Aeste der Tamarinden zu flüchten. Vielleicht stürmte die feindliche Horde vorbei, ohne den Portugiesen und seine Gefährten zu bemerken.
Der Gipfel dieser Bäume ragte wohl um sechzig Fuß in die Luft empor. Sehr ähnlich den Nußbäumen, doch gekennzeichnet durch die regellose Verschlingung ihres Geästes, sind die Tamarinden, eine Dattelart, in verschiedenen Zonen Afrikas außerordentlich verbreitet. Außer daß die Neger aus dem schleimigen Theile ihrer Früchte ein erquickendes Getränk zu bereiten verstehen, pflegen sie die Schoten des Baumes dem Reis zuzusetzen, mit dem sie sich, vorzüglich in den Küstenländern, vorwiegend ernähren.
Die Tamarinden hier standen so dicht bei einander, daß ihre tieferen Zweige sich untereinander verschlangen, so daß man von einem Baume zum andern gelangen konnte. Ihre Stämme hatten unten einen Umfang von sechs bis acht und am Anfange der Verästelung noch reichlich von vier bis fünf Fuß. Immerhin war damit noch nicht gesagt, daß sie hinreichend widerstandsfähig wären, wenn die Thiere den Hügel stürmten.
Bis an die ersten Aeste hinauf, die sich etwa dreißig Fuß über dem Erdboden abzweigten, boten die Stämme nur eine ganz glatte Oberfläche. Bei der Dicke dieser Schäfte wäre es sehr schwierig gewesen, bis zu ihrer Gabelung hinauf zu gelangen, wenn Khamis nicht einige »Chamboks« zur Hand gehabt hätte.
Das sind sehr geschmeidige lange Riemen aus Rhinozeroshaut, deren sich die Forelopers bedienen, die Ochsengespanne zu lenken.
Mittels eines solchen Riemens, der über die Gabelung der Bäume hinweggeworfen wurde, konnten Urdax und Khamis eine der Tamarinden erklimmen Mit Hilfe eines zweiten Riemens gelang es Max Huber und John Cort in gleicher Weise. Sobald diese dann rittlings auf einem Aste saßen, warfen sie das freie Ende ihres Chambok dem jungen Llanga zu, den sie im Handumdrehen zu sich hinauszogen.
Die Herde war jetzt nur noch höchstens dreihundert Meter weit entfernt; binnen zwei bis drei Minuten mußten sie den Hügel erreicht haben.
»Na, lieber Freund, bist Du denn nun zufriedengestellt?
fragte John Cort ironisch seinen Kameraden.
– Bah, das ist noch immer weiter nichts, als etwas Unerwartetes, John.
– Ja freilich, Max; etwas Außerordentliches würde es aber sein, wenn wir aus dieser Geschichte mit heiler Haut davonkämen.
– Alles in allem hast Du recht, John. Besser wär’ es unbedingt, von diesem Ueberfalle durch Elefanten, die sich gewöhnlich recht brutal benehmen sollen, ganz verschont zu bleiben.
– Nein, das ist unglaublich, lieber Max, daß wir einmal ein und derselben Ansicht sind!« begnügte sich John Cort zu antworten.
Was Huber noch darauf erwiderte, konnte sein Freund nicht verstehen. Gerade jetzt ertönte nämlich ein furchtbares Gebrüll, dann hörte man Schmerzenslaute, bei denen auch die Muthigsten gebebt hätten.
Als sie das Laubwerk auseinander bogen, sahen Urdax und Khamis, was etwa hundert Schritte vom Hügel vorging.
Nachdem die Zugochsen sich losgerissen hatten, konnten sie nur noch nach dem Walde zu fliehen. Leider war kaum zu erwarten, daß die nicht gerade schnellfüßigen Thiere diesen erreichten, ehe sie überfallen wurden. Wirklich wurden sie auch bald zurückgedrängt, und obwohl sie sich mit Füßen und Hörnern verzweifelt wehrten, unterlagen sie doch sehr bald den grimmigen Feinden. Von dem ganzen Gespann blieb vorderhand nur ein Ochse übrig, der sich unglücklicherweise unter die Kronen der Tamarinden flüchtete.
Ja, zum Unglück, denn die Elefanten verfolgten und umringten ihn, als hätten sie das verabredet. Nach wenigen Sekunden war der Wiederkäuer weiter nichts mehr, als ein formloser Haufen zerrissener Fleischtheile, zerbrochener Knochen und blutender Ueberreste, den die knorpelharten Füße der Dickhäuter noch weiter zerstampften.
Nun war der ganze Hügel umringt und jede Aussicht, daß sich die wüthenden Thiere weiter trollen würden, gänzlich verschwunden.
In einem Augenblicke wurde der Wagen gestürmt, aus der Lage gebracht, umgestoßen und unter der schweren Last der Elefanten, die sich um den Hügel gesammelt hatten, bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert.
Zwar fluchte und wetterte der Portugiese aus Leibeskräften aufs neue, darum kümmerten sich aber die Hunderte von Elefanten ebensowenig, wie um einen Flintenschuß, den Urdax auf einen der nächsten, der den Stamm mit seinem Rüssel gepackt hatte, abfeuerte. Die Kugel prallte einfach am Rücken des Ungeheuers ab, ohne bis auf dessen Fleisch einzudringen.
Max Huber und John Cort gaben sich keiner Täuschung hin.
Unter der Voraussetzung, daß kein Schuß verloren ging, daß jede Kugel ihr Opfer niederstreckte, hätte man sich wohl der schrecklichen Angreifer erwehren, sie bis zum letzten vernichten können, wenn ihrer nur eine geringe Menge gewesen wären. Der junge Tag hätte dann nur einen Haufen mächtiger Cadaver am Fuße der Tamarinden beleuchtet… doch dreihundert… fünfhundert… vielleicht tausend dieser Thiere!… Es ist ja keine Seltenheit, so große Herden von ihnen im Aequatorialgebiete Centralafrikas zu treffen, und Reisende und Händler berichten übereinstimmend von ungeheueren Ebenen, die über Sehweite hinaus von Thieren dieser und anderer Art bedeckt gefunden wurden.
»Die Geschichte wird ungemüthlich, bemerkte John Cort.
– Man könnte sogar meinen, das dickere Ende käme noch nach,« sagte Max Huber. Dann wendete er sich an den jungen Eingebornen, der neben ihm saß.
»Du hast doch keine Furcht? fragte er.
– Nein, lieber Herr Max, mit Ihnen und bei Ihnen fürchtet sich Llanga niemals!«
Und doch wäre einem Kinde, ja nicht einmal einem Erwachsenen, ein Vorwurf zu machen gewesen, wenn sein Herz jetzt vor Schrecken erzitterte.
Ohne Zweifel hatten die Elefanten nämlich inzwischen bemerkt, was von dem Personal der Karawane noch übrig war.
Da sich jetzt die hinteren Reihen der Thiere an die vorderen herandrängten, wurde deren Kreis um den Hügel immer enger und enger. Ein Dutzend davon versuchte sogar, auf den Hinterbeinen stehend, mit dem Rüssel die tieferen Aeste zu erreichen, was ihnen aber mißlang, da diese gegen dreißig Fuß über der Erde lagen.
Vier Gewehrschüsse krachten jetzt gleichzeitig… vier Schüsse aufs Gerathewohl, denn ein genaues Zielen war unter dem dunkeln Laubwerk der Tamarinden unmöglich.
Laute Schreie und noch wüthenderes Heulen gaben darauf Antwort. Es schien jedoch nicht so, als ob ein Elefant von den Kugeln tödtlich verwundet worden wäre. Vier weniger… das hätte schließlich auch nichts bedeutet.
Die unteren Aeste suchten die Rüssel jetzt gar nicht mehr zu packen. Sie umklammerten vielmehr den Stamm der Bäume, die gleichzeitig unter dem Anprall der gewaltigen Leiber erzitterten. Denn so dick die Tamarinden auch am Fuße waren, so fest sie im Erdboden wurzelten, einem so übermächtigen Andrange mußten sie doch am Ende nachgeben.
Noch einmal blitzte ein Feuerschein auf, diesmal von zwei Schüssen, die der Portugiese und der Foreloper abgegeben hatten. Gerade der Baum, worauf diese beiden saßen, schwankte schon dermaßen, daß er bald umzusinken drohte.
Der Franzose und sein Freund hatten ihre Gewehre noch nicht abgefeuert, sondern hielten sie nur jeden Augenblick schußbereit.
»Wozu sollten wir jetzt schießen? hatte John Cort geäußert.
– Ganz recht, sparen wir lieber unsere Munition, hatte Max Huber darauf geantwortet, später könnten wir’s vielleicht bereuen, unsere letzten Patronen schon verplatzt zu haben.«
Die Tamarinde, auf der Urdax und Khamis sich anklammerten, wurde inzwischen so heftig erschüttert, daß man sie in ihrer ganzen Länge knarren und knacken hörte.
Wenn sie nicht entwurzelt wurde, mußte sie jedenfalls bald brechen. Die Thiere rannten mit den Stoßzähnen dagegen an, wuchteten daran mit den Rüsseln und lockerten die Wurzeln des Baumes immer mehr.
Noch länger darauf auszuhalten, und wär’s nur noch eine Minute gewesen, hieß Gefahr laufen, mit der Tamarinde zu Boden geschleudert zu werden.
»Kommen Sie!« rief der Foreloper dem Portugiesen zu, während er schon versuchte, sich nach dem nächsten Baume zu retten.
Urdax hatte offenbar schon den Kopf verloren. Unausgesetzt schoß er sein Gewehr und seinen Revolver ab, deren Kugeln doch von der rauhen Haut der Pachydermen wie vom Panzer eines Alligators abprallten.
»Kommen Sie! Schnell, schnell!« wiederholte Khamis.
Noch in dem Augenblicke, wo die Tamarinde gerade am heftigsten geschüttelt wurde, gelang es dem Foreloper, einen starken Zweig des Baumes zu packen, worauf Max Huber, John Cort und Llanga Zuflucht gefunden hatten. Dieser Baum war vorläufig weniger bedroht als der andere, gegen den sich die Wuth der Thiere richtete.
»Und Urdax? fragte John Cort besorgt.
– Er wollte mir nicht nachfolgen, erklärte der Foreloper, er weiß nicht mehr, was er thut…
– Der Unglückliche wird hinunterstürzen!
– Wir dürfen ihn nicht da drüben lassen, sagte Max Huber.
– Müssen ihn auch wider seinen Willen zu uns herüberziehen, setzte John Cort hinzu.
– Zu spät!« rief Khamis.
In der That war es schon zu spät. Noch einmal krachte der andere Baum von der Wurzel bis zum Wipfel, dann senkte er sich ächzend zur Erde.
Was dabei aus dem Portugiesen wurde, konnten seine Gefährten nicht sehen; sein Schmerzgeschrei verrieth, daß er unter die Füße der Elefanten gekommen war, und da es sehr bald verstummte, ließ sich vermuthen, daß es mit ihm zu Ende sei.
»Der unglückliche, arme Mann! murmelte John Cort.
– Nun kommt die Reihe gleich an uns, sagte Khamis.
– Das wäre recht bedauerlich! bemerkte Max Huber sehr kühl.
– Noch einmal, lieber Freund, auch hierin bin ich Deiner Ansicht,« erklärte John Cort.
Was nun?… Die den Hügel bestürmenden Elefanten rüttelten jetzt auch an den anderen Bäumen, die sich wie vor einem Sturmwinde bewegten. War Urdaxens schreckliches Ende nicht auch den anderen bescheert, die ihn vielleicht nur um wenige Minuten überlebten?… Gab es für sie eine Möglichkeit, von der Tamarinde zu entkommen, bevor diese umstürzte?… Und wenn sie es wagten, hinabzuklimmen und nach der Ebene hinaus zu entfliehen, würden sie der Verfolgung der wüthenden Herde entgehen… den Wald noch rechtzeitig erreichen?… Bot ihnen dieser dann hinreichende Sicherheit?… Und wenn die Elefanten sie wirklich nicht verfolgten, wären sie diesen dann nicht nur entgangen, um den nicht minder wilden Eingebornen in die Hände zu fallen?…
War aber überhaupt noch die Möglichkeit gegeben, hinter dem Waldrande Schutz zu finden, so mußte sie wenigstens ohne Zögern ausgenutzt werden. Die vernünftige Ueberlegung verlangte, eine ungewisse Gefahr der gewissen vorzuziehen.
Der Baum schwankte immer heftiger, und bei einer solchen Schwankung konnten sogar mehrere Rüssel die tieferen Aeste packen. Der Foreloper und die anderen waren nahe daran, ihren Halt zu verlieren, so furchtbar wurden die Stöße. In seiner Sorge um Llanga legte Max Huber seinen linken Arm um diesen und hielt sich nur noch mit der Rechten fest. In der nächsten Minute schon mußten jetzt die Wurzeln des Baumes nachgeben oder dessen Stamm brechen. Der Sturz der Tamarinde bedeutete aber den Tod derer, die sich in ihre Krone geflüchtet hatten, und bedrohte sie, ebenso wie Urdax zertreten zu werden.
Unter den gewaltsamen, häufigen Stößen gaben endlich die Wurzeln nach, der Erdboden darüber hob sich und der Baum legte sich mehr langsam auf die Erde, als daß er plötzlich umstürzte.
»Nach dem Walde!… Nach dem Walde!« rief Khamis.
An der Seite, wo das Geäst der Tamarinde den Boden berührt hatte, waren die Elefanten ein wenig zurückgewichen und hatten damit das Feld freigegeben. Sofort war der Foreloper auf dem Boden, und die anderen, die seinen Ruf vernommen hatten, folgten ihm auf dem Fuße nach. Alle drei wandten sich eiligst zur Flucht.
Zu Anfang hatten die Thiere, die in ihrer Wuth die noch stehenden Bäume angriffen, die Flüchtlinge nicht bemerkt.
Max Huber lief, Llanga unter dem Arme haltend, was ihm die Kräfte gestatteten. John Cort hielt sich ihm zur Seite, bereit, ihm seine Last abzunehmen, doch auch bereit, den ersten von der Herde, der ihm in Schußweite käme, mit einer Kugel zu begrüßen.
Der Foreloper, John Cort und Max Huber hatten kaum einen halben Kilometer zurückgelegt, als etwa zehn Elefanten, die sich von der Herde getrennt hatten, ihre Verfolgung aufnahmen.
»Muth… Muth! ermahnte Khamis. Suchen wir unseren Vorsprung zu behalten – wir kommen noch an’s Ziel!«
Ja, vielleicht, dann durfte aber niemand im Laufe nachlassen.
Llanga mochte es wohl fühlen, daß Max Huber die Kräfte allmählich schwanden.
»Mich loslassen… Freund Max… mich loslassen!… Ich gute Beine haben! Mich loslassen!«
Max Huber hörte jedoch nicht darauf und strengte sich nur noch mehr an, um nicht zurückzubleiben.
Ein Kilometer war bereits durcheilt, ohne daß die Elefanten merkbar näher gekommen wären. Leider verminderte sich nun aber die Schnelligkeit des Forelopers und seiner Gefährten; von dem überhasteten Laufe drohte ihnen der Athem auszugehen.
Der Waldsaum war jetzt indeß nur noch einige hundert Schritte entfernt, und hinter dem dichten Baumwalle winkte die wahrscheinliche, wenn nicht gewisse Rettung. denn diesen Wall konnten die Thiere schwerlich durchdringen.
»Schnell… schnell! drängte Khamis. Geben Sie Llanga jetzt mir!
– Nein, Khamis… ich trage ihn bis zuletzt!«
Einer der Elefanten befand sich jetzt nur noch ein Dutzend Meter hinter ihnen. Man hörte schon seine Trompetentöne und fühlte bereits die Wärme seines Athems. Der Boden erzitterte unter den gewichtigen Füßen, die einen schnellen Galopp einhielten. Nach einer Minute mußte er Max Huber eingeholt haben, der mit den anderen kaum noch Schritt halten konnte.
Da blieb John Cort stehen, wandte sich um, erhob das Gewehr und zielte einen Augenblick. Der Schuß krachte und traf den Elefanten allem Anscheine nach an richtiger Stelle.
Die Kugel hatte ihm das Herz durchbohrt und der Koloß brach beim nächsten Schritte zusammen.
»Das hat gesessen!« murmelte John, als er die Flucht wieder aufnahm.
Die übrigen Thiere, die in kurzen Abständen von einander nachkamen, sammelten sich für kurze Zeit um die daliegende Masse. Das gewährte den Flüchtigen eine gewisse Frist, die sie schleunigst ausnutzen mußten.
Nachdem sie die letzten Bäume des Hügels umgestürzt hatten, stürmte jedenfalls die ganze Herde dem Walde zu.
Weder nahe dem Erdboden, noch in den Wipfeln der Bäume war jetzt noch ein Feuerschein zu bemerken gewesen. Im ganzen Kreise des Horizonts lag alles in tiefer Finsterniß.
Sollten die erschöpften athemlosen Flüchtlinge wirklich noch die Kraft haben, das rettende Ziel zu erreichen?…
»Immer weiter! Schnell weiter!« mahnte Khamis.
Jetzt, wo sie noch gegen hundert Schritt weit zu laufen hatten, waren die Elefanten nur noch etwa vierzig Schritt hinter ihnen zurück.
Mit der äußersten Kraftanstrengung, die ihnen der Trieb der Selbsterhaltung ermöglichte, flogen Khamis, John Cort und Max Huber fast zwischen die ersten Bäume, fielen hier aber zu Tode erschöpft lang nieder.
Vergebens versuchte die Herde durch den Wald einzudringen. Die Bäume standen so dicht, daß sie sich nicht dazwischen hindurchzwängen konnten, und ihre Stämme waren auch so dick, daß die Thiere sie nicht niederzubrechen vermochten. Vergeblich wühlten die Rüssel in den Spalten zwischen diesen, vergeblich drängten die nachkommenden Elefanten die vorderen…
Die Flüchtlinge hatten von den mächtigen Thieren nichts mehr zu fürchten… der große Wald von Ubanghi stellte diesen ein unüberwindliches Hinderniß entgegen.
Viertes Capitel.
Ueberlegung-Entschluß
Es war jetzt fast Mitternacht; noch sechs Stunden herrschte vollkommene Finsterniß. Sechs Stunden der Furcht und der Gefahr! Wohl befanden sich Khamis und seine Begleiter hier hinter der sturmfreien Wand der Waldriesen verhältnißmäßig in Sicherheit, doch drohte ihnen ja noch immer eine andere Gefahr. Fast an derselben Stelle hatten ja vorher die vielfachen Feuerpunkte geleuchtet, die später auch noch aus dem hohen Gezweig der Bäume herausschimmerten. Da nun gar nicht zu bezweifeln war, daß eine Rotte Eingeborner hier gelagert hatte, blieb auch jetzt noch ein Ueberfall zu befürchten, gegen den jede Abwehr unmöglich schien.
»Achtung nun!… Scharf aufpassen! sagte der Foreloper, als er nach dem erschöpfenden Wettrennen wieder zu Athem gekommen war und die anderen sich soweit erholt hatten, daß sie ihm antworten konnten.
– Ja, wir wollen wachsam sein, antwortete John Cort, und uns bereit halten, einen Angriff abzuschlagen. Die Nomaden können nicht fern von hier sein. An dieser Stelle des Waldsaumes hatten sie gerastet, hier sind auch noch die Ueberreste eines Feuers, worin noch einzelne Funken glimmen.«
Wirklich zeigte sich in der Entfernung von fünf bis sechs Schritten ein Häuschen mattglühender Asche, aus der ein rother Schein hervorleuchtete.
Max Huber erhob sich, das Gewehr schußfertig haltend, und drang in das Dickicht unter den Bäumen ein.
Khamis und John Cort standen bereit, ihm im Nothfalle Hilfe zu bringen.
Max Huber blieb jedoch nur drei oder vier Minuten aus. Er hatte nichts Verdächtiges bemerkt, nichts erlauscht, was auf die Gefahr eines unmittelbar drohenden Angriffs hingedeutet hätte.
»Dieser Theil des Waldes ist thatsächlich verlassen, erklärte er. Die Eingebornen haben ihn sicherlich geräumt.
– Vielleicht sind sie selbst entflohen, als sie die heranstürmenden Elefanten wahrgenommen hatten, bemerkte John Cort.
– Vielleicht, denn die Feuer, die wir, Herr Huber und ich, gesehen haben, sagte Khamis, verloschen in dem Augenblicke, wo im Norden das Getöse von der Dickhäuterherde zuerst erschallte. Wer weiß, ob sie es aus Klugheit oder nur aus Furcht gethan haben. Die Leute mußten doch wohl aus Erfahrung wissen, daß sie hinter den Bäumen in Sicherheit waren. Ich kann mir kaum erklären…
– Was überhaupt unerklärlich ist, fiel ihm Max Huber in’s Wort, und übrigens ist die Nacht auch nicht die rechte Zeit für langathmige Erklärungen. Wir wollen dazu den Tag abwarten, ich muß aber gestehen, daß es mich die größte Mühe kosten wird, wach zu bleiben… die Augen fallen mir jetzt schon von selbst zu.
– Es ist jedoch ein schlecht gewählter Augenblick zum Schlafen, lieber Max, hielt ihm John Cort entgegen.
– So schlecht wie möglich, lieber John, doch der Schlaf gehorcht nicht, er befiehlt. Gute Nacht also und auf morgen!«
In der nächsten Minute war Max Huber, der sich am Fuße eines Baumes ausgestreckt hatte, in tiefen Schlaf versunken.
»Leg Du Dich neben ihn, Llanga, sagte John Cort. Khamis und ich, wir werden schon bis zum Morgen wachen.
– Dazu bin ich allein genügend, Herr Cort, antwortete der Foreloper. Ich bin an so etwas gewöhnt, und empfehle Ihnen, es Ihrem Freunde gleichzuthun.«
Auf Khamis konnte man sich ja verlassen: er würde keine Minute unaufmerksam sein.
Llanga legte sich neben Max Huber nieder. John Cort wollte seiner Müdigkeit trotzen. Eine Viertelstunde unterhielt er sich noch mit dem Foreloper. Beide sprachen von dem unglücklichen Portugiesen, mit dem Khamis schon lange in Verbindung gestanden hatte, und dessen vortreffliche Eigenschaften auch im Laufe des letzten Zuges häufig genug hervorgetreten waren.
»Der Unglückliche, meinte Khamis, hatte den Kopf verloren, sobald er sich von den schurkischen, feigen Trägern verlassen und beraubt sah.
– Der arme Mann!« murmelte John Cort.
Das waren aber die letzten Worte, die er sprach. Von der Müdigkeit überwältigt, sank er auf das Gras nieder und schlief auch sofort ein.
Khamis wachte bis zum Tagesanbruch. Er allein hielt die Augen offen, lauschte gespannten Ohres auf das leiseste Geräusch, während er immer das Gewehr bei der Hand hatte.
Sein Blick suchte die finstere Umgebung zu erkennen, zuweilen erhob sich der Mann, um da und dort sich zu überzeugen, wie es unter den Bäumen der nächsten Umgebung aussah, und immer blieb er bereit, seine Gefährten rasch zu wecken, wenn es nöthig werden sollte, sich zu vertheidigen.
Aus einzelnen Zügen hat der Leser bereits erkennen können, welcher Unterschied im Charakter der beiden Freunde, des Franzosen und des Amerikaners, herrschte.
John Cort war sehr ernster und praktischer Natur, was man ja gewöhnlich an den eingebornen Bewohnern Neuenglands beobachtet. Ein in Boston geborner Yankee, hatte er von einem solchen doch nur die rühmenswerthen Eigenschaften an sich.
Mit Vorliebe beschäftigte er sich mit Fragen der Geographie und Anthropologie, und das Studium der verschiedenen Menschenrassen interessierte ihn im höchsten Grade. Mit diesen Vorzügen vereinigte er einen großen Muth und wäre für die, die er seine Freunde nannte, gewiß der äußersten Aufopferung fähig gewesen.
Max Huber, ein Pariser Kind, und ein solches noch immer auch in den fernen Ländern, wohin ihn der Zufall im Leben verschlagen hatte, stand an Kopf und Herz gegen John Cort nicht zurück. Er war dagegen weniger praktischen Sinnes, man hätte sagen können, er »lebte in Versen,« während John Cort
»in der Prosa« lebte. Sein Temperament verlockte ihn zu den außergewöhnlichsten Dingen. Wie sich schon gezeigt hat, hätte er sich gern zu den bedauerlichsten Unbesonnenheiten verleiten lassen, sobald seine Phantasie ihm ein merkwürdiges Ziel vorgaukelte, wenn sein klug abwägender Begleiter ihn nicht davon zurückgehalten hätte. Seit der Abreise aus Libreville war dazu schon wiederholt Gelegenheit gewesen.
Libreville ist die Hauptstadt des französischen Congogebiets.
Am linken Ufer der Gabonmündungen 1849 gegründet, zählt es jetzt zwischen fünfzehn- und sechszehnhundert Einwohner.
Es ist der Sitz des Gouverneurs der Colonie, andere eigentliche Gebäude als das Wohnhaus des hohen Beamten darf man hier freilich nicht suchen. Höchstens wäre noch das Krankenhaus und die Niederlassung der Missionäre zu nennen; im übrigen besteht die Stadt dann aber, in ihren dem Handel und der Industrie dienenden Theilen, aus Kohlenschuppen, Magazinen und aus den Werftanlagen.
Drei Kilometer von der Hauptstadt liegt jedoch eine Art Vorort, das Dorf Glaß, wo sich blühende deutsche, englische und amerikanische Factoreien befinden.
Hier hatten sich Max Huber und John Cort vor fünf oder sechs Jahren kennen gelernt und bald mit einander Freundschaft geschlossen. Ihre Familien waren an der amerikanischen Factorei in Glaß ziemlich stark betheiligt, und an dieser nahmen beide jungen Männer mehr hervorragende Stellungen ein. Das Etablissement stand in voller Blüthe; es war dem Handel mit Elfenbein, Arachidenöl, Palmenwein und sonstigen Erzeugnissen des Landes gewidmet, z. B. dem mit der lösend und belebend wirkenden Gurunuß, mit der Kaffabeere, die ein durchdringendes Aroma und stärkende Eigenschaften hat, u. s. w. Alle diese Erzeugnisse wurden in großer Menge nach den Märkten Europas und Amerikas ausgeführt.
Vor drei Monaten hatten nun Max Huber und John Cort den Plan entworfen, die östlich vom französischen Congo und von Kamerun gelegenen Gebiete zu besuchen. Bei ihrer ausgesprochenen Jagdlust zögerten sie keinen Augenblick, sich einer Karawane anzuschließen, die eben im Begriffe war, von Libreville aufzubrechen, um nach diesen Landestheilen zu ziehen, wo es, vorzüglich jenseit des Bahar-el-Abiad bis zu den Grenzen von Baghirmi und Darfur, noch sehr viele Elefanten giebt. Beide kannten den Leiter dieser Karawane, den Portugiesen Urdax, der aus Loango gebürtig war und allgemein für einen erfahrenen Händler galt.
Urdax hatte seiner Zeit zu der Gesellschaft von Elfenbeinjägern gehört, der Stanley, als sie eben aus dem nördlichen Congogebiete zurückkehrte, zwischen 1887 und 1889 bei Ipoto begegnet war. Der Portugiese stand aber nicht in dem schlechten Rufe seiner Genossen, die – wenigstens die meisten – unter dem Vorwande, Elefanten zu jagen, die Eingebornen niedermetzeln, um sie zu berauben, so daß, wie der unerschrockene Erforscher Aequatorial-Afrikas sich ausdrückt, das Elfenbein, das sie heimbrachten, gewöhnlich mit Menschenblut besudelt war.
Nein, ein Franzose und ein Amerikaner konnten, ohne sich etwas zu vergeben, der Gesellschaft Urdaxens und auch des Forelopers beitreten, des Führers der Karawane, den wir unter dem Namen Khamis kennen gelernt haben und auf dessen Ergebenheit und Eifer man sich unter allen Umständen verlassen konnte.
Der Jagdzug war, wie der Leser weiß, bisher recht erfolgreich gewesen. Des Klimas schon gewöhnt, hatten John Cort und Max Huber die Mühsal und die Anstrengungen der Reise ganz vorzüglich ausgehalten. Wenn auch etwas abgemagert, waren sie auf dem Rückwege völlig wohlauf, als der unglückliche Zwischenfall ihren weiteren Zug so grauenvoll unterbrach.
Jetzt, wo sie noch bis Libreville eine Strecke von reichlich zweitausend Kilometern zurückzulegen hatten, fehlte ihnen sogar der Leiter der ganzen Karawane.
Den »Großen Wald« hatte Urdax den Wald von Ubanghi, dessen Grenzen sie eben überschritten hatten, genannt, und seine Ausdehnung rechtfertigte auch diesen Namen.
In den bekannten Theilen der Erde giebt es mehrfach solche mit Millionen von Bäumen bedeckte und so große Flächen, daß die meisten Staaten Europas darauf bequem Platz fänden.
Unter den ausgedehntesten Waldgebieten der Welt nennt man vor allem vier, die in Nordamerika, in Südamerika, in Sibirien und in Centralafrika zu suchen sind.
Der erste erstreckt sich in nördlicher Richtung bis zur Hudsonbai und zur Halbinsel Labrador hinauf, und bedeckt, in den Provinzen Quebec und Ontario, nördlich vom Lorenzostrome, ein Gebiet von zweitausendsiebenhundertfünf-zig Kilometer Länge und sechzehnhundert Kilometer Breite.
Der zweite findet sich im nordwestlichen Brasilien im Thale des Amazonenstromes in einer Ausdehnung von dreitausenddreihundert Kilometer Länge bei zweitausend Kilometer Breite.
Der dritte, mit den Seitenlängen von viertausendachthundert und zweitausendsiebenhundert Kilometern, ragt mit seinen ungeheueren, bis hundertfünfzig Fuß hohen Coniferen (Nadelhölzern) im mittleren Theile von Sibirien empor, und zwar vom Becken des Obi im Westen an bis zum Thale des Indighiska im Osten, einer Gegend, die vom Jenissei, vom Olamk und von der Lena und Yana bewässert wird.
Der vierte endlich reicht vom Congothale bis zu den Quellen des Nils und des Sambesi; er umfaßt eine fast unbegrenzte Fläche, wahrscheinlich eine größere, als einer der anderen Riesenwälder. Hier dehnt sich die ungeheuere, noch fast unbekannte Landmasse aus, der mittlere zu beiden Seiten des Aequators liegende Theil Afrikas, der im Norden des Congo und des Oguë wohl eine Million Quadratkilometer – zweimal die Oberfläche Frankreichs – einnimmt.
Wie früher erwähnt, hatte der Portugiese Urdax niemals beabsichtigt, durch diesen Wald zu ziehen, sondern er wollte ihn nach Westen zu, umgehen. Wie hätten auch der Wagen und das Ochsengespann inmitten dieses Labyrinths vorwärts kommen können! Eine Verlängerung ihres Marsches um einige Tage in den Kauf nehmend, sollte die Karawane an dessen Saume hin einem bequemen Wege folgen, der nach dem rechten Ufer des Ubanghi führte, von dem aus dann die Factoreien von Libreville ohne Schwierigkeit zu erreichen waren.
Jetzt hatte sich die Sachlage freilich geändert. Das Hinderniß eines zahlreichen Personals und eines umfänglichen Gepäcks war plötzlich weggefallen… jetzt war von keinem Wagen, keinem Ochsen, von keinem Lagermaterial mehr die Rede…
nur drei Männer und ein Knabe – ein halbes Kind – waren noch übrig, und diesen fehlte es für die fünfhundert Lieues bis zur Küste des Atlantischen Oceans an jedem Transportmittel.
Was sollte nun geschehen? Sollten sie dem von Urdax vorgeschlagenen Wege nachgehen, oder etwa, wenn auch unter ungünstigen Verhältnissen, als Fußgänger versuchen, schräg durch den Wald zu dringen, wo Begegnungen mit Nomaden weniger zu fürchten waren und wodurch der Weg nach dem französischen Congogebiet nicht unbeträchtlich abgekürzt wurde?
Das war die nächstliegende wichtigste Frage, die am folgenden Morgen, wenn Max Huber und John Cort erwacht wären, erwogen und entschieden werden mußte.
Khamis hatte die langen Stunden über redlich Wacht gehalten. Kein Zwischenfall hatte die Ruhe der Schläfer gestört oder einen nächtlichen Ueberfall befürchten lassen. Wiederholt war der Foreloper, den Revolver in der Hand, ein Stück weit hineingegangen und hatte sich durch das Buschwerk geschlichen, sobald er in der Umgebung ein verdächtiges Geräusch vernahm. Immer war es nur das Abbrechen eines abgestorbenen Zweiges gewesen, der Flügelschlag eines großen Vogels, der sich in den Baumkronen bewegte, das Stapfen eines Wiederkäuers in der Nähe des Halteplatzes, oder es hatte von dem unbestimmbaren Waldesraunen hergerührt, wenn der Nachtwind das obere Laubdach bewegte.
Sobald die beiden Freunde die Augen aufschlugen, waren sie auch schon auf den Füßen.
»Wie steht es mit den Eingebornen? lautete John Cort’s erste Frage.
– Sie sind nicht wieder sichtbar geworden, erwiderte Khamis.
– Finden sich denn keine Spuren von ihrem Wegzuge?
– Das wäre wohl möglich, Herr Cort, wahrscheinlich näher am Rande…
– Wir wollen uns gleich davon überzeugen, Khamis.«
Alle drei, und mit ihnen Llanga, gingen nach der Seite der Ebene hin. Dreißig Schritte weiter fehlte es nicht an den vermutheten Merkzeichen: vielfache Fußabdrücke, am Fuße der Bäume niedergetretenes Gras, halb verbrannte harzige Zweige, Aschenhausen, worin noch immer einzelne Funken glitzerten, Dorngestrüpp, aus dem da und dort noch ein leichter Rauch aufwirbelte. Im übrigen aber fand sich kein menschliches Wesen unter den Bäumen oder an den Stellen, wo sich fünf bis sechs Stunden vorher die schwankenden Flammen gezeigt hatten.
»Davongezogen… sagte Max Huber.
– Oder sie haben sich wenigstens von hier entfernt, meinte Khamis, und ich glaube, wir haben hier nichts mehr zu befürchten…
– Na, wenn die Eingebornen sich auch entfernt haben, bemerkte John Cort, so sind die Elefanten wenigstens ihrem Beispiele nicht gefolgt.«
In der That tummelten sich die mächtigen Pachydermen noch immer in der Nähe des Waldes umher. Manche davon bemühten sich hartnäckig, die Bäume am Rande durch Anprallen daran umzustürzen. Was die Tamarindengruppe anging, konnten Khamis und seine Leidensgefährten erkennen, daß sie völlig umgelegt war. Der seiner Baumzierde beraubte Hügel bildete nur noch eine leichte Erhebung über der Fläche der Ebene.
Auf den Rath des Forelopers hin vermieden es John Cort und Max Huber, sich zu zeigen, in der Hoffnung, daß sich auch die Elefanten davontrollen würden.
»Das würde uns gestatten, noch einmal nach dem Lager zurückzukehren, sagte Max Huber, und dort die Ueberreste unserer Habseligkeiten zu sammeln, vielleicht einige Kistchen mit Conserven, Munition…
– Und dazu, fiel John Cort ein, könnten wir dem unglücklichen Urdax ein ehrliches Begräbniß bereiten.
– An alles das ist nicht zu denken, so lange die Elefanten sich noch am Saume des Waldes tummeln, erklärte Khamis. Was übrigens das Material aller Art betrifft, so dürfte das wohl in formlose Trümmer verwandelt sein.«
Der Foreloper sollte recht behalten, und da die Elefanten keine Anstalt machten, abzuziehen, handelte es sich nun darum, zu entscheiden, was begonnen werden sollte. Khamis, John Cort und Max Huber kehrten also nach dem Ruheplatze zurück.
Dabei gelang es Max Huber noch, ein hübsches Stück Wild zu erlegen, das die Ernährung der kleinen Gesellchaft für zwei bis drei Tage zu sichern versprach.
Es war ein Inyala, eine Art Antilope mit grauem, von braunen Haaren durchsetztem Fell, ein ziemlich großes Exemplar männlichen Geschlechts, mit gewundenen Hörnern und mit einer Art Mähne an der Brust und der Unterseite des Leibes. Die Kugel hatte das Thier getroffen, als dieses gerade den Kopf durch das Gesträuch vorstreckte.
Der Inyala mochte zweihundertfünfzig bis dreihundert Pfund wiegen. Als er ihn zusammenbrechen sah, war Llanga wie ein Jagdhund darauf zugelaufen. Natürlich konnte er ein so schweres Stück Wild nicht allein tragen und man mußte ihm dabei zu Hilfe kommen.
Der in solchen Dingen geübte Foreloper zerlegte das Thier und behielt davon nur die brauchbaren Stücke zurück, die nach einem schnell zurecht gemachten Feuerherd geschafft wurden.
John Cort schüttete einen Armvoll dürres Holz auf, das in wenigen Minuten hell aufflackerte. Nachdem sich dann eine Schicht glühender Kohlen gebildet hatte, legte Khamis mehrere Schnitte des leckeren Fleisches darauf.
Auf Conserven und Zwieback, wovon die Karawane viele Büchsen und Kisten mit sich geführt hatte, mußte man freilich verzichten; jedenfalls hatten die entflohenen Träger sich auch diese Vorräthe angeeignet. Zum Glück ist in den wildreichen Wäldern Centralafrikas ein Jäger immer in der Lage, die nöthige Nahrung zu erbeuten, wenn er sich nur mit gebratenem oder geröstetem Fleisch begnügt.
Dazu gehört natürlich, daß ihm die Munition nicht ausgeht.
John Cort, Max Huber und Khamis waren nun jeder mit einem Präcisionsgewehr und einem Revolver ausgerüstet. Diese Feuerwaffen konnten ihnen bei geschickter Benutzung große Dienste leisten, nur machte es sich nöthig, die Patronentaschen ordentlich zu füllen. Alles in allem verfügten sie aber, obwohl sie vor dem Verlassen des Wohnwagens ihre Taschen gehörig vollgestopft hatten, doch nicht über mehr als fünfzig Schuß.
Das war, wie man zugeben wird, ein dürftiger Vorrath, vorzüglich wenn die Wanderer auf dem sechshundert Kilometer langen Wege bis zum rechten Ubanghiufer auch noch in die Nothlage kamen, sich gegen Raubthiere oder nomadisierende Eingeborne zu vertheidigen. Von dem genannten Flusse aus konnten sich Khamis und seine Begleiter entweder in den Dorfschaften und den Niederlassungen der Missionäre, oder auch an Bord von Flottillen, die den großen Nebenfluß des Congo befahren, leicht mit allem nöthigen versorgen.
Nachdem sie sich an dem Fleische des Inyala tüchtig gesättigt und sich mit dem klaren Wasser eines zwischen den Bäumen verlaufenden Baches erquickt hatten, traten alle drei zur Berathschlagung ihrer weiteren Schritte zusammen.
John Cort begann die Verhandlung mit folgenden Worten:
»Bisher, Khamis, ist Urdax unser Leiter und Chef gewesen.
Er hat uns stets bereit gefunden, seinen Rathschlägen zu folgen, denn wir hatten auf ihn ein unbedingtes Vertrauen.
Dasselbe Vertrauen flößen Sie uns durch Ihren Charakter und Ihre Erfahrung ein. Erklären Sie, was Sie, in der Lage, worin wir uns befinden, zu thun für richtig halten, und Sie dürfen unserer Zustimmung sicher sein.
– Gewiß, bekräftigte Max Huber die Worte seines Freundes, darüber wird zwischen uns niemals ein Zwiespalt aufkommen.
– Ihnen, Khamis, ist das Land hier bekannt, fuhr John Cort fort. Seit einer Reihe von Jahren haben Sie Karawanen durch diese Gebiete, und zwar mit einer Ergebenheit geführt, die wir selbst an Ihnen schätzen zu lernen Gelegenheit hatten. An diese Ergebenheit, diese Treue appellieren auch wir, und ich weiß, daß wir damit keine Fehlbitte thun.
– Herr Cort und Herr Huber, Sie können auf mich rechnen«, erwiderte der Foreloper einfach.
Er drückte die ihm entgegengestreckten Hände der jungen Männer und reichte auch Llanga noch die Hand.
»Was ist nun Ihre Ansicht? nahm John Cort wieder das Wort.
Sollen wir, wie Urdax es wollte, den Wald an der Westseite umwandern oder nicht?
– Wir müssen vielmehr durch diesen ziehen, erklärte der Foreloper ohne Zögern. Dabei werden wir vor unliebsamen Begegnungen mehr geschützt sein. Auf wilde Thiere könnten wir ja treffen, auf Eingeborne aber nicht. Weder Pahuins oder Denkas, noch Funds oder Bughos haben sich jemals in dessen Inneres gewagt, so wenig wie überhaupt eine Völkerschaft aus Ubanghi. Auf der Ebene sind wir, vorzüglich durch Nomaden, weit mehr Gefahren ausgesetzt. Durch den Wald hier, in dem eine Karawane mit ihren Zugthieren niemals vorwärts käme, können sich Fußgänger schon einen Weg bahnen. Ich wiederhole also: brechen wir nach Südwesten hin auf, und ich habe die beste Hoffnung, daß wir damit die Fälle des Congo glücklich erreichen.«
Diese Stromschnellen unterbrechen den Lauf des Ubanghi an dem Winkel, den der Strom da beschreibt, wo er sich von Westen nach Süden zu wendet. Bis dahin soll sich den Berichten von Reisenden nach auch der große Wald ausdehnen. Weiterhin braucht man nur den Ebenen unter der Parallele des Aequators zu folgen, und da ist es, dank den zahlreichen, diese durchziehenden Karawanen, immer leicht, Proviant und sogar Transportmittel zu erhalten.
Der Rathschlag Khamises war gewiß klug zu nennen. Der Weg, den er empfahl, mußte auch die Wanderung bis zum Ubanghi wesentlich abkürzen. Die ganze Frage hing nur an den Hindernissen, die dieser tiefe Wald etwa bieten könnte. Daß ein gangbarer Pfad hindurch vorhanden wäre, darauf war gar nicht zu rechnen… vielleicht enthielt er nur einzelne Fährten von wilden Thieren, wie von Büffeln, Rhinocerossen und andern plumpen Säugethieren. Der Erdboden war gewiß vielfach mit Gesträuch bedeckt, was die Anwendung einer Axt verlangte, während der Foreloper nur ein kleines Beil bei sich trug und die anderen nur mit ihren Waidmessern ausgerüstet waren. Lange Verzögerungen würde der Marsch trotzdem aber wohl nicht erfahren.
Als diese Einwürfe abgethan waren, wollte John Cort keinen Augenblick mehr zögern. Was die Schwierigkeit betraf, unter den Bäumen, die kaum ein Sonnenstrahl durchdrang, die nöthige Richtung einzuhalten, darüber brauchte man sich keine große Sorge zu machen.
Eine Art Instinkt, der mit dem der Thiere verwandt sein muß
– eine unerklärliche Naturgabe, die man auch bei manchen Menschenrassen beobachtet – ermöglicht es unter anderen den Chinesen, doch auch verschiedenen wilden Völkerschaften des
»Fernen Westens« (in Nordamerika), sich mehr mit Hilfe des Gehörs und Geruchs, als mit der der Augen, zurecht zu finden und die einzuschlagende Richtung an mancherlei unscheinbaren Zeichen zu erkennen. Khamis besaß nun diese Orientierungsgabe in hervorragendem Maße und hatte davon wiederholt schon entscheidende Beweise abgelegt.
Einigermaßen konnten sich der Franzose und der Amerikaner auf diese mehr physische als intellectuelle Befähigung verlassen, die nur selten fehlgeht, auch wenn es nicht möglich ist, den Stand der Sonne zu beobachten.
Bezüglich der sonstigen Schwierigkeiten, die der Wald bieten könnte, bemerkte der Foreloper:
»Ich weiß, Herr John, daß wir nirgends einen Pfad, sondern nur einen von Gestrüpp, dürrem Holz und vor Alter umgestürzten Bäumen bedeckten Erdboden finden werden…
das sind aber leicht überwindliche Hindernisse. Meinen Sie aber nicht, daß ein so ausgedehnter Wald nicht auch von manchen Flüssen bewässert sein müsse, die dann nur Zuflüsse des Ubanghi sein könnten?
– Fände sich darin nur der Wasserlauf, der östlich vom Hügel verlief, bemerkte Max Huber. Er hatte die Richtung nach dem Walde, und warum sollte er da nicht zu einem wirklichen Flusse werden?… Dann erbauten wir uns ein Floß… aus einigen, mit einander verbundenen Baumstämmen…
– Halt, halt, bester Freund, unterbrach ihn John Cort, laß Dich nur von Deiner Phantasie nicht gleich auf dem Flusse dahintragen, den wir nur vermuthen…
– Herr Huber hat schon recht, erklärte Khamis. Weiter im Westen werden wir auf einen Wasserlauf treffen, der sich in den Ubanghi ergießen muß.
– Das mag ja sein, erwiderte John Cort, doch wir kennen sie schon, diese Art afrikanischer Flüsse, die meist nicht schiffbar sind.
– Du erblickst immer und überall nur Schwierigkeiten, lieber John…
– Besser, man erkennt solche zu früh, als zu spät, Freund Max!«
John Cort’s Erwiderung war ganz zutreffend. Die Ströme und Flüsse Afrikas bieten keinesweges dieselben Vortheile, wie so viele in Amerika, Asien und Europa. Man zählt an Hauptströmen vier: den Nil, den Sambesi, den Congo und den Niger. Diese werden von sehr vielen, ein dichtes Netz bildenden Nebenflüssen gespeist. Trotz dieser scheinbar günstigen Anordnung erleichtern sie die Züge ins Innere des Schwarzen Erdtheils doch nur in recht beschränktem Maße.
Nach den Berichten aller Reisenden, die ihr Forschereiser durch diese grenzenlosen Gebiete geführt hat, lassen sich die afrikanischen Ströme mit dem Mississippi, dem St. Lorenzo, der Wolga, dem Irauaddy, dem Brahmaputra, dem Ganges und dem Indus keineswegs vergleichen. Ist ihr Stromlauf auch eben so lang, wie der der genannten, so ist ihr Wasserreichthum doch weit geringer, und schon in kurzer Entfernung von ihrer Mündung können sie nur noch Schiffe von sehr mäßigem Tonnengehalt tragen. Außerdem werden sie von Untiefen, von Stromschnellen und Fällen unterbrochen, die von einem Ufer bis zum anderen reichen, und an den Stromschnellen fließen sie oft so reißend dahin, daß kein Fahrzeug dagegen aufzukommen vermag. Hierin ist eine der Ursachen zu suchen, die größere Erfolge bezüglich der Erforschung des Innern von Afrika bisher vereitelt haben.
Khamis konnte nicht bestreiten, daß der Einwurf John Cort’s berechtigt sei. Alles in allem war er aber doch nicht gewichtig genug, den Vorschlag des Forelopers, der ja auf anderen Seiten greifbare Vortheile bot, etwa gar abzulehnen.
»Treffen wir auf einen Wasserlauf, meinte er, so fahren wir darauf hinunter, so weit das eben möglich ist. Lassen sich etwaige Hindernisse umgehen, so thun wir es. Anderenfalls nehmen wir unsere Wanderung wieder auf…
– O, ich habe gegen Ihren Vorschlag selbst auch gar nichts einzuwenden, Khamis, antwortete John Cort, ich denke vielmehr, es wird weitaus das beste sein, nach dem Ubanghi längs eines seiner Nebenflüsse oder vielmehr auf einem solchen zu gelangen, wenn das irgend ausführbar ist.«
Als die Behandlung der Frage bis zu diesem Punkte gekommen war ließen sich ihr nur noch zwei Worte anschließen:
»Vorwärts also!« rief Max Huber.
Seine Gefährten wiederholten alle den Aufruf.
Gerade Max Huber paßte der angenommene Plan ja vortrefflich, sich in den ungeheueren Wald zu begeben, den noch keiner durchmessen haben sollte oder der vielleicht gar undurchdringlich war. Vielleicht erlebte er dabei das ganz
»Außerordentliche«, worauf er in den Gebieten des oberen Ubanghi vergeblich gehofft hatte.
Fünftes Capitel.
Der erste Marschtag
Ein wenig über acht Uhr war es, als John Cort, Max Huber, Khamis und der Knabe die Richtung nach Südwesten einschlugen.
In welcher Entfernung mochte wohl der Fluß liegen, dem sie bis zu seiner Vereinigung mit dem Ubanghi zu folgen gedachten?… Keiner wußte es zu sagen. Und wenn es der war, der sich, nachdem er den Tamarindenhügel umkreist hatte, nach dem Walde zu wendete, bog dieser nicht vielleicht nach Osten zu ab, ohne den Wald zu durchströmen?… Wenn nun auch noch Hindernisse, Felsen oder Stromschnellen, sein Bett so weit sperrten, daß es unbefahrbar war, was dann?… Und andererseits: wenn diese unermeßliche Anhäufung von Bäumen keinen Pfad unter sich, keinen offenen, von Thieren durch das Dickicht gebrochenen Durchgang aufwies, wie sollten die Wanderer sich ohne Mithilfe des Eisens und des Feuers einen Weg bahnen?… Wie unsicher war es also, ob Khamis und seine Begleiter, selbst in den von großen Vierfüßlern besuchten Theilen, einen freien Erdboden, niedergetretenes Strauchwerk und schon zerrissene Lianen finden würden, so daß sie ohne zu großen Aufenthalt weiter vordringen könnten.
Llanga lief häufig, gleich einem schnellfüßigen Wiesel, weit voraus, obwohl John Cort ihn immer ermahnte, sich nicht zu entfernen. Hatte man den Knaben aber einmal aus den Augen verloren, so erschallte sofort dessen durchdringende Stimme.
»Hierher!… Hierher!« rief er dann laut.
Alle Drei gingen der dadurch angedeuteten Richtung nach und folgten den Stellen, die jener schon durchbrochen und leichter passierbar gemacht hatte.
Galt es, sich in dem Labyrinthe hier zurechtzufinden, so erwies sich der Instinct des Forelopers ausnehmend nützlich.
Uebrigens war es durch die Spalten zwischen den Aesten noch immer möglich, dabei den Stand der Sonne zu beobachten.
Jetzt im März und zur Zeit ihrer Culmination, erreichte sie fast den Zenith, der in dieser Breitenlage den Himmelsäquator schneidet.
Die Belaubung verdichtete sich jedoch weiterhin dermaßen, daß unter den Abertausenden von Bäumen nur noch ein Halbtag herrschte. Bei bedecktem Himmel mußte es fast völlig dunkel werden, und in der Nacht war an ein weiteres Vorwärtsdringen natürlich gar nicht zu denken. Khamis beabsichtigte jedoch auch von vornherein, vom Abend bis zum Morgen Halt zu machen, für den Fall eines drohenden Regens Obdach am Fuße eines Baumes zu suchen, und ein Feuer nur so lange zu unterhalten, wie es die Zubereitung des am Vor-oder Nachmittage erlegten Wildes verlangte. Wurde der Wald auch von Nomaden nicht besucht – selbst von der, am Tage vorher nahe dem Waldrande lagernden Rotte war keine Spur mehr zu entdecken – so schien es dennoch rathsam, sich nicht durch den Schein eines Feuerherdes zu verrathen. Uebrigens genügten auch einige unter die Asche geschobene, glühende Kohlen, das Fleisch zum Essen gar zu machen, und von der Kälte war ja zu dieser Jahreszeit in Afrika nichts zu fürchten.
Die Karawane hatte auf ihrem Wege über die Ebenen der intertropischen Gegend vielmehr schon arg von der Hitze zu leiden gehabt. Die Temperatur erreichte daselbst erstaunlich hohe Grade. Unter den Bäumen hier wurden Khamis, Max Huber und John Cort davon jedenfalls weniger belästigt, sie fanden also günstigere Verhältnisse für den langen und anstrengenden Marsch, den die Umstände ihnen aufzwangen.
Selbstverständlich hatte es kein Bedenken, in den von den Sonnenstrahlen des Tages her noch warmen Nächten, wenigstens bei trockenem Wetter, unter freiem Himmel zu schlafen.
Nur die Niederschläge waren in dieser, in jeder Jahreszeit regenreichen Gegend zu fürchten. Ueber der Aequinoctialzone wehen die Passatwinde, die hier, auf einander treffend, sich aufheben. Als Folge davon herrscht ebenda meist eine sehr ruhige Luft und die Wolken ergießen die in ihnen verdichteten Dünste in den furchtbarsten Platzregen. Jetzt hatte sich der Himmel jedoch bei zunehmendem Monde aufgeheitert, und da der Satellit der Erde einen Einfluß auf die Witterungsgestaltung zu haben scheint, konnte man vielleicht für vierzehn Tage auf gutes, durch keinen Kampf der Elemente gestörtes Wetter rechnen.
In diesem Theile des Waldes, der in unauffälliger Neigung nach dem Ufer des Ubanghi hin abfiel, war der Erdboden nicht sumpfig. Weiter im Süden mochte das jedoch der Fall sein. Die sehr feste Erde war mit hohem, dichtem Grase bedeckt, das das Vorwärtskommen verlangsamte und erschwerte, wo es nicht von den Füßen von Thieren niedergetreten war.
»Wahrlich, begann da Max Huber, es ist doch sehr zu bedauern, daß unsere Elefanten nicht haben bis hierher gelangen können! Sie hätten hübsch die Lianen zerrissen, das Gesträuch zerstört, den Weg eingeebnet, das Dorngestrüpp zertreten…
– Jawohl, und uns dazu! fiel John Cort ein.
– Ganz sicherlich, bestätigte der Foreloper. Begnügen wir uns damit, was Rhinocerosse und Büffel gethan haben. Wo diese hindurchgekommen sind, werden wir auch nicht stecken bleiben.«
Khamis kannte ja diese Wälder Centralafrikas, da er wenigstens die des Congobeckens und die in Kamerun wiederholt durchzogen hatte. Es kann also nicht wundernehmen, daß er imstande war, über die so verschiedenen Baumarten und Gewächse, die im Walde vorkamen, Auskunft zu geben. John Cort interessierte sich sehr für das Studium der prächtigen Vertreter des Pflanzenreiches, der zahlreichen Phanerogamen im Gebiete zwischen Congo und Nil, die bereits in das Pflanzensystem eingereiht sind.
»Darunter giebt es, sagte Khamis, auch mancherlei eßbare, die geeignet sind, die Eintönigkeit unseres Speisezettels zu beseitigen.«
Ohne von den in großer Menge vorhandenen riesigen Tamarinden zu reden, erhoben hier mächtig entwickelte Mimosen und Baobabs ihre Wipfel bis hundertfünfzig Fuß in die Luft. Zwanzig bis dreißig Meter Höhe erreichten gewisse Arten aus der Familie der Euphorbiaceen mit stachlichen Zweigen, sechs bis sieben Zoll langen Blättern, die mit einer Schicht eines milchähnlichen Stoffes überzogen sind, und deren Nüsse nach erlangter völliger Reise krachend zerspringen und aus ihren sechzehn Abtheilungen den Samen nach allen Seiten hinausschleudern. Hätte Khamis nicht den Instinkt der Orientierung besessen, so würde er sich bezüglich der Himmelsrichtungen haben nach dem merkwürdigen Sylphinum lacinatum belehren können, einer Pflanze, deren Blätter sich immer in der Weise drehen, daß sie die eine Fläche nach Westen, die andere nach Osten wenden.
Ein in diesem tiefen Urwalde verirrter Brasilianer hätte sich für versetzt in die
jungfräulichen Wälder des
Amazonenstromgebietes halten müssen. Während Max Huber über das den Boden bedeckende Zwerggebüsch wetterte, bewunderte John Cort aufrichtig den grünenden Teppich, in dem es von Phrynien und Aniomen wimmelte und worunter wohl zwanzig Arten von Farnkraut vorkamen, denen man sorglich aus dem Wege gehen mußte. Und welche Mannigfaltigkeit von Bäumen mit hartem und weichem Holze!
Die zweiten vertreten – wie Stanley in seiner »Reise durch den finstern Theil Afrikas« bemerkt – die Fichte und die Weide nördlicherer Zonen. Aus ihren großen Blättern allein errichten sich die Eingebornen Hütten für die Rastzeit von einigen Tagen. Daneben enthält der Wald aber in großer Zahl Tekeichen, Acaju- und Eisenbäume, die nie verfaulenden Campechebäume, Copale von prächtigem Wuchs, weit verzweigte Mangobäume, Sykomoren, die mit den schönsten des östlichen Afrikas hätten wetteifern können, wilde Orangenbäume, ferner Feigenbäume, deren Stamm so weiß erglänzte, als ob er mit Kalkmilch bestrichen wäre, wahrhaft kolossale »Mpasus« und andere Bäume der verschiedensten Art.
Diese vielfachen Kinder des Pflanzenreiches standen auch nicht so dicht, daß sie die Entwicklung ihrer Aeste gegenseitig hätten hindern können, die andererseits das warme und feuchte Klima außerordentlich begünstigte. Sogar die Wagen einer Karawane hätten wohl zwischen den Stämmen hindurchfahren können, wenn nicht bis fußdicke Kabel von einem zum anderen ausgespannt gewesen wären, d. h. endlose Lianenstränge, die sich wie Schlangen um die Baumschäfte wanden. Nach allen Seiten verbreitete sich eine Art Guirlandenbehang der Aeste, von dem man sich kaum eine Vorstellung machen kann, hier launenhaft verlaufende Strähne, dort ununterbrochene Laubgewinde von den Baumkronen nach dem Gesträuch darunter. Auch nicht ein Zweig, der nicht mit einem anderen irgendwie verbunden gewesen wäre! Kein Stamm ohne lange Pflanzenketten, von denen manche wie blühende Stalaktiten zur Erde herabhingen! Keine runzlige Rinde, die nicht mit dichtem, sammetweichem Moose gepolstert gewesen wäre, in dem sich Tausende von Insekten mit goldgetüpfelten Flügeln tummelten!
Und aus den geringsten Anhäufungen dieses Laubgewirres ertönte ein Concert von Zwitschern und Zirpen, von Schreien und Singen unausgesetzt vom Morgen bis zum späten Abend.
Der Gesang rührte von Myriaden von Schnäbeln her, die sich in Rollertönen und Nachtigallenflöten überboten oder die das verschiedenste Pfeifen hervorbrachten, das lauter und schriller ertönte, als die Pfeife des Hochbootsmannes auf einem Kriegsschiffe. Da neben wurde man noch völlig betäubt von der geflügelten Welt der Papageien, Wiedehopfe, Eulen, Amseln, der fliegenden Eichhörnchen, Zwergpapageien und Ziegenmelker, abgesehen von den Mückenvögeln, die einem Bienenschwarm ähnlich in den oberen Zweigen summten.
Für das Geschrei sorgte eine Affengesellschaft; das bestand aus einem lärmenden Accord von Pavianen mit grauer Behaarung, von beschopften Koloben, Schimpansen, Mandrillassen und Gorillas, letztere die stärksten und gefährlichsten Affen der afrikanischen Fauna. Die Vierhänder hatten, obwohl sie in großer Zahl vorhanden waren, bisher noch keine feindlichen Absichten gegen Khamis und dessen Begleiter verrathen; offenbar waren das die ersten Menschen, die sie im Innern dieses Waldes Centralafrikas erblickten. Man durfte nämlich gern glauben, daß sich noch keine menschlichen Wesen in dieses Baumdickicht gewagt hatten. Die Affen betrachteten jene deshalb mehr mit Neugierde, als daß sie über den Anblick in Wuth geriethen. In anderen Theilen des Congogebietes und Kameruns wäre das sicherlich anders gewesen. Dort ist der Mensch schon keine seltene Erscheinung mehr. Die Elfenbeinjäger, denen sich Hunderte von Banditen, von Eingebornen oder Fremden anschließen, setzen dort die Affen nicht mehr allein in Erstaunen, denn die Thiere sind seit langer Zeit Zeugen der greulichen Verwüstungen durch jene gewesen, Zeugen ihrer Raubzüge, die schon so viele Menschenleben gekostet haben.
Nach einem ersten Halt in der Mitte des Tages wurde gegen sechs Uhr abends eine zweite Rast gemacht. Das unentwirrbare Netz von Lianen hatte die Wanderung zuweilen recht schwierig gemacht. Sie zu zerschneiden oder zu zerbrechen, erfordert allemal eine mühsame Arbeit. Immerhin fanden sich, und auch auf größere Strecken hin, mehr offene Pfade, auf denen sich jedenfalls Büffel hinzutrollen pflegten, denn einzelne von diesen, unter anderen Onjas von besonderer Größe, konnte man noch hinter entferntem Gesträuch entdecken.
Diese Wiederkäuer sind, schon infolge ihrer außerordentlichen Kräfte, gar sehr zu fürchten, und die Jäger, die sie verfolgen, müssen sich sorgsam hüten, von ihnen nicht selbst angegriffen zu werden. Das sicherste Mittel, sie zu erlegen, besteht darin, daß man ihnen zwischen den Augen eine Kugel in den Kopf jagt.
John Cort und Max Huber hatten noch nie Gelegenheit gehabt, ihre Geschicklichkeit gegenüber diesen Onjas, die sich hier übrigens in gemessener Entfernung hielten, zu erproben.
Da es überdies an Antilopenfleisch nicht mangelte, erschien es rathsamer, den kleinen Munitionsvorrath zu schonen. Auf diesem Zuge sollte kein Schuß fallen, wenn nicht die persönliche Vertheidigung in Frage kam, oder die täglich nothwendige Nahrung beschafft werden mußte.
Am Rande einer kleinen Waldblöße und am Fuße eines Baumes, der seine Umgebung überragte, gab Khamis das Zeichen, Halt zu machen. Sechs Meter über dem Erdboden begann die in’s Graue spielende grüne Belaubung des Baumes, den zahllose, mit weißem Flaume überzogene Blüthen schmückten, von denen viele, Schneeflocken ähnlich, rings um den Stamm mit seiner silberhellen Rinde herunterfielen. Es war ein afrikanischer Baumwollbaum, dessen Wurzeln die Gestalt von Stützpfeilern haben, unter denen man bequem Platz findet.
»Da ist ja das Bett schon gemacht! rief Max Huber heiter. Es hat
zwar keine elastische Unterlage, doch eine Baumwollmatratze, die wir mit Vergnügen einweihen werden!«
Mittels Stein und Schwamm, wovon Khamis genügenden Vorrath bei sich führte, wurde nun ein Feuer entzündet. Die Mahlzeit nachher glich freilich ganz der ersten am frühen Morgen und der zweiten gegen Mittag. Leider – man mußte sich eben wohl oder übel damit abfinden – fehlte es gänzlich an Zwieback, der während des früheren Zuges das Brod ersetzt hatte. Man begnügte sich also mit dem gebratenen Fleisch, von dem genug vorhanden war, auch den schlimmsten Hunger zu stillen.
Nach beendeter Mahlzeit und bevor sich alle unter den Wurzeln des Baumwollbaumes ausstreckten, sagte John Cort zu dem Foreloper:
»Wenn ich nicht irre, sind wir immer in südwestlicher Richtung hingewandert…
– Ja, immer, antwortete Khamis; jedesmal, wenn ich die Sonne erblicken konnte, habe ich mich vergewissert, daß wir nicht davon abwichen.
– Wieviel Lieues haben wir Ihrer Ansicht nach heute wohl zurückgelegt?
– Vier bis fünf, Herr John, und wenn wir diese Tagesleistung einhalten, werden wir in einem Monate das Ufer des Ubanghi erreicht haben.
– Das klingt recht tröstlich, meinte John Cort, doch ist es nicht rathsam, dabei auch mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen?
– Doch auch mit dem Gegentheile, fiel Max Huber ein. Wer weiß denn, ob wir nicht auf einen Wasserlauf treffen, der uns mühelos fortträgt?
– Bis jetzt scheint das nicht gerade so, lieber Max.
– Ja freilich, doch nur, weil wir noch nicht weit genug nach Westen vorgedrungen sind, äußerte sich Khamis, und es sollte mich sehr wundern, wenn morgen oder übermorgen…
– Verfahren wir lieber so, als ob wir an keinen Fluß kämen, erwiderte John Cort. Eine Reise von dreißig Tagen, vorzüglich wenn die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht größer sind als die, die uns heute begegneten, eine solche Reise kann doch afrikanische Jäger wie uns nicht erschrecken.
– Und obendrein, setzte Max Huber hinzu, fürchte ich, daß dieser geheimnißvolle Wald schließlich gar kein Geheimniß enthält.
– Desto besser, Max!
– Nein, desto schlimmer, John!… Komm aber nun, Llanga, Du mußt endlich schlafen.
– Ach ja, lieber Freund Max,« antwortete das Kind, dem schon die Augen zufielen, denn auf dem langen Wege war es niemals zurückgeblieben.
Llanga mußte sogar schon nach den Wurzeln des Baumes getragen werden, wo er im bequemsten Winkel niedergelegt wurde.
Der Foreloper hatte sich wieder erboten, die ganze Nacht zu wachen, die anderen wollten das aber nicht zulassen. Man einigte sich auch dahin, einander nach je drei Stunden abzulösen, obwohl sich in der Umgebung der Waldblöße nichts verdächtiges wahrnehmen ließ. Die einfache Klugheit verlangte aber doch, bis zum Tagesanbruch auf der Wacht zu bleiben.
Max Huber übernahm die erste Wache, während sich John Cort und Khamis auf dem weißen Flaum am Fuße des Baumes ausstreckten.
Das geladene Gewehr bequem zur Hand, lehnte sich der Franzose gegen eine der Wurzeln und überließ sich willig dem eigenen Reize der Nacht. Im Innern des großen Waldes herrschte jetzt völliges Schweigen. Durch die Zweige strich nur ein leiser Hauch, wie der Athem der eingeschlummerten Bäume. Die Strahlen des hoch am Himmel stehenden Mondes glitten durch die Lücken im Laubwerk und zauberten launenhafte, silberne Lichtbilder auf den Erdboden. Auch jenseits der Blöße schimmerte es da und dort heller unter den Baumkronen.
Sehr empfänglich für die Poesie der Natur, genoß Max Huber diese in vollen Zügen, er athmete sie sozusagen ein, glaubte zuweilen zu träumen und schlief doch nicht. Ihm erschien es, als sei er das einzige lebende Wesen im Schoße dieser Pflanzenwelt.
Der ganzen Pflanzenwelt, denn als diese gaukelte ihm seine Phantasie den Wald von Ubanghi vor.
»Und wenn man die letzten Geheimnisse der Erdkugel entschleiern will – so dachte er – muß man denn dazu bis zu den Enden ihrer Achse hinausgehen, um deren Geheimnisse zu entdecken?… Warum bemühen sich die Menschen, um den Preis ungeheuerer und so gut wie unüberwindlicher Schwierigkeiten, nach den beiden Polen vorzudringen?… Was kann damit erreicht werden?… Die Lösung einiger Räthsel der Meteorologie, der Elektricität und des Erdmagnetismus!… Ist das werthvoll genug, die Nekrologe der hochnördlichen und tiefsüdlichen Gebiete mit so vielen neuen Namen zu vergrößern?… Wäre es nicht weit nützlicher und mehr versprechend, statt sich auf die arktischen und antarktischen Meere zu wagen, die unermeßlichen Gebiete dieser Wälder zu durchforschen und ihre wilde Undurchdringlichkeit zu besiegen? Es giebt ja deren mehrere in Amerika, Asien und Afrika, und kein Forscher hat noch den Gedanken gehabt, sie zum Felde seiner Entdeckungen zu wählen, keiner hat noch den Muth gezeigt, sich in das Unbekannte hinein zu wagen!…
Noch hat kein Mensch den Bäumen ihr Räthselwort entrissen, wie früher die Alten den Eichen von Dodona. Hatten die Mythologen denn nicht recht, ihre Wälder mit Faunen, Satyren, Dryaden, Hamadryaden und phantastischen Nymphen zu bevölkern?… Und überdies, um uns auf die Erhebungen der modernen Wissenschaften zu beschränken, kann man nicht vermuthen, daß in den ungeheueren Waldmassen auch unbekannte, den hier herrschenden Lebensbedingungen angepaßte Wesen vorkommen?… Zur Zeit der Druiden beherbergte ja auch das transalpine Gallien noch halbwilde Völkerschaften, wie die Kelten, die Germanen, die Ligurier und in hunderten von Stämmen, hunderten von Städten und Dörfern, die ihre besonderen Gebräuche, ihre eigenen Sitten, ihre angeerbte Originalität bewahrt hatten, auch hier im Innern von Wäldern, deren Grenzen selbst die römische Allmacht nur mit größter Schwierigkeit überschreiten konnte.«
So träumte Max Huber.
Unverbürgten Mittheilungen nach bargen ja auch die Gebiete von Aequatorialafrika gewisse, unter der Stufe der übrigen Menschheit stehende, halb fabelhafte Wesen. Gerade der Wald von Ubanghi grenzte im Osten an die Gegenden, die Schweinfurth und Junker erforscht hatten, an die Länder der Niam-Niam, jener geschwänzten Menschen, die in Wirklichkeit freilich keinen äußerlichen Schwanzfortsatz haben. (Hierzu diene zur Erläuterung, daß die menschliche Wirbelsäule unten mit mehreren freier beweglichen, anatomisch als »Schwanzfortsatz« bezeichneten, kleinen Knochen endigt.) Ferner hat Henry Stanley im Norden von Ituri kaum einen Meter hohe Pygmäen gefunden, die im übrigen vollkommen gut entwickelt waren, eine glänzende, seine Haut und große Augen wie Gazellen hatten, und deren Vorkommen zwischen Uganda und Cabinda auch der englische Missionär Albert Lhyd bestätigt hat mit der Angabe, daß dort im Astwerk der Bäume oder unter diesen über zehntausend Bambustis hausen, die einen Häuptling haben, dem sie unweigerlich folgen. In den Wäldern von Neduqurbocha war derselbe, von Ipoto aus, durch fünf Dörfer gekommen, die deren liliputanische Einwohner erst am Tage vorher verlassen hatten. Ebenso war er Uambuttis, Batinas, Akkas und Bazungus begegnet, die durchschnittlich nur hundertdreißig Centimeter, manche davon gar nur zweiundneunzig Centimeter groß waren und deren Körpergewicht noch nicht einmal vierzig Kilogramm erreichte. Dennoch erwiesen sich diese Zwergvölker nicht minder intelligent, in ihrem Sinne gewerbfleißig, doch auch kriegslustig und grausam, so daß sie von den Ackerbau treibenden Stämmen am obern Nil nicht wenig gefürchtet wurden.
Verführt durch seine lebhafte Einbildungskraft, seinem Hange nach allerlei Außerordentlichem, verharrte Max Huber bei der Vorstellung, daß auch der Wald von Ubanghi seltsame Menschenformen bergen müsse, die die Ethnographen bisher noch nicht kannten. Warum könnte es hier auch nicht wunderbare, menschliche Wesen geben, vielleicht nur mit einem Auge, wie die Cyklopen der Sage, oder mit einer rüsselförmig verlängerten Nase, die es erlaubt hätte, sie, wenn auch nicht zu der Ordnung der Pachydermen, doch zu der Familie der Proboscidier zu rechnen?
Unter dem Einflusse seiner wissenschaftlich-phantastischen Träumereien vergaß Max Huber freilich ziemlich ganz seine Pflichten als Wächter. Leicht hätte sich hier ein Feind heranschleichen können, ohne daß Khamis und John Cort zeitig genug davon erfahren hätten, sich zur Vertheidigung zu rüsten.
Da legte sich eine Hand auf seine Schulter.
»Ho! – Was ist das? rief er aufspringend.
– Ich bin es, ertönte die Stimme John Cort’s. Sieh mich nur nicht für einen Wilden von Ubanghi an… Nun… nichts verdächtiges bemerkt?
– Gar nichts.
– Es ist Zeit, daß Du Dich nun niederlegst, lieber Max.
– Ja, ja; es sollte mich aber sehr wundern, wenn die Träume, die mir vielleicht im Schlafe kommen, den Vergleich mit denen aushielten, die ich im Wachen gehabt habe!«
Der erste Theil dieser Nacht war ohne jede Störung verlaufen, und so verlief auch deren Rest, als John Cort an die Stelle Max Huber’s getreten war und als Khamis nach drei Stunden wieder John Cort abgelöst hatte.
Sechstes Capitel .
Immer weiter nach Südwesten
Am nächsten Morgen, am 11. März, brachen John Cort, Max Huber, Khamis und Llanga, die sich von den Anstrengungen des ersten Tages jetzt vollständig erholt hatten, auf, um die des zweiten Marschtages zu überwinden.
Nachdem sie ihre Lagerstatt unter den Baumwollbäumen verlassen hatten, umkreisten sie die Waldlichtung und wurden hier von Myriaden von Vögeln begrüßt, von Sängern, die ihre Triller lustig hinausschmetterten oder Orgeltöne erklingen ließen, um die sie die Patti und alle anderen Virtuosen der italienischen Musik hätten beneiden können.
Doch vor dem eigentlichen Aufbruche empfahl es sich noch, ein Frühstück einzunehmen. Dieses bestand einzig aus kaltem Antilopenfleisch und Wasser aus dem zur Linken vorüberfließenden Bache, aus dem sich auch der Foreloper seine Feldflasche füllte.
Anfänglich führte der Weg nach rechts unter die Baumkronen, die schon die ersten Strahlen der Sonne durchblitzten, deren Stand sorgsam ermittelt wurde.
Offenbar hausten mächtige Vierfüßler in größerer Menge in diesem Theile des Waldes. Nach jeder Richtung hin waren hier Durchgänge gebrochen. Noch im Laufe des Vormittags wurden auch eine Anzahl Büffel und sogar zwei Rhinozerosse sichtbar, die sich aber in gemessener Entfernung hielten. Da dieselben offenbar in keiner kampflustigen Stimmung waren, brauchte man auch keine Patrone zu opfern, um sie zu vertreiben.
Nachdem etwa ein Dutzend Kilometer zurückgelegt waren, machte die kleine Gesellschaft gegen Mittag zum erstenmale wieder Halt.
Dabei fand John Cort Gelegenheit, ein Paar Trappen von der Abart der sogenannten Korans zu erlegen, die am Leibe ein gagatschwarzes Gefieder haben und mit Vorliebe im dichten Laubwerk nisten. Ihr von den Eingebornen sehr geschätztes Fleisch fand bei der Mittagsmahlzeit auch den Beifall eines Amerikaners und eines Franzosen.
»Ich wünschte aber dringend, hatte Max Huber gesagt, daß einmal wirklich gebratenes Fleisch an die Stelle des nur gerösteten träte.
– Nichts leichter als das,« hatte der Foreloper sofort erwidert.
Eine Trappe wurde infolgedessen gerupft, ausgenommen, an einen spitzen Stock gespießt und über lebhaft flackerndem Feuer gebraten. Sie mundete dann allen vortrefflich.
Der weitere Weg bot Khamis und seinen Gefährten größere Schwierigkeiten, als die des vorigen Tages.
Nach Südwesten zu fanden sich weniger häufig gangbare Durchbrüche. Hier mußten sie sich selbst einen Weg bahnen, und meist durch Buschwerk, das eben so zähe und fest war, wie die Lianen, die sich nur mit dem Messer zertrennen ließen.
Mehrere Stunden lang fiel jetzt auch ein ziemlich starker Regen. Die Baumkronen waren aber so dicht belaubt, daß nur einzelne Tropfen den Boden erreichten. Inmitten einer anderen Lichtung konnte Khamis jedoch die fast geleerte Feldflasche aufs neue füllen, was gewiß höchst erwünscht war, denn der Foreloper hatte unter dem Gebüsch bisher vergeblich nach einem Wässerchen gesucht. Aus diesem Mangel erklärte sich wohl auch die Seltenheit der Thiere und der gangbaren Wildpfade.
»Das deutet freilich nicht auf die Nähe eines Wasserlaufes hin,« bemerkte John Cort, als am Abend wieder Rast gemacht wurde.
Es erhellte daraus auch, daß der Rio, der sich um den Tamarindenhügel schlängelte, nur am Rande des Waldes hinlaufen möge.
An der bisher eingehaltenen Richtung durfte deshalb immerhin nichts geändert werden, schon aus dem einfachen Grunde, daß sie nächsten Weges nach dem Ubanghi führte.
»Sollten wir übrigens nicht, meinte Khamis, an Stelle des neben dem vorgestrigen Lagerplatze gesehenen Flüßchens in dieser Richtung auf ein anderes treffen?«
Die Nacht vom 11. zum 12. verbrachten die Wanderer nicht zwischen den Wurzeln eines Baumwollbaumes, sondern am Fuße eines anderen Waldriesen, eines Bombax, dessen runder, gerader Stamm sich bis auf hundertfünfzig Fuß über den dichten Teppich des Erdbodens erhob.
Die Nachtwache wurde ebenso wie vorher geordnet, und die Schläfer wurden höchstens durch entferntes Brüllen von Büffeln und Rhinozerossen dann und wann gestört. Daß auch das dröhnende Gebrüll eines Löwen sich zu diesem nächtlichen Concert gesellen werde, war kaum zu befürchten. Diese gewaltigen Raubthiere bewohnen kaum die Wälder Centralafrikas. Sie bevorzugen höher gelegene Landestheile, entweder jenseits des Congo im Süden, oder nahe der Grenze des Sudan, in der Nachbarschaft der Sahara, im Norden. Die allzudichten Waldmassen passen dem launenhaften Charakter und der gewohnten Bewegungsfreiheit des Königs der Thiere –des Königs aus eigener Macht, nicht Kraft einer Constitution –offenbar nicht. Er braucht mehr Raum, von der Sonne überfluthete Ebenen, wo er ganz nach Belieben umherjagen kann.
So wie sich dessen Gebrüll nicht hören ließ, so war es auch mit dem Grunzen des Flußpferdes – und das erschien bedauerlich, denn das Vorhandensein solcher amphibischer Säugethiere hätte auf die Nähe eines Wasserlaufes hingewiesen.
Am folgenden Morgen erfolgte der Aufbruch bei trübem Wetter. Max Huber gelang die Erbeutung einer Antilope von der Größe eines Esels, oder vielmehr von der eines Zebras, das in dieser Hinsicht zwischen Pferd und Esel steht. Es war ein weingelber Oryx mit mehrfachen, regelmäßigen Streifen. Der Oryx zeigt ein schwarzes Band vom Widerrist bis zum Hintergestell und schwarze Flecken an den übrigens weißlich behaarten Beinen, dazu hat er einen buschigen Schweif, der den Erdboden berührt, und auch an der Kehle ist er mit einem Bündel schwarzer Haare gezeichnet. Ein sehr schönes Thier, hat es wohl einen Meter lange Hörner mit etwa dreißig Ringwülsten nahe am Kopfe; seine Bewegungen sind zierlich, und im ganzen zeigt es ein Ebenmaß der Formen, wie ein solches nur selten zu finden ist.
Bei dem Oryx bilden die Hörner eine Schutzwaffe, die es ihm in den nördlichen und südlichen Gebieten Afrikas ermöglicht, sich sogar eines Löwen zu erwehren. Heute konnte das von dem Jäger scharf aufs Korn genommene Thier dessen gut sitzender Kugel freilich nicht entgehen, und mit durchbohrtem Herzen brach es auf der Stelle zusammen.
Hiermit war die Ernährung der Gesellschaft auf mehrere Tage gesichert. Khamis ging sofort daran, den Oryx auszuweiden, was gut eine Stunde in Anspruch nahm.
Dann wurde die Last unter alle vertheilt, selbst Llanga erbat sich, etwas davon auf sich zu nehmen, und dann ging es des Weges weiter.
»Wahrhaftig, scherzte John Cort, hier beschafft man sich mehr als das nöthige Fleisch erstaunlich billig, da es ja nur eine Patrone kostet…
– Wenigstens wenn einer ein geschickter Schütze ist, sagte der Foreloper.
– Und dazu etwas Glück hat,« setzte Max Huber hinzu, der sich bescheidener erwies, als sonst die Jünger des edlen Waidwerkes.
Hatten Khamis und seine Gefährten bisher aber ihr Pulver schonen und ihr Blei sparen können, da sie es nur zum Erlegen eßbaren Wildes gebraucht hatten, so sollte doch der Tag nicht vergehen, ohne daß die Gewehre zur Vertheidigung benutzt wurden.
Auf einer reichlich einen Kilometer langen Strecke glaubte der Foreloper sogar, sie würden sich schon zur Abwehr einer großen Affenbande genöthigt sehen. Diese Rotte tummelte sich weithin zur Rechten und zur Linken ihres Weges umher; die einen davon sprangen von einer Baumkrone zur anderen, die anderen hüpften mit grotesken Sätzen durch das Gesträuch am Erdboden mit einer Gewandtheit, die gewiß den Neid der geübtesten Akrobaten erregt hätte.
Die Affengesellschaft bestand aus mehreren Arten großer Vierhänder, aus Kynocephalen von drei Farben – gelben, wie die Farbe der Araber, rothen, wie die der Indianer des fernen Westens, und schwarzen, wie die der Eingebornen des Kaffernlandes – alle aber gehörten zu den gefährlichsten Thieren ihres Schlages. Darunter gaukelten mehrere Arten von Coloben umher, von leibhaftigen Dandys, den elegantesten Stutzern der Affenwelt, die unausgesetzt beschäftigt waren, ihren weißen Halskragen – um deswillen sie auch den Namen Bischofscoloben erhalten haben – zu bürsten und zu glätten.
Die unbehagliche Begleitung, die sich während der Mittagsmahlzeit angesammelt hatte, verschwand aber gegen zwei Uhr, wo Max Huber, John Cort, Khamis und Llanga ihre Wanderung längs eines unübersehbar weiten Pfades wieder antraten.
Während sie sich wegen dieser bequem gangbaren Wegstrecke beglückwünschen konnten, hatten sie sich dagegen auch über die Begegnung mit Thieren zu beklagen, die diesen offenbar vielfach zu betreten pflegten.
Hier waren es zwei Rhinocerosse, deren langgedehntes Schnaufen ein wenig vor vier Uhr aus geringer Entfernung hörbar wurde. Khamis erkannte das Geräusch sofort und ersuchte seine Begleiter, stehen zu bleiben.
»Es sind ungemüthliche Burschen, diese Rhinocerosse! sagte er und nahm schon das vorher umgehängte Gewehr in die Hand.
– Sehr ungemüthliche, bestätigte Max, und doch sind es nur Pflanzenfresser…
– Die aber ein sehr zähes Leben haben, setzte Khamis hinzu.
– Und wie sollen wir uns nun verhalten? fragte John Cort.
– Wir müssen womöglich vorüberzukommen suchen, ohne gesehen zu werden, rieth Khamis an, oder uns mindestens verstecken, bis die gefährlichen Thiere vorbeigetrottet sind.
Vielleicht bemerken sie uns dann nicht. Immerhin wollen wir uns schußfertig halten, denn wenn wir entdeckt werden, trampeln sie jedenfalls auf uns zu.«
Die Gewehre wurden untersucht und die Patronen zurechtgelegt, um schnell wieder laden zu können. Dann verließen alle den Wildpfad und verschwanden hinter dem dichten Gesträuch, das diesen auf der rechten Seite einsäumte.
Fünf Minuten später und als das Schnaufen und Grunzen weit lauter ertönte, erschienen die mißgestalteten Pachydermen, die zu der fast haarlosen Art der Ketloas gehörten. Sie trabten mit aufgerichtetem Kopfe und erhobenem Schwanze ziemlich schnell daher.
Es waren mächtige, zwischen drei und vier Meter lange Thiere mit geraden Ohren, kurzen, etwas gewundenen Beinen und abgestumpfter, mit einem Horne bewehrter Schnauze, mit der sie die gefährlichsten Stöße austheilen können. Die Härte ihrer Kiefer ist dabei so groß, daß sie Zweige mit spitzen Dornen ebenso ungestraft zerkauen, wie der Esel die Disteln verzehrt.
Die beiden Thiere machten plötzlich Halt. Khamis und die anderen erkannten sofort, daß sie erspäht waren.
Eines der Rhinocerosse – ein Ungeheuer mit rauher, trockener Haut – näherte sich dem Gesträuche.
Max Huber brachte schon das Gewehr in Anschlag.
»Schießen Sie nicht nach den Schenkeln, sondern nach dem Kopfe!« rief ihm der Foreloper zu.
Sofort krachte ein Schuß, ein zweiter, dritter folgte ihm. Die Kugeln durchdrangen kaum den dicken Panzer… die Schüsse blieben so gut wie verloren.
Das Knallen erschreckte die plumpen Angreifer keineswegs und hielt sie nicht zurück, im Gegentheil schickten sie sich an, in das Strauchwerk einzudringen.
Es lag auf der Hand, daß ein solches Gewirr von Dorngestrüpp und Buschwerk für so mächtige Thiere kein Hinderniß bilden konnte. In einem Augenblicke mußte dieses von ihnen zerrissen und niedergetreten sein. Sollten nun Khamis und seine Gefährten, nachdem sie vor den Elefanten auf der Ebene glücklich geflüchtet waren, ebenfalls den Rhinocerossen entgehen? Ob solche Pachydermen eine Nase in der Form eines Rüssels oder in der eines Hornes hatten, kam ja wohl so ziemlich auf eins hinaus. Hier gab es nur leider keinen Schutzwall wie den der Bäume am Waldrande, vor dem die Elefanten hatten Halt machen müssen. Versuchten der Foreloper, John Cort, Max Huber und Llanga jetzt zu fliehen, so wurden sie jedenfalls verfolgt und voraussichtlich eingeholt.
Das Lianennetz mußte sie im Laufe hemmen, während die Rhinocerosse es wie eine Lawine durchbrachen.
Unter den Bäumen des Dickichts befand sich aber zufällig ein ungeheuerer Baobab, der wohl eine Zufluchtsstätte bieten konnte, wenn es nur gelang, seine untersten Aeste zu erklimmen. Das wäre also eine Wiederholung des am Tamarindenhügel geübten Verfahrens gewesen, das freilich einen traurigen Ausgang hatte; ob es sich hier anders gestalten würde, blieb zunächst mindestens ungewiß.
Vielleicht war der Baobab aber doch groß und stark genug, dem Anprall der Rhinocerosse zu widerstehen.
Seine erste Gabelung lag freilich volle fünfzig Fuß über der Erde und sein kürbisartig ausgebauchter Stamm hatte nirgends einen Vorsprung, woran Hand oder Fuß hätte einen Haltepunkt finden können.
Der Foreloper hatte schnell erkannt, daß an ein Erklettern des Baumes nicht zu denken war. Max Huber und John Cort harrten schon gespannt auf seine Entscheidung.
In diesem Augenblick bewegte sich das Gesträuch am Rande des Pfades und es kam ein unförmlicher Kopf zum Vorschein.
Sofort krachte ein vierter Flintenschuß.
John Cort war damit nicht glücklicher, als vorher Max Huber.
Die in die Schulter des Thieres nicht eindringende Kugel hatte nur ein noch schrecklicheres Geschnaufe zur Folge, da jenes durch den Schmerz noch mehr erregt wurde. Es wich auch nicht zurück, sondern stürzte mit voller Wuth auf das Dickicht zu, während das andere Rhinoceros, das von einer Kugel des Forelopers nur gestreift worden war, sich anschickte, dem ersten zu folgen.
Weder Max Huber, noch John Cort oder Khamis fanden Zeit genug, ihre Gewehre aufs neue zu laden. In verschiedener Richtung zu entfliehen, sich unter den anderen Bäumen in Sicherheit zu bringen, dazu war es zu spät. Der Trieb der Selbsterhaltung veranlaßte nur alle drei, hinter den Stamm des Baobab zu flüchten, der am Boden wohl fünf bis sechs Meter Umfang hatte.
Wenn das erste Thier aber um den Stamm herum und das zweite ihm vielleicht von der andern Seite her entgegenkam…
was dann?
»Zum Teufel! stieß Max Huber hervor.
– Nein: Gott stehe uns bei!« rief John Cort.
Zweifellos galt es jetzt, auf jede Hoffnung zu verzichten, wenn nicht die Hand der Vorsehung den Bedrohten zu Hilfe kam.
Von einem unbeschreiblich heftigen Anprall erzitterte da der Baobab bis in die Wurzeln, als sollten diese aus der Erde gerissen werden.
Das in unsinnigster Wuth anstürmende Rhinoceros stand aber plötzlich ganz still. An einer Stelle, wo die Rinde des Baobab schon einen Sprung hatte, war dessen Horn, gleich der Axt des Holzfällers, wohl einen Fuß tief eingedrungen. Vergeblich machte es die größten Anstrengungen, das Horn wieder herauszuziehen. Selbst als es sich mit den plumpen, kurzen Beinen gegen den Baumriesen stemmte, gelang ihm das so wenig wie vorher.
Das zweite Rhinoceros, das alles Gesträuch ringsum wie spielend niedertrat, hielt damit ein, doch was beide Thiere jetzt aufs höchste erregte, war schwerlich zu errathen. Khamis schlich sich, über die Wurzeln hinkriechend um den Stamm, um zu sehen, was vorgegangen wäre.
»Fliehen… in aller Eile fliehen!« rief er sofort.
Die anderen verstanden ihn mehr, als daß sie ihn hörten.
Ohne eine Erklärung zu verlangen, stürmten John Cort und Max Huber mit Llanga, den sie mit sich fortzogen, durch das hohe Gras dahin. Zu ihrer größten Verwunderung wurden sie von den Rhinocerossen nicht verfolgt, doch erst nach fünf Minuten fortgesetztem, erschöpfendem Laufe machten sie auf ein Zeichen des Forelopers Halt.
»Was ist denn geschehen? erkundigte sich John Cort, sobald er nothdürftig zu Athem gekommen war.
– Das Rhinoceros hat sein Horn nicht wieder aus dem Baumstamme ziehen können.
– Herr, mein Gott, rief Max Huber, das ist ja der reine Milon von Kroton unter den Nashornen!
– Und wird auch dasselbe Ende nehmen wie jener Held der olympischen Spiele,« setzte John Cort hinzu.
Khamis, den es wenig kümmerte, von dem berühmten Athleten des Alterthums so gut wie nichts zu wissen, begnügte sich, zu murmeln:
»Mit einem Wort: Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, freilich um den Preis von vier nutzlos verplatzten Patronen.
– Das ist um so bedauerlicher, weil das große Thier da… nun ja, weil es eßbar ist, wenn ich recht unterrichtet bin.
– Das stimmt, bestätigte Khamis, nur schmeckt sein Fleisch etwas stark nach Moschus… jedenfalls lassen wir es in der Klemme sitzen…
– Und sich nach Belieben sein Horn abbrechen!« schloß Max Huber die Rede.
Es wäre unvorsichtig gewesen, nach dem Baobab zurückzukehren. Das Grunzen der beiden Rhinocerosse war aus dem Dickicht noch immer zu hören. Nach einem Umwege, der sie auf den Wildpfad zurückführte, nahmen alle vier ihren Marsch wieder auf, den sie erst gegen sechs Uhr nahe bei einem großen Felsen unterbrachen.
Der nächste Tag verlief ohne jeden Zwischenfall. Die Schwierigkeiten des Weges nahmen vorläufig nicht weiter zu, und so wurden einige dreißig Kilometer nach Südwesten hin zurückgelegt. Der Wasserlauf freilich, nach dem es Max Huber so dringend verlangte und den Khamis so zuversichtlich erwartet hatte, zeigte sich noch immer nicht.
An diesem Abend und nach einer Mahlzeit, zu der eine Antilope, eine sogenannte Käse-Antilope, den wenig abwechslungsreichen Braten lieferte, überließ man sich sorglos der Ruhe. Leider wurden die zehn Schlummerstunden durch das Umherflattern von Tausenden großer und kleiner Fledermäuse gestört, die erst mit dem anbrechenden Morgen davonflogen.
»Zu viele Harpyien… viel zu viele! rief Max Huber, als er sich nach einer so schlecht verbrachten Nacht gähnend und die Glieder streckend erhob.
– Wer wird sich immer gleich beklagen! sagte der Foreloper.
– Warum denn nicht?…
– Weil es immer noch besser ist, es mit Fledermäusen als mit Moskitos zu thun zu haben, und von den zweiten sind wir bis jetzt verschont geblieben.
– Am besten wäre es wohl, Khamis, man könnte den einen wie den anderen aus dem Wege gehen.
– Na, die Moskitos werden uns nicht geschenkt werden, Herr Max…
– Und wann werden wir von diesen abscheulichen Insecten aufgefressen werden?
– Mit der Annäherung an einen Rio…
– Einen Rio! platzte Max Huber heraus. An einen solchen haben wir wohl früher geglaubt, lieber Khamis, das ist aber jetzt nicht mehr möglich.
– Sie haben doch unrecht, Herr Huber, vielleicht ist er gar nicht mehr fern!«
Dem Foreloper waren thatsächlich schon einige Veränderungen des Erdbodens aufgefallen, und von Nachmittag drei Uhr an bestätigte sich seine Beobachtung nur noch weiter: der Wald, durch den sie zogen, wurde allmählich sumpfig.
Da und dort zeigten sich bereits Tümpel mit Wasserpflanzen, auch bot sich Gelegenheit, einzelne Gaupas, eine Art wilde Enten, zu erlegen, deren Vorkommen auf die Nähe von Wasser hinwies. Als sich die Sonne dem Horizonte zuneigte, ließ sich noch obendrein das Quaken von Fröschen hören.
»Entweder irre ich mich stark… oder das Land der Moskitos ist nicht mehr ferne,« sagte der Foreloper.
Auf der heute noch zurückzulegenden Wegstrecke ging die Wanderung recht beschwerlich vor sich, denn der Boden war mit den zahllosen Phanerogamen bedeckt, deren Entwicklung ein feuchtwarmes Klima so ungemein befördert. Dagegen zeigten sich die dünner stehenden Bäume weniger durch Lianen verbunden.
Max Huber und John Cort konnten die Veränderung gar nicht verkennen, die der sich nach Südwesten fortsetzende Theil des Waldes aufwies.
Trotz der Vorhersage Khamis’ war in dieser Richtung aber noch nichts von dem Spiegelglanze eines fließenden Gewässers wahrzunehmen.
Je mehr indeß die Neigung des Erdbodens zunahm, desto häufiger war er von Morastlöchern durchsetzt, so daß es große Aufmerksamkeit erforderte, nicht in ein solches zu versinken.
Ohne Stiche zu erleiden, wäre auch keiner wieder herausgekommen.
In den Löchern wimmelte es nämlich von Blutegeln, und auf ihrem morastigen Wasser huschten riesige Myriapoden umher, widerwärtige Gliederthiere von schwärzlicher Farbe und mit rothen Füßen, die man nur mit einem gewissen Abscheu betrachten konnte.
Eine herrliche Augenweide boten dafür unzählige Schmetterlinge mit schillernden Farben und graziöse Libellen, die von den vielen Eichhörnchen, den Zibet- und Ginsterkatzen, den Bengalischen Fischern, Traueramseln und Martinsfischern als Leckerbissen verzehrt wurden.
Der Foreloper bemerkte auch, daß nicht nur Wespen, sondern auch Tsetsefliegen in großer Menge im Gebüsch umherschwirrten. Muß man sich auch vor dem Stachel der ersten hüten, so braucht man glücklicherweise den Biß der zweiten nicht besonders zu fürchten. Deren Gift ist nur für Pferde, Kameele und Hunde tödtlich, nicht aber für Menschen und auch nicht für Raubthiere.
Die kleine Gesellschaft wanderte bis halb sieben Uhr des Abends nach Südwesten weiter und hatte damit bis jetzt die längste und erschöpfendste Wegstrecke zurückgelegt. Schon bemühte sich Khamis, einen geeigneten Platz für das Nachtlager zu wählen, als Max Huber und John Cort durch ein Geschrei Llangas erschreckt wurden.
Seiner Gewohnheit nach war der Knabe den anderen immer voraus gelaufen und von einer Seite zur anderen gesprungen.
Jetzt hörte man ihn mit lauter Stimme rufen… sollte er von einem Raubthiere überfallen worden sein?
John Cort und Max Huber liefen in der Richtung, aus der die Rufe kamen, hin und hatten sich bereits schußfertig gemacht.
Sie sollten jedoch bald beruhigt werden.
Auf dem dicken Stamme eines umgestürzten Baumes stehend, wies Llanga mit der Hand nach einer umfänglichen Lichtung und wiederholte mit scharfer Stimme:
»Der Rio!… der Rio!«
Khamis kam ebenfalls herzugeeilt und John Cort sagte zu ihm einfach:
»Der gewünschte Wasserlauf.«
Einen halben Kilometer entfernt und durch eine baumlose Stelle schlängelte sich ein klarer Fluß dahin, der eben die letzten Sonnenstrahlen widerspiegelte.
»Dort… dort werden wir meiner Ansicht nach unser Nachtlager aufschlagen, äußerte John Cort.
– Jawohl… dort, stimmte ihm der Foreloper zu, und verlassen Sie sich darauf, daß uns dieser Rio bis zum Ubanghi führen wird.«
Es konnte ja in der That nicht schwierig sein, ein Floß herzustellen und sich darauf der Strömung des Flusses anzuvertrauen.
Ehe man an dessen Ufer kam, war noch eine recht sumpfige Wegstrecke zu überwinden.
Da die Dämmerung hier in der Aequatorialgegend nur von sehr kurzer Dauer ist, war es schon recht dunkel geworden, ehe der Foreloper und seine Gefährten an einer ziemlich hohen Uferwand ankamen.
An dieser Stelle standen die Bäume mehr vereinzelt, stromauf- und stromabwärts dagegen bildeten sie wieder dichte Massen.
Die Breite des Flusses betrug nach John Cort’s Schätzung etwa vierzig Meter. Es war das also kein einfacher Bach, sondern ein nicht unbedeutender Nebenfluß mit scheinbar recht schneller Strömung.
Natürlich galt es, bis zum Morgen zu warten, um die Sachlage klarer zu übersehen. Das Nothwendigste war vorläufig die Aufsuchung eines geeigneten Platzes für die Nachtruhe. Khamis entdeckte auch einen solchen in einer Felsaushöhlung, einer Grotte in dem Kalkstein der Uferhöhe, die zur Aufnahme aller vier Wanderer ausreichen mußte.
Zunächst wurde der Ueberrest des letzten Wildbratens kalt verzehrt. Dadurch konnte man davon absehen, ein Feuer anzuzünden, dessen Glanz ja leicht genug Thiere aus der Nähe herbeilocken konnte. Krokodile und Flußpferde giebt es in den afrikanischen Flüssen in großer Menge. Hausten solche auch in diesem Flusse – und das war höchst wahrscheinlich – so mußte man sich wenigstens hüten, von ihnen in der Nacht überfallen zu werden.
Freilich hätte ein an der Grottenöffnung auflodernder und stark rauchender Feuerherd die Wolken von Moskitos vertrieben, die am unteren Theile der Uferwand umhersummten. Unter zwei Uebeln entschied man sich aber doch für das kleinere, und wollte lieber den Stacheln der Stechfliegen und anderer lästiger Insecten ausgesetzt, als von den ungeheueren Kiefern der Alligatoren bedroht sein.
In den ersten Stunden hielt John Cort am Eingange der Aushöhlung Wache, während seine Gefährten trotz des Summens und Schwirrens der Moskitos in tiefem Schlummer lagen.
In dieser Zeit bemerkte er nichts verdächtiges, nur glaubte er mehrmals ein Wort zu vernehmen, das in kläglichem Tone aus dem Munde eines Menschen zu kommen schien.
Das Wort lautete »Ngora«, das in der Eingebornensprache
»Mutter« bedeutet.
Siebentes Capitel .
Der leere Käfig
Warum hätte sich der Foreloper nicht beglückwünschen sollen, so zur rechten Zeit eine Grotte, eine von der Natur geschaffene Unterkunftsstätte an der Uferwand gefunden zu haben? Hier war keine Spur von Feuchtigkeit, weder an den Seitenwänden noch an der Dachwölbung zu entdecken. Dank diesem geschützten Plätzchen hatten dessen Insassen auch nicht von einem starken Regenguß zu leiden, der bis Mitternacht herabrauschte. Auch für die Zeit, die die Herrichtung eines Flosses beanspruchte, war hiermit ein genügendes Obdach gefunden.
Nach dem Regen wehte ein scharfer Nordwind. Der Himmel hatte sich mit dem Aufgang der Sonne vollständig geklärt und der Tag versprach sehr warm zu werden. Vielleicht sehnten sich dann Khamis und seine Gefährten nach dem Baumschatten zurück, in dem sie nun fünf Tage hingezogen waren.
John Cort und Max Huber zeigten sich in bester Laune, der Fluß versprach, sie mühelos gut dreihundert Kilometer weit hinunterzutragen, bis zu seiner Einmündung in den Ubanghi, zu dessen Stromnetz er zweifellos gehörte. Auf diese Weise mußten die letzten drei Viertel des Zuges höchst bequem zurückgelegt werden.
Nach den Mittheilungen, die ihm der Foreloper machte, hatte John Cort diese Berechnung mit hinreichender Genauigkeit anstellen können.
Stromaufwärts, wo der Fluß fast in gerader Linie verlief, verschwand er in der Entfernung von einem Kilometer unter dem Laubdache der Bäume.
Stromabwärts begann das Walddickicht bereits fünfhundert Meter von hier, wo der Fluß eine scharfe Biegung nach Südosten machte. Von dieser Stelle aus zeigte der Wald wieder die gewöhnliche Dichtigkeit.
Im Grunde war es nur eine große, morastige Waldblöße, die diesen Theil des rechten Ufers einnahm. An der anderen Seite standen die Bäume nahe beieinander. Ein mächtiger Hochwald ragt dort auf ziemlich bewegtem Boden empor, und seine Gipfel hoben sich, jetzt bei Sonnenaufgang, scharf vom Himmel ab.
Der Fluß selbst mit sehr klarem, schnell strömendem Wasser füllte sein Bett vollständig aus und führte morsche Stämme, Haufen von Gesträuch und von beiden Uferwänden abgenagte Grasbündel mit sich hinab.
Jetzt erinnerte sich John Cort, daß er in der Nacht das Wort
»Ngora« in der Nähe der Grotte hatte aussprechen hören. Er sah sich deshalb um, ob vielleicht ein menschliches Wesen in der Nachbarschaft umherirrte.
Daß Nomaden gelegentlich den Flußlauf benutzten, um nach Ubanghi zu gelangen, war ja recht gut anzunehmen, ohne daraus schließen zu müssen, daß das ungeheuere, im Osten bis zu den Quellen des Nil reichende Waldgebiet etwa von umherziehenden Stämmen besonders häufig besucht oder gar von seßhaften bewohnt wäre.
Soweit der sumpfige Platz reichte, bemerkte John Cort ebensowenig ein menschliches Wesen, wie längs der Ufer des Flusses.
»Da hab’ ich wohl eine Sinnestäuschung gehabt, dachte er.
Vielleicht war ich gar einen Augenblick eingeschlafen und habe jene Stimme nur im Traume vernommen.«
Er erwähnte auch gegen seine Gefährten nichts von der Sache.
»Mein lieber Max, fragte er später, hast Du Dich denn auch bei unserem wackeren Khamis genügend entschuldigt wegen Deines Zweifels an dem Vorhandensein dieses Flusses, woran er doch so unerschütterlich glaubte?
– Er hat mir gegenüber recht gehabt, John, und ich bin sehr zufrieden, unrecht geurtheilt zu haben, denn der Flußlauf wird uns ohne Anstrengung nach den Ufern des Ubanghi befördern.
– Ohne Anstrengung unsererseits… das möcht’ ich nicht gerade behaupten, fiel der Foreloper ein. Vielleicht kommen Wasserfälle… Stromschnellen…
– Ach, wir wollen die Sachen nur von der guten Seite ansehen, erklärte John Cort. Wir haben nach einem Flusse gesucht… da ist er ja. Wir beabsichtigten dann ein Floß zu bauen, und das wird geschehen…
– Und zwar gleich von diesem Morgen an, fiel Khamis ein.
Ich werde unverzüglich an die Arbeit gehen, und wenn Sie mich dabei unterstützen wollen, Herr John…
– Selbstverständlich, Khamis. Und während wir damit beschäftigt sind, wird Freund Max für den nöthigen Proviant sorgen…
– Was um so nöthiger ist, als wir davon nichts mehr übrig haben, erklärte Max Huber. Das Leckermäulchen, der Llanga, hat gestern Abend alles verzehrt…
– Ich, lieber Herr Max? erwiderte Llanga, der, jene Worte ernst nehmend, gegen einen solchen Vorwurf sehr empfindlich zu sein schien.
– Na na, Bürschchen, Du siehst doch, daß ich nur scherze!…
Vorwärts, geh’ mit mir. Wir wollen einmal das Ufer bis zur Flußecke absuchen. Bei dem Sumpflande auf der einen und dem Flusse auf der anderen Seite kann es weder rechts noch links an Wasserwild fehlen, und – wer weiß? – vielleicht haschen wir einen schmackhaften Fisch, der in unsere Tafel eine erwünschte Abwechslung brächte.
– Hüten Sie sich vor Krokodilen und auch vor Flußpferden, Herr Huber, warnte der Foreloper.
– O, Khamis, so eine Flußpferdkeule, auf der Stelle gebraten, soll, denke ich, auch nicht zu verachten sein!… Warum sollte ein Thier von so glücklichem Charakter – eigentlich ein Süßwasserschwein – kein saftiges Fleisch liefern?
– Von glücklichem Charakter, Max… mag sein, doch wenn man es reizt, ist seine Wuth geradezu furchtbar.
– Man kann ihm aber doch nicht so ein paar Kilogramm vom Leibe abschneiden, ohne es ein bischen böse zu machen…
– Kurz, fügte John Cort hinzu, wenn Ihr von der geringsten Gefahr bedroht seid, so kommt schnellstens zurück. Seid vorsichtig…
– Und Du sei nur ruhig, John… Komm, Llanga…
– Geh’, mein Junge, und vergiß nicht, daß wir Dir Deinen Freund Max anvertrauen!«
Nach einer solchen Rede konnte man sich für gesichert halten, daß Max Huber kein Unfall zustieße, denn Llanga würde schon über ihn wachen.
Max Huber ergriff sein Gewehr und übersah seinen Patronenvorrath.
»Schonen Sie Ihre Munition, Herr Max, ermahnte ihn der Foreloper.
– Gewiß, so viel wie möglich, Khamis. Es ist aber wirklich bedauernswerth, daß die Natur in den afrikanischen Wäldern nicht ebenso einen Patronenbaum, wie den Brod- und den Butterbaum erschaffen hat. Dann würde man sich im Vorübergehen seine Patronen wie Feigen oder Datteln von seinen Zweigen pflücken.«
Nach dieser unbestreitbar richtigen Bemerkung schlugen Max Huber und Llanga eine Art Fußpfad in der Mittelhöhe der Uferwand ein, wodurch beide sehr bald den Blicken der anderen entschwanden.
John Cort und Khamis gingen inzwischen daran, geeignete Stämme zur Herrichtung des Flosses zu suchen. Wurde das auch nur ein recht nothdürftiges Fahrzeug, so mußte dazu doch das möglichst geeignete Holz ausgewählt werden.
Der Foreloper und sein Begleiter besaßen nur ein kleines Beil und zwei Taschenmesser. Mit so mangelhaften Hilfsmitteln war es offenbar schwierig, Riesen des Waldes oder selbst Bäume von geringerem Durchmesser zu fällen. Khamis beabsichtigte deshalb auch, nur herabgefallene Aeste und Zweige zu benutzen, die mit Lianen unter einander verbunden werden sollten und über denen er eine Art Fußboden aus Gras und Erde herzustellen gedachte. Bei zwölf Fuß Länge und acht Fuß Breite mußte das Floß drei Männer und ein Kind aufnehmen können, die es überdies zu jeder Mahlzeit und jeder Nachtruhe verlassen sollten.
Von solchem Holz, das durch Alter, Sturmwind oder Blitzschlag zu Boden gefallen war, fand sich eine beträchtliche Menge auf dem Sumpfgebiete, worüber nur noch einige harzreiche Bäume aufragten. Die zum Bau des Flosses nöthigen Bestandtheile wollte Khamis nun zusammentragen, und als er das John Cort mitgetheilt hatte, war dieser sofort bereit, ihn dabei zu unterstützen.
Noch einmal warfen sie einen Blick auf das Ufer stromauf-und stromabwärts, und da alles in der Umgebung des Sumpfes ruhig zu sein schien, machten sich beide auf den Weg.
Sie hatten kaum hundert Schritte zu thun gehabt, als sie schon auf eine Anhäufung schwimmfähiger Holzstücke trafen.
Eine größere Schwierigkeit lag freilich in deren Beförderung bis zum Wasserrande. Erwiesen sie sich für die Kräfte zweier Personen zu schwer, so sollte das erst nach der Rückkehr der Jäger versucht werden.
Inzwischen ließ alles vermuthen, daß Max Huber auf der Jagd Glück habe. Eben krachte ein Schuß und bei der Treffsicherheit des Franzosen war anzunehmen, daß das kein verlorener wäre. Bei ausreichender Munition ließ sich mit Bestimmtheit erwarten, daß die Ernährung der kleinen Gesellschaft für die dreihundert Kilometer bis zum Ubanghi und auch noch darüber hinaus gesichert sein werde.
Khamis und John Cort waren noch mit der Auswahl der geeignetsten Hölzer beschäftigt, da vernahmen sie aus der von Max Huber eingeschlagenen Richtung her laute Rufe.
»Das war Maxens Stimme, sagte John Cort.
– Jawohl, antwortete Khamis, und daneben auch die Llangas.«
Wirklich mischten sich ein schärferer Laut und eine tiefere Männerstimme.
»Sollten sie in Gefahr sein?« fragte John Cort.
Beide schritten über das Sumpfland zurück und erreichten die mäßige Anhöhe, unter der die Grotte lag. Als sie von hier aus auf den Fluß hinunter blickten, sahen sie Max Huber und den kleinen Eingebornen am rechten Ufer stehen. Menschen oder Thiere zeigten sich nirgends. Aus dem Winken der beiden, die keinerlei Unruhe verriethen, konnten sie nur entnehmen, daß sie zu ihnen hinkommen sollten.
Khamis und John Cort stiegen sofort hinunter und eilten drei-bis vierhundert Meter am Ufer hin, wo sie bereits die anderen trafen.
»Ihr könnt Euch vielleicht die Mühe ersparen, ein Floß zu bauen, rief ihnen Max Huber entgegen.
– Und warum? fragte der Foreloper.
– Weil hier schon eines fix und fertig liegt. Es ist freilich nicht im besten Zustand, die einzelnen Stücke davon sind aber noch recht gut erhalten.«
Max Huber wies dabei in einer Einbuchtung des Ufers auf eine Art Plattform hin, eine Vereinigung von Pfählen und Planken, zusammengehalten durch ein halbverfaultes Tau, dessen freies Ende an einem Pfahle auf dem Lande befestigt war.
»Ah… ein Floß! rief John Cort erfreut.
– Ja, wahrhaftig… ein Floß!« bestätigte Khamis.
Ueber die Bestimmung dieser Pfähle und Planken konnte in der That kein Zweifel herrschen.
»So sind also doch schon Eingeborne auf dem Flusse bis an diese Stelle gekommen? bemerkte Khamis.
– Eingeborne oder Forschungsreisende, antwortete John Cort.
Und doch, wenn dieser Theil des Waldes schon besucht worden wäre, hätte man am Congo oder in Kamerun davon doch etwas wissen müssen.
– Im Grunde kann uns das ja gleichgiltig sein, ließ sich Max Huber vernehmen, die Hauptsache bleibt doch, ob wir uns dieses Flosses bedienen können.
– O, gewiß!«
Der Foreloper ließ sich schon nach der Wasserfläche der Einbuchtung hinabgleiten, als ein Ausruf Llangas ihn zurückhielt.
Der Knabe, der etwa fünfzig Schritt am Flusse hinunter gelaufen war, kam eben zurück und schwenkte einen Gegenstand, den er in der Hand hielt.
Eine Minute darauf übergab er ihn John Cort.
Es war ein von Rost zerfressenes, eisernes Vorlegeschloß, dessen Schlüssel fehlte, und das überhaupt nicht mehr brauchbar erschien.
»Entschieden handelt es sich hier, begann Max Huber, nicht um congolesische oder andere Nomaden, denen die Erzeugnisse der jetzigen Schlosserei ja noch unbekannt sind.
Dieses Floß haben Weiße bis an die Flußbiegung geführt.
– Weiße, die nie wieder hierher zurückgekehrt sind,« setzte Jahn Cort hinzu.
Aus dem Funde ließen sich nun ganz zuverlässige Schlüsse ziehen. Der oxydierte Zustand des Vorlegeschlosses und der theilweise Zerfall des Flosses bewiesen, daß mehrere Jahre vergangen sein mußten, seit das erste verloren und das zweite am Rande der Einbuchtung verlassen worden war.
Aus dieser Thatsache ergaben sich aber folgerichtig zwei weitere Schlüsse. Als John Cort sich darüber aussprach, stimmten Khamis und Max Huber ihm ohne Zögern bei. Seine Folgerungen aber lauteten:
1. Forscher oder andere Reisende, keine Eingebornen, hatten diese Lichtung bereits betreten, nachdem sie ober- oder unterhalb der Grenze des großen Waldes sich auf dem Flosse eingeschifft hatten.
2. Die Betreffenden hatten aus dem einen oder anderen Grunde ihr Floß verlassen, um den Waldestheil am rechten Flußufer zu besichtigen.
Auf jeden Fall war keiner von ihnen wieder hier erschienen.
Doch weder John Cort noch Max Huber erinnerte sich, daß seit ihrem Aufenthalte im Congogebiete jemals von einer Forschungsreise dieser Art die Rede gewesen wäre.
War das nun auch nichts Außerordentliches, so war es wenigstens etwas Unerwartetes, und Max Huber mußte auf die Ehre verzichten, der erste Besucher des mit Unrecht als undurchdringlich angesehenen Waldes gewesen zu sein.
Ohne Beachtung dieser Prioritätsfrage untersuchte Khamis sorgfältig die Pfähle und Planken des Flosses. Die ersten zeigten sich noch in gutem Zustande, die anderen hatten mehr von der Unbill der Witterung gelitten und zwei oder drei davon mußten womöglich durch frische ersetzt werden. Jedenfalls erwies es sich aber unnöthig, ein völlig neues Floß herzustellen. Einige Ausbesserungen des vorliegenden mußten schon genügen. Ebenso befriedigt wie überrascht, besaßen der Foreloper und seine Gefährten jetzt das schwimmende Fahrzeug, das ihnen erlauben sollte, die Ausmündung des Rio zu erreichen.
Während Khamis sich in der erwähnten Weise beschäftigte, tauschten die beiden Freunde ihre Gedanken über den Vorfall aus.
»Es unterliegt keinem Zweifel, wiederholte John Cort, daß bereits Weiße den Oberlauf des Rio untersucht haben… Weiße auf jeden Fall. Das aus rohem Holz erbaute Floß mag ja ein Werk von Eingebornen sein, doch das Vorlegeschloß…
– Das Aufklärung gebende Vorlegeschloß… ohne die anderen Gegenstände zu zählen, die wir viellleicht noch finden… fiel Max Huber ihm in’s Wort.
– Noch weitere… Max?
– Ei, John, es ist doch möglich, daß wir noch Spuren eines Lagers entdecken, wovon hier allerdings nichts zu sehen ist, denn die Grotte dürfen wir nicht für den Platz eines solchen halten. Sie kann nicht als Ruheplatz gedient haben, und ich bin überzeugt, daß wir als die ersten darin Zuflucht gesucht haben.
– Das liegt auf der Hand, Max. Laß uns bis an die eigentliche Flußbiegung gehen.
– Das erscheint um so mehr geboten, John, als dort die Lichtung aufhört, und es sollte mich gar nicht wundern, daß etwas weiter hin…
– Khamis?« rief da John Cort.
Der Foreloper trat an die beiden Freunde heran.
»Nun, wie steht’s mit dem Flosse? fragte John Cort.
– Das wird sich ohne große Mühe ausbessern lassen. Ich werde das dazu nöthige Holz schon herbeischaffen.
– Ehe wir an diese Arbeit gehen, schlug Max Huber vor, wollen wir doch einmal das Ufer noch eine Strecke weit verfolgen. Wer weiß, ob wir dabei nicht Geräthe finden, die uns durch eine Fabrikmarke über ihren Ursprung aufklären.
Diese könnten unsere recht nothdürftige Küchenausrüstung wohl in wünschenswerther Weise vervollständigen… Eine Feldflasche und nicht einmal ein Kochtopf und eine Tasse…
– Oho, Freund Max, Du erwartest doch nicht etwa, ein Speisezimmer und einen Tisch aufzustöbern, der schon für Vorüberkommende gedeckt wäre?
– Ich erwarte gar nichts, John, wir stehen aber hier vor unaufgeklärten Thatsachen. Versuchen wir wenigstens, eine annehmbare Erklärung zu finden.
– Zugegeben. Max. Es steht doch dem nichts entgegen, Khamis, daß wir noch einen Kilometer weiter hinuntergehen?
– Vorausgesetzt, daß Sie die Flußbiegung nicht überschreiten, antwortete der Foreloper. Da uns jetzt Gelegenheit geboten ist, auf dem Wasser zu fahren, wollen wir unnöthige Wanderungen doch lieber unterlassen.
– Richtig, Khamis, stimmte John Cort ihm zu. Später, wenn unser Floß mit der Strömung hinabgeleitet, können wir ja mühelos darauf achten, ob sich an dem einen oder dem anderen Ufer noch Spuren eines Lagers zeigen.«
Die drei Männer und Llanga folgten nun dem erhöhten Ufer, einer Art Deich zwischen dem Sumpflande und dem Flusse.
Schaaren von Vögeln, meist Wildenten und Trappen, flatterten bei ihrer Annäherung rauschenden Fluges davon Unterwegs erlegte Max Huber auf den ersten Schuß einen großen sogenannten Strandreiter, der zum Mittagsmahle dienen sollte.
Unausgesetzt behielten die Wanderer den Erdboden im Auge, um vielleicht menschliche Fußtapfen oder irgend einen zurückgelassenen Gegenstand zu entdecken.
Trotz gespanntester Aufmerksamkeit wurde jedoch oben und unten am Ufer gar nichts gefunden. Nirgends verrieth ein Anzeichen, daß hier jemand vorübergekommen wäre oder gerastet hätte. Als Khamis und seine Gefährten wieder die ersten Baumreihen erreicht hatten, wurden sie von dem Geschrei einer Affenbande begrüßt. Die Vierhänder schienen über das Auftauchen von Menschen nicht besonders verwundert zu sein, obwohl sie sich aus dem Staube machten.
Daß in den Baumkronen hier Vertreter der großen Affenfamilie hausten, war ja zu erwarten.
Es waren das Paviane und Mandrillassen, die äußerlich den Gorillas nahe stehen, ferner Schimpansen und einzelne Orang Utangs. Wie alle afrikanischen Arten, hatten sie einen kaum entwickelten Schwanz, der sich voll ausgebildet nur bei den amerikanischen und asiatischen Arten findet.
»Jedenfalls, bemerkte John Cort, haben diese Burschen das Floß nicht gezimmert, und trotz ihrer Intelligenz werden sie sich noch nie eines Vorlegeschlosses bedient haben.
– So wenig wie eines Käfigs, setzte Max Huber hinzu.
– Eines Käfigs, Max? wiederholte John Cort. Wie kommst Du denn darauf?
– Ich glaube dort… unter dem Dickicht… etwa zwanzig Schritt vom Ufer, ein solches Ding zu erkennen.
– Das wird ein Ameisenhaufen in der Form eines Bienenkorbes sein, erwiderte John Cort, wie die afrikanischen Ameisen solche erbauen.
– Nein, Herr Huber hat sich nicht getäuscht, ließ sich Khamis vernehmen. Da unten steht… man könnte es fast eine Hütte nennen, die zwischen zwei Mimosen steht und an der Vorderseite ein Gitter hat.
– Käfig oder Hütte, rief John Cort, wir wollen uns überzeugen, was die Sache zu bedeuten hat!
– Doch vorsichtig, rieth der Foreloper, immer unter der Deckung der Bäume hingehen.
– O, was hätten wir denn hier zu fürchten?« erwiderte Max Huber, der sich wie gewöhnlich vor Neugier und Ungeduld nicht halten konnte.
Die Umgebung schien übrigens gänzlich öde und verlassen zu sein, nur der Gesang von Vögeln und das Geräusch von dem fliehenden Affenvolke ließ sich noch hören. Am Rande der Lichtung zeigte sich keine ältere oder jüngere Spur eines Lagers, und auf dem Wasserlaufe, der große Bündel Gras mit hinabführte, ebensowenig irgend etwas verdächtiges. Auch auf der anderen Seite dieselbe Stille und Verlassenheit. So wurden denn die letzten hundert Schritte schnell am Ufer hin zurückgelegt, das sich entsprechend der Windung des Flusses allmählich krümmte. Hier war es mit dem Morast zu Ende und der Boden wieder trockener und fester, je mehr er unter dem Hochwald anstieg.
Das seltsame, jetzt zu drei Vierteln sichtbare Bauwerk lehnte sich an zwei Mimosen und hatte ein schräg abfallendes, mit vergilbten Gräsern bedecktes Dach. Eine seitliche Oeffnung war daran nicht zu bemerken, und tiefhängende Lianen verbargen seine Wände fast bis zur Erde hinunter. Was ihm das Aussehen eines Käfigs verlieh, war das Gitter oder vielmehr die Vergitterung der ganzen Vorderseite, die der ähnelte, die man in Menagerien zur Trennung der Raubthiere vom Publicum sieht.
Dieses Gitter hatte eine, jetzt offenstehende Thür.
Der Käfig selbst war leer.
Das meldete Max Huber, der als der erste hineingedrungen war.
Doch fanden sich einige Geräthe: ein Kochtopf in ziemlich gutem Zustande, eine Art Flaschenkorb, eine Tasse, drei oder vier zerbrochene Flaschen, eine sehr abgenutzte Wollendecke, Stoffsetzen, eine verrostete Axt und ein halbvermodertes Brillenfutteral, auf dem aber kein Name eines Fabrikanten zu lesen war.
In einer Ecke lag noch ein kupferner Kasten, dessen Deckel so dicht schloß, daß sein Inhalt – wenn er überhaupt etwas enthielt – unversehrt erhalten sein mußte.
Max Huber hob den Behälter auf und versuchte, ihn zu öffnen. Das gelang ihm aber nicht. Durch Oxydation hingen die beiden Theile des Kastens ziemlich fest aneinander.
Er mußte erst eine in den Spalt gedrängte Messerklinge als Hebel benutzen, ehe der Deckel nachgab.
Der Kasten enthielt ein völlig unversehrtes Notizbuch, auf dessen Vorderseite zwei Worte gedruckt waren, die Max Huber mit lauter Stimme verkündete:
»Doctor Johausen«.
Achtes Capitel.
Der Doctor Johausen
Wenn John Cort, Max Huber und selbst Khamis bei der Nennung dieses Namens keinen Ausruf der Verwunderung hören ließen, lag das nur daran, daß sie augenblicklich der Sprache beraubt waren.
Der Name Johausen hatte für sie die Bedeutung einer Offenbarung. Er enthüllte einen Theil des Geheimnisses, das eine der tollsten wissenschaftlichen Unternehmungen der neueren Zeit, in der sich die Komik mit dem Ernste, ja sogar mit der Tragik vermischte, bisher noch umgab, denn es ließ sich jetzt annehmen, daß diese ein sehr trauriges Ende genommen haben müsse.
Vielleicht erinnert sich der Leser des Versuches, den der Amerikaner Garner wagte, indem er die Sprache der Affen ergründen und seine Theorien durch ein Experiment bekräftigen wollte. Der Name dieses Professors, die in Hayser’s Weekly in New York von ihm erschienenen Aufsätze, sein Buch, das in England, Deutschland, Frankreich und Amerika herausgegeben worden war… alles das konnten die Bewohner des Congogebietes – vor allem John Cort und Max Huber – nicht wohl vergessen haben.
»Da haben wir ihn ja, rief der eine, ihn, von dem nie wieder eine Nachricht auftauchte…
– Und man auch nie eine erhalten wird, da er nicht zur Stelle ist, uns eine solche zu geben!« rief der andere.
Er, das war für den Franzosen wie für den Amerikaner der Doctor Johausen. Der Doctor hatte in dem genannten Garner freilich einen Vorläufer gehabt. Dieser Yankee konnte nicht, wie Jean Jacques Rousseau in der Einleitung zu seinen Confessions sagen: »Ich unternehme hier etwas, wofür es noch kein Beispiel giebt, und das auch keine Aachahmer haben wird.« Garner sollte einen solchen finden.
Ehe der Professor Garner den Schwarzen Erdtheil betrat, hatte er sich mit der Welt der Affen – natürlich der gezähmten
– eingehend beschäftigt. Aus seinen langen und sorgsamen Beobachtungen schöpfte er die Ueberzeugung, daß die Vierhänder wirklich »sprächen«, daß sie einander verständen, sich einer articulierten Sprache bedienten und z. B. ganz bestimmte Wörter gebrauchten, um ihr Bedürfniß zu fressen, und bestimmte andere, um das Bedürfniß zu saufen auszudrücken. Garner hatte im Washingtoner Zoologischen Garten phonographische Apparate vertheilt, um die Wörter dieser Sprache aufzunehmen. Er beobachtete auch, daß die Affen – ungleich den Menschen – nur sprachen, wenn dazu eine Nothwendigkeit vorlag. Seine Ansicht darüber drückte er in folgendem Satze aus:
»Die Kenntnisse, die ich mir über die Thierwelt erworben habe, nöthigten mir den Glauben auf, daß allen Säugethieren die Fähigkeit zu sprechen zukomme, und zwar bis zu dem Grade, wie ihre Erfahrungen und Bedürfnisse eine solche erheischen.«
Vor den Untersuchungen Garner’s wußte man ja schon, daß die Säugethiere, wie Hunde, Affen und andere, einen laryngo-buccalen Apparat (Kehlkopf- und Mundorgane) haben, der dem des Menschen ähnelt, und auch eine Stimmritze, die zur Hervorbringung articulierter Laute geeignet erscheint. Man wußte aber auch – möge sich die Schule der Simiologen deshalb nicht aufregen – daß der Gedanke dem Worte vorausgegangen ist. Um zu reden, muß man denken können, und das Denken setzt die Fähigkeit des Generalisierens voraus, eine Fähigkeit, die den Thieren offenbar abgeht. Der Papagei spricht, er versteht aber kein Wort von dem, was er sagt. Kurz, in Wahrheit reden die Thiere nur deswegen nicht, weil die Natur sie nicht mit hinreichender Intelligenz ausgestattet hat, denn sonst würde sie nichts daran hindern. Allgemein gilt ja der Satz, den ein gelehrter Kritiker ausgesprochen hat: »Wo eine Sprache sein soll, da muß auch Ueberlegung und wenigstens einigermaßen begründetes Urtheil sein, und zwar über einen abstracten und allgemeinen Begriff« Diese dem gesunden Menschenverstande entsprechende Voraussetzung wollte Garner aber nicht anerkennen.
Selbstverständlich wurde seine Lehre vielfach erörtert. Er entschloß sich, mit den betreffenden Geschöpfen, die er in den Wäldern des tropischen Afrika in großer Zahl und großer Verschiedenheit finden mußte, unmittelbar in Berührung zu treten. Wenn er dann dem Gorilla und dem Schimpansen ihre Sprache abgelauscht hätte, wollte er nach Amerika heimkehren und neben einer Grammatik ein Wörterbuch der Affensprache veröffentlichen. Dann müßte man, solchen greifbaren Beweisen gegenüber, ihm wohl recht geben.
Hat Garner nun das sich selbst und der Gelehrtenwelt gegebene Versprechen gehalten?… Das war die Frage, und –darüber konnte kein Zweifel aufkommen – Doctor Johausen glaubte das, wie es sich im weiteren zeigen wird, offenbar nicht.
Im Jahre 1892 begab sich Garner von Amerika nach Afrika, erreichte Libreville am 12. October und nahm bis zum Februar 1894 in der Factorei von John Holland und Cie. Wohnung. Erst hier entschloß sich der Professor eigentlich, seine Studienreise zu beginnen. Nachdem er den Oguë auf einem kleinen Dampfer hinausgefahren war, ging er bei Lambarana an’s Land und langte am 22. April in der katholischen Mission von Fernand Vaz an.
Gastfreundlich nahmen ihn die Väter vom heiligen Geist in ihrem am Ufer des prächtigen Fernand Vazsees errichteten Hause auf. Der Gelehrte hatte die Zuvorkommenheit der Insassen der Mission nur zu rühmen, denn alle bemühten sich, ihm sein abenteuerliches zoologisches Unternehmen zu erleichtern.
Gleich hinter der Niederlassung erhoben sich die ersten Bäume eines ausgedehnten Waldes, worin es von Affen geradezu wimmelte. Günstigere Verhältnisse, sich mit diesen in Verkehr zu setzen, konnte man sich gar nicht vorstellen.
Nothwendig war nur, sich mit den Vierhändern auf guten Fuß zu stellen und ihre Lebensweise so gut wie möglich zu theilen.
Zu diesem Zwecke hatte Garner einen eisernen, zerlegbaren Käfig anfertigen lassen, und dieser wurde nun in den Wald geschafft. Angeblich hat er darin drei Monate und auch meist ganz allein gewohnt, um die Vierhänder im Naturzustande zu beobachten.
Thatsächlich hatte der vorsichtige, kluge Amerikaner dafür eine Stelle gewählt, die nur zwanzig Minuten von der Wohnstätte der Patres und nahe dem Brunnen der Mission gelegen war, und hatte sein metallenes Haus das Fort Gorilla genannt. Nach diesem gelangte man auf einem schattigen Wege. Hier hat er sogar drei Nächte geschlafen. Verzehrt von Myriaden von Moskitos, konnte er es daselbst aber nicht lange aushalten. So brach er denn seinen Käfig wieder ab und nahm aufs neue die Gastfreundschaft der Väter vom heiligen Geist in Anspruch, die ihm ohne Widerrede bewilligt wurde. Am 18.
Juni verließ er dann endgiltig die Mission und kehrte über England nach Amerika zurück, wobei er als einzige Andenken von seiner Reise zwei kleine Schimpansen zurückbrachte, die sich leider nicht bewegen ließen, mit ihm zu plaudern.
Das war der ganze Erfolg der Garner’schen Studienreise.
Erwiesen war dadurch nur das eine, daß das Patois der Affen, wenn es überhaupt ein solches giebt, noch ebenso zu entdecken war, wie die betreffenden Lebensäußerungen, die in der Gestaltung ihrer Sprache eine Rolle spielten.
Der Professor behauptete freilich, es sei ihm gelungen, mehrere Affenworte von bestimmter Bedeutung erlauscht zu haben, z. B. »Whuri« gleich Futter, »Cheny« gleich Getränk,
»Jegk« gleich Achtung! und einige andere. Später versicherte er, auf Grund sorgfältiger, im Washingtoner Zoologischen Garten angestellter und mit Hilfe des Phonographen gleichsam fixierter Beobachtungen, überdies, daß er auch ein Wort von ganz allgemeiner Bedeutung erkannt habe, ein Wort, das etwa
»Nahrung«, d. h. alles, was eß- oder trinkbar wäre, ausdrückte, ferner eines, das sich auf den Gebrauch der Hände bezöge, und eines, das auf eine gewisse Messung der Zeit hinauskäme.
Seinen Erfahrungen nach bestand diese Thiersprache aus acht oder neun Grundlauten mit dreißig bis fünfunddreißig daraus abgeleiteten Lauten, deren musikalische Lage er sogar angab, und die meist in Aïs-moll ausgesprochen würden. Kurz, seiner Meinung nach könnte man, in Uebereinstimmung mit der Darwin’schen Lehre von der Einheit der ganzen Schöpfung und der Vererbung physischer Eigenschaften, nicht der Mängel, etwa den Satz aufstellen: »Wenn das Geschlecht der Menschen aus dem der Affen hervorgegangen ist, warum sollte die menschliche Sprache nicht nur eine Weiterentwicklung der unvollständigen Sprache dieser Anthropoïden sein?« Dabei bleibt nur die Frage bestehen, ob die Affen wirklich die Ahnen der Menschen seien. Das hätte bewiesen werden müssen, ist aber bisher nicht erwiesen worden.
Die von dem Naturforscher Garner vermuthete und von ihm ergründete Sprache der Affen kam also auf weiter nichts hinaus, als auf eine Reihe von Lauten, die diese Säugethiere ausstoßen, um sich ihresgleichen mitzutheilen, wie das allen Thieren, Hunden, Pferden, Schafen, Gänsen, Schwalben, Bienen, Ameisen u. s. w. möglich ist. Nach der Angabe des Beobachters erfolgt diese Art der Mittheilung entweder durch ein Geschrei oder durch Zeichen oder bestimmte Bewegungen, und wenn dadurch auch keine eigentlichen Gedanken zum Ausdrucke gelangen, so verdeutlichen sie doch äußerlich einzelne seelische Empfindungen, wie die der Freude oder des Erschreckens.
Es lag also auf der Hand, daß die vorliegende Frage durch die unvollkommenen Beobachtungen und Experimente des amerikanischen Professors ihrer Lösung keinen Schritt näher gerückt war. Da kam zwei Jahre später einem deutschen Arzte der Gedanke, den Versuch Garner’s zu wiederholen, und er begab sich dazu aber mitten hinein in den Wald und in die Welt der Vierhänder, auch nicht nur zwanzig Minuten weit von einer Mission, selbst auf die Gefahr hin, eine Beute der Moskitos zu werden, denen die simiologische Leidenschaft Garner’s zu trotzen nicht stark genug gewesen war.
Jener Zeit wohnte in Kamerun, und zwar in Malinba, ein Gelehrter Namens Johausen. Er hatte hier bereits einige Jahre geweilt. Es war eigentlich ein Arzt, doch ein Mann, der sich mehr zur Zoologie und Botanik als zur Heilkunde hingezogen fühlte. Als er von dem erfolglosen Versuche des Professor Garner Kunde erhielt, reiste in ihm – obwohl er die Fünfzig schon überschritten hatte – der Entschluß, das Unternehmen zu wiederholen. John Cort hatte in Libreville wiederholt Gelegenheit gehabt, mit dem Manne zu sprechen.
War der Doctor Johausen auch kein Jüngling mehr, so erfreute er sich doch einer vortrefflichen Gesundheit. Englisch und Französisch verstand er wie seine Muttersprache und war, infolge seiner Thätigkeit als Arzt, auch der Sprache der Eingebornen einigermaßen mächtig. Seine
Vermögensverhältnisse gestatteten ihm, auch ohne Entlohnung thätig zu sein, denn er hatte weder directe Angehörige, noch erbberechtigte Verwandte. Unabhängig im weitesten Sinne des Wortes, keinem Menschen für sein Thun und Lassen verantwortlich und von unerschütterlichem Selbstvertrauen erfüllt, konnte er sich ja unbedenklich zu einem so gewagten Schritte entschließen. Immerhin gehört hierzu die Bemerkung, daß es bei dem seltsamen Manne – wie man zu sagen pflegt –im Oberstübchen nicht ganz richtig zu sein schien.
Als Diener hatte der Doctor einen Eingebornen, mit dem er außerordentlich zufrieden war. Als dieser die Absicht seines Herrn, im Walde mitten unter den Affen zu leben, vernahm, zögerte er keinen Augenblick, den Arzt zu begleiten. Er mochte aber wohl kaum wissen, was er damit auf sich nahm.
Der Doctor Johausen und sein Diener gingen nun unverzüglich an die Arbeit. Mit einem Frachtschiffe, das Malinba anlief, traf ein in Deutschland bestellter, zerlegbarer Käfig ein, der zwar dem Garner’s ähnelte, doch fester und bequemer benutzbar als jener war. In der Hafenstadt war es leicht, genügende Mundvorräthe zu erwerben, wie Conserven und andere, und auch so viele Munition, daß eine Vervollständigung der Ausrüstung für einen langen Zeitraum unnöthig erschien. Die im übrigen sehr einfache Ausstattung an Bett- und Leibwäsche, Kleidung, Küchengeräthen u. dergl.
wurde dem Hause des Doctors entnommen, und ebenso eine alte Drehorgel, in der Hoffnung, die Affen könnten für die Reize der Musik vielleicht nicht unempfänglich sein.
Gleichzeitig ließ Johausen eine große Menge Medaillen aus Nickel anfertigen, die auf der einen Seite seinen Namen, auf der anderen sein Bildniß zeigten, und die er unter den höherstehenden Mitgliedern der Affencolonie, die er zu gründen gedachte, zur Vertheilung bringen wollte.
Der Arzt und der Eingeborne schifften sich endlich am 13.
Februar 1896 in Malinba mit allem Zubehör auf einer Barke des Nbarri ein und fuhren den Fluß hinauf, um später nach…
Ja, wohin denn zu gehen? Das hatte der Doctor keinem Menschen sagen wollen. Da seine Bedürfnisse für lange Zeit gedeckt waren, schützte er sich damit am besten gegen Störungen durch Unberufene. Der Eingeborne und er würden sich schon selbst genug sein. Das verhinderte auch jede Störung und Ablenkung der Vierhänder, die er sich als einzige Gesellschaft wünschte, und er hoffte, sich mit ihrem Geplauder zu begnügen, überzeugt, daß es ihm gelingen werde, die Geheimnisse der Makakensprache zu entschleiern.
Später erfuhr man nur, daß die Barke, nach etwa hundert Lieues langer Fahrt auf dem Nbarri, bei dem Dorfe Nghila vor Anker gegangen war. Dort waren gegen zwanzig Schwarze als Träger angenommen worden und der ganze Zug hatte sich von dem Dorfe aus nach Osten hin gewendet. Von dieser Stunde an war von dem Doctor Johausen aber nichts mehr zu hören gewesen. Die nach Nghila zurückgekehrten Träger hatten auch die Stelle nicht genau angeben können, wo sie sich von dem Doctor verabschiedet hatten. Kurz, auch nach zwei Jahren und trotz wiederholten, leider erfolglosen Nachsuchungen, hatte von dem deutschen Arzte und seinem treuen Diener keine Silbe wieder verlautet.
Was nun inzwischen vorgegangen war, konnten John Cort und Max Huber jetzt, wenigstens theilweise, erkennen und feststellen.
Der Doctor Johausen hatte mit seiner Begleitmannschaft einen Fluß im Nordwesten des Waldes von Ubanghi erreicht gehabt. Dann hatte er nach Zurücksendung der Eingebornen, die Herrichtung eines Flosses begonnen, für das er die Planken und Pfähle seinen Vorräthen entnahm. Nach Vollendung dieser Arbeit waren sein Diener und er den Lauf des unbekannten Flusses hinausgefahren und hatten ihre Käfigwohnung an der Stelle errichtet, wo sie hier unter den ersten Bäumen des rechten Ufers entdeckt worden war.
Soweit herrschte über die Angelegenheit des gelehrten Forschers also einige Gewißheit. Bezüglich alles weiteren waren freilich nur Vermuthungen aufzustellen. Warum mochte der Käfig denn leer sein?… Warum hatten seine beiden Bewohner ihn verlassen?… Wie viele Monate, Wochen oder Tage war er bewohnt gewesen? Darüber ließ sich gar nichts urtheilen. Waren die zwei Männer fortgeschleppt worden?…
Durch wen denn?… Durch Eingeborne?… Der Wald von Ubanghi galt aber doch für unbewohnt. Sollte man annehmen, daß sie vor einem Anfalle durch Raubthiere entflohen wären?… Lebten der Doctor Johausen und der Eingeborne überhaupt noch heute?
Alle diese verschiedenen Fragen drängten sich den beiden Freunden auf. Leider konnten sie für keine Vermuthung eine annehmbare Erklärung geben, und so verloren sie sich immer mehr in die Dunkelheit des Geheimnisses.
»Wir wollen doch in dem Notizbuche nachsehen, schlug John Cort vor.
– Ja, das ist das einzige, was uns übrig bleibt, sagte Max Huber. Vielleicht können wir, wenn es auch keine ausführlichen Mittheilungen enthält, schon aus etwaigen Zeitangaben weitere Schlüsse ziehen.«
Max Huber schlug das Notizbuch auf, in dem einige Blätter, die feucht geworden waren, aneinander klebten.
»Ich glaube nicht, daß dieses Buch uns besonderen Aufschluß geben wird, bemerkte er.
– Warum denn?
– Weil alle Seiten darin, mit Ausnahme der ersten, unbeschrieben sind.
– Nun… und diese erste Seite, Max?…
– Die enthält einige abgerissene Sätze, auch einige Datumangaben, wahrscheinlich bestimmt, dem Doctor Johausen später bei der Abfassung eines Reiseberichtes zu dienen.«
Max Huber gelang es, wenn auch mit einiger Schwierigkeit, die folgenden, mit Bleistift geschriebenen Zeilen zu entziffern.
»29. Juli 1896. – Mit den Trägern und meinem Diener am Rande des Waldes von Ubanghi eingetroffen. – Gelagert am rechten Ufer eines Flusses. – Unser Floß gebaut.
»3. August.
– Das Floß fertig gestellt.
– Die
Begleitmannschaft nach Nghila zurückgeschickt. – Mit meinem Diener eingeschifft.
»9. August. – Den Fluß sechs Tage lang ohne Hinderniß befahren… Bei einer Lichtung angehalten. – Viele Affen in der nächsten Umgebung. – Die Stelle scheint recht passend zu sein.
»13. August. – Unsere Einrichtung vollendet. – Die Käfighütte bezogen. – Die Nachbarschaft völlig menschenleer.
– Auch keine Spuren oder Fährten von Eingebornen oder anderen. – Wasserwild im Ueberfluß. – Der Fluß sehr fischreich. – In der Hütte bei einem schlimmen Wetter gut geschützt.
»25. August. – Siebenundzwanzig Tage verflossen. – Unser Leben regelmäßig geordnet. – Einige Hippopotamusse im Wasser, doch kein Angriff durch diese. – Elenthiere und Antilopen erlegt. – In der Nacht drängen sich große Affen an die Hütte heran. – Welcher Art sie angehören, habe ich noch nicht zu erkennen vermocht. Einmal auf dem Boden umherlaufend und einmal in den Baumkronen hin und her springend, zeigen sie doch keine feindlichen Absichten. – Habe etwa hundert Schritte weit von hier einen Feuerschein unter dem Hochwalde wahrzunehmen geglaubt. Merkwürdig! Diese Affen scheinen zu sprechen, mit einander zusammenhängende Worte zu wechseln! Ein kleiner hat »Ngora! Ngora! Ngora!« gerufen, ein Wort, worunter die Eingebornen doch »Mutter« verstehen.«
Llanga hatte aufmerksam zugehört, als sein Freund Max das Vorstehende verlas; jetzt rief er plötzlich mit lauter Stimme:
»Jawohl… jawohl! Ngora, ngora… Mutter… ngora… ngora!«
Als er dieses von dem Doctor Johausen gebrauchte und von dem Knaben wiederholte Wort vernahm, mußte sich John Cort doch unwillkürlich erinnern, daß dasselbe Wort ihm vorige Nacht ebenfalls zu Ohren gekommen war. Da er das aber für eine Gehörtäuschung, für einen Irrthum hielt, hatte er den anderen überhaupt nichts davon gesagt. Nach der eben gehörten Beobachtung des Doctors glaubte er sie aber doch über diesen Vorfall unterrichten zu müssen. Da rief eben Max Huber:
»Wahrlich, sollte der Professor Garner doch recht haben? Es gäbe sprechende Affen?…
– Ich kann Dir, lieber Max, nur sagen, daß auch ich das Wort
»Ngora« schon einmal zu hören bekommen habe!« erklärte John Cort.
Er erzählte nun, unter welchen Umständen dieses Wort in der Nacht vom 14. zum 15. als er die Wache gehabt habe, mit einer kläglichen Stimme ausgesprochen worden sei.
»Seh’ einer, rief Max Huber, das wäre ja fast etwas außerordentliches!
– Hast Du denn nicht nach solchem verlangt, bester Freund?« erwiderte John Cort.
Khamis hatte die Vorlesung ebenfalls mit angehört. Was aber den Franzosen und den Amerikaner im höchsten Grade interessierte, das ließ ihn einfach kalt. Was kümmerte er sich um Geschichten, die allein den Doctor Johausen etwas angingen! Ihm war es die Hauptsache, daß der Doctor ein Floß gebaut hatte, das er sich zu nutze machen konnte, und höchstens achtete er noch auf die Geräthe, die sich in dem verlassenen Käfig vorfanden. Der Foreloper begriff gar nicht, daß man danach fragen könne, was aus dem Arzte und seinem Diener geworden sei, noch weniger, daß es jemand in den Sinn kommen könne, sich zur Verfolgung seiner Spur in den großen Wald hineinzuwagen, auf die Gefahr hin, so wie jene beiden verschleppt zu werden. Wenn Max Huber und John Cort dann wirklich vorschlügen, nach den beiden Verschwundenen zu suchen, wollte er alles daransetzen, ihnen das auszureden und sie zu erinnern, daß ihnen nichts anderes obliege, als den Rückweg, und zwar auf dem Wasserlaufe bis zum Ubanghi hinunter, ohne Zögern fortzusetzen.
Vernünftigerweise war ja wohl auch anzunehmen, daß keine Nachsuchung von Erfolg gekrönt sein werde. Man wußte ja nicht einmal, in welcher Richtung man den deutschen Arzt suchen sollte. Wenn noch irgend eine Andeutung dafür vorhanden gewesen wäre, würde es John Cort für eine Menschenpflicht gehalten haben, einem jedenfalls Unglücklichen Hilfe zu bringen, und auch Max Huber hätte sich vielleicht für das von der Vorsehung erwählte Werkzeug gehalten, das den Verschwundenen retten solle. Doch nichts…
nichts als die abgerissenen Sätze des Notizbuches, das den letzten Eintrag vom 25. August enthielt, sonst nichts als weiße Blätter, die sorgsam bis zum letzten besichtigt wurden.
Ueber den Befund bemerkte John Cort:
»Ganz zweifellos ist der Doctor an einem neunten August an diese Stelle gekommen und seine Aufzeichnungen hören mit dem fünfundzwanzigsten desselben Monats auf. Hat er seit diesem Tage nichts mehr niedergeschrieben, so liegt das offenbar daran, daß er seine, von ihm nur sechzehn Tage bewohnte Hütte aus dem einen oder anderen Grunde verlassen hat.
– Jawohl, setzte Khamis hinzu, und es ist gar nicht zu ahnen, was aus ihm geworden sein mag.
– Das thut nichts, fiel der Max Huber ein. Ich bin zwar nicht neugierig…
– Oho, werther Freund, das bist Du in hohem Grade.
– Na, meinetwegen, John, um aber hinter dieses Räthsel zu kommen…
– Wollen wir sofort weiterziehen,« begnügte sich der Foreloper zu sagen.
Thatsächlich war es ja auch gerathen, damit nicht zu zögern, vielmehr mußte das Floß flott gemacht werden, um die Gesellschaft den Fluß hinunter zu tragen. Erschien es später angezeigt, eine Nachforschung nach dem Doctor Johausen zu unternehmen, so konnte das jedenfalls unter günstigeren Verhältnissen geschehen, und beiden Freunden stand es dann frei, daran theilzunehmen oder nicht.
Noch bevor alle den Käfig verließen, sah sich Khamis aufmerksam überall darin um, ob sich nicht irgend ein für sie brauchbarer Gegenstand vorfände, den man, ohne sich darüber Gedanken zu machen, mitnehmen könnte, denn es war ja kaum anzunehmen, daß der Eigenthümer noch nach zweijähriger Abwesenheit zurückkehren könnte, um hier zurückgelassene Dinge zu holen.
Die recht dauerhaft construierte Hütte bot übrigens auch noch heute ein vortreffliches Obdach. Das mit einer Strohlage bedeckte Zinkdach hatte den Unbilden der schlechten Jahreszeit sehr gut widerstanden. Die vergitterte Vorderseite war nach Osten gerichtet und deshalb den stürmischeren Winden weniger ausgesetzt. Wahrscheinlich hätte sich auch die gesammte Ausstattung an Lagerstätten, Tischen, Stühlen und Kisten und Kasten unversehrt erhalten, wenn sie nicht – und das erschien unerklärlich – von hier fortgeschafft worden wäre.
Nach Verlauf dieser zwei Jahre hätten aber doch einige Ausbesserungen vorgenommen werden müssen. Die Planken der Seitenwände klafften da und dort von einander und der untere Theil der Pfähle saß nur noch locker in dem feuchten Erdreich, auch bemerkte man schon Anzeichen von Verfall unter dem Geflecht der Lianen und des aufgerankten Grüns.
Khamis und seine Gefährten hatten natürlich keine Veranlassung, hier eine bessernde Hand anzulegen, es war ja auch gar nicht anzunehmen, daß später einmal noch ein weiterer Liebhaber der Simiologie sie als willkommenes Obdach benutzen würde. Die Käfighütte wurde also in ihrem dermaligen Zustande belassen.
Sollte sie aber nicht noch weitere Gegenstände bergen, als den Kochtopf, die Tasse, das Brillenfutteral und den von den beiden Freunden gefundenen Metallkasten mit dem Notizbuche? Khamis suchte sorgsam nach… nichts fand sich mehr, keine Waffen, Geräthe, Kasten, keine Conserven oder Kleidungsstücke. Der Foreloper wollte schon mit leeren Händen abziehen, als an einer Ecke rechts im Hintergrunde der Fußboden bei seinem Auftreten einen metallischen Klang gab.
»Halt, hier steckt noch etwas, sagte er.
– Vielleicht ein Schlüssel? fragte Max Huber.
– Was denn für ein Schlüssel? rief John Cort.
– O, bester Freund… der Schlüssel des Geheimnisses!«
Ein Schlüssel war es zwar nicht, wohl aber ein Kasten aus Eisenblech, den man an dieser Stelle eingesenkt hatte und den Khamis jetzt heraushob. Er schien unbeschädigt zu sein, und nicht ohne große Befriedigung entdeckte man, daß er etwa hundert Patronen enthielt.
»Schönen Dank, lieber Doctor, rief Max Huber, möge es uns vergönnt sein, Ihnen den Dienst, den Sie uns heute leisten, mit Zinsen zu vergelten!«
In der That, das war ein werthvoller Dienst, denn die Patronen erwiesen sich völlig passend für die Gewehre des Forelopers und seiner zwei Gefährten.
Jetzt war nichts anderes mehr zu thun, als nach der Haltestelle zurückzukehren und das Floß in brauchbaren Zustand zu setzen.
»Vorher wollen wir uns aber doch noch überzeugen, schlug John Cort vor, ob sich in der Umgebung wirklich gar keine Spuren von dem Doctor Johausen und seinem Diener zeigen.
Möglicherweise sind beide von Eingebornen tief in den Wald hinein entführt worden, sie könnten aber auch bei der Vertheidigung den Tod gefunden haben… und wenn sie etwa nicht begraben wären…
– Wär’ es unsere Pflicht, ihnen eine Ruhestätte zu bereiten,« erklärte Max Huber.
Die Nachforschungen in einem Umkreise von hundert Metern blieben ohne Erfolg. Das bestärkte die Annahme, daß der unglückliche Johausen weggeschleppt worden sei, und dann doch nur durch Eingeborne, durch dieselben Wesen, die der Doctor für Affen gehalten hatte, die mit dem Sprachvermögen begabt wären. Wie kam er nur zu der Annahme, daß Vierhänder des Wortes mächtig sein könnten?
»Mindestens deutet das, bemerkte dazu John Cort, auf die gelegentliche Anwesenheit von Nomaden im Walde von Ubanghi hin und mahnt uns zur größten Vorsicht.
– Wie Sie sagen, Herr Cort, stimmte ihm Khamis bei. Nun aber vorwärts nach dem Flosse!
– Ohne zu wissen, was aus dem gelehrten Teutonen geworden ist? erwiderte Max Huber. Wo mag er denn sein?
– Da, wo die Leute sind, von denen man niemals wieder hört, meinte John Cort.
– Ist das eine genügende Antwort, John?
– Wenigstens die einzige, die wir geben können, lieber Max.«
Als alle wieder in der Grotte waren, war es etwa neun Uhr.
Khamis machte sich zuerst an die Zubereitung des Frühstücks.
Jetzt im Besitz eines Kochtopfes, sollte er, auf dringendes Verlangen Max Huber’s, statt gebratenen oder gerösteten Fleisches einmal gekochtes vorsetzen. Das gab doch dem gewohnten Speisezettel eine erwünschte Abwechslung. Dem Verlangen wurde nachgegeben, ein tüchtiges Feuer angezündet, und gegen Mittag erquickten sich die Tischgenossen an einer Suppe, neben der es nur an Brod, Gemüsen und Salz fehlte.
Vor dem Essen arbeiteten aber alle emsig an der Ausbesserung des Flosses und nachher ebenso. Zum Glück hatte Khamis hinter der Hütte einige Planken gefunden, die zum Ersatz derer von der Plattform dienen konnten, die sich angefault und morsch erwiesen. Das ersparte viele Arbeit, zumal bei dem herrschenden Mangel an Werkzeug. Das aus Planken und Pfählen bestehende Bauwerk wurde durch Lianen verbunden, die ebenso fest wie Bandeisen oder wenigstens wie Haltetaue waren.
Das Werk war vollendet, als die Sonne eben hinter dem Baumdickicht des rechten Ufers versank.
Die Abfahrt wurde bis zum frühen Morgen des nächsten Tages verschoben, da es gerathener erschien, die Nacht in der Grotte zuzubringen. Es drohte nämlich schon ein starker Regen, der denn auch etwa von acht Uhr an herunterströmte.
Nachdem sie also die Stelle gefunden hatten, wo der Doctor Johausen sich häuslich eingerichtet gehabt hatte, sollten Khamis und seine Gefährten weiter fahren, ohne zu wissen, was aus dem gelehrten Herrn geworden war… Nichts… nichts verrieth ja eine Spur von ihm! Dieser Gedanke lastete recht schwer auf Max Huber, während sich John Cort leichter damit abfand und der Foreloper davon ganz unberührt blieb. Der Franzose träumte von Pavianen, Affen, Schimpansen, Gorillas, von Mandrill- und von sprechenden Affen, obwohl er zugeben mußte, daß der Doctor nur mit Eingebornen zu thun gehabt haben könne. Und dann gaukelte ihm seine lebhafte Einbildungskraft allerlei geheimnißvolle Bilder vor, unglaubliche Begegnungen, die sich im Herzen des Waldes ereignen sollten, völlig neue Völkerschaften, unbekannte Menschengestalten, unter den großen Bäumen verlorene Dörfer u. dergl. m.
Vor dem Weggange aus der Grotte begann er dann noch:
– »Lieber John und Sie, Khamis, ich habe noch einen Vorschlag auf dem Herzen.
– Und der wäre, Max?
– Doch wenigstens etwas für den Doctor zu thun.
– Aber beileibe nicht etwa nach ihm zu suchen? rief der Foreloper.
– Nein, das nicht, beruhigte ihn Max Huber. Doch seinen Namen wollen wir dem bisher wohl noch ungetauften Wasserlaufe beilegen.«
In Zukunft wird also auf den neuen Karten des äquatorialen Afrika der »Rio Johausen« zu finden sein.
Die Nacht verlief ruhig, und obgleich sie abwechselnd Wache hielten, schlug doch kein einziges Wort an John Cort’s, Max Huber’s oder des Forelopers Ohr.
Neuntes Capitel.
Mit der Strömung des Rio Johausen
Es war genau halb sieben Uhr des Morgens, als am 16. März das Floß abgestoßen wurde, sich von der Uferwand entfernte und bald von der Strömung des Rio Johausen ergriffen wurde.
Noch graute kaum der Tag, doch mußte es bald heller werden. Hoch am Himmel jagten Wolken unter starkem Winde hin. Zwar drohte kein Regen, doch hielt den ganzen Tag über bedecktes Wetter an.
Khamis und seine Gefährten brauchten sich darüber nicht zu beklagen, denn sie trieben jetzt auf einem Flusse hinunter, der den fast senkrechten Strahlen der Mittagssonne meist frei ausgesetzt war.
Das längliche Floß maß nur acht bis neun Fuß in der Breite und gegen zwölf in der Länge, wobei es zur Beförderung von vier Personen und den wenigen Gegenständen, die diese mit sich führten, gerade ausreichte. Das sehr beschränkte
»Frachtgut« bestand nämlich aus dem Metallkasten mit den Patronen, aus den Waffen (drei Gewehren), dem Kessel nebst dem Kochtopfe und der einzigen Tasse. Der drei Revolver mit kleinerem Kaliber als dem der Gewehre würde man sich nur für zwanzig Schuß bedienen können, mehr Patronen hatten Max Huber und John Cort jetzt nicht mehr bei sich. Im allgemeinen konnte man aber doch hoffen, daß es den Jägern bis zum Eintreffen am Ubanghi an Schießbedarf nicht fehlen werde.
Vorn auf dem Flosse und auf einer Schicht Erde lag ein Haufen trockenes Holz, der ja leicht erneuert werden konnte, im Fall, daß Khamis außerhalb der Raststunden einmal Feuerung brauchte. Am anderen Ende gestattete ein kräftiges, aus einer Planke hergestelltes Ruder das Fahrzeug zu steuern oder es mindestens in gleicher Richtung wie die Strömung zu erhalten.
Zwischen den beiden, gegen fünfzig Meter von einander entfernten Ufern verlief diese etwa mit der Geschwindigkeit von einem Kilometer in der Stunde. Dabei mußte das Floß also gegen zwanzig Tage brauchen, die dreihundert Kilometer, die den Foreloper und seine Gefährten noch vom Ubanghi trennten, zurückzulegen.
Ging die Fahrt durchschnittlich auch nicht schneller, als vorher die Wanderung durch den Wald, so war sie wenigstens mit keinerlei Anstrengung verknüpft.
Freilich war ganz und gar nichts bekannt bezüglich etwaiger Hindernisse im weiteren Verlaufe des Rio Johausen. Zunächst erkannte man nur, daß er ziemlich tief war und viele Windungen machte, so daß es einer sorgfältigen Beachtung der Strömung bedurfte. Sollten ihn Wasserfälle oder Stromschnellen unterbrechen, so gedachte der Foreloper nach den gerade gegebenen Umständen zu handeln.
Bis zur Mittagsrast verlief die Fahrt unbehindert. Mit Hilfe des Steuers konnte man den Wirbeln an hervorspringenden Landspitzen aus dem Wege gehen. Dank der Geschicklichkeit Khamisens, der die Lage des Flosses mit kräftigem Arm beherrschte, blieb diesem jedes Anstoßen an das Ufer erspart.
Der auf dem Vordertheile stehende John Cort beobachtete, das Gewehr stets zur Hand, die Uferstrecken in rein kulinarischem Interesse. Er dachte nur daran, für Proviantersatz zu sorgen. Vor seinem scharfen Auge war kein Stück Haar-oder Federwild, das ihm in Schußweite kam, nur noch eine Secunde sicher. Gegen halb zehn bot sich ihm eine Gelegenheit, sich als Jäger zu erproben: seiner Kugel erlag ein sogenannter Wasserbock, eine Antilopenart, die vielfach an Flußufern vorkommt.
»Ein trefflicher Schuß! sagte Max Huber.
– Und doch ein nutzloser, wenn wir uns das Thier nicht holen können, antwortete John Cort.
– Das wird die Sache weniger Minuten sein«, versicherte der Foreloper.
Durch passende Handhabung des Steuers lenkte er das Floß dem Ufer zu, wo der verendete Wasserbock nahe bei einem kleinen Einschnitte lag. Schnell wurde er ausgeweidet und seine nutzbaren Theile nahm man für den kommenden Bedarf mit.
Inzwischen hatte Max Huber sich als erfahrener Fischer bewährt, obwohl ihm nur sehr unzulängliche Angelgeräthe zur Verfügung standen: zwei Bindfadenstücke aus der Hütte Johausen’s, und als Haken daran Stacheln von Akazien mit Fleischstückchen als Köder daran. Da lag wohl die Frage nahe, ob von den Fischen, die sich vielfach dicht unter der Oberfläche des Rio zeigten, auch einer anbeißen werde.
Max Huber war am Steuerbordrande des Flosses niedergekniet, und ihm zur Rechten stehend, verfolgte Llanga sein Vorhaben mit gespannter Aufmerksamkeit.
Offenbar waren die Hechte im Rio Johausen nicht weniger gefräßig als dumm, denn in kürzester Zeit zappelte schon einer an dem ungewöhnlichen Angelhaken. Nachdem der Fisch dadurch, daß man ihn nur Luft schnappen ließ, geschwächt war
– die Eingebornen pflegen einen gefangenen Hippopotamus in ähnlicher Weise zu »lüften« – gelang es Max Huber, ihn mit der Schnur heran- und herauszuziehen. Der Fisch wog mindestens zwischen acht und neun Pfund, und es ist wohl erklärlich, daß die Fahrgäste nicht bis zum nächsten Tage warteten, den Leckerbissen zu verzehren.
Die Mahlzeit gegen Mittag bestand in einem Lendenbraten von dem Wasserbocke und in dem Hechte, von dem nur die Gräten übrig blieben. Zum Abendessen sollte von einem Antilopenviertel eine schmackhafte, kräftige Suppe bereitet werden. Da das dazu verwendete Fleisch aber einige Stunden kochen mußte, zündete der Foreloper auf der erwähnten Erdschicht ein Feuer an und setzte den Kochtopf darauf. Dann ging die Fahrt bis zum Abend ohne Unterbrechung weiter.
Am Nachmittag lieferte der Fischfang keine Ausbeute.
Gegen sechs Uhr hielt Khamis bei einem schmalen, steinigen Uferstreifen an, der von den unteren Aesten eines der zur Abart der Krabahs gehörigen Gummibäume überdacht war.
Zwischen dem Gestein wimmelte es von Schalenthieren, von Miesmuscheln und Austern. Diese vervollständigten, die einen gekocht, die anderen roh, das Abendessen in angenehmster Weise. Mit noch einigen Stücken Brod und dem nöthigen Salz
– freilich fehlte beides – wäre da wirklich nichts zu wünschen übrig gewesen.
Da die Nacht sehr finster zu werden drohte, wollte der Foreloper sich der Strömung heute nicht noch einmal anvertrauen, da der Rio Johausen gelegentlich auch mächtige Baumstämme mit hinabtrug, und der Anprall eines solchen für das Floß zu leicht hätte verderblich werden können. So machte man sich denn auf zusammengerafftem Grase ein Nachtlager am Fuße des Gummibaumes zurecht.
Dank der abwechselnden Ueberwachung durch John Cort, Max Huber und Khamis wurde das Lager auch von keinen zudringlichen Besuchern belästigt. Nur das Geschrei von Affen dauerte vom Sonnenuntergange bis zum Morgengrauen ununterbrochen an.
»Na, daß diese Burschen nicht sprechen, dafür stehe ich ein!«
rief Max Huber, als er am Morgen Gesicht und Hände, die von Moskitos arg zerstochen waren, in das klare Wasser des Rio tauchte.
Heute erfolgte die Abfahrt um eine gute Stunde später, da wieder ein furchtbarer Platzregen niederging. Rathsamer erschien es gewiß, sich dem Wasserströme, den der Himmel so häufig über die Aequatorialgebiete Afrikas ausschüttet, nicht auszusetzen. Die dichte Belaubung des Gummibaumes schützte dagegen bis zu gewissem Grade nicht nur den Lagerplatz, sondern auch das Floß, das an den dicken Wurzeln des Baumes angebunden lag. Die Witterung war übrigens gewitterhafter Natur. Auf dem Flusse bildeten die aufklatschenden Regentropfen kleine, gleichsam elektrisch geladene Blasen.
Ohne daß von hier aus Blitze zu sehen waren, hörte man doch stromaufwärts schon ein dumpfes Donnergrollen. Ein Hagelschlag war nicht zu fürchten; die ungeheueren Wälder Afrikas haben die Eigenschaft, einen solchen auszuschließen.
Der ganze Zustand der Atmosphäre hatte jedoch ein sehr bedenkliches Aussehen, das John Cort zu der Bemerkung veranlaßte:
»Wenn dieser Regen kein Ende nimmt, ist es besser, wir bleiben, wo wir sind. Wir haben jetzt Munition genug, unsere Patronentaschen sind gefüllt, dagegen fehlt es uns an Kleidung zum wechseln…
– Ja, unterbrach ihn Max Huber lachend, warum könnten wir uns denn nicht nach Landesgebrauch – einfach mit Menschenhaut – costümieren? Das vereinfacht doch die Sache gewaltig. Da braucht man nur zu baden, um seine Wäsche zu reinigen und sich gehörig zu reiben, um seine Kleidung abzubürsten!«
Thatsächlich hatten die beiden Freunde schon seit etwa acht Tagen diese Reinigung vornehmen müssen, da sie keine Kleidung zum wechseln besaßen.
Der Platzregen wurde zwar sehr heftig. doch gerade deshalb hielt er nur etwa eine Stunde an. Diese Zeit benutzte man für das erste Frühstück. Dabei erschien auch ein neues, sehr willkommenes Gericht: frische Trappeneier, die Llanga gesammelt hatte und die Khamis sofort im kochenden Wasser hart sott. Auch bei dieser Gelegenheit beklagte sich Max Huber bitter und nicht mit Unrecht, daß Mutter Natur es versehen habe, den Eiern die doch so nothwendige kleine Menge Salz beizumischen.
Gegen halb acht Uhr hörte der Regen auf, doch behielt der Himmel noch weiter sein gewitterhaftes Aussehen. Das Floß wurde nun wieder nach der Mitte des Rio in die Strömung gesteuert.
Die Angelschnüre wurden nachgeschleppt, und da hatten wohl die Fische die Verpflichtung, bald anzubeißen, um noch zur Mittagsmahlzeit zu dienen.
Khamis schlug vor, dazu nicht den gewohnten Halt zu machen, um den eben erlittenen Zeitverlust wieder auszugleichen. Das wurde angenommen; John Cort schürte das Feuer wieder an und bald summte der Kochtopf auf den glühenden Kohlen. Da von dem Wasserbock noch genug übrig war, blieben die Gewehre stumm, wenn Max Huber auch mehr als einmal durch feistes, an den Ufern äsendes Wild arg in Versuchung geführt wurde.
Dieser Theil des Waldes erwies sich überhaupt sehr wildreich. Ohne von den Wasservögeln zu reden, gab es hier auch Wiederkäuer in Menge. Häufig streckten sich die Köpfe von Pallahls und Sassabys – einer Abart der Antilopen – mit ihren mächtigen Hörnern aus dem hohen Grase und dem Gesträuch des Ufers hervor. Wiederholt zeigten sich große Elenthiere, rothbraune Damhirsche, Steinböcke, zierliche Gazellen, Kudus – eine besondere Hirschart Afrikas – Quaggas und selbst Giraffen, die ein sehr schmackhaftes Fleisch liefern.
Wie leicht wäre es gewesen, verschiedene dieser Thiere zu erlegen, doch was hätte es genützt, da es an Nahrung bis zum nächsten Tage ja nicht fehlte. Obendrein verbot es sich, das Floß unnöthig zu bepacken und zu belasten, worauf John Cort seinen Freund besonders aufmerksam machte.
»Ja, ich bitte Dich, entgegnete Max Huber, meine Flinte rutscht mir zuweilen von selbst an die Wange, wenn mir ein so hübsches Ziel vors Auge kommt.«
Das wäre aber immerhin nichts anderes gewesen als ein Schießen, um nur zu schießen, und wenn eine solche Betrachtung einen übereifrigen Jäger auch nicht leicht zu zähmen vermag, so befahl Max Huber seinem Gewehre doch, sich ruhig zu verhalten und sich nicht von selbst in Anschlag zu legen. Durch die Umgebung dröhnte also kein Knall von unzeitgemäßen Schüssen, und friedlich glitt das Floß den Rio Johausen hinunter.
Khamis, John Cort und Max Huber fanden jedoch am Nachmittage Gelegenheit, sich für ihre Zurückhaltung schadlos zu halten; da mußten die Feuerwaffen wieder den Mund aufthun, wenn auch nicht zum Angriffe, so doch zur Abwehr.
Seit dem Morgen waren etwa zehn Kilometer zurückgelegt worden. Der Fluß zeigte viele launenhafte Windungen, obwohl seine Hauptrichtung eine südwestliche blieb. Seine sehr unebenen Ufer waren von sehr großen Bäumen eingefaßt, vorzüglich von Bombaxarten (Wollbäumen), deren breiter Schirm weit über die Fläche des Rio hineinreichte.
Trotzdem, daß sich die Breite des Johausen nicht vermindert hatte, sondern da und dort über fünfzig, sogar bis sechzig Meter betrug, vermischten sich die Bombaxzweige von beiden Seiten her und bildeten ein tiefgrünes Laubgewölbe, worunter das Wasser leise plätscherte.
Die meisten davon, die mit ihren Enden in die von den jenseitigen Bäumen hinüberreichten, waren noch durch schlangenartige Lianen mit einander verbunden – eine Naturbrücke, über die gewandte Clowns oder mindestens Vierhänder von einem Ufer zum andern gelangen konnten.
Von den niedrigeren Theilen des Horizonts waren die Gewitterwolken immer noch nicht ganz verschwunden, im übrigen aber schien die Sonne wieder und ihre Strahlen fielen fast lothrecht auf den Fluß.
Khamis und seine Gefährten konnten sich also beglückwünschen, hier unter dem Blätterdome hinzufahren.
Das erinnerte sie an ihre Wanderung unter den Bäumen und längs tiefschattiger Gänge, nur daß sie jetzt mühelos vorwärts kamen und keinen von Sisiphus und anderen Stachelkräutern bedeckten Boden zu überwinden hatten.
»Wahrhaftig, der reine Park, dieser Wald von Ubanghi, rief John Cort, ein Park mit üppigem Baumschlag und plätscherndem Wasser. Man könnte hier glauben, im Nationalpark der Vereinigten Staaten, an den Quellen des Missouri und des Yellowstone zu sein!…
– Ja, ein Park, worin sich Affen tummeln, bemerkte dazu Max Huber. Wahrlich, hier scheint sich das ganze Affengeschlecht ein Stelldichein gegeben zu haben! Wir sitzen mitten drin im Reiche der Vierhänder, wo Schimpansen, Gorillas und Gibbons eine unbeschränkte Herrschaft führen!«
Eine Bestätigung erhielt dieser Ausspruch durch die ungeheuere Menge dieser Thiere, die auf den Ufern durcheinandersprangen, von den Bäumen herablugten und im tieferen Walde hin und her liefen. Noch niemals hatten Khamis und dessen Gefährten so viele, so lärmende und so überaus gelenkige Affen beobachtet. Das war ein ewiges Schreien und Springen und Purzelbaumschlagen, und ein Photograph hätte hier ganze Bilderserien urkomischer Grimassen aufnehmen können.
»Ja, fuhr Max Huber fort, das ist aber alles nur etwas sehr natürliches, befinden wir uns doch im Herzen Afrikas.
Zwischen congolesischen Eingebornen und Vierhändern –unseren Khamis selbstverständlich ausgenommen – scheint mir überhaupt kein großer Unterschied zu bestehen.
– Oho, erwiderte John Cort, einen solchen giebt es doch, den nämlich, der den Menschen vom Thiere trennt, das mit Vernunft begabte Geschöpf von dem, das nur einem unwillkürlichen Instincte gehorcht…
– Der es oft weit zuverlässiger leitet als jene, mein lieber John!
– Darin widerspreche ich Dir nicht, Max. Die beiden Triebkräfte und Leitsterne des Lebens sind aber nichtsdestoweniger durch einen Abgrund von einander geschieden, und so lange dieser nicht ausgefüllt wird, wird die Fortentwickelungsschule nicht behaupten können, daß der Mensch vom Affen abstamme.
– Ganz recht, antwortete Max Huber, in der Leiter fehlt immer eine Stufe, ein Typus zwischen dem Anthropoïden und dem Menschen selbst, der etwas weniger Instinct und etwas mehr Vernunft als die Affen aufwiese. Und wenn dieser Typus fehlt, liegt das sicherlich daran, daß er niemals existiert hat.
Doch selbst wenn er vorhanden gewesen wäre, würde die Darwin’sche Theorie doch, wenigstens meiner Ansicht nach, noch nicht als richtig bewiesen sein.«
Jetzt war freilich etwas anderes zu thun, als in Erörterung des aufgestellten Grundsatzes, daß die Natur niemals Sprünge mache, eine Lösung der Frage zu versuchen, ob alle lebenden Wesen wirklich in enger Verbindung miteinander stehen – jetzt galt es Schutz- oder Abwehrmaßregeln zu treffen gegen einen feindlichen Angriff, der durch die numerische Uebermacht recht gefährlich werden konnte. Es wäre eine unverzeihliche Unklugheit gewesen, diesen als bedeutungslosen Zwischenfall anzusehen. Die Vierhänder bildeten ein Heer, zu dem die gesammte Affenbevölkerung zusammengeströmt zu sein schien. Ueber die Absichten der Thiere konnte sich niemand täuschen, hier hieß es, sich auf Leben und Tod vertheidigen.
Der Foreloper beobachtete die geräuschvolle Bewegung nicht ohne ernste Beunruhigung. Das erkannte man an seinem strengen, hochgerötheten Gesicht, an der Senkung der buschigen Brauen ebenso, wie aus dem durchdringenden Blick und an den tiefen Furchen der Stirne des Mannes.
»Halten wir uns bereit, mahnte er, die Gewehre geladen, die Patronen bei der Hand, denn ich weiß nicht, welche Wendung diese Geschichte nehmen wird…
– Pah, ein einziger Schuß wird die Bande in alle Winde versprengen,« meinte Max Huber.
Schon legte er das Gewehr an.
»Schießen Sie nicht, Herr Max! rief der Foreloper. Wir dürfen die Burschen nicht angreifen… sie nicht selbst reizen.
Wir werden genug zu thun haben, uns gegen sie zu vertheidigen!
– Doch wenn sie den Anfang machen… warf John Cort ein.
– Dann antworten wir nur, wenn es unbedingt nöthig wird!«
erklärte Khamis.
Der Angriff sollte nicht lange auf sich warten lassen. Vom Ufer flogen schon Steine und Aststücke herüber, geschleudert von den Affen, deren größere Arten eine erstaunliche Körperkraft haben. Sie bedienten sich dabei auch harmloserer Wurfgeschosse, unter anderen verschiedener von den Bäumen abgerissener Früchte.
Der Foreloper bemühte sich, das Floß im Rio möglichst gleichweit von beiden Ufern zu halten. Die Würfe wurden dadurch, weil unsicherer, auch minder gefährlich. Zum Unglücke fehlte es nur an jeder Möglichkeit, dem Angriff gegenüber Schutz zu suchen. Ueberdies wuchs die Zahl der Feinde immer mehr, und bereits hatten mehrere Projectile die Passagiere getroffen, ohne diesen jedoch ernsthaft Schaden zu thun.
»Nun ist es aber genug.« sagte endlich Max Huber.
Er zielte nach einem zwischen dem Gesträuch auftauchenden Gorilla und streckte ihn auf den ersten Schuß nieder.
Den Flintenknall beantwortete ein betäubendes Geschrei. Der Angriff hörte damit nicht auf, die Vierhänderbande wandte sich nicht zur Flucht. Die Affen einen nach dem anderen zu vernichten, dazu hätte die Munition gar nicht ausgereicht. Nur eine Kugel für jeden gerechnet, wäre der Vorrath an solchen bald erschöpft gewesen. Was begannen aber die Jäger, wenn ihre Patronentasche leer war?
»Wir wollen nicht mehr schießen, gebot John Cort. Das reizt die abscheulichen Bestien nur noch mehr. Hoffen wir, mit einigen unbedeutenden Verletzungen von ihnen davonzukommen.
– Na, ich danke!« antwortete Max Huber, den eben ein Stein ans Bein getroffen hatte.
Die Fahrt ging also, begleitet von einem doppelten Gefolge auf den hier recht windungsreichen Ufern des Rio Johausen, ununterbrochen weiter. An manchen Stellen verengerte sich das Flußbett freilich gut um ein Drittel, dafür war die Strömung dann aber um so schneller.
Wenn es völlig Nacht war, nahmen die Feindseligkeiten ja voraussichtlich ein Ende, denn wahrscheinlich zerstreuten sich die Angreifer dann im Walde. Auf jeden Fall wollte Khamis, wenn es nöthig wurde, statt gegen Abend anzuhalten, es wagen, auch in der Finsterniß weiter zu fahren. Jetzt war es freilich erst vier Uhr, und bis um sieben blieb die Lage immer noch recht bedrohlich.
Ein erschwerender Umstand lag ferner darin, daß das Floß gegen einen unmittelbaren Ueberfall keineswegs gesichert erschien. Wenn die Affen das Wasser ebensowenig lieben, wie die Katzen, und also nicht zu befürchten war, daß sie schwimmend herüberkämen, so ermöglichte ihnen doch die Verschränkung des Gezweiges über dem Flusse an manchen Stellen, sich dieser Brücke von Zweigen und Lianen zu bedienen und von da aus Khamis und seinen Gefährten geradezu auf den Kopf herunter zu springen. Das konnte für die gelenkigen und boshaften Thiere ja nur eine Kleinigkeit sein.
Vier oder fünf große Gorillas unternahmen gegen fünf Uhr wirklich diesen Versuch an der Biegung des Flusses, wo sich die Bombaxzweige dicht vereinigten. Etwa fünfzig Fuß weit flußabwärts erwarteten die Thiere das Vorüberkommen des Flosses.
John Cort hatte sie beobachtet und konnte sich über ihre Absicht keiner. Täuschung hingeben.
»Sie werden auf uns herunterfallen, rief Max Huber, und wenn wir sie nicht verjagen…
– Feuer!« commandierte der Foreloper.
Sofort krachten drei Schüsse. Tödtlich getroffen stürzten drei Affen nach dem eiteln Versuche, sich noch an das Gezweig zu klammern, hinunter in den Fluß.
Mit ohrzerreißendem Geschrei schwangen sich jetzt wohl zwanzig Vierhänder auf die Lianen, bereit, sich auf das Floß zu werfen.
Die Gewehre mußten eiligst wieder geladen und augenblicklich abgefeuert werden. Nun folgte ein gut genährtes Geknatter. Zehn oder zwölf Gorillas und Schimpansen wurden verwundet, ehe das Floß sich unter der Pflanzenbrücke befand, und entmuthigt flüchteten die anderen nach den Ufern zurück.
Da kam allen der Gedanke, daß der Professor Garner, wenn er sich allein tief in den Wald hinein gewagt hätte, jedenfalls demselben Schicksal wie der Doctor Johausen verfallen wäre.
Nahm man nun an, daß dieser von der Bevölkerung des Waldes in gleicher Weise wie Khamis, John Cort und Max Huber empfangen worden war, so brauchte man nach keiner Erklärung seines Verschwindens weiter zu suchen. Wäre er in der Hütte angegriffen worden, so hätten sich unzweifelhafte Anzeichen dafür finden müssen, denn bei der angeborenen Zerstörungssucht der Affen wäre diese bestimmt nicht unversehrt geblieben und dann hätten sich an der Stelle, wo sie sich befand, nur noch Trümmer davon vorgefunden.
Augenblicklich erschien es aber keine dringende Aufgabe, darüber nachzusinnen, was aus dem deutschen Arzte geworden sein mochte, weit mehr galt es, darüber nachzudenken, was noch mit dem Floß geschehen könnte. Die Breite des Flusses verringerte sich sichtlich mehr und mehr. Hundert Schritte an der rechten Seite weiter hin und vor einer Landspitze verrieth das Gurgeln des Wassers einen starken Strudel. Wenn das Floß in diesen gerieth und nicht mehr in der hier seitwärts abgeleiteten Strömung zu halten war, mußte es unfehlbar gegen das Ufer stoßen. Khamis vermochte es wohl gewöhnlich mit seinem Steuer auf dem richtigen Wege zu halten, es aber auch wieder aus jenem Strudel zu lootsen, erschien als eine sehr schwierige Aufgabe. Dann überfielen es aber jedenfalls die Affen vom Ufer aus in großer Zahl. Darum machte es sich nöthig, sie durch Gewehrschüsse zu vertreiben, ehe das Floß sich in dem Wasserwirbel sing.
Eine Minute später war die ganze Bande verschwunden, doch nicht die Kugeln und nicht der Knall der Schüsse hatte sie vertrieben. Schon seit einer Stunde thürmte sich am Himmel langsam ein Gewitter auf. Fahle Blitze zuckten durch die Wolkenmassen. Immer weiter schoben sich die dunkeln, gelblich geränderten Wolken herauf und bald brach eines jener furchtbaren Unwetter aus, wie sie nur in niedrigen Breiten vorkommen. Bei dem entsetzlichen Donnerkrachen bemächtigte sich der Vierhänder die instinctive Unruhe, die eine elektrische Spannung in der Luft in sehr vielen Thieren hervorruft. Sie singen an sich zu fürchten und suchten unter dem dichtesten Laubdache Schutz gegen die blendenden Entladungen, unter denen die Wolkendecke zu zerreißen schien. In kürzester Zeit waren beide Ufer verlassen, und von der ganzen Rotte waren nur noch etwa zwanzig todte Körper zu sehen, die zerstreut zwischen dem Gebüsch des Waldrandes lagen.
Zehntes Capitel.
Ngora!
Am nächsten Morgen wölbte sich der wieder heitere – man hätte sagen können, von dem Riesenwedel des Gewitters reingefegte – Himmel in tiefem Blau über den Wipfeln der Bäume. Bei Sonnenaufgang verflüchtigten sich vollends noch die letzten Tröpfchen, die an Blättern oder Gräsern hingen. Der schnell wieder trocken gewordene Erdboden hätte recht gut eine Wanderung durch den Wald gestattet. Natürlich war aber von einer Wiederaufnahme des Marsches nach Südwesten jetzt keine Rede mehr. Wich der Rio Johausen nicht aus seiner bisherigen Richtung ab, so hoffte Khamis, das eigentliche Becken des Ubanghi binnen vierzehn Tagen zu erreichen.
Die gewaltige atmosphärische Störung mit den zuckenden, zuweilen auf die Erde niederschlagenden Blitzen und dem lange hinrollenden Donner hatte erst früh gegen drei Uhr ein Ende genommen. Durch den Strudel hindurch war das Floß an die steile Uferwand getrieben worden und hatte hier Schutz gefunden. Dicht daneben stand ein mächtiger Baobab (Affenbrodbaum), dessen hohler Stamm nur noch durch die äußersten Holzschichten und die Rinde gebildet wurde. Khamis und seine Gefährten nahmen darin Platz, wenn es dabei auch etwas eng zuging. Ebenso waren die wenigen Geräthe, die Feuerwaffen und die Munition, die hier von dem Unwetter nichts zu leiden hatten, hereingeschafft worden und wurden in der Stunde vor der Abfahrt ohne große Mühe wieder auf das Floß gebracht.
»Nun wahrlich, dieses Gewitter kam gerade zur rechten Zeit,« bemerkte John Cort gegen Max, während der Foreloper die Reste des Wildes zum Frühstück zurecht machte.
Unter fortwährendem Plaudern beschäftigten sich die beiden jungen Männer mit der Reinigung ihrer Gewehre, die einer solchen nach dem gestrigen Feuergefecht nothwendig bedurften.
Llanga schlenderte inzwischen im Gesträuch und im hohen Grase umher, um Nester und Eier zu suchen.
»Jawohl, lieber John, das Gewitter kam uns recht gelegen, sagte Max Huber, gebe nur der Himmel, daß es jetzt, wo der Sturm vorüber ist, den Burschen nicht einfällt, noch einmal hier aufzutauchen. Jedenfalls müssen wir auf der Hut sein.«
Auch Khamis befürchtete, daß die Vierhänder mit Tagesanbruch die beiden Ufer wieder besetzen würden. Er beruhigte sich jedoch bald: obwohl es unter den Bäumen allmählich heller wurde, war doch kein neuer Lärm zu hören.
»Ich bin am Ufer wohl hundert Schritte weit hinausgegangen, habe aber keinen einzigen Affen entdecken können, versicherte John Cort.
– Das läßt ja das beste hoffen, antwortete Max Huber, und ich denke, unsere Patronen ferner anders zu verwenden, als zur Vertheidigung gegen die Schlingel von Makaken!… Wahrlich, ich befürchtete schon, daß unser gesammter Schießvorrath gestern daraufgehen würde.
– Und wie hätten wir den erneuern können? fiel John Cort ein. Eine zweite Hütte anzutreffen, um sich da mit Pulver, Kugeln und Schrot frisch versorgen zu können, daran ist doch nicht zu denken.
– O, rief Max Huber, wenn ich mir vorstelle, daß der gute Doctor beabsichtigte, mit solchen Burschen einen gesellschaftlichen Verkehr anzubandeln! Eine hübsche Gesellschaft! Um ergründen zu wollen, welche Worte sie gebrauchen, sich zum Essen einzuladen oder einander Guten Tag oder Gute Nacht zu wünschen, dazu muß man wahrlich ein Professor Garner sein, von denen es in Amerika vielleicht noch mehrere giebt, oder ein Doctor Johausen, der vielleicht in Deutschland, vielleicht sogar in Frankreich, noch einige Geistesverwandte hat…
– In Frankreich, Max?…
– O, wenn man danach unter den gelehrten Perücken des Instituts oder der Sorbonne suchte, fände man wahrscheinlich einen Idio…
– Idioten! vollendete protestierend John Cort das letzte Wort.
– Idiomographen, verbesserte Max Huber, der fähig wäre, in den congolesischen Wäldern die Untersuchungen des Professor Garner und des Doctor Jo hausen wieder aufzunehmen.
– Ist man sich, lieber Max, auch klar über den Erfolg des ersten, der jede Verbindung mit der Gesellschaft der Makaken abgebrochen zu haben scheint, so gilt dasselbe doch noch nicht für den zweiten, und ich fürchte sehr, daß…
… die Paviane oder andere ihm alle Knochen im Leibe zerbrochen haben, fuhr Max Huber fort. Nach der Art und Weise, wie sie sich gestern gegen uns benahmen, kann man sich ja ein Urtheil erlauben, ob es civilisierte Wesen sind oder jemals solche werden können.
– Siehst Du, Max, ich bleibe dabei, daß die Thiere bestimmt sind, unvernünftige Geschöpfe zu bleiben…
– Und die Menschen nicht minder, fügte Max Huber lachend hinzu. Das schließt nicht aus, daß ich sehr bedauere, nach Libreville zurückzukommen, ohne Nachrichten über den Doctor mit heimzubringen.
– Mag sein; für uns wäre es aber doch von Werth, durch diesen undurchdringlichen Wald gekommen zu sein.
– Das wird geschehen…
– Vielleicht, doch ich wünschte, es wäre schon geschehen!«
Das weitere Vordringen schien übrigens von keinen weiteren Schwierigkeiten bedroht zu sein, da das Floß ja nur der Strömung zu folgen brauchte, freilich unter der Voraussetzung, daß der Rio Johausen nicht durch Stromschnellen oder Barren versperrt oder durch Wasserfälle unterbrochen war, und gerade solche Hindernisse befürchtete der Foreloper noch immer.
Eben jetzt rief er seine Gefährten zum Frühstück. Llanga kam sofort herzugesprungen und brachte mehrere Enteneier mit, die für das Mittagsessen aufbewahrt wurden. Da noch ein Stück von der Antilope übrig war, brauchte der Mundvorrath vor der Mittagsrast nicht vervollständigt zu werden.
»Da fällt mir eben ein, begann jetzt John Cort, wir hätten doch unsere Munition nicht so nutzlos verschwenden sollen.
Konnten wir denn nicht auch von dem Fleische der Affen zehren?
– O, pfui! stieß Max Huber hervor.
– Seh’ einer diesen Kostverächter!
– Ich bitte Dich, lieber John, Gorillacoteletten, Gibbonfilet, Schimpansenkeule… ein Fricassée von Mandrillassen…
– Nun, ich äße im Nothfalle davon, meinte John Cort.
– Anthropophage Du! rief Max Huber mit komischer Entrüstung, wärst wahrhaftig imstande, fast Deinesgleichen zu verzehren…
– Ah, danke schön, Max!«
Schließlich überließ man natürlich die Cadaver der in der
»Schlacht« erlegten Vierhänder den Vögeln als willkommene Beute. Der Wald von Ubanghi beherbergte so viele Wiederkäuer und Vögel, daß man den Vertretern des Affengeschlechtes die Ehre, sie in einen menschlichen Magen aufzunehmen, nicht anzuthun brauchte.
Khamis bereitete es ernste Schwierigkeiten, das Floß aus dem Wirbel zu befreien und es um die Landspitze herum zu steuern.
Alle halfen bei dieser Arbeit, die fast eine Stunde in Anspruch nahm. Man hatte dazu dünne Bäume abbrechen und deren Zweige entfernen müssen, um eine Art Stangen zu bekommen, womit das Fahrzeug vom Ufer abgedrängt wurde.
Wurde dieses noch von dem Strudel zurückgehalten, wenn die Affenbande etwa wieder herangestürmt kam, so wäre deren Angriffen dadurch, daß man sich nach der Strömung flüchtete, nicht aus dem Wege zu gehen gewesen, und ohne Zweifel wären weder der Foreloper noch seine Gefährten heil und gesund aus dem gar zu ungleichen Kampfe hervorgegangen.
Kurz, nach vieler Anstrengung bewegte sich das Floß langsam um die vorspringende Ecke und begann wieder, auf dem Rio Johausen hinabzugleiten.
Der Tag versprach schön zu werden, wenigstens deutete nichts auf ein drohendes Gewitter oder einen bevorstehenden Regen. Dafür schoß aber eine Lawine von Sonnenstrahlen lothrecht herunter und die Hitze wäre kaum erträglich gewesen, wenn sie nicht durch einen frischen Wind von Norden her gemildert worden wäre, einem Winde, der auch die Fahrt des Flosses, wenn dieses ein Segel trug, sehr beschleunigt hätte.
Je weiter der Fluß nach Südwesten verlief, desto mehr nahm er jetzt an Breite zu. Freilich wölbte sich nun auch keine Laube und vereinigten sich keine belaubten Zweige mehr über seinem Bette. Unter diesen Verhältnissen hätte das Wiedererscheinen der Vierhänder auch nicht mehr die Gefahr gehabt, wie am Vortage. Uebrigens zeigte sich von diesen nichts.
Verlassen waren die Ufer des Rio aber deshalb nicht.
Vielerlei Wasservögel, Enten, Trappen, Pelikane, Martinstaucher und mehrere Arten von Strandreitern flatterten kreischend überall umher.
John Cort schoß einiges von diesem Geflügel, das nebst den von dem jungen Eingebornen gesammelten Eiern zur Mittagsmahlzeit diente. Um die verlorene Zeit einzubringen, wurde auch zur gewohnten Stunde nicht Halt gemacht, und die erste Hälfte dieses Tages verlief ohne den geringsten Zwischenfall.
Am Nachmittage kam es jedoch zu einem Alarm, der eine recht ernste Ursache hatte.
Es mochte etwa vier Uhr sein, als Khamis, der am Hintertheile das Steuer handhabte, John Cort bat, einmal seine Stelle zu vertreten, während er selbst nach vorn ging.
Max Huber stand auf, überzeugte sich, daß weder am rechten noch am linken Ufer etwas Verdächtiges zu bemerken war, und sagte dann zum Foreloper:
»Was sehen Sie denn Besonderes?…
– Das da!«
Khamis wies dabei mit der Hand stromabwärts nach einer stark bewegten Stelle des Wasserlaufes.
»Noch ein Wirbel, sagte Max Huber, oder vielmehr ein Maëlstrom im Kleinen! Achtung, Khamis, daß wir nicht dahinein gerathen.
– Das ist kein Wasserwirbel, antwortete der Foreloper.
– Was denn sonst?«…
Auf diese Frage antwortete fast augenblicklich ein Wasserstrahl, der gegen zehn Fuß über die Fläche des Rio emporstieg.
Da rief Max Huber in höchster Verwunderung:
»Sollte es in den Flüssen Centralafrikas etwa gar Walfische geben?
– Nein, aber Flußpferde,« belehrte ihn der Foreloper.
Ein fauchendes Geräusch ließ sich da zu gleicher Zeit vernehmen, wo ein ungeschlachter Kopf mit mächtigen Stoßzähnen an den Kiefern emportauchte, und dazu – um eine merkwürdige, doch treffende Vergleichung zu gebrauchen –
»das Innere eines Maules, das schon mehr einem Fleischerladen ähnelte, und ein Paar Augen, die sich an Größe mit der Dachlucke eines holländischen Bauernhauses messen konnten!« (In dieser Weise haben sich nämlich einzelne besonders phantasiereiche Reisende in ihren Berichten ausgedrückt.)
Flußpferde findet man zwischen dem Cap der guten Hoffnung und dem dreiundzwanzigsten Grade nördlicher Breite fast allenthalben. Sie hausen meist in den Flüssen, Seen und Sümpfen dieses ausgedehnten Gebietes. Hätte der Rio Johausen – dieser Hinweis fiel im Laufe des Gespräches –seine Mündung im Mittelländischen Meere gehabt, so wäre kein Angriff jener Amphibien zu besorgen gewesen, denn in den dahin verlaufenden Strömen kamen solche, mit Ausnahme des oberen Nils, überhaupt nicht vor.
Der Hippopotamus ist trotz seines eigentlich sanften Charakters ein recht gefährliches Thier. Wenn es aus irgend einem Grunde gereizt wurde, z. B. unter dem Einflusse des Schmerzes, wenn es harpuniert wird, stürzt es sich mit unbeschreiblicher Wuth auf die Jäger, verfolgt sie längs der Ufer, packt auch unmittelbar Bote an, die es bei seinem ungeheueren Körpergewicht leicht zum Kentern bringt, oder die es mit seinen mächtigen Kinnladen, die Arme und Beine des Menschen glatt abbeißen können, ernsthaft beschädigt.
Kein Insasse des Botes – nicht einmal der überaus jagdeifrige Max Huber – konnte auch nur daran denken, eine solche Amphibie anzugreifen. Das that aber wahrscheinlich die Amphibie, wenn sie das Floß erreichte, dagegen anstieß, es durch ihr, zuweilen bis zweitausend Kilogramm ansteigendes Gewicht überlastete, und wenn sie gar ihre schrecklichen Hauer hineinbohrte, was sollte dann aus Khamis und seinen Genossen werden?
Die Strömung war gerade ziemlich schnell, und vielleicht empfahl es sich mehr, ihr zu folgen, als dem Ufer zuzulenken, wohin der Hippopotamus doch nachgeschwommen wäre. Auf dem Lande konnte man seinen Stößen freilich leichter ausweichen, weil das Thier sich mit seinen kurzen, plumpen Beinen und dem fast auf der Erde geschleppten Bauche nur unbeholfen bewegen kann. Es gleicht eben mehr dem Mastschweine als dem Eber. Auf dem Rio schwimmend, war das Floß dagegen ihm auf Gnade und Ungnade preisgegeben und wurde von ihm jedenfalls zerstört. Gelang es dessen Insassen dann vielleicht auch wirklich, das Ufer schwimmend zu erreichen, so standen sie wenigstens der erschreckenden Schwierigkeit gegenüber, sich ein neues Floß bauen zu müssen.
»Wir wollen versuchen, unbemerkt vorüberzukommen, rieth Khamis. Wir strecken uns alle platt aus, vermeiden jedes Geräusch und halten uns nur fertig, jeden Augenblick ins Wasser zu springen.
– Die Sorge für Dich, Llanga, nehme ich auf mich,« sagte Max Huber.
Alle befolgten den Rath des Forelopers und legten sich auf dem Flosse nieder, das die Strömung ziemlich schnell hinabtrug. In dieser Lage hatten sie vielleicht Aussicht, von dem Hippopotamus nicht bemerkt zu werden.
Wenige Augenblicke später, als sie das von dem mächtigen Thiere aufgewühlte Wasser passierten, das ihr Fahrzeug stark erschütterte, vernahmen sie ein grimmiges Schnaufen und Grunzen, wie von einem Wildschweine.
Jetzt folgten einige Secunden tödtlicher Angst in der Ungewißheit, ob das Floß von dem Kopfe des Ungeheuers in die Höhe gehoben oder durch seine Last versenkt werden würde.
Khamis, John Cort und Max Huber beruhigten sich erst, als sie wieder in ruhigem Wasser hintrieben und das Schnaufen, von dem sie die Wärme des Athems im Vorbeifahren gespürt hatten, allmählich schwächer hörbar wurde. Nun erhoben sie sich auch und sahen wirklich nichts mehr von der Amphibie, die nach der Tiefe des Flusses hinabgetaucht war.
Jäger, die an den Kampf mit Elefanten gewöhnt waren, die noch unlängst der Karawane des Händlers Urdax angehört hatten, hätten eigentlich vor dem Zusammentreffen mit einem Hippopotamus nicht zurückschrecken sollen. Wiederholt, doch unter günstigeren Verhältnissen, hatten sie ja auch schon in der Sumpfgegend des oberen Ubanghi auf diese Thiere Jagd gemacht. An Bord ihres gebrechlichen Fahrzeugs aber, dessen Verlust für sie so schmerzlich gewesen wäre, wird man ihre Besorgniß wohl erklärlich finden, und es war ein Glück, daß sie von einem Angriffe des furchtbaren Thieres verschont blieben.
Am Abend hielt Khamis an der Mündung eines Baches am rechten Ufer an. Ein besseres Unterkommen für die Nacht, am Fuße einer Gruppe von Bananen, deren breite Blätter ein Schutzdach bildeten, konnte man sich kaum wünschen. An derselben Stelle war auch ein sandiger Uferstreifen mit eßbaren Mollusken bedeckt, die eingesammelt und je nach ihrer Art roh oder gekocht gegessen wurden. Der etwas rohe Geschmack der Bananen ließ dagegen viel zu wünschen übrig. Zum Glück ließ sich aus dem Wasser des Baches unter Zusatz des Saftes dieser Früchte ein recht erquickendes Getränk herstellen.
»Das wäre alles gut und schön, äußerte Max Huber, wenn wir nur die Gewißheit hätten, auch ruhig schlafen zu können.
Leider schwirren hier aber die verwünschten Insecten umher, von deren Stachel wir nicht verschont bleiben werden. Bei dem Mangel an Moskitonetzen werden wir greulich zerstochen erwachen.«
Das wäre in der That nicht ausgeblieben, wenn Llanga nicht ein Mittel gefunden hätte, die in surrenden Wolken umherschwärmenden Moskitos zu vertreiben.
Er war längs des Ufers ein Stück hinausgegangen, und jetzt hörte man ihn rufen.
Khamis lief zu dem Knaben hin, und Llanga zeigte ihm am Ufer trockenen Mist, der von Wiederkäuern, Antilopen, Hirschen, Büffeln und anderen herrührte, die hier gewiß ihren Durst zu löschen pflegten.
Warf man diese Reste in ein helles Feuer, wodurch ein dichter, eigenthümlich scharfer Rauch erzeugt wird, so war das das beste und vielleicht einzige Mittel, die Moskitos zu verjagen. Die Eingebornen bedienen sich seiner immer, und sie fahren auch gut dabei.
Sofort wurde also zwischen den Bananen ein tüchtiges Feuer aus dürrem Holz angezündet. Der Foreloper warf einige Hände voll trockenen Mist hinein. Augenblicklich stieg davon eine dunkle Rauchwolke auf und die Luft war in kürzester Zeit von den unerträglichen Insecten gesäubert.
Das Feuer sollte die ganze Nacht über von John Cort, Max Huber und Khamis unterhalten werden, wozu sie abwechselnd die Wache übernahmen. Am nächsten Morgen gedachten sie dann, durch einen ruhigen Schlummer gestärkt, schon in früher Stunde den Rio Johausen weiter hinunter zu fahren.
Im Klima Mittelafrikas ist nichts veränderlicher als das Wetter. Auf den klaren Himmel am vorigen Tage folgte ein grau überzogener, der einen regnerischen Tag ankündigte. Da die Wolken sich aber mehr in den tieferen Luftschichten hielten, fiel nur ein seiner Regen, ein einfacher Wasserstaub, der aber nichtsdestoweniger recht lästig wurde.
Zum Glück kam da Khamis ein vortrefflicher Gedanke. Die Bananenblätter sind vielleicht die größten Blätter des gesammten Pflanzenreiches. Die Schwarzen benutzen sie als Bedeckung ihrer Strohhütten. Schon aus einem Dutzend davon ließ sich mitten über dem Flosse eine Art Plane herstellen, die mittels Lianenfasern befestigt wurde. Das hatte der Foreloper schon vor der Abfahrt ausgeführt. Die Passagiere befanden sich also unter Schutz gegen den andauernden Regen, der von den breiten Blättern nach der Seite zu ablief.
Während des ersten Theiles des Tages zeigten sich am rechten Ufer wieder einige – vielleicht zwanzig – große Affen, die nicht abgeneigt schienen, die Feindseligkeiten des vorigen Tages aufs neue zu eröffnen. Das Klügste blieb es immer, jede Berührung mit den häßlichen Burschen zu vermeiden, und es gelang auch, das Floß mehr am linken Ufer zu halten, das von Vierhänderbanden weniger bevölkert war.
John Cort bemerkte sehr richtig, daß die Beziehungen zwischen den Affenscharen der beiden Ufer nur sehr dürftig sein könnten, weil der Uebergang von einer Seite zur anderen nur auf den Brücken aus Zweigen und Lianen möglich war, was selbst für Affen seine Schwierigkeiten haben dürfte.
Man »schnitt« heute wiederum die Mittagsrast und im Laufe des Nachmittags hielt das Floß nur ein einziges Mal an, um eine Sassabys-Antilope zu holen, die John Cort nahe bei einer Flußbiegung unter dem Gesträuch am Lande durch einen Schuß erlegt hatte.
An dieser Biegung, wo der Rio Johausen sich nach Südosten wendete, machte er fast einen rechten Winkel gegen seine bisherige Richtung. Natürlich beunruhigte es Khamis nicht wenig, sich damit wieder mehr nach dem Waldesinnern verschlagen werden zu sehen, während sein Reiseziel doch auf der entgegengesetzten Seite am Atlantischen Oceane lag. War auch nicht zu bezweifeln, daß der Rio Johausen zu den Nebenflüssen des Ubanghi gehörte, so bildete es doch einen gewaltigen Umweg, wenn man auf den Hauptstrom erst mehrere hundert Kilometer weiter oben, in der Mitte des unabhängigen Congogebietes traf. Zum Glück erkannte der Foreloper nach einstündiger Weiterfahrt, dank seinem scharfen Orientierungssinne – denn die Sonne war nicht sichtbar – daß der Wasserlauf wieder seine ursprüngliche Richtung einschlug.
Das erweckte die Hoffnung, daß er das Floß nach der Grenze von Französisch-Congo bringen werde, von wo aus es leicht war, Libreville zu erreichen.
Halb sieben Uhr lief Khamis mit einem kräftigen Ruderschlage das linke Ufer in einer Einbuchtung an, die von dem dichten Laube eines Cailecedrat, einer den Acajons der Senegalwälder fast gleichkommenden Baumart, beschattet war.
Regnete es auch nicht mehr, so bedeckten den Himmel doch noch starke Dunstmassen, die die Sonne nicht zu durchdringen vermochte. Man brauchte deshalb aber nicht zu glauben, daß die nächste Nacht kalt sein werde. Ein Thermometer hätte hier noch immer fünfundzwanzig Centigrade gezeigt. Bald loderte ein Feuer zwischen den Steinen am Ufer der Einbuchtung auf, das nur für Küchenzwecke, nämlich zum Braten eines Sassabysviertels, angezündet worden war. Diesmal hätte Llanga vergeblich nach Mollusken gesucht, um in die Mahlzeit Abwechslung zu bringen, oder nach Bananen, um das Wasser aus dem Rio Johausen schmackhafter zu machen, denn »trotz eines Anklingens an den Namen« – bemerkte Max Huber –erinnerte es in keiner Weise an den Johannisberger des Fürsten Metternich. Dafür konnte man sich wenigstens in gleicher Weise, wie am Abend vorher, der Moskitos erwehren.
Halb acht Uhr war es noch nicht völlig dunkel. Auf dem Wasser des Flusses spiegelte sich ein schwacher Lichtschein, und Haufen von Gesträuch und anderen Pflanzen, sowie einzelne Stämme, die vom Ufer losgerissen sein mochten, trieben auf dem Rio daher.
Während John Cort, Max Huber und Khamis Lagerstätten zurecht machten, indem sie dicke Schichten trockenen Grases am Fuße des Baumes ausbreiteten, lief Llanga noch auf dem Flosse hin und her, und betrachtete mit Interesse die vorüberschwimmenden Gegenstände.
Da zeigte sich, etwa dreißig Toisen stromaufwärts, der Stamm eines mittelstarken Baumes sammt vollständiger Krone.
Er war fünf bis sechs Fuß unterhalb des Aesteansatzes abgebrochen und zeigte eine noch ganz frische Bruchfläche.
Diese Aeste, deren unterste im Wasser schwammen, zeigten sich bedeckt mit dickem Laube, auch mit einigen Blüthen und Früchten, kurz, mit dem ganzen Grün, das trotz des Sturzes an dem Baume haften geblieben war.
Wahrscheinlich war dieser bei dem letzten Gewitter von einem Blitze getroffen worden. Von der Stelle, wo ihn seine Wurzeln hielten, mochte er auf ein abhängiges Uferstück gefallen, dann, von dem Gesträuch nach und nach frei werdend, weiter geglitten und von der Strömung gefaßt worden sein, mit der er jetzt, gleich der anderen Trift, auf dem Rio weiter hinunter trieb.
Daß sich Llanga solchen Betrachtungen hätte hingeben können, war ja ausgeschlossen und auch nicht der Fall gewesen. Er würde diesem Stamm ebensowenig eine besondere Beachtung geschenkt haben, wie den anderen dahintreibenden Gegenständen, wenn seine Aufmerksamkeit nicht in ganz seltsamer Weise darauf hingelenkt worden wäre.
Mitten unter den Zweigen glaubte Llanga nämlich ein lebendes Wesen zu bemerken, das Bewegungen machte, als ob es um Hilfe flehte. Bei dem herrschenden Halbdunkel war freilich nichts genaues zu erkennen, nicht einmal, ob es sich um ein Thier handelte.
Unentschlossen, was er thun sollte, wollte der Knabe eben nach John Cort und Max Huber rufen, als er durch einen weiteren Zwischenfall davon abgehalten wurde.
Der Stamm befand sich jetzt nur noch vierzig Meter weit von ihm entfernt und trieb schräg nach der Ausbuchtung zu, worin das Floß angebunden lag.
Da ertönte plötzlich ein Schrei, ein eigenthümlicher Schrei oder vielmehr ein verzweifelter Ruf, als ob ein menschliches Wesen Hilfe und Beistand verlangte. Als der Stamm dann vor der Ausbuchtung vorbeitrieb, stürzte sich dieses Wesen in den Fluß, offenbar in der Absicht, nach dem Ufer zu schwimmen.
Llanga glaubte ein Kind zu erkennen, das noch kleiner war, als er selbst. Das Kind mußte sich wohl auf dem Baume befunden haben, als dieser gerade umstürzte. Es schien des Schwimmens nur sehr wenig mächtig zu sein, so daß es das Ufer voraussichtlich nicht erreichen konnte; offenbar versagten ihm auch schon die Kräfte. Es paddelte im Wasser, verschwand jetzt und tauchte dann wieder auf, und von Zeit zu Zeit kam ein auffallendes Glucksen über seine Lippen.
Seinem reinen Mitgefühle folgend und ohne erst noch andere herbeizurufen, stürzte sich Llanga in den Rio und erreichte schwimmend die Stelle, wo das Kind eben wieder versunken war.
John Cort und Max Huber, die dessen erste Rufe auch schon gehört hatten, kamen nach dem Rande der Ausbuchtung geeilt.
Da sie Llanga einen Körper an der Wasseroberfläche halten sahen, streckten sie ihm die Hände entgegen, um that das Ersteigen des Ufers zu erleichtern.
»Heda, Llanga, rief Max Huber, was hast Du denn da aufgefischt?
– Ein Kind, lieber Herr Max, ein Kind, das dem Ertrinken nahe war.
– Ein Kind? wiederholte kopfschüttelnd John Cort.
– Ja, lieber Herr John.«
Llanga kniete neben dem kleinen Wesen, das er gerettet hatte, nieder.
Max Huber bückte sich neben ihm, um es genauer sehen zu können.
»Oho, sagte er sich erhebend, das ist ja gar kein Kind!
– Was denn? fragte John Cort.
– Weiter nichts als ein kleiner Affe… ein Abkömmling der greulichen Grimassenschneider, die uns belästigt haben!…
Und um den aus dem Wasser zu ziehen, hast Du, Llanga, Dich der Gefahr ausgesetzt, selbst zu ertrinken!
– Nein, es ist ein Kind… es ist doch ein Kind! wiederholte Llanga.
– Es ist nicht wahr, und ich fordere Dich auf, den Burschen wieder zu seiner Familie im Walde laufen zu lassen.«
Ob er nun an die Behauptung seines Freundes Max nicht glaubte oder sonst welche Gründe für eine andere Anschauung hatte, jedenfalls blieb Llanga dabei, ein Kind in dem kleinen Geschöpf zu sehen, das ihm seine Rettung verdankte, wenn es auch noch nicht wieder zum Bewußtsein gekommen war. Er dachte also gar nicht daran, sich von ihm zu trennen, sondern hob es sorgsam vom Boden auf. Im ganzen schien es das beste, ihn, wenigstens vorläufig, gewähren zu lassen. Als er es nach dem Lagerplatze gebracht hatte, überzeugte sich Llanga, daß es noch athmete; dann rieb er das seltsame Wesen ab, suchte es zu erwärmen und legte es endlich, in Erwartung, daß es die Augen schon noch aufschlagen werde, auf eine Schicht von dürrem Grase nieder.
Die Bewachung während der Nacht wurde in gewohnter Weise geregelt, und die beiden Freunde schliefen bald ein, da Khamis bis Mitternacht wach bleiben sollte.
Llanga dagegen konnte kein Auge zuthun. Er lauschte gespannt auf die leiseste Bewegung seines neben ihm liegenden Schützlings, hielt ihn an den Händen und beobachtete seine Athmung. Wie groß aber war seine Ueberraschung, als er gegen elf Uhr eine schwache Stimme vernahm… er erlauschte das Wort: »Ngora… Ngora!« Es klang, als ob ein Kind nach seiner Mutter riefe.
Elftes Capitel.
Am 19. März
An der jetzt erreichten Stelle war der, halb zu Fuß, halb auf dem Flosse zurückgelegte Weg etwa auf eine Strecke von zweihundert Kilometern zu schätzen Bedurfte es noch ebenso vieler Mühsal, den Ubanghi zu erreichen? Der Ansicht des Forelopers nach nicht. Die zweite Hälfte der Reise sollte schneller überwunden werden, wenn nur kein Hinderniß die Fahrt auf dem Flusse unterbrach.
Mit Tagesanbruch ging es wieder weiter; der neue Ankömmling, von dem sich Llanga nicht hatte trennen wollen, wurde mitgenommen. Der Knabe hatte ihn unter das Blätterdach getragen und wollte bei ihm bleiben, um ihn die Augen öffnen zu sehen.
Max Huber und John Cort zweifelten auch jetzt noch nicht daran, es mit einem Zugehörigen der Vierhänderfamilien, der Schimpansen, Gorillas, Mandrillassen, der Paviane und anderer zu thun zu haben. Sie hatten gar nicht daran gedacht, ihn näher zu besichtigen oder ihm sonst eine größere Aufmerksamkeit zu widmen. Das Geschöpfchen interessierte sie nicht weiter.
Llanga hatte den Burschen gerettet und wünschte ihn zu behalten, wie man einen aus Mitleid aufgenommenen Hund behält… er sollte seinen Willen haben. Daß er ihn zu seinem Gefährten machte, zeugte ja für sein gutes Herz. Kurz, da die beiden Freunde den jungen Eingebornen adoptiert hatten, mußte auch diesem gestattet sein, einen kleinen Affen zu adoptieren. Fand dieser Gelegenheit, in den Wald zu entwischen, so würde er seinen Retter schon verlassen.
verlassen mit der Undankbarkeit, worauf die Menschen ja nicht das alleinige Monopol haben.
Freilich, hätte Llanga gegen John Cort und Max Huber oder auch nur gegen Khamis geäußert: Er kann sprechen dieser Affe!… Er hat schon drei- oder viermal das Wort »Ngora«
wiederholt, so wäre vielleicht deren Aufmerksamkeit, wenigstens deren Neugier erregt worden. Vielleicht hätten sie ihn sorgsamer betrachtet… das kleine Thier! Vielleicht hätten sie in ihm den Vertreter einer noch unbekannten Rasse, der der sprechenden Affen entdeckt!
Llanga schwieg aber noch, da er sich getäuscht, falsch gehört zu haben fürchtete. Er nahm sich nur noch ernster vor, seinen Schützling zu beobachten, und wenn ihm dann das Wort
»Ngora« oder ein anderes über die Lippen käme, wollte er seinem Freund John und seinem Freund Max sofort davon Mittheilung machen.
Das war einer der Gründe, der ihn unter dem Schutzdache hielt, er bemühte sich aber auch, seinem durch langes Fasten aufs äußerste erschöpften Schützling etwas Nahrung beizubringen. Ihn zu ernähren, wenn es ein Affe war, mußte allerdings schwierig werden, da Affen nur Früchte verzehren, und von solchen hatte Llanga nichts zu bieten. Ein Stückchen Antilopenfleisch würde er jedenfalls verschmähen. Uebrigens hätte ein heftiges Fieber ihn jetzt überhaupt gehindert, etwas zu sich zu nehmen, denn er lag noch immer in tiefer Betäubung vor seinem Lebensretter.
»Na, wie geht’s denn Deinem Affen? fragte Max Huber Llanga, als dieser sich eine Stunde nach der Abfahrt einmal sehen ließ.
– Er schläft noch immer, Herr Max.
– Und Du willst ihn wirklich behalten?…
– Wenn Sie nichts dagegen haben… ja!
– Ich?… Ich habe nichts dagegen, Llanga. Hüte Dich nur, daß er Dich nicht kratzt!
– O… lieber Herr Max!
– Solchen Burschen soll man mißtrauen, sie sind heimtückisch wie die Katzen!
– Dieser nicht. Er ist noch so jung und hat ein so sanftes Gesicht.
– Na, wenn Du ihn denn zu Deinem Kameraden erheben willst, solltest Du doch auch einen Namen für ihn wählen.
– Einen Namen?… Welchen denn?
– Nun, sapperment: Jocko!… Alle Affen heißen ja Jocko!«
Wahrscheinlich paßte dem Knaben dieser Name nicht. Er gab keine weitere Antwort, sondern wendete sich wieder seinem Schützling zu.
Im Laufe dieses Vormittags ging die Fahrt recht angenehm vor sich und man hatte auch nicht von der Hitze zu leiden. Die Wolkenschichten waren so dick, daß sie kein Sonnenstrahl durchdringen konnte. Das war um so werthvoller, als der Rio Johausen zuweilen durch große Lichtungen hinfloß. Auch nahe am Ufer wäre kein Schutz zu finden gewesen, da an diesen nur vereinzelte Bäume standen. Der Erdboden wurde allmählich sumpfig. Nach rechts und nach links hin hätte man wohl einen halben Kilometer weit gehen müssen, um das nächste Waldesdickicht zu erreichen. Heute war höchstens ein, wie gewöhnlich, heftiger Niederschlag zu fürchten, der Himmel öffnete jedoch seine Schleusen nicht.
Wasservögel schwärmten zwar scharenweise über dem Sumpfe, Wiederkäuer aber zeigten sich kaum, was Max Huber sehr bedauerte. Die Enten und Trappen der vorhergehenden Tage hätte er so gern wieder durch Sassabys-Antilopen, Inyalas, Wasserböcke oder andere Vierfüßler ersetzt. Immer hielt er sich deshalb auch mit dem schußfertigen Gewehre, wie ein Jäger auf dem Anstand, vorn auf dem Flosse auf und spähte das Ufer ab, dem sich Khamis je nach den Windungen des Flusses gerade mehr näherte.
Man mußte sich also zum Mittagsessen wohl oder übel mit Keulen und Flügeln von Vögeln begnügen. Verwunderlich war es ja nicht, daß die Theilnehmer an der Karawane des Portugiesen Urdax ihrer täglichen Nahrung etwas überdrüssig wurden. Nichts als gebratenes, geröstetes oder gekochtes Fleisch und dazu einfaches Wasser, kein Obst, kein Brod, kein Körnchen Salz! Zuweilen wohl Fisch, doch in nicht schmackhafter Zubereitung. Sie sehnten sich recht sehr, nach den ersten Ansiedlungen am Ubanghi zu kommen, wo sie alle diese Entbehrungen, dank der großen Gastfreundlichkeit der Missionäre, gewiß bald vergessen würden.
Am heutigen Tage suchte Khamis vergeblich nach einem geeigneten Halteplatze. Die mit hohem Gesträuch bestandenen Ufer erschienen völlig ungangbar. Wie sollte es an ihrem halb erweichten unteren Theile möglich sein, sie zu betreten? Für das Vorwärtskommen war dieser Umstand sogar günstig, denn das Floß setzte infolgedessen seine Fahrt ununterbrochen fort.
So ging es bis gegen fünf Uhr weiter. John Cort und Max Huber plauderten inzwischen von den Erlebnissen während der Reise. Sie erinnerten sich der verschiedenen Vorfälle seit dem Aufbruche aus Libreville, der anregenden und erfolgreichen Jagden im Gebiete des oberen Ubanghi, der reichen Beute an Elefanten, der Gefahren des Zuges, die sie im Laufe von zwei Monaten so glücklich überstanden hatten, und ferner ihrer unbehinderten Rückkehr bis zu dem Tamarindenhügel, der beweglichen Feuer, des Auftauchens der Pachydermenherde und ihres Angriffes auf die Karawane, sowie der Flucht der Träger, des traurigen Endes des Händlers Urdax, der nach dem Sturz des Baumes elend zertreten wurde, und der Verfolgung durch die Elefanten, die erst am Waldessaum aufhörte.
»Ein trauriger Ausgang des so glücklich begonnenen Zuges, schloß John Cort. Und wer weiß, ob ihm nicht ein zweiter und eben so schlimmer noch bevorsteht?
– Das ist wohl möglich, meiner Ansicht nach aber nicht wahrscheinlich, lieber John.
– Nun ja, ich übertreibe vielleicht etwas.
– Nein, sogar bestimmt, denn dieser Wald birgt nicht mehr Geheimnisse als Euere großen Waldungen im fernen Westen, und wir haben obendrein nicht einmal einen Ueberfall durch Rothhäute zu besorgen! Hier giebt es weder Nomaden, noch Ansässige, keine Chiloux, Denkas oder Monbullus, jene wilden Sippen, die durch die Gebiete des Nordostens ziehen und
»Fleisch! Fleisch!« rufen, wie echte Menschenfresser, die zu sein sie ja eigentlich nicht aufgehört haben. Nein, und dieser Wasserlauf, dem wir den Namen Rio Johausen gegeben haben, den des Mannes, dessen Spuren ich so gern nachgegangen wäre, dieser friedliche, sichere Fluß wird uns mühelos bis zu seiner Einmündung in den Ubanghi tragen.
– Den Ubanghi, lieber Max, an den wir auch auf dem Wege um den Wald herum gekommen wären, wie das der arme Urdax sich vorgenommen hatte, und dann noch dazu in einem bequemen Wagen, wo es uns bis zum Ziele der Reise an gar nichts gefehlt hätte!
– Du hast ja recht, bester John, das wäre besser gewesen.
Entschieden gehört dieser Wald auch zu denen der alltäglichsten Sorte und verdient keinen besonderen Besuch. Es ist eben ein Gehölz, ein großes Gehölz, weiter aber auch nichts! Du erinnerst Dich ja der Fackeln, die sich an seinem Rande hin und her bewegten und zwischen dem Gezweig der vordersten Bäume aufleuchteten… dann, als wir dahin kamen… nichts, keine Seele mehr zu entdecken!… Wohin zum Kuckuck, mögen jene Neger nur verschwunden sein!…
Zuweilen kommt mir wirklich der Gedanke, sie in den Kronen der Baobabs, Bombax, Tamarinden und anderer Riesen des Waldes zu suchen… Nein, wahrlich, kein Mensch!
– Max! unterbrach ihn da John Cort.
– John? antwortete Max Huber.
– Willst Du einmal dort hinaus, stromabwärts sehen… dort am linken Ufer….
– Wie?… Ein Eingeborner?
– Ja, doch einer mit vier Beinen!… Sieh, da draußen über dem Gebüsch, ein paar prächtige, kielförmig gestaltete Hörner…«
Auch der Foreloper wandte seine Aufmerksamkeit jetzt derselben Stelle zu.
»Ein Büffel… sagte er.
– Hei, ein Büffel! wiederholte Max, das Gewehr ergreifend.
Das giebt einmal ein leckeres Gericht, wenn ich den Burschen in gute Schußweite bekomme!«
Khamis legte das Steuer mit kräftiger Hand um. Das Floß trieb schräg auf die Uferwand zu; sehr bald war es nur noch etwa dreißig Meter davon entfernt.
»Also endlich ein gutes Beefsteak in Aussicht, murmelte Max Huber, der die Feuerwaffe gegen das linke Knie gestützt hatte.
– Du magst den ersten Schuß haben, Max, sagte John Cort, ich begnüge mich mit dem zweiten, wenn der nöthig würde.«
Der Büffel schien nicht geneigt, von der Stelle, wo er stand, zu weichen. Wohl schnüffelte er eifrig die Luft durch die weiten Nasenlöcher ein, erkannte aber nichts von der Gefahr, die ihm drohte. Da man nicht nach dem Herzen des Thieres zielen konnte, mußte der Kopf als Ziel gewählt werden, und das that auch Max Huber, als er das Thier gut ins Visier bekam.
Der Schuß krachte, der Schwanz des Büffels peitschte hinter dem Gebüsch die Luft und gleichzeitig erscholl ein schmerzhaftes Gebrüll, nicht das gewöhnliche, rauhe Blöken der Büffel… ein Beweis, daß dieser tödtlich getroffen war.
»Hat gesessen!« jubelte Max Huber in befriedigter Jagdlust.
John Cort brauchte nicht erst noch zu feuern, was eine zweite Patrone ersparte. Das zwischen dem Gesträuch zusammengebrochene Thier glitt den Uferabhang hinunter und ein Blutstrom färbte längs des Ufers das klare Wasser des Rio.
Um das köstliche Beutestück nicht einzubüßen, steuerte das Floß nach der Stelle, wo der Wiederkäuer erlegt worden war, und der Foreloper machte sich daran, ihn zu zerlegen, um nur die eßbaren Theile mitzunehmen.
Die beiden Freunde bewunderten voller Freude dieses Exemplar der Wildochsen Afrikas, das von erstaunlicher Größe war. Wenn diese Thiere in Herden von zwei- bis dreihundert Köpfen über die Ebene dahinstürmen, kann man sich wohl vorstellen, welch wüthende Galoppade inmitten der von ihnen aufgewühlten Staubwolken das geben mag.
Hier handelte es sich aber um einen »Onga«, mit welchem Namen die Eingebornen die vereinzelt als Hagestolze umherschweifenden männlichen Büffel bezeichnen, die ihre europäischen Namensverwandten an Größe weit übertreffen.
Die hiesigen haben auch eine mehr gerade Stirne, eine verlängerte Schnauze und mehr oval zusammengedrückte Hörner. Die Haut des Büffels dient zur Anfertigung vorzüglich guter Lederarbeiten, seine Hörner liefern das Material zu Tabakdosen und Kämmen, sein zähes schwarzes Fellhaar benutzt man zum Polstern von Stühlen und Sesseln, seine Filets, Coteletten und Rippenstücke aber geben eine ebenso schmackhafte wie stärkende Nahrung, gleichgiltig ob es sich um afrikanische, asiatische oder amerikanische Büffel handelt.
Kurz, Max Huber hatte einen glücklichen Schuß gethan. Fällt ein Büffel aber nicht auf den ersten Schuß, so wird er zum furchtbaren Feinde, wenn er sich auf den Jäger stürzt.
Mit Hilfe des Beiles und seines Messers nahm Khamis die Ausweidung des Thieres vor, wobei seine Gefährten ihm so gut wie möglich helfen mußten. Das Floß durfte nicht unnöthigerweise überlastet werden, und zwanzig Kilogramm dieses appetitlichen Fleisches versprachen ja für mehrere Tage auszureichen.
Während nun diese wichtige Arbeit vor sich ging, war Llanga, der sonst immer gern beobachtete, was seine Freunde Max und John interessierte, diesmal unter dem Bananendache, und zwar aus folgendem Grunde zurückgeblieben: Bei dem Knalle des Flintenschusses war sein kleiner Pflegling ein wenig aus der langen Betäubung erwacht und hatte mit den Armen eine leichte Bewegung gemacht. Hoben sich seine Lider dabei auch nicht in die Höhe, so entfloh seinen entfärbten Lippen doch nochmals das einzige Wort, das Llanga bisher von ihm vernommen hatte:
»Ngora!… Ngora!«
Diesmal täuschte Llanga sich nicht. Das Wort traf sein Ohr ganz deutlich und er erkannte auch eine eigenthümliche Aussprache, eine Art Schnarrens, bei dem »r« in »Ngora«.
Ergriffen von dem schmerzlichen Ton des armen Wesens, faßte Llanga nach dessen Hand, die noch immer fieberhaft heiß war. Er füllte die Tasse mit frischem Wasser und versuchte, ihm einige Tropfen davon einzuflößen. Vergeblich. Die Kinnladen, die zwei Reihen blendend weißer Zähne zeigten, wichen nicht von einander. Da befeuchtete Llanga ein Bäuschchen trocknes Gras und netzte dem Kleinen vorsichtig die Lippen, was diesem recht wohlzuthun schien. Seine Hand drückte leise die, die ihn hielt, und noch einmal flüsterte er das Wort »Ngora«.
Der Leser erinnert sich ja, daß die Eingebornen dieses congolesische Wort gebrauchen, um den Begriff »Mutter« zu bezeichnen. Rief nun das kleine fremdartige Wesen wohl nach der seinen?…
Von Natur schon mitleidig, empfand Llanga noch eine Verdoppelung seiner Theilnahme bei dem Gedanken, daß dieses Wort vielleicht zum letzten Seufzer des armen Kleinen werden könne. – Ein Affe wäre es? hatte Max Huber behauptet.
… Nein, das war kein Affe. Llanga hätte es sich bei seinem Mangel an geistiger Ausbildung nicht erklären können.
Eine Zeit lang blieb er noch sitzen, streichelte einmal die Hand seines Pfleglings, benetzte ihm dann wieder die Lippen und stand nicht eher auf, als bis dieser wieder in tiefen Schlaf gesunken war.
Jetzt aber entschlossen, seinen Freunden alles mitzutheilen, näherte er sich den beiden jungen Männern, als das eben vom Ufer abgestoßene Floß wieder in die Strömung einlenkte.
»Na, fragte Max Huber nochmals lächelnd, wie steht’s denn mit Deinem Affen?«
Llanga sah ihn ernst an, als zögere er zu antworten. Dann legte er aber die Hand auf Max Huber’s Arm:
»Das ist kein Affe, sagte er bestimmt.
– Wie?… Kein Affe? wiederholte John Cort.
– Laß ihn! Unser Llanga hat sich nun einmal auf seine Ansicht versteift, meinte Max Huber. Nicht wahr, Du bildest Dir ein, es sei ein Kind wie Du?
– Ein Kind… nicht wie ich… aber doch ein Kind!
– Ueberlege Dir, Llanga, fuhr John Cort in ernsterem Tone als sein Gefährte fort, Du behauptest, daß es ein Kind sei?…
– Ja… er hatte gesprochen… schon in vergangener Nacht.
– Er hat etwas gesprochen?
– Gewiß… und eben jetzt wieder.
– Und was sagt es denn, das kleine Wunderkind? fragte Max Huber.
– Er sagte leise »Ngora«…
– Wie, dasselbe Wort, das ich auch schon gehört habe? rief John Cort, der seine Verwunderung nicht verbergen konnte.
– Jawohl… »Ngora«,« versicherte der junge Eingeborne.
Jetzt war nur zweierlei möglich: entweder war Llanga das Opfer einer Sinnestäuschung oder er hatte den Verstand verloren.
»Das müssen wir untersuchen, sagte John Cort, und wenn es sich bestätigte, wäre es wenigstens etwas ganz außergewöhnliches, lieber Max!«
Beide traten unter das Schutzdach und betrachteten den kleinen Schläfer.
Auf den ersten Blick hin hätte wohl jeder erklärt, daß dieser zum Geschlechte der Affen gehöre. John Cort bemerkte aber bald, daß er hier keinen Vierhänder, sondern einen Zweihänder vor sich hatte. Nach Blumenbach’s allgemein angenommener Eintheilung des Thierreiches weiß man aber, daß ganz allein der Mensch zur Ordnung der Zweihänder gehört. Dieses merkwürdige Geschöpf besaß nun bloß zwei Hände, während die Affen ohne Ausnahme deren vier haben, auch seine Füße schienen zum Gehen eingerichtet und nicht zum Greifen, wie die aller Affentypen.
John Cort wies Max Huber auf diese Unterscheidungszeichen hin.
»Merkwürdig… sehr merkwürdig!« sagte der Franzose.
Die Körperlänge des kleinen Wesens überstieg kaum fünfundsiebzig Centimeter. Es schien noch sehr jung, höchstens im fünften oder sechsten Lebensjahre zu sein. Seine Haut trug keine eigentliche Behaarung, sondern nur einen leichten Flaum. Auch Stirn, Kinn und Wangen waren frei von jedem Haarwuchs, der sich nur auf der Brust und den Ober-und Unterschenkeln zeigte. Seine Ohren gingen in einen runden, weichen Hautanhang aus, abweichend von den Affen, die keine Ohrläppchen haben. Die Arme erschienen nicht übermäßig lang. Die Natur hatte es auch nicht mit einem
»fünften Gliede« ausgestattet, wie die meisten Affen, mit einem Schwanze, der diesen zum Tasten und Festhalten dient.
Sein mehr rundlicher Kopf zeigte einen Gesichtswinkel von ziemlich achtzig Graden, die Nase war stumpf, die Stirn wenig abfallend. Den Schädel bedeckten keine schlichten Haare, sondern eine Art Vlies, gleich dem der Eingebornen Centralafrikas. Offenbar wies an ihm alles, der äußeren Erscheinung und jedenfalls auch dem inneren Körperbau nach, weit mehr auf einen Menschen, als auf einen Affen hin.
Leicht wird man sich das Erstaunen vorstellen können, das Max Huber und John Cort erfüllte, als sie sich hier einem völlig neuen Wesen gegenüber sahen, das noch kein Anthropolog beobachtet hatte und das die Mitte zwischen dem Menschen und dem Thiere zu halten schien.
Ferner hatte Llanga versichert, daß der Kleine gesprochen habe, wenn da nicht darauf hinauskam, daß der junge Eingeborne für articulierte Laute gehalten hatte, was nur ein Schrei gewesen war, der keinerlei Gedanken ausdrückte, nur ein Schrei, der vom Instinct, nicht von der Intelligenz eingegeben war.
Die beiden Freunde standen schweigend beieinander und warteten, daß der Mund des Kleinen sich nochmals aufthun sollte, während Llanga diesem zärtlich Stirn und Schläfen wärmte. Seine Athmung war jetzt übrigens weniger keuchend, die Haut weniger heiß… das Fieber schien sich seinem Ende zu nähern. Endlich bewegten sich schwach die blutlosen Lippen.
»Ngora!… Ngora!« kam es klagend hervor.
»Sapperment, stieß Max Huber hervor, das geht einem doch über allen Verstand!«
Weder der eine noch der andere wollte glauben, was sie eben gehört hatten.
Wie, mochte dieses Geschöpf, das sicherlich nicht auf der höchsten Stufe des Thierreichs stand, sein, was es wollte… es besaß doch die Gabe des Wortes! Hatte es bisher auch nur jenes einzige Wort der congolesischen Sprache vernehmen lassen, so war doch nicht ausgeschlossen, daß es auch noch andere kannte, daß es eines Gedankens fähig war, dem es Ausdruck zu verleihen vermochte!
Bedauerlich blieb es vorläufig nur, daß es die Augen nicht aufschlug, den Spiegel der Seele, in dem man so vieles erkennen kann. Die Lider blieben jedoch geschlossen, und nichts deutete darauf hin, daß sie sich bald öffnen sollten.
Ueber den Kleinen niedergebeugt, harrte John Cort gespannt auf jedes Wort, auf jeden Schrei, der ihm entschlüpfen könnte.
Er hob seinen Kopf etwas empor, ohne daß der Kleine aufwachte, wie groß war aber seine Ueberraschung, als er entdeckte, daß eine Schnur um dessen Hals gewunden war.
Er ließ diese Schnur aus Seidenfäden durch die Finger gleiten, um den Knoten zu finden, der sie hielt. Sofort rief er aber da:
»Eine Medaille!
– Eine Medaille?« wiederholte Max Huber.
John Cort löste den Knoten der Schnur.
Da fiel ihm eine Denkmünze aus Nickel in der Größe eines Sous in die Hand, mit einem Namen auf der einen und einem Gesichtsprofil auf der anderen Seite.
Der Name war der Johausen’s, das Profil das Bild des Doctors.
»Er! rief Max Huber, und das Bürschchen hier geschmückt mit dem Orden des deutschen Gelehrten, dessen Hütte wir so leer aufgefunden haben!«
Daß diese Denkmünzen in der Gegend von Kamerun eine weite Verbreitung gefunden hätten, das war ja nichts erstaunenswerthes, da der Doctor viele solche an Frauen und Männer im Congobecken ausgetheilt hatte; daß sich ein solches Abzeichen aber gerade am Halse dieses merkwürdigen Bewohners von Ubanghi vorfand…
»Das ist rein phantastisch, erklärte Max Huber, vorausgesetzt, daß die Halbmenschen-Halbaffen diese Medaille nicht aus dem Kasten des Doctors gestohlen haben.«
Er winkte den Foreloper herbei, um ihm ihre außerordentliche Entdeckung mitzutheilen und ihn zu fragen, was er wohl von der Sache denke.
Fast gleichzeitig ließ sich aber auch die Stimme des Forelopers vernehmen.
»Herr Max!… Herr John!« tönte es herein.
Die beiden jungen Männer traten unter dem Schutzdache hervor und gingen auf Khamis zu.
»Horchen Sie einmal!« sagte dieser.
Fünfhundert Meter stromabwärts bog der Fluß schroff nach rechts hin ab, an einer Stelle, die wieder ein dichterer Baumbestand bedeckte. Lauschte man in dieser Richtung hin, so vernahm man ein dumpfes, unausgesetztes Geräusch, das mit dem Blöken von Wiederkäuern oder dem Brüllen von Raubthieren nicht zu verwechseln war. Es erschien wie ein wüster Lärm, der mit der Annäherung des Flosses immer zunahm.
»Ein verdächtiger Lärm, sagte John Cort.
– Dessen Natur ich nicht zu errathen vermag, setzte Max Huber hinzu.
– Vielleicht befindet sich da draußen ein Wasserfall oder eine Stromschnelle, meinte der Foreloper. Der Wind weht aus Süden und ich fühle, daß die Luft auffallend feucht, fast nässend ist.«
Khamis täuschte sich nicht. Ueber den Rio hin trieben Wolken von Wasserstaub, die nur von einer heftigen Bewegung desselben herrühren konnten.
War der Fluß hier durch ein Hinderniß gesperrt und wurde der Weiterfahrt dadurch ein Ende gemacht, so war das ein so ernstes Ding, daß Max Huber und John Cort an Llanga und dessen Schützling gar nicht mehr dachten.
Das Floß trieb jetzt ziemlich geschwind weiter, und jenseit der Biegung mußte sich die Ursache des entfernten Geräusches ja bald zeigen.
Als die Biegung hinter ihnen lag, erwies sich die Befürchtung des Forelopers leider allzusehr begründet.
Etwa hundert Toisen weiter unten bildete eine Anhäufung dunkler Felsmassen eine von einem Ufer zum anderen reichende Barre, außer einer Oeffnung in der Mitte, durch die das Wasser schaumbekrönt hindurchrauschte. Im übrigen schlug es auf beiden Seiten gegen diesen Naturdamm an oder brandete stellenweise darüber hinweg. Hier befand sich also eine Stromschnelle in der Mitte, und stürzten Wasserfälle an den Seiten hinunter. Gelangte das Floß nicht nach einer der Uferwände und konnte es da nicht festgelegt werden, so wurde es mit hinweggerissen und mußte an der Barre in Trümmer gehen, wenn es nicht gar in der Strömung kenterte.
Alle hatten ihr ruhiges Blut bewahrt. Jetzt galt es aber, keinen Augenblick zu verlieren, denn die Schnelligkeit der Strömung nahm zusehends zu.
»Ans Ufer!… Ans Ufer!« rief Khamis.
Es war jetzt halb sieben Uhr und bei dem dunstigen Wetter herrschte schon bei Beginn der Dämmerung ein unbestimmtes Zwielicht, das die Unterscheidung aller Gegenstände erschwerte.
Die Sachlage wurde hierdurch nur noch verfänglicher.
Vergeblich bemühte sich Khamis, das Floß nach dem Ufer zu lenken. Seine Kräfte reichten dazu nicht aus. Max Huber sprang ihm zu Hilfe, um aus der Strömung zu kommen, die in gerader Linie auf die Mitte der Barre zu verlief.
Zu Zweien erzielten sie wohl einigen Erfolg und es wäre ihnen schließlich gelungen, das Floß aus der Strömung zu drängen, wenn nicht das Steuer gebrochen wäre.
»Haltet Euch bereit, auf die Steine zu springen, ehe wir in die Stromschnelle gerathen… commandierte Khamis.
– Es bleibt uns nichts anderes übrig!« antwortete John Cort.
Auf diese laut ausgesprochenen Worte hin trat Llanga unter der Schutzdecke hervor. Er sah sich um und erkannte offenbar die drohende Gefahr, doch statt an sich zu denken, dachte er an den anderen, den armen Kleinen. Ihn nahm er in die Arme und kniete am Hintertheile des Fahrzeuges nieder.
Nach einer weiteren Minute war dieses wieder völlig in die Strömung hineingerissen. Vielleicht stieß es doch nicht gegen den Felsendamm und gelangte ohne umzuschlagen glücklich hindurch.
Doch nein, das Unglück kam heran und mit ungeheuerer Wucht prallte das gebrechliche Fahrzeug gegen einen der Blöcke an der linken Seite. Vergeblich versuchten Khamis und die anderen, sich an der Barre, auf die sie den Kasten mit Patronen, die Waffen und ihre wenigen Geräthe geworfen hatten, noch festzuhalten.
Alle wurden hinuntergeschleudert in den tosenden Strudel, als das Floß in Stücke ging, dessen Trümmer inmitten des schäumenden Wassers stromabwärts verschwanden.
Zwölftes Capitel.
Unter Bäumen
Am nächsten Tage lagen drei Männer lang ausgestreckt neben einer Feuerstätte, auf der eben die letzten Kohlen verglommen.
Ueberwältigt von der Müdigkeit und außer stande, dem Schlafe zu widerstehen, waren alle drei, nachdem sie ihre am Feuer getrockneten Kleider wieder angelegt hatten, in halber Betäubung eingeschlummert.
Doch welche Zeit war es jetzt und war es überhaupt Tag oder Nacht? Keiner von ihnen hätte es sagen können. Nach der seit gestern verflossenen Zeit zu urtheilen, ließ sich jedoch annehmen, daß die Sonne über dem Horizont stehen müsse.
Wo lag aber die Ostseite? Wäre diese Frage gestellt worden, so wäre sie unbeantwortet geblieben.
Befanden sich die drei Männer etwa in einer Höhle, an einer Stelle, die kein Lichtstrahl erreichen konnte?
Nein; rings um sie standen zahllose Bäume so dicht bei einander, daß man höchstens einige Meter weit sehen konnte.
Auch während das Feuer noch hell brannte, wäre es unmöglich gewesen, zwischen den dicken Stämmen und den. sie verbindenden Lianen einen für Fußgänger brauchbaren Steg zu entdecken. Die unteren Aeste der Bäume breiteten sich erst in der Höhe von etwa fünfzig Fuß aus. Darüber war das Laub bis zu den höchsten Wipfeln so dicht, daß weder das Flimmern der Sterne noch die Strahlen der Sonne hindurchdringen konnten.
Ein Kerker hätte nicht finsterer, sein Mauerwerk nicht undurchdringlicher sein können, und doch befand man sich hier nur unter den Baumriesen des großen Waldes.
In den drei Männern wird der freundliche Leser wohl John Cort, Max Huber und Khamis wieder erkannt haben.
Wie in aller Welt es gekommen sei, daß sie sich jetzt an dieser Stelle befanden, wußte keiner von ihnen zu sagen. Nach der Zertrümmerung des Flosses an der Felsenbarre, auf die sie sich nicht hatten retten können, waren sie in das dahinjagende Wasser gerissen worden, wußten aber von gar nichts, was nach diesem Unfalle geschehen sein mochte, ebensowenig, wem der Foreloper und seine Gefährten ihre Rettung verdankten und wer sie, bevor sie das Bewußtsein wieder erlangten, nach diesem dichten Theil des Waldes geschafft hätte.
Leider waren nicht alle dem Unheile entgangen. Einer fehlte: das Adoptivkind John Cort’s und Max Huber’s, der arme Llanga, und außer diesem das kleine Wesen, das der Knabe früher erst selbst einmal gerettet hatte… und wer konnte wissen, ob er nicht bei dem Versuche, dieses nochmals zu retten, elend umgekommen wäre?
Jetzt besaßen Khamis, John Cort und Max Huber weder Munition noch Gewehre und auch keine sonstigen Hilfsmittel, außer ihrem Taschenmesser und dem kleinen Beile, das der Foreloper immer im Gürtel trug. Ebenso war ihr Floß verloren, und sie wußten auch nicht, wohin sie sich wenden sollten, um wieder an den Rio Johausen zu kommen.
Die wichtige Frage der Ernährung machte nun ungeahnte Schwierigkeiten, denn an Jagdbeute war ja gar nicht mehr zu denken. Khamis, John Cort und Max Huber sahen sich für die folgende Zeit auf Wurzeln und wilde Früchte, jedenfalls auf kaum zulängliche und obendrein unsichere Hilfsquellen angewiesen. Da stand ihnen doch die Aussicht, Hungers zu sterben, in erschreckender Nähe.
Ihnen winkte noch eine Frist von zwei bis drei Tagen, denn für diesen Zeitraum hatten sie noch Nahrungsmittel zur Hand, da sich die Ueberreste des Büffels hier wunderbarerweise vorfanden. Nachdem sie einige, bereits gekochte Stücke davon verzehrt hatten, waren sie um das dem Erlöschen nahe Feuer eingeschlafen.
John Cort erwachte als erster inmitten einer Finsterniß, die auch in der Nacht hätte keine tiefere sein können. Seine Augen gewöhnten sich jedoch allmählich daran und er erkannte zur Noth Max Huber und Khamis, die am Fuße der Bäume lagen.
Ehe er sie weckte, bemühte er sich, das Feuer wieder anzuschüren, indem er die unter der Asche glimmenden Zweigenden näher zusammenschob. Dann raffte er einen Arm voll dürres Holz und trockenes Gras zusammen, und bald warf eine lodernde Flamme ihren Schein über die Lagerstatt.
»Nun – so sprach John Cort für sich – heißt es: überlegen, wie wir von hier wegkommen.«
Das Flackern des Feuers erweckte auch sehr bald Max Huber und Khamis. Beide erhoben sich fast gleichzeitig. Sie kamen schnell zur Erkenntniß ihrer Lage und thaten, was allein angezeigt war: sie berathschlagten, was zunächst zu thun sei.
»Wo sind wir denn überhaupt? fragte Max Huber.
– Da, wohin uns irgendwer geschafft hat, antwortete John Cort, und daraus folgt, daß wir gar nichts von dem wissen, was seit…
– Etwa seit einer Nacht und einem Tage geschehen ist, fiel Max Huber ein. War es denn wirklich gestern, wo unser Floß an der Barre zerschellte?… Haben Sie darüber ein Urtheil, Khamis?«
Statt jeder Antwort schüttelte der Foreloper nur mit dem Kopfe. Auch ihm war es ja unmöglich, die inzwischen verflossene Zeit anzugeben oder zu sagen, in welcher Weise ihre Rettung überhaupt zustande gekommen sei.
»Und Llanga? fragte John Cort. Der ist sicherlich umgekommen, da er nicht bei uns ist. Die, die uns gerettet haben, haben ihn jedenfalls der Stromschnelle nicht entreißen können.
– Armes Kind, seufzte Max Huber, er war uns so aufrichtig zugethan!… Wir liebten ihn und hätten ihm so gern ein glückliches Leben bereitet. Erst aus den Händen der Denkas gerettet, und nun… armes Kind!«
Die beiden Freunde hätten gewiß nicht gezögert, ihr Leben für das Llangas zu wagen. Doch auch sie waren nahe daran gewesen, in dem brodelnden Wasser zu ertrinken, und sie wußten nicht, wem sie ihre Rettung verdankten.
Es bedarf kaum der Erwähnung, daß sie an das seltsame Geschöpf, das der junge Eingeborne aus dem Wasser gezogen hatte, kaum noch dachten. Das war jedenfalls mit dem Knaben umgekommen. Jetzt drängten sich ihnen ganz andere Fragen auf… Fragen von ernsterer Bedeutung, als jenes anthropologische Problem betreffs eines Typus, der zwischen Mensch und Affe lag.
John Cort fuhr fort:
»Soviel ich auch nachsinne, erinnere ich mich doch keines Umstandes nach dem Anprallen an den Steindamm. Nur kurz vorher glaubte ich noch Khamis gesehen zu haben und wie er unsere Waffen und Geräthe auf die Felsblöcke warf.
– Ganz recht, bestätigte Khamis, und es ist ein großes Glück, daß diese Gegenstände nicht in den Rio gefallen sind. Gleich nachher…
– Gleich nachher, fiel Max Huber ein, als wir ganz nahe daran waren, verschlungen zu werden, glaubte ich… ja, da glaubte ich, Menschen zu bemerken…
– Ja, ja… mehrere Menschen, fiel John Cort lebhaft ein, Eingeborne, die Zeichen gebend und schreiend nach der Barre eilten…
– Sie haben Eingeborne gesehen? fragte der Foreloper höchst erstaunt.
– Etwa ein Dutzend, versicherte Max Huber, und zweifellos sind diese es gewesen, die uns aus dem Rio gezogen haben.
– Ferner haben dieselben uns, setzte John Cort hinzu, bevor wir wieder zu uns kamen, hierher geschafft und die Reste unseres Mundvorraths obendrein. Nachdem sie dann ein Feuer angezündet hatten, müssen sie sich beeilt haben, zu verschwinden.
– Und sie sind so gründlich verschwunden, sagte Max Huber, daß wir von ihnen keine Fährte entdecken können. Das beweist, daß sie auf einen Dank von uns verzichteten.
– Geduld, mein lieber Max, entgegnete John Cort, möglicherweise halten sie sich doch noch in der Nähe unserer Lagerstatt auf. Es läßt sich ja kaum annehmen, daß sie uns hierher geführt hätten, um uns nachher völlig im Stich zu lassen.
– Hierher! Wohin denn? rief Max Huber. Daß es im Walde von Ubanghi ein solches Baumdickicht giebt, übersteigt doch jede Vorstellung!… Wir befinden uns ja hier in der schlimmsten Finsterniß…
– Zugegeben, doch ist es denn jetzt draußen Tag?« bemerkte John Cort.
Diese Frage sollte bald eine Lösung im bejahenden Sinne finden. So dicht und dunkel das Blätterdach auch war, bemerkte man doch über den Gipfeln der hundert bis hundertfünfzig Fuß hohen Bäume da und dort ein Stückchen hellen Himmels. Es unterlag also keinem Zweifel, daß die Sonne jetzt das Land umher beleuchtete. Die Uhren Max Huber’s und John Cort’s, in die Wasser eingedrungen war, konnten die Stunde nicht mehr anzeigen. Man konnte also nur noch nach dem jeweiligen Stande der Sonne rechnen, und dazu war es fraglich, ob ihre Strahlen je durch das dichte Gezweig unmittelbar sichtbar würden.
Während die beiden Freunde derlei Fragen erörterten, ohne sie zuverlässig beantworten zu können, hatte Khamis ihnen zugehört, doch kein Wort dazu gesagt. Er hatte sich erhoben und ging auf dem beschränkten Raume, den die mächtigen Bäume frei ließen und der überdies durch ein Gewirr von Lianen und stachligem Sisiphus begrenzt war, nachdenklich hin und her. Gleichzeitig suchte er durch die Lücken zwischen den Aesten ein Stückchen freien Himmel zu entdecken und bemühte sich, seinen Orientierungssinn wachzurufen, der sich jetzt so nützlich erweisen konnte, wie noch niemals vorher.
War er schon früher durch die Waldungen des Congo und die von Kamerun gezogen, so hatte er sich doch niemals in einem so undurchdringlichen Waldgebiete befunden, wie heute hier.
Dieser Theil des großen Waldes ließ sich gar nicht vergleichen mit dem, durch den seine Gefährten und er bis an den Rio Johausen gewandert waren. Von dem Punkte aus, wo sie den Fluß erreicht hatten, waren sie in der Hauptsache nach Südwesten zu gefahren, doch wo war Südwesten jetzt zu suchen und sollte der Instinct ihres Khamis ihnen darüber Aufklärung geben?
Gerade als Max Huber, der seine Unklarheit darüber errieth, den Foreloper fragen wollte, wendete sich dieser selbst an ihn mit den Worten:
»Herr Max, Sie sind sich also sicher, bei der Barre Eingeborne bemerkt zu haben?
– Ganz sicher, Khamis; in dem Augenblicke, wo das Floß an die Felsblöcke stieß.
– Und auf welchem Ufer?
– Auf dem linken.
– Besinnen Sie sich recht, war es auf dem linken?
– Ja, auf dem linken Ufer.
– Dann wären wir jetzt also auf der Ostseite des Rio.
– Ohne Zweifel, stimmte John Cort ein, und folglich im tiefsten Theile des Waldes. Doch in welcher Entfernung vom Rio Johausen?
– Diese Entfernung kann nicht sehr groß sein, meinte Max Huber. Sie auf einige Kilometer zu schätzen, dürfte schon übertrieben sein. Es ist doch ganz ausgeschlossen, daß unsere Retter, wer sie auch sein mögen, uns sehr weit fortgeschafft haben sollten.
– Ich bin auch der Ansicht, ließ sich Khamis vernehmen, daß der Rio nicht weit von hier sein kann. Uns muß vor allem daran liegen, ihn wieder zu finden, und sobald wir ein neues Floß gebaut haben, unsere Fahrt unterhalb der Barre fortzusetzen.
– Wovon sollen wir uns aber bis dahin und später auf der Fahrt bis zum Ubanghi ernähren? warf Max Huber ein. Eßbares Wild können wir doch nicht mehr erlegen.
– Und außerdem, setzte John Cort hinzu, auf welcher Seite sollen wir denn den Rio Johausen suchen? Zugegeben, daß wir auf das linke Ufer gebracht worden waren; da es uns aber unmöglich ist, eine bestimmte Himmelsgegend zu erkennen, wer kann da sagen, ob wir den Rio in dieser oder in jener Richtung suchen sollen?
– Und zunächst, sagte Max Huber, wie und wo können wir aus diesem Dickicht herauskommen?
– Dort!« antwortete der Foreloper.
Er zeigte dabei nach einem Riß in dem Lianennetze, durch den er und seine Gefährten jedenfalls nach dieser Stelle gebracht worden waren. Weiter draußen war ein dunkler und gewundener Pfad zu erkennen, der gangbar zu sein schien.
Wohin dieser Pfad, und ob er vielleicht nach dem Rio führte, war natürlich ganz ungewiß. Er konnte sich ja auch mit anderen kreuzen, was die Gefahr nahe legte, sich in diesem Labyrinth noch mehr zu verirren. Und was blieb nach achtundvierzig Stunden an Nahrungsmitteln übrig, wenn der Rest des Büffels verzehrt war?…
Was sollte dann geschehen?… Für Löschung des Durstes sorgten ja die hier so häufigen Regenfälle, so daß man in dieser Hinsicht nichts zu befürchten brauchte.
»Auf jeden Fall, bemerkte John Cort, kommen wir nicht aus der Verlegenheit, wenn wir hier wie angewurzelt stehen bleiben. Fort müssen wir… hier oder dorthin… aber fort… fort von hier!
– Vorher wollen wir wenigstens erst etwas essen,« sagte Max Huber.
Etwa ein Kilogramm Fleisch wurde nun in drei gleiche Stücke getheilt, und jeder mußte sich mit der dürftigen Mahlzeit begnügen.
»Und wenn man bedenkt, äußerte Max Huber, daß wir nicht einmal wissen, ob wir jetzt ein Frühstück oder ein Mittagessen verzehren?
– Das ist gleichgiltig, meinte John Cort, der Magen bekümmert sich nicht um solche Unterscheidungen.
– Mag sein, er verlangt aber nach einem Trunke, der Magen, und ein paar Tropfen aus dem Rio Johausen würde ich jetzt den edelsten Weinsorten Frankreichs vorziehen!«
Während des Essens waren alle wieder schweigsam geworden. Die herrschende Dunkelheit machte einen beunruhigenden, quälenden Eindruck. Die mit der feuchten Ausdünstung des Erdbodens gesättigte Luft erschien unter dem Laubdache besonders drückend. In der Umgebung, durch die, wie es schien, nicht einmal ein Vogel fliegen konnte, war kein Schrei, kein Ton, kein Flügelschlag zu hören. Höchstens erstarb zuweilen das Geräusch von einem herabfallenden morschen Zweige bei Aufschlagen auf den Teppich schwammähnlicher Moose. der zwischen den Stämmen die Erde bedeckte. Ganz selten ließ sich etwas wie ein schrilles Pfeifen vernehmen, oder ein Rascheln in trockenen Blättern, wenn kleine, kaum über einen halben Meter lange und zum Glück harmlose Schlangen durch diese hinhuschten. Insecten schwirrten wie gewöhnlich umher und waren mit ihren Stichen auch nicht sparsam.
Nach beendeter Mahlzeit erhoben sich alle von der Erde.
Khamis nahm den letzten Rest Büffelfleisch mit und wandte sich dann nach der Oeffnung zwischen den Lianen.
Noch mehrmals rief Max Huber so laut wie möglich nach dem jungen Eingebornen.
»Llanga!… Llanga!… Llanga!«
Vergeblich, nicht einmal ein Echo wiederholte den Namen des Knaben.
»Nun vorwärts!« sagte der Foreloper.
Er schritt den anderen voran.
Kaum hatte er aber den Fuß auf den erwähnten Pfad gesetzt, da rief er schon:
»Ein Licht!«
Max Huber und John Cort eilten ihm nach.
»Etwa die Eingebornen?… fragte der eine.
– Das werden wir ja erfahren,« erwiderte der andere.
Das Licht – höchstwahrscheinlich eine brennende Fackel –leuchtete einige hundert Schritt vor ihnen in der Richtung des Wildpfades. Es erhellte den Wald nur auf einem sehr beschränkten Umkreise und warf einen lebhaften Schein hinauf nach dem hohen Blätterdache.
Wohin bewegte sich der Träger dieser Fackel?… War er allein?… Hatte man einen Angriff zu erwarten oder auf Hilfe zu hoffen?
Khamis und die beiden Freunde zögerten keinen Augenblick, weiter in den Wald einzudringen.
So vergingen zwei bis drei Minuten.
Die Fackel blieb an ihrer Stelle.
Sollte der helle Schein etwa nur von einem Irrlichte herrühren?… Doch nein, dagegen sprach seine Unbeweglichkeit.
»Was beginnen wir nun? fragte John Cort.
– Wir gehen auf das Licht zu, da es nicht zu uns kommt, antwortete Max Huber.
– Also weiter!« sagte Khamis.
Der Foreloper that auf dem Pfade einige Schritte vorwärts.
Sofort begann die Flamme sich zu entfernen, offenbar mochte deren Träger bemerkt haben, daß die drei Fremdlinge sich in Bewegung gesetzt hatten. Es sah fast aus, als wolle er ihnen auf dem Wege durch das Waldesdunkel voranleuchten und sie nach dem Rio Johausen oder nach einem anderen Zuflusse des Ubanghi geleiten.
Jetzt war keine Zeit zu einer Ueberlegung. Es galt zunächst, jenem Lichte zu folgen und womöglich einen Weg nach Südwesten bestimmt wieder zu finden.
So schritten sie denn auf dem schmalen Pfade weiter über einen Boden, wo durch Menschen oder Thiere die Gräser seit längerer Zeit niedergetreten, die Lianen zerrissen und die Gesträuche auseinandergedrängt zu sein schienen.
Ohne von den Bäumen zu reden, die Khamis und seine Gefährten bisher schon zu Gesicht gekommen waren, fanden sich hier auch seltenere Arten, wie die »Gura crepitans« mit explodierenden Früchten – wie man von solchen nur unter der Familie der Euphorbiaceen Amerikas etwas wußte – deren zarte Schale einen milchartigen Stoff umhüllt und deren Nüsse mit starkem Geräusch zerplatzen, wodurch sie die Samenkerne weithin ausstreuen; ferner den »Tsofar«, den Pfeiferbaum, zwischen dessen Zweigen der Wind wie durch einen schmalen Spalt hindurchpfiff, und über dessen Vorkommen bisher nur aus den nubischen Wäldern berichtet wurde.
John Cort, Max Huber und Khamis marschierten so gegen drei Stunden lang weiter, und als sie nach dieser beschwerlichen Wanderung Halt machten, blieb gleichzeitig das Licht still stehen.
»Entschieden ist das ein Führer, erklärte Max Huber, ein höchst gefälliger Führer!… Wenn wir nur wüßten, wohin er uns geleiten will.
– Mag er uns nur aus diesem Labyrinth führen, antwortete John Cort, mehr verlange ich von ihm gar nicht. Nun, Max, erscheint Dir das außergewöhnlich genug?
– Ja wahrlich… reichlich genug!
– Wenn’s nur nicht noch mehr als genug wird, lieber Freund!« setzte John Cort hinzu.
Den ganzen Nachmittag über verlief der vielfach gewundene Pfad unter einem immer dunkler werdenden Laubgewölbe weiter. Khamis blieb an der Spitze, seine Begleiter folgten ihm im Gänsemarsch, denn es war nicht mehr Raum als für eine Person vorhanden. Wenn sie einmal schneller ausschritten, um sich ihrem Führer zu nähern, so beschleunigte auch dieser seine Gangart und hielt sich immer in gleichbleibender Entfernung.
Gegen sechs Uhr abends konnten seit dem Aufbruche –schätzungsweise – nur vier bis fünf Lieues zurückgelegt worden sein. Khamis beharrte aber trotz aller Erschöpfung dabei, dem Lichte nachzugehen, so lange es sichtbar blieb.
Schon wollte er sich eben wieder in Gang setzen, da erlosch plötzlich die Fackel.
»Machen wir Halt, sagte John Cort, das ist offenbar ein uns geltendes Zeichen.
– Oder vielmehr ein Befehl, meinte Max Huber.
– Dem wir ohne Widerrede nachkommen wollen, ließ sich Khamis vernehmen. Wir wollen die Nacht hier an dieser Stelle verbringen.
– Ja… doch morgen?… fragte John Cort. Wird denn das Licht morgen wieder auftauchen?«
Wer konnte das wissen?
Alle drei streckten sich am Fuße eines Baumes nieder.
Wiederum wurde ein Stück von dem Büffel vertheilt, und zum Glück konnte man seinen Durst mit dem Wasser eines Bächleins stillen, das zwischen dem Grase hinrieselte.
Trotz der Häufigkeit des Regens in diesem Waldgebiete war doch seit achtundvierzig Stunden kein Tropfen Niederschlag gefallen.
»Wer weiß selbst, bemerkte John Cort, ob unser Führer nicht gerade diese Stelle für uns ausgewählt hat, damit wir etwas zu trinken fänden?
– Eine zarte Aufmerksamkeit,« gestand Max Huber, während er mittels eines dütenförmig zusammengebogenen Blattes sich etwas frisches Wasser schöpfte.
Wie beunruhigend die Sachlage auch erschien, die Müdigkeit trug doch den Sieg davon und der Schlaf ließ nicht auf sich warten. John Cort und Max Huber schlummerten jedoch nicht ein, ohne von Llanga gesprochen zu haben… Das arme Kind!… War es in der Stromschnelle ertrunken?… Und wenn der Knabe gerettet worden war, warum hatte man ihn nicht wiedergesehen?… Warum war er nicht zu seinen Freunden Max und John gekommen?
Als die Schläfer erwachten, verrieth ein durch die Zweige fallender Dämmerschein, daß es wieder Tag war. Khamis glaubte annehmen zu dürfen, daß sie in östlicher Richtung hingeführt worden seien. Leider war das die falsche Seite, und dennoch blieb ihnen nichts übrig, als in derselben Richtung weiter zu wandern.
»Und das Licht?… sagte John Cort.
– Eben blitzt es dort wieder auf, antwortete Khamis.
– Meiner Treu, rief Max Huber, das ist ja rein der Stern der drei Könige aus dem Morgenlande! Leider führt er uns nicht dem Abendlande entgegen, und wann werden wir unser Bethlehem erreichen?«
Im Laufe des 22. März ereignete sich nichts besonderes. Die Fackel führte die kleine Truppe unausgesetzt nach Osten weiter.
Auf jeder Seite des Pfades erschien der Hochwald ganz undurchdringlich, so dicht standen die Bäume an einandergedrängt und mit einem unentwirrbaren Knäuel von Gestrüpp verbunden. Es sah aus, als ob der Foreloper und seine Gefährten sich in einem endlosen Schlauch von Grün verloren hätten. An einzelnen Stellen jedoch durchschnitten ebenso schmale Pfade, wie der, auf dem sie hinmarschierten, den von dem Führer eingeschlagenen Weg, und ohne diesen Anhalt hätte Khamis nicht gewußt, welchen er einschlagen sollte.
Kein einziger Wiederkäuer hatte sich bisher wieder gezeigt, diese großen Thiere hätten auch wohl kaum hierher vordringen können… keine der Fährten, die dem Foreloper so nützlich gewesen waren, nach dem Rio Johausen zu kommen. Wären die Jäger auch noch im Besitz ihrer Gewehre gewesen, hier hätten sie sie nicht gebrauchen können, denn es wäre ihnen doch kein Stück Wild vor deren Mündung gekommen.
Max Huber, John Cort und der Foreloper sahen mit Besorgniß, daß ihr Proviant mehr und mehr zu Ende ging.
Noch eine Mahlzeit, dann konnte nichts mehr davon übrig sein.
Und wenn sie morgen nicht am Ziele anlangten, das heißt, am Ende dieser merkwürdigen Wanderung unter Verfolgung jenes geheimnißvollen Lichtscheins, was sollte dann aus ihnen werden?
Wie am Tage vorher, erlosch gegen Abend die Fackel, und wie die vorhergehende, verlief auch diese Nacht ohne jede Störung.
Als John Cort wieder zuerst aufgestanden war, weckte er seine Gefährten sofort mit dem Rufe:
»Während wir schliefen, ist jemand hier gewesen!«
In der That war ein Feuer angezündet worden, von dem noch eine ruhige Gluth übrig war, und ein Stück Antilope hing an dem niedrigen Zweige einer Akazie über dem kleinen Bache.
Diesmal ließ Max Huber nicht einmal einen Ausruf der Ueberraschung hören. Weder er, noch seine Gefährten wollten über die Seltsamkeit ihrer Lage grübeln, so wenig wie über den unbekannten Führer, der sie über ebenso unbekannte Pfade leitete, über diesen guten Geist des großen Waldes, dem sie nun schon seit vorgestern nachfolgten.
Da alle jetzt tüchtigen Hunger verspürten, röstete Khamis das vorgefundene Stück der Antilope, das für die Mittags- und die Abendmahlzeit recht gut ausreichte.
Bald darauf gab die Fackel das Signal zum Aufbruche.
Die Wanderung verlief nochmals unter den gewöhnlichen Verhältnissen. Am Nachmittage fiel es jedoch auf, daß der Hochwald nach und nach weniger dicht wurde. Mindestens durch die Gipfel der Bäume. drang etwas mehr Licht herein.
Immerhin war es noch nicht möglich, das unbekannte Wesen, das wie gewöhnlich vorausging, auch nur unbestimmt zu erkennen.
Wie am Tage vorher wurden auch heute – schätzungsweise –fünf bis sechs Lieues zurückgelegt. Vom Rio Johausen ab mochte die Strecke bis hierher gegen sechzig Kilometer messen.
Am Abend machten Khamis, John Cort und Max Huber, sobald die Fackel erlosch, wieder Halt. Die Nacht kam offenbar heran, denn eine tiefe Finsterniß lagerte sich allmählich über die Waldung. Von der langen Wanderung ermüdet und nachdem sie das noch vorhandene Stück von der Antilope verzehrt und sich mit frischem Quellwasser erquickt hatten, legten sich alle am Fuße eines Baumes nieder und versanken bald in tiefen Schlummer.
Da glaubte Max Huber – jedenfalls im Traume – die Töne eines Instruments zu vernehmen, auf dem, hoch über ihm – der so bekannte… Walzer aus dem »Freischütz« von Weber gespielt wurde…
Dreizehntes Capitel.
Das Dorf in den Lüften
Beim Erwachen am nächsten Morgen bemerkten der Foreloper und seine Gefährten zu ihrer größten Verwunderung, daß die Dunkelheit in diesem Theile des Waldes eher noch ärger war als vorher. – Ob es wohl Tag war?… Keiner hätte es sagen können. Merkwürdigerweise tauchte aber auch der Lichtschein nicht wieder auf, der ihnen seit sechzig Stunden den Weg gewiesen hatte. Die drei Männer sahen sich also gezwungen, zu warten, bis dieser sich aufs neue zeigte.
Da machte John Cort noch eine Bemerkung, aus der seine Gefährten und er sofort gewisse Schlüsse zogen.
»Mir fällt besonders auf, sagte er, daß wir heute Morgen keine glimmende Feuerstätte vorfanden, und in der Nacht auch jedenfalls niemand hierher gekommen ist, um uns mit dem nöthigen Mundvorrath zu versorgen.
– Das ist um so schlimmer, setzte Max Huber hinzu, da wir nichts mehr übrig haben.
– Vielleicht, meinte der Foreloper, ist das ein Zeichen, daß wir angekommen sind…
– Wo denn? fragte John Cort.
– Da, wohin wer weiß wer uns geführt hat, lieber John!«
Das war freilich eine Antwort so gut wie keine, doch wer hätte eine bessere ertheilen können?
Ferner: War der Wald auch jetzt noch dunkler, so schien er doch keineswegs schweigsamer zu sein. Man hörte eine Art Summen in der Luft, ein wirres Getöse, das aus den Aesten oben herabdrang. Als sie in die Höhe sahen, erkannten Khamis, John Cort und Max Huber, wenn auch nur unklar, eine Art von großer Holzdecke etwa hundert Fuß über dem Erdboden.
Zweifellos dehnte sich da oben eine erstaunliche Menge durcheinander gewachsener Aeste und Zweige aus, ohne jeden Zwischenraum, durch den das Tageslicht hätte herunterleuchten können. Ein dickes Strohdach wäre für Lichtstrahlen nicht undurchdringlicher gewesen. Das erklärte wenigstens die Dunkelheit, die unter den Bäumen herrschte.
An der Stelle, wo die drei Männer die Nacht verbracht hatten, zeigte sich auch die Natur des Erdbodens auffallend verändert.
Hier stand kein ineinander verwirrtes Gesträuch, keine der stachlichen Sisiphusarten, die früher den Pfad auf beiden Seiten begrenzten. Ueberall ein fast glatter Rasen, auf dem kein Wiederkäuer hätte weiden können. Er glich mehr einer Wiese, die niemals von einem Tropfen Regen oder einer Quelle benetzt würde.
Die Bäume, die hier in Zwischenräumen von zwanzig bis dreißig Fuß standen, ähnelten eigentlich den Grundpfeilern eines riesigen Bauwerks und ihre Kronen mußten wohl eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern bedecken.
Hier erhoben sich in Gruppen afrikanische Sykomoren, deren Stamm aus mehreren, mit einander verbundenen Schäften besteht, Bombaxbäume mit glattem, rundem Stamm und riesigen Wurzeln, die in der Größe die aller anderen übertreffen; ferner Baobabs, erkennbar an der bauchigen Flaschenform am unteren Theile, wo sie einen Umfang von zwanzig bis dreißig Metern haben, und über den eine ungeheuere Laube von Zweigen herabhängt; weiter noch
»Dumpalmen« mit gegabeltem Stamme, »Delebpalmen«, die einen höckerigen Schaft haben, Wollbäume, deren Stamm eine Reihe so großer Aushöhlungen aufweist, daß sich ein Mensch bequem darin bewegen kann, Acajons mit Wurzelschößlingen von anderthalb Meter Durchmesser, aus denen man wohl fünfzehn bis achtzehn Meter lange, drei bis vier Tonnen große Boote herstellt, endlich Bauhinias, die unter anderen Breiten nur als Büsche vorkommen, hier aber die Riesen aus der Familie der Leguminosen darstellen. Man kann sich wohl denken, welch ungeheuere Ausbreitung die Kronen dieser Bäume in der Höhe von einigen hundert Fuß haben mochten.
Eine Stunde verstrich ohne Aenderung der Sachlage. Khamis ging unausgesetzt nach allen Seiten hin und her und spähte nach der früher führenden Fackel. Warum hätte er dem unbekannten Führer auch nicht noch weiter folgen sollen? Sein Instinct in Verbindung mit gelegentlichen Beobachtungen sagte ihm freilich, daß er immer nach Osten zu gegangen sei. Das war aber nicht die Seite, wo der Ubanghi verlief, nicht der Weg, der ihn zurückführte. Wohin mochte er sich unter Leitung jenes Lichtscheines verirrt haben?
Was war zu thun, da dieser nicht wieder sichtbar wurde?…
Von hier weggehen?… Doch wohin?… Hier bleiben?… Sich ernähren, so gut es anging?… Schon meldeten sich der Hunger und der Durst wieder recht bedenklich.
»Wir werden aber, begann John Cort, trotz alledem gezwungen sein, aufzubrechen, und ich frage mich, ob es nicht das rathsamste ist, sofort weiter zu wandern.
– Nach welcher Seite denn?« warf Max Huber ein.
Das war freilich eine wichtige Frage, zu deren Beantwortung es an jeglicher Handhabe fehlte.
»Kurz und gut, fuhr John Cort ungeduldig fort, so viel ich weiß, sind wir hier doch nicht festgewurzelt. Der Weg zwischen den Bäumen steht ja offen und es ist nicht mehr so dunkel, daß man sich nicht zurechtfinden könnte.
– So kommen Sie!« rief Khamis.
Alle drei gingen etwa einen Kilometer vorsichtig weiter. Der Weg führte unverändert über einen strauch- und buschlosen Boden, über einen nackten und so trockenen Teppich, als läge er unter einem für Regen und Sonnenstrahlen ganz undurchdringlichen Dache.
Ueberall dieselben Bäume, von denen nur die untersten Aeste zu sehen waren. Und noch immer der konfuse Lärm, der von oben herabzuschalten schien und dessen Ursprung ganz unerklärbar blieb.
Der Wald schien unter dem Laubdache nicht gänzlich öde und verlassen zu sein. Wiederholt glaubte Khamis Schattengestalten zwischen den Bäumen hinschlüpfen zu sehen, ohne sich klar zu werden, ob er sich täusche oder nicht.
Nach einer halben Stunde erfolgloser Umschau setzten sich seine Gefährten und er nahe am Stamme einer Bauhinia nieder.
Ihre Augen hatten sich an die, übrigens langsam abnehmende Dunkelheit schon etwas gewöhnt. Infolge des Aufsteigens der Sonne wurde es unter der den Erdboden überspannenden Decke ein wenig heller. Schon konnte man auf zwanzig Schritte alles deutlicher erkennen.
Da flüsterte der Foreloper den anderen zu;
»Dort unten bewegt sich etwas…
– Ein Thier oder ein Mensch? fragte John Cort, während er nach der bezeichneten Richtung hinausblickte.
– Jedenfalls könnte es nur ein Kind sein, sagte der Foreloper.
Der kleinen Gestalt nach…
– Sapperment, das ist ein Affe!« unterbrach ihn Max Huber.
Unbeweglich starrten alle hinaus, um den vermuthlichen Vierhänder nicht zu verscheuchen. Gelang es, sich seiner zu bemächtigen… nun… trotz des von Max Huber und John Cort geäußerten Widerwillens gegen Affenfleisch… freilich, wie hätte das ohne Feuer geröstet oder gebraten werden sollen?
Das seltsame Wesen kam näher heran, verrieth aber keinerlei Erstaunen. Es ging auf den Hinterbeinen und blieb wenige Schritte vor den Männern stehen.
Wie verblüfft waren aber John Cort und Max Huber, als sie jetzt das merkwürdige Geschöpf erkannten, das Llanga gerettet hatte, jenen Schützling des jungen Eingebornen.
Da schwirrten plötzlich die Worte durcheinander:
»Er… das ist er!
– Unzweifelhaft!
– Doch da dieser Kleine hier erscheint, warum sollte Llanga nicht ebenfalls hier sein?
– Sind Sie sicher, daß Sie sich nicht täuschen? fragte der Foreloper.
– Ganz sicher, erklärte John Cort, übrigens werden wir davon sogleich einen Beweis haben!«
Damit zog er die von dem Halse des Kleinen genommene Denkmünze aus der Tasche und ließ sie, die Schnur in der Hand haltend, hin und her pendeln wie ein Spielzeug, das man einem Kinde bietet, um es heranzulocken.
Kaum hatte der Kleine die Denkmünze bemerkt, als er schon mit einem Satze darauf zu sprang. Jetzt war er nicht mehr krank! In den verflossenen drei Tagen hatte er seine Gesundheit und auch seine Gelenkigkeit wieder erlangt. Er stürzte auf John Cort zu mit der deutlichen Absicht, sein Eigenthum wieder in Empfang zu nehmen.
Khamis ergriff ihn bei dieser Bewegung; jetzt entschlüpfte dem Munde des Kleinen aber nicht das Wort »Ngora«, sondern er rief deutlich:
»Li-Maï!… Ngala… Ngala!«
Was diese Wörter einer selbst Khamis völlig unbekannten Sprache wohl bedeuten könnten, darüber nachzudenken hatten die drei Männer jetzt keine Zeit. Plötzlich tauchten nämlich weitere Vertreter derselben Rasse auf, aber lauter Erwachsene, die vom Kopf bis zu den Füßen mindestens fünfundeinhalb Fuß maßen.
Khamis, John Cort und Max Huber hatten noch nicht bestimmt erkennen können, ob sie es hier mit Menschen oder mit Vierhändern zu thun hätten.
Dem reichlichen Dutzend von Bewohnern des großen Waldes Widerstand leisten zu wollen, wäre ganz nutzlos gewesen. Der Foreloper, Max Huber und John Cort wurden an den Armen gepackt, vorwärts gedrängt und gezwungen, zwischen den Bäumen hin zu gehen, und von der Bande umringt, kamen sie erst nach einem Wege von fünf- bis sechshundert Metern zum Stillstehen.
An dieser Stelle hatten es zwei nahe bei einander und schräg stehende Bäume ermöglicht, dazwischen dünne Aeste wie eine Art Stufen zu befestigen. Wenn auch keine Treppe, war das doch besser als eine Leiter. Fünf oder sechs Individuen kletterten darauf voraus, während die übrigen ihre Gefangenen, ohne sie übrigens zu mißhandeln, zwangen, jenen auf dem nämlichen Wege zu folgen.
Je höher man hinauskam, desto heller glänzte das Licht durch das Laubwerk. Da und dort blitzten sogar einzelne Sonnenstrahlen hindurch, deren Khamis und seine Gefährten seit dem Aufbruche vom Rio Johausen beraubt gewesen waren.
Max Huber hätte ein arger Zweifler sein müssen, nicht zuzugestehen, daß das, was er hier erlebte, zur Kategorie des ganz außergewöhnlichen gehörte.
Als der Aufstieg etwa hundert Fuß über der Erde ein Ende nahm, welche Ueberraschung harrte ihrer da! Vor sich sahen sie eine hell vom Himmelslicht beleuchtete Plattform liegen.
Darüber wölbten sich die üppiggrünen Gipfel der Bäume.
Darauf aber standen in leidlicher Ordnung aus gestampfter Erde und Laub erbaute Hütten, die wirkliche Straßen bildeten.
Das Ganze stellte also ein in dieser Höhe errichtetes Dorf dar, dessen Grenzen sich vorläufig dem Blicke entzogen.
Hier schwärmten eine Menge Eingeborner umher, Leute mit ähnlichem Typus, wie dem des Schützlings Llanga’s. Ihre mit der des Menschen übereinstimmende Haltung ließ erkennen, daß sie aufrecht zu gehen gewöhnt waren, sie hatten also das Recht zur Bezeichnung als Erectus – die der Doctor Eugène Dubois den in den Wäldern Javas aufgefundenen Pitheranthropen beigelegt hatte
– womit er einen
anthropogenischen Charakter andeuten wollte, den der genannte Gelehrte, unter Anlehnung an die Lehre Darwin’s als das wichtigste Mittelglied zwischen dem Menschen und dem Affen betrachtete.
Wenn die Anthropologen behaupten, daß auch die am höchsten entwickelten Vierhänder unter dem Affengeschlechte, die, die sich ihrer Körpergestalt nach dem Menschen am meisten nähern, sich von diesem durch die Eigenthümlichkeit unterscheiden, daß sie sich ihrer vier Gliedmaßen bedienen, wenn sie fliehen, so schien es doch, daß diese Bemerkung für die Bewohner des Dorfes in den Lüften nicht zutreffen könne.
Khamis, Max Huber und John Cort mußten es jedoch auf spätere Zeit verschieben, hierüber weitere Beobachtungen zu sammeln. Ob diese Wesen nun wirklich zwischen Thier und Mensch standen oder nicht, jedenfalls trieb die Rotte, die in einem ganz unverständlichen Idiome eifrig hin und her sprach, die drei Männer einer Hütte zu, ohne daß die übrigen Dorfbewohner darüber besonders erstaunt zu sein schienen.
Die Thür der Hütte wurde hinter ihnen zugeschlagen und sie sahen sich darin auf Gnade und Ungnade gefangen gesetzt.
»Das ist ja recht hübsch! begann Max Huber. Was mich am meisten wundert, ist, daß diese originellen Kerle uns gar keine Aufmerksamkeit zu schenken scheinen. Sollten sie schon früher Menschen zu Gesicht bekommen haben?…
– Das ist ja möglich, antwortete John Cort. Mich verlangt nur zu wissen, ob sie ihre Gefangenen auch zu ernähren gewohnt sind…
– Oder ob sie sich nicht vielmehr selbst von diesen nähren!«
setzte Max Huber hinzu.
In der That, wenn unter den Volksstämmen Afrikas die Munbuttus und auch andere noch heute der Menschenfresserei huldigen, warum sollten die Waldmenschen hier, die auf noch tieferer Stufe standen als jene, ihresgleichen nicht ebenfalls –wenigstens gelegentlich – zu verzehren pflegen?
Jedenfalls bilden diese Wesen Anthropoïden, aber eine höher stehende Art, als etwa die Orangs auf Borneo, die Schimpansen Guineas und die Gorillas von Gabon, die äußerlich dem Menschen so nahe stehen.
Sie verstanden ja, Feuer zu machen und es zu mancherlei häuslichen Zwecken zu verwenden, das bewies die Feuerstätte bei dem ersten Nachtlager und ebenso die Fackel, die der Führer durch die Finsterniß des Waldes getragen hatte. Da tauchte auch der Gedanke auf, daß die am Waldessaume früher beobachteten, beweglichen Fackeln von diesen seltsamen Bewohnern des großen Waldes angezündet gewesen sein möchten.
In Wahrheit darf man glauben, daß gewisse Vierhänder sich des Feuers bedienen. So berichtet z. B. Emir Pascha, daß in den Waldungen von Msokgonien in warmen Sommernächten große Banden von Schimpansen ihr Unwesen treiben, daß sie brennende Fackeln benutzen und damit Raubzüge durch die Pflanzungen unternehmen.
Im vorliegenden Falle verdient es ferner Beachtung, daß diese Wesen von unbekannter Art bezüglich der Haltung und des Ganges dem Menschen völlig gleich erschienen. Kein anderer Vierhänder wäre würdiger des Namens »Orang« gewesen, der ja genau mit »Waldmensch« zu übersetzen ist.
»Und obendrein können sie sprechen, bemerkte John Cort, als die drei Männer ihre vorläufigen Wahrnehmungen bezüglich der Insassen dieses Dorfes in den Lüften austauschten.
– Na schön, rief Max Huber, wenn sie sprechen können, müssen sie auch Wörter haben, allerlei ausdrücken zu können, und ich wäre gar nicht böse, davon die zu kennen, mit denen man »Ich sterbe vor Hunger!« sagen kann.«
Von den drei Gefangenen erschien Khamis der am meisten betroffene zu sein. Ihm wollte es nicht in den Kopf. – der anthropologischen Erörterungen überhaupt abhold war – daß diese Thiere keine Affen wären. Es wären Affen, die aufrecht gehen, sprechen und Feuer anzünden könnten, die in wirklichen Dörfern wohnten, doch schließlich immer nichts als Affen. Er empfand es schon als etwas ganz außerordentliches, daß der Wald derartige Wesen beherberge, Geschöpfe, von denen er noch nie etwas gehört hatte.
Seine Würde als Eingeborner des Schwarzen Erdtheils litt darunter, daß diese Thiere »ihrer natürlichen Begabung nach seinen eigenen Landsleuten so nahe ständen«.
Es giebt Gefangene, die sich ruhig in ihr Schicksal begeben, und andere, die das nicht thun. John Cort und der Foreloper, vorzüglich aber der ungeduldige Max Huber, gehörten zu der ersten Art nicht. Außer der Unbehaglichkeit, in dieser Hütte eingesperrt zu sein und nichts von der Außenwelt sehen zu können, beunruhigte sie nicht wenig die Unsicherheit bezüglich der Zukunft, die Ungewißheit des Ausgangs dieses Abenteuers.
Dazu quälte sie obendrein der Hunger, denn seit fünfzehn Stunden hatten sie keinen Bissen gegessen.
Einen Umstand gab es jedoch, auf den sie eine, wenn auch schwache Hoffnung gründen konnten, nämlich den, daß ja der Schützling Llangas in diesem Dorfe, wahrscheinlich seiner Heimat, bei seiner Familie wohnte, vorausgesetzt, daß es das, was man eine Familie nennt, bei den Waldmenschen von Ubanghi überhaupt gäbe.
»Da nun, wie John Cort sagte, der Kleine aus dem Strudel gerettet worden ist, dürfen wir dasselbe wohl auch bezüglich Llangas annehmen. Die beiden werden sich nicht getrennt haben, und wenn Llanga hört, daß drei Männer ins Dorf eingebracht worden sind, wie sollte er nicht darauf kommen, daß wir diese wären?… Uns hat man bis jetzt kein Uebel angethan, und wahrscheinlich dem Llanga doch auch nicht.
– Wer weiß? Der Schützling ist heil und gesund, meinte Max Huber, doch ob sein Beschützer und Pfleger auch?… Es liegt kein Beweis dafür vor, daß der arme Llanga nicht im Rio ertrunken wäre.«
In der That gab es dafür keinen.
In diesem Augenblick aber öffnete sich die von zwei kräftigen Burschen bewachte Thür der Hütte, in der der junge Eingeborne erschien.
»Llanga!… Llanga! riefen die beiden jungen Männer wie aus einem Munde.
– Guter Freund Max… lieber Freund John! antwortete Llanga, der diesen in die Arme fiel.
– Seit wann bist Du hier? fragte der Foreloper.
– Seit gestern Morgen.
– Und wie bist Du hierher gekommen?
– Sie haben mich durch den Wald getragen.
– Nun, die Dich getragen haben, müssen schneller gegangen sein, als wir, Llanga.
– Ja, sehr schnell.
– Wer hat Dich denn getragen?
– Einer von denen, die mich, die auch Sie alle gerettet hatten.
– Menschen? Wirklich Männer?
– Ja wohl, Menschen… nein, keine Affen.«
Der junge Eingeborne blieb immer bei seiner Anschauung.
Jedenfalls waren es aber Zugehörige einer untergeordneten Rasse, die gegenüber der Menschheit das Prädicat
»minderwerthig« verdiente, eine besondere Rasse von Urgeschöpfen, vielleicht des Geschlechtes der Anthropopitheken, die der Stufenleiter des Thierreiches bisher fehlten.
Mit kurzen Worten erzählte nun Llanga seine Geschichte, wobei er wiederholt dem Franzosen und dem Amerikaner die Hand küßte, den beiden Freunden, die wie er aus dem Wasser gezogen worden waren, als die Stromschnelle sie verschlang, und die er nie wiederzusehen gefürchtet hatte.
Als das Floß an die Felsblöcke anprallte, waren er und Li-Mar in den Strudel geschleudert worden.
»Li-Maï? rief Max Huber.
– Ja, Li-Maï, so heißt er. Er hat seinen Namen, indem er auf sich zeigte, wiederholt vor mir ausgesprochen.
– Er hat also einen Namen? fragte John Cort.
– Unzweifelhaft, John!… Wenn man sprechen kann, ist es doch ganz natürlich, auch einen Namen zu haben.
– Und hat diese Sippe, diese Völkerschaft, oder was sie sonst sein mag, ebenfalls einen Namen? fragte John Cort.
– Ja… die Wagddis heißen sie, antwortete Llanga. Ich habe Li-Maï sie Wagddis nennen hören.«
Der congolesischen Sprache gehört dieses Wort nicht an.
Doch, ob Wagddis oder nicht, jedenfalls hatten sich Eingeborne am linken Ufer des Rio Johausen befunden, als der Unfall sich ereignete. Die einen sprangen da auf die Barre, um Khamis, John Cort und Max Huber zu helfen, wozu sie sich ohne Zögern ins Wasser stürzten, die anderen retteten auf gleiche Weise Llanga und den kleinen Li-Maï. Llanga hatte bereits das Bewußtsein verloren gehabt; er erinnerte sich nicht mehr, was später geschehen wäre, und glaubte, seine Freunde müßten in dem tosenden Wasser umgekommen sein.
Als Llanga wieder zu sich kam, sah er sich in den Armen eines Wagddi, des Vaters Li-Maïs, während dieser in den Armen seiner »Ngora«, seiner Mutter, lag. Hier ließ sich nur annehmen, daß der Kleine, einige Tage, bevor Llanga ihn
»auffischte«, sich im Walde verirrt haben mochte, und daß seine Eltern sich aufgemacht hatten, nach ihm zu suchen. Der Leser weiß, wie Llanga das Kind gerettet hatte, und daß dieses ohne seine muthige Hilfe umgekommen wäre.
Wohl verwahrt und gepflegt war Llanga dann nach dem Wagddidorfe gebracht worden. Li-Maï kam sehr bald wieder zu Kräften, da er nur vor Hunger und Erschöpfung krank gewesen war. Erst der Schützling Llanga’s, wurde er nun dessen Beschützer. Der Vater und die Mutter Li-Maï’s hatten sich gegen den jungen Eingebornen sehr dankbar erwiesen.
Eine gewisse Dankbarkeit erkennt man ja auch an Thieren für diesen geleistete Dienste, und warum sollte sie nicht bei Wesen anzutreffen sein, die über diesen stehen?
Kurz, am heutigen Morgen war Llanga nach der Hütte hier geführt worden. Aus welchem Grunde, wußte jener zunächst natürlich nicht. Da vernahm er aber Stimmen, und bei aufmerksamerem Lauschen erkannte er die John Cort’s und Max Huber’s.
Das war es also, was seit dem unglücklichen Vorfalle auf dem Rio geschehen war.
»Gut, Llanga, gut! sagte Max Huber, doch wir sterben vor Hunger und bevor wir Deinen weiteren Bericht anhören…
wenn es Dir bei Deinen ernsten Protectionen möglich wäre….
Llanga lief hinaus und kam sehr bald mit einigem Mundvorrath zurück, mit einem großen Stück gerösteten und gesalzenen Büffelfleisches, einem halben Dutzend Früchten der Acacia adansonia, gewöhnlich »Affenbrod« genannt, mit frischen Bananen und einer Art Kürbisflasche mit klarem Wasser, dem etwas Lutex-Milchsaft zugesetzt war, ein Saft, der aus einer Kautschukliane von der Art der Landolphia africana quillt.
Das Gespräch wurde jetzt selbstverständlich unterbrochen.
John Cort, Max Huber und Khamis hatten ein so starkes Bedürfniß nach Nahrung, daß sie nicht im geringsten wählerisch waren. Von dem Büffelstücke, dem Brode und den Bananen ließen sie nur die Knochen und die häutigen Schalen übrig.
Darauf fragte John Cort den jungen Eingebornen, ob die Wagddis ein sehr volkreicher Stamm wären.
»O, es sind viele… sehr viele! Ich habe ihrer eine große Zahl in den Straßen und den Hütten gesehen, antwortete Llanga.
– Ebenso viele Leute, wie in den Dörfern von Burnu oder Baghirmi?
– Jawohl!
– Und sie begeben sich niemals auf die Erde hinunter?…
– O doch; um zu jagen, oder um Wurzeln und Früchte oder auch Wasser zu holen.
– Und sie sprechen auch?
– Gewiß, ich verstehe sie nur nicht. Und doch… zuweilen einzelne Wörter… Wörter, die mir bekannt sind… wie wenn Li-Maï spricht.
– Und der Vater, die Mutter des Kleinen?
– Die sind sehr gut gegen mich. Was ich hier gebracht hatte, kam von ihnen.
– Ich wünsche herzlich, den Leuten dafür danken zu können, sagte Max Huber.
– Wie heißt denn das Dorf in den Bäumen?
– Ngala.
– Giebt es in dem Dorfe auch einen Häuptling? fragte John Cort.
– Ja.
– Hast Du ihn schon gesehen?
– Nein, das nicht. Ich habe aber gehört, daß sie ihn Mselo-Tala-Tala nannten.
– Das sind Worte der Eingebornen! rief Khamis.
– Und was bedeuten sie?
– Der »Vater Spiegel«, antwortete der Foreloper.
So bezeichnen die Congolesen in der That einen Mann, der eine Brille trägt.
Vierzehntes Capitel.
Die Wagddis
Seine Majestät Mselo-Tala-Tala, König des Stammes der Wagddis, Beherrscher des Dorfes in den Lüften… war das nicht genug, die geheimsten Wünsche Max Huber’s zu erfüllen? Hatte seine überschwängliche französische Phantasie ihm nicht alles vorgegaukelt, was er hier verwirklicht fand, alle diese Geheimnisse des Waldes von Ubanghi, neue Volkstypen, unbekannte Wohnstätten, eine ganz außergewöhnliche Welt, von der niemand eine Ahnung hatte? Nun, jetzt war ihm doch wohl nach Wunsch gedient.
Er war auch der erste, sich selbst zu loben wegen seiner richtig eingetroffenen Ahnungen, und er hörte damit erst auf, als John Cort zu ihm sagte:
»Ja, ja, lieber Freund, Du bist wie jeder Dichter mit einem Seherblick begabt und hast deshalb alles vorher errathen…
– Richtig, lieber John, doch welcher Art die Wagddis, die Halbmenschen, auch sein mögen, hab’ ich doch nicht die geringste Lust, mein Leben in ihrer Hauptstadt zu beschließen.
– Aber, liebster Max, wir müssen doch eine Zeit lang hier bleiben, um diese Rasse vom ethnologischen und anthropologischen Standpunkt aus zu studieren und später darüber einen dickleibigen Quartband zu veröffentlichen, der alle Akademien der beiden Welten in Aufruhr versetzen wird.
– Jawohl, erwiderte Max Huber, wir wollen gern beobachten, vergleichen, alle die Frage der Anthropomorphie berührenden Dinge ausspähen, doch nur unter zwei Bedingungen…
– Deren erste wäre…?
– Daß man uns, und das erwarte ich ja, volle Freiheit gewährt, im Dorfe hin- und herzugehen.
– Und die zweite?
– Daß uns, wenn wir uns hier unbehindert bewegt haben, gestattet wird, fortzugehen, sobald es uns paßt.
– An wen sollen wir uns aber deshalb wenden?
– An Seine Majestät den Vater Spiegel, antwortete Max Huber. Doch, das giebt mir die Frage ein: Warum mögen ihn seine Unterthanen wohl so nennen?
– Und noch dazu in congolesischer Sprache? setzte John Cort hinzu.
– Sollte Seine Majestät vielleicht kurz oder weitsichtig sein, und deshalb eine Brille tragen? fuhr Max Huber fort.
– Dabei entsteht wieder die Frage, woher diese Brille stammen möge, bemerkte John Cort.
– Mag das sein, woher es will, meinte Max Huber, wenn wir erst imstande sind, mit diesem Souverän zu verhandeln, ob er nun unsere Sprache versteht oder wir die seinige gelernt haben, jedenfalls machen wir ihm dann den Vorschlag, ein Schutz-und Trutzbündniß mit Amerika und Frankreich abzuschließen, er aber wird darauf nicht umhin können, uns das Großkreuz des Wagddischen Hausordens zu verleihen.«
Max Huber sprach sich recht zuversichtlich aus, indem er darauf rechnete, daß sie sich hier würden frei umher bewegen und das Dorf nach Belieben verlassen können. Wenn aber Khamis, John Cort und er in der Factorei nicht wieder erschienen, wer könnte da auf den Gedanken kommen, sie im Dorfe Ngala im Herzen des großen Waldes zu suchen? Kam überhaupt niemand von der Karawane zurück, so konnte das nur dahin gedeutet werden, daß diese im Gebiete des oberen Ubanghi mit Mann und Maus zu Grunde gegangen sei.
Die Frage, ob Khamis und seine Gefährten als Gefangene in der Hütte eingesperrt bleiben sollten, fand da fast augenblicklich ihre Entscheidung. Eben schwengte die Thür an ihren Lianenbändern zurück und Li-Maï erschien in der Oeffnung.
Zunächst ging der Kleine auf Llanga zu und überhäufte ihn mit Liebkosungen, die dieser gutherzig erwiderte. John Cort fand dabei Gelegenheit, sich das seltsame Geschöpfchen näher anzusehen. Da die Thür aber offen blieb, schlug Max Huber vor, hinauszugehen und sich unter die Luftbewohner zu mischen.
Jetzt befanden sie sich also im Freien und wurden von dem kleinen Wilden – so durfte man ihn wohl nennen – der seinen Freund Llanga an der Hand hielt, geleitet. Sie sahen sich an einer Art Straßenkreuzung, über die viele Wagddis, »ihren Geschäften nachgehend«, von allen Seiten hineilten.
Der Platz war mit Bäumen bepflanzt, oder vielmehr von deren Kronen beschattet, während die Stämme das merkwürdige Bauwerk in der Luft trugen. Dieses selbst ruhte, etwa hundert Fuß über der Erde, auf den Hauptästen mächtiger Bauhinias, Wollbäume und Baobabs. Auf fest mit Pflöcken und Lianen verbundenen Planken war eine Lage festgestampfter Erde ausgebreitet, und da deren Unterstützungspunkte sehr haltbar und zahlreich waren, bewegte sich der künstliche Boden unter dem Fuße nicht im geringsten. Selbst wenn heftige Stürme durch die hohen Wipfel brausten, erlitt die ganze Anlage kaum eine leise Erschütterung.
Durch die Lücken im Laubwerke brachen die Sonnenstrahlen herein; gerade heute war das Wetter sehr schön. Breitere Stücke blauen Himmels wurden hinter den untersten Zweigen sichtbar. Eine mit starkem Dufte geschwängerte Brise erfrischte die Luft.
Während die Gruppe der Fremden dahinwandelte, betrachteten sie die Wagddis, Männer ebenso, wie die Frauen und Kinder, ohne besonderes Erstaunen. Diese wechselten mit einander im raschen Tone nur einzelne Worte oder schnell herausgestoßene, kurze, völlig unverständliche Sätze. Der Foreloper glaubte darunter zuweilen einige congolesische Ausdrücke zu vernehmen, was ja kaum zum Verwundern war, da Li-Maï wiederholt das Wort »Ngora« ausgesprochen hatte.
Immerhin blieb die Sache unerklärlich. Noch mehr aber: John Cort hörte sogar zwei oder drei deutsche Wörter, darunter das Wort »Vater«, und er unterrichtete seine Genossen von dieser auffallenden Beobachtung.
»Ja, was willst Du denn, lieber John? antwortete Max Huber.
Ich erwarte sogar, daß einer dieser Burschen mir auf den Bauch klopft und mich dazu – in französischer Sprache – fragt: »Na, wie geht’s denn, Alterchen?«
Von Zeit zu Zeit ließ Li-Maï Llangas Hand los und lief wie ein lebhaftes, lustiges Kind zu dem einen und dem anderen hin.
Er schien sehr stolz darauf zu sein, die Fremden durch die Straßen des Dorfes führen zu können. Das that er offenbar nicht ohne Zweck und Ziel, sondern geleitete sie mit Berechnung hier und dort hin so daß man gar nichts besseres thun konnte, als dem fünfjährigen Führer zu folgen.
Die Urmenschen – wie John Cort die Leute hier bezeichnete
– gingen nicht völlig nackt. Abgesehen von dem rothbraunen Flaum, der ihren Körper theilweise bedeckte, trugen Männer und Frauen eine Art Schurz aus Pflanzenstoff, zwar gröber gearbeitet, doch im übrigen ähnlich den Geweben aus Akazienfasern, die in Porto Novo, einem Hafen Dahomeys, in großer Menge angefertigt werden.
Was John Cort besonders auffiel, war die Thatsache, daß die ziemlich runden, die Größenverhältnisse des mikrocephalischen Typus mit dem des Menschen sehr nahe kommenden Gesichtswinkel zeigenden Köpfe der Wagddis sehr wenig von Prognathismus erkennen ließen. Die Augenbrauenbogen traten auch nicht so bemerkbar hervor, wie bei allen Affenarten. Das Kopfhaar bildete ein glattes Vließ, wie bei den Eingebornen von Aequatorialafrika, und der Bart war nur ganz schwach entwickelt.
»Und kein zum Greifen geschaffener Fuß, bemerkte John Cort.
– Auch kein Schwanzanhang, setzte Max Huber hinzu, keine Spur davon!
– Ja wirklich, antwortete John Cort, und das ist schon ein Zeichen von höherer Entwicklung. Die anthropomorphen Affen haben weder einen Schwanz, noch Backentaschen oder Schwielen. Sie bewegen sich nach Belieben aufrecht stehend oder auf allen vieren. Hier ist aber nicht außer Acht zu lassen, daß die aufrecht gehenden Affen dabei nicht mit der Fußsohle auftreten, sondern sich auf den Rücken der umgebogenen Finger stützen. Bei den Wagddis ist das anders, ihr Gang gleicht, das sieht man auf dem ersten Blick, vollkommen dem des Menschen.«
Diese Bemerkung war ganz richtig und es handelte sich hier ohne Zweifel um eine völlig neue Rasse. Was übrigens den Fuß betrifft, so behaupten manche Gelehrte, daß zwischen dem des Affen und dem des Menschen gar kein Unterschied bestehe, und daß auch der zweite eine gegenständige große Zehe (gleich dem Daumen der Hand) haben würde, wenn der Fuß nicht durch das Schuhwerk verunstaltet wäre.
Noch außerdem giebt es aber physische Aehnlichkeiten zwischen den beiden Rassen. Die Vierhänder mit menschlicher Körperhaltung sind weniger unbändig und schneiden weniger Grimassen, kurz, sie erschienen als die ernstesten und verständigsten ihrer Art. Gerade dieser äußere Ernst zeigte sich nun auch in der Haltung wie in den Handlungen der Bewohner von Ngala. Hätte John Cort sie eingehender untersuchen können, so würde er auch gefunden haben, daß ihr Gebiß mit dem der Menschen übereinstimmte.
Derlei Aehnlichkeiten stützten zwar bis zu gewissem Grade die Lehre von der Veränderlichkeit der Arten, die von Darwin vertretene Descendenztheorie. Man hat sie sogar, unter Vergleichung der am höchsten entwickelten Affenfamilien mit den auf der niedrigsten Stufe stehenden Menschen, als entscheidend dafür angesehen. Linné z. B. vertrat die Anschauung, daß es einst Troglodyten (menschliche Höhlenbewohner) gegeben habe, eine Bezeichnung, die sich auf die Wagddis gewiß nicht anwenden ließ, denn diese wohnten ja auf Bäumen. Vogt hat sogar behauptet, daß die Menschheit aus drei großen Affenfamilien hervorgegangen sei: der Orang, eine brachycephale Art mit langer, brauner Behaarung, wäre nach ihm der Ahne der Negritos; der Schimpanse, eine dolichocephale Art mit mächtigen Kiefern, der der eigentlichen Neger, und von dem Gorilla, der sich durch eine besondere Entwicklung des Brustkorbes, durch die ihm eigene Haltung, die Gestalt des Fußes und durch den Knochenbau des Rumpfes und der Gliedmaßen auszeichnet, sollte der weiße Mensch abstammen. Dieser Aehnlichkeit kann man freilich leicht genug sehr ins Gewicht fallende Unähnlichkeiten der intellectuellen und moralischen Eigenschaften gegenüberstellen – Unähnlichkeiten, die zu einer Verwerfung der Darwin’schen Leitsätze führen müssen.
Immerhin kann man bei Betrachtung der unterscheidenden Merkmale der drei Vierhänderfamilien annehmen, daß sie –ohne gleichzeitig zuzugeben, daß sie die zwölf Millionen Zellen und die vier Millionen Fasern des menschlichen Gehirns besitzen – einer den anderen Thieren weit überlegenen Rasse angehören. Daraus folgt aber nimmermehr, daß der Mensch nur ein vervollkommneter Affe oder der Affe ein degenerierter Mensch wäre.
Was den Mikrocephalen betrifft, den man zum Mittelglied zwischen Mensch und Affen hat stempeln wollen, und dessen Vorhandensein von den Anthropologen ebenso vergeblich prophezeit, wie nach ihm vergeblich geforscht worden ist, dieses Kettenglied, das die animalische Welt mit der
»hommalen« verbinden soll… sollte man bezüglich dieses fehlenden Gliedes annehmen, daß es etwa von den Wagddis gebildet würde? Hatten es die merkwürdigen Zufälligkeiten ihrer Reise diesem Franzosen und diesem Amerikaner vorbehalten, es zu entdecken?
Und wenn sich diese Rasse physisch der Menschenrasse noch so sehr näherte, hätte man bei den Wagddis doch noch nachweisen müssen, daß sie die dem Menschen eigenen moralischen und religiösen Eigenschaften und Empfindungen besäßen, ganz abgesehen von der Fähigkeit, Schlußfolgerungen zu ziehen und sich Verallgemeinerungen vorzustellen, ebenso wie von einer Veranlagung für Künste und Wissenschaften.
Nur dann hätte man sich endgiltig über die zwischen Monogenisten und Polygenisten herrschende Streitfrage aussprechen können.
Bisher stand nur das eine fest, daß die Wagddis sprechen konnten. Nicht auf Instincte allein beschränkt, hatten sie Vorstellungen, Gedanken
– die ja überhaupt die
Voraussetzungen des Wortes sind – und Wörter, deren Verbindung ihre Sprache ausmachte. Besser als durch Schreie, die durch Blicke und Bewegungen weiter erläutert wurden, bedienten sie sich articulierter Laute, die als Unterlage eine Reihe von Tönen und von Formen hatten, welche durch Atavismus auf sie vererbt worden sein mochten.
Am verblüfftesten über diese Wahrnehmung zeigte sich John Cort. Diese Fähigkeit, die ohne gleichzeitig vorhandenes Gedächtniß undenkbar ist, verrieth einen angeborenen Rasseneinfluß.
Immer auf die Sitten und Gebräuche dieser Waldmenschen achtend. durchwanderten John Cort, Max Huber und Khamis die Straßen des Dorfes.
Es war ziemlich groß, denn es mußte wenigstens einen Umfang von drei Kilometern haben.
»Und wenn es ein Nest ist, wie Max Huber sagte, so ist es mindestens ein sehr geräumiges Nest.«
Von der Hand der Wagddis erbaut, ließ die Anlage eine der der Vögel, der Bienen, Biber und Ameisen entschieden überlegene Kunstfertigkeit erkennen. Lebten diese Urmenschen hier in Bäumen, Geschöpfe, die doch denken und ihre Gedanken ausdrücken konnten, so hatte gewiß der Atavismus sie dazu bestimmt.
»Auf jeden Fall, bemerkte John Cort, hat die Natur, die sich ja niemals irrt, Gründe gehabt, die Wagddis ein solches Leben in den Lüften wählen zu lassen. Statt auf dem ungesunden Erdboden zu siedeln, bis zu dem die Sonne mit ihren Strahlen niemals hinunterdringt, leben sie fröhlich inmitten der Wipfel dieses Waldes.«
Die meisten, hübsch kühlen und grün umkränzten Hütten von der Form der Bienenkörbe standen weit offen. Die Frauen besorgten darin emsig ihre höchst einfache Wirthschaft. Kinder liefen in Menge umher, die kleinsten wurden von ihren Müttern gesäugt. Von den Männern beschäftigten sich die einen mit dem Einsammeln der Früchte zwischen den Zweigen, die anderen waren die Leitertreppe hinuntergestiegen und widmeten sich ihren gewohnten Arbeiten. Ein Theil von ihnen kam mit mehreren Stücken Wildpret wieder herauf, andere brachten große Gefäße, die sie aus einem Rio mit Wasser gefüllt hatten.
»Es ist doch ärgerlich, sagte Max Huber, daß wir die Sprache dieses Naturvölkchens nicht verstehen! So werden wir nie mit ihnen plaudern oder eine genauere Kenntniß von ihrer Litteratur gewinnen können. Uebrigens habe ich die hiesige Stadtbibliothek noch ebensowenig gesehen, wie die Fortbildungsschulen für Knaben und für Mädchen!«
Da die Sprache der Wagddis aber, soweit man sie von Li-Maï gehört hatte, mit Wörtern anderer Eingebornen vermischt war, versuchte Khamis, das Kind mit einigen der gebräuchlichsten davon anzureden.
So geweckt Li-Maï jedoch im allgemeinen erschien, konnte er nichts verstehen. In Gegenwart John Cort’s und Max Huber’s hatte er aber doch in einem hilflosen Zustande das Wort »Ngora« ausgesprochen, und ferner versicherte Llanga, vom Vater des Kleinen gehört zu haben, daß das Dorf Ngala und dessen Oberhaupt Mselo-Tala-Tala heiße.
Nach etwa einstündiger Wanderung erreichten der Foreloper und seine Gefährten das Ende des Dorfes. Hier erhob sich eine mehr in die Augen fallende Hütte. Zwischen dem Geäst eines ungeheueren Wollbaumes errichtet, war sie von Gesträuch umgittert und ihr Dach verlor sich in der Laubwölbung.
Diese Hütte war der königliche Palast, das Heiligthum der Zauberer und der Tempel der Götter, wie solche die meisten wilden Volksstämme Afrikas Australiens und der Pacifischen Inseln verehren.
Jetzt war Gelegenheit, von Li-Ma? einige weiter gehende Mittheilungen zu erhalten. John Cort legte ihm deshalb die Hände auf die Schultern, wendete ihn der großen Hütte zu und fragte:
»Mselo-Tala-Tala?…«
Als Antwort erhielt er ein Zeichen mit dem Kopfe.
Hier wohnte also der Häuptling des Dorfes Ngala, Seine wagddische Majestät.
Ohne jede Ceremonie schritt Max Huber gelassen auf die betreffende Hütte zu.
Da veränderte sich die Haltung des Kindes, das ihn unter allen Zeichen des Schreckens zurückzuhalten suchte.
Max Huber ließ sich jedoch nicht beirren und wiederholte nur nochmals: »Mselo-Tala-Tala?«
Als der Franzose dann eben die Hütte erreichte, rannte der Kleine wieder auf ihn zu und verhinderte ihn, weiter zu gehen.
Offenbar war es verboten, sich der Königswohnung zu nähern.
Wirklich erhoben sich sofort zwei wachhabende Wagddis und stellten sich, ihre Waffen, eine Axt aus Eisenholz und einen Speer, schwingend, vor die Thür.
»Nun seh’ mir einer, rief Max Huber, hier ganz wie anderwärts, im großen Walde von Ubanghi wie in den Hauptstädten der civilisierten Welt: Leibwachen, Hundertgarden, wachhabende Prätorianer vor dem Palaste, und vor welchem Palaste… vor dem einer affenmenschlichen Majestät!
– Was ist dabei zu verwundern, lieber Max?
– Na, meinte dieser, wenn wir denn den gestrengen Monarchen jetzt nicht sehen können, so werden wir schriftlich um eine Audienz bei ihm nachsuchen.
– Sehr schön, erwiderte John Cort, doch wenn diese Unmenschen auch sprechen, glaube ich kaum, daß sie sich schon zum Lesen und Schreiben aufgeschwungen haben. Noch in wilderem Zustande, als die Eingebornen des Congo oder des Sudan, als die Funds, die Chilus, die Denkas und die Monbuttus, scheinen sie mir noch nicht civilisiert genug zu sein, ihre Kinder in eine Schule zu schicken.
– Das möchte ich doch etwas bezweifeln, John. Doch wie wollen wir uns überhaupt diesen Leuten, deren Sprache wir nicht kennen, schriftlich mittheilen?
– Richtig; lassen wir uns lieber von dem Kleinen weiter führen, sagte Khamis.
– Ist Dir nicht die Hütte seines Vaters und seiner Mutter bekannt? fragte John Cort den jungen Eingebornen.
– Nein, lieber Freund John, antwortete Llanga. Doch… ohne Zweifel… Li-Maï wird uns dahin führen. Wir müssen ihm folgen.«
Damit trat er an das Kind heran und zeigte mit der Hand nach links.
»Ngora?… Ngora?«… sagte er.
Man sah, daß das Kind ihn verstand, denn es senkte den Kopf und hob ihn lebhaft wieder empor.
»Das beweist, sagte John Cort, daß das Zeichen für eine Verneinung und eine Bejahung ein instinctiver Ausdruck und als solcher bei allen Menschen der nämliche ist… ein weiterer Beweis, daß diese Urmenschen der übrigen Menschheit ungemein nahe stehen.«
Wenige Minuten später kamen die Besucher nach einem tiefer beschatteten Theile des Dorfes, wo die Wipfel der Bäume dicht untereinander verschlungen waren.
Li-Maï blieb vor einer sauberen Hütte stehen, deren Dach mit den breiten Blättern der Ensete, einer in dem großen Walde weit verbreiteten Banane, bedeckt war, mit denselben Blättern, die der Foreloper für das Sonnendach des Flosses verwendet hatte. Eine Art Stampferde bildete die Wände der Hütte, in die eine, augenblicklich offen stehende Thür hineinführte.
Li-Maï wies Llanga mit der Hand danach hin, und dieser erkannte sie sofort wieder.
»Da ist es,« sagte er.
Das Innere bildete einen einzigen Raum. Im Hintergrunde befand sich eine Lagerstätte aus trockenem Gras, das leicht zu erneuern war. In einer Ecke dienten einige größere Steine als Herd, auf dem jetzt mehrere Zweige in Brand standen. Von sonstigem Geräthe sah man nur zwei oder drei Kürbisflaschen, eine mit Wasser gefüllte irdene Schale und zwei irdene Töpfe.
Bis zu Gabeln hatten es die Waldmenschen noch nicht gebracht, sie aßen einfach mit den Fingern. Da und dort zeigten sich auf einem an der Wand befestigten Brette verschiedene Früchte, eßbare Wurzeln, ein Stück gekochtes Fleisch, nebst einem halben Dutzend, für die nächste Mahlzeit bereits gerupfter Vögel, und, an Dornen aufgehängt, mehrere Stücke Stoff aus Rinde und Aguliegewebe.
Ein Wagddi und eine Wagddierin erhoben sich sofort, als Khamis und seine Begleiter in die Hütte eintraten.
»Ngora!… Ngora!… Lo-Maï… la Maï!« rief das Kind.
Und als ob er glaubte, besser verstanden zu werden, setzte er noch hinzu:
»Vater… Vater!«
Er sprach das Wort, wenn auch sehr schlecht, deutsch aus.
Doch, wie seltsam ein Wort aus dieser Sprache von einem Wagddi aussprechen zu hören!
Kaum eingetreten, ging Llanga auf die Mutter zu, und diese breitete die Arme aus, drückte ihn an sich, liebkoste ihn mit der Hand und gab durch alles dem Retter ihres Kindes ihre Dankbarkeit zu erkennen.
John Cort hatte bei dem Besuche folgende Beobachtungen gemacht:
Der Vater war ein ziemlich großer Mann, gut gewachsen und von kräftigem Aussehen; seine Arme erschienen etwas länger als gewöhnlich die der Menschen, die Hände waren groß und stark, die Beine leicht gebogen, und die Fußsohlen standen ihrer ganzen Länge nach auf dem Boden.
Er zeigte die ziemlich helle Hautfarbe der eingebornen Stämme, die sich mehr von Fleisch als von Pflanzen nähren, einen flockigen kurzen Bart, schwarzes Kraushaar und eine Art Flaum, der den ganzen Körper bedeckte. Sein Kopf war von mittlerer Größe, die Kiefer standen nur wenig vor und seine Augen mit glänzender Pupille hatten einen lebhaften Ausdruck.
Die Mutter erschien fast graziös, mit ihren einnehmenden, sanften Zügen, ihrem Blick, der eine warme Liebe verrieth.
Dazu hatte sie wohlgeordnet stehende Zähne von blendender Weiße, und – bei welcher Vertreterin des schwächeren Geschlechts träfe man gar nichts von Koketterie? – einige Blumen, daneben aber – was rein unerklärlich erschien –einzelne Glas- und Elfenbeinperlen im Haar.
Die junge Wagddifrau erinnerte an den Typus der Kaffern im Süden, und zwar durch ihre runden, wohlgeformten Arme, mit den zarten, sein zugespitzten Fingern, den weichen Händen mit Grübchen, und mit ihren Füßen, um die sie manche Europäerin hätte beneiden können. Ueber dem wolligen Flaum der Haut trug sie einen Ueberwurf aus Rindenstoff, der in der Taille zusammengehalten war. An ihrem Halse hing eine Denkmünze von Doctor Johausen, ganz ähnlich der, die das Kind getragen hatte.
Zum großen Leidwesen John Cort’s war es nicht möglich, sich mit Lo-Maï und Li-Maï irgendwie zu verständigen, dagegen zeigte es sich unverkennbar, daß die beiden Eingebornen bemüht waren, allen Pflichten der wagddiischen Gastfreundschaft nachzukommen. Der Vater bot auf einer Schale einige Früchte an, Matofes, die von einer stark duftenden Liane stammen.
Die Gäste langten zu und verzehrten einige Matofes zur größten Befriedigung der Familie.
Im weiteren Verlaufe des Besuches fand man auch die schon lange ausgesprochene Bemerkung bestätigt, daß die Sprache der Wagddis, ganz entsprechend den polynesischen Mundarten, viel Aehnlichkeiten mit dem kindlichen Lallen aufweise, was die Philologen zu der Behauptung veranlaßt hat, daß es für das gesammte Menschengeschlecht eine lange Zeit gegeben habe, wo alle Sprachen nur aus Vocalen bestanden, und daß die Consonanten erst weit später aufgetaucht wären. In fast zahllosen Verbindungen ließen sich die Vocale in verschiedenster Bedeutung gebrauchen und lauteten, freilich schon mit einzelnen, wenig hervortretenden Consonanten verbunden, z. B. ori, oriori, oro, oroora, orurna u. s. w. – An Consonanten traten zunächst das ‘k’, das ‘t’ und das ‘p’ auf, und bald auch die Nasenlaute ‘ng’ und ‘m’. Allein mit den Vocalen (im vorher bezeichneten Sinne) ‘ha’ und ‘ra’ ließ sich schon eine Reihe von Wörtern bilden, die ohne Mithilfe wirklicher Consonanten die verschiedensten Ausdrücke gestatteten und zur Bildung von Hauptwörtern, Fürwörtern und Zeitwörtern dienten.
In der Umgangssprache der Wagddis waren die Fragen und die Antworten sehr kurz, und bestanden meist nur aus zwei oder drei Wörtern, die wie bei den Congolesen fast alle mit
‘ng’, ‘mgu’ oder ‘mf’ anfingen. Die Mutter erschien weniger gesprächig als der Vater, wahrscheinlich hatte ihre Zunge nicht, wie die Zunge der Frauen der beiden Welten, die Fähigkeit, in der Minute zwölftausend Bewegungen auszuführen.
Recht auffallend war auch – und John Cort wunderte sich darüber am meisten – daß die Urmenschen verschiedene congolesische und deutsche Ausdrücke gebrauchten, wenn diese auch infolge ihrer Aussprache stark verunstaltet waren.
Im ganzen hatte es den Anschein, als ob der Gedankenkreis dieser Wesen sich nur auf alles zur Lebenserhaltung nothwendige beschränkte, und daß sie nur über Wörter verfügten, Vorstellungen dieser Art auszudrücken. An Stelle der sonst auch bei den niedrigst stehenden Wilden zu beobachtenden Religiosität, die den Insassen von Ngala offenbar abging, ließ sich doch mit Sicherheit erkennen, daß sie der Empfindung der Liebe und Zuneigung fähig waren. Sie verriethen für ihre Kinder nicht nur das Gefühl, das auch den Thieren, soweit es die Vorsorge für die Erhaltung der Art betrifft, nicht abgeht, sondern das ging auch, wie man es an dem Vater und der Mutter gegenüber Li-Maï beobachten konnte, entschieden darüber hinaus. Dazu trat ferner eine gewisse Reciprocität zu Tage, ein Austausch elterlicher und kindlicher Zärtlichkeit, kurz, man hatte hier das Bild einer
»Familie« vor Augen.
Nach einviertelstündigem Verweilen in der Hütte verließen Khamis, John Cort und Max Huber diese wieder unter Führung des Hausvaters und seines Kindes. Sie kamen nun wieder nach der Hütte, worin sie eingeschlossen gewesen waren und wie es scheint bleiben sollten, bis… ja, bis wann?… Immer wieder diese Frage, deren Lösung wahrscheinlich auch nicht durch sie allein erfolgen sollte.
Vor der Hütte trennte man sich. Li-Maï umarmte noch einmal den jungen Eingebornen und streckte – nicht etwa wie ein Hund die Pfote oder wie ein Vierhänder seine Vorderhand, nein – beide Hände John Cort und Max Huber entgegen, die diese mit mehr Herzlichkeit drückten, als Khamis.
»Mein lieber Max, bekannte dann John Cort, einer unserer berühmten Schriftsteller hat behauptet, daß in jedem Menschen ein Ich und ein Anderer verborgen sei. Wahrscheinlich fehlt den Urmenschen hier einer davon…
– Und welcher, John?
– Ganz sicher der andere. Um sie gründlich zu erforschen, müßte man sich Jahre lang bei ihnen aufhalten; ich hoffe jedoch, daß wir binnen wenigen Tagen wieder aufbrechen können…
– Das dürfte, fiel Max Huber ein, wohl von Seiner Majestät abhängen, und wer weiß denn, ob der König Mselo-Tala-Tala uns nicht zu Kammerherren des wagddiischen Hofes ernennen will?«
Fünfzehntes Capitel.
Dreiwöchige Studien
Wie lange sollten John Cort, Max Huber, Khamis und Llanga sich in diesem Dorfe wohl zurückgehalten sehen? – Sollte irgend ein Ereigniß in ihrer immerhin beunruhigenden Lage eine Aenderung herbeiführen?…Sie sahen sich so scharf überwacht, daß an eine Flucht kaum zu denken war… Doch selbst angenommen, daß es ihnen gelänge, zu entfliehen, wohin hätten sie sich inmitten des undurchdringlichsten Theiles des großen Waldes wenden, wie dessen Ende erreichen oder das Bett des Rio Johausen wiederfinden sollen?
Trotz seiner Sehnsucht nach außergewöhnlichen Erlebnissen meinte Max Huber doch, daß die Sachlage, wenn sie in gleicher Weise fortbestand, ungemein an Reiz verliere. Er war denn auch der erste, dem die Geduld ausging und der jetzt nichts sehnlicher wünschte, als nach dem Becken des Ubanghi zu kommen und nach der Factorei in Libreville zurückzukehren, von der John Cort und ihm doch keinerlei Hilfe in Aussicht stand.
Der Foreloper zeterte über das Pech, das ihn den Tatzen –seiner Ansicht nach waren es eben Tatzen – dieses tief unten stehenden Waldmenschenvolkes zugeführt hatte. Er verheimlichte auch gar nicht die vollkommene Verachtung, die jene Geschöpfe ihm einflößten, während sie sich doch nicht wesentlich von den anderen in Centralafrika hausenden Stämmen unterschieden. Khamis empfand eine Art instinctive, unbewußte Eifersucht, die den beiden Freunden keineswegs entging. Jedenfalls aber verlangte es ihn ebenso wie Max Huber, Ngala den Rücken zu kehren, und was dazu zu thun nöthig wäre, das wollte er gerne thun.
Am wenigsten schien es John Cort eilig zu haben, denn ihn drängte es, sich über diese Urmenschen möglichst eingehend zu unterrichten. Zur Ergründung ihrer Sitten, ihrer Lebensweise, ihres ethnologischen Charakters und moralischen Werthes, sowie zu bestimmen, bis wie weit sie noch ins Thierreich hineinreichten, dafür hätten ja wenige Wochen genügt. Jetzt wußte freilich noch niemand, ob sich der unfreiwillige Aufenthalt bei den Wagddis nicht weit länger, auf Monate, vielleicht auf Jahre ausdehnen werde, und ebenso ungewiß war der endliche Ausgang dieses erstaunlichen Abenteuers.
Von einer schlechten Behandlung schienen John Cort, Max Huber und Khamis dagegen nicht bedroht zu sein; offenbar erkannten die Waldmenschen deren geistige Ueberlegenheit rückhaltlos an. Ferner – und das war eine kaum erklärliche Erscheinung – hatten sie sich über das Erscheinen wirklicher Menschen nie besonders verwundert gezeigt. Hätte die kleine Truppe aber ihre Flucht mit Gewalt durchsetzen wollen, so setzte sie sich damit sicherlich Fährlichkeiten aus, die besser vermieden wurden.
»Für uns ist es das wichtigste, sagte Max Huber, mit dem Vater Spiegel, dem Herrscher mit der Brille, zu verhandeln und ihn zu bestimmen, daß er uns freien Abzug gewährt.«
Es konnte ja nicht unmöglich sein, eine Unterredung mit Seiner Majestät Mselo-Tala-Tala zu erlangen, wenn es Fremden nicht ausdrücklich verboten war, seine erhabene Person zu sehen. Doch wenn man auch bei ihm vorgelassen würde, wie sollte die Verhandlung geführt werden? Selbst in congolesischer Sprache wäre ja eine Verständigung ausgeschlossen gewesen. Der Erfolg einer solchen war dann noch ebenso unsicher. Es konnte ja im Interesse der Wagddis liegen, die Fremden überhaupt hier zurückzuhalten, um einer Enthüllung des Geheimnisses von dem Vorhandensein einer noch unbekannten Rasse vorzubeugen.
Wenn man John Cort glauben durfte, so waren der Gefangenschaft in dem Dorfe in den Lüften sogar mildernde Nebenumstände nachzurühmen, da die vergleichende Anthropologie daraus Nutzen ziehen und die gelehrte Welt die Auffindung einer neuen Rasse mit größter Verwunderung begrüßen mußte. Wie die Geschichte freilich enden möchte…
»Der Kuckuck soll mich holen, wenn ich das weiß!« rief Max Huber, der nicht das Zeug zu einem Garner oder Johausen in sich hatte.
Als die drei, und mit ihnen Llanga, ihre Hütte wieder betreten hatten, bemerkten sie darin einige recht anerkennenswerthe Veränderungen.
Erstens war daselbst ein Wagddi beschäftigt, das »Zimmer aufzuräumen«, wenn dieser Ausdruck hier am Platze ist. Schon vorher hatte John Cort beobachtet, daß den Eingebornen ein gewisser Sinn für Sauberkeit eigen war, der den meisten Thieren doch abgeht. Sie ordneten ihre Zimmer, doch auch ihre Toilette. Im Hintergrunde der Hütte lag jetzt eine reichliche Menge dürres Gras ausgebreitet. Da Khamis und seine Gefährten aber seit der Zerstörung der Karawane keine andere Lagerstatt gehabt hatten, änderte das nichts in ihren bisherigen Gewohnheiten.
Auf dem Fußboden standen verschiedene Gegenstände, zwar kein Möblement mit Tischen und Stühlen, wohl aber einige grobgearbeitete Geräthe, Töpfe und Schalen, wie sie die Wagddis herstellten. Hier lagen Früchte verschiedener Art, dort ein schon gekochtes Oryxviertel. Das rohe Fleisch von diesen wird nur von Raubthieren nicht verschmäht, außer den seltenen Fällen, wo man es bei sehr tiefstehenden Volksstämmen fast als ausschließliches Nahrungsmittel antrifft.
»Ja, wer einmal Feuer erzeugen kann, erklärte John Cort, der bedient sich seiner auch zum Kochen der Speisen. Ich wundere mich also gar nicht, daß auch die Waggdis das Fleisch in gekochtem Zustande genießen.«
Die Hütte enthielt jetzt ferner einen, aus einem flachen Steine bestehenden Herd, von dem sich der emporwirbelnde Rauch in dem Gezweig eines Caulecedratbaumes verlor, das sich darüber ausbreitete.
Als die Vier im Eingange der Hütte erschienen, unterbrach der Wagddi seine Arbeit.
Es war ein junger Bursche von zwanzig Jahren mit flinken Bewegungen und intelligentem Gesicht. Er wies mit der Hand nach den hierher gebrachten Dingen. Darunter entdeckten Max Huber, John Cort und Khamis – selbstverständlich mit größter Befriedigung – auch ihre Gewehre, die zwar etwas verrostet, doch leicht wieder in Stand zu setzen waren.
»Sapperment, rief Max Huber, die kommen uns aber gelegen! Wenn es gilt…
– Würden wir davon Gebrauch machen, fuhr John Cort fort, wenn… ja, wenn wir auch unseren Patronenkasten hätten.
– O, der ist hier!« antwortete der Foreloper.
Er wies bei diesen Worten nach dem links von der Thür stehenden Metallkasten. Diesen Kasten sammt den Gewehren hatte Khamis, wie der Leser weiß, noch auf die Felsblöcke und so hoch hinauf geworfen, daß das Wasser die Gegenstände nicht erreichen konnte. Das geschah in dem Augenblicke, wo das Floß an die Barre stieß.
»Wenn sie uns die Gewehre zurückgegeben haben, bemerkte Max Huber, bleibt die Frage übrig, ob sie den Gebrauch von Feuerwaffen überhaupt kennen.
– Das weiß ich nicht, antwortete John Cort, sie aber wissen offenbar, daß man nicht behalten soll, was einem nicht gehört, und das spricht sehr zu Gunsten ihrer Moralität.«
Das zugegeben, erschien Max Huber seine aufgeworfene Frage doch von besonderer Wichtigkeit.
»Kollo… Kollo!«
Klar verständlich ertönte dieses Wort mehrere Male, und während der junge Wagddi es aussprach, hob er die Hand bis zur Stirn und berührte sich dann an der Brust, als wolle er sagen:
»Kollo… das bin ich!«
John Cort vermuthete, daß das der Name ihres neuen Dieners war, und als er diesen fünf- bis sechsmal wiederholt hatte, zeigte Kollo seine Freude darüber durch ein längeres Lachen.
Ja, sie konnten auch lachen, diese Urmenschen, das war eine in anthropologischer Hinsicht wichtige Thatsache. Kein Wesen, außer dem Menschen, ist sonst dazu befähigt.
Beobachtet man bei den intelligentesten Geschöpfen, z. B.
bei den Hunden, auch einige Andeutungen des Lachens oder Lächelns, so zeigen sich diese doch nur in den Augen und vielleicht in der Gestaltung der Lippen. Außerdem folgten die Wagddis auch nicht dem fast allen Vierfüßlern gemeinsamen Naturtriebe, ihre Nahrung zu beschnüffeln, ehe sie sie kosteten, und dann davon zuerst zu verzehren, was ihnen am besten mundete.
Das Leben der beiden Freunde, wie das Llangas und des Forelopers, gestaltete sich nun in folgender Weise: Die Hütte war kein Gefängniß. Sie konnten sie nach Belieben verlassen; doch Ngala überhaupt zu verlassen, daran würden sie jedenfalls gehindert sein, so lange sie von Seiner Majestät Mselo-Tala-Tala dazu keine Erlaubniß erhalten hatten.
Sie sahen sich also, wenigstens vorläufig, gezwungen, ihren Aerger zu verschlucken und sich’s gefallen zu lassen, inmitten dieser merkwürdigen Waldwelt in dem Dorfe in den Lüften zu leben.
Die Wagddis schienen übrigens sanfter, wenig zänkischer Natur zu sein, und waren, darauf ist besonderes Gewicht zu legen, weniger neugierig und weniger überrascht von der Erscheinung von Fremdlingen, als es bei den tiefststehenden Wilden Afrikas und Australiens der Fall gewesen wäre. Der Anblick der beiden Weißen und der beiden Congolesen verwunderte sie nicht so sehr, wie er jeden andern Eingebornen Afrikas verwundert hätte. Die Sache ließ sie offenbar gleichgiltig, und von Zudringlichkeit war bei ihnen keine Spur.
Hier zeigte sich nichts von Maulaffenfeilhalten oder von albernem Vornehmthun. Was die Akrobatik anging, nämlich ein Erklettern der Bäume, ein Hinüberspringen von einem Aste zum anderen, oder ein Hinuntergleiten längs der Treppenleiter von Ngala, hätten sie einem Billy Hayden, einem Joë Bibb und einem Fottit, den damals unerreichten Meistern der Circus-Akrobatik, leicht die Stange halten können.
Neben ihren hoch entwickelten physischen Eigenschaften zeichneten sich die Wagddis auch durch einen ungemein scharfen Gesichtssinn aus. Bei der Jagd auf Vögel erlegten sie diese mit kleinen Pfeilen. Auch ihre Schläge führten sie mit größter Sicherheit, wenn sie Damwild, Elenthiere, Antilopen und sogar Büffel und Flußpferde im Hochwalde verfolgten.
Dabei hätte sie Max Huber gar zu gern begleitet, ebenso in der Absicht, ihre Geschicklichkeit als Jäger zu bewundern, wie um sich bei passender Gelegenheit aus dem Staube zu machen.
Ja, entfliehen… das war’s, woran die Gefangenen unausgesetzt dachten. Eine Flucht war aber nur über die einzige Leitertreppe ausführbar, und diese war an ihrem obersten Absatz von Kriegern besetzt, deren Wachsamkeit schwerlich getäuscht werden konnte.
Wiederholt stieg in Max Huber der Wunsch auf, einige von den Vögeln zu schießen, die – es waren Su-mangas, Ziegenmelker, Perlhühner, Wiedehopfe, Griots und andere – in Scharen unter den Bäumen umherflatterten und den Waldmenschen vielfach als Nahrung dienten. Seine Gefährten und er wurden aber Tag für Tag mit Wildpret versorgt, meist mit dem Fleische von verschiedenen Antilopen, von Oryx, Inyalas, Sassabys und Wasserböcken, die im Walde von Ubanghi zahlreich vorkamen. Ihr Diener Kollo ließ es an nichts fehlen; er erneuerte täglich den Vorrath an frischem Wasser, der für die Zubereitung der Speisen erforderlich war, und auch den an trockenem Holze zur Unterhaltung des Feuers.
Wurden die Gewehre übrigens zu Jagdzwecken verwendet, so wäre das mit dem mißlichen Umstande verknüpft gewesen, daß damit ihre Wirkung verrathen wurde. Jedenfalls erschien es aber rathsamer, diese geheim zu halten und die Waffen erst im Nothfall zur Abwehr oder zum Angriff zu benutzen.
Die Fremdlinge wurden reichlich mit Fleisch versorgt, weil sich auch die Wagddis mit solchem, das entweder über glühenden Kohlen geröstet oder in den von ihnen selbst angefertigten irdenen Gefäßen gekocht war, in der Hauptsache ernährten. Die Zubereitung der Speisen ließ sich, mit Unterstützung durch Llanga, Kollo eifrig angelegen sein –
Khamis betheiligte sich dabei nicht, sein Stolz als Eingeborner hätte das niemals zugelassen.
Hier muß noch erwähnt werden, daß es – zur großen Befriedigung Max Huber’s – auch an Salz nicht fehlte. Das war jedoch nicht das Natriumchlorür, das im Meerwasser enthalten ist, sondern das in Afrika, Asien und Amerika so weitverbreitete Steinsalz, das den Erdboden in der Umgebung von Ngala an vielen Stellen bedeckte. Den Nutzen dieses Minerals, des einzigen, das im Naturzustande genossen wird, hatten die Wagddis – so gut wie sogar die Thiere – rein aus Instinct erkannt.
John Cort interessierte sich nebenbei auch lebhaft für die Frage, wie diese Urmenschen sich wohl Feuer erzeugen möchten, und ob sie das mittels Reibung eines harten Holzstückes auf einem weichen nach der bei den Wilden gewöhnlichen Art erreichten. Das war jedoch nicht der Fall; sie bedienten sich dazu vielmehr zweier Feuersteine, die beim Aneinanderschlagen Funken gaben. Diese Funken genügten zur Entzündung des Flaumes der Frucht eines »Rentenier«
genannten Baumes, den man in den afrikanischen Wäldern häufig antrifft, und von dem gewisse Theile unseren Zündschwamm vollkommen ersetzen.
Zu der stickstoffhaltigen Nahrung trat bei den wagddiischen Familien als stickstofflose eine pflanzliche Nahrung, die ihnen die Natur gleich fertig lieferte. Sie bestand einerseits aus zwei bis drei Arten eßbarer Wurzeln und andererseits aus vielerlei Früchten, z. B. denen der Acacia adonsonia, die den ihr mit Recht zukommenden Namen Brod- oder Affenbrodbaum führt, ferner denen der Karitas, deren kastanienähnliche Frucht eine fettige Masse enthält, die einigermaßen als Ersatz für Butter dienen kann, sowie denen der Kijelia mit etwas fade schmeckenden, doch sehr nahrhaften und außerordentlich – gut zwei Fuß – langen Beeren; endlich aus anderen Früchten, wie Bananen, Feigen, Mangofrüchten in rohem Zustande und aus den vortrefflichen Früchten des Tso, woneben man sich der Tamarindenschoten an Stelle eines Gewürzes bediente. Die Wagddis sammelten aber auch Honig ein und ließen sich beim Aufsuchen der Bienenwohnungen vom Rufe des Kuckucks leiten. Aus diesem köstlichen Süßstoffe und aus dem Safte anderer Pflanzen, z. B. dem aus einer gewissen Liane gewonnenen Lutex, verstanden sie, unter Zusatz von Wasser aus dem Rio, gegohrene Getränke mit hohem Alkoholgehalt zu bereiten. Das ist ja kaum zum verwundern, wenn man bedenkt, daß sogar die afrikanischen Mandrills, die doch nur Affen sind, eine große Vorliebe für Alkohol verrathen.
Zu dem allen lieferte noch ein unterhalb Ngalas sich hinschlängelnder, fischreicher Wasserlauf dieselben Arten von Fischen, die Khamis und seine Gefährten im Rio Johausen gefunden hatten. Für den Fall eines Fluchtversuches war es nur von Bedeutung, zu wissen, ob jener Wasserlauf befahrbar war und ob die Wagddis sich dazu irgendwelcher Boote bedienten.
Von dem der Königswohnung entgegengesetzten Ende des Dorfes aus konnte man den Fluß sehen. Stellte man sich dort nahe an die letzten Bäume, so erkannte man, daß sein Bett dreißig bis vierzig Fuß Breite hatte. Weiterhin verlor er sich unter prächtigen Baumriesen, wie fünfschächtigen Baumwollbäumen, wunderbar schönen Mparamusis mit knotigen, herabhängenden Zweigflechten und unter herrlichen Msukulios, deren Stamm mit riesigen Lianen umwunden war, mit diesen Epiphyten, die ihn schlangengleich umrankten.
Es zeigte sich da, daß die Wagddis Wasserfahrzeuge herzustellen verstanden, eine Kunst, die ja auch den niedrigst stehenden Bewohnern Oceaniens nicht fremd ist. Ihre schwimmenden Fahrzeuge waren mehr als ein Floß, doch weniger als eine Pirogue, denn sie bestanden aus einem mit der Axt und mittels Feuers ausgehöhlten Baumstamme. Diese wurden mit einer Art flacher Schaufel fortgetrieben oder bei günstigem Winde auch durch ein zwischen zwei Stangen ausgespanntes Segel, das aus der Rinde des sehr harten Eisenbaumholzes hergestellt war, die man durch geeignetes Beklopfen geschmeidig gemacht hatte.
John Cort konnte sich überzeugen, daß diese Urmenschen für ihre Ernährung keine Gemüse- oder Getreidearten verwendeten. Sie bauten weder Sorgho, noch Hirse, Reis oder Manioc an, wie das sonst die Völkerschaften Centralafrikas thun.
Man durfte von diesen Leuten bezüglich des Ackerbaues ja auch nicht erwarten, was man bei den zu den wirklichen Menschen zählenden Denkas, Funds und Monbullus sehen konnte.
Nach diesen Beobachtungen bemühte sich John Cort noch zu ergründen, ob die Wagddis eine gewisse Moral oder etwas wie eine Religion besäßen.
Eines Tages fragte ihn Max Huber, was er denn in dieser Beziehung gefunden habe.
»Nun, eine gewisse Moralität, wenigstens ein Sinn für Rechtschaffenheit, ist bei ihnen vorhanden. Sie unterscheiden wohl mit Sicherheit Gutes und Böses. Sie kennen auch den Begriff des Eigenthums. Ich weiß wohl, vielen Thieren fehlt dieser auch nicht, z. B. den Hunden, die sich nicht gern stören lassen, wenn sie ihr Futter verzehren. Meiner Ansicht nach haben die Wagddis einen deutlichen Begriff von Mein und Dein. Das habe ich gelegentlich an einem von ihnen beobachtet, der sich aus einer Hütte, in die er eingedrungen war, mehrere Früchte geholt hatte.
– Nun, rief man da nach der Polizei oder gleich nach dem Kriminalgerichte? fragte Max Huber.
– Lacht nur, liebe Freunde, doch was ich sage, ist in diesem Falle kennzeichnend: der Dieb wurde von dem Bestohlenen, dem seine Nachbarn willig beisprangen, tüchtig durchgeprügelt. Ich möchte hier noch hinzufügen, daß bei diesen Urgeschöpfen noch eine Einrichtung vorkommt, die sie der Menschheit weiter nähert…
– Und das wäre?
– Die des Familienstandes, dem man überall bei ihnen begegnet, die Lebensgemeinschaft von Vater und Mutter, die Sorge für die Kinder, und die gegenseitige Liebe, die alle verbindet. Haben wir das nicht schon bei Lo-Maï sehen können? Die Wagddis sind selbst für rein menschliche Seeleneindrücke empfänglich. Achtet nur auf unseren Kollo…
erröthet der nicht zuweilen aus irgend welcher Ursache? Ob das aus Scham oder Furchtsamkeit, aus Bescheidenheit oder Verwirrung geschieht, denn das sind die vier Veranlassungen, die dem Menschen das Blut ins Gesicht treiben, ist ja gleichgiltig, doch unbestreitbar bringt irgend etwas diese Wirkung bei ihm hervor. Wo aber eine Empfindung ist, da ist auch eine Seele.
– Wenn die Wagddis aber, ließ sich Max Huber vernehmen, so viele menschliche Eigenschaften zeigen, warum soll man sie dann nicht als wirkliche Menschen anerkennen?
– Weil ihnen doch noch eine Vorstellung fehlt, die sonst allen Menschen eigen ist, mein lieber Max.
– Welche hast Du da im Sinne?
– Die von einem höchsten Wesen, kurz, die Religiosität, die sich selbst bei den wildesten Volksstämmen findet. Ich habe noch nicht beobachten können, daß sie irgendwelche Gottheiten anbeten, habe hier auch noch keine Götzenbilder oder Priester gesehen.
– Wenn ihr höchstes Wesen, meinte Max Huber, nicht gerade jener König Mselo-Tala-Tala ist, von dem sie uns nicht einmal die Nasenspitze zu sehen erlauben!«
Hier wäre übrigens Gelegenheit zu einem ausschlaggebenden Versuche gewesen, zu der Probe, ob diese Urmenschen unempfindlich wären gegen die giftige Wirkung des Atropins, der jeder Mensch unterliegt, während die Thiere sie ohne Nachtheil vertragen. Wenn ja, so waren es Menschen, wenn nein, so waren es Thiere. Wegen Mangels an diesem Giftstoffe konnte der Versuch leider nicht angestellt werden. Beiläufig sei ferner erwähnt, daß während des Aufenthaltes John Cort’s und Max Huber’s in Ngala kein einziger Todesfall vorkam. Es blieb also ungewiß, ob die Wagddis ihre Todten verbrannten oder beerdigten, ebenso ob sie eine Art Todtenverehrung kannten oder nicht.
Begegnete man unter der wagddiischen Bevölkerung auch keinen Priestern oder Zauberern, so sah man doch eine Anzahl mit Pfeil und Bogen, mit Spießen und Aexten ausgerüstete Krieger… vielleicht hundert Mann, die aus den kräftigsten und bestgewachsenen Leuten ausgewählt waren. Unklar blieb, ob diese nur als Leibwache für den König oder auch für den Angriff oder die Abwehr Verwendung fanden. In dem großen Walde konnten ja noch andere Dörfer gleicher Art und gleichen Ursprunges liegen, und wenn deren Einwohner nach Tausenden zählten, warum sollten sie, wie die übrigen Völker Afrikas, sich nicht gegenseitig bekriegt haben?
Daß die Wagddis schon mit den Eingebornen von Ubanghi, Baghirmi, vom Sudan oder mit Congolesen in Berührung gekommen wären, ließ sich kaum annehmen, und dasselbe dürfte wohl auch bezüglich des Zwergvolkes, der Bambusti, gelten, die der englische Missionär Albert Lloyd in den Wäldern Centralafrikas entdeckt und als fleißige Ackerbauer erkannt hatte, was auch Stanley in dem Berichte über seine letzte Reise hervorhebt. Hätte eine solche Berührung stattgefunden, so wäre das Vorkommen dieser Waldmenschen schon lange bekannt geworden und es John Cort und Max Huber nicht vorbehalten gewesen, sie zu entdecken.
»Doch, bemerkte der zweite, wenn die Wagddis einander tödten, liebster John, so würde sie das auch zum Range der eigentlichen Menschen erheben!«
Uebrigens erschien es kaum annehmbar, daß die Wagddikrieger nur einem nutzlosen Müßiggehen fröhnten, und daß sie nicht in der Umgebung gelegentlich eine Razzia ausführten. Nach zwei- bis dreitägiger Abwesenheit tauchten sie nämlich einmal plötzlich wieder auf, und da waren einzelne davon verwundet und andere brachten verschiedene Dinge, Geräthe oder Waffen, wagddiischen Ursprungs mit.
Mehrmals, doch immer vergeblich, wagte der Foreloper den Versuch, aus dem Dorfe zu entkommen. Die Kriegsleute, die die Treppe besetzt hielten, wiesen ihn dabei mit einiger Gewalt zurück. Einmal wäre Khamis sogar gehörig mißhandelt worden, wenn ihm Lo-Maï, den der Auftritt herbeigelockt hatte, nicht schnell zu Hilfe gekommen wäre.
Bei dieser Gelegenheit kam es übrigens zu einem hitzigen Wortwechsel zwischen Lo-Maï und einem kräftigen Burschen, der Raggi genannt wurde. Nach dem Fellüberwurf, den er trug, nach den Waffen, die an seinem Gürtel hingen, und nach den Federn, die seinen Kopf schmückten, ließ sich vermuthen, daß er der Anführer der Krieger sei. Schon sein grimmiger Gesichtsausdruck, seine befehlerischen Bewegungen und seine natürliche Derbheit ließen ihn zum Befehlshaber geschaffen erscheinen.
Als Folge dieser Fluchtversuche hatten die beiden Freunde erwartet, daß sie nun Seiner Majestät vorgeführt werden würden und sie endlich diesen König zu sehen bekämen, den seine Unterthanen so eifersuchtig in der königlichen Wohnung verborgen hielten. Ihre Hoffnung sollte getäuscht werden.
Offenbar war Raggi mit weitestgehender Vollmacht ausgestattet, und es schien rathsamer, ihn nicht durch Wiederholung solcher Versuche zu reizen. Die Aussichten auf ein Entkommen waren also sehr beschränkt, wenn nicht etwa die Wagddis beim Angriffe auf ein Nachbardorf selbst angegriffen wurden, denn dann konnte es ja bei einem feindlichen Einfalle möglich werden, Ngala unbemerkt zu verlassen. Doch nachher… was dann?…
Das Dorf wurde jedoch in den ersten Wochen in keiner Weise bedroht, außer durch gewisse Thiere, die Khamis und seinen Gefährten in dem großen Walde noch nicht vor Augen gekommen waren. Wenn die Wagddis in der Hauptsache auch in Ngala lebten oder wenigstens für die Nacht hierher zurückkehrten, so besaßen sie doch einige Hütten am Ufer des Rio. Man hätte fast von einem kleinen Flußhafen, dem Anlegeplatz für die Fischerfahrzeuge, reden können, und diese Fahrzeuge hatten sie nicht selten gegen Flußpferde, Manatis und die in den afrikanischen Gewässern so häufigen Krokodile zu vertheidigen.
Eines Tages, es war am 9. April, erhob sich da ein lauter Lärm; wüstes Geschrei schallte vom Rio heraus. Handelte es sich um einen Angriff, den Wesen ihresgleichen gegen die Wagddis unternahmen? Dank seiner Lage war das Dorf ja gegen einen plötzlichen Ueberfall gesichert. Bedachte man aber, daß vielleicht an die das Bauwerk tragenden Stämme Feuer gelegt würde, so mußte dessen Zerstörung das Werk weniger Stunden sein. Es war ja nicht unmöglich, daß die Urmenschen gegen ihre Nachbarn zu diesem Mittel gegriffen hätten, und daß diese es jetzt versuchten, es gegen sie anzuwenden.
Auf die ersten Schreie hin stürmten Raggi und etwa dreißig Krieger nach der Treppe hin, die sie mit affenartiger Geschwindigkeit hinunterkletterten. Von Lo-Maï geführt, kamen John Cort, Max Huber und Khamis nach der Stelle, von der aus der Wasserlauf zu überblicken war.
Es handelte sich wirklich um einen Ueberfall der am Flusse stehenden Hütten. Eine ganze Herde, nicht von Flußpferden, sondern von Cheropotamen oder vielmehr von Potamocheren, das heißt von eigentlichen Flußschweinen, war aus dem Hochwald hervorgebrochen, und die Thiere traten alles, wohin sie kamen, unter ihren Füßen nieder.
Diese Potamocheren, die die Boeren Bosh-wark und die Engländer Bushpigs nennen, kommen in der Gegend des Caps der Guten Hoffnung, in Guinea, am Congo, auch in Kamerun vor und richten oft recht empfindlichen Schaden an. Kleiner als das europäische Wildschwein, haben sie feinere Borsten, eine bräunliche, ins orangefarbene spielende Haut, spitze, mit einem Haarbüschel versehene Ohren, eine schwarze, mit weißen Borsten durchsetzte Mähne, die sich über das ganze Rückgrat hinzieht, einen stark entwickelten Rüssel und – was die männlichen Thiere betrifft – zwischen Nase und Auge eine Hautausstülpung, die von einem Knochenhöcker getragen wird.
Diese Schweine sind immer zu fürchten, im vorliegenden Falle waren sie es umsomehr, als sie in starker Ueberzahl auftraten.
Man hätte ihrer wohl hundert zählen können, die gegen das linke Ufer des Rio angestürmt kamen. Vor dem Dazwischentreten Raggi’s und seiner Leute waren auch schon die meisten Hütten umgeworfen worden.
Durch die Zweige der äußersten Bäume konnten John Cort, Max Huber, Khamis und Llanga dem Kampfe zusehen. Er war nur kurz, doch nicht gefahrlos. Die Krieger entwickelten dabei großen Muth. Sie bedienten sich mehr der Spieße und Aexte als der Pfeile und der Bogen, und drangen auf die Angreifer mit gleichem Ungestüm ein, wie die Thiere auf sie. So entwickelte sich ein Handgemenge – wenn dieser Ausdruck hier statthaft ist – wobei die Wagddis mit den Aexten dreinschlugen und den Vierfüßlern die Speere in die Seite rannten.
Nach kaum einstündigem Kampfe waren die Flußschweine verjagt und Ströme von Blut vermischten sich mit dem Wasser des kleinen Flusses.
Max Huber hatte große Lust gehabt, an der Schlacht theilzunehmen. Seine Flinte und die John Cort’s zu holen, von oben her auf die Herde zu schießen, die Potamocheren mit einem Bleihagel zu überschütten, gewiß zum größten Erstaunen der Wagddis, das wäre ja leicht auszuführen gewesen. Der kluge John Cort beruhigte aber seinen aufbrausenden Freund, und der Foreloper unterstützte ihn dabei.
»Nein, nein, sagte er, wir wollen uns für wichtigere Fälle ein Einschreiten vorbehalten. Wenn man über den Blitz verfügt, lieber Max…
– Ja, Du hast recht, John, dann schleudere man ihn nur im geeigneten Augenblick; und da es zum Donnern noch nicht Zeit, wollen wir unseren Donner für später aufsparen!«
Sechzehntes Capitel.
Seine Majestät Mselo-Tala-Tala
An diesem Tage – das heißt richtiger am 15. April – kam es zu einer auffallenden Veränderung in dem sonst so ruhigen Verhalten der Wagddis. Im Laufe von drei Wochen hatte sich den Gefangenen von Ngala keine Möglichkeit geboten, ihren Weg durch den großen Wald von Ubanghi fortzusetzen. Scharf überwacht und in die unübersteigbaren Grenzen dieses Dorfes eingeschlossen, hatten sie nicht entfliehen können. Wohl war es ihnen, und vor allem John Cort, unverwehrt gewesen, die Sitten und Gebräuche dieser zwischen dem am höchsten entwickelten Anthroporden und dem Menschen stehenden Wesen zu studieren, zu beobachten, welche ihre Instincte sie dem Thierreich zuwiesen und welche Dosis von Verstand sie der Menschheit näher brächte. Das ergab einen wahren Schatz von Einzelbeobachtungen, die in einer Erörterung der Darwinschen Lehre recht ersprießlich verwerthet werden konnten. Doch um die gelehrte Well damit zu beglücken, war es nöthig, wieder nach dem französischen Congogebiete und nach Libreville zurückgekehrt zu sein.
Das Wetter war herrlich. Blendender Sonnenschein lag warm auf den Wipfeln der Bäume, die das Dorf in den Lüften beschatteten. Nach Ueberschreitung des Zeniths in der Stunde ihrer Culmination verminderte sich Wärme und Glanz der Sonnenstrahlen, obwohl es schon über drei Uhr war, nicht im mindesten.
John Cort und Max Huber hatten mit den beiden Maïs vielfach Verkehr gehabt. Kein Tag war vergangen, ohne daß die Familie einmal in die Hütte der Fremden kam oder daß diese sie in der ihrigen aufsuchten. Es war ein richtiger Austausch von Besuchen, höchstens fehlten dabei die Visitenkarten. Der Kleine wich kaum von Llanga’s Seite und hatte eine herzliche Zuneigung für den jungen Eingebornen gewonnen.
Leider bestand immer die Unmöglichkeit, die Wagddisprache zu verstehen, obgleich diese nur eine kleine Zahl von Wörtern umfaßte, die jedenfalls für den Ausdruck der Gedanken dieser Urmenschen ausreichten. Hatte sich John Cort auch die Bedeutung einzelner Wörter gemerkt, so setzte ihn das doch noch nicht in den Stand, mit den Bewohnern von Ngala zu sprechen. Immer überraschte es ihn aber, daß im wagddiischen Wörterschatze verschiedene – vielleicht ein Dutzend –
Ausdrücke der Eingebornen vorkamen. Das schien ja anzudeuten, daß die Wagddis mit anderen Völkerschaften Ubanghis, vielleicht gar mit einem Congolesen in Berührung gekommen wären, der nach dem Congobecken nicht wieder zurückgekehrt war. Eine derartige Vermuthung ließ sich gewiß nicht gänzlich abweisen. Obendrein hörte man von Lo-Maï aber gar deutsche Wörter, wenn auch mit so falscher Aussprache, daß man sie kaum wiedererkennen konnte.
Das war ein Punkt, den John Cort für ganz unerklärlich hielt.
Wenn man auch annehmen konnte, daß andere Eingeborne und die Wagddis einander schon begegnet wären, wie fern lag da doch noch der Gedanke, daß die zweiten auch mit Deutschen in Kamerun in Berührung gestanden hätten! In diesem Falle hätte dem Franzosen und dem Amerikaner eine Priorität für ihre Entdeckung nicht zugestanden. Obgleich John Cort recht geläufig deutsch sprach, konnte er davon doch keinen Gebrauch machen, da Lo-Maï nur zwei oder drei Wörter dieser Sprache verstand.
Unter den den Eingebornen entlehnten Ausdrücken war Mselo-Tala-Tala, die Bezeichnung des Beherrschers dieser Sippe, der, den man am häufigsten hörte. Wir wissen, wie sehnlich es die beiden Freunde verlangte, von dieser unsichtbaren Majestät empfangen zu werden. Allemal freilich, wenn sie diesen Namen aussprachen, neigte Lo-Maï wie als Zeichen der Ehrerbietung den Kopf. Und wenn ihr Weg sie vor die königliche Hütte führte, hielt Lo-Maï sie zurück, drängte sie weg und führte sie nach rechts oder links weiter. Er machte ihnen dabei auf seine Art begreiflich, daß niemand das Recht habe, die Schwelle dieser geheiligten Wohnstätte zu überschreiten.
An diesem Nachmittage stellten sich nun, kurz vor drei Uhr, der Ngoro, die Ngora und deren kleiner Sohn bei Khamis und seinen Gefährten ein. Auf den ersten Blick sah man, daß die Familie in ihrer schönsten Kleidung erschien: der Vater mit einer mit Federn geschmückten Kopfbedeckung und in einem Ueberwurf aus Rindenstoff, die Mutter gehüllt in ein Aguliegewebe von wagddiischer Herkunft, mit einigen grünen Blättern im Haar und mit einer Kette aus Glasperlen und anderen kleinen Kugeln um den Hals, der Kleine endlich mit einem um die Taille gebundenen leichten Schurz – »in seinem Sonntagsstaate«, wie Max Huber sagte.
Als er alle drei so sonntäglich geputzt vor sich stehen sah, rief er lustig:
»Alle Wetter, was bedeutet denn das? Wollen die uns vielleicht gar eine Staatsvisite machen?
– Offenbar ist heute ein Festtag, meinte John Cort. Vielleicht handelt es sich um eine Ehrenbezeigung für irgend welche Gottheit. Das wäre hochinteressant in Bezug auf die Erkennung ihrer religiösen Vorstellungen!«
Noch bevor er diesen Satz vollendet hatte, sagte Lo-Maï, wie um zu antworten:
»Mselo-Tala-Tala…
– Der Vater mit der Brille!« übersetzte Max Huber.
Sofort trat er aus der Hütte in dem Glauben, daß der König der Wagddis eben hier vorüberkommen müsse.
Eine arge Täuschung… Max Huber sah auch nicht den Schatten von Seiner Majestät! Jedenfalls konnte er sich überzeugen, daß ganz Ngala in Bewegung war. Von allen Seiten strömte eine, ähnlich wie die Familie Mar geschmückte Menge zusammen. Ein richtiger Volksauflauf, dessen Theilnehmer sich in einem Zuge nach den zum westlichen Ende des Dorfes führenden Straßen wandten, wobei sich die einen wie lustige Bauern gegenseitig an den Händen hielten und die anderen wie Affen von einem Baum zum anderen umhersprangen.
»Da giebt es etwas neues, erklärte John Cort, der auf der Schwelle der Hütte stehen blieb.
– Das wird sich ja bald zeigen,« antwortete Max Huber.
Damit wendete er sich wieder Lo-Maï zu.
»Mselo-Tala-Tala? sagte er wiederholt in fragendem Tone.
– Mselo-Tala-Tala!« erwiderte Lo-Maï, indem er die Arme über der Brust kreuzte und den Kopf langsam neigte.
John Cort und Max Huber glaubten daraufhin annehmen zu dürfen, daß die wagddiische Bevölkerung sich anschickte, ihren Herrscher zu begrüßen, und daß dieser bald in all seinem Glanze erscheinen werde.
Die beiden Freunde hatten nun freilich keine Festkleider zur Hand. Sie sahen sich auf ihr abgetragenes und ziemlich fleckiges Jagdkostüm beschränkt und auf ihre Leibwäsche, die sie übrigens immer so sauber wie möglich zu halten suchten.
Sie brauchten also für seine Majestät keine besondere Toilette zu machen, und als die Familie Mar aus der Hütte heraustrat, folgten sie ihr mit Llanga nach.
Khamis hatte keine Lust, sich der tief unter ihm stehenden Volksmenge anzuschließen, er »blieb also allein zu Hause«, wo er sich damit beschäftigte, alles aufzuräumen, die Zubereitung des Abendessens zu überwachen und die Gewehre zu putzen.
Es erschien ihm rathsam, für jeden Fall vorbereitet zu sein, und vielleicht näherte sich schon die Stunde, wo es darauf ankam, von den Waffen Gebrauch zu machen.
John Cort und Max Huber ließen sich also von Lo-Maï willig durch das belebte Dorf führen. Dieses hatte keine eigentlichen Straßen, sondern die nach der Laune eines jeden hier oder da errichteten Strohhütten gruppierten sich höchstens um die Bäume oder vielmehr um deren sie beschützende Kronen.
Geschlossen wälzte sich die Menge dahin. Mindestens tausend Wagddis begaben sich nach dem Theile Ngalas, an dessen Ende sich die Königswohnung erhob.
»Nichts kann doch einer Menschenmenge ähnlicher sein, als was wir hier vor uns sehen! bemerkte John Cort, ganz dieselben Bewegungen, dieselbe Weise, seine Befriedigung durch Gesten und Ausrufe kund zu geben…
– Und daneben durch Grimassen, setzte Max Huber hinzu, und das verweist diese wunderlichen Wesen zu den Vierhändern!«
In der That hatten sich die gewöhnlich ernsten, zurückhaltenden und wenig mittheilsamen Wagddis noch niemals so ausgelassen lustig gezeigt. Und dabei bewahrten sie doch die unerklärliche Gleichgiltigkeit gegen die Fremden, denen sie nicht die geringste Beachtung zu schenken schienen
– eine Beachtung, die bei den Denkas, den Monbullus und andern afrikanischen Volksstämmen gewiß recht lästig empfunden worden wäre.
Das war wieder nicht sehr »menschlich«.
Nach einem langem Wege kamen John Cort und Max Huber nach dem Hauptplatze des Ortes, den die Aeste der letzten Bäume an der Westseite abschlossen, und von denen die üppiggrünen Zweige den Königspalast umrahmten.
Vorn standen hier die Krieger in voller Waffenausrüstung und mit Antilopenfellen, die mit seinen Lianen zusammengehalten waren, bekleidet, die Anführer mit Steinbockschädeln auf dem Kopfe, deren Hörner eine ganze Herde vortäuschten. Der »Oberst« Raggi war gar mit einem Büffelkopfe bedeckt, und mit dem Bogen auf der Schulter, der Axt im Gürtel und dem Spieß in der Hand stolzierte er vor der wagddiischen Armee auf und ab.
»Wahrscheinlich, meinte John Cort, beabsichtigt der Herrscher eine Truppenschau abzuhalten.
– Ja wohl; doch wenn er nicht erscheint, kann das nur daran liegen, daß er sich vor seinen getreuen Unterthanen überhaupt niemals zeigt. Oh, man hat kaum eine Vorstellung davon, welch hohes Ansehen die Unsichtbarkeit einem Monarchen verleiht, und der hier…«
Er wendete sich zu Lo-Maï, dem er sich durch Zeichen verständlich zu machen suchte.
»Wird Mselo-Tala-Tala denn herauskommen?«
Lo-Maï machte ein bejahendes Zeichen, doch als wollte er sagen:
»Später… später!
– Das ist gleichgiltig, erwiderte Max Huber, vorausgesetzt, daß es uns gestattet ist, sein erhabenes Antlitz zu betrachten…
– Und da wollen wir, fuhr John Cort fort, uns von dem Schauspiele ja nichts entgehen lassen!«
Die beiden Freunde beobachteten nun von dem, was erwähnenswerth erscheint, folgendes:
Die baumlose Mitte des Platzes bildete eine freie Fläche von etwa einem halben Hektar. Jetzt füllte diese die Menge, die sich jedenfalls an den vor sich gehenden Festlichkeiten bis zu dem Augenblick betheiligen wollte, wo der Herrscher auf der Schwelle seines Palastes erscheinen würde. Ob sie dann wohl vor ihm niederfiel?… Ob sie ihm vielleicht göttliche Ehren erwies?…
»Nun, bemerkte John Cort hierzu, solche Ehrenerweisungen hätten bezüglich der fraglichen Religiosität keinerlei Bedeutung, denn sie gälten ja doch nur einem Menschen.
– Wenigstens, erwiderte Max Huber, wenn dieser Mensch nicht aus Holz oder Stein besteht. Wenn der Potentat nur ein Götzenbild wäre, von der Art derer, die die Eingebornen Polynesiens anbeten…
– Dann, lieber Max, würde den Bewohnern von Ngala rein gar nichts mehr fehlen, ihnen die Würde als Menschen zuzugestehen. Sie hätten dann berechtigten Anspruch, ebenso wie die von Dir genannten Eingebornen, zur Menschheit gerechnet zu werden…
– Vorausgesetzt, daß die anderen das verdienen, antwortete Max Huber in einem für die polynesische Rasse wenig schmeichelhaften Tone.
– Gewiß, Max, schon weil diese an irgendwelchen Gott glauben, und noch nie ist es jemand in den Sinn gekommen oder wird es ihm einfallen, sie unter die Thiere zu rechnen, auch nicht unter die höchststehenden Vertreter der Thierwelt.«
Dank der Familie Lo-Maï konnten John Cort, Max Huber und Llanga einen Platz bekommen, von dem aus alles zu übersehen war.
Als die Menge die Mitte des freien Platzes geräumt hatte, begannen junge Wagddis beider Geschlechter einen Tanz aufzuführen, während die älteren zu trinken anfingen, als wollten sie es den Helden einer holländischen Kirmeß gleichthun.
Die Waldmenschen verzehrten ein aus Tamarindenschoten hergestelltes, gegohrenes und gewürztes Getränk, das sehr alkoholreich sein mußte, denn man sah daß die Köpfe sich dabei bald erhitzten und die Beine der Leute unsicher wurden.
Die Tänze erinnerten in keiner Weise an die hübschen Figuren eines Passe-pied (eines alten Schnelltanzes) oder eines Menuetts, arteten aber auch nicht aus zu den wüsten Verrenkungen und tollen Seitensprüngen, die man bei öffentlichen Bällen innerhalb der Pariser Bannmeile sehen kann. Im ganzen wurden sie mehr von Grimassen, als von Körperwendungen, und mehr von Purzelbäumen begleitet.
Kurz, in diesen choreographischen Uebungen fand man weniger vom Menschen, als vom Affen, doch wohl verstanden, nicht von dem, der zur Vorführung seiner Künste auf Jahrmärkten abgerichtet ist, sondern von dem Affen, der nur seinen natürlichen Instincten folgt.
Die Tänze wurden auch nicht von Rufen oder Gesängen der Zuschauer begleitet, sondern nur von höchst urwüchsigen Instrumenten, wie von Calebassen, die mit einer Haut straff bezogen waren, und von einer Art zu Pfeifen zugeschnittenen hohlen Stengeln, die ein Dutzend kräftiger Musikanten anbliesen, als wollten sie sich mit aller Gewalt die Lungen zersprengen. Wohl noch niemals mochte solch ein betäubender Lärm die Ohren von Weißen zerrissen haben.
»Sie scheinen keine Idee von einem musikalischen Tacte zu haben, bemerkte John Cort.
– Nicht mehr als von einer Tonhöhe und Harmonie, antwortete Max Huber.
– Trotzdem sind sie offenbar empfänglich für Musik, lieber Max…
– Das sind die Thiere auch, lieber John, wenigstens manche davon. Meiner Ansicht nach ist die Musik eine niedere Kunst, die sich nur an die niederen Sinne richtet. Handelt es sich dagegen um Malerei, Bildhauerei oder Literatur, so giebt es kein Thier, das deren Reiz empfände, und selbst von den intelligentesten wird man noch nicht beobachtet haben, daß sie beim Erblicken eines Gemäldes oder beim Anhören eines Gedichtes ihrer Befriedigung Ausdruck gegeben hätten.«
Wie dem auch sei, die Wagddis näherten sich mehr dem Menschen, nicht allein, weil sie einen Eindruck von der Musik empfanden, sondern auch, weil sie diese selbst ausübten.
So gingen, unter großer Ungeduld Max Huber’s, zwei volle Stunden hin. Am meisten erregte ihn freilich, daß Seine Majestät Mselo-Tala-Tala noch immer nicht zu erscheinen geruhte, um die Huldigungen seiner
Unterthanen
entgegenzunehmen.
Unter noch lauterem Getöse und wilderen Tänzen nahm die Festlichkeit ihren Fortgang. Die starken Getränke brachten bald Ausbrüche der Trunkenheit hervor, und schon drängte sich die Frage auf, wie dieses wüste Gelage enden möge, als plötzlich jeder Lärm verstummte.
Alle kauerten sich stillschweigend nieder. Das tiefste Schweigen folgte den geräuschvollen Kundgebungen, dem betäubenden Dröhnen der Tamtams und dem scharfen Kreischen der Pfeifen.
Da öffnete sich die Thüre der königlichen Wohnstätte und sofort bildeten davor die Krieger zu beiden Seiten Spalier.
»Endlich, rief Max Huber aufathmend, endlich werden wir ihn sehen, den Beherrscher dieser Waldmenschen!«
Aus der Thür trat seine Majestät aber noch nicht, vielmehr wurde ein dick mit Blättern bedeckter Kasten nach der Mitte des Platzes gebracht. Wie erstaunten aber die beiden Freunde, als sie darin eine… ganz gewöhnliche Drehorgel erkannten.
Höchst wahrscheinlich wurde dieses geheiligte Instrument nur bei großen Feierlichkeiten in Ngala benutzt, und die Wagddis lauschten auf dessen verschiedene Weisen mit dem Entzücken kunstbegeisterter Dilettanten.
»Das ist aber doch die Orgel des Doctor Johausen, sagte John Cort.
– Es kann nur dasselbe antediluvianische Musikwerk sein, antwortete Max Huber. Jetzt kann ich mir auch erklären, warum ich in der Nacht, wo wir hier darunter eintrafen, über mir den unausweichlichen Walzer aus dem »Freischütz«
unbestimmt zu hören glaubte.
– Und davon hast Du nichts gesagt, Max?
– Ich glaubte nur geträumt zu haben, John.
– Und diesen Leierkasten werden sich die Wagddis jedenfalls aus der Käfighütte des Doctors angeeignet haben.
– Und zwar, nachdem sie dem armen Manne übel mitgespielt hatten!« setzte Max Huber hinzu.
Ein stolz aussehender Wagddi – offenbar der Concertmeister des Dorfes – trat an das Instrument und begann dessen Handgriff zu drehen.
Sofort ertönte zum größten Vergnügen der Zuhörer der genannte Walzer, wenn von ihm auch einzelne Töne ausblieben.
Jetzt fand nach den Tanzaufführungen also ein regelrechtes Concert statt. Die Anwesenden hörten ihm, mit dem Kopfe –freilich nicht taktmäßig – nickend, zu. Den Einfluß, der bei einer Walzermelodie alle civilisierten Menschenkinder der Alten und der Neuen Welt veranlaßt, die Füße in entsprechende Bewegung zu setzen, empfanden hier die Zuhörer nicht.
Und wie erfüllt von der Wichtigkeit seines Amtes, leierte der Wagddi immer unverdrossen weiter.
John Cort fragte sich, ob es in Ngala wohl bekannt wäre, daß die Drehorgel auch noch andere Melodien hervorbringen konnte. Der Zufall hatte ja vielleicht diese Urmenschen entdecken lassen können, durch welchen Handgriff – nämlich durch Druck auf einen Knopf – die Melodie von Weber durch eine andere zu ersetzen wäre.
Und siehe da, nachdem eine halbe Stunde lang der Freischützwalzer erklungen war, drückte der Vortragende auf eine Feder an der Seite des Gehäuses, ganz wie es der Leierkastenmann auf der Straße, der sein Instrument an Riemen befestigt trägt, gethan haben würde.
»Sapperment… nein… das ist denn doch zu stark!« rief Max Huber.
Ja wahrlich, zu stark, wenigstens wenn den Waldmenschen nicht irgend jemand den Mechanismus des Leierkastens erklärt und ihnen gezeigt hatte, wie man alle in seinem Inneren verborgenen Melodien auslösen könne.
Schon setzte sich der Handgriff wieder in Bewegung.
Der deutschen Melodie folgte eines der beliebtesten französischen Volkslieder, das ergreifende Lied von der
»Gnade Gottes«.
Dieses »Meisterwerk« der Loïsa Puget ist ja wohl allgemein bekannt. Jedermann weiß, daß die Melodie in den ersten sechs Takten in A-moll gesetzt ist, und daß, wie es in der Zeit seiner Entstehung allgemein beliebt war, der Refrain jedes Verses dann nach A-dur übergeht.
»O, der Elende… der elende Pfuscher! stieß Max Huber so laut hervor, daß aus der Zuhörerschaft ein recht bedenkliches Murmeln hörbar wurde.
– Welcher Elende? fragte John Cort. Der, der den Leierkasten bearbeitet?
– Nein, der, der ihn angefertigt hat. Um an klingenden Stimmen zu sparen, hat er in seinem Kasten das Cis und Gis einfach weggelassen, und der in A-dur zu spielende Refrain:
»Nun geh’, mein Kind, leb’ wohl,
Dich leite Gottes Gnade«,
der ertönt nun in C-dur!
– Ja, ja, das ist ein Kapitalverbrechen! erklärte John Cort lachend.
– Und diese Barbaren, die davon gar nichts merken, die nicht entsetzt in die Höhe springen, wie jeder mit einem menschlichen Ohre Begabte aufspringen müßte!«
Nein, diese Schändung ließ die Wagddis völlig gleichgiltig; ruhig nahmen sie die verbrecherische Unterschiebung einer falschen Tonart für die richtige hin!
Wenn sie auch nicht in die Hände klatschten, obwohl genug, ihrem Aeußeren nach recht brauchbare Claqueure unter ihnen waren, so gaben sie ihrer Entzückung doch in der ihnen eigenen Weise Ausdruck.
»Schon das allein, sagte Max Huber, berechtigt dazu, sie zu den Thieren zu zählen!«
Dem Anscheine nach war der Leierkasten für keine anderen Stücke, als für den deutschen Walzer und für das französische Volkslied eingerichtet, denn die wechselten halbstündlich unverändert mit einander ab. Die Walzenstifte für andere Melodien waren jedenfalls gar zu lückenhaft. Zum Glücke gab das Instrument wenigstens alle Töne des deutschen Walzers an, so daß bei diesem Max Huber’s Widerwille sich nicht so fühlbar machte, wie bei der französischen Romanze.
Nach Schluß des Concertes begannen die Tänze aufs neue, und reichlich floß berauschendes Getränk wieder durch die Gurgel der Wagddis. Die Sonne war hinter den Baumkronen an der Westseite versunken, und zwischen dem Gezweig tauchten bald brennende Fackeln auf, um den Festplatz zu erleuchten, der bei der kurzen Dämmerung sonst bald in tiefes Dunkel gehüllt gewesen wäre.
Max Huber und John Cort hatten von dem Schauspiele genug und dachten schon daran, nach ihrer Hütte zurückzukehren, als Lo-Maï deutlich sagte:
»Mselo-Tala-Tala!«
Wirklich?… Wollte Seine Majestät jetzt die Ehrenbezeigungen seines Volkes annehmen?… Geruhte er endlich, seine göttliche Unsichtbarkeit aufzugeben?
Jetzt hüteten sich John Cort und Max Huber natürlich, fortzugehen.
Nach der Seite der königlichen Wohnung zu entstand eine neue Bewegung, die von einem dumpfen Murmeln der Menge begrüßt wurde. Die Thür sprang auf, und davor ordnete sich eine Leibwache von Kriegern, deren Führung der »Oberst«
Raggi übernahm.
Fast gleichzeitig wurde ein Thronsessel sichtbar – eigentlich ein altes, mit Stoffen und Blättern geschmücktes Sopha, worauf
– von vier stämmigen Burschen getragen – Seine Majestät hingestreckt lag.
Es war eine Persönlichkeit von etwa sechzig Jahren mit einem Kopfschmuck von glänzenden grünen Blättern, mit weißem Bart und Haar und von beträchtlichem Leibesumfang, dessen Gewicht auf den breiten Schultern seiner Diener recht fühlbar lasten mochte.
Der kleine Zug setzte sich in Bewegung und verfolgte einen Weg rings um den Platz.
Schweigsam, wie hypnotisiert durch die Erscheinung des erhabenen Mselo-Tala-Tala, verbeugte sich die Menge bis zum Boden.
Der Souverän erschien übrigens ziemlich unberührt von den Huldigungen, die ihm dargebracht wurden, die ihm zukamen und an die er wahrscheinlich längst gewöhnt war. Kaum geruhte er einmal, durch eine leise Bewegung des geheiligten Hauptes seiner Anerkennung Ausdruck zu geben. Sonst blieb er – abgesehen davon, daß er sich zwei- oder dreimal an der Nase kratzte – reungslos liegen. Auf seiner sehr langen Nase aber saß eine große Brille, was seinen Zunamen »Vater Spiegel« genügend erklärte.
Mit gespanntester Aufmerksamkeit betrachteten ihn die beiden Freunde, als er nahe bei ihnen vorüberkam.
»Das… das ist ja aber ein Mensch! versicherte John Cort.
– Ein Mensch? fragte Max Huber zweifelnd.
– Ja… ein Mensch… und was noch mehr ist, sogar ein Weißer!
– Wie?… Ein Weißer?«
Unzweifelhaft war der, den man auf seiner sedia gestatoria eben hier vorübertrug, ein anderes Wesen, als die von ihm regierten Wagddis, und auch kein Eingeborner aus den Stämmen des oberen Ubanghi. Nein, hier blieb jede Täuschung ausgeschlossen; es war ein Weißer, ein nicht zu verkennender Vertreter des Menschengeschlechtes!
»Und unsere Anwesenheit macht auf ihn gar keinen Eindruck, sagte Max Huber, er scheint uns überhaupt gar nicht zu bemerken. Zum Kuckuck! Wir gleichen doch nicht diesen Halbaffen von Ngala, und wenn wir auch drei Wochen unter ihnen verlebt haben, glaube ich doch nicht, daß wir schon nicht mehr wie richtige Menschen aussähen!«
Schon wollte er über die Köpfe vor ihm hinüberrufen:
»He da… Sie… geehrter Herr, da drüben, wollen Sie uns denn nicht eines Blickes würdigen?«
Da faßte ihn jedoch John Cort am Arme, und mit einer Stimme, die sein maßlosestes Erstaunen verrieth, sagte er:
»Ich erkenne ihn!
– Was?… Du willst ihn kennen?
– Ja!… Das ist der Doctor Johausen!«
Siebzehntes Capitel.
Der Zustand des Doctor Johausen
John Cort war früher in Libreville mit dem Doctor Johausen zusammengetroffen. Er konnte nicht irren: es war derselbe gelehrte Herr, der jetzt den Stamm der Wagddis regierte.
Es ist leicht genug, den Anfang seiner Geschichte im Auszuge wiederzugeben und sie sogar in ihrem Gesammtverlauf darzustellen. Ohne Unterbrechung reihten sich die Erlebnisse und Vorgänge auf dem Wege von der Waldhütte bis zum Dorfe Ngala aneinander.
Vor drei Jahren hatte dieser Deutsche, erfüllt von dem Wunsche, den wenig ernst genommenen und jedenfalls völlig mißglückten Versuch des Professor Garner wieder aufzunehmen, Malimba mit einer Begleitmannschaft von Schwarzen verlassen und genügende Vorräthe, Schießbedarf und Lebensmittel für ziemlich lange Zeit mitgenommen. Was er im Osten von Kamerun vorhatte, war ja nicht unbekannt geblieben. Er hatte die tolle Absicht, sich mitten unter den Affen häuslich niederzulassen, um deren Sprache zu erforschen. Nach welcher Gegend er sich aber begeben wollte, hatte er niemand anvertraut. Der Mann war eben ein Original mit weitreichenden Plänen, doch es war bei ihm, um einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, offenbar »eine Schraube locker«.
Was Khamis und seine Gefährten auf ihrem Rückwege entdeckt hatten, bewies zweifellos, daß der Doctor in dem Walde bis zu der Stelle gekommen war, wo der von Max Huber auf seinen Namen getaufte Rio Johausen hinfloß. Nach Zurücksendung seiner Begleiter hatte er hier ein Floß gebaut und sich darauf mit einem zu seiner Bedienung zurückbehaltenen Eingebornen eingeschifft.
So waren beide den Fluß hinuntergefahren, und zwar bis zu dem Sumpfgebiete, an dessen Grenze sie die vergitterte Hütte unter den Bäumen am rechten Ufer errichtet hatten.
Bis hierher reichten die sicheren Quellen bezüglich des Abenteuers des Doctor Johausen. Bezüglich des später Geschehenen verwandelten sich jetzt die bisherigen Vermuthungen zu unumstößlichen Gewißheiten.
Der Leser erinnert sich, daß Khamis damals, als er die verlassene Hütte durchsuchte, einen kleinen, kupfernen Kasten und darin eine Art Tagebuch gefunden hatte. Die Anmerkungen darin beschränkten sich freilich auf wenige, mit Bleistift geschriebene Zeilen von verschiedenem Datum, und zwar vom 27. Juli 1896 bis zum 24. August desselben Jahres.
Daraus ergab sich jedoch, daß der Doctor am 29. Juli ans Land gegangen war, seine Einrichtung am 13. August vollendet und seine Hütte bis zum 25. August, im ganzen also dreizehn Tage lang, bewohnt hatte.
Warum mochte er sie verlassen haben?… Vielleicht aus freien Stücken? Nein, das jedenfalls nicht. Daß die Wagddis zuweilen bis zu den Ufern des Rio vordrangen, davon hatten sich ja Khamis, John Cort und Max Huber selbst überzeugen können. Auch die flammenden Fackeln, die sich am Tage der Ankunft der Karawane am Saume des Waldes hin und her bewegten, waren jedenfalls von ihnen zwischen den Bäumen getragen worden. Das legte doch den Schluß nahe, daß jene Urmenschen die Hütte des Gelehrten entdeckt, sich seiner Person und seiner Habe bemächtigt und alles nach dem Dorfe in den Lüften übergeführt hatten.
Der eingeborne Diener war jedenfalls bei Zeiten durch den Wald entflohen. Wäre dieser auch nach Ngala gebracht worden, so würde John Cort oder Max Huber ihm auf jeden Fall schon einmal begegnet sein, denn er war ja hier nicht König und bewohnte auch gewiß nicht den Königspalast.
Uebrigens wäre er doch wohl bei der heutigen Feierlichkeit an der Seite seines Herrn als Würdenträger – warum nicht als erster Minister? – erschienen.
Die Wagddis hatten also den Doctor nicht schlechter behandelt, als Khamis und dessen Gefährten. Seine geistige Ueberlegenheit mochte sie so verblüfft haben, daß sie ihn zu ihrem Herrscher ernannten, was auch John Cort oder Max Huber hätte widerfahren können, wenn der Thron nicht bereits besetzt gewesen wäre. Seit drei Jahren regierte also hier der Doctor Johausen, der Vater Spiegel – jedenfalls hatte er diese Bezeichnung seinen Unterthanen selbst angelernt – unter dem Namen Mselo-Tala-Tala.
Das erklärte viele, bisher unerklärliche Dinge, so z. B. daß in der Sprache dieser Urmenschen mehrere congolesische und sogar einzelne deutsche Wörter vorkamen, ferner den Umstand, daß sie mit der Handhabung der Drehorgel vertraut waren, endlich, daß wohl auch ein gewisser Fortschritt in den Sitten und Gebräuchen der auf der tiefsten Sprosse der Stufenleiter der Menschheit stehenden Wesen stattgefunden hatte.
Diese Gedanken tauschten die beiden Freunde unter einander aus, als sie ihre Hütte wieder erreicht hatten.
Khamis erhielt sofort von allem Mittheilung.
»Was mir nicht recht in den Kopf will, setzte Max Huber dann noch hinzu, ist, daß der Doctor Johausen sich über die Anwesenheit von Fremden in seiner Hauptstadt gar nicht beunruhigt haben sollte. Er hat sich uns ja nicht einmal vorführen lassen, und es scheint ihm bei der Feierlichkeit gar nicht aufgefallen zu sein, daß wir seinen Unterthanen nicht im geringsten ähnelten.
– Ich bin ganz Deiner Ansicht, Max, antwortete John Cort, und ich kann unmöglich begreifen, warum uns Mselo-Tala-Tala noch nicht nach seinem Palaste befohlen hat.
– Vielleicht weiß er gar nicht, daß die Wagddis in diesem Theile des Waldes jemand gefangen genommen habe, bemerkte der Foreloper.
– Das ist wohl möglich, wäre aber immerhin seltsam, meinte John Cort. Hier liegt noch etwas vor, was wir aufzuklären suchen müssen.
– Doch wie denn? fragte Max Huber.
– Wir wollen uns nur darum bemühen, dann wird es uns schon gelingen,« antwortete John Cort.
Aus allem ging jedenfalls hervor, daß der Doctor Johausen, der nach dem Walde von Ubanghi gekommen war, um mitten unter Affen zu leben, in die Hände eines Stammes gefallen war, der entschieden über den Anthropoïden stand und dessen Vorhandensein er gar nicht geahnt hatte. Er war hier der Mühe überhoben, diesen Geschöpfen die Sprache zu lehren, denn sie sprachen schon allein; so hatte er sich darauf beschränkt, ihnen einzelne Wörter aus der congolesischen und aus der deutschen Sprache beizubringen. Da er ihnen wohl gleichzeitig als Arzt Beistand leistete, hatte er eine so große Popularität gewonnen, daß man ihn auf den Thron erhob. In der That war es John Cort auch schon aufgefallen, daß die Bewohner Ngalas sich einer vortrefflichen Gesundheit erfreuten, daß es hier keinen Kranken gab, und daß seit dem Eintreffen der Fremden – wie schon erwähnt – kein einziger Wagddi gestorben war.
Hier muß man also zugeben, daß, obwohl ein Arzt, den man sogar zum König gemacht hatte, im Dorfe lebte, die Sterblichkeit nicht zugenommen hatte. Eine etwas unziemliche Bemerkung über den Aerztestand, die Max Huber aber doch nicht unterdrücken konnte.
Was sollte nun geschehen?… War zu erwarten, daß die Stellung, die der Doctor Johausen in Ngala einnahm, eine Aenderung in der Lage der Gefangenen herbeiführen werde?…
Würde der Herrscher von teutonischer Rasse zögern, ihnen die Freiheit wiederzugeben, wenn sie vor ihm erschienen und ihn ersuchten, sie nach dem Congogebiete heimkehren zu lassen?
»Ich kann es nicht glauben, meinte Max Huber, und was wir zu thun haben, liegt klar zu Tage. Es ist sehr möglich, daß unsere Anwesenheit dem Doctor-Könige verheimlicht worden ist. Ich nehme sogar, obgleich das recht unwahrscheinlich ist, an, daß er uns bei der Feierlichkeit inmitten der Zuschauermenge gar nicht bemerkt hat. Das ist aber ein weiterer Grund, in seine königliche Wohnung Zutritt zu erzwingen.
– Wann denn? fragte John Cort.
– Noch heut’ Abend; und da er ein von seinem Volke hochverehrter Herrscher ist, wird sein Volk ihm gehorchen, und wenn er uns die Freiheit geschenkt hat, wird man uns mit den Seiner wagddiischen Majestät gleichen Wesen zukommenden Ehren bis an die Grenze begleiten.
– Doch wenn er es abschlägt?…
– Warum sollte er unseren Wunsch abschlagen?
– Weiß man das, lieber Max? rief John Cort lachend.
Vielleicht aus diplomatischen Erwägungen…
– Nun, wenn er es abschlägt, erklärte Max Huber erregt, werd’ ich ihm ins Gesicht sagen, daß er eben höchstens würdig sei, über die niedrigst stehenden Makaken zu herrschen und daß er noch weit unter seinen Unterthanen stehe!«
Von mehr phantastischen Nebendingen abgesehen, war dieser Vorschlag wohl der Erwägung werth.
Die Gelegenheit schien besonders günstig zu sein. Wenn das Fest mit der Nacht zu Ende ging, so dauerte ja wenigstens der Zustand der Trunkenheit fort, in den die gesammte Dorfbevölkerung gerathen war. Diesen Umstand galt es doch auszunützen, zumal da es wahrscheinlich lange dauerte, ehe er sich wiederholte. Die halb berauschten Wagddis waren dann jedenfalls zum Theil in ihren Strohhütten eingeschlafen, zum Theil mochten sie sich weit in den Wald hinein zerstreut haben.
Selbst die Krieger hatten dadurch, daß sie sinnlos tranken, ihre Uniform nicht zu entehren gefürchtet. Die königliche Wohnung würde deshalb also weniger sorgsam überwacht, und es konnte nicht schwer sein, bis zum Zimmer Mselo-Tala-Talas vorzudringen.
Dieser, auch von Khamis, dem allzeit weisen Berather, gebilligte Plan sollte also ausgeführt werden, und man wartete dazu nur die Nacht ab, wo im Dorfe allgemeine Trunkenheit herrschen mußte. Natürlich war Kollo, dem man erlaubt hatte, den Festlichkeiten beizuwohnen, noch nicht zurückgekehrt.
Gegen neun Uhr verließen Max Huber, John Cort, Llanga und der Foreloper ihre Hütte.
Ngala, das keinerlei öffentliche Beleuchtung hatte, lag in tiefem Dunkel. Die harzigen Fackeln, die zwischen den Baumkronen leuchteten, waren dem Erlöschen nahe. In der Umgebung Ngalas wie unter diesem summte noch ein verworrener Lärm, meist an der der Wohnstätte des Doctor Johausen entgegengesetzten Seite.
John Cort, Max Huber und Khamis hatten in der Voraussicht, noch heute Nacht mit oder ohne Zustimmung Seiner Majestät zu entfliehen, schon ihre Gewehre mitgenommen und ihre Taschen mit allen in dem Kasten noch vorhandenen Patronen gefüllt. Ueberraschte man sie, so konnte es ja nothwendig werden, die Feuerwaffen mitreden zu lassen… eine Sprache, die die Wagddis offenbar noch nicht kannten.
So gingen alle vier zwischen den meist leerstehenden Hütten dahin. Auf dem Platze angekommen, zeigte er sich völlig leer und in Dunkel gehüllt.
Nur aus dem Fenster der Wohnung des Souveräns drang ein schwacher Lichtschein.
»Hier ist niemand,« flüsterte John Cort.
In der That war kein lebendes Wesen zu entdecken, nicht einmal vor der Wohnung Mselo-Tala-Talas.
Raggi und seine Krieger hatten ihren Posten verlassen; diese Nacht war der Herrscher also nicht gut bewacht.
Immerhin konnten sich in der Nähe Seiner Majestät einige
»dienstthuende Kammerherren« aufhalten, deren Wachsamkeit wohl nicht so leicht zu täuschen war.
Wie dem auch sein mochte, Khamis und seinen Gefährten erschien die Gelegenheit gar zu verlockend. Durch glücklichen Zufall waren sie schon völlig unbemerkt bis an die Königswohnung gekommen, und jetzt wollten sie auf jeden Fall hineindringen.
Auf den Aesten hinkletternd, konnte Llanga bis an die Thür gelangen und sich von oben aus überzeugen, daß man diese nur aufzustoßen brauche, um ungehindert einzutreten.
John Cort, Max Huber und Khamis gingen sofort darauf zu.
Vor dem Eintreten legten sie einige Minuten das Ohr an die Wand, um zu lauschen und sich im Nothfalle noch zurückziehen zu können.
Weder drin noch draußen ließ sich das geringste hören.
Da überschritt Max Huber als der erste die geheiligte Schwelle. Seine Gefährten folgten ihm und drückten die Thür hinter sich wieder zu.
Die Wohnung bestand aus zwei nebeneinander liegenden Zimmern, das waren alle Räumlichkeiten, über die Mselo-Tala-Tala verfügte.
In dem vollkommen dunkeln Vorderzimmer befand sich keine lebende Seele.
Khamis drückte ein Ohr an die nach dem zweiten Raume führende Thür, die diesen nur mangelhaft abschloß und da und dort einen Lichtstrahl hindurchdringen ließ.
Der Doctor Johausen befand sich in halb liegender Stellung in dem Hinterzimmer auf einem Sopha. Dieses Möbelstück und einige andere, die sich darin befanden, entstammten offenbar der Ausstattung der Käfighütte und waren jedenfalls mit deren Eigenthümer nach Ngala gebracht worden.
»Nun hinein!« sagte Max Huber.
Bei dem dadurch entstehenden Geräusch wendete der Doctor Johausen den Kopf nach der Thüre zu und richtete sich ein wenig auf. Vielleicht war er erst aus tiefem Schlafe aufgewacht. Jedenfalls schien das Auftauchen der Fremden auf ihn aber gar keinen Eindruck zu machen.
»Herr Doctor Johausen, begann John Cort in deutscher Sprache, meine Freunde und ich wollten sich erlauben, Eurer Majestät ihre Ehrerbietung zu bezeigen!«
Der Doctor gab keine Antwort. Sollte er die Anrede nicht verstanden haben? Hatte er nach dreijährigem Verweilen unter den Wagddis vielleicht seine Muttersprache verlernt?
»Verstehen Sie mich? fuhr John Cort fort. Wir sind Fremde, die mit Gewalt nach dem Dorfe Ngala geschleppt worden waren.«
Keine Antwort.
Der wagddiische Herrscher schien die Fremden anzustarren, ohne sie zu sehen, sie anzuhören, ohne sie zu verstehen. Er machte keine Bewegung, keine Geste, so als wäre er völlig stumpfsinnig.
Max Huber trat an ihn heran, ergriff ihn, wenig respectvoll gegenüber einem centralafrikanischen Herrscher, an den Schultern und schüttelte ihn tüchtig ab.
Seine Majestät schnitt eine Grimasse, wie sie der geübteste Mandrillaffe von Ubanghi nicht besser hätte fertig bringen können.
Max Huber schüttelte ihn noch einmal.
Seine Majestät steckte ihm die Zunge heraus.
»Ist er denn verrückt? fragte John Cort.
– So verrückt, wie nur einer sein kann,« erklärte Max Huber.
Ja… der Doctor Johausen war vollkommen geistesabwesend.
Schon bei seiner Abreise aus Kamerun ziemlich überspannt, hatte er nach seiner Ankunft in Ngala den Verstand vollends eingebüßt. Wer weiß auch, ob es nicht gerade diese geistige Entartung war, der er seine Erhebung zum Könige der Wagddis verdankte. Bei den Indianern des Fernen Westens, wie bei den Wilden Oceaniens, steht ja die Tollheit in höherem Werthe als die Weisheit, und bei diesen Eingebornen gilt der Narr für ein geheiligtes Wesen, für einen Träger göttlicher Allmacht.
Der arme Doctor Johausen hatte thatsächlich jede Spur von Verstand verloren. Das war’s, warum er sich um die Anwesenheit der vier Fremden im Dorfe nicht kümmerte, warum er in zweien von ihnen nicht Individuen seiner eigenen, von der wagddiischen doch so abweichenden Rasse erkannt hatte.
»Jetzt bleibt uns nur eins übrig, sagte Khamis. Auf eine Entschließung dieses Uebergeschnappten, uns die Freiheit wiederzugeben, können wir nicht rechnen…
– Nein… gewiß nicht! bestätigte John Cort.
– Und das halbthierische Volk hier wird uns nie hinwegziehen lassen, setzte Max Huber hinzu. Da sich nun einmal die Gelegenheit zur Flucht bietet, so wollen wir entfliehen…
– Und zwar augenblicklich, mahnte Khamis. Machen wir uns die Nacht zu nutze…
– Und den Zustand, in dem sich diese ganze Welt von Halbaffen befindet, bemerkte Max Huber.
– Kommt also, sagte Khamis, der sich schon nach dem Vorzimmer hin wendete. Wir wollen versuchen, die Leitertreppe zu finden und dann in den Wald entweichen.
– Ja, ja, erwiderte Max Huber, doch… der Doctor…
– Der Doctor? wiederholte Khamis.
– Wir können ihn doch nicht in seiner wagddiischen Souveränität hier seinem Schicksale überlassen. Es ist unsere Menschenpflicht, auch ihn zu retten.
– Ja, gewiß lieber Max, stimmte John Cort dem Freunde zu.
Der Unglückliche ist nur des Verstandes völlig beraubt… er leistet vielleicht Widerstand. Wenn er sich nun weigert, uns zu folgen?
– Wir wollen wenigstens den Versuch machen,« antwortete Max Huber, sich dem Doctor nähernd.
Khamis und John Cort traten auch herzu und ergriffen den Doctor an den Armen.
Dieser, noch immer ein sehr kräftiger Mann, stieß sie zurück und streckte sich, gleich einer Crustacee, die man auf den Rücken gewendet hat, mit den Beinen zappelnd wieder lang nieder.
»Zum Teufel, rief Max Huber, der ist ja allein so schwer wie drei andere…
– Doctor Johausen?« rief ihn John Cort zum letztenmale an.
Statt jeder Antwort kratzte sich Seine Majestät, wie man es von Affen sieht, grinsend hinter den Ohren.
»Mit diesem zum Thier herabgesunkenen Menschenkinde ist nichts anzufangen, erklärte Max Huber. Er ist zum reinen Affen geworden. So mag er auch Affe bleiben und weiterhin über Affen herrschen!«
Jetzt hieß es nun blos, die königliche Wohnung zu verlassen.
Zum Unglücke hatte Seine Majestät unter abscheulichem Grimassenschneiden angefangen, zu schreien, und zwar so laut, daß es gehört werden mußte, wenn sich Wagddis in der Nähe befanden.
Zögerte man jetzt aber nur wenige Secunden, so ging damit vielleicht die so günstige Gelegenheit zur Flucht verloren…
vielleicht kam Raggi mit seinem Kriegsvolk herzugelaufen.
Die Lage der Fremden mußte sich, wenn diese in Mselo-Tala-Talas Wohnstätte überrascht wurden, entschieden verschlimmern, und dann konnten sie auf jede Hoffnung, ihre Freiheit wieder zu erlangen, getrost verzichten.
Khamis und seine Gefährten überließen also den Doctor sich selbst und stürmten durch die wieder geöffnete Thür ins Freie.
Achtzehntes Capitel.
Der Ausgang des Abenteuers
Der Zufall begünstigte die Flüchtlinge. Der Auftritt und Lärm im Innern der Wohnung hatte noch niemand herbeigezogen.
Der Vorplatz war leer, leer auch die darauf einmündenden Straßen. Einige Schwierigkeit machte es nur, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden,
zwischen dem Gezweig
hindurchzuschlüpfen und auf kürzestem Wege nach der Ngalaer Treppe zu gelangen.
Plötzlich tauchte vor den Fliehenden ein Wagddi auf.
Lo-Maï war es, in Begleitung seines Söhnchens. Der Kleine, der Khamis und den übrigen schon nachgelaufen war, als diese sich nach der Hütte Mselo-Tala-Talas begaben, hatte seinen Vater von dem Vorgange unterrichtet. Dieser beeilte sich, die Fremden aufzusuchen, weil er den Foreloper und dessen Gefährten in ernster Gefahr wähnte. Jetzt, wo ihm klar wurde, daß sie zu entfliehen trachteten, erbot er sich, ihnen als Führer zu dienen.
Das war ein Glück, denn sonst hätte keiner die Treppe gefunden.
Doch welche Enttäuschung, als sie diese erreicht hatten!
Der Eingang dazu war von Raggi und einem Dutzend Kriegern bewacht.
Wenn sie – zu vier – den Durchgang zu erzwingen versuchten, war doch wohl kaum der erwünschte Erfolg zu erwarten.
Jetzt hielt es Max Huber für an der Zeit, von seinem Gewehre Gebrauch zu machen.
Raggi und zwei andere wollten sich eben auf ihn stürzen.
Max Huber wich einige Schritte zurück und gab auf die Gegner Feuer.
Mitten in die Brust getroffen brach Raggi auf der Stelle todt zusammen.
Offenbar kannten die Wagddis weder den Gebrauch der Feuerwaffen, noch deren Wirkung. Der Knall und das Niederstürzen Raggi’s flößte ihnen einen solchen Schreck ein, daß man ihn kaum beschreiben kann. Und wäre ein Blitz während der Feierlichkeiten auf den Festplatz niedergefahren, sie hätten nicht heftiger erschrecken können. Der ganze Kriegertrupp stob auseinander; die einen flüchteten ins Dorf, die anderen voltigierten mit der Geschwindigkeit von Vierhändern die Treppe hinunter.
Für einen Augenblick war der Weg jetzt frei.
Nun hieß es nur, Lo-Maï und dem Kleinen zu folgen, die vorausgingen. John Cort, Max Huber, der Foreloper und Llanga ließen sich sozusagen hinuntergleiten, ohne dabei auf ein Hinderniß zu stoßen. Nachdem sie unter dem Dorfe in den Lüften hingeeilt waren, wendeten sie sich dem Rio zu. Diesen erreichten sie in wenigen Minuten, lösten hier eines der Canots vom Ufer und stiegen mit dem Vater und dem Kinde hinein.
Jetzt leuchteten aber von allen Seiten Fackeln auf und von allen Seiten kamen eine Menge Wagddis herbeigelaufen, die vorher in der Umgebung des Dorfes umhergeirrt waren. Ein wüthendes, drohendes Geschrei wurde von einer wahren Wolke von Pfeilen begleitet.
»Nun ohne Rücksicht, rief John Cort, es geht nicht anders!«
Max Huber und er legten die Gewehre an, während Khamis die Patronen zum schnellen Wiederladen bereit hielt.
Zwei Schüsse krachten. Zwei Wagddis waren getroffen und die wuthschnaubende Menge floh auseinander.
In diesem Augenblick wurde das durch Khamis vom Ufer abgestoßene Canot schon von der Strömung erfaßt und schnell verschwand es stromabwärts unter dem Schutze einer Reihe mächtig entwickelter Bäume.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Von der nach Südwesten gerichteten Fahrt durch den großen Wald ist nichts – wenigstens nichts besonderes – zu melden.
Mochte es auch noch andere ähnliche Luftdörfer geben, so bekamen die beiden Freunde doch kein weiteres zu Gesicht.
Da es an Munition nicht mangelte, war die Ernährung leicht durch die Jagd zu sichern, und in den Nachbargebieten des Ubanghi gab es Antilopen in Ueberfluß.
Am nächsten Abend legte Khamis das Canot für die Nacht an einem Baume am Ufer fest.
Während der Fahrt hatten John Cort und Max Huber mit den Beweisen ihrer Erkenntlichkeit gegen Lo-Maï nicht gegeizt, denn sie empfanden für diesen eine wirklich menschliche Theilnahme.
Zwischen Llanga und dem Kinde hatte sich eine wahrhaft brüderliche Freundschaft herausgebildet. Wie hätte der junge Eingeborne auch die anthropologischen Unterschiede herausfühlen können, die ihn weit über dieses kleine Wesen stellten.
John Cort und Max Huber hofften stark, Lo-Maï bestimmen zu können, daß er sie nach Libreville begleitete. Die Rückreise auf dem Rio, zweifellos einem Nebenflusse des Ubanghi, mußte ja ohne Beschwerde verlaufen, wenigstens wenn auch dieser Fluß nicht durch Stromschnellen oder Wasserfälle unterbrochen war.
Es war am Abend des 16. April, wo das plumpe Boot nach zwanzigstündiger Fahrt Halt machte. Khamis schätzte den seit dem vorigen Tage zurückgelegten Weg auf achtzig bis hundert Kilometer.
Hier an der Landungsstelle sollte die Nacht verbracht werden. Nothdürftig wurde ein Lager hergerichtet, dann aßen alle tüchtig, und während Lo-Maï wach blieb, genossen die übrigen einen durch nichts gestörten, stärkenden Schlummer.
Früh am nächsten Morgen machte Khamis alles zur Weiterfahrt zurecht und das Canot hätte bloß in die Strömung gesteuert zu werden brauchen.
Zu derselben Zeit stand Lo-Maï, sein Kind an der Hand, wartend am Flußrande.
John Cort und Max Huber traten auf ihn zu und drängten ihn, doch mit ihnen weiter zu fahren.
Lo-Maï schüttelte nur den Kopf und wies dabei nach dem Bette des Rio und andererseits nach der Tiefe des Waldes.
Die beiden Freunde wiederholten jedoch ihre dringende Aufforderung, die sie dem Wagddi durch allerlei Zeichen verständlich machten. Sie hätten Lo-Maï und Li-Maï so gern nach Libreville mitgenommen.
Gleichzeitig überhäufte Llanga das Kind mit seinen Liebkosungen, fiel ihm um den Hals und preßte es in die Arme.
Er suchte den Kleinen mit nach dem Canot zu ziehen.
Da sprach Li-Maï ein einziges Wort aus:
»Ngora!«
Ja… seine Mutter, die im Dorfe zurückgeblieben war und zu der Vater und Sohn zurückkehren wollten. Hier erkannte man die Familie, die nichts zu trennen vermochte.
So wurde denn endgiltig Abschied genommen, nachdem LoMaï für sich und den Kleinen mit dem nöthigen Nahrungsvorrath für den Rückweg bis Ngala versorgt worden war.
John Cort und Max Huber verhehlten nicht ihre tiefe Erregung bei dem Gedanken, die beiden, zwar der Rasse nach unter ihnen stehenden, doch so gemüthvollen, guten Wesen niemals wiederzusehen.
Llanga konnte sich nicht enthalten zu weinen, und große Thränen füllten auch die Augen des Vaters und des Kindes.
»Sieh da, sagte John Cort, glaubst Du nun, lieber Max, daß diese armen Geschöpfe der Menschheit doch sehr nahe stehen?
– Ja, John, weil sie lächeln und weinen können wie der Mensch!«
Das Canot trieb mit der Strömung hinunter, und von einer Biegung des Flusses aus konnten Khamis und seine Gefährten den beiden seelensguten Geschöpfen noch ein letztes Lebewohl zuwinken.
Die nächsten Tage, der 18. 19. 20. und 21. April, vergingen während der weiteren Fahrt auf dem Flusse bis zu dessen Einmündung in den Ubanghi. Die Strömung blieb immer sehr schnell, und daraufhin konnte man die vom Dorfe Ngala aus zurückgelegte Strecke wohl auf nahezu dreihundert Kilometer abschätzen.
Der Foreloper und seine Gefährten befanden sich damit in der Höhe der Stromschnellen des Zongo, in der Nähe des Winkels, den dieser Fluß da beschreibt, wo er schräg nach Süden abbiegt. Die Stromschnellen wären in dem Canot unmöglich zu überwinden gewesen, und um die Wasserfahrt weiter unten wieder aufzunehmen, hätte sich ein beschwerlicher Transport des Fahrzeuges über Land nöthig gemacht. Wohl wäre es von hier aus auch angänglich gewesen, den Rückweg in diesem Grenzgebiete zwischen dem Unabhängigen und dem Französischen Congo am linken Ufer des Ubanghi zu Fuß fortzusetzen, einer beschwerlichen Wanderung gegenüber bot das Canot aber doch gar zu handgreifliche Vortheile, denn mit einem solchen wurde viel Zeit gewonnen und viele Anstrengung erspart.
Glücklicherweise konnten Khamis und seine Gefährten die mühsame Ueberlandbeförderung umgehen.
Unterhalb der Stromschnellen des Zongo ist der Ubanghi bis zu seiner Vereinigung mit dem Congo überall schiffbar. Auch fehlt es von hier aus nicht an Schiffen, die Händler und Waaren nach dem Gebiete bringen, wo es vielfach Dörfer, Flecken und Missionärniederlassungen giebt. Die fünfhundert Kilometer, die sie noch von ihrem nächsten Ziele trennten, legten John Cort, Max Huber, Khamis und Llanga denn auch auf einem dieser großen Fahrzeuge zurück, für die damals sogar schon ein Dampfschleppdienst theilweise eingerichtet war.
Am 26. April legten sie bei einer Ortschaft am rechten Ufer an. Nach den früheren Strapazen wieder völlig gekräftigt und in vortrefflichem Gesundheitszustande, hatten sie nun, wie erwähnt, nur noch fünfhundert Kilometer bis Libreville zurückzulegen.
Durch die Vermittelung des Forelopers wurde sofort eine Karawane zusammengestellt, die, sich geraden Weges nach Westen wendend, binnen vierundzwanzig Tagen durch die fast endlosen congolesischen Ebenen zog.
Am 20. Mai langten dann John Cort, Max Huber, Khamis und Llanga in der ein Stück vor der Stadt gelegenen Factorei an, mit Jubel empfangen von ihren Freunden, die, seit fast sechs Monaten ohne jede Nachricht von ihnen, durch ihr langes Ausbleiben schwer beunruhigt gewesen waren.
Weder Khamis noch der junge Eingeborne sollten für die Zukunft von John Cort und Max Huber scheiden. Den jungen Llanga hatten sie ja so gut wie als Sohn angenommen, und Khamis war ihnen während der abenteuerlichen Reise der allzeit ergebene und erfahrene Führer gewesen.
Und der Doctor Johausen?… Und Ngala, das merkwürdige Dorf in den Lüften, das in Baumkronen des großen Waldes verborgen lag?…
Nun, früher oder später würde schon eine Expedition im Interesse der neueren anthropologischen Wissenschaft mit den seltsamen Wagddis in nähere Verbindung treten.
Was den deutschen Doctor angeht, so ist und bleibt dieser dem Wahnsinn verfallen, doch selbst angenommen, daß er noch einmal wieder zu Verstande käme und nach Malimba zurückkehrte, ist kaum zu sagen, ob er nicht mit Bedauern an die Zeit zurückdächte, wo der »Vater Spiegel« unter dem Namen Mselo-Tala-Tala noch seine mühelose Herrschaft ausübte, und ob nicht auf seine Veranlassung jene Bevölkerung von halbwerthigen Menschen unter die Gewalt des Deutschen Reiches käme.
Es wäre nur möglich, daß England…