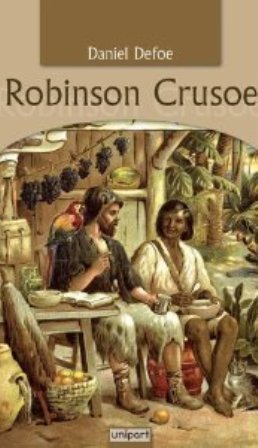
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Kapitel 1
Ich bin geboren zu York im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die ursprünglich nicht aus jener Gegend stammten. Mein Vater, ein Ausländer, aus Bremen gebürtig, hatte sich zuerst in Hull niedergelassen, war dort als Kaufmann zu hübschem Vermögen gekommen und dann, nachdem er sein Geschäft aufgegeben hatte, nach York gezogen. Hier heirathete er meine Mutter, eine geborene Robinson. Nach der geachteten Familie, welcher sie angehörte, wurde ich Robinson Kreuznaer genannt. In England aber ist es Mode, die Worte zu verunstalten, und so heißen wir jetzt Crusoe, nennen und schreiben uns sogar selbst so, und diesen Namen habe auch ich von jeher unter meinen Bekannten geführt.
Ich hatte zwei ältere Brüder. Der eine von ihnen, welcher als Oberstlieutenant bei einem englischen, früher von dem berühmten Oberst Lockhart befehligten Infanterieregiment in Flandern diente, fiel in der Schlacht bei Dünkirchen. Was aus dem jüngeren geworden ist, habe ich ebensowenig in Erfahrung bringen können, als meine Eltern je Kenntniß von meinen eignen Schicksalen erhalten haben.
Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Mein bereits bejahrter Vater hatte mich so viel lernen lassen, als durch die Erziehung im Hause und den Besuch einer Freischule auf dem Lande möglich ist. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Kein anderer Gedanke aber in Bezug auf meinen künftigen Beruf wollte mir behagen als der, Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem Zureden meiner Mutter, wie auch sonstiger mir freundlich gesinnter Menschen. Es schien, als habe das Schicksal in meine Natur einen unwiderstehlichen Drang gelegt, der mich gerades Wegs in künftiges Elend treiben sollte.
Mein Vater, der ein verständiger und ernster Mann war, durchschaute meine Pläne und suchte mich durch eindringliche Gegenvorstellungen von denselben abzubringen. Eines Morgens ließ er mich in sein Zimmer, das er wegen der Gicht hüten mußte, kommen und sprach sich über jene Angelegenheit mit großer Wärme gegen mich aus.»Was für andere Gründe«, sagte er,»als die bloße Vorliebe für ein unstetes Leben, können dich bewegen, Vaterhaus und Heimat verlassen zu wollen, wo du dein gutes Unterkommen hast und bei Fleiß und Ausdauer in ruhigem und behaglichem Leben dein Glück machen kannst. Nur Leute in verzweifelter Lage, oder solche, die nach großen Dingen streben, gehen außer Landes auf Abenteuer aus, um sich durch Unternehmungen empor zu bringen und berühmt zu machen, die außerhalb der gewöhnlichen Bahn liegen. Solche Unternehmungen aber sind für dich entweder zu hoch oder zu gering. Du gehörst in den Mittelstand, in die Sphäre, welche man die höhere Region des gemeinen Lebens nennen könnte. Die aber ist, wie mich lange Erfahrung gelehrt hat, die beste in der Welt; in ihr gelangt man am sichersten zu irdischem Glück. Sie ist weder dem Elend und der Mühsal der nur von Händearbeit lebenden Menschenklasse ausgesetzt, noch wird sie von dem Hochmuth, der Ueppigkeit, dem Ehrgeiz und dem Neid, die in den höheren Sphären der Menschenwelt zu Hause sind, heimgesucht.«
«Am besten«, fügte er hinzu,»kannst du die Glückseligkeit des Mittelstandes daraus erkennen, daß er von Allen, die ihm nicht angehören, beneidet wird. Selbst Könige haben oft über die Mißlichkeiten, die ihre hohe Geburt mit sich bringt, geklagt und gewünscht, in die Mitte der Extreme zwischen Hohe und Niedrige gestellt zu sein. Auch der Weise bezeugt, daß jener Stand der des wahren Glückes ist, indem er betet:»Armuth und Reichthum gib mir nicht«.
«Habe nur darauf Acht«, fuhr mein Vater fort,»so wirst du finden, daß das Elend der Menschheit zumeist an die höheren und niederen Schichten der Gesellschaft vertheilt ist. Die, welche in der mittleren leben, werden am seltensten vom Mißgeschick getroffen, sie sind minder den Wechselfällen des Glücks ausgesetzt, sie leiden bei weitem weniger an Mißvergnügen und Unbehagen des Leibes und der Seele wie jene, die durch ausschweifend üppiges Leben auf der einen, durch harte Arbeit, Mangel am Notwendigen oder schlechten und unzulänglichen Lebensunterhalt auf der anderen Seite, in Folge ihrer natürlichen Lebensstellung geplagt sind. Der Mittelstand ist dazu angethan, alle Arten von Tugenden und Freuden gedeihen zu lassen. Friede und Genügsamkeit sind im Gefolge eines mäßigen Vermögens. Gemüthsruhe, Geselligkeit, Gesundheit, Mäßigkeit, alle wirklich angenehmen Vergnügungen und wünschenswerten Erheiterungen sind die segensreichen Gefährten einer mittleren Lebensstellung. Auf der Mittelstraße kommt man still und gemächlich durch die Welt und sanft wieder heraus, ungeplagt von allzu schwerer Hand- oder Kopfarbeit, frei vom Sklavendienst ums tägliche Brod, unbeirrt durch verwickelte Verhältnisse, die der Seele die Ruhe, dem Leib die Rast entziehen, ohne Aufregung durch Neid, oder die im Herzen heimlich glühende Ehrbegierde nach großen Dingen. Dieser Weg führt vielmehr in gelassener Behaglichkeit durch das Dasein, gibt nur dessen Süßigkeiten, nicht aber auch seine Bitternisse zu kosten, er läßt die auf ihm wandeln mit jedem Tage mehr erfahren, wie gut es ihnen geworden ist.«
Hierauf drang mein Vater ernstlich und inständigst in mich, ich solle mich nicht gewaltsam in eine elende Lage stürzen, vor welcher die Natur, indem sie mich in meine jetzige Lebensstellung gebracht, mich sichtbarlich habe behüten wollen. Ich sei ja nicht gezwungen, meinen Unterhalt zu suchen. Er habe es gut mit mir vor und werde sich bemühen, mich in bequemer Weise in die Lebensbahn zu bringen, die er mir soeben gerühmt habe. Wenn es mir nicht wohl ergehe in der Welt, so sei das lediglich meine Schuld. Er habe keine Verantwortung dafür, nachdem er mich vor Unternehmungen gewarnt habe, die, wie er bestimmt wisse, zu meinem Verderben gereichen müßten. Er wolle alles Mögliche für mich thun, wenn ich daheim bleibe und seiner Anweisung gemäß meine Existenz begründe. Dagegen werde er sich dadurch nicht zum Mitschuldigen an meinem Mißgeschick machen, daß er mein Vorhaben, in die Fremde zu gehen, irgendwie unterstütze. Schließlich hielt er mir das Beispiel meines älteren Bruders vor. Den habe er auch durch ernstliches Zureden abhalten wollen, in den niederländischen Krieg zu gehen. Dennoch sei derselbe seinen Gelüsten gefolgt und habe darum einen frühen Tod gefunden.»Ich werde zwar«, so endete mein Vater,»nicht aufhören, für dich zu beten, aber das sage ich dir im Voraus: wenn du deine thörichten Pläne verfolgst, wird Gott seinen Segen nicht dazu geben, und du wirst vielleicht einmal Muße genug haben, darüber nachzudenken, daß du meinen Rath in den Wind geschlagen hast. Dann aber möchte wohl Niemand da sein, der dir zur Umkehr behülflich sein kann.«
Bei diesen letzten Worten, die, was mein Vater wohl selbst kaum ahnte, wahrhaft prophetisch waren, strömten ihm, besonders als er meinen gefallenen Bruder erwähnte, die Thränen reichlich über das Gesicht. Als er von der Zeit der zu späten Reue sprach, gerieth er in eine solche Bewegung, daß er nicht weiter reden konnte.
Ich war durch seine Worte in innerster Seele ergriffen, und wie hätte das anders sein können! Mein Entschluß stand fest, den Gedanken an die Fremde aufzugeben und mich, den Wünschen meines Vaters gemäß, zu Hause niederzulassen. Aber ach, schon nach wenigen Tagen waren diese guten Vorsätze verflogen, und um dem peinlichen Zureden meines Vaters zu entgehen, beschloß ich einige Wochen später, mich heimlich davon zu machen. Indeß führte ich diese Absicht nicht in der Hitze des ersten Entschlusses aus, sondern nahm eines Tages meine Mutter, als sie ungewöhnlich guter Laune schien, bei Seite und erklärte ihr, mein Verlangen die Welt zu sehen gehe mir Tag und Nacht so sehr im Kopfe herum, daß ich Nichts zu Hause anfangen könnte, wobei ich Ausdauer genug zur Durchführung haben würde.»Mein Vater«, sagte ich,»thäte besser, mich mit seiner Einwilligung gehen zu lassen als ohne sie. Ich bin im neunzehnten Jahre und zu alt, um noch die Kaufmannschaft zu erlernen oder mich auf eine Advokatur vorzubereiten. Wollte ich's doch versuchen, so würde ich sicherlich nicht die gehörige Zeit aushalten, sondern meinem Principal entlaufen und dann doch zur See gehen. «Ich bat die Mutter bei dem Vater zu befürworten, daß er mich eine Seereise zum Versuch machen lasse. Käme ich dann wieder und die Sache hätte mir nicht gefallen, so wollte ich nimmer fort und verspräche für diesen Fall, durch doppelten Fleiß das Versäumte wieder einzuholen.
Meine Mutter gerieth über diese Mittheilung in große Bestürzung. Es würde vergebens sein, erwiederte sie, mit meinem Vater darüber zu sprechen, der wisse zu gut, was zu meinem Besten diene, um mir seine Einwilligung zu so gefährlichen Unternehmungen zu geben.»Ich wundere mich«, setzte sie hinzu,»daß du nach der Unterredung mit deinem Vater und nach seinen liebreichen Ermahnungen noch an so Etwas denken kannst. Wenn du dich absolut ins Verderben stürzen willst, so ist dir eben nicht zu helfen. Darauf aber darfst du dich verlassen, daß ich meine Einwilligung dir nie gebe und an deinem Unglück nicht irgend welchen Theil haben will. Auch werde ich niemals in Etwas einwilligen, was nicht die Zustimmung deines Vaters hat.«
Wie ich später erfuhr, war diese Unterredung von meiner Mutter, trotz ihrer Versicherung, dem Vater davon Nichts mittheilen zu wollen, ihm doch von Anfang bis zu Ende erzählt worden. Er war davon sehr betroffen gewesen und hatte seufzend geäußert:»Der Junge könnte nun zu Hause sein Glück machen, geht er aber in die Fremde, wird er der unglücklichste Mensch von der Welt werden; meine Zustimmung bekommt er nicht.«
Es währte beinahe noch ein volles Jahr, bis ich dennoch meinen Vorsatz ausführte. In dieser ganzen Zeit aber blieb ich taub gegen alle Vorschläge, ein Geschäft anzufangen, und machte meinen Eltern oftmals Vorwürfe darüber, daß sie sich dem, worauf meine ganze Neigung ging, so entschieden widersetzten.
Eines Tages befand ich mich zu Hull, wohin ich jedoch zufällig und ohne etwa Fluchtgedanken zu hegen, mich begeben hatte. Ich traf dort einen meiner Kameraden, der im Begriff stand, mit seines Vaters Schiff zur See nach London zu gehen. Er drang in mich, ihn zu begleiten, indem er nur die gewöhnliche Lockspeise der Seeleute, nämlich freie Fahrt, anbot. So geschah es, daß ich, ohne Vater oder Mutter um Rath zu fragen, ja ohne ihnen auch nur ein Wort zu sagen, unbegleitet von ihrem und Gottes Segen und ohne Rücksicht auf die Umstände und Folgen meiner Handlung, in böser Stunde (das weiß Gott!) am ersten September 1651 an Bord des nach London bestimmten Schiffes ging.
Niemals, glaube ich, haben die Mißgeschicke eines jungen Abenteurers rascher ihren Anfang genommen und länger angehalten als die meinigen. Unser Schiff war kaum aus dem Humberfluß, als der Wind sich erhob und die See anfing fürchterlich hoch zu gehen. Ich war früher nie auf dem Meere gewesen und wurde daher leiblich unaussprechlich elend und im Gemüth von furchtbarem Schrecken erfüllt. Jetzt begann ich ernstlich darüber nachzudenken, was ich unternommen, und wie die gerechte Strafe des Himmels meiner böswilligen Entfernung vom Vaterhaus und meiner Pflichtvergessenheit alsbald auf dem Fuße gefolgt sei. Alle guten Rathschläge meiner Eltern, die Thränen des Vaters und der Mutter Bitten traten mir wieder vor die Seele, und mein damals noch nicht wie später abgehärtetes Gewissen machte mir bittere Vorwürfe über meine Pflichtwidrigkeit gegen Gott und die Eltern.
Inzwischen steigerte sich der Sturm, und das Meer schwoll stark, wenn auch bei weitem nicht so hoch, wie ich es später oft erlebt und schon einige Tage nachher gesehen habe. Doch reichte es hin, mich, als einen Neuling zur See und da ich völlig unerfahren in solchen Dingen war, zu entsetzen. Von jeder Woge meinte ich, sie würde uns verschlingen, und so oft das Schiff sich in einem Wellenthal befand war mir, als kämen wir nimmer wieder auf die Höhe. In dieser Seelenangst that ich Gelübde in Menge und faßte die besten Entschlüsse. Wenn es Gott gefalle, mir das Leben auf dieser Reise zu erhalten, wenn ich jemals wieder den Fuß auf festes Land setzen dürfe, so wollte ich alsbald heim zu meinem Vater gehen und nie im Leben wieder ein Schiff betreten. Dann wollte ich den väterlichen Rath befolgen und mich nicht wieder in ein ähnliches Elend begeben. Jetzt erkannte ich klar die Richtigkeit der Bemerkungen über die goldene Mittelstraße des Lebens. Wie ruhig und behaglich hatte mein Vater sein Leben lang sich befunden, der sich nie den Stürmen des Meeres und den Kümmernissen zu Lande ausgesetzt hatte. Kurz, ich beschloß fest, mich aufzumachen gleich dem verlorenen Sohne und reuig zu meinem Vater zurückzukehren.
Diese weisen und verständigen Gedanken hielten jedoch nur Stand, so lange der Sturm währte und noch ein Weniges darüber. Am nächsten Tage legte sich der Wind, die See ging ruhiger, und ich ward die Sache ein wenig gewohnt. Doch blieb ich den ganzen Tag still und ernst und litt noch immer etwas an der Seekrankheit. Am Nachmittag aber klärte sich das Wetter auf, der Wind legte sich völlig, und es folgte ein köstlicher Abend. Die Sonne ging leuchtend unter und am nächsten Morgen ebenso schön auf. Wir hatten wenig oder gar keinen Wind, die See war glatt, die Sonne strahlte darauf, und ich hatte einen Anblick so herrlich wie nie zuvor.
Nach einem gesunden Schlaf, frei von der Seekrankheit, in bester Laune betrachtete ich voll Bewunderung das Meer, das gestern so wild und fürchterlich gewesen und nun so friedlich und anmuthig war. Und gerade jetzt, damit meine guten Vorsätze ja nicht Stand halten sollten, trat mein Kamerad, der mich verführt hatte, zu mir.»Nun, mein Junge«, sagte er, mich mit der Hand auf die Schulter klopfend,»wie ist's bekommen? Ich wette, du hast Angst ausgestanden, bei der Hand voll Wind, die wir gestern hatten, wie?«—»Eine Hand voll Wind nennst du das?«erwiederte ich;»es war ein gräßlicher Sturm.«—»Ein Sturm? Narr, der du bist; hältst du das für einen Sturm? Gib uns ein gutes Schiff und offene See, so fragen wir den Teufel was nach einer solchen elenden Brise. Aber du bist nur ein Süßwassersegler; komm, laß uns eine Bowle Punsch machen, und du wirst bald nicht mehr an die Affaire denken. Schau, was ein prächtiges Wetter wir haben!«
Um es kurz zu machen, wir thaten nach Seemannsbrauch. Der Punsch wurde gebraut und ich gehörig angetrunken. Der Leichtsinn dieses einen Abends ersäufte alle meine Reue, all meine Gedanken über das Vergangene, alle meine Vorsätze für die Zukunft. Wie die See, als der Sturm sich gelegt, wieder ihre glatte Miene und friedliche Stille angenommen hatte, so war auch der Aufruhr in meiner Seele vorüber. Meine Befürchtungen, von den Wogen verschlungen zu werden, hatte ich vergessen, meine alten Wünsche kehrten zurück, und die Gelübde und Verheißungen, die ich in meinem Jammer gethan, waren mir aus dem Sinn. Hin und wieder stellten sich indessen meine Bedenken wiederum ein, und ernsthafte Besorgnisse kehrten von Zeit zu Zeit in meine Seele zurück. Jedoch ich schüttelte sie ab und machte mich davon los gleich als von einer Krankheit, hielt mich ans Trinken und an die lustige Gesellschaft und wurde so Herr über diese» Anfälle«, wie ich sie nannte. Nach fünf oder sechs Tagen war ich so vollkommen Sieger über mein Gewissen, wie es ein junger Mensch, der entschlossen ist, sich nicht davon beunruhigen zu lassen, nur sein kann.
Aber ich sollte noch eine neue Probe bestehen. Die Vorsehung hatte, wie in solchen Fällen gewöhnlich, es so geordnet, daß mir keine Entschuldigung bleiben konnte. Denn wenn ich das erste Mal mich nicht für gerettet ansehen wollte, so war die nächste Gelegenheit so beschaffen, daß der gottloseste und verhärtetste Bösewicht sowohl die Größe der Gefahr, als die der göttlichen Barmherzigkeit dabei hätte anerkennen müssen.
Am sechsten Tage unserer Fahrt gelangten wir auf die Rhede von Yarmouth. Der Wind war uns entgegen und das Wetter ruhig gewesen, und so hatten wir nach dem Sturm nur eine geringe Strecke zurückgelegt. Dort sahen wir uns genöthigt, vor Anker zu gehen, und lagen, weil der Wind ungünstig, nämlich aus Südwest blies, sieben oder acht Tage daselbst, während welcher Zeit viele andere Schiffe von New-Castle her aus eben dieser Rhede, welche den gemeinsamen Hafen für die guten Wind die Themse hinauf erwartenden Schiffe abgab, vor Anker gingen.
Wir wären jedoch nicht so lange hier geblieben, sondern mit der Flut allmählich stromaufwärts gegangen, hätte der Wind nicht zu heftig geweht. Nach dem vierten oder fünften Tag blies er besonders scharf. Da aber die Rhede für einen guten Hafen galt, der Ankergrund gut und unser Ankertau sehr stark war, machten unsre Leute sich Nichts daraus, sondern verbrachten ohne die geringste Furcht die Zeit nach Seemannsart mit Schlafen und Zechen. Den achten Tag aber ward des Morgens der Wind stärker, und wir hatten alle Hände voll zu thun, die Topmasten einzuziehn und Alles zu dichten und festzumachen, daß das Schiff so ruhig wie möglich vor Anker liegen könnte. Um Mittag ging die See sehr hoch. Es schlugen große Wellen über das Deck, und ein- oder zweimal meinten wir, der Anker sei losgewichen, worauf unser Kapitän sogleich den Nothanker loszumachen befahl, so daß wir nun von zwei Ankern gehalten wurden.
Unterdessen erhob sich ein wahrhaft fürchterlicher Sturm, und jetzt sah ich zum ersten Mal Angst und Bestürzung auch in den Mienen unsrer Seeleute. Ich hörte den Kapitän, der mit aller Aufmerksamkeit auf die Erhaltung des Schiffes bedacht war, mehrmals, während er neben mir zu seiner Kajüte hinein- und herausging, leise vor sich hinsagen:»Gott sei uns gnädig, wir sind Alle verloren «und dergleichen Aeußerungen mehr.
Während der ersten Verwirrung lag ich ganz still in meiner Koje, die sich im Zwischendeck befand, und war in einer unbeschreiblichen Stimmung. Es war mir nicht möglich, die vorigen reuigen Gedanken, die ich so offenbar von mir gestoßen hatte, wieder aufzunehmen. Ich hatte geglaubt die Todesgefahr überstanden zu haben, und gemeint, es würde jetzt nicht so schlimm werden wie das erste Mal. Jedoch als der Kapitän in meine Nähe kam und die erwähnten Worte sprach, erschrak ich fürchterlich. Ich ging aus meiner Kajüte und sah mich um. Niemals hatte ich einen so furchtbaren Anblick gehabt. Das Meer ging bergehoch und überschüttete uns alle drei bis vier Minuten. Wenn ich überhaupt Etwas sehen konnte, nahm ich Nichts als Jammer und Noth ringsum wahr. Zwei Schiffe, die nahe vor uns vor Anker lagen, hatten, weil sie zu schwer beladen waren, ihre Mastbäume kappen und über Bord werfen müssen, und unsre Leute riefen einander zu, daß ein Schiff, welches etwa eine halbe Stunde von uns ankerte, gesunken sei. Zwei andere Schiffe, deren Anker nachgegeben hatten, waren von der Rhede auf die See getrieben und, aller Masten beraubt, jeder Gefahr preisgegeben. Die leichten Fahrzeuge waren am besten daran, da sie der See nicht so vielen Widerstand entgegensetzen konnten; aber zwei oder drei trieben auch von ihnen hinter uns her und wurden vom Winde, dem sie nur das Sprietsegel boten, hin und her gejagt.
Gegen Abend fragten der Steuermann und der Hochbootsmann den Kapitän, ob sie den Fockmast kappen dürften. Er wollte anfangs nicht daran, als aber der Hochbootsmann ihm entgegen hielt, daß, wenn es nicht geschähe, das Schiff sinken würde, willigte er ein. Als man den vorderen Mast beseitigt hatte, stand der Hauptmast so lose und erschütterte das Schiff dermaßen, daß die Mannschaft genöthigt war, auch ihn zu kappen und das Deck frei zu machen.
Jedermann kann sich denken, in welchem Zustand bei diesem Allen ich, als Neuling zur See, und nachdem ich so kurz vorher eine solche Angst ausgestanden, mich befand. Doch wenn ich jetzt die Gedanken, die ich damals hatte, noch richtig anzugeben vermag, so war mein Gemüth zehnmal mehr in Trauer darüber, daß ich meine früheren Absichten aufgegeben und wieder zu den vorhergefaßten Plänen zurückgekehrt war, als über den Gedanken an den Tod selbst. Diese Gefühle, im Verein mit dem Schreck vor dem Sturm, versetzten mich in eine Gemüthslage, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Das Schlimmste aber sollte noch kommen!
Der Sturm wüthete dermaßen fort, daß die Matrosen selbst bekannten, sie hätten niemals einen schlimmern erlebt. Unser Schiff war zwar gut, doch hatte es zu schwer geladen und schwankte so stark, daß die Matrosen wiederholt riefen, es werde umschlagen. In gewisser Hinsicht war es gut für mich, daß ich die Bedeutung dieses Worts nicht kannte, bis ich später danach fragte.
Mittlerweile wurde der Sturm so heftig, daß ich sah, was man nicht oft zu sehen bekommt, nämlich wie der Kapitän, der Hochbootsmann und etliche Andere, die nicht ganz gefühllos waren, zum Gebet ihre Zuflucht nahmen. Sie erwarteten nämlich jeden Augenblick, das Schiff untergehen zu sehen. Mitten in der Nacht schrie, um unsre Noth vollzumachen, ein Matrose, dem aufgetragen war darauf ein Augenmerk zu haben, aus dem Schiffsraum, das Schiff sei leck und habe schon vier Fuß Wasser geschöpft. Alsbald wurde Jedermann an die Pumpen gerufen. Bei diesem Ruf glaubte ich das Herz in der Brust erstarren zu fühlen. Ich fiel rücklings neben mein Bett, auf dem ich in der Kajüte saß, die Bootsleute aber rüttelten mich auf und sagten, wenn ich auch sonst zu Nichts nütze sei, so tauge ich doch zum Pumpen so gut wie jeder Andere. Da raffte ich mich auf, eilte zur Pumpe und arbeitete mich rechtschaffen ab.
Inzwischen hatte der Kapitän bemerkt, wie einige leichtbeladene Kohlenschiffe, weil sie den Sturm vor Anker nicht auszuhalten vermochten, in die freie See stachen und sich uns näherten. Daher befahl er ein Geschütz zu lösen und dadurch ein Nothsignal zu geben. Ich, der ich nicht wußte, was das zu bedeuten hatte, wurde, weil ich glaubte, das Schiff sei aus den Fugen gegangen, oder es sei sonst etwas Entsetzliches geschehen, so erschreckt, daß ich in Ohnmacht fiel. Weil aber Jeder nur an Erhaltung des eignen Lebens dachte, bekümmerte sich keine Seele um mich. Ein Anderer nahm meine Stelle an der Pumpe ein, stieß mich mit dem Fuß bei Seite und ließ mich für todt liegen, bis ich nach geraumer Zeit wieder zu mir kam.
Wir arbeiteten wacker fort, aber das Wasser stieg im Schiffsraum immer höher, und das Schiff begann augenscheinlich zu sinken. Zwar legte sich jetzt der Sturm ein wenig, allein unmöglich konnte unser Fahrzeug sich so lange über Wasser halten, bis wir einen Hafen erreichten. Deshalb ließ der Kapitän fortwährend Nothschüsse abfeuern. Endlich wagte ein leichtes Schiff, das gerade vor uns vor Anker lag, ein Hülfsboot auszusenden. Mit äußerster Gefahr nahete dieses sich uns, doch schien unmöglich, daß wir hineinsteigen könnten oder daß es auch nur an unser Schiff anzulegen vermöchte. Endlich kamen die Matrosen mit Lebensgefahr durch mächtiges Rudern so nahe, daß unsre Leute ihnen vom Hintertheil des Schiffes ein Tau mit einer Boje zuwerfen konnten. Als sie unter großer Mühe und Noth des Seils habhaft geworden, zogen sie sich damit dicht an den Stern unseres Fahrzeugs heran, worauf wir denn sämmtlich uns in das ihrige begaben. Aber nun war gar kein Gedanke daran, daß wir mit dem Boote das Schiff, zu dem es gehörte, erreichen könnten. Daher beschlossen wir einmüthig, das Boot vom Wind treiben zu lassen und es nur so viel wie möglich nach der Küste zu steuern. Der Kapitän versprach den fremden Leuten, ihr Fahrzeug. wenn es am Strande scheitern sollte, zu bezahlen. So gelangten wir denn, theils durch Rudern, theils vom Winde getrieben, nordwärts etwa in der Gegend von Winterton-Neß nahe an die Küste heran.
Kaum eine Viertelstunde hatten wir unser Schiff verlassen, als wir es schon untergehen sahen. Jetzt begriff ich, was es heißt, wenn ein Schiff in See leck wird. Ich gestehe, daß ich kaum den Muth hatte hinzusehen, als die Matrosen mir sagten, das Schiff sei im Sinken. Denn seit dem Augenblick, wo ich in das Boot mehr geworfen als gestiegen war, stand mir das Herz vor Schrecken und Gemüthsbewegung und vor den Gedanken an die Zukunft, so zu sagen, stille.
Während die Bootsleute sich müheten uns an Land zu bringen, bemerkten wir (denn sobald uns die Woge in die Höhe trug, vermochten wir die Küste zu sehen), wie eine Menge Menschen am Strande hin- und herliefen, um uns, wenn wir herankämen, Hülfe zu leisten. Doch gelangten wir nur langsam vorwärts und konnten das Land nicht eher erreichen, bis wir den Leuchtthurm von Winterton passirt hatten. Hier flacht sich die Küste von Cromer westwärts ab, und so vermochte das Land die Heftigkeit des Windes ein wenig zu brechen. Dort legten wir an, gelangten sämmtlich, wiewohl nicht ohne große Anstrengungen ans Ufer und gingen hierauf zu Fuße nach Yarmouth. Als Schiffbrüchige wurden wir in dieser Stadt, sowohl von den Behörden, welche uns gute Quartiere anwiesen, als auch von Privatleuten und Schiffseignern, mit großer Humanität behandelt und mit so viel Geld versehen, daß es hingereicht hätte, uns, je nachdem wir Lust hatten, die Reise nach London oder nach Hull zu ermöglichen.
Hätte ich nun Vernunft genug gehabt, in meine Heimat zurückzukehren, so wäre das mein Glück gewesen, und mein Vater würde, um mit dem Gleichniß unseres Heilandes zu reden, das fetteste Kalb zur Feier meiner Heimkehr geschlachtet haben. Nachdem er gehört, das Schiff, mit dem ich von Hull abgegangen war, sei auf der Rhede von Yarmouth untergegangen, hat er lange in der Meinung gelebt, ich sei ertrunken.
Jedoch mein böses Schicksal trieb mich mit unwiderstehlicher Hartnäckigkeit vorwärts. Zuweilen zwar sprach mir meine Vernunft und mein besonnenes Urtheil laut zu, heimzukehren, aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Ich weiß nicht, ob es eine geheimnißvolle zwingende Macht, oder wie ich es sonst nennen soll, gibt, die uns treibt, Werkzeuge unseres eigenen Verderbens zu werden, wenn es auch unmittelbar vor uns liegt und wir mit offenen Augen ihm uns nähern. Gewiß ist aber, daß nur ein unabwendbar über mich beschlossenes Verhängniß, dem ich in keiner Weise entrinnen konnte, mich, trotz den ruhigen Gründen und dem Zureden meiner Ueberlegung, und ungeachtet zweier so deutlichen Lehren, wie ich sie bei meinem ersten Versuch erhalten hatte, vorwärts drängte.
Mein Kamerad, der mich früher in meiner Gewissensverhärtung bestärkt hatte (er war, wie ich schon sagte, der Sohn des Eigenthümers unseres untergegangenen Schiffs), war nun verzagter als ich. Als wir uns das erste Mal in Yarmouth sprachen, zwei oder drei Tage nach unserer Ankunft, — wir lagen in verschiedenen Quartieren, — schien der Ton seiner Stimme verändert, und mit melancholischer Miene fragte er mich, wie es mir gehe. Nachdem er seinem Vater mitgetheilt hatte, wer ich sei und daß ich diese Reise nur zum Versuche gemacht habe, und zwar in der Absicht, später in die Fremde zu gehen, wandte sich dieser zu mir und sagte in einem sehr ernsten feierlichen Ton:»Junger Mann, Ihr dürft niemals wieder zur See gehen; Ihr müßt dies Erlebniß für ein sichtbares und deutliches Zeichen ansehen, daß Ihr nicht zum Seemann bestimmt seid«. —»Wie, Herr«, erwiederte ich,»wollt Ihr selbst denn nie wieder auf das Meer?«—»Das ist etwas Anderes«, antwortete er.»Es ist mein Beruf und daher meine Pflicht; allein Ihr habt bei Dieser Versuchsreise vom Himmel eine Probe von dem erhalten, was Euch zu erwarten steht, wenn Ihr auf Eurem Sinne beharret. Vielleicht hat uns dies Alles nur Euretwegen betroffen, wie es mit Jona in dem Schiffe von Tarsis ging. Sagt mir«, fuhr er fort,»was in aller Welt hat Euch bewegen können, diese Reise mitzumachen?«
Hierauf erzählte ich ihm einen Theil meiner Lebensgeschichte. Als ich geendet, brach er leidenschaftlich in die Worte aus:»Was habe ich nun verbrochen, daß solch ein Unglücksmensch in mein Schiff gerathen mußte! Ich würde nicht um tausend Pfund meinen Fuß wieder mit Euch in dasselbe Fahrzeug setzen.«
Dieser Ausbruch war durch die Erinnerung an den von ihm erlittenen Verlust hervorgerufen, und der Mann hatte eigentlich kein Recht dazu, sich mir gegenüber so stark zu äußern. Doch redete er mir auch später noch sehr ernst zu und ermahnte mich, zu meinem Vater zurückzukehren und nicht noch einmal die Vorsehung zu versuchen. Ich würde sehen, sagte er, daß die Hand des Himmels sichtbar mir entgegenarbeite.»Verlaßt Euch darauf, junger Mann«, fügte er hinzu,»wenn Ihr nicht nach Hause geht, werdet Ihr, wohin Ihr Euch auch wendet, nur mit Mißgeschick und Noth zu ringen haben, bis die Worte Eures Vaters sich an Euch erfüllt haben.«
Bald darauf trennten wir uns. Ich hatte ihm nur kurz geantwortet und sah ihn nachher nicht wieder, weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist.
Ich meinestheils begab mich, da ich jetzt etwas Geld in der Tasche hatte, zu Lande nach London. Sowohl dort wie schon unterwegs hatte ich manchen inneren Kampf zu bestehen durch den Zweifel, ob ich heimkehren oder zur See gehen sollte. Was die erstere Absicht betraf, so stellte sich den bessern Regungen meiner Seele alsbald die Scham entgegen. Es fiel mir ein, wie ich von den Nachbarn ausgelacht werden und wie beschämt ich nicht nur vor Vater und Mutter, sondern auch vor allen anderen Leuten stehen würde. Seit jener Zeit habe ich oft beobachtet, wie ungereimt und thöricht die Artung des Menschenherzens, besonders in der Jugend, gegenüber der Vernunft, die es in solchen Fällen allein leiten sollte, sich zeigt: daß wir nämlich uns nicht schämen zu sündigen, aber wohl zu bereuen; daß wir keine Bedenken haben vor der Handlung, derentwegen wir für einen Narren angesehen werden müssen, aber wohl vor der Buße, die allein uns wieder die Achtung vernünftiger Menschen verschaffen könnte.
In jener Unentschlossenheit darüber, was ich ergreifen und welchen Lebensweg ich einschlagen sollte, verharrte ich geraume Zeit. Ein unwiderstehlicher Widerwille hielt mich auch ferner ab heimzukehren. Nach einer Weile aber verblaßte die Erinnerung an das Mißgeschick, das ich erlebt, und als diese sich erst gemildert hatte, war mit ihr auch der letzte Rest des Verlangens nach Hause geschwunden. Und kaum hatte ich alle Gedanken an die Rückkehr aufgegeben, so sah ich mich auch schon nach der Gelegenheit zu einer neuen Reise um.
Das Unheil, welches mich zuerst aus meines Vaters Hause getrieben; das mich in dem unreifen und tollen Gedanken verstrickt hatte, in der Ferne mein Glück zu suchen; das diesen Plan in mir so fest hatte einwurzeln lassen, daß ich für allen guten Rath, für Bitten und Befehle meines Vaters taub gewesen war, dasselbe Unheil veranstaltete jetzt auch, daß ich mich auf die allerunglückseligste Unternehmung von der Welt einließ. Ich begab mich nämlich an Bord eines nach der afrikanischen Küste bestimmten Schiffes, oder, wie unsre Seeleute zu sagen pflegen, eines Guineafahrers. Jedoch, und dies war ein besonders schlimmer Umstand, verdingte ich mich nicht etwa als ordentlicher Seemann auf das Schiff. Dadurch, ob ich gleich ein wenig härter hätte arbeiten müssen, würde ich doch den seemännischen Dienst gründlich erlernt und mich allmählich zum Matrosen oder Lieutenant, wenn nicht gar zum Kapitän hinaufgearbeitet haben. Nein, wie es immer mein Schicksal war, daß ich das Schlimmste wählte, so that ich es auch diesmal. Denn da ich Geld in der Tasche und gute Kleider auf dem Leibe hatte, wollte ich nur wie ein großer Herr an Bord gehen, und hatte somit auf dem Schiffe weder etwas Ordentliches zu thun, noch lernte ich den Seemannsdienst vollständig kennen.
In London hatte ich gleich anfangs das Glück, in gute Gesellschaft zu gerathen, was einem so unbesonnenen und unbändigen Gesellen nicht oft zu Theil wird. Denn ob zwar der Teufel gern bei Zeiten nach solchen seine Netze auswirft, hatte er's bei mir doch unterlassen. Ich machte die Bekanntschaft eines Schiffskapitäns, der eben von der guineischen Küste zurückgekehrt war und, da er dort gute Geschäfte gemacht hatte, im Begriffe stand, eine neue Reise dahin zu unternehmen. Er fand Gefallen an meiner damals nicht ganz reizlosen Unterhaltung, und als er vernommen, daß ich Lust hatte, die Welt zu sehen, bot er mir an, kostenfrei mit ihm zu reisen. Ich könne mit ihm den Tisch und den Schlafraum theilen, und wenn ich etwa einige Waaren mitnehmen wolle, sie auf eigene Rechnung in Afrika verkaufen und vielleicht dadurch zu weiteren Unternehmungen ermuthigt werden.
Dies Anerbieten nahm ich an und schloß mit dem Kapitän, einem redlichen und aufrichtigen Manne, innige Freundschaft. Durch seine Uneigennützigkeit trug mir ein kleiner Kram, den ich mitgenommen, bedeutenden Gewinn ein. Ich hatte nämlich für ungefähr 40 Pfund Sterling Spielwaaren und dergleichen Kleinigkeiten auf den Rath des Kapitäns eingekauft, wofür ich das Geld mit Hülfe einiger Verwandten, an die ich mich brieflich gewendet, zusammenbrachte, welche, wie ich vermuthe, auch meine Eltern oder wenigstens meine Mutter vermocht hatten, etwas zu meiner ersten Unternehmung beizusteuern.
Dies war die einzige unter meinen Reisen, die ich eine glückliche nennen kann. Ich verdanke das nur der Rechtschaffenheit meines Freundes, durch dessen Anleitung ich auch eine ziemliche Kenntniß in der Mathematik und dem Schifffahrtswesen erlangte. Er lehrte mich, den Cours des Schiffs zu verzeichnen, Beobachtungen anzustellen, überhaupt alles Nothwendigste, was ein Seemann wissen muß. Da es ihm Freude machte, mich zu belehren, hatte ich auch Freude, von ihm zu lernen, und so wurde ich auf dieser Reise zugleich Kaufmann und Seemann. Ich brachte für meine Waaren fünf Pfund und neun Unzen Goldstaub zurück, wofür ich in London dreihundert Guineen löste; aber leider füllte mir gerade dieser Gewinn den Kopf mit ehrgeizigen Plänen, die mich ins Verderben bringen sollten.
Uebrigens war jedoch auch diese Reise nicht ganz ohne Mißgeschick für mich abgelaufen. Insbesondere rechne ich dahin, daß ich während der ganzen Dauer derselben mich unwohl fühlte und in Folge der übermäßigen afrikanischen Hitze (wir trieben nämlich unsern Handel hauptsächlich an der Küste vom 15. Grad nördlicher Breite bis zum Aequator hin) von einem hitzigen Fieber befallen wurde.
Nunmehr galt ich für einen ordentlichen Guineahändler. Nachdem mein Freund zu meinem großen Unheil bald nach der Rückkehr gestorben war, beschloß ich, dieselbe Reise zu wiederholen, und schiffte mich auf dem früheren Schiffe, das jetzt der ehemalige Steuermann führte, ein. Nie hat ein Mensch eine unglücklichere Fahrt erlebt. Ich nahm zwar nur für hundert Pfund Sterling Waaren mit und ließ den Rest meines Gewinns in den Händen der Wittwe meines Freundes, die sehr rechtschaffen gegen mich handelte; dennoch aber erlitt ich furchtbares Mißgeschick.
Das Erste war, daß uns, als wir zwischen den kanarischen Inseln und der afrikanischen Küste segelten, in der Morgendämmerung ein türkischer Korsar aus Saleh überraschte und mit allen Segeln Jagd auf uns machte. Wir spannten, um zu entrinnen, unsere Segel gleichfalls sämmtlich aus, soviel nur die Masten halten wollten. Da wir aber sahen, daß der Pirat uns überhole und uns in wenigen Stunden erreicht haben würde, blieb uns Nichts übrig, als uns kampfbereit zu machen.
Wir hatten zwölf Kanonen, der türkische Schuft aber führte deren achtzehn an Bord. Gegen drei Uhr Nachmittags hatte er uns eingeholt. Da er uns jedoch aus Versehen in der Flanke angriff, statt am Vordertheil, wie er wohl ursprünglich beabsichtigt hatte, schafften wir acht von unsern Kanonen auf die angegriffene Seite und gaben ihm eine Salve. Nachdem der Feind unser Feuer erwiedert und dazu eine Musketensalve von 200 Mann, die er an Bord führte, gefügt hatte (ohne daß jedoch ein einziger unserer Leute, die sich gut gedeckt hielten, getroffen wurde), wich er zurück. Alsbald aber bereitete er einen neuen Angriff vor, und auch wir machten uns abermals zur Verteidigung fertig. Diesmal jedoch griff er uns auf der andern Seite an, legte sich dicht an unsern Bord, und sofort sprangen sechzig Mann von den Türken auf unser Deck und begannen unser Segelwerk zu zerhauen.
Wir empfingen sie zwar mit Musketen, Enterhaken und andern Waffen, machten auch zweimal unser Deck frei; trotzdem aber, um sogleich das traurige Ende des Kampfes zu berichten, mußten wir, nachdem unser Schiff seeuntüchtig gemacht und drei unsrer Leute getödtet waren, uns ergeben und wurden als Gefangene nach Saleh, einer Hafenstadt der Neger, gebracht.
Dort ging es mir nicht so schlecht, als ich anfangs befürchtet hatte. Ich wurde nicht wie die Andern ins Innere nach der kaiserlichen Residenz gebracht, sondern der Kapitän der Seeräuber behielt mich unter seiner eignen Beute, da ich als junger Bursch ihm brauchbar schien. Die furchtbare Verwandlung meines Standes, durch welche ich aus einem stolzen Kaufmann zu einem armen Sklaven geworden war, beugte mich tief. Jetzt gedachte ich der prophetischen Worte meines Vaters, daß ich ins Elend gerathen und ganz hülflos werden würde. Ich wähnte, diese Vorhersagung habe sich nun bereits erfüllt und es könne nichts Schlimmeres mehr für mich kommen. Schon habe mich, dachte ich, die Hand des Himmels erreicht, und ich sei rettungslos verloren. Aber ach, es war nur der Vorschmack der Leiden, die ich noch, wie der Verlauf dieser Geschichte lehren wird, durchmachen sollte.
Als mein neuer Herr mich für sein eigenes Hans zurückbehielt, tauchte die Hoffnung in mir auf, er werde mich demnächst mit zur See nehmen und ich könne dann, wenn ihn etwa ein spanisches oder portugiesisches Kriegsschiff kapern würde, wieder meine Freiheit erlangen. Dieser schöne Wahn entschwand bald. Denn so oft sich mein Patron einschiffte, ließ er mich zurück, um die Arbeit im Garten und den gewöhnlichen Sklavendienst im Hause zu verrichten, und wenn er dann von seinen Streifzügen heimkam, mußte ich in der Kajüte seines Schiffes schlafen und dieses überwachen.
Während ich hier auf Nichts als meine Flucht dachte, wollte sich doch nicht die mindeste Möglichkeit zur Ausführung derselben zeigen. Auch war Niemand da, dem ich meine Pläne hätte mittheilen, und der mich hätte begleiten können. Denn unter meinen Mitsklaven befand sich kein Europäer. So bot sich mir denn zwei Jahre hindurch, so oft ich mich auch in der Einbildung damit beschäftigte, nicht die mindeste hoffnungerweckende Aussicht auf ein Entrinnen dar.
Kapitel 2
Ungefähr nach Ablauf dieser Zeit rief mir ein seltsamer Umstand meine Fluchtpläne wieder ins Gedächtniß. Eine geraume Weile hindurch blieb nämlich mein Herr, wie ich hörte aus Geldmangel, gegen seine Gewohnheit zu Hause liegen. Während dieser Zeit fuhr er jede Woche ein oder mehre Mal in seinem kleinen Schiffsboot auf die Rhede zum Fischen, wobei er stets mich und einen kleinen Moresken zum Rudern mitnahm. Wir machten ihm auf diesen Fahrten allerlei Späße vor, und da ich mich zum Fischfang anstellig zeigte, erlaubte er, daß ich nebst einem seiner Verwandten und dem Mohrenjungen auch bisweilen allein hinausfuhr und ihm ein Gericht Fische holte.
Als wir einst an einem sehr windstillen Morgen solch eine Fahrt machten, entstand ein so dicker Nebel, daß wir die Küste, von der wir kaum eine Stunde entfernt waren, aus dem Gesicht verloren. Wir ruderten unablässig, ohne zu wissen, ob wir vorwärts oder zurück kämen, den ganzen Tag und die folgende Nacht hindurch und wurden erst am nächsten Morgen gewahr, daß wir, statt uns dem Lande zu nähern, nach der offenen See hin gerathen und mindestens zwei deutsche Meilen vom Ufer entfernt waren. Dennoch erreichten wir dieses, völlig ausgehungert, unter nicht geringer Mühe und Gefahr wieder, nachdem sich des Morgens ein scharfer Wind landwärts erhoben hatte.
Unser Gebieter, durch dies Ereigniß gewarnt, beschloß, künftig für seine Person größere Vorsicht anzuwenden und nicht mehr ohne Kompaß und Proviant auf den Fischfang zu gehen. Da er das Langboot unseres von ihm genommenen Schiffes zu seiner Verfügung hatte, trug er seinem Schiffszimmermann, der wie ich Sklave und geborener Engländer war, auf, in diesem Boot eine kleine Kajüte zu errichten, ähnlich der in einer Barke, und zwar so, daß hinter derselben Jemand Platz habe, um zu steuern und das große Segel zu regieren, davor aber zwei Personen Raum fänden, um die andern Segel zu handhaben.
Das Langboot führte ein sogenanntes Gieksegel und die Raa ragte über die Kajüte hinaus, welche schmal und niedrig war und höchstens für den Kapitän und ein Paar Sklaven, sowie einen Tisch und ein Schränkchen zur Aufbewahrung von Brod, Reis, Kaffee und dergleichen Raum bot. In diesem Fahrzeug fuhren wir dann fleißig zum Fischen aus, und da ich mich gut auf das Geschäft verstand, ließ mein Herr mich nie zu Hause.
Eines Tages wollte dieser mit ein paar vornehmen Mohren zum Vergnügen oder zum Fischfang eine Fahrt machen und ließ dazu ungewöhnliche Anstalten treffen. Schon Abends zuvor hatte er Mundvorrath an Bord geschickt und mir aufgetragen, drei Flinten mit dem im Boot befindlichen Pulver und Blei bereit zu halten, damit er und seine Freunde sich auch durch die Vogeljagd vergnügen könnten. Ich that wie mir befohlen, und wartete in dem sauber geputzten Boot, darauf Flagge und Wimpel lustig weheten, auf die Ankunft meines Gebieters und seiner Gäste. Bald nachher aber kam jener allein, sagte mir, die letzteren seien durch Geschäfte verhindert, ich solle daher mit dem Mohren und dem kleinen Jungen wie gewöhnlich allein hinausfahren und für seine Freunde zum Abendessen ein Gericht Fische fangen.
In diesem Augenblick kamen mir meine Fluchtgedanken wieder in den Sinn. Ich sah jetzt ein kleines Schiff ganz zu meiner Verfügung gestellt und bereitete, als mein Herr fort war, sogleich Alles statt für den Fischfang zu einer langen Fahrt vor. Freilich wußte ich nicht, wohin diese gehen sollte, aber das kümmerte mich nicht, da ich nur von dort wegzukommen bedacht war.
Zunächst sann ich auf einen Vorwand, um den Mohren nach Proviant auszuschicken. Ich sagte ihm, es zieme sich nicht für uns, von dem Mundvorrath unsers Gebieters zu nehmen. Dies leuchtete ihm ein, und er brachte denn auch bald einen großen Korb mit geröstetem Zwieback, wie solcher dort zu Lande bereitet wurde, nebst drei Krügen mit frischem Wasser herbei. Ich wußte, wo mein Herr seinen Flaschenkorb hatte, der, nach der Façon zu schließen, auch von einem englischen Schiffe erbeutet sein mußte. Diesen stellte ich in das Boot, wie wenn er dort für unsern Herrn schon gestanden habe. Dann trug ich einen etwa fünfzig Pfund schweren Wachsklumpen hinein, sowie einen Knäuel Bindfaden, ein Beil, eine Säge und einen Hammer, lauter nützliche Dinge, besonders das Wachs, aus dem ich Lichter machen wollte. Dann drehete ich dem Mohren, welcher Ismael hieß, aber Muley genannt wurde, eine weitere Nase.»Muley«, sagte ich zu ihm,»die Gewehre unsers Herrn sind an Bord. Könnten wir nicht auch ein wenig Pulver und Schrot bekommen? Es wäre doch hübsch, wenn wir für uns einige Alkamies (eine Art Seevögel) schießen könnten. Ich weiß, der Schießbedarf liegt im großen Schiff.«—»Gut«, erwiederte er,»ich will's holen. «Bald darauf kam er wirklich mit einem großen Lederbeutel, in welchem sich etwa anderthalb Pfund Pulver, fünf bis sechs Pfund Schrot und etliche Kugeln befanden, und trug dies Alles zusammen ins Boot. Unterdeß hatte ich auch in meines Herrn Kajüte etwas Pulver gefunden, das ich in eine der großen Flaschen im Flaschenkorb, die beinahe leer war und deren Inhalt ich in eine andere goß, füllte. So, mit dem Nötigsten versehen, segelten wir aus dem Hafen zum Fischfang. Der Wind ging leider aus Nordnordost; wäre er von Süden gekommen, hätte ich leicht die spanische Küste, oder wenigstens die Bai von Cadix erreichen können. Trotz dem aber, mochte der Wind auch noch so ungünstig wehen, blieb mein Entschluß fest, von diesem schrecklichen Orte zu entrinnen, das Uebrige aber dem Geschick anheim zu stellen.
Nachdem wir einige Zeit gefischt hatten, ohne Etwas zu fangen (denn wenn ich auch einen Fisch an der Angel spürte, zog ich ihn nicht heraus), sagte ich zu dem Mohren:»Hier hat's keine Art; wir werden von hier unserm Herrn Nichts heimbringen, wir müssen es weiter draußen versuchen«. Er, sich nichts Arges versehend, willigte ein und zog, da er am Stern des Schiffes stand, die Segel auf. Ich steuerte dann das Boot beinahe eine deutsche Meile auf die offene See hinaus. Hierauf brachte ich es in die Stellung, als ob ich fischen wolle, gab dem Jungen das Steuerruder, ging nach vorn, wo der Mohr stand, that, wie wenn ich beabsichtigte, hinter ihm Etwas aufzuheben, faßte ihn rücklings an und warf ihn kurzer Hand über Bord. Sofort tauchte er wieder auf, denn er schwamm wie Kork, und bat mich, ihn wieder herein zu heben. Er wolle ja, sagte er, mit mir in die weite weite Welt gehen. Da er rasch hinter dem Boot her schwamm, würde er mich bei dem schwachen Wind bald erreicht haben. Ich aber eilte in die Kajüte, ergriff eine der Vogelflinten und rief ihm zu:»Wenn du dich ruhig verhältst, werde ich dir Nichts zu Leide thun. Du schwimmst gut genug, um das Land erreichen zu können, und die See ist ruhig. Mach, daß du fortkommst, so will ich dich verschonen; wagst du dich aber an das Boot heran, so brenne ich dir Eins vor den Kopf, denn ich bin entschlossen, mich zu befreien. «Hierauf wandte er sich um, schwamm nach der Küste und hat diese auch jedenfalls mit Leichtigkeit erreicht; denn er war ein ausgezeichneter Schwimmer.
Ebenso gut freilich hätte ich auch den Mohren mit mir nehmen und den Jungen statt seiner ersäufen können, aber es war Jenem nicht zu trauen. Als er sich fort gemacht, sagte ich zu dem kleinen Burschen, welcher Xury hieß:»Höre, wenn du mir treu bleibst, will ich etwas Großes aus dir machen; willst du mir aber nicht beim Barte Mahomeds und seines Vaters Treue schwören, so muß ich dich ins Wasser werfen. «Der Junge lächelte mir ins Gesicht und antwortete mir so treuherzig, daß ich ihm nicht mißtrauen konnte: er verspreche mir treu zu sein und mit mir zu gehen, wohin ich wolle.
So lange mich der schwimmende Mohr im Auge zu behalten vermochte, steuerte ich das Boot dem hohen Meer zu, und zwar so, daß man meinen sollte. wir hätten uns der Meerenge von Gibraltar zugewandt. Jeder vernünftige Mensch mußte an Stelle der Neger dies auch annehmen. Denn wer hätte denken sollen, daß wir südwärts gesegelt wären, recht eigentlich nach der Barbarenküste hin, an der ganze Völkerschaften von Negern wohnten, die uns mit ihren Kähnen umzingeln und uns umbringen konnten; wo wir auch nirgends zu landen vermochten, ohne Gefahr zu laufen, von wilden Bestien oder noch unbarmherzigern wilden Menschen zerrissen zu werden. Dennoch aber änderte ich, sobald die Abenddämmerung kam, die Richtung unseres Bootes und steuerte direkt nach Südost. Diesen Cours schlug ich ein, um in der Nähe der Küste zu bleiben. Da wir guten frischen Wind hatten. kamen wir so schnell vorwärts, daß wir am nächsten Nachmittag gegen drei Uhr uns schon beinahe 150 Meilen südlich von Saleh, weit entfernt von dem Reich des Kaisers von Marokko und irgend eines andern Herrschers (wir sahen wenigstens keinen Menschen am Lande) befanden.
Meine Furcht vor den Mohren war so groß, und ich bangte so sehr davor, ihnen in die Hände zu fallen, daß ich mich nicht entschließen konnte, an Land oder auch nur vor Anker zu gehen. Der Wind wehte noch volle fünf Tage hindurch uns günstig. Nachdem er sich dann südwärts gedreht hatte, durfte ich glauben, daß, wenn man auch zu Schiffe auf uns Jagd gemacht haben sollte, diese doch nun aufgegeben sein würde. Daher wagte ich mich jetzt an die Küste und warf Anker an der Mündung eines kleinen Flusses. Ich wußte weder, unter welchem Breitengrade, noch in welchem Land, noch bei welchem Volk ich mich befinde. Keine Menschenseele ließ sich sehen; auch hatte ich kein Verlangen danach, denn das Einzige, wonach ich mich sehnte, war frisches Wasser.
Wir gelangten Abends in die Flußmündung und beschlossen, sobald es dunkel sei, an Land zu schwimmen und die Gegend auszukundschaften. Jedoch vernahmen wir, als es Nacht geworden, einen so fürchterlichen Lärm, ein solches Bellen, Brüllen und Heulen wilder Thiere, Gott weiß welcher Art, daß mein armer Junge vor Angst sterben wollte und mich flehentlich bat, nicht vor Tagesanbruch an das Ufer zu gehen.»Gut, Xury«, sagte ich,»dann wollen wir es lassen; aber vielleicht bekommen wir bei Tage Menschen zu sehen, die es gerade so schlecht mit uns meinen als diese Löwen.«—»Ei, dann wir schicken ihnen einige Kugeln aufs Fell«, erwiederte Xury lachend,»die ihnen machen Beine.«— Ein wenig Englisch nämlich hatte der Junge durch den Verkehr mit uns Sklaven gelernt.
Ich war froh, den Jungen so lustig zu sehen, und ließ ihn zur Ermuthigung einen Schluck Rum aus einer der Flaschen meines Patrons thun. Uebrigens war Xury's Rath gut, daher ich ihn auch befolgte. Wir warfen unsern kleinen Anker aus und lagen die Nacht über still. An Schlafen war jedoch kein Gedanke. Denn nach einigen Stunden sahen wir gewaltig große Bestien verschiedener Art, die wir nicht zu nennen wußten, an den Strand kommen und sich ins Wasser stürzen. Sie machten sich das Vergnügen einer Abkühlung und heulten und brüllten dabei in einer Art, wie ich es mein Lebtag nicht wieder gehört habe.
Xury war furchtbar erschrocken und ich nicht minder. Aber wie entsetzten wir uns erst, als eines der Unthiere auf unser Boot zugeschwommen kam. Wir konnten es nicht sehen, doch an seinem Schnauben war zu hören, daß es eine ungeheuer große und grimmige Bestie sein mußte. Xury behauptete, es sei ein Löwe, und es mochte wohl auch einer sein. Der arme Junge schrie, ich sollte den Anker lichten und wegrudern.»Nein«, erwiederte ich,»wir wollen nur das Kabeltau verlängern und nach der See hinsteuern, dann können die Thiere uns nicht folgen. «Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, als ich das Ungeheuer zu meiner großen Ueberraschung schon bis auf zwei Ruderlängen uns nahe erblickte. Sofort eilte ich nach der Kajüte, ergriff ein Gewehr und gab Feuer, worauf die Bestie sich alsbald umwandte und wieder nach dem Lande schwamm.
Es ist unmöglich, den fürchterlichen Lärm, das Geschrei und Geheul zu beschreiben, das unmittelbar an der Küste und weiter ins Land hinein nach meinem Schusse entstand. So Etwas hatten diese Kreaturen wahrscheinlich früher nie gehört. Ich zog daraus den Schluß, daß wir während der Nacht nicht hier ans Land gehen dürften, und es schien sogar fraglich, ob wir es bei Tage wagen dürften; denn den wilden Menschen in die Hände zu gerathen, war um Nichts besser, als in die Gewalt der wilden Thiere zu kommen, zum wenigsten hatten wir vor beiden gleich große Angst. Trotzdem aber gebot uns die Notwendigkeit, irgendwo zu landen, um Wasser zu holen, wovon wir keine Pinte mehr im Boote hatten. Es fragte sich nur, wo wir es wagen sollten. Xury sagte mir, wenn er mit einem der Krüge ans Ufer gehen dürfe und es da überhaupt Wasser gäbe, wolle er es schon bekommen. Ich fragte ihn, warum denn er gehen wolle und er nicht lieber sehe, wenn ich es thäte. Er antwortete mir darauf mit solcher Treuherzigkeit, daß ich ihn dadurch für immer lieb gewann.»Wenn kommen wilde Männer«, sagte er,»sie essen mich, du weggehen.«»Nun, Xury«, erwiederte ich,»dann wollen wir alle beide gehen, und wenn die wilden Männer kommen, schießen wir sie nieder, dann können sie keinen von uns fressen. «Hierauf gab ich ihm ein Stück Zwieback und ließ ihn einen Schluck Rum aus dem Flaschenkorb thun. Dann ruderten wir das Boot möglichst nahe ans Ufer und wateten, nur mit unsern Gewehren und zwei Wasserkrügen ausgerüstet, ans Land.
Ich wagte nicht das Boot aus den Augen zu verlieren, weil ich fürchtete, die Wilden möchten in Kähnen den Fluß herunter kommen. Der Junge aber, welcher etwa eine Meile landeinwärts eine Niederung gewahrte, eilte danach hin, und gleich darauf sah ich ihn wieder zurückkehren. Ich glaubte, er sei von Wilden verfolgt oder durch ein Thier erschreckt, und rannte, um ihm zu helfen, ihm entgegen. Als ich jedoch näher kam, sah ich, daß er Etwas über die Schultern hängen hatte, das ich als ein von ihm getödtetes Thier erkannte. Es glich einem Hasen, war aber von anderer Farbe und länger von Beinen. Wir hatten große Freude darüber, da es uns eine herrliche Mahlzeit lieferte. Das Beste aber, was Xury mitbrachte, war die Nachricht, daß er gutes Wasser gefunden und keine Wilden gesehen hatte.
Bald darauf wurden wir gewahr, daß wir uns um Wasser nicht so große Sorgen hätten zu machen brauchen. Denn ein wenig höher in der Bucht hinauf, in der wir lagen, fanden wir, sobald die Flut, die nicht tief den Fluß hinein ging, verlaufen war, das Wasser süß und frisch. So füllten wir denn unsere Krüge, verschmausten unser Wildpret und machten uns wieder reisefertig. Spuren eines menschlichen Wesens hatten wir in dieser Gegend nicht wahrgenommen.
Weil ich schon früher einmal an dieser Küste gewesen war, wußte ich, daß die kanarischen Inseln, sowie die des grünen Vorgebirgs von hier nicht weit abliegen konnten. Da mir's aber an Instrumenten zur Untersuchung des Breitengrads, unter dem wir uns befanden, gebrach, und ich auch leider nicht genau die Lage jener Inseln kannte, war ich im Zweifel über die Richtung, die ich nach ihnen einzuschlagen hätte. Außerdem wäre es eine Leichtigkeit gewesen, sie zu erreichen.
Ich hatte meine Hoffnung darauf gesetzt, daß mir, wenn ich mich immer längs der Küste hielte, bis ich in die Region käme, wo die Engländer ihren Handel trieben, eins von ihren Schiffen aufstoßen und uns aufnehmen werde. Soviel ich nach meiner Berechnung herausgebracht, mußte ich damals in der Gegend sein, die zwischen dem Kaiserreich Marokko und den Negerstaaten liegt und wo die Küste nur von Bestien bewohnt ist. Die Neger haben diesen Landstrich verlassen und sich aus Furcht vor den Mohren nach Süden zurückgezogen, während die Mohren die Gegend wegen ihrer Unfruchtbarkeit nicht des Anbaus werth halten. Beide Völkerschaften haben auch deshalb jene Strecke aufgegeben, weil so erstaunlich viel Tiger, Löwen, Leoparden und andere wilde Thiere dort hausen. Die Mohren benutzen die Gegend daher nur zum Jagen, indem sie armeenweis zu zwei- bis dreitausend Mann dorthin ziehen. Beinahe hundert Meilen lang sahen wir an der Küste nur wüstes Land, bei Tage wie ausgestorben, des Nachts erfüllt vom Geheul und Gebrüll der Bestien.
Ein- oder zweimal glaubte ich den Pik von Teneriffa zu erblicken und hatte große Lust, nach ihm hin zu steuern; nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen aber, durch widrigen Wind genöthigt und auch weil die See für mein kleines Fahrzeug zu hoch ging, beschloß ich, nach meinem früheren Plane mich längs der Küste zu halten.
Mehrmals war ich genöthigt, ans Land zu gehen, um frisches Wasser zu holen. Eines Tages warfen wir früh am Morgen unter einem ziemlich hoch gelegenen Küstenpunkt Anker. Die Flut begann und wir wollten sie abwarten, um mit ihr weiter zu gehen. Xury, der seine Augen flinker als ich überall hatte, rief mir leise zu, es sei besser, wenn wir von der Küste uns abwendeten,»denn«, sagte er,»dort liegt ein schreckliches Ungeheuer neben dem Hügel und schläft«.
Ich sah nach der angedeuteten Richtung und erblickte wirklich ein scheußliches Unthier. Es war ein sehr großer Löwe, der am Ufer im Schatten eines Hügelvorsprungs lag.»Xury«, sagte ich,»du mußt ans Land und ihn abmucksen. «Xury schauderte und erwiederte:»Ich mucksen? Er mich essen auf einen Bissen. «Da ließ ich den Jungen sich still verhalten, nahm unsre größte Flinte, lud sie stark mit Pulver und mit zwei Kugeln und legte sie neben mich. In ein anderes Gewehr that ich zwei Kugeln, in ein drittes (denn wir hatten drei) fünf Kugeln von kleinerem Kaliber. Beim ersten Schuß hielt ich der Bestie scharf nach dem Kopf, allein sie hatte die Tatze ein wenig über die Schnauze gelegt, so daß die Kugeln sie über dem Knie trafen und ihr nur den Gelenkknochen zerschmetterten. Der Löwe sprang auf, knurrte anfangs leise, fühlte aber sein Bein entzwei, sank nieder und stellte sich dann auf drei Beine, indem er das schrecklichste Gebrüll los ließ, das ich je vernommen. Ich war erschrocken, daß ich den Kopf verfehlt, griff aber sofort nach dem zweiten Gewehr und gab abermals Feuer; wiewohl der Feind ausreißen wollte, traf ich ihn diesmal doch in den Kopf und sah mit Vergnügen, wie er zusammenbrach und ohne großen Lärm seinen Todeskampf kämpfte. Jetzt bekam Xury Courage und wollte ans Land.»Gut«, sagte ich,»geh. «Darauf sprang er ins Wasser, nahm in die eine Hand eine kleine Flinte, schwamm mit der andern ans Ufer, begab sich dicht an das Thier heran, hielt ihm das Gewehr nahe vor's Ohr und machte ihm mit einem neuen Schuß durch den Kopf vollends den Garaus.
Dies Wildpret lieferte uns aber Nichts zu essen, und es that mir leid, drei Schüsse an ein Thier verschwendet zu haben, mit dem wir Nichts anfangen konnten. Xury aber sagte, Etwas wolle er doch davontragen, und bat mich um das Beil.»Wozu, Xury?«fragte ich.»Kopf abhauen«, antwortete er. Jedoch gelang ihm das nicht, und er brachte nur eine ungeheure Tatze mit sich zurück.
Ich hatte unterdessen überlegt, daß uns vielleicht das Fell von einigem Werth sein könnte, und beschloß es abzuziehen. So machte ich mich denn mit Xury ans Werk; der Junge aber leistete dabei viel mehr als ich, denn ich verstand mich schlecht auf die Sache. Die Arbeit nahm einen ganzen Tag in Anspruch, bis wir zuletzt das Fell davontrugen. Wir spannten es über das Dach unserer Kajüte aus, wo es die Sonne rasch trocknete; dann benutzte ich es als Decke für mein Lager.
Nach diesem Aufenthalt segelten wir zehn bis zwölf Tage in Einem fort südwärts. Jetzt gingen wir mit unserm Proviant, der stark ins Abnehmen gerathen war, sehr sparsam um. Ans Land wagten wir uns nur, um Wasser zu nehmen.
Mein Plan war, zu versuchen, ob wir den Gambia oder Senegal, das heißt die Gegend des grünen Vorgebirgs zu erreichen vermöchten, wo ich hoffen durfte, einem europäischen Schiffe zu begegnen. Geschah dies nicht, so blieb mir Nichts übrig, als nach den kapverdischen Inseln zu steuern oder unter den Negern umzukommen. Ich wußte, daß alle europäischen Schiffe, die nach der Küste von Guinea oder nach Brasilien oder Ostindien gehen, auf dem grünen Vorgebirg oder jenen Inseln Station machen. So setzte ich denn mein ganzes Geschick auf die Eine Nummer: entweder begegnete ich einem Schiff, oder ich war verloren.
Als ich in dieser Ungewißheit etwa zehn Tage hindurch geregelt war, begann ich wahrzunehmen, daß die Küste bewohnt sei. An mehren Stellen sahen wir im Vorbeifahren Leute an dem Ufer stehen, die uns beobachteten. Wir konnten auch erkennen, daß sie ganz schwarz und völlig nackt waren. Einmal wandelte mich die Lust an, ans Land zu ihnen zu gehen, aber Xury rieth mir ab und sagte:»Nicht gehen, ja nicht gehen.«
Dennoch näherte ich mich der Küste so weit, daß ich mit den Leuten sprechen konnte. Sie liefen eine geraume Strecke neben dem Schiffe die Küste entlang. Waffen hatten sie nicht, außer einem Einzigen, der einen langen dünnen Stab trug, den Xury als eine Lanze bezeichnete, mit der diese Leute auf weite Entfernung mit großer Sicherheit werfen könnten. Deshalb hielt ich mich in gehöriger Ferne, redete aber, so gut es ging, durch Zeichen mit ihnen und gab ihnen insbesondere zu verstehen, daß ich Etwas zu essen haben möchte. Sie forderten mich durch Winke auf, das Boot anzuhalten, und deuteten an, sie würden dann Speisen für mich herbeischaffen. Hierauf zog ich die Segel ein und legte bei, während zwei der Neger landeinwärts liefen. Nach kaum einer halben Stunde kamen sie mit zwei Stücken geröstetem Brod und etwas Korn zurück. Ohne zu wissen, was es sei, waren wir doch entschlossen es anzunehmen, nur fragte es sich, wie wir's bekommen könnten. Denn ans Land zu gehen wagte ich nicht. Die guten Leute aber schienen sich ebenso sehr vor uns zu fürchten wie wir vor ihnen. Endlich fanden sie einen guten Ausweg. Sie legten die Sachen auf die Erde nieder und zogen sich eine weite Strecke zurück, bis wir ihre Gaben an Bord gebracht hatten; dann kamen sie wieder ans Ufer heran.
Wir machten ihnen Zeichen des Danks, da wir sonst Nichts zu bieten hatten. Gleich darauf aber ward uns die Gelegenheit, ihnen einen großen Dienst zu leisten. Es kamen nämlich zwei gewaltige Thiere, eins das andere verfolgend, von den Bergen herab nach dem Meere gelaufen. Wir konnten nicht erkennen, ob Brunst das Männchen das Weibchen jagen hieß, oder ob die Bestien wüthend auf einander waren; ebensowenig ob eine solche Sache hier zu Lande alltäglich oder ungewöhnlich sei. Doch glaube ich das Letztere. Einmal weil solche wilde Thiere regelmäßig sich nur des Nachts zeigen, und dann weil die Leute am Ufer, besonders die Weiber, sehr erschrocken schienen. Alle, außer dem Mann mit der Lanze, entflohen. Die Bestien dachten jedoch nicht daran, die Neger zu verfolgen, sie stürzten sich vielmehr ohne Weiteres ins Wasser und schwammen darin umher, als ob sie sich ein Plaisir machen wollten.
Endlich kam eins der Thiere dem Boote näher. Ich legte mich auf die Lauer, ein Gewehr schußfertig in der Hand. Zuvor hatte ich Xury befohlen, die andern beiden Flinten zu laden. Sobald mir das Thier in Schußweite kam, gab ich Feuer und traf es gerade vor den Kopf. Alsbald sank es unter, kam aber gleich wieder in die Höhe und tauchte im Todeskampf auf und nieder. Es hatte sich unverzüglich nach dem Lande hin gewendet, allein noch ehe es das Ufer erreichte, gaben ihm die tödliche Wunde und das verschluckte Wasser den Tod.
Es ist unmöglich, das Erstaunen der armen Leute über den Knall und das Feuer meines Gewehrs zu schildern. Einige von ihnen wollten vor Furcht sterben und fielen wie todt vor Schrecken um. Als sie aber die Bestie leblos und ins Wasser versunken sahen und ich ihnen zugewinkt hatte, ans Ufer zu kommen, faßten sie Muth, näherten sich und fingen an das Thier zu suchen. Es schwamm in seinem Blute, von dem das Wasser sich gefärbt hatte. Ich schlang ihm ein Seil um den Leib, das ich den Negern zuwarf, welche das todte Thier damit an den Strand zogen. Es war ein ungemein schöner und wundervoll gefleckter Leopard. Die Neger schlugen vor Verwunderung über das Ding, womit ich ihn getödtet hatte, die Hände über dem Kopfe zusammen.
Die andere Bestie, erschreckt durch Blitz und Knall des Schusses, schwamm ans Land und rannte nach dem Berg zurück, woher es gekommen. Wegen der Entfernung vermochte ich nicht zu erkennen, was es für ein Thier war. Ich merkte, daß die Neger Lust hatten, den todten Leoparden zu verzehren, und war auch gern bereit, ihnen denselben zu überlassen. Daher gab ich ihnen das durch Zeichen zu verstehen, und sie schienen sehr dankbar dafür. Sofort machten sie sich an die Arbeit und zogen ihm mit einem scharfen Stück Holz das Fell rascher ab, als wir es mit unseren Messern gekonnt hätten.
Sie boten mir Etwas von dem Fleisch an, was ich jedoch ablehnte, dagegen winkte ich ihnen, sie sollten mir das Fell geben, was sie denn auch sehr bereitwillig thaten. Sie brachten mir ferner noch eine große Menge von Lebensmitteln, die ich zwar nicht kannte, aber dennoch annahm. Ich machte ihnen dann durch Zeichen begreiflich, daß ich Wasser nöthig habe, indem ich einen von meinen Krügen umgekehrt ihnen vorzeigte, um damit anzudeuten, daß er leer sei. Sofort kamen auf ihren Ruf zwei Weiber und trugen ein großes irdenes Gefäß, das, wie ich vermuthe, in der Sonne gebrannt war. Sie setzten es in der früher erwähnten Weise nieder, und ich schickte Xury ans Ufer und ließ meine drei Krüge sämmtlich füllen. Die Weiber waren ganz und gar nackt, wie auch die Männer.
Jetzt hatte ich eßbare Wurzeln, Korn und Wasser in Menge. Nachdem ich diese freundlichen Neger verlassen, segelte ich etwa elf Tage weiter, ohne der Küste nahe zu kommen, bis ich ungefähr fünf Meilen vor mir eine weit in die See ragende Landspitze bemerkte. Da das Meer sehr ruhig war, steuerte ich vom Land ab, um diese Spitze zu umsegeln. Endlich, nachdem ich etwa zwei deutsche Meilen an dem gedachten Punkt vorüber war, erblickte ich vollkommen deutlich auch auf der andern Seite seewärts Land, woraus ich den gegründeten Schluß zog, jenes sei das grüne Vorgebirge und dies Land seien die nach demselben benannten kapverdischen Inseln. Jedoch lagen sie mir noch zu fern, und ich wußte nicht, nach welcher Seite ich mich wenden sollte, denn wenn sich ein frischer Wind erhob, war es leicht möglich, daß ich keine von beiden erreichte.
In dieser zweifelhaften Lage ging ich gedankenvoll in die Kajüte und setzte mich, nachdem ich Xury das Ruder übergeben, dort nieder. Plötzlich rief der Junge:»Herr, ein Schiff, ein Segelschiff!«Der arme Teufel war vor Schreck ganz außer sich, weil er meinte, es müsse nothwendig eines von den uns verfolgenden Schiffen unseres Patrons sein, während ich wußte, daß wir uns längst außer dessen Bereich befanden.
Ich sprang aus der Kajüte und sah nicht nur das Schiff, sondern erkannte es auch sofort als ein portugiesisches. Anfangs glaubte ich, es sei nach der guineischen Küste zum Negerhandel bestimmt, jedoch wurde mir bei genauerer Betrachtung seines Courses klar, daß es anderswohin gehe und nicht nach dem Lande hin steuere. Ich wendete mich deshalb mit vollen Segeln nach der offenen See, entschlossen, wenn es möglich sei, mit den Leuten im Schiffe zu unterhandeln.
Aller Anstrengung ungeachtet erkannte ich aber bald, daß ich sie nicht einholen würde und daß sie mir aus den Augen kommen müßten, ehe ich ein Zeichen zu geben vermöchte. Schon fing ich an zu verzweifeln, als sie, wie es schien, mit Hülfe ihrer Perspektive mich bemerkt und wahrgenommen hatten, daß mein Boot ein europäisches sei, das vermuthlich zu einem verlorenen Schiffe gehöre. Sie zogen die Segel ein und ließen mich herankommen. Hierdurch ermuthigt, hißte ich die Flagge meines ehemaligen Patrons auf und feuerte als weiteres Nothsignal einen Schuß ab. Sofort legten sie das Schiff bei und nach ungefähr drei Stunden hatte ich sie erreicht.
Sie fragten mich nacheinander auf portugiesisch, spanisch und französisch, was ich für ein Landsmann sei. Ich verstand aber keine dieser Sprachen. Endlich rief mich ein schottischer Matrose, der an Bord war, an, und ich erwiederte, daß ich ein Engländer und aus der Mohrensklaverei von Saleh entflohen sei. Hierauf luden sie mich ein, an Bord zu kommen, und nahmen mich mit all meiner Habe freundlich auf.
Ich war, wie Jedermann glauben wird, unbeschreiblich froh, auf diese Art aus einer so elenden und fast hoffnungslosen Lage befreit zu sein. Sofort bot ich Alles, was ich hatte, dem Schiffskapitän als Lohn für meine Befreiung an. Er aber erwiederte mir großmüthig, er werde Nichts annehmen, es solle vielmehr alle meine Habe mir wieder zugestellt werden, sobald wir nach Brasilien kämen.»Denn«, sagte er,»ich habe Euch das Leben nur aus dem Grunde gerettet, aus dem ich mir selber in ähnlicher Lage Rettung wünschen würde. Vielleicht werde ich früher oder später einmal in gleicher Weise von Jemandem aufgenommen werden müssen. Obendrein«, fuhr er fort,»wenn ich Euch so weit von der Heimat, wie Brasilien entfernt ist, brächte und Euch dann Eure Habe abnähme, so müßtet Ihr doch Hungers sterben und ich hätte Euch dann ja das wieder genommen, was ich Euch kaum gegeben habe. Nein, nein, Sennor Inglese, ich will Euch umsonst mitnehmen, und Eure Sachen werden Euch dort Unterhalt verschaffen und die Heimreise ermöglichen«.
So liebreich, wie er gesprochen, so liebreich handelte er auch. Er untersagte den Matrosen, das Geringste unter meinen Sachen anzurühren; dann nahm er diese in eigenes Gewahrsam und händigte mir ein genaues Verzeichniß derselben ein, damit ich sie sämmtlich, sogar meine drei irdenen Krüge, wiederbekomme.
Mein Boot war ein treffliches Fahrzeug. Der Kapitän bemerkte das und fragte mich, ob ich es wohl an sein Schiff verkaufen und was ich dafür haben wolle. Ich antwortete, er sei so edelmüthig in jeder Hinsicht gegen mich, daß ich für das Boot gar Nichts nehmen könne, sondern es ihm gänzlich überlasse. Er aber erwiederte, er wolle mir einen Handschein auf achtzig Goldstücke für Brasilien geben, und wenn mir dort Jemand mehr biete, so werde er auch das zahlen.
Dann bot er mir sechzig Goldstücke für meinen Jungen, den Xury. Hierzu aber hatte ich keine Lust, nicht weil ich den Buben dem Kapitän nicht gern überlassen hätte, sondern weil es mir leid that, seine Freiheit zu verkaufen, nachdem er mir so treulichen Beistand geleistet hatte. Als ich dies dem Kapitän vorstellte, fand er es gerechtfertigt und schlug die Auskunft vor, daß er dem Jungen durch eine Urkunde versprechen wolle, ihn nach zehn Jahren, wenn er Christ geworden sei, wieder frei zu geben. Hierauf, und da Xury auch einwilligte, überließ ich ihn dem Kapitän.
Wir hatten eine sehr gute Reise nach Brasilien und warfen schon nach etwa drei Wochen in der Allerheiligenbucht Anker. Nun war ich auf einmal aus der jämmerlichsten Lebenslage befreit, und es galt zu überlegen, was ich in Zukunft anfangen wolle.
Das edelmüthige Benehmen des Kapitäns gegen mich werde ich nie vergessen. Er nahm für die Ueberfahrt Nichts von mir und gab mir obendrein zwanzig Ducaten für das Leopardenfell und vierzig für das Löwenfell, auch ließ er mir pünktlich Alles, was im Schiffe mir gehörte, ausliefern. Was ich zu verkaufen Lust hatte, z. B. den Flaschenkorb, zwei meiner Gewehre und den Rest des Wachses, kaufte er mir ab. Kurz, ich löste aus meiner Habe gegen zweihundert spanische Speciesthaler. Mit diesem Kapital ging ich in Brasilien an Land.
Kurze Zeit darauf empfahl mich der Kapitän an einen Mann von gleicher Redlichkeit, wie er selbst war. Dieser besaß ein Ingenio, das heißt eine Zuckerplantage. Auf derselben hielt ich mich eine Zeitlang auf und wurde dadurch mit der Kultur und Bereitung des Zuckers bekannt. Da ich sah, welch angenehmes Leben die Pflanzer führten und wie rasch sie reich wurden, entschloß ich mich, wenn mir die Niederlassung gestattet würde, gleichfalls Pflanzer zu werden und mir zu diesem Zweck mein in London hinterlassenes Geld schicken zu lassen. Ich ließ mich deshalb durch eine Urkunde naturalisiren, kaufte so viel Land, als mit meinem Kapital möglich war, und machte einen Plan zu einer Pflanzung, wie sie mein in England befindliches Geld mir anzulegen gestatten würde.
Ich hatte einen Portugiesen, der aus Lissabon, aber von englischen Eltern stammte, mit Namen Wells zum Nachbar, der sich ungefähr in gleichen Umständen befand wie ich. Wir wurden mit einander gut bekannt. Sein Betriebskapital war wie das meinige nur gering, und unsre Pflanzung verschaffte uns etwa zwei Jahre hindurch wenig mehr als den Lebensunterhalt. Indessen begannen wir uns zu vergrößern und unser Land zu verbessern, so daß wir im dritten Jahr schon etwas Tabak anpflanzen und Jeder von uns ein großes Stück Land zum Zuckeranbau für das folgende Jahr vorbereiten konnte. Beide aber hatten wir Hülfe nöthig, und jetzt wurde es mir fühlbar, daß es eine Thorheit von mir gewesen war, mich von Xury zu trennen.
Aber ach! es ist kein Wunder, daß ich, der ich's nie vernünftig angefangen hatte, auch diesmal verkehrt gehandelt hatte. Das war nun nicht wieder gut zu machen. Ich hatte mich jetzt auf ein Leben eingelassen, das meiner ganzen Natur entgegen und völlig verschieden von dem war, an dem ich Gefallen fand, dessentwillen ich das Vaterhaus verlassen und den väterlichen Rath in den Wind geschlagen hatte. Jetzt befand ich mich auf der Mittelstraße des Lebens, die ich zu Hause auch hätte wandern können, ohne mich in der Welt so abzuplagen, wie ich es nun that. Oft sagte ich zu mir selbst: diese Art Leben konntest du auch in England unter deiner Sippschaft führen und brauchtest nicht deswegen fünftausend englische Meilen unter Fremde und unter die Wilden in eine Wüstenei zu gehen, wo man von dem Fleckchen Erde, das deine Heimat ist, niemals ein Wort vernommen hat.
So sah ich meine Lage mit immer größerem Mißvergnügen an. Ich hatte Niemanden zum Umgange als jenen Nachbar, mit dem ich zuweilen verkehrte. Was zu arbeiten war, mußte ich mit eigenen Händen thun, und ich kam mir vor wie Jemand, der auf eine einsame Insel verschlagen ist. Aber das sollte erst noch kommen. Jedermann möge bedenken, daß, wenn er seine gegenwärtige Lage ungerecht beurtheilt, die Vorsehung ihn leicht zu einem Tausche zwingen kann, damit er durch die Erfahrung lerne, wie glücklich er früher gewesen. Jenes einsame Leben auf einem öden Eilande, an das ich damals dachte, sollte mir noch dereinst beschieden sein, weil ich so oft ungerechter Weise damit mein damaliges Leben verglichen hatte, welches, wenn es länger gedauert, mich sehr wahrscheinlich zu einem begüterten und reichen Mann gemacht hätte.
Ich hatte meine Plantage schon einigermaßen in Stand gebracht, als der Schiffskapitän, der mich auf der See eingenommen, die Rückreise antrat. Das Schiff hatte nämlich, bis die Ladung und die Reisevorbereitungen beendet waren, beinahe drei Monate dort verweilt. Als ich meinem Freunde sagte, daß ich ein kleines Kapital in London hinterlassen, erwiederte er in seiner freundlichen und aufrichtigen Art:»Sennor Inglese (denn so nannte er mich immer), wenn Ihr mir Briefe und eine Vollmacht mitgeben wollt, mit dem Auftrag an die Person, die Euer Geld in London hat, dieses nach Lissabon zu schicken, und zwar in solcher Münze, wie sie hierzu Lande gilt, so werde ich's Euch, will's Gott, bei meiner Rückkehr mitbringen. Doch weil menschliche Dinge dem Wechsel und Mißgeschick so sehr unterworfen sind, rathe ich Euch, nur die Hälfte Eures Kapitals, hundert Pfund Sterling, kommen zu lassen und dem Glück anzuvertrauen. Kommt dies Geld richtig hier an, dann könnt Ihr ja den Rest in gleicher Weise beziehen. Geht's verloren, so habt Ihr wenigstens die Hälfte gerettet.«
Dies war ein so vernünftiger Rath, daß ich ihn nicht ausschlagen durfte. Ich faßte daher Briefe an die Frau in London, welche mein Geld besaß, und eine Vollmacht für den portugiesischen Kapitän ab, wie mein Freund es mir gerathen hatte. Der Kapitänswittwe gab ich einen ausführlichen Bericht über meine Abenteuer, erzählte ihr von meiner Sklaverei und Flucht, von der Begegnung mit dem portugiesischen Kapitän und seinem menschenfreundlichen Benehmen, von meiner gegenwärtigen Lage und ertheilte ihr die nöthige Anweisung zur Uebersendung des Geldes. Als mein Freund nach Lissabon gekommen, gelang es ihm, durch einen englischen Kaufmann sowohl die Anweisung, als auch einen mündlichen Bericht über meine Erlebnisse nach London zu übermachen. Die Wittwe sandte hierauf außer dem Geld noch aus eigner Tasche an den portugiesische Kapitän ein sehr schönes Geschenk für sein liebreiches Benehmen gegen mich.
Der londoner Kaufmann legte die hundert Pfund in englischen Waaren an, wie es der Kapitän vorgeschrieben, schickte sie sofort nach Lissabon und letzterer brachte sie wohlbehalten nach Brasilien. Es befanden sich darunter (der Anordnung des Kapitäns gemäß, denn ich verstand zu wenig von der Sache) alle Arten Werkzeuge, Eisenwaaren und andere Dinge, die ich auf meiner Pflanzung gut benutzen konnte.
Als die Sendung angekommen war, dachte ich, mein Glück sei gemacht, so voll freudiger Zuversicht war ich. Mein guter Kapitän hatte die fünf Pfund Sterling, die ihm meine Freundin zum Geschenk gemacht, dazu verwandt, für mich auf sechs Jahre einen Diener zu miethen. Er nahm Nichts dafür zur Vergeltung an als ein wenig Tabak, den ich selbst gezogen hatte.
Meine Waaren bestanden in lauter englischen Manufaktursachen, in Tüchern, Stoffen, und solchen Dingen, die in Brasilien besonders gesucht waren, daher ich sie mit Vortheil verkaufen konnte. So löste ich denn das Vierfache des Einkaufspreises aus meiner ersten Ladung und war nun meinem armen Nachbar weit an Mitteln überlegen. Das Erste, was ich nun that, war, daß ich mir einen Negersklaven kaufte und außer dem europäischen Diener, welchen der Kapitän mitgebracht hatte, noch einen weitern miethete.
Wie aber der Mißbrauch des Glücks oftmals unser größtes Unglück herbeiführt, so war's auch bei mir. Meine Pflanzung nahm im nächsten Jahr einen großen Aufschwung. Ich erntete fünfzig schwere Rollen Tabak, außerdem, was ich an meine Nachbarn überlassen hatte. Diese fünfzig Rollen, deren jede über hundert Centner wog, wurden wohl verwahrt aufgespeichert bis zur Rückkehr der lissaboner Schiffe.
Jetzt aber füllte mir mein wachsender Reichthum den Kopf mit allerlei Anschlägen, die über meine Mittel gingen, wie das schon oft die gescheitesten Geschäftsleute ruinirt hat.
Wäre ich in meiner damaligen Lage geblieben, so hätte ich wohl noch alles Glückes theilhaftig werden können, um dessentwillen mein Vater mir so eindringlich ein ruhiges stilles Leben empfohlen hatte. Allein es harreten andere Dinge auf mich. Ich sollte noch der willfährige Schmied meines eigenen Unglücks werden. Ich sollte das Maß meiner Thorheit vollmachen und mir für Selbstbetrachtungen, zu denen ich später Zeit genug haben sollte, noch mehr Stoff sammeln. All mein Mißgeschick aber ward herbeigeführt durch meine thörichte Neigung zu einem unstäten Leben, dem ich, entgegen den klarsten Beweisen, daß mir das Beharren in meinem jetzigen Leben am besten bekomme, unablässig nachstrebte.
Wie ich einst meinen Eltern entlaufen war, so konnte ich auch jetzt nicht in zufriedener Ruhe leben. Ich mußte auf und davon und der glücklichen Aussicht, ein reicher Mann auf meiner neuen Pflanzung zu werden, den Rücken kehren. Nur das unmäßige Verlangen, höher zu steigen, als es meiner Natur angemessen war, trieb mich dazu, und so stürzte ich mich denn in die tiefste Tiefe menschlichen Elends, in die je Einer gerathen ist, und in der nicht leicht ein Anderer sein Leben und seine Gesundheit behalten haben würde.
Kapitel 3
Ich werde jetzt den Faden meiner Geschichte wieder im Zusammenhang verfolgen. Wie man denken kann, hatte ich nach vierjährigem Aufenthalt in Brasilien und nachdem meine Pflanzung in guten Zug gekommen war, nicht nur die Landessprache gelernt, sondern auch Bekannte und Freunde unter meinen Pflanzerkollegen und den Kaufleuten zu St. Salvador gewonnen. Bei meinen Gesprächen mit ihnen war auch oft von meinen beiden Reisen an die Küste von Guinea, von der Art und Weise des Handels mit den Negern und auch davon die Rede gewesen, wie leicht es sei, dort für Kleinigkeiten, wie Spielwaaren, Glasperlen, Messer, Scheeren, Beile und dergleichen, nicht nur Goldstaub, Guineakorn, Elephantenzähne &c., sondern auch Neger zur Sklavenarbeit in Brasilien zu erhandeln.
Man lauschte auf diese Mittheilungen mit gespannter Aufmerksamkeit, vorzüglich aber auf das, was den Ankauf von Negern anging. Damals wurde der Handel mit diesen noch nicht stark betrieben. Er stand unter der Oberaufsicht der Könige von Spanien und Portugal, und die Einkünfte flossen in die königlichen Kassen, daher wurden nur wenig Neger nach Brasilien gebracht und diese kosteten schweres Geld.
Einmal, nachdem ich mit einigen Pflanzern und Kaufleuten über diese Dinge mich angelegentlich unterhalten hatte, kamen am nächsten Morgen drei von ihnen zu mir und sagten, sie hätten sich jene Angelegenheit reiflich überlegt und wollten mir einen Vorschlag machen. Ich mußte Verschwiegenheit geloben und hierauf theilten sie mir mit, daß sie Lust hätten ein Schiff nach Guinea zu schicken, da es ihnen auf ihren Pflanzungen an Nichts so sehr fehle als an Arbeitern. Weil sie jedoch keinen öffentlichen Handel mit Sklaven treiben dürften, so beabsichtigten sie nur eine einzige Reise zu machen, die erkauften Neger heimlich ans Land zu bringen und dann unter sich zu theilen. Es frage sich nun, ob ich als ihr Supercargo die Expedition zu Schiffe leiten wolle. Als Vergütung sollte ich einen gleichen Antheil wie sie von den Negern bekommen, ohne zu dem Ankaufskapital beizusteuern.
Dies wäre ein lockendes Anerbieten für Einen gewesen, der nicht eine eigne Pflanzung, die auf dem besten Wege sich zu vergrößern war, zu überwachen gehabt hätte. Für mich aber, der ich einen guten Anfang gemacht hatte und nur so fort zu fahren brauchte, um mit Hülfe meiner andern hundert Pfund aus England binnen drei oder vier Jahren sicherlich mir ein Vermögen von drei- bis viertausend Pfund Sterling erworben zu haben, war der bloße Gedanke an eine solche Reise das Unsinnigste, dessen ich mich schuldig machen konnte.
Jedoch ich hatte nun einmal die Bestimmung, mich zu Grunde zu richten, und deshalb konnte ich dem Anerbieten ebensowenig widerstehen, als ich einst dem guten Rath meines Vaters zu folgen vermocht hatte. Kurz, ich sagte jenen Leuten, daß ich von Herzen gern die Reise machen wolle, wenn sie versprächen, während meiner Abwesenheit für meine Pflanzung zu sorgen und sie, wenn ich umkommen sollte, an die von mir bestimmten Personen zu überliefern. Sie gingen hierauf ein und stellten mir ein urkundliches Versprechen darüber aus. Ich faßte dann ein förmliches Testament ab, verfügte darin über meine Pflanzung und über meine sonstige Habe für den Fall meines Todes und ernannte den Kapitän, meinen Lebensretter, zum Universalerben, mit der Bestimmung, daß er die Hälfte meines Besitztums für sich behalten, die andere Hälfte verkaufen und den Ertrag nach England schicken solle.
So traf ich allerdings die besten Maßregeln, um die Zukunft meines Vermögens zu sichern. Hätte ich nur halb so viel Nachdenken auf das verwandt, was mein wahres Interesse forderte und was ich thun und lassen sollte, so würde ich sicherlich nicht meine günstige Lage aufgegeben und eine Seereise angetreten haben, auf der mich die gewöhnlichen Gefahren einer solchen und obendrein noch, wie ich nach meiner Erfahrung Grund hatte anzunehmen, ganz besondere Fährlichkeiten erwarteten.
Ich aber folgte blindlings den Lockungen meiner Einbildungskraft und hörte nicht auf die Stimme der Vernunft. Das Schiff wurde ausgerüstet, die Ladung geliefert und Alles der Verabredung gemäß von meinen Compagnons ins Werk gesetzt. In schlimmer Stunde ging ich an Bord, am 1. September 1659, just an dem Tage, an welchem ich acht Jahre zuvor meinen Eltern zu Hull entflohen war, ihren Geboten trotzend und mein eignes Glück thöricht verscherzend.
Unser Schiff war etwa 120 Tonnen schwer, führte sechs Kanonen und eine Mannschaft von vierzehn Leuten außer dem Kapitän, dem Schiffsjungen und mir. Wir hatten keine schwere Ladung, sondern nur solche Waaren. die sich zum Handel mit den Negern eigneten: Perlen, Muscheln und allerlei Kleinigkeiten, wie kleine Spiegel, Messer, Scheeren, Beile und dergleichen.
Noch an dem Tage, an dem ich an Bord gegangen, lichteten wir die Anker. Wir hielten uns zunächst nordwärts an der brasilianischen Küste entlang, um dann vom 10. oder 12. Grad nördlicher Breite aus hinüber nach Afrika zu steuern, welches der gewöhnliche Cours dorthin in dieser Jahreszeit war. Wir hatten bis auf die große Hitze bei der Küstenfahrt sehr gutes Wetter. Von der Höhe von St. Augustin aus nahmen wir, das Land aus dem Gesicht verlierend, den Weg seewärts, als ob wir nach der Insel Fernando de Noronha wollten, die wir jedoch östlich liegen ließen. Nach zwölftägiger Fahrt passirten wir die Linie und hatten gerade, nach unserer Berechnung, 7°22′ nördlicher Breite erreicht, als ein heftiger Orkan uns gänzlich desorientirte. Er erhob sich von Südost, drehte sich dann nach Nordwest und blieb hierauf in Nordost stehen. Von dort blies er in so furchtbarer Weise zwölf Tage hindurch, daß wir weiter Nichts thun konnten, als uns von der Wuth der Windsbraut forttreiben lassen. Ich brauche kaum zu sagen, daß ich während dieser ganzen Zeit jeden Tag meinen Untergang erwartete, und daß Niemand im Schiffe hoffte, mit dem Leben davon zu kommen.
Zur Steigerung dieser Noth verloren wir drei unserer Leute. Einer davon starb am hitzigen Fieber, ein Anderer nebst dem Schiffsjungen wurde über Bord gespült. Ungefähr am zwölften Tag legte sich der Sturm ein wenig und der Kapitän begann, so gut es gehen wollte, zu observiren. Er brachte heraus, daß wir etwa unter dem 11. Grad nördlicher Breite, aber 22 Längengrade westwärts vom Kap St. Augustin verschlagen wären. Demnach befanden wir uns in der Nähe der Küste von Guyana oberhalb des Amazonenstroms und nahe beim Orinoko, der gewöhnlich der große Fluß genannt wird. Der Kapitän berieth mit mir, welchen Cours er jetzt nehmen sollte, und war gewillt, da unser Schiff leck und arg zugerichtet war, direkt nach der brasilianischen Küste zurückzukehren; wogegen ich mich jedoch entschieden erklärte. Wir studirten hierauf die Seekarte und fanden, daß wir kein bewohntes Land antreffen würden, bis wir in den Bereich der karaibischen Inseln kämen. Deshalb beschlossen wir nach Barbados hinzusteuern, das wir, wenn wir uns seewärts hielten, um den Golfstrom der Bai von Mexiko zu vermeiden, binnen etwa fünfzehn Tagen zu erreichen hoffen konnten. Denn ohne unser Schiff auszubessern und für uns selbst Lebensmittel einzunehmen, wären wir in keinem Falle im Stande gewesen die afrikanische Küste zu erreichen.
In der erwähnten Absicht änderten wir nun den Cours und steuerten nach Westnordwest, um auf irgend einer der englischen Inseln Station zu machen. Aber es sollte anders kommen. Als wir uns unter 12°18′ nördlicher Breite befanden, überfiel uns ein neuer Sturm und trieb uns mit solcher Gewalt nach Westen, daß wir aus dem Bereich aller civilisirten Bevölkerung und in die Gefahr geriethen, selbst wenn uns die See verschonte, wahrscheinlich eher von Wilden gefressen zu werden, als wieder heim zu kommen.
In dieser traurigen Lage, während der Wind noch sehr heftig ging, erscholl eines Morgens von einem unserer Leute der Ruf» Land!«— Kaum aber waren wir aufs Deck geeilt, um zu schauen, wo wir uns befänden, so saß auch schon unser Schiff auf einer Sandbank. Sobald es fest lag, wurde es von den Wogen dergestalt überflutet, daß wir uns sämmtlich verloren glaubten und uns so rasch als möglich in die Kajüten zurückzogen, um vor den schäumenden Wellen Schutz zu suchen.
Niemand, der nicht Aehnliches durchgemacht hat, kann sich die menschliche Rathlosigkeit in solcher Lage vorstellen. Wir wußten nicht, wo wir uns befanden, ob das Land, an das wir getrieben waren, eine Insel oder ein Theil des Festlandes, ob es bewohnt sei oder nicht. Auch mußten wir, da der Wind zwar ein wenig gemäßigt, aber immer noch sehr heftig war, jeden Augenblick fürchten, das Schiff werde in Trümmern gehen, wenn nicht wie durch eine Art Wunder der Wind plötzlich umschlage. Wir schauten Einer den Andern in Todeserwartung an, und Jeder von uns machte sich zum Eintritt in eine andere Welt bereit. Ganz gegen unser Erwarten jedoch zerbarst das Schiff nicht, und, wie der Kapitän versicherte, begann der Wind sich plötzlich zu legen.
Trotzdem aber, da wir auf dem Strande saßen und keine Hoffnung hatten, das Schiff flott zu machen, blieb uns in unserer traurigen Lage Nichts übrig, als darauf zu denken, wie wir das nackte Leben retten könnten. Vor dem Sturm hatten wir am Stern unseres Schiffes ein Boot gehabt, das aber während des Unwetters ans Steuerruder geschleudert, dann los geworden und entweder versunken oder fortgetrieben war. Wir hatten zwar noch ein anderes Boot an Bord, aber es schien unmöglich, dasselbe in See zu bringen. Zu langem Besinnen jedoch fehlte die Zeit, da wir jede Minute das Schiff in Stücken zu sehen meinten, und Einige riefen, es sei bereits geborsten.
Trotz dieser schlimmen Lage gelang es dem Steuermann, mit Hülfe der übrigen Mannschaft jenes Boot über Bord zu lassen. Wir sprangen alle, elf an der Zahl, hinein, uns der Barmherzigkeit Gottes und dem wilden Meere gänzlich überlassend. Denn wiewohl der Sturm sich bedeutend gemindert hatte, gingen die Wogen doch noch furchtbar hoch, und man konnte hier mit den Holländern die stürmische See in Wahrheit» den wild Zee «nennen.
Unsere Noth war immer noch groß genug. Wir sahen klar voraus, daß das Boot sich in den hohen Wellen nicht halten könne, sondern untergehen müsse. Segel hatten wir nicht, hätten auch Nichts damit anfangen können. Daher arbeiteten wir uns mit den Rudern nach dem Lande hin, aber schweren Herzens, wie Leute, an denen ein Todesurtheil vollzogen werden soll. Denn es war uns bewußt, daß das Boot, näher zur Küste gelangt, von der Brandung in tausend Stücke zerschmettert werden müsse. Gleichwohl, indem wir unsere Seelen Gott befahlen, ruderten wir mit allen Kräften nach dem Land hin, mit eigenen Händen unserem Verderben entgegen.
Ob die Küste aus Fels oder Sand bestehe, ob sie flach oder steil sei, wußten wir nicht. Der einzige Hoffnungsschimmer, der uns noch geblieben, bestand in der Aussicht, daß wir vielleicht das Boot in irgend eine Bai oder Flußmündung einlaufen lassen oder uns unter einem Vorsprung der Küste bis zum Eintritt der Ebbe bergen könnten. Von diesen Dingen ließ sich aber Nichts sehen, vielmehr bot das Land, als wir dem Ufer näher kamen, einen noch schrecklicheren Anblick als das Meer selbst.
Wir waren nach unserer Berechnung ungefähr anderthalb Meilen gerudert oder vielmehr vom Wasser getrieben, als eine berghohe wüthende Welle gerade auf uns gerollt kam und uns den Gnadenstoß erwarten ließ. Sie traf das Boot mit solcher Gewalt, daß sie es alsbald umwarf und uns nicht nur aus demselben schleuderte, sondern auch von einander trennte. Ehe wir nur ein Stoßgebet hatten thun können, waren wir sämmtlich von den Wogen verschlungen.
Die Verwirrung meiner Gedanken beim Untersinken ins Wasser ist unbeschreiblich. Obwohl ich sehr gut schwamm, hatte mich die Welle, noch ehe ich Athem zu schöpfen vermochte, eine ungeheure Strecke nach der Küste hingetragen, und als sie dann erschöpft zurückkehrte, sah ich mich halbtodt in Folge des verschluckten Wassers auf dem fast trockenen Lande zurückgeblieben.
Ich besaß noch so viel Geistesgegenwart, daß ich, da ich mich unerwartet so nahe dem Festland sah, mich aufrichtete und versuchte, so weit als möglich nach dem Ufer hin zu gelangen, ehe eine andere Welle kommen und mich mitnehmen würde. Dieser Versuch mißlang jedoch. Eine Woge wie ein großer Hügel, gleich einem wüthenden Feinde, mit dem zu kämpfen ich mir nicht einfallen lassen konnte, stürzte hinter mir her. Es blieb mir Nichts übrig, als den Athem einzuhalten und mich, so gut es ging, über dem Wasser zu halten. Dabei war mein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, daß die See mich nicht, wie sie mich eine gute Strecke landeinwärts getrieben, auch ebenso weit wieder zurücktrage.
Die neue Woge begrub mich sofort wieder zwanzig bis dreißig Fuß in die Tiefe. Ich konnte fühlen, wie sie mich mit großer Gewalt und Schnelligkeit eine geraume Strecke nach der Küste hintrug. Wiederum hielt ich den Athem an und bemühete mich, mit aller Kraft vorwärts zu schwimmen. Fast wäre mir der Athem ausgegangen, als ich plötzlich auftauchte und Hand und Kopf über dem Wasser sah. Obwohl dies nur zwei Sekunden dauerte, reichte es doch aus, mir neue Luft und neuen Muth zu verschaffen. Abermals war ich eine gute Weile mit Wasser bedeckt, dann aber, als sich die Woge erschöpft hatte und zurückkehrte, fühlte ich Grund unter den Füßen. Ich stand einige Augenblicke still, schöpfte Luft und eilte sofort mit allen Kräften dem Ufer zu. Aber auch diesmal entrann ich nicht der wüthenden See, die mich aufs Neue überflutete. Zweimal noch erfaßten mich die Wellen und trieben mich, da die Küste sehr flach war, vorwärts wie vorher.
Das letzte dieser beiden Male hätte leicht verhängnißvoll für mich werden können. Das Meer warf mich nämlich dabei gegen ein Felsstück, und zwar mit solcher Gewalt, daß ich die Besinnung verlor und ganz hülflos dalag. Der Schlag traf mich in die Seite und gegen die Brust und benahm mir dadurch den Athem, so daß ich, wäre alsbald wieder eine Welle gekommen, ertrunken sein würde. Jedoch kam ich kurz vor der Rückkehr der Wogen wieder zu mir und beschloß diesmal, mich fest an dem Fels zu fassen und wenn möglich den Athem bis zur Rückkehr der Welle einzuhalten. Dies gelang denn auch, da die Wogen nicht mehr so hoch wie vorher gingen. Ein weiterer Lauf brachte mich dann so nahe dem Strand, daß die nächste Welle, obwohl sie mich übergoß, mich nicht mehr fortzutragen vermochte. Abermals rannte ich weiter und diesmal gelangte ich zum festen Lande, wo ich in großer Freude die Anhöhe der Küste erkletterte und mich da frei von Gefahr und außerhalb des Bereichs der See ins Gras niedersetzte.
Jetzt, da ich mich gerettet sah, hob ich meine Augen empor und dankte Gott für das Leben, auf dessen Erhaltung ich vor einigen Minuten noch nicht hatte hoffen können. Ich glaube, es ist unmöglich, das Entzücken und die Wonne eines Menschen, der sozusagen unmittelbar dem Grabe entronnen ist, zu schildern. Ich begreife jetzt, daß, wenn man einem armen Schächer, der schon den Strick um den Hals hat, Begnadigung schenkt, man zu gleicher Zeit einen Wundarzt schickt, der ihm zur Ader läßt, damit die Ueberraschung ihm nicht das Herz abdrücke:
«Denn rasche Freud' gleicht jähem Leid«.
Mit emporgehobenen Händen, ganz versunken in das Gefühl meiner Errettung, ging ich am Strande auf und ab. Ich dachte an meine ertrunkenen Gefährten und daß ich die einzige gerettete Seele unter Allen sei; denn ich sah Keinen wieder, habe auch kein Zeichen von ihnen mehr wahrgenommen, außer drei Hüten, einer Mütze und zwei nicht zusammengehörigen Schuhen.
Als ich nach dem gestrandeten Fahrzeug, das durch die Stärke der Brandung meinem Anblick fast entzogen worden war, blickte, rief ich unwillkürlich aus:»Gott, wie ist es möglich gewesen, daß ich das Land erreichen konnte!«
Nachdem ich nun meine Seele in solcher Weise an der tröstlichen Seite meiner Lage erhoben hatte, begann ich umherzublicken und auszuschauen, auf was für einem Lande ich mich eigentlich befinde und was zunächst zu thun sei. Da sank nun bald wieder mein Muth und ich erkannte, daß meine Errettung eine furchtbare Begünstigung sei. Ich war durchnäßt und konnte die Kleider nicht wechseln; hatte weder etwas zu essen, noch etwas zu meiner Stärkung zu trinken; keine andere Aussicht bot sich mir, als Hungers zu sterben oder von den wilden Thieren gefressen zu werden; und, was mich besonders bekümmerte, ich besaß keine Waffen, um irgend ein Thier zu meiner Nahrung zu tödten, oder mich gegen andere, die mich zu der ihrigen zu verwenden Lust hätten, zu wehren. Nichts trug ich bei mir als ein Messer, eine Tabakspfeife und ein wenig Tabak in einem Beutel. Dies war meine ganze Habe, und ich gerieth darob in solche Verzweiflung, daß ich wie wahnsinnig hin und her lief. Die Nacht kam, und ich begann schweren Herzens zu überlegen, was mein Loos sein würde, wenn es hier wilde Thiere gäbe, von denen ich wußte, daß sie stets des Nachts auf Beute auszugehen pflegen.
Die einzige Auskunft, die mir einfiel, war, einen dicken buschigen Baum, eine Art dorniger Fichte, die in meiner Nähe stand, zu erklettern. Ich beschloß, dort die ganze Nacht sitzen zu bleiben und am nächsten Tag die Art, wie ich meinen Tod finden wolle, zu wählen, denn auf das Leben selbst hoffte ich nicht mehr. Ich ging einige Schritte am Strande her, um nach frischem Wasser zu suchen: das fand ich denn auch zu meiner großen Freude. Nachdem ich getrunken und etwas Tabak in den Mund gesteckt hatte, um den Hunger abzuwehren, erstieg ich den Baum und versuchte mich in demselben so zu lagern, daß ich im Schlafe nicht herunter fallen könnte. Vorher hatte ich mir einen kurzen Stock, eine Art von Prügel zu meiner Vertheidigung abgeschnitten, und dann verfiel ich in Folge meiner großen Müdigkeit auf dem Baum in einen tiefen Schlaf und schlief so erquickend, wie es wohl Wenige in meiner Lage vermocht hätten. Nie im Leben hat mir, glaube ich, der Schlummer so wohl gethan wie damals.
Als ich erwachte, war es heller Tag. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und der Sturm sich gelegt, so daß die See ruhig ging. Am meisten überraschte mich, daß das Schiff in der Nacht durch die Flut von der Sandbank, auf der es gestrandet, fast bis zu dem früher erwähnten Felsen, an welchen mich die Woge so heftig geschleudert hatte, getrieben war. Es befand sich etwa eine Meile von der Küste, und da es noch aufrecht stand, wünschte ich sehr an Bord zu sein, um wenigstens einige nöthige Gegenstände für mich retten zu können.
Als ich von meiner Schlafstätte auf dem Baum heruntergestiegen, schaute ich umher, und das Erste, worauf meine Augen fielen, war das Boot. Der Wind und die Wellen hatten es etwa zwei Meilen zu meiner Rechten entfernt auf den Strand geschleudert. Ich ging die Küste entlang danach hin, aber ein kleiner, etwa eine halbe Meile breiter Meeresarm hinderte mich zu ihm zu gelangen. Da ich nun für den Augenblick mein Augenmerk mehr auf das Schiff gerichtet hatte, wo ich Etwas zu meiner nächsten Lebensfristung zu finden hoffte, kehrte ich für diesmal wieder um.
Kurz nach Mittag ward die See sehr ruhig und die Ebbe so stark, daß ich bis auf eine Viertelmeile dem Schiffe nahe kommen konnte. Hier wurde mir ein neuer Schmerz bereitet. Ich sah nämlich klar, daß wir, wären wir Alle an Bord geblieben, sämmtlich gerettet sein würden. Wir würden dann Alle ans Land gelangt und ich nicht so jammervoll von allem Trost und aller menschlichen Gesellschaft verlassen gewesen sein wie jetzt. Die Thränen traten mir bei diesem Gedanken in die Augen. Da ich aber wenigstens einige Erleichterung meines Aufenthalts auf dem Schiffe zu finden hoffte, beschloß ich den Versuch zu machen, ob ich es erreichen könne. Ich zog wegen der großen Hitze die Kleider aus und begab mich ins Wasser. Als ich zu dem Schiff gelangt war, zeigte sich eine neue besonders große Schwierigkeit, in der Frage nämlich, wie ich an Bord gelangen sollte. Das auf dem Grunde aufliegende Fahrzeug ragte hoch aus dem Wasser, und ich konnte nirgends eine Handhabe finden, um mich daran in die Höhe zu heben. Erst nachdem ich es zweimal umschwommen, erspähete ich beim letzten Male ein kleines Tauende, das an dem Vordertheil so tief herunter hing, daß ich, wenn auch nur mit großer Mühe, es fassen und mit Hülfe desselben in den Vordertheil des Schiffes gelangen konnte.
Hier sah ich, daß das Schiff leck und schon eine große Masse Wasser eingedrungen war. Es lag auf der Seite einer Sandbank und das Hintertheil ragte hoch in die Luft. Das Vordertheil lag gänzlich im Wasser. Dennoch war das Deck frei und was sich auf diesem befand trocken. Wie man denken kann, untersuchte ich vor allen Dingen, was verdorben sei und was nicht. Zunächst fand ich, daß der sämmtliche Schiffsproviant trocken und vom Wasser verschont geblieben war. Da ich starken Appetit verspürte, eilte ich sofort nach dem Brodkasten, füllte mir die Taschen mit Zwieback und aß davon, während ich zugleich noch die andern Sachen durchmusterte, da ich keine Zeit zu verlieren hatte. Auch etwas Rum fand ich in der großen Kajüte und trank davon einen gehörigen Schluck, was zur Ermunterung meiner Lebensgeister nöthig genug war. Jetzt hätte ich vor allen Dingen ein Boot brauchen können, um mich mit mancherlei Dingen zu versehen, die mir voraussichtlich sehr nöthig sein würden. Aber was hätte es geholfen, die Hände in den Schooß zu legen und Unerreichbares zu wünschen. Meine große Noth spornte meinen Eifer an. Wir hatten an Bord einige Raaen und zwei oder drei dicke hölzerne Sparren, auch einige große Masten. Ich beschloß, dies Alles zu benutzen und warf davon so viel über Bord, als ich, der Schwere halber, bewältigen konnte, indem ich jeden Balken mit einem Seil befestigte, daß er nicht fortschwimmen konnte. Hierauf verließ ich das Schiff und zog die Hölzer an mich heran, band vier davon an beiden Enden, floßartig, möglichst fest zusammen und legte zwei bis drei Stücke quer darüber. Da ich bemerkte, daß ich zwar ganz gut auf den so verbundenen Hölzern herumgehen konnte, daß sie aber kein großes Gewicht zu tragen vermochten, machte ich mich an eine neue Arbeit. Ich sägte mit der Zimmermannssäge einen langen Topmast der Länge nach in drei Theile und brachte diese mit großer Mühe und Arbeit an meinem Floß an. Die Hoffnung, mich mit dem Notwendigsten zu versehen, feuerte mich an, so daß ich vollbrachte, was mir wohl bei keiner andern Gelegenheit möglich gewesen wäre.
Das Floß war nun stark genug, um ein ansehnliches Gewicht aushalten zu können. Es fragte sich zunächst, womit ich es belasten und wie ich die Ladung vor dem Seewasser schützen solle. Zuerst beschloß ich alle Planken und Dielen, deren ich habhaft werden konnte, darauf zu legen. Nachdem dies geschehen, nahm ich, in richtiger Erwägung dessen, was ich am nöthigsten brauchte, drei den Matrosen gehörige Kisten, brach sie auf und ließ sie, nachdem ich sie leer gemacht, auf das Floß herunter. In die erste that ich Lebensmittel, nämlich Brod, Reis, drei holländische Käse, fünf Stücke Ziegenfleisch (das auf dem Schiff unsere Hauptkost ausgemacht hatte) und einen kleinen Rest europäischen Getreides, welches wir für Geflügel mitgenommen hatten, das unterwegs geschlachtet worden war. Es bestand aus Gerste mit Weizen untermischt, was aber, wie ich später mit großem Bedauern bemerkte, theils von den Ratten angefressen, theils durch die Länge der Zeit verdorben war. Auch einige Flaschen Liqueur entdeckte ich, die der Kapitän für sich bestimmt hatte, sowie fünf bis sechs Gallonen Arrak. Die letzteren Gegenstände stellte ich frei auf das Floß, da in den Kisten kein Raum mehr für sie war.
Inzwischen begann die Flut sehr allmählich zu steigen. Mit Betrübniß sah ich sie meinen Rock, mein Hemd und die Weste wegschwemmen, die ich am Ufer auf dem Sand zurückgelassen hatte, während ich meine leinenen, nur bis ans Knie reichenden Hosen, sowie die Strümpfe beim Schwimmen anbehalten hatte. Der Verlust jener Sachen veranlaßte mich, nach Kleidern umherzustöberu und ich fand deren auch in Menge. Doch nahm ich nur das für den Augenblick Nöthigste, denn ich hatte mein Augenmerk noch mehr auf andere Dinge gerichtet, und zwar vor Allem auf Handwerkszeug, mit dem ich auf dem Lande hantieren könnte. Nach langem Suchen fand ich denn auch den Zimmermannskasten, der mir eine sehr kostbare Beute und in diesem Augenblick mehr werth war als eine ganze Schiffsladung von Goldbarren. Ich brachte ihn, wie er war, aufs Floß, ohne seinen Inhalt vorher zu untersuchen, da mir dieser ungefähr bekannt war.
Meine nächste Sorge ging nun auf Munition und auf Waffen. Es befanden sich zwei sehr gute Vogelflinten und zwei Pistolen in der großen Kajüte, und dieser sowie einiger Pulverhörner, eines kleinen Schrotbeutels und zweier alter verrosteter Säbel bemächtigte ich mich zuerst. Wie ich wußte, waren auch drei Fäßchen mit Pulver im Schiff, doch hatte ich keine Ahnung davon, wo sie der Stückmeister aufgehoben hatte. Erst nach langem Suchen fand ich sie, zwei davon waren noch gut und trocken, das dritte aber hatte Wasser gezogen. Die beiden ersteren schaffte ich nebst den Waffen aufs Floß und dachte nun darüber nach, wie ich dieses aus Ufer bringen solle. Ich hatte nämlich weder Segel, noch Steuer, noch Ruder. Eine Hand voll Windes aber würde ausgereicht haben, mein ganzes Fahrzeug umzuwerfen.
Dreierlei jedoch ermuthigte mich: erstens die ruhige See, zweitens das Steigen der Flut, die landwärts ging, und drittens der Umstand, daß das Bischen Wind, das wehte, nach der Küste hin blies. So nun, nachdem ich noch mehre zerbrochene Ruder, die zum Boot des Schiffs gehört hatten, sowie außer dem Werkzeug im Kasten zwei Sägen, eine Axt und einen Hammer aufgefunden, begab ich mich auf die Fahrt.
Etwa eine Meile weit ging es ganz gut mit meinem Floß, nur bemerkte ich, daß es ein wenig von meinem früheren Landungsplatz abgetrieben wurde. Darauf hin vermuthete ich, es möge da wohl eine Wasserströmung und dem zufolge vielleicht eine Bucht oder eine Flußmündung sein, die ich als Hafen für meine Landung benutzen könnte.
Wie ich gedacht, so war's in der That. Vor mir zeigte sich eine kleine Landöffnung, und die Flut strömte, wie ich merkte, stark nach derselben hin. In dieser Strömung suchte ich denn mein Floß so gut als möglich zu halten.
Jetzt aber hätte ich fast zum zweiten Mal Schiffbruch gelitten, und diesmal würde ich schwerlich den Kummer überstanden haben. Weil ich nämlich die Beschaffenheit der Küste nicht kannte, gerieth mein Floß mit dem einen Ende auf eine Untiefe, und da das andere Ende nicht auch auf den Grund stieß, fehlte nicht viel, daß meine ganze Ladung abgerutscht und ins Wasser gefallen wäre.
Ich that mein Möglichstes, um dies zu verhüten, indem ich mich hinten auf die Kisten setzte, um sie an ihrem Platz festzuhalten. Leider aber konnte ich nun das Floß mit aller Gewalt nicht los bringen, besonders deshalb, weil ich meinen Posten bei den Kisten nicht verlassen durfte. In dieser Situation verharrte ich beinahe eine halbe Stunde, dann aber brachte mich das steigende Wasser ein wenig mehr ins Gleichgewicht, kurz darauf wurde mein Floß wieder flott, ich stieß mit dem Ruder ab und gelangte endlich in die Mündung eines kleinen Flusses, zwischen dessen engen Ufern die Flut sich in heftigem Strome bewegte. Jetzt sah ich mich nach einem geeigneten Landungsplatze um, indem ich besonders wünschte, einen solchen nicht allzu weit flußaufwärts zu finden. Denn in der Hoffnung, bald ein Schiff auf dem Meere zu erspähen, hatte ich beschlossen, dem Ufer so nahe als möglich zu bleiben.
Endlich ersah ich denn auch zur rechten Seite der Bucht eine kleine Einbiegung; nach dieser trieb ich mit großer Mühe das Floß, bis ich ihr so nahe kam, daß ich mit meinem Ruder Grund fand und gerades Weges einlaufen konnte. Hier aber wäre beinahe abermals meine ganze Ladung zu Grunde gegangen. Die Küste fiel nämlich dort ziemlich steil ab, und wenn ich landen wollte, mußte das eine Ende meines Fahrzeugs, sobald es auf den Strand stieß, wieder hoch, das andere wieder so tief zu liegen kommen, daß meine Beute dadurch gefährdet wurde. Da blieb mir denn Nichts weiter zu thun, als den höchsten Grad der Flut abzuwarten, indem ich mit meinem Ruder wie mit einem Anker das Floß fest hielt und das letztere möglichst dicht an eine flache Uferstelle drängte, welche voraussichtlich vom Wasser überflutet werden mußte. Sobald dies geschehen war (meine Flöße ging etwa einen Fuß tief im Wasser) trieb ich sie auf jene flache Stelle und befestigte sie da, indem ich an jedem Ende eines meiner zerbrochenen Ruder in den Grund stieß. So blieb ich liegen, bis die Ebbe das Floß und meine ganze Beute unversehrt auf dem Lande zurückließ.
Meine nächste Aufgabe war jetzt, die Gegend auszukundschaften, einen geeigneten Platz für meine Niederlassung auszusuchen und mich umzusehen, wo ich meine Güter am sichersten unterbringen könnte. Ich wußte nämlich nicht, ob ich mich auf dem Festlande oder auf einer Insel befinde; ob die Gegend unbewohnt sei oder nicht; ob es hier wilde Thiere gebe oder keine.
Etwa eine Meile von mir entfernt stieg ein Hügel steil empor, welcher den sich ihm nach Norden hin anreihenden Höhenzug überragte. Ich nahm eine von den Vogelflinten, eine Pistole und ein Pulverhorn zu mir, und so bewaffnet trat ich meine Entdeckungsreise nach jenem Punkte an. Von dort erkannte ich zu meiner großen Betrübniß, daß ich mich auf einer rings vom Meer umgebenen Insel befand. Kein Land war zu sehen, ausgenommen einige Felsen in ziemlicher Entfernung und zwei kleinere Inseln, die etwa drei Meilen westwärts ablagen.
Ich bemerkte ferner, daß meine Insel unangebaut und, wie deshalb mit gutem Grunde anzunehmen, unbewohnt war, wenn es nicht etwa wilde Bestien dort gab, deren ich jedoch bis dahin keine wahrnahm. Nur eine große Menge mir unbekannter Vögel sah ich, von denen ich jedoch, auch nachdem ich einige getödtet, nicht zu sagen vermochte, ob sie eßbar seien. Bei meiner Rückkehr schoß ich einen großen Vogel, der neben einem ansehnlichen Gehölz auf einem Baum saß. Das mochte wohl der erste Schuß sein, der hier seit Erschaffung der Welt vernommen wurde. Kaum war er gefallen, so erhob sich aus allen Gegenden des Waldes eine Unzahl von Vögeln verschiedenster Art, die alle durcheinander krächzten und schrieen. Keine mir bekannte Art war darunter. Der von mir erlegte schien, nach der Farbe und dem Schnabel zu schließen, dem Habichtgeschlecht anzugehören, doch waren seine Klauen nicht wie die bei dieser Vogelgattung gewöhnlichen beschaffen. Mit dem Fleische ließ sich Nichts anfangen.
Indem ich mit diesen Ergebnissen meiner Entdeckungswanderung mich vorläufig begnügte, ging ich nach meinem Floß zurück und beschäftigte mich den Rest des Tages über damit, die Ladung aus Land zu bringen. Da ich mich fürchtete, auf bloßer Erde zu schlafen, wegen der etwa vorhandenen wilden Thiere (später zeigte sich, daß diese Furcht ungegründet gewesen), verbarrikadirte ich mich, so gut es ging, mit den Kisten und Brettern, die ich ans Ufer gebracht hatte, und baute mir daraus für mein nächstes Nachtlager eine Art von Hütte. In Bezug auf meine Nahrung hatte ich vorläufig nichts Brauchbares bemerkt außer einigen hasenähnlichen Thieren, die aus dem Walde gelaufen kamen, in welchem ich den Vogel geschossen hatte.
Ich bedachte nun, daß ich noch sehr mannigfache nützliche Gegenstände und vor Allem das Tau- und Segelwerk aus dem Schiffe holen konnte. Daher beschloß ich eine weitere Reise an Bord des gestrandeten Fahrzeugs zu unternehmen, und da ich einsah, daß der nächsterfolgende Sturm dieses nothwendig zertrümmern mußte, nahm ich mir vor, mit Beiseitesetzung alles andern, sofort zu retten, was möglich sei. Meine Flöße wiederum zu der Fahrt zu benutzen, erschien mir nach reiflicher Erwägung nicht gerathen, und so entschloß ich mich, den Weg zum Schiffe wieder ganz in der früheren Weise zu machen.
Sobald die Flut vorüber war, entkleidete ich mich in meiner Hütte und behielt Nichts an als mein leinenes Hemd, meine leinenen Hosen und die Strümpfe, schwamm an das Wrack heran und begann, an Bord gelangt, sogleich mir ein zweites Floß herzurichten. Diesmal baute ich es, durch die Erfahrung genöthigt, weniger schwerfällig und belud es auch nicht so sehr als das erste Mal. Unter den nützlichen Dingen, die ich diesmal mitnahm, befanden sich zunächst einige Beutel mit Nägeln, ein großer Bohrer, etliche Dutzend Handbeile und ein mir ganz besonders dienlich erscheinender Schleifstein. Außer diesen Gegenständen versicherte ich mich einiger dem Stückmeister anvertraut gewesenen Sachen, nämlich mehrer Stücke Eisen, zweier Fäßchen mit Musketenkugeln, sieben Musketen, noch einer Vogelflinte und einer weiteren kleineren Quantität von Pulver; ferner fand ich einen großen Sack mit kleinem Schrot und eine dicke Rolle Blei. Die letztere war jedoch so schwer, daß ich nicht wagte sie über Bord zu bringen. Weiterhin eignete ich mir zu, was ich an Kleidungsstücken finden konnte, sodann ein Bramsegel, eine Hängematte und etwas Bettwerk. Auch diese zweite Ladung brachte ich zu meiner großen Freude auf dem Floß unversehrt und vollständig ans Ufer.
Mit einiger Furcht hatte ich daran gedacht, während meiner Abwesenheit vom Lande könnten meine dort befindlichen Lebensmittel geraubt sein, doch fand ich bei meiner Rückkehr keinerlei Spuren eines Gastes. Nur sah ich ein Thier, ähnlich einer wilden Katze, auf einer der Kisten sitzen, das, als ich näher kam, eine Strecke fortlief und dann stehen blieb. Es saß ganz ruhig da und sah mir ins Gesicht, als ob es Lust habe, meine Bekanntschaft zu machen. Ich zielte mit dem Gewehr nach ihm, aber das verstand es nicht, wenigstens machte es keine Miene wegzulaufen. Hierauf warf ich ihm ein Stück Zwieback zu, wiewohl ich nicht sehr freigebig mit diesem Artikel sein durfte, da mein Vorrath nicht weit reichte. Das Thier lief darauf zu, beschnüffelte es, fraß es auf und sah mich dann vergnügt an, als ob es noch mehr verlange. Ich dankte jedoch für Weiteres, und da es sah, daß Nichts mehr zu erwarten sei, lief es fort.
Nachdem ich meine zweite Ladung ans Land gebracht, hätte ich am liebsten vor allen Dingen die Pulverfässer geöffnet, um den Inhalt nach und nach (denn es waren große, schwere Behälter) fortzuschaffen. Doch hielt ich es für gerathener, mir zunächst aus Segeltuch und einigen Pfählen, die ich zu diesem Zwecke gefällt hatte, ein Zelt zu errichten. Sobald dies fertig war, brachte ich Alles hinein, was durch Regen oder Sonne beschädigt werden konnte. Rund um das Zelt thürmte ich sämmtliche leere Kisten und Fässer auf, um mich gegen plötzliche Angriffe von Menschen oder Thieren zu sichern. Sodann verschloß ich den Eingang mit einigen Brettern von Innen und mit einem leeren Kasten von Außen, breitete ein Bett auf den Boden, legte meine zwei Pistolen mir zu Häupten und meine Flinte neben mich, ging dann zum ersten Male wieder zu Bett und schlief die ganze Nacht sehr ruhig. Meine Müdigkeit war begreiflich genug, da ich die vorige Nacht nur wenig geschlafen und den letzten Tag über tüchtig gearbeitet hatte.
Wiewohl ich jetzt das größte Magazin von Gegenständen besaß, das wohl jemals ein einzelner Mensch um sich her aufgehäuft hat, gab ich mich dennoch nicht damit zufrieden. Denn da das zertrümmerte Schiff noch in seiner früheren Stellung verharrte, glaubte ich mich verpflichtet daraus zu holen, was ich nur bekommen konnte. So ging ich denn jeden Tag bei niedrigem Wasser an Bord und schaffte diesen und jenen Gegenstand herüber. Das dritte Mal holte ich mir, so viel ich vermochte, vom Takelwerk, alle dünnen Seile und Stricke, ein Stück Leinwand, das zum Ausbessern der Segel bestimmt war, und das Faß mit dem nassen Pulver. In der Folge bemächtigte ich mich nach und nach des sämmtlichen Segeltuchs, ließ es jedoch nicht ganz, sondern schnitt es kurzer Hand in Stücke, da es nur noch als bloße Leinwand zu verwenden war.
Wie groß aber war meine Freude, als ich nach fünf oder sechs solcher Fahrten, während ich schon glaubte, das Schiff enthalte nichts Brauchbares mehr für mich, noch eine große Tonne mit Brod, drei ansehnliche Behälter mit Rum und Spiritus, eine Schachtel mit Zucker und ein Fäßchen mit feinem Mehl entdeckte. Ich leerte die Brodtonne aus, wickelte die Brode einzeln in Segelstücke und brachte Alles wohlbehalten aus Ufer.
Am nächsten Tag unternahm ich eine weitere Fahrt. Da jetzt das Schiff alles Beweglichen entledigt war, machte ich mich an die Taue, schnitt das große Kabel in Stücke, um es fortschaffen zu können, und nahm auch noch zwei andere Taue und eine Helse, sowie alles Eisenwerk mit ans Land. Dann fällte ich den Fock- und den Brammast, verfertigte aus diesen und allen anderen dazu brauchbaren Dingen wiederum ein großes Floß, belud es mit jenen schweren Gütern und trat dann die Rückfahrt an. Jetzt aber begann mein gutes Glück mich zu verlassen. Die Flöße war nämlich so schwerfällig, daß ich sie, nachdem ich in die kleine Bucht, wo ich sonst immer gelandet war, gebracht hatte, nicht so gut zu dirigiren vermochte wie die früheren. Sie schlug um, und ich fiel mit meiner ganzen Beute ins Wasser. In Bezug auf meine Person hatte das Nichts zu sagen, da das Ufer nahe war. Jedoch von meiner Ladung ging der größte Theil, besonders des Eisens, von dem ich große Dienste erwartet hatte, verloren. Indeß bekam ich während der Ebbe die meisten Taustücke und auch ein wenig von dem Eisen wieder, das letztere aber nur mit unendlicher Mühe, da ich es durch Tauchen aus dem Wasser holen mußte, und das war eine ungemein anstrengende Arbeit.
Von jetzt an begab ich mich täglich nach dem Wrack, um was nur möglich war zu holen. Am dreizehnten Tage meines Aufenthalts auf der Insel war ich bereits elfmal auf dem Schiffe gewesen und hatte in dieser Zeit alles, was zwei Menschenhände fortzuschleppen vermochten, herübergeschafft. Wäre das Wetter ruhig geblieben, so würde ich mich nach und nach des ganzen Schiffes bemächtigt haben, aber schon als ich mich anschickte, zum zwölften Mal an Bord zu gehen, fühlte ich, daß sich der Wind erhob. Dennoch trat ich während der Ebbe die Fahrt an. Ich entdeckte denn auch, wiewohl ich geglaubt hatte, die Kajüte schon völlig ausgeräumt zu haben, darin noch eine Kommode, in der sich mehre Rasirmesser, ein paar große Scheeren und zehn bis zwölf gute Messer und Gabeln befanden; in einem anderen Behälter aber lag ein Häuflein Geld, etwa sechsunddreißig Pfund werth, in europäischen und brasilianischen Gold- und Silbermünzen.
Bei diesem letzteren Anblick konnte ich mich eines ironischen Lächelns nicht erwehren.»O elender Plunder«, rief ich,»wozu taugst du mir nun? Du bist hier nicht werth der Mühe, dich im Wege aufzulesen. Eines jener Messer nützt mehr als dein ganzer Haufe! Bleib wo du bist und ertrinke wie ein Thier, um das es sich nicht verlohnt, ihm das Leben zu retten.«
Nach besserer Ueberlegung nahm ich jedoch trotzdem das Geld mit. Ich wickelte meine sämmtliche Beute in ein Stück Leinwand und schickte mich an, eine neue Flöße herzustellen. Während ich eben daran gehen wollte, sah ich, daß der Himmel sich umzog. Zugleich steigerte sich der Wind, und nach einer Viertelstunde wehete eine ganz frische Brise vom Lande her. Sofort überlegte ich, daß ich mit einem Floß nicht dem Wind entgegen landen könne, und daß ich vor Beginn der Flut hinüber sein müsse, wenn ich überhaupt ans Ufer gelangen wolle. Da sprang ich denn ohne Weiteres ins Wasser und schwamm nach der Küste, allerdings nicht ohne erhebliche Anstrengung, theils wegen des Gewichts, das ich zutragen hatte, theils wegen der Strömung des Wassers. Denn der Wind war heftig geworden, und bis die volle Flut eintrat, hatte sich ein förmlicher Sturm erhoben. Da aber war ich schon wohlbehalten zu meinem kleinen Zelt gelangt, wo ich, meinen ganzen Reichthum um mich her gebreitet, sicher lag. Es stürmte die ganze Nacht hindurch, und als ich am Morgen mich umsah, war das Schiff verschwunden. Nun gereichte es mir zum großen Trost, daß ich keine Zeit und Mühe versäumt hatte, was mir nützlich sein konnte, aus demselben herüber zu schaffen. Ich konnte jetzt von dem Fahrzeug und dem, was es etwa noch enthielt, Nichts mehr hoffen und höchstens darauf bedacht sein zu retten, was von dem Winde an den Strand getrieben werden würde. In der That geschah das später mit mehren Stücken, die ich jedoch wenig zu nützen vermochte.
Kapitel 4
Jetzt vertiefte ich mich gänzlich in die Ueberlegung, wie ich mich gegen die Wilden, wenn solche sich etwa zeigen sollten, oder gegen die Bestien, wenn deren auf der Insel wären, zu schützen hätte. Ich war anfangs unschlüssig, ob ich mir eine Höhle in die Erde graben oder ein Zelt über derselben errichten solle. Endlich entschloß ich mich Beides zu thun. Die Art und Weise, wie ich es bewerkstelligte, wird dem Leser nicht uninteressant sein.
Ich erkannte bald, daß die Gegend der Insel, in der ich mich damals aufhielt, zu einer Niederlassung nicht geeignet sei, theils weil der Boden dort tief gelegen, sumpfig, dem Meere zu nah und auch ungesund war, und theils weil sich kein frisches Wasser in der Nähe befand. Ich beschloß daher, einen gesünderen und passenderen Platz auszusuchen.
«Vor Allem«, sagte ich mir,»werden folgende Umstände bei dieser Wahl ins Auge zu fassen sein: erstens gesunde Lage und frisches Wasser; sodann Schutz vor der Sonnenhitze; Sicherung vor wilden Menschen oder Thieren; endlich ein freier Ausblick auf die See, damit du, wenn Gott dir ein Schiff auf Sehweite nahe kommen läßt, nicht die Gelegenheit zu deiner Befreiung versäumst. «Denn ich hatte noch keineswegs aufgegeben, auf diese zu hoffen.
Bei dem Suchen nach einer geeigneten Stelle fand ich denn auch eine kleine Ebene neben einem felsigen Hügel, der wie die Fronte eines Hauses steil nach jener hinabfiel, so daß von oben her kein lebendes Wesen so leicht an mich herankommen konnte. An der Seite dieses Felsens war eine Höhlung wie der Eingang zu einem Keller, ohne daß jedoch der Felsen an dieser Stelle wirklich ausgehöhlt gewesen wäre.
Auf dieser grünen Fläche nun, gerade vor der Höhlung, beschloß ich, mein Zelt aufzuschlagen. Der ebene Platz war nicht mehr als hundert Ruthen breit und nur etwa zweimal so lang und fiel an seinem Ende unregelmäßig gegen das Meer hin ab. Er lag auf der Nordnordwestseite des Hügels, so daß ich immer vor der Höhe geschützt war, bis die Sonne, was in diesen Gegenden spät geschieht, von Ostsüdost her schien.
Ehe ich das Zelt errichtete, zog ich vor der Höhlung einen Halbkreis, zehn Ellen im Halbmesser von dem Felsen aus und zwanzig Ellen im Durchmesser von seinem einen Endpunkt bis zum andern gerechnet.
In diesem Halbkreis pflanzte ich zwei Reihen Palissaden, die ich in den Boden schlug, bis sie fest wie Pfeiler standen. Sie ragten fünf und einen halben Fuß von der Erde empor und waren oben zugespitzt. Beide Reihen standen nur sechs Zoll von einander entfernt.
Dann legte ich die aus dem Schiffe abgeschnittenen Tauenden reihenweise zwischen die Pfähle und schlug andere Palissaden, die sich wie Strebepfeiler gegen jene stützten, etwa drittehalb Schuh hoch auf der Innenseite gleich in die Erde. Der so errichtete Zaun war dermaßen stark, daß weder Menschen, noch Thiere ihn hätten durchbrechen oder übersteigen können. Am meisten Mühe bei der ganzen Arbeit kostete es mich, die Pfähle in dem Wald zu fällen, sie an Ort und Stelle zu schaffen und in den Boden einzutreiben.
Zum Eingang in diesen Platz bestimmte ich nicht eine Thür, sondern ich überstieg den Zaun stets mit Hülfe einer kurzen Leiter. Befand ich mich in der Einfriedigung, so zog ich die Leiter hinter mir her und war so, wie ich glaubte, gegen alle Welt sicher verschanzt. Indeß sah ich später ein, daß all diese Vorsichtsmaßregeln unnöthig gewesen waren.
In meine neue Festung brachte ich nun mit unsäglicher Mühe all meine Reichthümer, die Lebensmittel, die Munition, das Werkzeug, und was ich sonst oben erwähnt habe. Sodann errichtete ich mir ein großes Zelt, und zwar um vor dem Regen, der zu gewisser Jahreszeit hier sehr heftig ist, geschützt zu sein, ein doppeltes, d. h. ich spannte über ein kleineres Zelt ein größeres, das ich oben mit einem Stück getheerter Leinwand bedeckte, welche ich unter den Schiffssegeln gefunden hatte.
Statt in dem Bett, das ich ans Land gebracht, zu schlafen, nahm ich von jetzt an mein Nachtlager in einer sehr guten Hängematte, die früher dem Steuermann gehört hatte. In das Zelt brachte ich alle meine Vorräthe, die keine Nässe vertragen konnten; nachdem ich nun meine Güter solchergestalt sämmtlich hereingeschafft, verschloß ich den bis dahin offen gelassenen Eingang und stieg von nun an, wie gesagt, mittels der Leiter aus und ein.
Hierauf machte ich mich daran, ein Loch in den Felsen zu graben, trug alle Erde und Steine, die ich dabei losarbeitete, durch das Zelt und legte sie terrassenförmig um den Zaun, so daß der Erdboden auf dessen Innenseite etwa anderthalb Fuß höher wurde als der äußere. Zugleich gewann ich dabei just hinter meinem Zelt eine Höhlung, die mir für meine Behausung als Keller diente.
Schwere Arbeit und manchen Tag kostete es, bis ich alle diese Dinge zu Stande brachte. Aus der Zwischenzeit sind einige Umstände, die mein Nachdenken in Anspruch nahmen, nachträglich zu erwähnen. Einmal, während ich an meinem Zelt und an der Höhlung arbeitete, erhob sich ein starkes Gewitter. Aus dunklem dicken Gewölk zuckte plötzlich ein Blitz und ein gewaltiger Donnerschlag folgte. Rascher noch wie dieser Blitz überkam mich der Gedanke: O weh, mein Pulver! Das Herz bebte mir bei der Ueberlegung, daß ein einziger Blitzstrahl meinen ganzen Vorrath vernichten könne, von dem, so meinte ich, nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Ernährung meines Lebens gänzlich abhängig sei. Wegen der Gefahr, in der ich selbst dabei schwebte, ängstigte ich mich nicht so sehr, obwohl ein Funke, ins Pulver gerathen, mich ja gleichfalls augenblicklich vernichtet haben würde.
Ich war von jenem Gedanken so betroffen, daß ich, sobald der Sturm vorüber war, alles Andere stehen und liegen ließ, um nur Beutel und Kästen anzufertigen, in denen ich das Pulver vertheilen und in kleinen Partien aufheben wollte; denn ich hoffte, es würde dann wenigstens nicht Alles zu gleicher Zeit vom Feuer verzehrt werden. Diese Arbeit brachte ich in etwa vierzehn Tagen fertig. Ich theilte mein Pulver, das etwa drittehalb Centner wog, in wenigstens hundert Häuflein. Von dem Fäßchen, das Wasser gezogen hatte, fürchtete ich keine Gefahr und hob es daher in meiner neuen Höhle auf, die ich meine Küche nannte. Das Uebrige verbarg ich in Löchern unter dem Felsen, damit es nicht naß werden sollte, und merkte mir aufs Genaueste die Orte, wo ich es aufbewahrt hatte.
Diese Beschäftigung zur Sicherung meines Schießbedarfs unterbrach ich jeden Tag durch Pausen, in denen ich wenigstens einmal mit dem Gewehre ausging, sowohl zum Vergnügen, als auch um zu sehen, ob ich irgend etwas Eßbares erlegen könne. Zu gleicher Zeit beabsichtigte ich hierbei mich möglichst mit dem, was die Insel hervorbrachte, bekannt zu machen. Gleich auf dem ersten dieser Streifzüge entdeckte ich zu meiner großen Befriedigung, daß es hier Ziegen gab; sie zeigten jedoch so viel Schlauheit, Vorsicht und Flinkheit, daß ihnen nur mit der allergrößten Schwierigkeit beizukommen war. Dennoch gab ich die Hoffnung nicht auf, hin und wieder eine davon zu schießen. Bei der Verfolgung ihrer Fährten beobachtete ich, daß sie, wenn sie sich auf dem Felsen befanden und mich im Thale erblickten, in größtem Schreck davon eilten, während sie dagegen im Thale weidend, wenn ich auf dem Felsen stand, mich gar nicht beachteten. Da ich hieraus schloß, daß sie durch die Stellung ihrer Augen genöthigt seien, den Blick zur Erde zu richten und dem zufolge nicht leicht Gegenstände über ihnen wahrnehmen könnten, wendete ich später den Kunstgriff an, ihnen immer von den Felsen aus beizukommen, von wo aus ich dann auch oft Gelegenheit hatte, Beute zu machen.
Bei der ersten Jagd auf diese Thiere erlegte ich eine Geis, die ein Junges säugte. Das that mir nun sehr leid. Als die Alte todt hingefallen war, stand das Lamm ganz still neben ihr, bis ich kam und sie aufhob, worauf das Junge mir nach meiner Einfriedigung folgte. Ich legte die Ziege von den Schultern ab und hob das Lamm über die Einpfählung. Meine Hoffnung, es aufziehen zu können, erfüllte sich nicht, denn da es nicht fressen wollte, mußte ich es gleichfalls tödten und zu meinem Unterhalt verwenden. Die beiden Thiere versahen mich auf lange Zeit mit Fleisch, da ich nur wenig aß und mit meinen Vorräten überhaupt (besonders aber mit dem Brod) so sparsam als möglich umging.
Nachdem ich mich nun fest angesiedelt hatte, fand ich es unumgänglich nöthig, mir einen Platz zur Feuerung und Brennmaterial zu verschaffen. Ehe ich berichte, wie ich dies bewerkstelligte, muß ich zunächst angeben, welche sehr verschiedenartigen Gedanken mir, seit ich die Insel bewohnte, durch den Kopf gingen.
Die Aussicht, die sich vor meinem innern Auge eröffnete, war sehr düster. Ich war an dies Eiland nur durch einen heftigen Sturm, der mich gänzlich von dem beabsichtigten Cours und Hunderte von Meilen weit von den gewöhnlichen Handelswegen verschlagen hatte, getrieben. Daher hatte ich guten Grund anzunehmen, daß ich nach dem Rathschluß des Himmels auf diesem öden Fleckchen Erde in trostloser Weise mein Leben endigen solle.
So oft ich bei diesem Gedanken verweilte, rannen mir die Thränen reichlich über das Gesicht. Zuweilen haderte ich mit der Vorsehung darüber, daß sie ihre Geschöpfe so ins Verderben führe und so ganz und gar unglücklich und hülflos verlassen mache, daß man für die Erhaltung eines solchen Daseins ihr kaum Dank zollen könne.
Immer aber wurden diese Gedanken durch irgend eine andere Betrachtung rasch in eine abweichende Richtung geleitet. Besonders einmal, als ich, das Gewehr in der Hand, am Strande handelnd über meine Lage nachdachte und mir jene vermessene Frage wieder aufstieß, drängte sich mir die Erwägung auf: Ja, es ist wahr, du bist in einer trostlosen Lage, aber gib dir doch Antwort auf dies: Wo sind deine Gefährten? Waret ihr nicht zu Elfen in dem Boot? Wo sind die anderen Zehn? Warum sind denn nicht sie gerettet, und warum bist nicht du untergegangen? Warum hast du allein diese Auszeichnung erfahren? Ist es besser hier zu sein oder dort in den Fluten? Hat man nicht die Pflicht alles Uebel zugleich mit dem, was es Gutes bietet, zu betrachten und mit dem zu vergleichen, was schlimmer sein könnte?
Dann fiel mir ein, wie gut für meinen Unterhalt hier gesorgt sei und in einer wie viel schlimmern Lage ich mich befinden würde, wenn nicht zufällig das Schiff von dem Platz aus, an dem es gescheitert war, so nahe ans Land getrieben worden war, daß ich alle jene Dinge daraus zu holen vermochte; und ferner wie traurig meine Existenz sein würde, wenn sie so geblieben wäre, wie da ich zuerst ans Ufer kam, ohne alle Nothwendigkeiten des Lebens.»Vor Allem aber«(rief ich in lautem Selbstgespräch aus),»was würde ich ohne ein Gewehr, ohne Munition, ohne jedes Arbeitswerkzeug, ohne Kleider und Betten, ohne Zelt oder sonstiges Obdach angefangen haben?«Dann erinnerte ich mich, daß ich jetzt alle diese Dinge reichlich besitze und mich auf dem Wege befinde, mir meinen Unterhalt auch ohne die Gewehre verschaffen zu können, wenn meine Munition einmal verbraucht sein würde. Denn von Anfang an hatte ich darauf gedacht, wie ich für die Zeit, in der nicht nur mein Schießbedarf zu Ende sein, sondern auch meine Kraft und Gesundheit in Verfall gerathen sein werde, für mich sorgen wolle.
Ich bemerke hierzu, daß die Furcht vor der Vernichtung meines Pulvers durch den Blitz damals noch gar nicht in mir aufgetaucht war, daher auch der Gedanke hieran mich bei dem ersten Gewitter um so jäher überfiel.
Nun aber will ich den traurigen Bericht von einem einsamen Dasein, wie es vielleicht nie ein anderer Mensch auf Erden geführt hat, von seinem Beginne an erzählen und in aller Ordnung fortführen.
Wir hatten nach meiner Berechnung den 30. September, als ich den Fuß zuerst auf das fürchterliche Eiland setzte, es war also die Jahreszeit, in welcher bei uns die Sonne in der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche steht. Dort dagegen glühete sie senkrecht über meinem Scheitel. Wie ich durch eine Berechnung, die ich angestellt, zu wissen glaubte, lag meine Insel 9 Grad 22 Minuten nördlich von der Linie.
Nach etwa zwölf Tagen fiel mir ein, daß, wenn ich keine Vorkehrungen träfe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel: ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich kreuzförmig an einen Pfahl befestigte, den ich da, wo ich gelandet war, in die Erde getrieben hatte, die Worte ein:
«Hier bin ich am 30. September 1659 gelandet.«
An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt, an jedem siebenten Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am ersten Tage jedes Monats eine doppelt so große Einkerbung, als diejenigen für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung.
Ich habe hier noch zu bemerken, daß unter den Gegenständen, die ich vom Schiffe gebracht, sich einige an sich ziemlich werthlose, mir aber sehr nützliche, befanden, die ich oben zu erwähnen unterlassen habe: hierzu gehörten unter Anderem Federn, Tinte, Papier, die ich zum Theil aus den Vorräthen des Kapitäns, des Steuermanns, des Stückmeisters und des Zimmermanns entnommen hatte; ferner mehre Kompasse, einige mathematische Instrumente, Quadranten, Ferngläser, Karten und Schifffahrtsbücher. Das Alles hatte ich zusammengerafft, ohne viel darüber nachzudenken, ob ich es jemals brauchen könne oder nicht. Auch drei gute Bibeln waren mir in die Hände gefallen, die mit meinen Sachen von London gekommen waren, und die ich unter meine Reiseeffekten gepackt hatte. Sodann hatte ich einige portugiesische Bücher, darunter drei katholische Gebetbücher und verschiedene andere Schriften, aus dem Wrack mitgenommen und sorgfältig aufbewahrt. Ferner darf ich nicht vergessen, daß an Bord unseres Schiffes ein Hund und zwei Katzen gewesen waren, von denen ich im Verlauf meiner Geschichte noch zu reden haben werde. Denn die beiden Katzen hatte ich mitgenommen; der Hund aber war an dem Tage, nachdem ich die erste Floßfahrt gemacht hatte, von selbst aus dem Schiffe gesprungen und ans Land geschwommen. Er war mir manches Jahr hindurch ein treuer Gefährte, trug und apportirte mir alles Mögliche und leistete mir Gesellschaft, so gut er vermochte. Ihn aber sprechen zu lehren, wollte nicht gelingen, wie große Mühe ich mir auch darum gab.
Wie schon bemerkt, hatte ich auch Federn, Tinte und Papier gefunden. Ich ging damit sehr haushälterisch um, zeichnete aber dennoch, so lange der Vorrath reichte, alle meine Erlebnisse auf das Genaueste auf. Später wurde mir dies unmöglich, da es mir durchaus nicht gelang, Tinte zu bereiten.
Ueberhaupt gebrach es mir, so viel Gegenstände ich auch um mich aufgehäuft hatte, doch an einer Menge sehr wesentlicher Dinge, so zum Beispiel außer der Tinte an einer Hacke und einem Spaten, oder einer Schaufel, um die Erde damit umzugraben; ferner an Nähnadeln, Stecknadeln und Zwirn. Was die Wäsche angeht, so gewöhnte ich mich schnell daran, sie zu entbehren.
Dieser Mangel an Gerätschaften erschwerte natürlich alle meine Arbeiten, und so dauerte es zum Beispiel fast ein Jahr, bis ich die Einzäunung meiner Wohnung beendigt hatte. Die Pfähle, die ich so schwer wählte, als ich sie nur tragen konnte, nahmen viel Zeit zum Fällen, Vorbereiten und Heimschaffen in Anspruch. Zuweilen brauchte ich zwei Tage, um eine von diesen Palissaden fertig an Ort und Stelle zu bringen, und einen dritten Tag, um sie in die Erde zu treiben. Hierzu bediente ich mich anfangs eines schweren Holzstückes, später aber nahm ich dazu eine der eisernen Brechstangen. Trotzdem war es ein mühsames und zeitraubendes Werk, diese Pfähle festzumachen. Aber was lag daran, daß irgend Etwas, das ich verrichtete, Zeit kostete, da ich ja deren in Ueberfluß hatte? Denn so viel ich vorläufig übersah, blieb mir nach Vollendung jener Arbeit nur noch die übrig, die Insel nach Lebensmitteln zu durchsuchen, was ich ohnehin schon jetzt fast an jedem Tage that.
Ich faßte nun meine Lage ernsthaft ins Auge und setzte das Ergebniß schriftlich auf, nicht sowohl um den Bericht Denen zu hinterlassen, die etwa nach mir einmal auf die Insel kommen würden (denn ich hatte wenig Aussicht auf Erben), als um mich dadurch von den Gedanken, die täglich auf mich einstürmten und mir die Seele verdüsterten, zu befreien. Meine Vernunft begann allmählich Herr zu werden über meine verzweifelte Stimmung; ich tröstete mich dadurch, daß ich das Gute meiner Lage dem Schlimmen derselben gegenüberstellte und unparteiisch, gleichwie der Kaufmann sein Soll und Haben, die Freuden gegenüber den Leiden, die ich erfuhr, folgendermaßen verzeichnete:
| Das Böse: | Das Gute: |
|---|---|
| Ich bin auf ein wüstes, trostloses Eiland ohne alle Hoffnung auf Befreiung verschlagen. | Aber ich lebe und bin nicht, wie alle meine Gefährten, ertrunken. |
| Ich bin vereinsamt und von aller Welt geschieden, dazu verurtheilt ein elendes Dasein zu führen. | Jedoch bin ich auch erlesen aus der ganzen Schiffsmannschaft, vom Tode verschont zu bleiben, und der, welcher mir das Leben wunderbar erhalten hat, kann mich auch aus dieser elenden Lage wieder erlösen. |
| Ich bin von der Menschheit getrennt, ein Einsiedler, verbannt vom Menschengeschlechte. | Trotzdem bin ich auf diesem öden Orte nicht Hungers gestorben. |
| Ich habe keine Kleider, um meine Blöße zu bedecken. | Aber ich befinde mich in einem heißen Klima, wo ich Kleider, hätte ich sie, schwerlich tragen könnte. |
| Ich bin ohne Vertheidigungsmittel gegen irgend einen gewaltsamen Angriff von Menschen oder Thieren. | Allein ich bin an eine Insel verschlagen, wo ich keine wilden Thiere zu sehen bekomme, wie ich sie an der afrikanischen Küste sah. Was wäre aus mir geworden, hätte ich dort Schiffbruch gelitten? |
| Ich habe keine Seele, um mit ihr zu reden, oder mich von ihr trösten zu lassen. | Aber Gott schickte durch wunderbare Fügung das Schiff so nahe ans Land, daß ich so viele Dinge daraus holen konnte, die zur Befriedigung meiner Nothdurft selbst dienen oder mir die Mittel zur Befriedigung derselben an die Hand geben werden, so lange ich lebe. |
Alles in Allem ergab diese Uebersicht, daß es zwar kaum eine unglücklichere Lage als die meinige in der Welt gab, daß aber doch negative und positive Umstände darin vorhanden waren, um derentwillen ich dankbar sein mußte. Daraus mag man lernen, daß kein Zustand existirt, der nicht etwas Tröstliches darbietet, und bei dem wir nicht bei der Verzeichnung des Guten und Schlimmen immer dem Debet gegenüber auch Etwas auf die Seite des Credit zu setzen haben.
Nachdem ich mich auf solche Weise mit meinem Zustand einigermaßen ausgesöhnt, dagegen aber die Hoffnung, auf der See ein Schiff zu erspähen, aufgegeben hatte, begann ich, mir das Leben so angenehm einrichten, als es nur möglich war.
Meine Wohnung habe ich bereits beschrieben. Sie bestand, wie erwähnt, aus einem Zelt zu Füßen eines Felsens, das mit eigner starken Einzäunung von Pfählen und Tauen umgeben war. Ich durfte diese wohl eine Mauer nennen, besonders nachdem ich eine Art Wall von Erdstücken, etwa zwei Fuß hoch, an der Außenseite auf derselben aufgeführt und nach Ablauf von etwa anderthalb Jahren von diesem Wall aus Holzstücke gegen den Felsen gestemmt und sie mit Baumzweigen und Aehnlichem bedeckt hatte, um den Regen abzuhalten, welcher während gewisser Jahreszeiten sehr heftig war.
Meine Güter hatte ich sämmtlich in diese Einhegung und die im Hintergrund derselben befindliche Höhlung gebracht. Anfangs hatten sie dort einen unordentlichen Haufen gebildet und mir allen Platz weggenommen, so daß ich kaum mich hatte rühren können. Daher hatte ich mich daran gemacht, die Höhlung zu erweitern und tiefer in den Felsen einzudringen. Dieser bestand aus lockerem Sandstein und gab leicht nach. Da ich mich gegen wilde Thiere doch hinlänglich geschützt glaubte, arbeitete ich mich ganz durch den Felsen durch und bekam so eine Thür nach Außen hin, durch die ich meine Festung verlassen konnte. So hatte ich nicht nur einen Aus- und Eingang, sondern auch einen größern Behälter für meine Besitztümer bekommen.
Ich begann sodann mir diejenigen Gegenstände anzufertigen, die mir die notwendigsten schienen, nämlich vor Allem einen Tisch und einen Stuhl, da ich ohne diese nicht einmal die geringe Behaglichkeit, die mir auf der Welt geboten war, zu genießen vermocht haben würde. Denn ohne Tisch hätte ich weder schreiben, noch essen, noch andere dergleichen Geschäfte mit einiger Bequemlichkeit vornehmen können.
Hierbei kann ich nicht umhin zu bemerken, daß, da die Vernunft die Wurzel und der Ursprung der Mathematik ist, Jedermann durch vernünftige Berechnung und Ausmessung der Dinge binnen kurzer Zeit ein Meister in allen mechanischen Künsten zu werden vermag. Ich hatte in meinem früheren Leben niemals Handwerkszeug zwischen den Fingern gehabt, und trotzdem erkannte ich jetzt bald, daß es mir durch Arbeit, Ausdauer und Eifer möglich sein würde, Alles, was ich brauchte, wenn ich nur das nöthige Geräthe gehabt hätte, selbst anzufertigen. Indeß machte ich eine Menge Dinge auch ohne Handwerkszeug. Einige lediglich mit Hobel und Hackbeil, und zwar waren das Gegenstände, die wohl nie früher auf solche Art verfertigt waren. Zum Beispiel, wenn ich ein Brett nöthig hatte, blieb mir Nichts übrig, als einen Baum zu fällen und ihn mit der Axt von beiden Seiten so lange zu behauen, bis er dünn wie ein Brett war, worauf ich ihn dann mit dem Hobel glättete. Freilich konnte ich auf diese Weise aus einem ganzen Baum nur ein einziges Brett erhalten; doch da half Nichts weiter als die Geduld, und wenn auch die Anfertigung eines einzigen solchen Gegenstandes mich eine enorme Menge Zeit und Arbeit kostete, so war ja Arbeit und Zeit für mich von geringem Werth, und es kam Nichts darauf an, ob ich sie so oder so verwendete.
Zunächst machte ich mir aus den kurzen Latten, die ich auf meinem Floße aus dem Schiffe geholt hatte, Tisch und Stuhl. Ferner brachte ich, nachdem einige Bretter in der oben angegebenen Weise fertig geworden waren, große Fächer von anderthalb Fuß Breite übereinander an der Seitenwand meiner Höhle an, um alle meine Werkzeuge, Nägel und eiserne Geräthe darauf zu legen und Alles zur größeren Bequemlichkeit an einer bestimmten Stelle zu haben. Hierauf schlug ich Pflöcke in die Felswand, um mein Gewehr und Anderes dergleichen daran zu hängen. Meine Höhle sah jetzt aus wie ein großes Magazin von allen unentbehrlichen Dingen, und ich hatte Jegliches so zur Hand, daß diese Ordnung mir ein großes Vergnügen gewährte.
Von nun an begann ich auch ein Tagebuch zu führen und darin meine täglichen Beschäftigungen zu verzeichnen. Früher hatte es mir zu sehr an Ruhe, besonders an Gemüthsruhe gefehlt, und mein Journal würde in dieser Zeit mit vielen unbedeutenden Dingen angefüllt worden sein. Da hätte ich zum Beispiel vom 30. September Nichts zu berichten gehabt, als etwa: Nachdem ich gelandet und dem Tod des Ertrinkens entronnen war, bin ich, nachdem ich zuvor eine ganze Menge Salzwasser, das ich verschluckt, gebrochen hatte und wieder ein wenig zu mir gekommen war, statt Gott für meine Errettung zu danken, mit dem Ausruf:»Ich bin verloren! ich bin verloren!«händeringend am Strand auf- und abgelaufen, bis ich müde und matt mich auf die Erde zur Ruhe legen mußte, wo ich aber nicht schlafen konnte, aus Furcht gefressen zu werden.
Einige Tage nachdem ich schon Alles vom Schiff geholt hatte, konnte ich es nicht unterlassen, doch wieder einmal die Spitze des kleinen Berges zu ersteigen und auf die See hinauszuschauen, in der Hoffnung, ein Schiff zu erblicken. Wirklich bildete ich mir auch ein, in großer Entfernung ein Segel zu erspähen. Ich täuschte mich lange mit dieser Hoffnung und blickte starr auf das Meer, bis ich fast erblindete. Dann gab ich es auf, setzte mich nieder, weinte wie ein Kind und vergrößerte so durch eigne Thorheit mein Elend.
Erst nachdem ich diesen Kummer einigermaßen überwunden, meine Niederlassung beendigt und mein Hauswesen eingerichtet hatte, und Alles um mich so hübsch wie möglich geordnet war, begann ich mein Tagebuch. Ich will den kärglichen Inhalt desselben (ich konnte es nämlich nur so lange fortsetzen, bis mir die Tinte ausging) hier mittheilen, obwohl dasselbe viele Dinge wiederholt, die schon berichtet sind.
Tagebuch.
Den 30. September 1659. Ich armer unglückseliger Robinson Crusoe habe bei einem fürchterlichen Sturm Schiffbruch gelitten und bin auf diese traurige Insel gerathen, der ich den Namen» das Eiland der Verzweiflung «gegeben habe. Alle meine Schiffsgefährten sind ertrunken, und ich selbst bin nur mit Noth dem Tode entronnen.
Nachdem ich gelandet war, habe ich den Rest des Tages dazu verwendet, meine trostlose Lage zu erwägen und darüber nachzudenken, daß ich weder Nahrung, Wohnung, Kleidung, Waffen, noch irgend einen Zufluchtsort habe. Es gebrach mir an jedem Trost und ich sah Nichts als Verderben um mich her. Ich erwartete, entweder von den wilden Thieren gefressen, oder von wilden Menschen ermordet zu werden, oder Hungers sterben zu müssen. Als die Nacht kam, erstieg ich einen Baum, aus Furcht vor den Bestien. Es regnete die ganze Nacht hindurch, dennoch aber erfreute ich mich eines gesunden Schlafes.
Den 1. Oktober. Am Morgen sah ich mit großer Verwunderung, daß das Schiff von der Flut dem Ufer weit näher getrieben war, als es am vorigen Tage gelegen hatte. Es war mir ein Trost, es aufrecht stehen und unzertrümmert zu sehen. Denn ich hoffte, wenn sich der Wind lege, könnte ich an Bord gehen, um Lebensmittel und sonstige nothwendige Gegenstände holen zu können. Andererseits erneuete aber der Anblick auch meinen Schmerz um den Verlust der Kameraden, die, so schien es mir, wenn sie an Bord geblieben wären, das Schiff hätten retten können, oder wenigstens nicht ertrunken sein würden. Wäre die Mannschaft gerettet worden, so hätten wir vielleicht aus den Trümmern des Schiffes uns ein Boot bauen und in demselben irgend ein anderes Fleckchen Erde erreichen können. Ich verbrachte einen großen Theil des Tages damit, mich durch solche Gedanken zu quälen. Endlich aber, als ich das Schiff beinahe auf dem Trockenen liegen sah, ging ich am Strande so nahe wie möglich an es heran, schwamm dann bis zu demselben und begab mich an Bord. Auch an diesem Tage regnete es unaufhörlich, dabei war es jedoch gänzlich windstill.
Vom 1. bis zum 24. Oktober. Alle diese Tage wendete ich nur zu verschiedenen Fahrten nach dem Schiff an, aus welchem ich, jedesmal die Zeit der Flut benutzend, auf Flößen ans Land brachte, was ich nur vermochte. Auch in dieser Zeit währte der Regen, wiewohl zuweilen von schönem Wetter unterbrochen, fort. Es scheint dies die regnerische Jahreszeit zu sein.
Den 24. Oktober. Mein Floß schlug um und mit ihm meine ganze Ladung. Doch geschah es in seichtem Wasser, und da die Gegenstände schwer waren, bekam ich viele von ihnen während der Ebbe wieder.
Den 25. Oktober. Es regnete die ganze Nacht und den ganzen Tag über; einige Male traten auch starke Windstöße ein. Während eines solchen brach das Schiff in Stücke und es war Nichts mehr davon zu sehen außer dem Rumpf, und auch den erblickte ich nur bei niedrigem Wasser. Ich verbrachte den Tag damit, meine Habe in Sicherheit zu bringen, damit sie der Regen nicht verderbe.
Den 26. Oktober. Ich wanderte heute fast den ganzen Tag am Strande umher, um einen Platz für meine Niederlassung zu finden. Besonders war ich darauf bedacht, mich für die Nacht vor den Angriffen der wilden Thiere und Menschen zu sichern. Gegen Abend traf ich auf einen geeigneten Platz unter einem Felsen. Ich markirte einen Halbkreis für meine Wohnung, die ich mit einem Wall, gleichsam einer Festungsmauer, aus einer doppelten Reihe von Palissaden zu umgeben beschloß, welche letztere ich mit Taustücken zu verbinden gedachte.
Vom 26. bis zum 30. Oktober. Ich plagte mich sehr ab, indem ich all meine Habseligkeiten in die neue Wohnung brachte. Unterdessen regnete es eine Zeitlang heftig.
Den 31. Oktober ging ich des Morgens mit meinem Gewehr auf der Insel umher, um zu jagen und das Land auszukundschaften. Ich erlegte eine Ziegengeis und das Junge folgte mir nach meiner Wohnung, wo ich es später schlachten mußte, da es nicht fressen wollte.
Den 1. November. Ich schlug mein Zelt unter dem Felsen auf und schlief dort die Nacht zum ersten Mal. Ich habe es so groß als möglich gemacht, um meine Hängematte darin an Pfählen aufhängen zu können.
Den 2. November trug ich alle meine Kisten und Bretter und die Holzstücke, aus denen ich die Flöße verfertigt hatte, zusammen und bildete aus ihnen, etwas nach Innen zurück von der für die Umzäunung bezeichneten Linie, eine Art Zaun um mich her.
Den 3. November. Ich ging mit dem Gewehr aus und schoß zwei entenartige Vögel, die mir eine vortreffliche Mahlzeit lieferten. Am Nachmittag machte ich mich daran, mir einen Tisch zu verfertigen.
Den 4. November. Die Frühstunden verwendete ich dazu, meine Arbeitszeit regelmäßig einzutheilen. Die Morgenzeit bestimmte ich zu einem zwei- bis dreistündigen Ausgang mit dem Gewehr, vorausgesetzt, daß es nicht regnet. Hierauf will ich bis etwa eilf Uhr arbeiten und dann verzehren, was ich gerade Eßbares habe. Von zwölf bis zwei Uhr gedenke ich mich zum Schlafe niederzulegen, da das Wetter ungemein heiß ist, der Abend soll dann wieder für die Arbeit bestimmt sein. (Die Arbeitszeit an diesem und den nächsten Tagen verwendete ich gänzlich auf die Anfertigung meines Tisches, denn es ging mir anfangs noch langsam mit der Arbeit. Zeit und Nothwendigkeit machten mich jedoch bald darauf zu einem perfekten Naturhandwerker, wie es in gleicher Lage wohl mit jedem Andern geschehen würde.)
Den 5. November. Heute ging ich mit der Flinte und meinem Hunde aus und erlegte eine wilde Katze. Ihr Fell war sehr schön, aber das Fleisch ungenießbar. Ich zog ihr, wie ich es mit allen erlegten Thieren zu thun pflege, das Fell ab und bewahrte es auf. Als ich am Strande zurück ging, sah ich mancherlei Seevögel, die ich nicht kannte. Erstaunt und fast erschrocken war ich über den Anblick mehrer Robben, die, während ich sie anstarrte, ohne gleich zu wissen, was es für Thiere seien, ins Meer eilten und mir für diesmal entrannen.
Den 6. November. Nach meinem Morgenspaziergang beendigte ich den Tisch, doch nicht zu meiner Zufriedenheit; bald jedoch lernte ich so Etwas besser machen.
Den 7. November. Es hat sich jetzt schönes Wetter eingestellt. Den 7. 8. 9. und 10. und einen Theil des 12. (denn der 11. war ein Sonntag) verwendete ich dazu, um mir einen Stuhl zu verfertigen. Mit großer Mühe brachte ich auch ein leidliches Gestell zu Stande; doch gefiel es mir nicht, obwohl ich es schon während der Arbeit mehre Male wieder in Stücken zerschlagen und aufs Neue begonnen hatte.
Anmerkung. Nach kurzer Zeit versäumte ich die Sonntage einzuhalten, da ich vergessen hatte, die Einschnitte an meinen Pfosten zu machen, und daher bald nicht mehr die Tage unterscheiden konnte.
Den 13. November. Heute regnete es, was mich ungemein erfrischte und auch die Erde abkühlte. Ein Gewitter aber, von dem der Regen begleitet war, erschreckte mich furchtbar, indem es mich um mein Pulver besorgt machte. Sobald das Unwetter vorüber war, beschloß ich, meinen Pulvervorrath in möglichst viele und kleine Partien zu vertheilen und ihn so außer Gefahr zu bringen.
Den 14. 15. und 16. November. Diese drei Tage verwendete ich dazu, kleine viereckige Schachteln oder Kästen zu machen, deren jede ein bis zwei Pfund Pulver faßte. In diesen hob ich meinen Pulvervorrath, und zwar jeden Behälter möglichst entfernt von dem andern, auf. An einem dieser Tage schoß ich einen großen Vogel, der mir vortreffliche Speise lieferte, mir aber unbekannt war.
Den 17. November. Heute begann ich hinter meinem Zelt in den Felsen zu graben, um mir größere Bequemlichkeit zu verschaffen.
Anmerkung. Dreierlei entbehrte ich sehr bei dieser Arbeit, nämlich eine Hacke, eine Schaufel und einen Schiebkarren oder Korb. Daher unterbrach ich meine Arbeit und überlegte, wie ich diesem Mangel abhelfen könnte. Statt der Hacke bediente ich mich der eisernen Brechstangen, die sich, obwohl sie schwer waren, doch dazu eigneten. Eine Schaufel oder ein Spaten war mir dagegen so unerläßlich nöthig, daß ich ohne sie Nichts anfangen konnte. Doch sah ich vorläufig durchaus nicht ab, wie ich mir solch ein Ding verschaffen sollte.
Den 18. November. Am nächsten Tag fand ich beim Durchstreifen des Waldes einen Baum von der Art, die in Brasilien wegen der Härte ihres Holzes Eisenbäume genannt werden. Von diesem hieb ich, wobei ich aber beinahe meine Art verdorben hätte, mit großer Mühe ein Stück ab und brachte es gleichfalls unter großer Anstrengung, da es sehr schwer war, heim. Die ungemeine Härte des Holzes machte lange Zeit erforderlich, bis ich es endlich in Spatenform gestaltet hatte. Der Handgriff war genau geformt wie der der unsrigen in England, die breite Seite am Fuß entbehrte jedoch der eisernen Bekleidung. Trotzdem leistete es mir gute Dienste.
Ich vermißte nun noch einen Korb oder einen Schiebkarren. Einen Korb vermochte ich durchaus nicht zu Stande zu bringen, da es mir an Zweigen fehlte, die sich zu Flechtarbeit eigneten; wenigstens hatte ich bis jetzt noch keine solchen gefunden. Was dagegen den Schiebkarren angeht, so glaubte ich wohl alle Theile eines solchen herausbringen zu können, bis auf das Rad. Wie ich aber damit zu Stande kommen sollte, davon hatte ich nicht den mindesten Begriff. Ebenso unmöglich war mir aber auch die eiserne Hülse, in welcher die Axe laufen mußte, anzufertigen. Ich gab daher das ganze Unternehmen auf und machte mir, um die Erde aus meiner Höhle zu schaffen, eine Art von Lehmkübel, wie ihn die Maurer zum Fortschaffen des Mörtels benutzen. Dies war minder schwierig als die Anfertigung des Spatens, und dennoch nahmen mich beide Arbeiten und der vergebliche Versuch, einen Schiebkarren zu verfertigen, vier volle Tage in Anspruch, natürlich abgerechnet meine Morgenspaziergänge mit dem Gewehr, die ich nur ausnahmsweise unterließ und von denen ich selten heimkehrte, ohne etwas Eßbares erbeutet zu haben.
Den 23. November. Nach Anfertigung dieser Werkzeuge nahm ich meine frühere Arbeit wieder auf und verwendete achtzehn Tage gänzlich auf Ausweitung und Vertiefung meiner Höhle, damit diese meine Habe bequemer fassen könne.
Anmerkung. Mein Hauptzweck bei diesem Unternehmen war, einen Raum zu bekommen, der mir als Magazin, Küche, Eßzimmer und Keller diene. Ich wohnte nämlich für gewöhnlich in meinem Zelt; nur während der feuchten Jahreszeit nöthigte mich der heftige Regen, da ich sonst völlig durchnäßt worden wäre, dasselbe zu verlassen. Dies bewog mich später, den ganzen Platz vor der Felswand mit Pfählen, in der Form von Dachsparren, zu bedecken. Diese stützten sich gegen den Felsen und ich bedeckte sie mit Zweigen und breiten Baumblättern wie mit einem Strohdach.
Den 10. December. Ich glaubte schon meine Höhle vollendet zu haben, als plötzlich eine große Menge Erde von der Decke an der einen Seite herabstürzte, was mich nicht wenig erschreckte. Und zwar mit Recht, denn wäre ich gerade unter jener Stelle gewesen, so hätte ich keinen Todtengräber nöthig gehabt. Dies Mißgeschick verursachte mir wieder eine große Menge Arbeit, da ich die abgefallene Erde zu entfernen und, was wichtiger war, die Höhlendecke zu stützen hatte, damit ich ein Herunterfallen derselben nicht mehr zu besorgen brauchte.
Den 11. December. Ich machte mich heute gleich an diese Aufgabe und richtete unter dem Gewölbe zwei Pfeiler, die ich mit zwei Querbrettern kreuzte, auf. Am nächsten Tag war ich hiermit zu Ende, fügte dann aber noch weitere Pfeiler und Bretter dazu und hatte so binnen einer Woche das Dach befestigt, und die reihenweise eingeschlagenen Pfosten dienten mir zugleich dazu, meine Wohnung in einzelne Räume abzutheilen.
Den 17. December. Von diesem Tag bis zum 20. gab ich mich damit ab, Gefächer aufzurichten und Nägel in die Pfosten zu schlagen, um Alles daran aufzuhängen, was sich dazu eignete. Jetzt fing ich endlich an, in meiner Behausung einigermaßen Ordnung zu haben.
Den 20. December. Ich trug Alles, was dahin gehörte, in den Keller und schlug kleine Bretter, wie ein Gesims, auf, um meine Lebensmittel darauf zu legen. Als jedoch meine Bretter auf die Neige gingen, machte ich mir noch einen zweiten Tisch, um allerlei auf denselben stellen zu können.
Den 24. December. Es regnete die ganze Nacht, sowie den ganzen Tag, und ich konnte daher nicht ausgehen.
Den 25. December. Unaufhörlicher Regen.
Den 26. December. Der Regen hatte aufgehört. Die Erde war stark abgekühlt und die Temperatur sehr angenehm.
Den 27. December. Ich erlegte eine junge Geis und lähmte eine andere, die ich fing und an einem Strick nach Hause führte; hier verband und schiente ich ihr das zerbrochene Bein.
Nota bene. Ich sorgte für das Thier so, damit es am Leben bleibe. Das Bein heilte und wurde so gerade wie vorher. Durch mein Füttern machte ich das Thier zahm, es weidete auf dem kleinen grünen Platz vor meiner Thür und lief niemals fort. Jetzt kam mir zum ersten Mal der Gedanke, Thiere aufzuziehen und zu zähmen, um davon zu leben, wenn ich einmal meinen Schießbedarf verbraucht haben würde.
Den 28. bis 31. December. Große Hitze und völlige Windstille, so daß ich nur am Abend zur Jagd ausgehen konnte. Die Tage verbrachte ich damit, alle meine Sachen zu ordnen.
Den 1. Januar. Immer noch große Hitze, doch ging ich in der Frühe und Abends mit meinem Gewehr aus; die Zwischenzeit über lag ich still zu Hause. An diesem Abend ging ich tiefer hinein in die Thäler, die nach dem Mittelpunkt der Insel hin liegen, und fand dort eine Menge Ziegen, denen ich aber, weil sie so scheu waren, nicht beikommen konnte. Ich beschloß daher, zu versuchen, ob es nicht gelingen werde, sie mit dem Hunde zu jagen.
Den 2. Januar. Sogleich am nächsten Tag stellte ich diesen Versuch an. Ich hatte mich jedoch verrechnet, denn die Ziegen kehrten sich alle mit dem Gehörn gegen den Hund, und er hütete sich wohl, ihnen zu nahe zu kommen.
Den 3. Januar. Heute begann ich mein Gebiet einzuzäunen und machte, da ich noch immer in der Furcht lebte, von Jemandem angegriffen zu werden, die Umhegung so dick, fest und stark, wie nur möglich.
Anmerkung. Da ich die Einzäunung früher beschrieben habe, so übergehe ich, was darüber in dem Tagebuch gesagt ist. Es genügt, zu bemerken, daß ich nicht weniger als vom 3. Januar bis zum 14. April mit der Vollendung derselben beschäftigt war, wiewohl sie nur vierundzwanzig Ellen in der Länge (von einem Ende des Felsens bis zum andern gemessen) und acht Ellen in der Tiefe (von der Thür der Höhle, als dem Mittelpunkt, aus gerechnet) maß.
Diese ganze Zeit über arbeitete ich sehr angestrengt, wobei mir jedoch der Regen viele Tage, ja einigemal ganze Wochen hindurch hinderlich war. Doch hielt ich mich nicht vollkommen sicher, bis ich die Einhegung vollendet. Man glaubt kaum, was für eine unbeschreibliche Arbeit sie mir machte; besonders war dies der Fall mit dem Herbeischaffen der Pfähle aus dem Walde und dem Einschlagen derselben in die Erde.
Als der Wall beendigt war, hielt ich ihn für so dicht, daß, wenn Besucher auf die Insel kommen sollten, sie Nichts einer menschlichen Wohnung Aehnliches dort entdecken würden. Daß ich mit dieser Ansicht Recht hatte, wird sich später bei einer merkwürdigen Gelegenheit zeigen.
Auch während dieser Beschäftigung machte ich täglich meinen Jagdausflug in die Wälder, das heißt, so oft es der Regen zuließ. Hierbei entdeckte ich häufig erfreuliche Dinge. Besonders gehört dahin, daß ich eine Art wilder Tauben fand, die nicht wie die Waldtauben auf Bäumen, sondern wie die Haustauben in Felslöcher bauten. Ich nahm einige Junge mit mir und bemühte mich sie aufzuziehen. Als sie jedoch älter wurden, flogen sie sämmtlich fort, da ich ihnen nicht ausreichendes Futter geben konnte. Indeß fand ich oft solche Nester und holte mir dann die Jungen heraus, die ich mir sehr wohl schmecken ließ.
Kapitel 5
Bei der Ordnung meines Hauswesens fühlte ich aufs Neue, daß mir verschiedene Dinge doch noch sehr abgingen. Einige darunter glaubte ich niemals machen zu können, und bezüglich mehrer ist das auch in der That der Fall gewesen. Zum Beispiel brachte ich es durchaus nicht fertig, eine Tonne zu bauen. Ich hatte mehre kleine Fässer, wie schon oben erwähnt ist, aber es gelang mir nicht, wiewohl ich viele Wochen darauf verwendete, nach dem Modell derselben ein neues zu machen. Weder vermochte ich den Boden gehörig einzulassen, noch konnte ich die Dauben so nahe an einander fügen, daß sie wasserdicht wurden. Ich gab daher die ganze Sache auf. Ferner vermißte ich sehr Lichter. Sobald es dunkel wurde, was gewöhnlich um sieben Uhr geschah, mußte ich zu Bette gehen. Jetzt wünschte ich mir oft den Klumpen Bienenwachs, aus dem ich bei meiner Flucht von Afrika mir Kerzen verfertigt hatte, zurück, aber der war längst nicht mehr vorhanden.
Um jenem Mangel abzuhelfen, fand ich kein anderes Auskunftsmittel, als daß ich, so oft ich eine Ziege erlegt hatte, das Fett sammelte und mir mittels eines kleinen Gefäßes von Lehm, das ich in der Sonne trocknete und mit einem Docht aus Taugarn versah, eine Lampe verfertigte. Sie leuchtete, wenn auch nicht ganz, doch fast so hell wie eine gewöhnliche Kerze. Während dieser Beschäftigung fiel mir, als ich einmal unter meinen Sachen kramte, ein Säckchen wieder in die Hand, das, wie früher bemerkt wurde, mit Korn zum Futter des Geflügels gefüllt gewesen war. Der geringe Rest des Korns war von den Ratten im Schiff gefressen worden, und ich hatte nur Hülsen und Staub in dem Säckchen bemerkt; da ich dieses zu einem andern Zweck benutzen wollte (ich glaube bei der Vertheilung des Pulvers), so hatte ich die Kornhülsen an die Seite meiner kleinen Festung unter dem Felsen ausgeschüttet.
Es war kurz vor dem großen Regen, dessen ich gedachte, geschehen, daß ich diesen Kehricht weggeworfen. Ich hatte mit keinem Gedanken mehr daran gedacht, als ich etwa einen Monat später einige grüne Halme aus dem Boden ragen sah, die ich anfangs für eine früher nicht bemerkte Pflanze hielt. Aber wie war ich erstaunt, als ich kurze Zeit darauf sich zehn bis zwölf Aehren daraus entwickeln sah, die ich als vollkommen gute grüne Gerste der europäischen oder vielmehr der englischen Art erkannte.
Ich vermag meine Empfindungen bei dieser Entdeckung nicht zu beschreiben. Bisher hatte ich überhaupt keine religiöse Weltanschauung gehabt; nur wenige Ideen dieser Art waren in meinem Kopf vorhanden gewesen, Alles, was mir widerfahren, hatte ich als Zufall oder, wie man so obenhin spricht, als Gottes Fügung angesehn. Um die Zwecke der Vorsehung und ihre Anordnung der Dinge dieser Welt war ich gänzlich unbekümmert gewesen. Als ich jedoch nun in einem Klima, von dem ich wußte, daß es sich nicht für Getreide eigne, Gerste wachsen sah, ohne eine Ahnung zu haben, wie sie dahin gekommen sei, wurde ich höchlichst betroffen, und ich begann zu glauben, Gott habe durch ein Wunder diese Aehren sprießen lassen, ohne daß ein Samenkorn vorhanden gewesen sei, und zwar lediglich, damit sie in dieser trostlosen Einöde mir zur Nahrung dienten.
Dieser Gedanke bewegte mir das Herz zu Thränen, und ich fing an mich selig zu preisen, daß um meinetwillen solch ein Naturwunder geschehen sei. Noch mehr stieg meine Ueberraschung, als ich in der Nähe, dem Fels entlang, auch noch andere Halme erblickte, die ich von meinem Aufenthalt in Afrika her als Reisähren kannte. Da ich nicht zu glauben wagte, diese seien auch nur zu meiner Erhaltung von der Vorsehung hierhergebracht, indem ich vielmehr überzeugt war, daß dergleichen noch mehr sich hier befinde, suchte ich auf dem ganzen mir bekannten Theil der Insel, in allen Ecken und unter jedem Felsen nach weiteren Aehren, aber ich entdeckte keine. Endlich fiel mir ein, daß ich ja den Sack mit dem Hühnerfutter an jener Stelle ausgeschüttet hatte, und nun begann die Sache ihr Wunderbares zu verlieren. Ich muß bekennen, auch meine Dankbarkeit für die göttliche Fügung fing an, durch die Entdeckung, daß das Ganze ein gewöhnliches Ereigniß sei, sich zu mindern; wiewohl ich für ein Ereigniß, das ja gerade so seltsam und unerwartet wie ein Wunder war, nicht minder hätte dankbar sein sollen. War es denn nicht wirklich ein Werk der Vorsehung, daß zehn oder zwölf Getreidekörner unversehrt blieben, als die Ratten alles Uebrige vernichteten; wie auch das, daß ich diese Körner gerade an der bestimmten Stelle ausschütten mußte, wo sie in dem Schatten des Felsens sofort aufgingen, während sie, hätte ich sie irgend anderswo ausgestreut, in dieser heißen Jahreszeit hätten verdorren und umkommen müssen?
Wie man sich denken kann, bewahrte ich die Aehren, sobald sie reif geworden (es geschah gegen Ende des Juni), sorgfältig auf. Ich beschloß, die darin enthaltenen Körner wieder auszusäen, und hoffte dadurch bald eine hinreichende Menge Frucht zu erhalten, um Brod daraus bereiten zu können. Jedoch durfte ich erst im vierten Jahre mir erlauben, von diesem Korn zu essen, und selbst dann nur sparsam, wie ich seiner Zeit berichten werde. Ich verlor nämlich die ganze erste Aussaat, weil ich nicht die geeignete Zeit beobachtet und sie unmittelbar vor den trockenen Monaten ausgestreut hatte, so daß sie nicht aufkam, oder wenigstens nicht in erwünschter Menge Frucht trug.
Außer der Gerste fand ich, wie erwähnt, auch zwanzig bis dreißig Reishalme, die ich mit gleicher Sorgfalt aufhob und in gleicher Weise benutzte. Ich entdeckte nämlich eine Methode, die Körner zu kochen, statt das Mehl davon zu backen, wiewohl mir auch das Letztere später gelang. — Doch ich will jetzt wieder zu meinem Tagebuch zurückkehren.
Diese drei oder vier Monate hindurch arbeitete ich überaus angestrengt, um meine Einzäunung fertig zu bekommen. Am 14. April vollendete ich sie. Um in dieselbe zu gelangen, bediente ich mich nicht einer Thüre, sondern stieg mittels einer Leiter über die Einfriedigung, damit man von der Außenseite meiner Behausung Nichts von dieser gewahr werden sollte.
Den 16. April. Heute wurde ich mit der Leiter fertig. So oft ich diese benutzt hatte, zog ich sie mir nach und legte sie im Innern der Umfriedigung nieder, so daß ich, wenn ich mich in meiner Wohnung befand, gegen Außen gänzlich abgeschlossen war.
Schon am nächsten Tage aber, nachdem ich die Einfriedigung vollendet, wäre fast meine ganze Arbeit über den Haufen geworfen worden und ich selbst beinahe umgekommen. Die Sache verhielt sich so. Ich war hinter meinem Zelte gerade am Eingang in die Höhle beschäftigt, als mich ein unerwartetes Ereigniß furchtbar erschreckte. Ich sah nämlich die Erde, welche die Decke meiner Höhle bildete, mit Einem Mal sich loslösen und von dem Gipfel des Hügels über mir herabstürzen. Zwei der Pfähle, mit denen ich die Wölbung meiner Höhle gestützt hatte, krachten mit fürchterlichem Lärm zusammen. Ich war aufs Aeußerste bestürzt, hatte jedoch keine Ahnung von der wirklichen Ursache, indem ich glaubte, meine Höhlendecke stürze wieder in derselben Weise ein, wie es mit einem Theil derselben schon einmal geschehen war. Aus Furcht, lebendig begraben zu werden, rannte ich nach meiner Leiter und glaubte mich nicht eher im Sichern und vor den herabstürzenden Felsen geschützt, als bis ich über meine Palissadirung geklettert war.
Kaum hatte ich den Fuß auf den Boden gesetzt, als ich erkannte, daß ein schreckliches Erdbeben die Ursache der Erschütterung war. Der Erdboden, auf dem ich stand, wurde nämlich dreimal in Zwischenräumen von je etwa acht Minuten durch solche Stöße erschüttert, daß sie das festeste Gebäude umgeworfen haben würden. Ein großes Stück der Felsspitze, die ungefähr eine halbe Meile von mir entfernt über das Ufer ragte, stürzte mit einem so entsetzlichen Getöse, wie ich es im Leben nicht gehört, in das Meer. Auch dieses befand sich in heftiger Bewegung, und wie mir schien, waren die Stöße unter dem Wasser noch stärker als die auf der Insel.
Ich erschrak so sehr, denn ich hatte dergleichen nie erlebt und auch niemals nur davon erzählen gehört, daß ich wie todt vor Bestürzung war. Die Erderschütterung machte mir übel, als ob ich seekrank sei. Erst der Lärm des herabstürzenden Felsens erweckte mich wieder aus meiner Betäubung und ich glaubte jetzt nichts Anderes, als der Hügel werde zusammensinken und mein Zelt nebst meiner ganzen Habe begraben, ein Gedanke, der mir abermals das Herz erbeben machte.
Nachdem aber der dritte Stoß vorüber war und ich einige Zeit hindurch Nichts verspürte, begann ich wieder Muth zu schöpfen. Dennoch wagte ich noch nicht wieder über meine Einzäunung zu steigen, aus Furcht verschüttet zu werden. Ich saß still und trostlos auf der Erde, ohne zu wissen, was ich anfangen sollte. Diese ganze Zeit über kam mir nicht der geringste religiöse Gedanke in den Sinn. Nur das gewöhnliche» Gott sei mir gnädig «ging über meine Lippen, und auch das wiederholte ich nicht mehr, sobald das Ereigniß vorüber war.
Während ich so saß, sah ich, wie der Himmel sich mit Wolken überzog, als ob ein Regen drohe. Nach und nach erhob sich der Wind, und in weniger als einer halben Stunde tobte ein fürchterlicher Sturm. Die See war plötzlich mit Schaum bedeckt, die Braudung tobte am Ufer, starke Bäume wurden entwurzelt. Erst nach drei Stunden begann der Sturm sich zu mildern, und nach weiteren zwei Stunden wurde es dann vollkommen windstill und fing an stark zu regnen. Diese ganze Zeit über saß ich niedergeschlagen und furchtsam auf der Erde. Plötzlich aber fiel mir ein, daß dieser Wind und Regen wohl die gewöhnlichen Folgen des Erdbebens sein möchten, und daß dieses daher aufgehört habe. Jetzt erst erwachten meine Lebensgeister wieder. Der Regen trieb mich in meine Behausung zurück, wo ich mich im Zelt niedersetzte, bis mich der heftige Regen in die Höhle zu gehen zwang, obgleich ich noch immer nicht von der Furcht befreit war, sie werde mir über dem Kopfe zusammenstürzen.
Dort zwangen mich die Regengüsse, rasch eine Arbeit in Angriff zu nehmen. Ich erkannte nämlich die Notwendigkeit, eine Rinne zu machen, damit das Wasser einen Ausweg aus der Höhle nehmen könne. Als ich nach einiger Zeit bemerkte, daß keine weiteren Erderschütterungen eintraten, fing ich an ruhiger zu werden. Um mich, was mir sehr noth that, einigermaßen wieder zu Kräften zu bringen, ging ich an mein kleines Proviantmagazin und nahm einen Schluck Rum, wobei ich jedoch wie immer sparsam verfuhr, da ich, wie mir wohl bewußt war, außer diesem Vorrath keinen weiteren hatte. Es regnete die ganze Nacht und einen großen Theil des nächsten Tages hindurch, so daß ich nicht ausgehen konnte. Als ich wieder einige Fassung gewonnen, dachte ich darüber nach, was ich jetzt anfangen solle. Ich erwog, daß ich, wenn die Insel solchen Erderschütternden öfters ausgesetzt sei, in der Höhle nicht wohnen bleiben könne, sondern darauf sinnen müsse, mir auf einem freien Platze ein Hüttchen zu bauen und es wiederum, um mich vor wilden Thieren und Menschen zu sichern, mit einer Einfriedigung zu versehen. Denn ich glaubte, wenn ich hier wohnen bliebe, würde ich früher oder später sicher lebendig begraben werden.
Ans diesen Gründen beschloß ich denn, mein Zelt von seinem jetzigen Platze unter dem Felsvorsprung, von dem ich fürchtete, er werde bei der nächsten Erschütterung sicherlich auf jenes stürzen, zu entfernen. Die beiden nächsten Tage, den 19. und 20. April, verwendete ich auf die Nachforschung nach einem Platz, wohin ich meine Wohnung verlegen sollte. Die Furcht, verschüttet zu werden, ließ mich nicht ruhig schlafen. Fast ebenso stark aber war auch die Angst davor, im Freien, ohne irgend eine Schutzwehr, zu schlafen, und als ich mich umschaute und bemerkte, wie Alles um mich wieder in bester Ordnung war, und wie wohl verborgen und sicher ich jetzt wohnte, kam mich doch eine große Abneigung an, meinen Aufenthalt zu wechseln.
Ich bedachte daneben auch, wie viel Zeit mich dieser Wechsel kosten würde, und daß ich einstweilen, bis ich mir einen neuen Zufluchtsort verschafft hätte, ja doch auf gut Glück bleiben müsse, wo ich war. Mit dieser Erwägung suchte ich mich vorläufig zu beruhigen und beschloß nur, mit möglichster Eile mir eine neue Umhegung anzulegen und dann mein Zelt dahineinzubringen, vorläufig aber zu bleiben, wo ich mich befand.
Den 22. April. Am nächsten Morgen überlegte ich, wie ich meinen Vorsatz ausführen sollte. Es mangelte mir jetzt sehr am nöthigen Werkzeug. Ich hatte zwar drei große Aexte und eine Menge kleiner Beile (die wir an Bord gehabt hatten, um sie den Wilden zu verkaufen), aber durch das Behauen des vielen harten Holzes waren diese voll Scharten und stumpf geworden. Nun besaß ich wohl auch den Schleifstein, aber ich vermochte ihn nicht ordentlich in Bewegung zu setzen. Diese Sache kostete mich so viel Nachdenken, als ein Staatsmann nur auf eine wichtige politische Angelegenheit oder ein Richter auf Abfassung eines Urtheils über Leben und Tod verwenden kann. Endlich brachte ich denn auch ein Schleifrad fertig, das ich vermittels einer Schnur durch Treten bewegen und dabei die Hände frei behalten konnte.
Anmerkung. Ich hatte in England nie ein solches Ding gesehen oder mich wenigstens nicht darum gekümmert, wie es gemacht wird; wiewohl ich später sah, daß man dergleichen dort sehr häufig benutzt. Meine Maschine nahm daher bis zu ihrer Vollendung eine volle Woche Arbeitszeit in Anspruch.
Den 28. und 29. April. Diese beiden Tage verwendete ich gänzlich dazu, meine Werkzeuge zu schärfen, wobei sich meine Schleifmaschine bestens bewährte.
Den 30. April. Da ich schon seit einiger Zeit bemerkt hatte, daß mein Brod stark auf die Neige gehe, schränkte ich mich, wennschon mit sehr schwerem Herzen, von jetzt an auf ein einziges Stück Zwieback für jeden Tag ein.
Den 1. Mai. Als ich Morgens während der Ebbe das Meer überschaute, sah ich am Strande etwas ungewöhnlich Hervorragendes, das wie eine Tonne aussah. Als ich näher kam, fand ich ein Fäßchen und einige Stücke von dem Schiffswrack, die während des letzten Sturms an das Land getrieben waren. Indem ich nach dem Schiffsrumpf selbst hinüberblickte, schien mir dieser höher aus dem Wasser hervorzuragen als früher. Bei der Untersuchung des Fäßchens fand ich, daß es Pulver enthielt, das aber naß gewesen und dann steinhart zusammengebacken war. Ich rollte das Faß vorläufig höher ans Ufer und ging dann auf dem Sande so nah als möglich an das Wrack, um zu untersuchen, ob etwa von demselben noch mehr zu holen sei.
Hier sah ich nun, daß das Schiff auffallend seine Lage verändert hatte. Das Vordertheil, das früher vom Sand verschüttet gewesen war, hatte sich sechs Fuß in die Höhe gehoben, und der Stern, der bald nachdem ich ihn das letzte Mal durchstöbert, durch die Gewalt der Wellen zertrümmert und von dem übrigen losgerissen war, lag nun umgestürzt auf der Seite. Da jetzt ein Sandhügel an der Stelle aufgethürmt war, wo ich früher eine Viertelmeile zu schwimmen gehabt hatte, um an das Wrack zu kommen, vermochte ich nun während der Ebbe trockenen Fußes bis zu demselben zu gelangen. Anfangs befremdete mich diese Wahrnehmung, bald aber erkannte ich, daß die Veränderung durch das Erdbeben bewirkt sein müsse. Durch dessen Gewalt war auch das Schiff noch mehr als früher zertrümmert worden, so daß täglich allerlei Dinge von der See abgelöst und, durch Wind und Wellen allmählich fortgeschwemmt, ans Land getrieben wurden.
Diese Dinge zogen meine Gedanken von dem Plane, meine Wohnung zu verändern, wieder ab, und ich beschäftigte mich eifrig, besonders an diesem Tage, mit der Erwägung, auf welche Weise ich in das Schiff einzudringen vermöchte. Ich fand jedoch anfangs kein Mittel, da die ganze Innenseite desselben von Sand bedeckt war. Da ich aber schon gelernt hatte, an Nichts zu verzweifelt, beschloß ich, was ich nur vom Schiffe lostrennen könne, mir zu holen, weil ich überzeugt war, es in der einen oder andern Weise verwerthen zu können.
Den 3. Mai. Zunächst durchschnitt ich mit meiner Säge einen Balken, der, wie es mir schien, einen Theil des Quarterdecks zusammenhielt. Als ich ihn in Stücke gesägt, beseitigte ich von dem höchstgelegenen Theil, so gut es gehen wollte, den Sand, wurde aber durch die steigende Flut genöthigt, meine Arbeit für diesmal zu unterbrechen.
Den 4. Mai. Ich fischte heute mit der Angel, erbeutete aber keinen eßbaren Fisch. Schon war ich der Beschäftigung müde und stand im Begriff heimzukehren, als ich einen jungen Delphin fing. Ich hatte mir nämlich aus Taugarn eine lange Schnur gemacht und damit, wiewohl ich keinen Angelhaken besaß, zu andern Zeiten Fische genug gefangen, wenigstens so viel für meine Mahlzeit nöthig waren. Um sie verspeisen zu können, pflegte ich sie an der Sonne zu trocknen.
Den 5. Mai. Am Wrack gearbeitet. Ich sägte noch einen andern Balken ab, machte drei große Fichtenbretter vom Deck los, band sie zusammen und ließ sie durch die Flut an den Strand treiben.
Den 6. Mai. Ich arbeitete abermals am Schiffsrumpf, zog mehre eiserne Bolzen und anderes Eisenwerk heraus, kam aber so ermüdet von der schweren Arbeit zurück, daß ich beschloß die Sache aufzugeben.
Den 7. Mai. Wiederum war ich zum Wrack gegangen, doch nicht in der Absicht, daran zu arbeiten. Ich fand, daß es durch sein eignes Gewicht auseinandergebrochen war, nachdem ich die Querbalken herausgesägt hatte. Es lagen jetzt mehre Stücke des Rumpfes abgerissen umher, und ich vermochte nun in das Innere des Schiffs zu sehen, das aber fast ganz mit Wasser und Sand angefüllt war.
Den 8. Mai. Ich ging wiederum zu dem Schiffe und nahm diesmal ein Brecheisen mit, um das Deck aufzubrechen, das jetzt ganz frei von Wasser und Sand dalag. Zwei Planken, die ich losgerissen, wurden durch die Flut gleichfalls ans Ufer geschwemmt. Das Brecheisen ließ ich für den nächsten Tag im Wrack zurück.
Den 9. Mai. Auch heute begab ich mich zu dem Schiffsrumpf und brach nun mit dem Eisen einen Weg in denselben, wobei ich auf mehre Tonnen stieß, die ich frei machte, ohne sie jedoch öffnen zu können. Auch fand ich eine Rolle englischen Blei's, die aber zu schwer war, als daß ich vermocht hätte, sie fortzuschaffen.
Den 10. bis 14. Mai. An allen diesen Tagen ging ich zu dem Wrack und holte mir nach und nach eine große Menge Bretter und Balkenwerk sowie etwa zwei Centner Eisen.
Den 15. Mai. Ich hatte zwei Beile mitgenommen, um zu versuchen, ob ich nicht ein Stück von der Bleirolle abtrennen könne, indem ich die Schneide des einen auf dieselbe setzte und sie mit dem Gewicht des andern hineintrieb. Da das Blei jedoch anderthalb Fuß tief im Wasser lag, gelang es mir nicht.
Den 16. Mai. Während der Nacht hatte es stark gewindet, und das Wrack schien am Morgen durch die Gewalt der Wellen noch mehr zertrümmert als vorher. Ich hatte mich an diesem Tage lange in den Wäldern herumgetrieben, um mir eine Taubenmahlzeit zu verschaffen, da die steigende Flut mich hinderte, an das Wrack zu gehen.
Den 17. Mai. Heute gewahrte ich einige Schiffstrümmer, welche die Wellen etwa zwei Meilen von mir entfernt ans Land getrieben hatten. Ich begab mich dahin und erkannte sie als ein Stück des Vordertheils, doch waren sie zu schwer, und ich konnte sie deshalb nicht fortbringen.
Den 24. Mai. An jedem der letztvergangenen Tage arbeitete ich am Schiff und löste mit schwerer Mühe mittels des Brecheisens so viel davon ab, daß bei der ersten starken Flut einige Tonnen und zwei Matrosenkisten fortgeschwemmt wurden. Aber der Wind wehte vom Lande her und so gelangte diesen Tag Nichts ans Ufer, außer einigem Stücken Holz und einem Faß mit brasilianischem Schweinefleisch, das aber durch Salzwasser und Sand verdorben war.
Ich trieb dieselbe Arbeit bis zum 15. Juni an jedem Tag, wenn ich nicht gerade für meinen Lebensunterhalt zu sorgen hatte, was ich aber stets zur Zeit der Flut that, um beim Beginn der Ebbe frei zu sein. Ich hatte mir nach und nach Bretter, Planken und Eisenwerk genug verschafft, um damit ein stattliches Boot erbauen zu können, wenn ich es nur verstanden hätte. Auch von der Bleirolle hatte ich allmählich in einzelnen Stücken beinahe einen Centner schwer herübergebracht.
Den 16. Juni. Ich fand heute am Strande eine große Schildkröte. Es war die erste, die ich seit meiner Anwesenheit auf der Insel sah, was nur an zufälligem Mißgeschick lag. Denn wenn ich von ungefähr einmal auf die andere Seite des Ufers gekommen wäre, hätte ich täglich, wie ich später sah, Schildkröten zu Hunderten bekommen können. Jedoch wäre mir das vielleicht theuer zu stehen gekommen.
Den 17. Juni. Als ich die Schildkröte zu kochen versuchte, fand ich in ihrem Leibe etwa sechzig Eier; das Fleisch schien mir das saftigste und wohlschmeckendste, das ich im Leben genossen, nachdem ich aus diesem trostlosen Eiland seit meiner Ankunft nur Ziegen- und Vogelfleisch gegessen hatte.
Den 18. Juni. Es regnete den ganzen Tag, und ich blieb daher zu Hause. Der Regen schien mir diesmal eine ungewöhnliche Kälte zu verbreiten, und es überkam mich ein unter diesem Breitengrad ungewöhnliches Frösteln.
Den 19. Juni. Ich fühlte mich sehr unwohl und fror so, als ob es ganz kaltes Wetter gewesen wäre.
Den 20. Juni. Die ganze letzte Nacht that ich kein Auge zu und litt an heftigen Kopfschmerzen und Fieberhitze.
Den 21. Juni. Ich war sehr krank. Der Gedanke an meine traurige Lage und an meine gänzliche Hülflosigkeit machte mich bis zum Tode betrübt. Zum ersten Mal seit dem Sturm von Hull betete ich zu Gott, freilich ohne zu wissen, was und warum ich es sagte, denn meine Gedanken waren in vollständiger Verwirrung.
Den 22. Juni. Heute fühlte ich mich ein wenig besser, war aber immer noch in schrecklicher Furcht vor einer schweren Krankheit.
Den 23. Juni. Es ging wir wieder sehr schlecht. Kälte und Fieberschauer quälten mich, und dann trat heftiges Kopfweh ein.
Den 24. Juni. Mein Zustand schien sich heute bedeutend der Besserung zu nähern.
Den 25. Juni. Wiederum suchte mich ein heftiger Anfall heim. Der Fieberschauer hielt sieben Stunden an. Frost und Hitze wechselten, dann trat ein gelinder Schweiß ein.
Den 26. Juni. Ich befand mich heute wohler. Um mir etwas Eßbares zu verschaffen, nahm ich das Gewehr und erlegte auch, wiewohl ich mich sehr schwach fühlte, eine Geis, brachte sie mit vieler Mühe nach Hause, röstete mir ein Stückchen Fleisch und verzehrte es. Gern hätte ich mir Bouillon gekocht, aber es mangelte mir an einem Gefäß dazu.
Den 27. Juni. Der Fieberanfall war wieder so heftig, daß ich den ganzen Tag über, ohne zu essen oder zu trinken, im Bette bleiben mußte. Fast wäre ich vor Durst verkommen, aber ich war zu schwach aufzustehen und mir einen Trunk Wassers zu holen. Ich betete wieder zu Gott, aber ich war zu schwach im Kopfe und wußte auch überdies nicht recht, was ich sagen sollte. Ich rief nur immer:»Herr sieh mich an! Gott sei mir gnädig und erbarme dich meiner!«Das trieb ich, glaub' ich, gegen drei Stunden lang, bis der Fieberanfall nachließ und ich in einen festen Schlaf verfiel, aus dem ich erst tief in der Nacht erwachte. Danach fühlte ich mich weit kräftiger, aber doch noch immer schwach genug, und besonders litt ich entsetzlichen Durst. Gleichwohl, da ich kein Wasser in der Nähe hatte, mußte ich still liegen bleiben bis zum Morgen, wo ich denn auch wieder einschlief.
Während dieses letzten Schlafes hatte ich folgenden schrecklichen Traum. Ich glaubte außerhalb meiner Einfriedigung auf dem Platze zu sitzen, wo ich während des Sturms nach dem Erdbeben gesessen hatte. Dort sah ich aus einer großen schwarzen Wolke einen Mann von hellen Flammen umgeben, welche die Erde erleuchteten, herabsteigen. Der Glanz, der ihn umstrahlte, war so stark, daß ihn meine Augen kaum ertrugen. Sein Gesicht war unaussprechlich schreckenerregend. Als er den Boden betrat, schien mir die Erde wie bei dem Erdbeben zu zittern, und Blitze durchzuckten rings die Luft. Auf der Erde angekommen, trat er auf mich zu, einen langen Speer in der Hand, als ob er mich tödten wolle. Er redete mich in einiger Entfernung von dem Gipfel einer kleinen Erhöhung aus mit fürchterlicher Stimme an, doch verstand ich nur das Folgende:»Alles dies hast du geschaut, ohne dich zur Buße bewegen zu lassen, darum sollst du sterben. «Dabei erhob er die Lanze, um mich zu durchbohren.
Niemand wird erwarten, daß ich das Entsetzen, welches meine Seele bei dieser Vision erfüllte, schildere. Ich meinte im Traume, das Entsetzliche könne selbst nur ein Traum sein, aber auch nachdem ich erwacht war und erkannte, daß ich nur geträumt hatte, war meine Angst über alle Beschreibung groß.
Leider fehlte es mir an aller Religion. Was ich durch die vortreffliche Unterweisung meines Vaters davon gelernt hatte, war in dem ununterbrochenen achtjährigen Seeleben und dem beständigen Verkehr mit ebenso gottlosen Menschen, wie ich war, mir abhanden gekommen. Ich erinnere mich nicht, daß ich während dieser ganzen Zeit meine Gedanken ein einziges Mal zu Gott erhoben oder über meinen Wandel nachgedacht hätte. Eine gewisse Stumpfheit des Herzens, eine Gleichgültigkeit gegen alles Bessere und eine völlige Bewußtlosigkeit von der Sünde hatte ganz und gar Besitz von meiner Seele genommen. Ich war ein so verhärtetes gedankenloses elendes Geschöpf, als nur eines unter Seeleuten je zu finden war. Weder von der Furcht Gottes in Gefahren, noch vom Dankgefühl gegen Gott nach der Errettung hatte ich die geringste Ahnung.
Man wird dies nach dem, was ich von meiner Geschichte berichtet habe, um so eher glauben, wenn ich hinzufüge, daß während jener wechselvollen Reihe von Unglücksfällen, die ich bis dahin erlebt hatte, mir nicht ein einziges Mal der Gedanke gekommen war, daß das die Hand Gottes herbeigeführt und daß es die gerechte Strafe meiner Sünden sei. Die Strafe nämlich entweder wegen des Ungehorsams gegen meinen Vater, oder wegen meiner gegenwärtigen Sünden, die groß genug waren, oder endlich die Züchtigung für den gesammten Verlauf meines nichtswürdigen Lebens.
Auch während ich mich noch auf der unheilvollen Reise an den öden Küsten von Afrika befand, war es mir keinmal eingefallen, Gott um einen Fingerzeig zu bitten, wohin ich mich wenden solle, oder seinen Schutz gegen gefräßige Thiere und grausame Menschen anzuflehen. Ich hatte weder an Gott, noch an eine Vorsehung gedacht, sondern nur wie ein rohes Thier nach meinen natürlichen Eingebungen gehandelt, indem ich nur dem Folge leistete, was mich der gesunde Menschenverstand lehrte, und auch dem kaum. Ebenso war mir, nachdem der portugiesische Kapitän mich gerettet, in sein Schiff aufgenommen, gut behandelt und sich barmherzig und gerecht gegen mich bezeigt hatte, dennoch nicht das geringste Dankgefühl in die Seele gekommen. Als ich dann wieder Schiffbruch gelitten und an dieser Insel die Gefahr des Ertrinkens ausgestanden hatte, war ich abermals weit davon entfernt gewesen, Gewissensbisse zu fühlen oder mein Unglück als ein gerechtes Gericht anzusehen. Nur das wiederholte ich oft bei mir, daß ich ein Unglücksvogel und zu einem ununterbrochenen Elend geboren sei.
Freilich das muß ich mir nachsagen, daß ich, als ich zuerst ans Land gekommen war und alle meine Schiffsgefährten ertrunken, mich selbst aber gerettet sah, eine Art von Entzücken und einige Regungen der Seele empfunden hatte, die unter Gottes gnädigem Beistand zu wirklicher Dankbarkeit sich hätten entwickeln können. Aber das hatte geendet, wie es angefangen, nämlich in einer flüchtigen Freude gewöhnlicher Art. Ich war nur voll Freude gewesen, daß ich am Leben geblieben, und hatte nicht im Geringsten die große Güte der Hand, die mich erhalten und vor allen Andern ausgezeichnet hatte, bedacht. Es war eben bloß die gemeine Art von Wohlempfinden gewesen, welche Seeleute regelmäßig fühlen, wenn sie aus einem Schiffbruch glücklich ans Land gekommen sind, und die sie in der nächsten Bowle Punsch für immer ertränken. So war es auch während der ganzen bisherigen Zeit meines einsamen Lebens in mir geblieben. Sogar als ich später aufmerksamer darüber nachgedacht hatte, wie ich auf diese schreckliche Insel verschlagen sei und außer dem Bereiche der Menschheit ohne Hoffnung auf Rettung lebe, war doch, sobald sich mir nur die Aussicht am Leben zu bleiben und nicht vor Hunger umzukommen zeigte, all meine Betrübniß verschwunden; ich fing an ganz ruhig zu sein, machte mich sofort an die Arbeit, um mir das Dasein zu fristen, und war weit entfernt von dem Gedanken, daß Gott sein Gericht an mir vollzogen und seine Hand über mich ausgereckt habe.
Erst das Aufgehen des Korns hatte, wie ich in meinem Tagebuch erwähnte, einen kleinen Eindruck auf mich bewirkt und mich nachdenklich gemacht, so lang ich es für etwas Wunderbares hielt. Aber sobald dies aufhörte, war auch jene Wirkung wieder vollkommen verraucht. Sogar das Erdbeben, wiewohl es keine furchtbarere Naturerscheinung und Nichts, das die unsichtbare Macht, die Alles lenkt, augenscheinlicher zeigt, geben kann, hatte, als der erste Schreck vorüber war, keine dauernde Einwirkung bei mir hinterlassen. Ich dachte jetzt nicht mehr an Gott und daran, daß mein gegenwärtiges Elend von ihm geschickt sei, als in der glücklichsten Zeit meines Lebens. Nun aber, nachdem ich erkrankt war und sich die Aussicht auf langsame Todesqual mir vor Augen stellte, als mein Lebensmuth unter der Last der schweren Leiden anfing zu sinken und meine Natur durch das heftige Fieber erschöpft war, begann mein Gewissen, das so lange geschlafen hatte, aufzuwachen und Vorwürfe über meine Vergangenheit, in der ich so offenbar Gottes Gericht über mich herauf beschworen, wurden in mir laut. Diese Gedanken lagen besonders am zweiten oder dritten Tag meiner Krankheit schwer auf mir. Die Gewalt des Fiebers und die Gewissensbisse preßten mir einige Worte aus, die wie ein Gebet zu Gott lauteten, wiewohl sie weder Wünsche, noch Hoffnungen aussprachen. Sie waren vielmehr der bloße Ausdruck meiner Furcht und Verzweiflung. Meine Gedankenverwirrung und die Angst, in so elender Lage umkommen zu müssen, veranlaßten Empfindungen in meiner Seele, die sich in allerlei Worten Luft machten, wie etwa:»Gott, welch ein erbärmliches Geschöpf bin ich! Wenn ich krank werde, muß ich sicherlich hülflos verschmachten«. Thränen brachen aus meinen Augen, und die Worte meines Vaters kamen mir ins Gedächtniß, insbesondere seine Prophezeiung, daß, wenn ich seinem Rathe nicht folge, Gottes Segen mir fehlen und ich einmal Zeit haben würde, über meine Thorheit nachzudenken, wenn Niemand vorhanden sein werde, mir Beistand zu leisten» Jetzt«, rief ich laut,»haben sich diese Worte bewahrheitet und Gottes Strafe ist über mich gekommen. Ich habe der Vorsehung, die mich gnädig in eine Lebenslage versetzt hatte, in der ich glücklich und zufrieden leben konnte, Trotz geboten. Ich wollte nicht sehen, was mir verliehen war an göttlichem Segen; nun trauern meine Eltern über meine Thorheit und ich trauere über die Folgen derselben. Ich habe den Beistand Derer, die mir Alles im Leben leicht gemacht haben würden, zurückgewiesen und bin nun ohne Hülfe, ohne Trost, ohne Rath. «Dann rief ich:»Herr, hilf mir, denn ich bin in großem Elend!«Dies war, wenn ich so sagen darf, das erste Gebet, das ich seit vielen Jahren aussprach. Doch ich kehre wieder zu meinem Tagebuch zurück.
Den 28. Juni. Da ich durch den Schlaf, den ich genossen, einigermaßen gekräftigt und der Fieberanfall gänzlich vorüber war, stand ich auf. Trotz des Entsetzens, das mir mein Traum eingeflößt, dachte ich doch daran, daß mein Fieber am nächsten Tage wiederkehren werde, und daß es Zeit sei, mich für eine etwaige Krankheit mit Erfrischungen zu versehen. Ich füllte daher vor Allem eine große Flasche mit Wasser und stellte sie auf meinen Tisch, so daß ich sie vom Bett aus erreichen konnte. Um die Kälte des Wassers etwas zu vermindern, mischte ich etwa ein Viertelquart Rum hinein; dann holte ich mir ein Stück Ziegenfleisch und röstete es auf Kohlen, konnte aber nur wenig davon essen. Ich machte einen Gang, fühlte mich aber sehr schwach, und das Herz war mir schwer in der Furcht vor der Wiederkehr des Fiebers. Mein Nachtessen bereitete ich mir aus drei Schildkröteneiern, die ich in der Asche röstete, und dies war der erste Bissen, den ich, so lange ich mich erinnern konnte, unter Anrufung des göttlichen Segens verzehrte.
Nach der Mahlzeit versuchte ich abermals einen Spaziergang zu machen, war aber so kraftlos, daß ich kaum meine Flinte zu tragen vermochte, ohne die ich nie ausging. Ich setzte mich daher nach wenigen Schritten auf die Erde nieder und blickte nach der See hinaus, die in völliger Stille vor mir lag. Jetzt stiegen allerlei Gedanken in mir auf, z. B.»Wie wunderbar ist doch diese Erde und dies Meer! Wer hat sie geschaffen? Wer bin ich, und wer sind alle die anderen Geschöpfe auf Erden und von wannen sind sie gekommen? Gewiß gibt es eine verborgene Macht, die Wasser und Land, Himmel und Erde gebildet hat, aber wo ist sie?«Und nun ergab sich die natürliche Antwort:»Gott hat Alles dies hervorgebracht!«—»Nun denn«, so dachte ich weiter,»wenn Gott Alles dies geschaffen hat, so regiert er auch Alles, und Nichts in dem weiten Umfang seiner Werke kann seiner Allwissenheit entgehen. Und weiter, wenn Nichts ohne sein Wissen geschieht, so weiß er auch, daß ich hier in dieser schrecklichen Lage bin, und wenn Alles auf seine Anordnung eintritt, so hat er auch Alles dies über mich verhängt. «Daran reihte sich unmittelbar die Frage:»Warum hat Gott dies so gefügt? Womit habe ich ein solches Geschick verdient?«Da aber schrak mein Gewissen alsbald wie vor einer Gotteslästerung zurück, und ich glaubte eine Stimme zu hören, die mir zurief:»Elender! Fragst du noch, was du verschuldet hast? Schau zurück auf dein schändlich vergeudetes Leben und frage dich lieber, was du nicht verbrochen hast! Frage, warum du nicht längst vernichtet bist! Warum du nicht auf der Rhede von Yarmouth ertrunken, nicht in dem Seegefecht mit dem Mann von Saleh getödtet, nicht von den Bestien an der afrikanischen Küste gefressen oder hier ertrunken bist, als alle deine Reisegefährten untergingen. Willst du noch fragen, was du gesündigt hast?«
Diese Gedanken überfielen mich mit einer solchen Gewalt, daß ich wie niedergedonnert in düsterem Sinnen nach meiner Behausung zurückschlich. Ich hatte keine Lust zu schlafen, sondern saß in meinem Stuhl, nachdem ich beim Dunkelwerden meine Lampe angezündet hatte.
Jetzt fiel mir ein, daß die Brasilianer sich als eines Heilmittels in fast allen Krankheiten des Tabaks bedienen, und daß ich in einer meiner Kisten ein Stück einer Tabaksrolle, das völlig zubereitet war, sowie ein anderes noch in grünem und unfertigem Zustand befindliches aufbewahrte.
Die Erinnerung hieran, die mir ohne Zweifel der Himmel selbst eingegeben, trieb mich zu jener Kiste, in der ich ein Labsal für Leib und Seele fand. Ich öffnete sie, nahm den Tabak und, da die wenigen Bücher, die ich gerettet, auch dort lagen, auch eine der erwähnten Bibeln heraus, in welcher zu lesen ich früher weder Zeit noch Lust gehabt hatte. Beides legte ich auf meinen Tisch.
Da ich nicht wußte, wie der Tabak anzuwenden sei, machte ich verschiedene Versuche, um zu sehen, ob er mir auf eine oder die andere Weise helfen könne. Zunächst kaute ich ein Stück eines Blattes, fühlte mich aber davon, da der Tabak noch grün und kräftig und ich nicht daran gewöhnt war, wie betäubt. Außerdem weichte ich einige Stückchen etliche Stunden in Rum auf, in der Absicht, davon einen Schluck beim Schlafengehen zu nehmen. Endlich verbrannte ich eine Portion auf Kohlen und hielt meine Nase in den Dampf, so lange ich es aushalten konnte.
In den Pausen dieser Beschäftigung griff ich nach der Bibel und fing an, darin zu lesen. Doch war mir der Kopf von dem Tabaksrauch zu verwirrt, um lange dabei zu bleiben. Als ich das Buch aufs Gerathewohl geöffnet, fiel mir die Stelle zuerst ins Auge:»Rufe mich an in der Noth, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen«.
Diese Worte paßten so sehr für meine Lage, daß sie einen gewissen Eindruck auf mich hervorbrachten, jedoch war dieser für jetzt noch nicht so tief als der, den dieselben Worte später in mir hervorriefen. Denn das Wort Errettung schien mir noch, sozusagen, ohne Sinn für mich; die Erlösung aus meiner Einsamkeit dünkte mich so fern und so unmöglich, daß ich, gleich den Kindern Israel, die, als ihnen Fleisch verheißen wurde, sprachen:»Kann Gott uns einen Tisch in der Wüste decken?«sagte:»Vermag auch Gott selbst mich wohl zu erretten aus dieser Oede?«Da die folgenden Jahre hindurch sich auch wirklich kein Hoffnungsschimmer in dieser Hinsicht zeigte, so kehrte jener Gedanke noch oft in mir wieder. Gleichwohl aber gaben mir jene Worte von jetzt an Veranlassung zu häufigem Nachdenken.
Weil es inzwischen spät geworden war und die Betäubung durch den Tabak mich schläfrig gemacht hatte, ging ich, nachdem ich meine Lampe hatte brennen lassen, zu Bett. Ehe ich mich aber niederlegte, that ich, was ich in meinem ganzen Leben nicht gethan hatte. Ich kniete nieder und betete zu Gott, daß er seine Verheißung an mir erfüllen und mich erretten möge, wenn ich ihn anriefe in der Noth.
Hierauf trank ich den Rum, in den ich den Tabak getaucht hatte, der Trank war jedoch so scharf und bitter, daß ich ihn fast nicht hinunterzubringen vermochte. Kaum zu Bette gestiegen, fiel ich in einen tiefen Schlaf und erwachte erst gegen drei Uhr des folgenden Nachmittags. Ja, zuweilen bilde ich mir noch bis auf den heutigen Tag ein, damals auch den ganzen andern Tag und die nächste Nacht hindurch geschlafen zu haben. Denn, wie sich einige Jahre später zeigte, fehlte mir ein Tag in meiner Zeitrechnung, ohne daß ich wußte, wohin er gekommen war. Sei dem aber wie ihm wolle, ich fühlte mich beim Erwachen ungemein erfrischt und meinen Lebensmuth heiter gekräftigt. Als ich aufgestanden war, konnte ich besser gehen als früher und spürte Hunger. Auch blieb ich am nächsten Tag (den 29. Juni) vom Fieber frei und erholte mich von da an allmählich ganz.
Den 30. Juni hatte ich gleichfalls einen fieberfreien Tag und ging daher mit dem Gewehr aus, entfernte mich jedoch absichtlich nicht weit. Ich schoß einige Seevögel von der Art der Baumgänse und brachte sie heim. Da ich jedoch keine große Lust verspürte, sie zu verzehren, begnügte ich mich wieder mit einigen Schildkröteneiern, die mir trefflich mundeten. Am Abend wiederholte ich das Mittel, das mir am vorigen Tage gut bekommen zu sein schien. Ich nahm wieder etwas von dem Rum, in welchem ich Tabak erweicht hatte, jedoch weniger als daß erste Mal, und unterließ auch, den Tabak zu kauen und den Rauch einzuathmen. Doch fühlte ich mich am andern Morgen (es war der 1. Juli) nicht so wohl, als ich gehofft, hatte auch einen neuen Fieberanfall, doch war er nicht stark.
Den 2. Juli. An diesem Tage wandte ich den Tabak wieder auf die drei erwähnten verschiedenen Arten an und betäubte mich wie früher, indem ich diesmal die Menge des Aufgusses verdoppelte.
Den 3. Juli. Das Fieber kehrte von jetzt an nicht wieder, obwohl ich erst nach mehren Wochen ganz wieder zu Kräften kam. Während ich mich erholte, kehrten meine Gedanken immer wieder zu den Worten der Schrift zurück:»So will ich dich erretten«. Die Unmöglichkeit meiner Befreiung bedrückte mir das Gemüth schwer, wiewohl ich doch immer wieder auf eine solche harrte. Da aber fiel mir plötzlich ein, daß ich ja über diese große Betrübniß die mir wirklich schon zu Theil gewordene Rettung vergessen hätte. Ich fragte mich: Bist du nicht wie durch ein Wunder von deiner Krankheit erlöst, aus der trostlosesten Lage, in der Jemand sein kann? Und hast du dafür deinen schuldigen Dank gezollt? Gott hat dich gerettet, und du hast ihn nicht dafür gepriesen. Wie darfst du auf eine größere Errettung hoffen? Dies bewegte mir das Herz so sehr, daß ich alsbald niederkniete und Gott laut für meine Genesung dankte.
Kapitel 6
Den 4. Juli. Am Morgen nahm ich die Bibel und fing an, aufmerksam im neuen Testamente zu lesen. Ich machte mir zur Vorschrift, von jetzt an jeden Abend und Morgen eine Weile darin zu lesen, ohne mich jedoch dabei an eine bestimmte Kapitelzahl zu binden, sondern nur so lange, als meine Gedanken dabei haften würden. Nicht lange, nachdem ich diese Thätigkeit begonnen, fühlte ich eine tiefe und aufrichtige Betrübniß über die Verworfenheit meines vergangenen Lebens. Mein Traum wurde wieder in mir lebendig und die Worte:»Alles dieses hat dich nicht zur Buße geführt«, traten mir vor die Seele. Ich hatte Gott ernstlich angefleht, daß er mir Reue ins Herz gebe, als ich zufällig an demselben Tag auf die Schriftstelle stieß:»Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöhet zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden«. Ich legte das Buch fort, und Herz und Hand in einer Art freudigen Entzückens zum Himmel erhebend, rief ich laut:»Jesus, du Sohn Davids, Jesus, du erhöheter Fürst und Heiland, gib mir ein bußfertiges Herz!«
Das war das erste Mal im Leben, daß ich mit Wahrheit behaupten konnte, gebetet zu haben. Denn ich hatte aus dem tiefsten Gefühle meiner Lage und in einer Hoffnung zu Gott gerufen, die auf seine Verheißung gegründet war, und von jetzt an faßte ich auch den Glauben, daß Gott mich erhören würde.
Ich verstand jetzt die früher erwähnten Worte:»Rufe mich an in der Noth, so will ich dich erretten «in einem andern Sinn als damals, wo ich dabei nur an meine Erlösung aus der Gefangenschaft dachte (denn wie groß auch die Insel war, auf der ich lebte, so war sie doch für mich ein Gefängniß im schlimmsten Sinne des Wortes). Nun aber, jene Stelle anders verstehend, suchte ich, in Furcht und Schrecken über die Sünden meiner vorigen Tage, nur Befreiung von dem Gewicht der Schuld, die auf meiner Seele lag. Mein einsames Leben bekümmerte mich nun nicht mehr. Ich bat nicht um und dachte nicht an Erlösung aus demselben; es schien mir Nichts im Vergleich zu jenem Elend. Und dies sei für alle meine Leser gesagt: daß, wenn sie zur Erkenntniß der Wahrheit gekommen sind, sie die Erlösung von der Sünde als einen viel größeren Segen empfinden werden als die Befreiung aus der Trübsal.
Doch ich wende mich nun wieder zu meinem Tagebuch. Meine Lage war zwar jetzt so elend als früher, aber sie bedrückte meine Seele weit weniger. Meine Gedanken richteten sich durch Gebet und Lesen in der Schrift auf Dinge höherer Art. Ich fühlte einen Trost in mir, wie ich ihn vorher nie empfunden, und jetzt kehrte auch meine volle Kraft und Gesundheit zurück. Ich entschloß mich, mir Alles, was ich bedurfte, durch Arbeit zu verschaffen, und von nun an ein möglichst regelmäßiges Leben zu führen.
Vom 4. bis 14. Juli verwendete ich meine Zeit zu neuen ausgedehnteren Gängen mit meinem Gewehr. Es ist kaum zu glauben, wie sehr herunter und schwach ich mich anfangs dabei fühlte. Die Heilmittel, die ich gebraucht hatte, waren gewiß niemals vorher von Jemandem gegen das Fieber angewendet worden, und ich kann das Experiment auch Niemandem empfehlen. Denn wiewohl es mich von dem Fieber befreit hatte, war ich doch auch wieder dadurch sehr geschwächt worden und litt noch geraume Zeit hindurch in Folge desselben an Nervenzucken und Zittern. Ich erkannte jetzt auch, daß es meiner Gesundheit sehr nachtheilig sei, während der Regenzeit auszugehen, besonders wenn der Regen von Wind und Sturm begleitet war. Sodann bemerkte ich, daß der im September und Oktober fallende Regen bei stürmischem Wetter mir viel gefährlicher war, als Sturm und Regen, wenn sie in der trockenen Zeit auftraten.
Ich befand mich jetzt schon über zehn Monate auf meiner einsamen Insel. Eine Möglichkeit, aus meiner trostlosen Lage befreit zu werden, schien mir nicht mehr vorhanden, weil ich fest glaubte, es habe noch nie ein menschliches Wesen außer mir einen Fuß auf diese Erde gesetzt.
Da ich jetzt meine Behausung hinlänglich gesichert zu haben meinte, spürte ich lebhaftes Verlangen, die Insel genauer kennen zu lernen und zu untersuchen, was für mir noch unbekannte Erzeugnisse darauf zu finden seien.
Ich begann diese Nachforschung am 15. Juli. Zunächst begab ich mich nach der kleinen Bucht, in die ich meine Flöße gesteuert hatte. Nachdem ich von dort aus den Fluß etwa zwei Meilen stromaufwärts verfolgt hatte, bemerkte ich, daß hier die Flut nicht weiter ging, und daß die Bucht sich in einem kleinen reißenden Bach von sehr frischem und klarem Wasser fortsetzte. Da es aber gerade die trockene Jahreszeit war, fand sich an einigen Stellen fast gar kein Wasser, oder es fehlte wenigstens eine sichtbare Strömung. An den Ufern des Baches traf ich auf liebliche grasreiche Wiesen, und an den höher gelegenen Uferstellen, welche das Wasser vermutlich nie erreichte, grünten zahlreiche Tabaksblätter auf starken und hohen Stengeln. Auch andere, mir aber unbekannte Pflanzen, die vielleicht, ohne daß ich es wußte, besondere gute Eigenschaften besaßen, fanden sich dort. Ich suchte vor Allem nach der Maniokpflanze, welche den Indianern in diesen Erdgegenden überall statt des Brodes dient, aber es war keine zu sehen. Dagegen bemerkte ich große Aloëstauden und etwas wildes, aus Mangel an Pflege verkümmertes Zuckerrohr.
Für diesmal begnügte ich mich mit diesen Entdeckungen und kehrte heim, indem ich bei mir überlegte, auf welche Art es mir gelingen könnte, die etwaige Trefflichkeit einer oder der andern Pflanzenfrucht zu entdecken. Mein Nachdenken war jedoch fruchtlos. Ich hatte mich während meines Aufenthalts in Brasilien zu wenig mit der Beobachtung der Pflanzenwelt abgegeben, um aus dieser jetzt irgend welchen Nutzen ziehen zu können.
Am nächsten Tag, den 16. Juli, schlug ich wieder denselben Weg ein. Etwas weiter als früher vorgedrungen, stieß ich auf das Ende des Baches und der Wiesen und die Gegend fing an waldiger zu werden. Hier fand ich verschiedene Früchte, besonders eine Menge Melonen und Weintrauben. Die Reben rankten sich von Baum zu Baum, und die Beeren waren gerade in voller Reife. Diese überraschende Entdeckung erfreute mich sehr; doch warnte mich vor zu reichlichem Genuß die Erinnerung daran, daß während meines Aufenthalts an der Barbarenküste einige englische Sklaven in Folge übermäßigen Weintraubenessens an der Ruhr und dem Fieber gestorben waren. Gleichwohl machte ich mir die Trauben vortrefflich zu Nutze. Ich hob sie nämlich in der Sonne getrocknet als Rosinen auf, die mir für die Zeit, wenn es keine Trauben mehr geben würde, als eine angenehme Speise dienen sollten.
Da ich den ganzen Abend an jenem Platze verweilt hatte, konnte ich nicht mehr zu meiner Behausung zurückkehren. Zum ersten Mal schlief ich sozusagen außer dem Hause; das heißt ich erstieg wieder, wie in der ersten Nacht nach meiner Ankunft auf der Insel, einen Baum und ruhete dort vortrefflich. Am andern Morgen setzte ich meinen Weg fort, und zwar nach meiner Berechnung etwa vier Meilen das Thal entlang, das sich zwischen zwei Hügelreihen nordwärts erstreckte. Am Ende meiner Wanderung kam ich zu einer Lichtung, von der aus die Gegend sich westlich auszudehnen schien. Ein frischer Quell, der seitwärts von mir an einer Anhöhe entsprang, nahm seinen Weg nach Osten hin. Die Landschaft bot einen üppig blühenden, saftgrünen Anblick und erschien wie ein wohlgepflegter Garten. Ich stieg ein wenig an der Seite dieses lieblichen Thals herab und überblickte es mit einer Art wehmüthiger Freude in dem Gedanken, daß dies Alles mir gehöre, daß ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes sei und daß, wenn ich es in bewohnte Gegend versetzen könnte, es ein Erbe so groß, wie nur irgend ein Lord in England es besitzen mag, repräsentiren würde.
Rings umher standen Cocusnußbäume in Menge, auch Orangen-, Limonen- und Citronenbäume, aber alle wild und gegenwärtig nur mit wenigen Früchten behangen. Indeß schmeckten die grünen Limonen, die ich brach, nicht nur vortrefflich, sondern später verschaffte mir der Saft, den ich mit Wasser mischte, auch ein sehr gesundes kühles und labendes Getränke. Ich hatte nun alle Hände voll zu thun, um Früchte zu sammeln und heim zu bringen, da ich beabsichtigte, mir einen Vorrath von Trauben, Limonen und Citronen für die Regenzeit, die ich nahe wußte, zu sammeln. Zu diesem Zweck häufte ich eine große Menge von Trauben auf, sammelte eine kleinere an einem anderen Platze und einen guten Theil Limonen in einem dritten Haufen. Einige der Früchte nahm ich sogleich mit nach Hause, den Rest gedachte ich in einem Beutel oder Sack später zu holen. Nach dreitägiger Entfernung zu meiner Wohnung zurückgelangt, fand ich, daß die Trauben, die ich bei mir trug, unterwegs verdorben waren; ihre eigne Schwere hatte die Beeren zerdrückt, während die wenigen Limonen, die ich mitgenommen, sich unversehrt erhalten hatten.
Am nächsten Tage, den 19., ging ich mit zwei kleinen Säcken versehen aus, um meine Ernte zu holen. Aber wie erstaunte ich, als ich zu meinen aufgehäuften Trauben, die, während ich sie gepflückt hatte, so voll und schön gewesen waren, kam, sie zerstreut, zerrissen, zertreten und zum Theil verzehrt fand. Ich schloß daraus, daß das Unheil von wilden, mir unbekannten Thieren angerichtet sei. Da ich somit die Unmöglichkeit einsah, die Trauben hier aufgehäuft liegen zu lassen, und da ich sie auch nicht in meinen Säcken mitnehmen konnte, weil sie in jenem Fall gefressen, in diesem verdorben sein würden, verfiel ich auf ein anderes Auskunftsmittel: nachdem ich nämlich eine große Menge Trauben gesammelt hatte, hing ich sie an Baumzweigen auf, um sie in Sicherheit von der Sonne trocknen zu lassen. Von den Citronen und Limonen nahm ich dagegen so viel mit, als ich nur zu tragen vermochte.
Auf dem Heimweg betrachtete ich mit großer Freude die Fruchtbarkeit des Thals und die Lieblichkeit der Gegend, die auch vor Stürmen geschützt und mit Wasser und Holz reichlich versehen war. Jetzt machte ich mir Vorwürfe, daß ich meine Behausung thörichter Weise an einer Stelle angeschlagen hatte, die in bei weitem der ungünstigsten Gegend der Insel gelegen sei, und begann ernstlich an eine Wohnungsveränderung zu denken und mich nach einem Obdach, das gleiche Sicherheit wie mein jetziges biete, in diesem reizenden fruchtbaren Theil des Landes umzusehen.
Dieser Gedanke ging mir sehr im Kopfe herum und reizte mich eine Weile außerordentlich. Bei näherer Betrachtung aber erwog ich, daß ich jetzt auf der Seeseite wohnte, wo mindestens die Möglichkeit vorhanden war, daß sich ein erwünschtes Unheil ereignen und ein gleiches Mißgeschick wie das meinige auch andere Unglückliche dort ans Land gerathen lassen könnte. Wie unwahrscheinlich das auch bedünken mochte, so hieß doch, mich in den Hügeln und Wäldern inmitten der Insel anzusiedeln auf meine Erlösung geradezu Verzicht leisten, und so kam ich denn auch zur Einsicht, daß ich deshalb auf keinen Fall meine Wohnung verändern dürfe. Da ich aber förmlich verliebt in jene Gegend war, brachte ich einen großen Theil meiner Zeit während des Restes des Monats Juli dort zu. Ich baute mir eine Art von kleiner Laube, die ich in einiger Entfernung mit einem starken Zaun, so hoch als ich mit den Armen reichen konnte, umgab. Dort schlief ich zuweilen mehre Nächte hinter einander ganz ruhig, indem ich den Zaun wie den um meine alte Wohnung mit einer Leiter überkletterte. So konnte ich mir denn einbilden, jetzt ein Landhaus und ein Haus an der Küste zu besitzen.
Jene Arbeiten nahmen mich bis zu Anfang des August in Anspruch. Kaum hatte ich die Einfriedigung vollendet und fing an mich der Früchte meiner Arbeit zu erfreuen, als die Regenzeit mich fest in meiner zuerstgewählten Behausung einschloß. Denn wiewohl ich in der zweiten mir von einem Stück eines Segels gleichfalls ein Zelt errichtet hatte, fehlte mir dort doch der Schutz eines Hügels, um die Stürme abzuhalten, sowie auch eine Höhle, um darin bei ungewöhnlich starkem Regen Schutz zu suchen.
Am 3. August schienen mir die aufgehängten Trauben hinlänglich trocken; sie waren auch wirklich zu trefflichen Rosinen geworden. Ich fing an, sie von den Bäumen abzunehmen und das war gut, denn der Regen würde sie außerdem bald verdorben und mich um den besten Theil meines Winterunterhalts gebracht haben. Nachdem ich nämlich über zweihundert große Trauben eingeheimst und in meine Höhle geschafft hatte, begann der Regen und dauerte vom 14. August bis zur Mitte des Oktober fort. Einige Male war er so heftig, daß ich mehre Tage hindurch meine Höhle keinmal verlassen konnte.
Während dieser Zeit wurde ich durch einen Familienzuwachs sehr überrascht. Ich hatte eine Weile in Sorgen um eine meiner Katzen gelebt, die verschwunden gewesen war, so daß ich geglaubt hatte, sie sei umgekommen. Nachdem sie geraume Zeit nichts von sich hatte sehen und hören lassen, kam sie plötzlich gegen Ende des August mit drei Jungen heim. Dies befremdete mich sehr. Zwar hatte ich einmal eine wilde Katze geschossen, aber, wie mir schien, war dieselbe von der europäischen Art völlig verschieden gewesen, und ich hatte daher geglaubt, die hier einheimische Art würde sich mit jener nicht paaren. Die Kätzchen glichen aber ganz der Mutter, und da meine beiden Katzen Weibchen waren, fand ich das sehr seltsam. Durch diese drei Katzen wurde ich später so mit Katzen überschwemmt, daß ich sie wie Ungeziefer oder wilde Thiere tödten und mit aller Anstrengung von meiner Wohnung verscheuchen mußte.
Vom 14. bis zum 26. August fortwährender Regen. Ich konnte nicht ausgehen und suchte mich nur möglichst vor der Nässe zu schützen. In dieser Eingeschlossenheit ging mir die Nahrung auf die Neige; ich wagte mich daher zweimal hinaus, schoß den einen Tag eine Ziege und fand am andern eine große Schildkröte, die mir einen wahren Leckerbissen bot. Meine Mahlzeiten hatte ich jetzt folgendermaßen geregelt: zum Frühstück genoß ich einige Rosinen, als Mittagsessen ein Stück gedörrtes Ziegenfleisch oder etwas geröstete Schildkröte (denn um zu kochen mangelte mir zu meinem großen Bedauern ein taugliches Gefäß). Mein Abendessen bestand regelmäßig aus einigen Schildkröteneiern.
Während jener durch den Regen bewirkten Gefangenschaft arbeitete ich täglich mehre Stunden daran, meine Höhle zu erweitern. Ich gelangte dabei bis zur entgegengesetzten Außenseite des Hügels und legte mir auf dieser eine Thür an, durch die ich nun ein- und ausgehen konnte. Es war mir zwar nicht ganz wohl zu Muthe bei dem Gedanken, so offen und frei dazuliegen. Früher war ich vollkommen abgeschlossen gewesen, während jetzt Alles, was Lust hatte, zu mir gelangen konnte. Jedoch hatte ich bis dahin kein lebendes Wesen auf der Insel bemerkt, das ich zu fürchten brauchte; denn die größten Thiere, die ich bisher hier gesehen, waren die Ziegen gewesen.
Den 30. September. Es war jetzt ein Jahr seit meiner Ankunft vergangen, wenigstens fand ich beim Zusammenzählen der Einschnitte an meinem Pfahl, daß ich bereits 365 Tage auf der Insel gelebt hatte. Ich fastete diesen Jahrestag über und verwendete ihn zu frommen Uebungen. Ich warf mich nieder in aufrichtiger Demuth, bekannte meine Sünden vor Gott, erkannte sie an als gerechtes Gericht über mich und flehte zu ihm, er möge um Jesu Christi willen mir gnädig sein. Nachdem ich zwölf Stunden ohne die geringste Erfrischung geblieben war, verzehrte ich nach Sonnenuntergang ein Stück Zwieback und eine Traube mit getrockneten Beeren und legte mich dann zu Bett, nachdem ich den Tag mit einem Gebete, wie ich ihn begonnen, auch beschlossen hatte. Bisher war nicht ein einziger Sonntag von mir gefeiert worden, da ich anfangs aus Mangel an religiöser Stimmung unterlassen hatte, die Wochen zu bezeichnen, und daher später die Tage nicht mehr zu unterscheiden vermochte. Nun aber theilte ich bei der Berechnung der Tage nachträglich das verflossene Jahr in Wochen und zeichnete den siebenten Tag als Sonntag aus. Bald darauf nahm ich wahr, daß meine Tinte auf die Neige ging, und ich setzte mir daher vor, von nun an nur noch die bemerkenswertesten Ereignisse meines einsamen Lebens aufzuzeichnen.
Jetzt, wo ich allmählich die Regelmäßigkeit im Eintreten der trockenen und nassen Jahreszeit erkannt hatte, war ich auch im Stande, für jede die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Wie ich jedoch all meine Erfahrungen theuer erkaufen mußte, war es auch mit derjenigen der Fall, von welcher ich jetzt berichten will, ja sie war eine der entmuthigendsten unter allen.
Wie erwähnt, hatte ich die wenigen so wunderbar aufgesprossenen Gersten- und Reisähren aufbewahrt. Es waren, wenn ich nicht irre, dreißig Reis- und etwa zwanzig Gerstenhalme. Weil ich glaubte, es sei jetzt nach dem Regen, als die Sonne sich südlich von mir entfernte, Zeit, die Körner zu säen, grub ich, so gut es mit meinem hölzernen Spaten gehen wollte, ein Stück Land um und streute das Korn in zwei Abtheilungen darauf. Wegen meiner nicht völligen Sicherheit darüber, ob es die geeignete Zeit sei, verbrauchte ich zunächst nur zwei Drittel des Korns und behielt etwa eine Handvoll von jeder Art zurück. Das gereichte mir später zu großem Trost; denn nicht ein einziges Korn ging auf, da die trockenen Monate folgten, und die Erde des Regens entbehrte, auch kein Düngmittel das Wachsthum unterstützte. Erst in der feuchten Jahreszeit entwickelte sich meine Aussaat, wie wenn sie erst kurz zuvor geschehen sei. Als ich mein Korn nicht wachsen sah, suchte ich eine feuchtere Stelle des Bodens auf, um einen weiteren Versuch zu machen. Ich grub ein Stück Landes in der Nähe meiner Laube um und säete den Rest meines Korns dort im Februar kurz vor dem Frühlingsäquinoctium aus. Da die regnerischen Monate März und April folgten, ging es denn dort auch üppig auf und gab reichlichen Ertrag. Weil ich aber nur wenig Korn gehabt hatte, betrug meine ganze Ernte auch nur eine halbe englische Metze von jeder Art. Doch war ich durch diese Erfahrung gewitzigt, kannte jetzt die zur Aussaat geeigneten Zeiten und wußte, daß ich jährlich zweimal säen und ernten konnte.
Während mein Korn wuchs, machte ich eine kleine Entdeckung, die mir später nützlich wurde. Sobald der Regen vorüber war und das Wetter sich aufheiterte, was gegen den November hin geschah, besuchte ich nämlich meine Laube nach monatelanger Anwesenheit einmal wieder. Ich fand Alles dort, wie ich es verlassen. Die von mir angelegte Doppelhecke war nicht nur fest und unversehrt, sondern es waren auch die Pfähle, die ich von benachbarten Bäumen abgehauen hatte, ausgeschlagen und hatten hohe Zweige getrieben, wie es die Weidenbäume im ersten Jahre, nachdem sie geköpft sind, zu thun pflegen. Die Baumart, von der ich die Pfähle genommen, konnte ich nicht nennen. Ich war sehr angenehm überrascht, die jungen Stämme grünen zu sehen, beschnitt sie und suchte sie zu möglichst gleichmäßiger Höhe zu gestalten. Es ist kaum glaublich, wie schön sie binnen drei Jahren heranwuchsen. Denn wiewohl der Kreis, den sie beschrieben, gegen fünfundzwanzig Ellen im Durchmesser hielt, bedeckten sie ihn doch vollständig und gewährten so viel Schatten, daß ich fast die ganze trockene Jahreszeit hindurch mich unter demselben aufzuhalten pflegte.
Dies veranlaßte mich, weitere Pfähle zu fällen und mir eine ähnliche Umfriedigung auch um meine erste Wohnung anzulegen. Ich schlug die Palissaden etwa acht Ellen entfernt von der früher angelegten Einzäunung und in einer Doppelreihe ein, sie wuchsen prächtig heran und gewährten meiner Wohnung nicht nur Schatten, sondern dienten, wie ich seiner Zeit erzählen werde, mir später auch zur Vertheidigung.
Ich beobachtete, daß das Jahr hier nicht, wie in Europa, in Sommer und Winter, sondern in regnerische und trockene Zeiten zerfiel. Das Verhältniß stellte sich so: die Hälfte des Februar, der März und der halbe April gehörten zur Regenzeit, da dann die Sonne der Tag- und Nachtgleiche nahe war. Der halbe April, der Mai, Juni, Juli und der halbe August, wenn die Sonne nördlich vom Aequator stand, waren trocken. Die zweite Hälfte des August, der September und der halbe Oktober gehörten wieder zur Regenzeit, dagegen zählte zur trockenen Periode: der Rest des Oktober, der November, December, Januar und die erste Hälfte des Februar, wenn die Sonne südlich vom Aequator stand.
Zuweilen dauerte die Regenzeit länger oder kürzer, je nachdem der Wind wehete. Nachdem ich die üblen Wirkungen meiner Ausgänge in der nassen Periode erkannt hatte, trug ich Sorge dafür, mich stets mit den nöthigen Vorräthen zu versehen, um während der regnerischen Monate zu Hause bleiben zu können. Diese Zeit verwendete ich sehr zweckmäßig, um mich mit allerlei Dingen auszurüsten, deren Herstellung nur durch schwere und langwierige Arbeit zu bewirken war. So machte ich namentlich verschiedene Versuche, einen Korb zu Stande zu bringen. Alle Zweige aber, mit denen ich es probirte, waren unbrauchbar wegen ihrer großen Sprödigkeit. Jetzt gereichte es mir sehr zum Vortheil, daß ich als Knabe in meiner Vaterstadt oft mit großem Vergnügen dem Hantieren eines Korbmachers zugeschaut hatte. Ich war damals, wie Jungen pflegen, sehr dienstfertig gewesen, dem Korbflechter zu helfen, und hatte mir daher vollkommene Kenntniß seiner Methode angeeignet, so daß mir jetzt nur das Material fehlte. Da fiel es mir ein, daß die Zweige des Baumes, von welchem ich meine Pfähle geholt, vielleicht so geschmeidig seien wie in England die Weidenruthen. Daher begab ich mich sogleich am nächsten Tag zu meinem sogenannten Landhaus, schnitt einige dünnere Zweige ab und fand sie zu meinem Zweck so geeignet, als ich es nur wünschen konnte. Ich holte mir daher am folgenden Tage, mit dem Beil versehen, eine große Menge derselben, legte sie zum Trocknen innerhalb meiner Einfriedigung nieder und brachte sie, als sie brauchbar waren, in meine Höhle. Hier fertigte ich mir während der nächsten Regenzeit eine Menge von Körben, theils um Erde oder Anderes darin zu tragen, theils um Allerlei darin aufzubewahren. Meine Arbeit gerieth zwar nicht sehr schön, aber ihre Resultate waren doch vollkommen zweckentsprechend. Später trug ich Sorge, immer einen Vorrath von Körben zu haben, und fertigte mir, sobald die früheren abgenutzt waren, eine Anzahl neue. Dabei kam es mir besonders darauf an, die Körbe möglichst stark und tief zu machen, um darin, statt in Säcken, mein Korn aufbewahren zu können, wenn ich davon einmal einen großen Vorrath haben würde.
Nachdem ich diese eine schwierige Aufgabe mit unendlichem Zeitaufwand glücklich gelöst hatte, dachte ich daran, mich mit zwei anderen nöthigen Gegenständen, wenn möglich, zu versehen. Ich besaß nämlich kein Gefäß, um Flüssigkeiten darin aufzubewahren, außer zwei, beinahe noch ganz mit Rum angefüllten Fäßchen und einigen Glasflaschen, die theils die gewöhnliche Form hatten, theils viereckig waren. Zur Benutzung beim Kochen hatte ich nichts als einen aus dem Schiff geretteten großen Kessel, der zur Bereitung von Bouillon und zum Kochen kleiner Stückchen Fleisch zu umfangreich war. Das Zweite, wonach ich großes Verlangen trug, war eine Tabakspfeife. Obschon mir anfangs die Verfertigung einer solchen ganz unmöglich schien, gelang es mir endlich doch, eine zu erfinden. Die Anlegung meiner Doppelreihe von Pfählen und die Korbmacherarbeit beschäftigten mich den ganzen Sommer, das heißt die ganze trockene Jahreszeit hindurch.
Ich sprach schon von meiner großen Lust, die ganze Insel kennen zu lernen, und daß ich schon früher an dem Bache herauf bis an die Stelle, wo ich meine Laube angelegt, und weiterhin, wo ich den Ausblick nach der See auf der anderen Seite der Insel hatte, gekommen war. Jetzt beschloß ich, einmal meinen Weg längs der Seeküste auf jener Seite hin zu nehmen, und machte mich denn auch mit meiner Flinte, einem Beil, meinem Hund und mit einer größeren Quantität von Pulver und Blei als gewöhnlich, sowie mit zwei Zwiebacken und einem großen Bündel Rosinen in meinem Beutel auf die Wanderung. Nachdem ich das Ende des Thals, in welchem sich meine Laube befand, passirt hatte, bekam ich bald das Meer in Sicht. Da es ein außerordentlich heller Tag war, entdeckte ich plötzlich in der Ferne Land, konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Insel oder Festland sei. Es lag hoch und streckte sich von Westen nach Westsüdwesten in langer Ausdehnung hin. Nach meiner Berechnung mußte es mindestens fünfzehn bis zwanzig Meilen von meiner Insel entfernt sein.
Es war mir unbekannt, was für ein Stück Erde das sein mochte, nur so viel glaubte ich zu wissen, daß es zu Amerika gehöre und allen meinen Beobachtungen nach in der Nähe der spanischen Besitzungen liegen müsse. Vielleicht mochte es von Wilden bewohnt sein, und wenn ich dort ans Land gerathen wäre, hätte ich mich wohl noch in schlimmerer Lage befunden als hier. Dieser Gedanke söhnte mich noch mehr aus mit der Fügung der Vorsehung, die, wie ich jetzt einzusehen begann, Alles aufs Beste ordnet. Meine Seele wurde nun ruhiger und ich quälte mich nicht mehr mit fruchtlosen Wünschen, anderswo zu leben.
Uebrigens sagte ich mir, daß, wenn jenes Land wirklich zur spanischen Küste gehöre, sich früher oder später sicherlich in der Nähe desselben ein Schiff zeigen werde. War das Erstere aber nicht der Fall, so konnte jene Küste nur von den zwischen den spanischen Kolonien und Brasilien hausenden Wilden bewohnt sein, welche die schlimmsten von Allen, nämlich Cannibalen oder Menschenfresser sind und alle menschlichen Geschöpfe, die in ihre Hände fallen, ermorden und verzehren.
Unter solchen Gedanken schritt ich gemächlich weiter. Wie ich bemerkte, war die Inselseite, auf der ich mich jetzt befand, weit anmuthiger als die meinige. Es gab hier blumengeschmückte Savannen oder Wiesen und schönes Gehölz fand sich in Menge. — Ich erblickte eine große Anzahl von Papageien, und es überkam mich stark die Lust, mir einen zu fangen, um ihn zu zähmen und sprechen zu lehren. Nach mehren vergeblichen Versuchen gelang es mir auch, eines jungen Thieres dieser Vogelart habhaft zu werden, das ich mit einem Stock vom Baume schlug und, nachdem es sich erholt hatte, nach Hause trug. Es währte mehre Jahre, bis dieser Papagei sprechen lernte, endlich aber hatte er gelernt, mich ganz verständlich bei meinem Namen zu rufen. Ein Vorfall, der sich hieran knüpfte, soll, obwohl er an sich unbedeutend ist, später zum Ergötzen des Lesers mitgetheilt werden.
Ich war sehr befriedigt von meiner Wanderung. In den Thälern hatte ich Hasen, wenigstens hielt ich einige mir begegnende Thiere für solche, und Füchse angetroffen. Doch unterschieden sie sich wesentlich von denen, die mir anderwärts vorgekommen waren, und lieferten mir auch kein Nahrungsmittel, wiewohl ich einige davon erlegte. Uebrigens litt ich auch in Bezug auf Victualien jetzt keinen Mangel, denn ich war mit solchen von trefflicher Qualität versehen, und zwar besonders mit dreierlei Fleischarten, nämlich dem der Ziegen, Tauben und Schildkröten. Die Rosinen dazu gerechnet, hätte selbst der Markt von Leadenhall wenigstens für einen einzelnen Menschen keine bessern Tafelfreuden liefern können als diese. So hatte ich, wie traurig meine Lage auch sein mochte, doch Grund genug zur Dankbarkeit. Litt ich doch so wenig Mangel an Unterhalt, daß ich eher im Ueberfluß, und zwar sogar an nahrhaften Leckerbissen lebte.
Während meiner Entdeckungsreise machte ich nicht viel über zwei Meilen des Tags, dennoch kehrte ich stets durch viele Umwege, die ich einschlug, um Wahrnehmungen zu machen, müde genug zu dem Platze zurück, den ich ein- und für allemal zu meinem Nachtlager bestimmt hatte. Ich schlief dort entweder auf einem Baum, oder bildete mir eine Einfriedigung, indem ich rings um mich her Pfähle einsteckte, oder solche von einem Baum zum andern legte. So konnten wilde Thiere nicht in meine Nähe kommen, ohne daß ich aufwachte. Wieder an das Meeresufer gelangt, sah ich mit Erstaunen, daß ich auch in Bezug auf dieses mein Quartier auf der ungünstigsten Seite der Insel genommen hatte. Denn hier war der Strand von unzähligen Schildkröten bedeckt, während ich deren auf der anderen Seite binnen anderthalb Jahren nur drei gefunden hatte. Auch eine große Menge von Vögeln gab es hier, von denen mir einige bisher noch nicht zu Gesicht gekommen waren. Manche darunter lieferten leckere Mahlzeiten, dem Namen nach erkannte ich darunter nur die sogenannten Fettgänse. Wiewohl es eine Leichtigkeit gewesen wäre, von diesen so viel mir beliebte zu schießen, begnügte ich mich, da ich mit Pulver und Blei sehr haushälterisch umging, lieber damit, mir eine Ziege zu erlegen, die mir längern Unterhalt gewährte. Obgleich auch von diesen Thieren hier eine Menge, und zwar eine noch größere als auf meiner Inselseite vorhanden war, hielt es doch schwerer als dort, an sie heran zu kommen, da sie wegen der Ebenheit und Flachheit der Gegend mich immer sehr bald bemerkten.
Dieser ganze Theil des Eilandes behagte mir, wie gesagt, weit besser als der, in welchem ich mich niedergelassen hatte. Aber dennoch fühlte ich nicht die geringste Lust, meine Wohnung zu verlassen, denn durch die Gewohnheit war diese mir lieb geworden, und es dünkte mich die ganze Zeit meiner Wanderung hindurch, als ob ich in der Fremde sei. Ich ging an der Küste ungefähr zwölf Meilen ostwärts, pflanzte dort einen großen Pfahl zum Merkzeichen am Strande auf und beschloß dann, heimzukehren. Meinen nächsten Ausflug gedachte ich die andere Seite der Insel entlang zu machen und so in die Runde zu gehen, bis ich wieder an jenem Pfahl ankäme. Diesmal schlug ich einen andern Rückweg an, in der Ueberzeugung, daß ich leicht den Ueberblick über die Insel behalten und nach meiner ersten Wohnung nicht fehl gehen könne. Ich hatte mich jedoch getäuscht, denn nach zwei bis drei Meilen befand ich mich in einem großen, von Wald bedeckten Hügeln umkränzten Thale, so daß ich mich über den einzuschlagenden Weg nur durch die Beobachtung des Sonnenstandes zu orientiren vermochte. Um das Mißgeschick zu steigern, wurde das Wetter während der drei oder vier Tage, die ich in diesem Thale zubrachte, neblig, so daß ich die Sonne nicht zu sehen bekam und so lange mißmuthig herumirrte, bis ich mich nothgedrungener Weise wieder nach der Seeseite hinwendete, meinen Pfahl aufsuchte und dann auf demselben Wege, den ich auf dem Hinweg gekommen war, heimkehrte. Da das Wetter ungemein heiß war und ich an meiner Flinte, dem Schießbedarf und dem Beil schwer zu tragen hatte, legte ich den Weg nach Hause in nur kleinen Tagemärschen zurück.
Auf meiner Heimwanderung fing mein Hund ein Ziegenlamm, das ich, herbeigeeilt, während es noch am Leben war, ihm entriß. Es wandelte mich große Lust an, es mit nach Hause zu nehmen, da ich schon darüber nachgedacht hatte, ob es nicht gelingen könne, ein oder zwei Lämmer zu fangen und mir so für die Zeit, wenn mein Pulver und Blei verbraucht sein würde, eine Zucht von zahmen Ziegen anzulegen. So machte ich denn dem kleinen Geschöpf ein Halsband und führte es an einer Leine, die ich mir aus etwas Taugarn, wovon ich beständig ein wenig bei mir trug, verfertigte, bis zu meiner Laube, wo ich es einschloß und zurückließ. Denn ich brannte vor Ungeduld, nach mehr als einmonatlicher Abwesenheit wieder nach Hause zu kommen.
Ich kann nicht beschreiben, mit welcher Freude ich meine alte Behausung begrüßte und mich in meine Hängematte schlafen legte. Die kleine Reise, auf der ich wie ein Nomade gelebt hatte, war mir so wenig angenehm gewesen, daß mein eignes Haus, wie ich es nannte, mir jetzt als ein wohlgeordnetes Heimwesen erschien. Alles um mich muthete mich so traulich an, daß ich mir vornahm, mich, so lange ich auf der Insel verweilen müßte, nicht wieder auf eine so weite Strecke zu entfernen.
Eine Woche hindurch pflegte ich jetzt der Ruhe, um mich von den Anstrengungen meiner Wanderung zu erholen. Den größten Theil dieser Zeit nahm ein wichtiges Geschäft in Anspruch. Ich fertigte nämlich für mein Papchen, das sich schon wie zu Hause bei mir fühlte und gar gut bekannt mit mir geworden war, einen Käfig an. Dann dachte ich an das arme Ziegenlamm, das ich in meiner kleinen Umfriedigung eingesperrt hatte, und ging, es zu holen und ihm zu fressen zu geben. Zwar fand ich es noch am alten Ort, aber es war halb verhungert. Ich schnitt Zweige von Bäumen und Sträuchern ab, warf sie ihm vor, und nachdem es gefressen, wollte ich es wie früher anbinden, um es nach Hause zu leiten. Aber es war durch den Hunger so zahm geworden, daß es nicht nöthig schien, es zu fesseln, denn es folgte mir von freien Stücken wie ein Hund. Ich fütterte es dann regelmäßig, und das Thierchen wurde so anmuthig, zutraulich und zahm, daß es nun auch zu meiner Familie gehörte und nicht wieder von mir weichen wollte.
Jetzt war wiederum die Regenzeit der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche gekommen, und ich beging den 30. September in derselben feierlichen Weise wie früher als den Jahrestag meiner Landung. Zwei Jahre waren seit dieser nun vergangen, und meine Aussicht auf Befreiung schien noch nicht größer als am ersten Tage. Ich verwendete den ganzen 30. September zu demüthiger, dankbarer Erinnerung an die vielen wunderbaren Gnadenerweisungen, die mir in meiner Einsamkeit zu Theil geworden waren und ohne die mein Elend unendlich viel größer gewesen sein würde. Aus tiefstem Herzen dankte ich Gott, daß er mir die Augen darüber geöffnet hatte, wie ich in dieser Einsamkeit sogar glücklicher als inmitten menschlicher Gesellschaft und unter allen Freuden der Welt sein könne; daß er mir die Entbehrungen meiner Lage und den Mangel an menschlichem Verkehr durch seine Gegenwart und durch seine gnädige Offenbarung reichlich ersetzt, mir Hülfe und Trost gewährt und mich ermuthigt hatte, auf seine Vorsehung zu bauen und zu hoffen, daß er allezeit bei mir sein werde.
Allmählich kam mir zum Bewußtsein, um wie viel glücklicher mein jetziges Leben trotz aller seiner betrübsamen Umstände sei als das nichtswürdige verworfene Dasein, das ich in früheren Tagen geführt hatte. Meine Sorgen und Freuden gestalteten sich von Grund aus um, sogar meine Wünsche änderten ihre Natur, meine Neigungen waren wie vertauscht, und ich fand jetzt mein Vergnügen in ganz anderen Dingen als denen, in welchen ich es nach meiner ersten Ankunft, oder wenigstens noch vor zwei Jahren gesucht hatte.
Sonst, wenn ich umher gewandert war, auf der Jagd, oder um das Land kennen zu lernen, hatte oft eine plötzliche Angst meine Seele überfallen und mir das Herz beklemmt. Der Gedanke an die Wälder, die Berge, die Einöde, die mich umgab, und wie ich eingeschlossen sei durch die ewigen Riegel und Schlösser des Oceans, in einer öden Wildniß, ohne Hoffnung auf Erlösung, hatte mich da oft niedergebeugt. Mitten in der ruhigsten Stimmung war es oft wie ein Sturmwind über mein Gemüth gekommen, und mit gerungenen Händen hatte ich oft wie ein Kind weinen müssen. Zuweilen hatte mich's mitten in der Arbeit überfallen, dann hatte ich mich sofort niedergesetzt und stundenlang seufzend auf die Erde geblickt. Und gerade dieser Zustand war der schlimmste, denn wenn mein Kummer sich in Thränen oder Worten Luft machen konnte, pflegte er sich bald zu mildern.
Jetzt aber fing ich an, mich in anderen Stimmungen zu ergehen. Ich las täglich in Gottes Wort und wendete seine Tröstungen auf meine gegenwärtige Lage an. Eines Morgens, da ich sehr traurig war, fiel mir die Bibelstelle in die Augen:»Ich will dich nicht verlassen noch versäumen«. Sofort fiel mir auf, daß diese Worte wie für mich geschrieben seien. Weshalb wären sie auch sonst wohl gerade in dem Augenblick mir aufgestoßen, als ich mich über meine Lage grämte und klagte, daß ich ein von Gott und Menschen Verlassener sei?» Nun denn«, sagte ich mir jetzt,»wenn Gott dich nicht verlassen will, was kann dir dann geschehen, und was liegt daran, wenn auch die ganze Welt dich verläßt, da du doch siehst, daß, wenn du die ganze Welt gewännest und solltest Gottes Gnade und Segen dafür entbehren, dein Schade unvergleichlich größer sein würde!«
Von diesem Augenblick an kam ich zu der Erkenntniß, daß ich in dieser Einsamkeit seliger zu sein vermochte, als ich vermuthlich in irgend einer andern Lebenslage gewesen wäre. Nun dankte ich Gott sogar dafür, daß er mich hierher gebracht hatte. Aber ich weiß nicht, wie es kam, daß ich bei diesem Gedanken erschrak und ihm nicht Worte zu geben wagte.»Wie kannst du so heucheln«, sagte ich laut vor mich hin,»und dich stellen, als ob du Gott für eine Lage dankbar seiest, in der zufrieden zu sein du zwar dir Mühe gibst, aus der du aber doch mit herzlichem Dank dich befreien lassen würdest. «Wenn ich nun auch in solcher Weise mit meinem Danke inne hielt, so sprach ich ihn doch um so aufrichtiger dafür aus, daß mir Gott die Augen geöffnet und mich mein früheres Leben im richtigen Lichte hatte sehen, betrauern und bereuen lassen. Niemals öffnete oder schloß ich die Bibel, ohne Gott für die segensreiche Fügung zu danken, der meinen Freund in England. ohne daß ich ihm Auftrag dazu gegeben, veranlaßt hatte, sie unter meine Habe zu packen, und der mir beigestanden, daß ich sie später aus dem Schiffswrack hatte retten können.
In solcher Gemüthsstimmung begann ich mein drittes Jahr. Wenn ich aus dem Verlaufe des zweiten bezüglich meiner Arbeiten den Leser auch nicht mit dem Bericht über so viel Einzelnheiten ermüdet habe wie in der Erzählung von dem ersten, so wird man doch im Allgemeinen bemerkt haben, daß ich selten müßig gewesen war. Ich hatte meine Zeit regelmäßig eingetheilt und für gewisse tägliche Beschäftigungen fest bestimmt. Dazu gehörten vor Allem mein Gottesdienst und das Bibellesen, das ich eine Zeitlang täglich dreimal vornahm; zweitens, mein Ausgang mit dem Gewehr nach Lebensmitteln, der mich gewöhnlich drei Morgenstunden in Anspruch nahm, wenn es nicht gerade regnete; drittens die Eintheilung und Zubereitung dessen, was ich erlegt oder gefangen hatte. Auch darüber ging ein großer Theil des Tages hin. Es ist dabei übrigens nicht zu vergessen, daß um Mittag, wenn die Sonne im Zenith stand, das Uebermaß der Hitze mich am Ausgehen hinderte, so daß ich nur etwa vier Abendstunden für jene Arbeit verwenden konnte. Zuweilen vertauschte ich auch die Zeit der verschiedenen Geschäfte, arbeitete am Morgen und ging dafür am Nachmittag auf die Jagd.
Neben der Kürze der Zeit, die ich auf die Arbeit verwenden konnte, muß man die ungemeine Mühseligkeit der letzteren in Anschlag bringen und bedenken, wie viele Stunden durch Mangel an Werkzeug, an Hülfe, an Geschick bei Allem, was ich in Angriff nahm, verloren ging. So brachte ich zum Beispiel volle zweiundvierzig Tage damit zu, ein Brett für ein langes Gestell herzurichten, das ich für meine Höhle brauchte. Zwei Zimmerleute mit dem gehörigen Werkzeug und einem Sägebock hätten in einem halben Tag aus demselben Baum sechs solcher Bretter schneiden können.
Das Verfahren, was ich bei jener Arbeit einschlug, war folgendes: Zunächst war ich genöthigt einen großen Baum zu fällen, da mein Brett eine ansehnliche Breite haben mußte. Damit hatte ich drei Tage zu thun, und zwei weitere nahmen die Entfernung der Zweige und die Gestaltung des Stammes zu einem einzigen Block in Anspruch. Mit unglaublicher Arbeit hackte und hämmerte ich an den beiden Seiten des Baumes, bis er begann sich leicht genug bewegen zu lassen. Hierauf machte ich ihn auf der einen Seite von einem Ende bis zum andern eben und glatt und nahm dann dieselbe Arbeit auf der anderen Seite vor, bis das Brett etwa drei Zoll dick war. Jedermann kann sich vorstellen, wie viel Mühe diese Thätigkeit erforderte, aber Fleiß und Geduld ließen mich dieses, wie viele andere Dinge, endlich doch fertig bringen.
Es waren jetzt die Monate November und December herangekommen, und ich hoffte bald eine Ernte von meinem Reis und Korn zu gewinnen. Das Feld, das ich damit besäet, war nicht groß, da, wie bemerkt, meine Aussaat von jeder Kornart, weil ich die frühere ganze Ernte eingebüßt, nicht mehr als eine halbe englische Metze betragen hatte. Diesmal aber versprach der Ertrag reichlich zu werden. Da aber sah ich plötzlich mein Getreidefeld von allerlei Feinden bedroht, die ich nur mit Mühe von ihm fern halten konnte. Vor Allem durch die Ziegen und die hasenähnlichen Thiere, welche Geschmack an den Halmen gefunden hatten und Tag und Nacht daran fraßen, so daß viele Halme nicht zu Aehren aufgehen konnten.
Hierfür sah ich kein anderes Mittel der Abhülfe, als daß ich mit großer Arbeit und Eile eine Einfriedigung um das Stück Land zog. Innerhalb drei Wochen war das kleine Feldstück vollkommen eingehegt, und da ich bei Tage mehrmals einige von den Thieren schoß, und des Nachts meinen Hund, den ich an einen der Pfähle band, wo er die ganze Nacht hindurch bellte, zum Wächter setzte, so zogen sich die Feinde binnen kurzer Zeit weg, und das Korn wuchs hoch heran, stand gut und begann zusehends zu reifen.
Wie mir aber früher die vierfüßigen Thiere Schaden gethan hatten, so lange das Korn grün war, so drohten ihm jetzt, als es Aehren trug, die Vögel. Als ich das Feld besuchte, um zu wissen, wie es gedeihe, fand ich eine Menge gefiedertes Volk ringsherum, das nur auf den Augenblick zu warten schien, bis ich mich entfernt habe. Sofort gab ich, da ich mein Gewehr bei mir trug, Feuer unter den Schwarm, und alsbald erhob sich mitten aus dem Korn eine Wolke von Vögeln, die ich vorher gar nicht gesehen hatte.
Dies verdroß mich sehr, denn ich sah voraus, daß binnen wenigen Tagen meine ganze Hoffnung zu nichte sein, sowie daß ich es niemals bis zu einer ordentlichen Ernte bringen und später in Mangel gerathen würde. Daher beschloß ich mein Korn, wenn möglich, zu retten, und wenn ich es auch Tag und Nacht bewachen sollte. Zuerst untersuchte ich den schon angerichteten Schaden und fand, daß die Vögel eine Menge Körner bereits gefressen hatten. Da diese aber noch zu grün waren, belief sich der Verlust nicht sehr hoch, und wenn ich den Rest rettete, so konnte die Ernte wohl immer noch eine gute werden.
Während ich bei dieser Gelegenheit, neben dem Feld stehend, mein Gewehr lud, sah ich die Diebe rings auf allen Bäumen sitzen, als ob sie nur auf mein Weggehen warteten. Deshalb that ich, als ob ich mich entfernen wollte, und kaum war ich ihnen aus dem Gesicht gekommen, als sie auch schon, einer nach dem andern, wieder ins Korn fielen. Das reizte mich so, daß ich nicht Geduld hatte zu warten, bis sich noch mehre eingefunden haben würden. Ich wußte, daß jedes Korn, das sie jetzt fraßen, mich sozusagen um eine zukünftige Metze bringe. Daher schlich ich mich an die Hecke und tödtete diesmal drei. Das war auch für meinen Zweck vorläufig genug. Ich machte es mit den Erlegten, wie man es in England mit ausgezeichneten Dieben macht: ich hing sie nämlich, zum abschreckenden Exempel für die anderen, auf. Man sollte kaum denken, daß dies eine solche Wirkung hätte haben können, wie es in der That der Fall war. Denn die Vögel blieben von nun an nicht nur von meinem Korn weg, sondern zogen sich auch sehr bald ganz aus dieser Gegend der Insel weg, und ich habe, so lange die Vogelscheuchen hingen, niemals wieder einen der gefiederten Diebe in der Nähe meines Feldes bemerkt. Wie man denken kann, war ich sehr erfreut darüber; gegen Ende des December, in der zweiten Herbstzeit des Jahres, heimste ich dann mein Korn ein.
Kapitel 7
Da mir bei dieser Arbeit der Mangel einer Sense oder Sichel sehr fühlbar wurde, blieb mir nichts Anderes übrig, als mir, so gut es ging, eine solche aus einem der breiten Säbel, die ich unter den Waffen aus dem Schiffe gerettet hatte, anzufertigen. Uebrigens war meine erste Ernte nur mäßig, und das Schneiden derselben machte mir daher keine große Mühe. Ich vollzog es auf meine besondere Weise, indem ich nur die Aehren abschnitt und sie in einem großen Korb, den ich mir geflochten, heimbrachte. Dann entkörnte ich sie mit den Händen und gewann dabei nach meinem Ueberschlag (denn ich mußte nach dem bloßen Auge schätzen, da ich kein Maß hatte) nur etwa zwei Scheffel Reis und über zwei und einen halben Scheffel Gerste.
Trotzdem diente diese Ernte mir zu großer Ermuthigung, da ich hoffte, mir nun mit Gottes Hülfe in Zukunft auch Brod verschaffen zu können. Dabei zeigten sich aber neue Schwierigkeiten. Ich wußte nämlich weder, wie ich das Korn zerquetschen und Mehl daraus bereiten, noch wie ich dieses von der Kleie reinigen solle, und ebensowenig wie ich dann aus dem Mehl Brodteig gewinnen und diesen backen könne. Diese Zweifel vereint mit dem Wunsche, einen reichlichen Vorrath zu besitzen, um für meinen künftigen Unterhalt Sorge zu tragen, veranlagten mich, die jetzige Ernte noch nicht anzugreifen, sondern sie abermals ganz zur Aussaat aufzubewahren. Inzwischen nahm ich mir vor, all mein Nachdenken und meine ganze Thätigkeit auf das große Werk der Brodbereitung zu verwenden.
Jetzt konnte ich mit Wahrheit sagen, daß ich für mein tägliches Brod arbeite. Es ist fast wundersam, und wenige Menschen haben wohl je darüber nachgedacht, wie viel Dinge nothwendig sind, um nur den einen Artikel Brod bis zur Vollendung zu bringen. Mir aber, der ich im nackten Zustand der Natur lebte, kam dies, seit ich die erste Handvoll Korn gewonnen, in entmutigender Weise zu täglich klarerem Bewußtsein.
Zunächst hatte ich weder einen Pflug, die Erde zu ackern, noch einen Spaten, sie umzugraben. Diesem Mangel half ich jedoch, wie erzählt, ab, indem ich mir einen hölzernen Spaten machte. Allein mit diesem ging die Arbeit eben auch nur in hölzerner Manier von Statten, und wiewohl seine Anfertigung mich manchen Tag gekostet hatte, nutzte er sich, weil er keinen eisernen Beschlag hatte, rasch ab, und ich brachte die Arbeit mit ihm auch nur ungenügend zu Stande. Indeß schickte ich mich auch hierein mit Geduld.
Sodann, als das Korn gesäet war, fehlte es mir an einer Egge. Ich half mir, indem ich, über das Land gehend, einen großen und schweren Baumzweig darüber schleifte und die Erde also mehr kratzte als eggte. Dann brauchte ich, sobald das Korn hervorgewachsen war, gleichfalls, wie schon erwähnt ist, eine Menge von Dingen, um es einzuzäunen, zu schneiden, zu trocknen, einzubringen, zu dreschen, von der Spreu zu trennen und es dann aufzubewahren Ferner hätte ich auch eine Mühle nöthig gehabt, es zu mahlen, Siebe, um das Mehl zu reinigen, Hefe und Salz, um Brod daraus zu machen, und einen Ofen, um es zu backen. Trotzdem ich alle diese Dinge entbehrte, war mir das Korn doch von unschätzbarem Vortheil. Die Mühsamkeit und Langwierigkeit der Arbeit hatte, abgesehen davon, daß sie eben nicht zu äudern war, insofern für mich keine Bedeutung, als ich ja mit meiner Zeit nicht so sparsam zu sein brauchte. Ich hatte einen Theil des Tages für jene Arbeiten ein und für allemal bestimmt, und da ich Willens war, vorläufig Nichts von dem Korn für Brod zu verwenden, so konnte ich während der nächsten sechs Monate meine ganze Thätigkeit und Erfindungsgabe zur Beschaffung von Gerätschaften benutzen, welche für die spätere Verwerthung meines Getreides nöthig waren.
Da ich jetzt Samen genug besaß, um mehr als einen Morgen Land damit zu bestellen, mußte ich mir zunächst ein größeres Stück Erde bearbeiten. Vorher brauchte ich über eine Woche zur Anfertigung eines Spatens, der aber, wie gesagt, doch nur ein trauriger Nothbehelf wurde und doppelte Anstrengung bei der Arbeit nöthig machte. Nachdem ich auch damit zu Stande gekommen, streute ich meinen Samen in zwei große, flache Landstücke, die meinem Hause zunächst gelegen waren und mir tauglich schienen. Ich umgab sie mit einer dichten Hecke von demselben Strauchwerk, das ich schon früher angepflanzt hatte, und das, wie ich wußte, von raschem Wachsthum war, so daß ich binnen Jahresfrist auf eine starke lebendige Hecke rechnen konnte, die nur geringer Ausbesserung bedurfte. Ich brauchte zu dieser Arbeit nicht weniger als drei volle Monate, weil der größte Theil dieser Zeit in die Regenperiode fiel, in der ich nicht oft ausgehen konnte.
Während des Regens unterhielt ich mich zu Hause bei der Arbeit damit, daß ich meinen Papagei sprechen lehrte. Es gelang mir bald, ihm seinen eigenen Namen beizubringen, so daß er ihn zuletzt ganz deutlich aussprach. Pol war das erste Wort, was ich auf der Insel aus einem andern als meinem eignen Munde hörte.
Daneben verwendete ich meine Hauptthätigkeit auf ein neues großes Unternehmen. Längst hatte ich nämlich auf Mittel und Wege gesonnen, mich mit einigen irdenen Gefäßen zu versehen, die ich schmerzlich entbehrte. Ich war überzeugt, daß ich, sobald sich nur eine einigermaßen geeignete Art Thon finden ließe, daraus Töpfe formen könnte, die, in der Sonne des heißen Klimas getrocknet, hart und stark genug zur Benutzung und namentlich zur Aufbewahrung trocken zu haltender Sachen sein würden. Da ich sie vor Allem um Korn, Mehl und dergleichen zu bereiten brauchte, so beschloß ich jetzt einige solche möglichst große Gefäße im Voraus anzufertigen, an die ich weiter keine Ansprüche machte, als daß sie wie Krüge aufrecht stehen und was ich hinein thäte wohl verwahren könnten.
Der Leser würde mich bedauern, oder wahrscheinlicher auslachen, wenn ich ihm erzählte, wie viel ungeschickte Versuche ich hierbei unternahm, was für wunderliche, plumpe, häßliche Dinger ich zu Stande brachte, wie viele davon zusammen oder auseinander fielen, weil der Thon nicht steif genug war, die Form zu halten; wie viele ferner in der starken Sonnenhitze sprangen und wie viele vom bloßen Anfassen entzwei gingen. Nachdem ich mit großer Mühe den Thon gefunden, ihn ausgegraben, angefeuchtet nach Hause getragen und verarbeitet hatte, gelang es mir, binnen ungefähr zwei Monaten nicht mehr als zwei große häßliche Dinger (Krüge darf ich sie nicht nennen) fertig zu bringen.
Als die Sonne diese hart und trocken gebrannt hatte, flocht ich sie in Körbe, damit sie nicht zerbrechen sollten. Den kleinen Raum zwischen den Töpfen und dem Geflecht füllte ich mit Reis- und Gerstenstroh aus und hoffte nun, diese Gefäße würden Korn und Mehl aufbewahren können.
Während meine Arbeit in Bezug auf die großen Töpfe mangelhaft ausgefallen war, hatte ich bessern Erfolg bei der Verfertigung von allerlei kleinem Geschirr, z. B. runden Töpfchen, flachen Schüsseln, Krügen und Tiegeln und was mir sonst noch unter der Hand gerieth. Die Sonnenglut brannte diese Sachen außerordentlich fest.
Dies Alles aber erfüllte noch nicht meinen Zweck, ein irdenes Gefäß herzustellen, welches Flüssigkeiten halten und dem Feuer ausgesetzt werden könnte; dazu war keins von jenen Gefäßen zu brauchen. Da begegnete es mir einige Zeit später, als ich eines Tages ein ziemlich großes Feuer, das ich angezündet, um mir Fleisch daran zu braten, auslöschen wollte, daß ich darin einen Scherben von einem meiner irdenen Gesäße fand, steinhart gebrannt und ziegelroth. Ich war sehr angenehm überrascht durch diesen Anblick und sagte mir, daß, wenn ein solches Stück von meinem Geschirr sich brennen ließe, dies auch mit den ganzen Gefäßen möglich sein müsse.
Dies veranlaßte mich nachzudenken, wie ich mein Feuer einzurichten habe, um einige Töpfe daran zu brennen. Ich hatte keinen Begriff von einem Brennofen, wie die Töpfer sie benutzen, oder vom Glasiren mit Blei, von welchem letzteren ich ja eine Quantität besaß, die ich wohl dazu hätte verwenden können. Lediglich zum Versuche stellte ich drei große Tiegel und zwei oder drei Töpfe aufeinander und vertheilte mein Brennholz rings herum, mit einem großen Haufen Asche als Unterlage; dann versah ich das Feuer von Außen her und obenauf mit frischem Brennmaterial, bis ich die Töpfe innerhalb des Feuers durch und durch roth glühend werden sah, ohne daß sie zerplatzten. Als ihre Farbe hellroth geworden war, ließ ich sie in derselben Hitze noch etwa fünf bis sechs Stunden stehen, bis ich wahrnahm, daß einer von ihnen anfing zu schmelzen oder zu fließen, ohne jedoch entzwei zu springen. Denn der dem Thon beigemischte Sand schmolz durch die scharfe Hitze und würde zu Glas geworden sein, wenn ich so fortgefahren hätte. Ich milderte daher das Feuer nach und nach, bis die Töpfe die rothe Farbe verloren; nachdem ich die ganze Nacht dabei gewacht und dafür gesorgt hatte, daß das Feuer nicht zu schnell nachließ, hatte ich am andern Morgen drei sehr gute, ich will nicht sagen schöne, Tiegel und zwei andere irdene Gefäße, so hart gebrannt, als es nur zu wünschen war. Der eine davon erschien völlig glasirt durch den herausgeflossenen Sand.
Ich habe kaum nöthig zu sagen, daß ich nach diesem Experiment keinerlei irdenes Geschirr zu meinem Gebrauch mehr entbehrte; es fiel aber, wie ich nicht verhehlen will, hinsichtlich der Form sehr unvollkommen aus. Machte ich doch meine Gefäße ganz auf dieselbe Art, wie Kinder aus Sand Topfkuchen backen, oder wie eine Köchin, die nie gelernt hat mit Teig umzugehen, eine Pastete formen würde.
Niemals aber hat wohl Jemand größere Freude über einen unbedeutenden Gegenstand gehabt, als ich sie empfand, da es mir endlich gelungen war, einen irdenen Topf zu machen, der das Feuer zu ertragen vermochte. Ich konnte kaum die Zeit erwarten, bis mein Geschirr kalt geworden war und ich einen der Töpfe halb mit Wasser angefüllt wieder an das Feuer setzen und Fleisch darin kochen konnte, was ausgezeichnet gelang. Von einem Stück Fleisch einer jungen Ziege bereitete ich mir sehr gute Bouillon, hatte aber freilich weder Graupen, noch sonstige Zuthaten, um sie so schmackhaft zu machen, wie ich sie wohl gern gehabt hätte.
Meine Gedanken richteten sich nun zunächst auf Anfertigung eines steinernen Mörsers, um das Korn darin zu zerstampfen. Denn daß mein einziges Paar Hände es bis zum Kunstwerk einer Mühle bringen werde, daran war nicht zu denken. Für diese aber einen Ersatz zu finden, machte mir nicht geringe Schwierigkeit. Unter allen Handwerken der Welt war ich zu dem der Steinhauerei am wenigsten ausgerüstet. Es fehlten mir nicht weniger als alle Werkzeuge, um die Sache in Angriff zu nehmen. Manchen Tag wendete ich daran, einen Stein ausfindig zu machen, der groß genug zum Aushöhlen und zur Umgestaltung in einen Mörser wäre; aber ich fand durchaus nur solche, die in dem Felsen fest saßen und die ich auf keinerlei Weise ausgraben oder ausschneiden konnte. Auch waren die Felsen auf der Insel an sich nicht von hinreichender Härte. Sie bestanden vielmehr alle aus einer sandigen, bröckeligen Steinart, die weder die Wucht einer schweren Keule aushalten konnte, noch geeignet war, das Korn darin, ohne es mit Sand zu vermengen, klein zu stoßen. Nachdem ich sehr viel Zeit mit dem Suchen verloren hatte, gab ich es auf und beschloß, mich nach einem harten Holzklotz umzusehen, den ich auch in der That viel leichter fand. Als ich einen, den ich fortzubewegen vermochte, ausgesucht hatte, rundete ich ihn ab und formte ihn an der Außenseite mittels Axt und Hacke. Dann arbeitete ich mit unendlicher Mühe durch Feuer eine Höhlung hinein, wie die Indianer in Brasilien ihre Canoes auszuhöhlen pflegen. Hierauf fertigte ich mir eine große schwere Keule oder richtiger einen Schlägel von dem sogenannten Eisenholz an und verwahrte beides für die Zeit nach meiner nächsten Ernte, wo ich das Korn zu mahlen, oder vielmehr es zu Mehl zu stoßen und dann Brod daraus zu backen gedachte.
Die nächste schwere Aufgabe bestand in der Beschaffung eines Siebes oder Beutels, um das Korn darin zu reinigen und es von den Hülsen zu befreien. Denn ohne ein solches Ding Brod herzustellen hielt ich für unmöglich, wagte aber auch kaum auf ein Gelingen dieses Unternehmens zu hoffen. Ich hatte nicht das Mindeste, womit es allenfalls zu bewerkstelligen gewesen wäre, zum Beispiel Gaze oder ähnliches feines dünnes Zeug. Mehre Monate hindurch wußte ich nicht, wie ich die Sache angreifen sollte; besonders deshalb, weil, was ich noch an Leinwand besaß, aus bloßen Lumpen bestand. Zwar hatte ich Ziegenhaare, aber ich verstand sie nicht zu spinnen, und hätte ich es auch verstanden, so fehlte mir doch jedes nöthige Werkzeug dazu. Endlich fiel mir als einziges Auskunftsmittel ein, daß sich unter den Matrosenkleidungsstücken, die ich aus dem Schiff gerettet hatte, auch einige Halstücher von Kattun oder Mousselin befanden. Aus diesen verfertigte ich denn drei kleine Beutel, die ihren Zweck leidlich erfüllten, und behalf mich damit mehre Jahre hindurch. Wie ich es später anfing, werde ich seiner Zeit berichten.
Nun mußte auch die Art des Backens selbst überlegt werden und wie ich es anstellen sollte Brod zu bekommen, wenn ich erst das Korn haben würde. Erstens nämlich fehlte mir die Hefe; da es für diesen Mangel absolut keine Abhülfe gab, so machte ich mir darüber weiter kein Kopfzerbrechen. Aber auch um einen Ofen war ich sehr verlegen. Endlich verfiel ich auf folgenden Ausweg: ich verfertigte einige sehr breite, aber flache irdene Gefäße, etwa zwei Fuß im Durchmesser und nicht mehr als neun Zoll hoch. Diese brannte ich im Feuer, wie ich es mit den andern gemacht hatte, und stellte sie vorläufig bei Seite. Als ich dann später ans Backen ging, zündete ich ein großes Feuer auf einem Herd an, den ich mit einigen viereckigen Ziegeln, gleichfalls aus eigner Fabrik, gebaut hatte, bedeckte, sobald das Brennholz ziemlich zu Asche oder zu lebendigen Kohlen verbrannt war, damit den Herd gänzlich und ließ sie da liegen, bis die Platte ganz heiß war. Dann fegte ich alle Asche ab und legte die Brode darauf, stülpte die irdenen Schüsseln darüber und häufte dann die Asche wieder von Außen darum, um so die Hitze zusammenzuhalten und zu verstärken. Auf diese Weise buk ich mein Gerstenbrod so gut wie in dem besten Backofen der Welt und bildete mich nebenbei in ganz kurzer Zeit auch zum Conditor aus. Denn ich bereitete mir auch verschiedene Arten von Kuchen und Puddings aus Reis. Freilich Pasteten zu backen, mußte ich bleiben lassen, da ich ja doch Nichts gehabt hätte, um sie zu füllen, außer etwa Vögel und Ziegenfleisch.
Es kann nicht Wunder nehmen, daß über alle diese Dinge der größte Theil des dritten Jahres meines Aufenthalts auf der Insel verstrich: besonders wenn man bedenkt, daß ich zwischendurch auch meine erste Ernte und die Bestellung des Feldes zu besorgen hatte. Ich schnitt mein Korn zur rechten Zeit, brachte es so gut ich konnte ein und bewahrte es in den Aehren in meinen großen Körben auf, bis ich Zeit fand es auszureiben. Denn ich hatte ja weder Tenne, noch Flegel, um es regelrecht dreschen zu können.
Da jetzt meine Kornvorräthe zuzunehmen begannen, wurde es nöthig, auch die Scheunen größer zu bauen. Ich brauchte einen besondern Raum, um meinen Vorrath aufzuheben, denn das Korn hatte sich in dem Maße vervielfältigt, daß ich ungefähr zwanzig Scheffel Gerste und ebenso viel oder mehr Reis besaß. Von nun an beschloß ich, aus dem Vollen damit zu wirthschaften, besonders da mein Brod jetzt schon seit einer ganzen Weile völlig aufgezehrt ward. Ich nahm mir vor darauf zu achten, wie viel ich in Zeit von einem Jahr verbrauchen würde, um nur einmal jährlich säen zu müssen. Da sich hierbei ergab, daß die vierzig Scheffel Gerste und Reis viel mehr waren, als ich in einem Jahre verzehren konnte, beschloß ich, alle Jahre dieselbe Quantität wie das letzte Mal zu säen, in der Hoffnung, dies würde hinreichen, mich reichlich mit Brod und dergleichen zu versorgen.
Während der ganzen Zeit, in welcher diese Angelegenheiten mich beschäftigten, schweiften, wie man sich denken kann, meine Gedanken auch oftmals nach dem fernen Lande hinüber, welches ich von der andern Seite der Insel aus erblickt hatte. Ich wünschte im Stillen an jener Küste zu sein, die ich für das feste Land und für eine bewohnte Gegend hielt, und von wo aus ich mich auf eine oder die andere Art weiter zu befördern und vielleicht endlich Mittel und Wege zur Flucht zu finden hoffte. An die Gefahren, die mir dabei drohen würden, dachte ich gar nicht. Wie leicht hätte ich den Wilden in die Hände fallen können, und zwar solchen, die ich Ursache hatte für schlimmer zu halten als die Löwen und Tiger in Afrika. Wäre ich einmal in ihre Gewalt gerathen, dann war tausend gegen eins zu wetten, daß sie mich tödten, vielleicht gar auffressen würden; denn ich hatte gehört, daß die Bewohner der karaibischen Küste Cannibalen oder Menschenfresser seien, und nach meiner Berechnung der Breitengrade wußte ich mich nicht weit von dieser Küste entfernt. Aber auch wenn keine Cannibalen dort lebten, mußte ich doch annehmen, die Bewohner jener Gegend würden mich wahrscheinlich tödten. Hatten sie es doch mit vielen Europäern, die in ihre Hände gefallen, so gemacht, sogar wenn diese in Menge zusammen gewesen waren. Wie viel mehr drohte das mir Einzelnem, der ich mich wenig oder gar nicht vertheidigen konnte. Alle diese ernstlich zu erwägenden Bedenken, die später auch wirklich in meiner Seele auftauchten, flößten mir anfangs gar keine Besorgniß ein, und mein Sinn stand sehnsüchtig danach, auf das andere Ufer hinüber zu gelangen.
Wie sehr wünschte ich jetzt meinen Knaben Xury und das Langboot mit dem dreieckigen Segel herbei, in welchem ich über tausend Meilen an der afrikanischen Küste entlang gefahren war. Doch das blieb eine vergebliche Sehnsucht. Da kam mir eines Tages der Einfall, mich einmal nach dem Boot von unserem Schiffe wieder umzusehen, das, wie ich seiner Zeit erzählt habe, vom Sturm weit auf das Ufer hinauf getrieben war, als wir Schiffbruch gelitten hatten. Es befand sich auch noch beinahe an derselben Stelle, aber nicht ganz in der früheren Lage; die Gewalt von Wind und Wellen hatte es fast völlig umgekehrt und gegen einen hohen sandigen Uferrand getrieben, wo es mit dem Boden nach oben gewandt, aber nicht mehr wie anfangs von Wasser umgeben, lag. Wenn ich Arbeitskräfte genug gehabt hätte, um es wieder in Stand zu setzen und es flott zu machen, so würde das Boot noch ganz brauchbar gewesen sein, und es wäre mir dann ein Leichtes gewesen, darin nach Brasilien zurückzukehren. Obgleich ich nun hätte voraussehen können, daß ich ebenso gut die Insel selbst fort zu bewegen vermocht hätte, als das Boot aufzurichten und es auf seinen Bauch zu stellen, so ging ich dennoch in den Wald, schnitt Hebel und Rollen und brachte sie an das Boot, um zu versuchen, was ich ausrichten könnte. Dabei meinte ich, wenn ich es nur umkehren könnte, sei der Schaden, den es erlitten, leicht auszubessern, und ich würde dann leicht damit in See gehen können.
Ich sparte keine Mühe an diesem fruchtlosen Stück Arbeit und verwendete, glaube ich, drei bis vier Wochen darauf. Als ich es endlich unmöglich fand, das Boot mit meinen geringen Kräften zu heben, verfiel ich darauf, den Sand wegzuschaufeln, um es zu unterminiren und dadurch zu Falle zu bringen, und stellte Holzklötze auf, um es zu stützen und seinem Fall die nöthige Richtung zu geben.
Nachdem ich aber damit zu Stande gekommen war, zeigte es sich mir unmöglich, das Fahrzeug wieder aufzurichten, oder darunter zu gelangen, und viel weniger noch, es vorwärts nach dem Wasser hinzubewegen. So sah ich mich denn gezwungen, die Sache aufzugeben. Trotzdem aber so die Hoffnung, die ich auf das Boot gesetzt hatte, vereitelt war, stieg mein Verlangen, mich auf das Meer zu wagen, je mehr die Möglichkeit dazu verschwand, statt daß es sich minderte. Mit der Zeit kam ich auf den Gedanken, ob es nicht möglich sei, mir selbst ein Canoe oder eine Pirogue zu fertigen, wie sie die Eingeborenen jener Gegenden, ohne Werkzeuge, ja ich möchte sagen fast ohne alle Arbeit aus großen Baumstämmen machen. Es schien mir das bei genauerer Ueberlegung auch nicht nur möglich, sondern sogar leicht, und ich freute mich sehr darauf, den Plan auszuführen. Hatte ich doch dazu weit mehr Hülfsmittel als die Neger oder Indianer. Dabei bedachte ich aber ganz und gar nicht den besondern anderen Umstand, mit dem ich zu kämpfen haben würde, den Mangel an Kräften, nämlich zum Transport des fertigen Canoe's ins Wasser. Das mußte mir viel größere Schwierigkeiten machen, als der Mangel an Werkzeugen den Indianern. Denn was konnte es mir helfen, wenn ich, nachdem ich im Walde einen dicken Baum aufgesucht und mit vieler Mühe gefällt, ihn hierauf mit Hülfe meines Handwerkszeugs behauen und an der Außenseite ihm die richtige Form gegeben, ihn auch inwendig ausgehöhlt und so in ein Boot verwandelt hätte, dieses nach aller Mühe an seiner Stelle liegen lassen mußte und nicht im Stande war, es flott zu machen! Ich hatte nicht im Mindesten, bevor ich an dem Boot zu arbeiten anfing, über dies Verhältniß nachgedacht; denn sonst würde sich mir ja sofort die Frage aufgedrängt haben, wie ich es ins Meer schaffen solle. Nein, meine Gedanken waren so eingenommen von der beabsichtigten Seereise, daß ich nicht einen Augenblick überlegte, in welcher Weise ich das Ding vom Lande weg bekommen könne. Und doch lag es in der Natur der Sache, daß es mir leichter sein mußte, das Boot fünfundvierzig Meilen weit im Wasser, als auch nur ebenso viel Schritte auf dem Land, nämlich von der Stelle, wo es lag, bis ans Ufer fortzubringen. Ich machte mich an die Anfertigung meines Fahrzeugs in so wahnwitzigem Eifer, als ob mir mein Bischen Menschenverstand abhanden gekommen wäre. Nicht als ob die Frage, wie ich es anfangen sollte, das Boot flott zu machen, mir nicht nachträglich oft durch den Kopf gegangen wäre. Aber ich schnitt dieselbe ein- für allemal durch die alberne Antwort ab: Mache nur erst das Boot fertig, das Uebrige wird sich dann finden. So begann ich denn in leichtsinniger Hast mein Werk. Zunächst fällte ich eine Ceder. Es ist sehr fraglich, ob Salomo zum Bau des Tempels in Jerusalem einen so prachtvollen Stamm, wie der meinige war, zu verwenden gehabt hat. Derselbe maß an seinem unteren Ende, dicht an der Wurzel, fünf Fuß zehn Zoll im Durchmesser und zweiundzwanzig Fuß weiter nach oben immer noch vier Fuß elf Zoll; am oberen, noch mehr verjüngten Theil gliederte er sich in Aeste. Mit unbeschreiblicher Mühsal hatte ich diesen Baum umgehauen; zwanzig Tage lang hieb und hackte ich dann an ihm herum, und vierzehn weitere Tage erforderte das Beseitigen der Aeste und Zweige und der ganzen ungeheuren Krone, was ich mit Axt und Beil bewerkstelligte. Dann verwendete ich einen ganzen Monat darauf, ihn so zu behauen, daß er Form und richtige Verhältnisse annahm und eine Art von Kiel bekam, damit er aufrecht, wie es sich gehört, schwimmen konnte. Weitere drei Monate kostete es mich, das Innere zu höhlen und zu einem richtigen Boote auszuarbeiten. Dies Letztere brachte ich ohne Feuer lediglich mit Hammer und Meißel, wenn auch nur mit großer Mühsal zu Stande, und so hatte ich denn endlich eine sehr hübsche Pirogue fertig, die sechsundzwanzig Personen fassen konnte, also auch hinlänglich groß genug war, mich und mein Hab und Gut aufzunehmen.
Als das Werk vollendet dastand, freute ich mich außerordentlich darüber. Das Boot war viel größer, als ich je ein aus einem Baumstamm gefertigtes Canoe gesehen hatte, und manchen sauern Hieb hatte es mich gekostet, das kann ich versichern. Hätte ich es nun auch in das Wasser zu schaffen vermocht, so bezweifle ich gar nicht, daß ich die wahnsinnigste und unausführbarste Reise, die je unternommen worden, darin angetreten haben würde. Alle meine Versuche aber, es an das Wasser zu bringen, schlugen fehl, obgleich ich auch hierauf Mühe genug verwendete. Das Boot lag nur etwa hundert Schritt vom Ufer entfernt, aber gleich die erste Schwierigkeit bestand darin, daß die Insel nach der Flußmündung hin eine Anhöhe bildete. Um dies Hinderniß zu beseitigen, entschloß ich mich, die Erde abzugraben und auf solche Weise einen Abhang herzustellen. Ich begann die unendlich mühselige Arbeit mit Feuereifer. Wer läßt sich auch eine Mühe verdrießen, wenn die Freiheit damit zu erwerben steht! Als jedoch diese Aufgabe gelöst und die erste Schwierigkeit gehoben war, befand ich mich um nichts weiter als vorher, denn ich konnte jetzt mein Canoe ebensowenig von der Stelle bewegen, wie früher das andere Boot. Nun maß ich die Entfernung aus und beschloß, einen Kanal zu graben, um, da ich mein Boot nicht nach dem Wasser zu schaffen vermochte, das Wasser nach dem Boote hinzuleiten. Auch dieses Werk fing ich muthig an, jedoch als ich näher darüber nachdachte und ausrechnete, wie tief und breit ich graben müßte und wie ich die ausgegrabene Erde fortschaffen sollte, fand ich, daß ich mit den beiden mir einzig zu Gebote stehenden Händen zehn bis zwölf Jahre nöthig haben würde, ehe ich damit fertig sein könnte. Denn die Küste lag so hoch, daß der Kanal am oberen Ende wenigstens zwanzig Fuß tief werden mußte. Endlich, wenn auch mit großem Widerstreben, gab ich auch diesen Versuch auf.
Ich war herzlich bekümmert darüber, und jetzt erst sah ich ein, wie thöricht es ist, ein Werk zu beginnen, ehe man die Kosten veranschlagt und seine Fähigkeit, es durchzuführen, gehörig geprüft hat.
Mitten in diesen Arbeiten ging das vierte Jahr meines Aufenthalts auf der Insel zu Ende. Ich feierte den Jahrestag mit derselben Andacht und in gleicher Sammlung des Gemüths als die frühern Male. Denn durch fortwährendes Studium und ernstliches Forschen in Gottes Wort und mit Hülfe seiner Gnade war ich zu einer viel tieferen religiösen Erkenntniß als früher gelangt. Ich sah jetzt alle Dinge anders an als sonst. Die Welt betrachtete ich jetzt als etwas mir Fernliegendes, das mich Nichts anging, davon ich Nichts zu erwarten hätte und danach mich nicht verlangte. Ich hatte jetzt Nichts mehr mit ihr zu schaffen, noch war es wahrscheinlich, daß ich es je wieder haben würde. Darum stellte ich sie mir vor, wie wir vielleicht im Jenseits thun werden, als einen Ort, an dem wir gelebt, den wir aber verlassen haben, und wohl konnte ich sagen, wie Vater Abraham zum reichen Manne:»Zwischen mir und Euch ist eine große Kluft befestiget«.
Vor allen Dingen war ich hier abgesondert von aller Bosheit der Welt. Für mich gab es weder Fleischeslust, noch Augenlust, noch Eitelkeit des Lebens. Ich begehrte Nichts, denn ich besaß Alles, was ich genießen konnte. Ich war Herr der ganzen Insel; wenn es mir beliebte, konnte ich mich König oder Kaiser des Landes nennen, das ich in Besitz genommen hatte. Es gab keinen Rivalen, keinen Prätendenten neben mir, Keinen, der meine Herrschaft angefochten oder getheilt hätte. Ich hätte ganze Schiffsladungen voll Korn produciren können, aber ich vermochte sie nicht nutzbar zu machen, und darum säete ich nur eben so viel aus, als mein eigener Bedarf erforderte. Auch Wasser- und Landschildkröten hatte ich in Menge, aber mehr als von Zeit zu Zeit eine einzige konnte ich nicht verwenden. Ich besaß Bauholz genug. um eine ganze Flotte von Schiffen damit bauen, und Trauben genug, um mit ihnen als Wein oder Rosinen diese Flotte vollständig befrachten zu können. Jedoch was half mir das, was ich nicht nützen konnte? Ich hatte genug zu essen und meine Lebensnothdurft zu befriedigen, was sollte ich mit dem Uebrigen machen? Wenn ich mehr Thiere tödtete, als ich aufessen konnte, so mußte das Fleisch von dem Hund oder den Würmern gefressen werden. Säete ich mehr Korn, als ich verbrauchen konnte, so verdarb es; die Bäume, die ich fällte, blieben liegen und verfaulten; ich konnte sie zu nichts Anderem als zu Brennholz verwenden, und auch das brauchte ich nur, um meine Speisen zu bereiten.
Kurz, Natur und Erfahrung lehrten mich, bei genauer Betrachtung, daß alle guten Dinge dieser Welt nicht mehr Werth für uns haben, als in so weit wir sie gebrauchen können. Wie viel wir auch immer anhäufen mögen, um es Anderen zu geben, wir genießen nur gerade so viel, als wir selbst nöthig haben, und nicht mehr. Der habgierigste, gewinnsüchtigste Geizhals in der Welt würde vom Laster der Begehrlichkeit geheilt worden sein wenn er an meiner Stelle gewesen wäre; denn ich besaß ja unendlich viel mehr, als ich je verwenden konnte. Es blieb mir Nichts zu wünschen übrig, außer einigen Kleinigkeiten, die mir allerdings sehr willkommen gewesen sein würden. Ich war, wie ich früher erwähnt habe, im Besitz eines Beutels voll Geld, das aus Silber und Gold ungefähr im Werth von sechsunddreißig Pfund Sterling bestand. Aber, du lieber Gott! da lag nun das schlechte, erbärmliche, unnütze Zeug; ich hatte keine Art von Verwendung dafür, und oft dachte ich bei mir, wie gern ich eine Handvoll davon für eine Anzahl Tabakspfeifen oder für eine Handmühle, um mein Korn damit zu mahlen, geben würde. Ja, das Ganze hätte ich mit Freuden hingegeben für ein wenig englischen Runkelrüben- und Mohrrübensamen oder für ein Häuflein Erbsen und Bohnen und eine Flasche voll Tinte.
Wie jetzt die Sachen standen, hatte ich nicht den geringsten Vortheil oder Gewinn von jenem Mammon. Er lag im Kasten und verrostete durch die Feuchtigkeit der Höhle in der nassen Jahreszeit. Und hätte ich den Kasten voller Diamanten gehabt, so wäre es nicht anders gewesen; sie hätten keinen Werth für mich gehabt, weil ich sie nicht brauchen konnte.
Mit der Zeit war mein Leben viel freudiger geworden als im Anfange, sowohl das leibliche als das geistige. Ich setzte mich oftmals mit Dankbarkeit zu Tische und bewunderte die göttliche Vorsehung, die mir so den Tisch in der Wüste gedeckt hatte. Ich lernte mehr die Lichtseite meiner Lage ansehen und weniger bei der Schattenseite verweilen, und das gewährte mir zuweilen so viel innere Freude, daß ich es gar nicht auszudrücken vermag. Diesen Umstand erwähne ich hier, um ihn unzufriedenen Leuten einzuprägen, die nicht behaglich genießen können, was Gott ihnen bescheert hat, weil sie immer Dinge ansehen und begehren, die er ihnen versagt hat. Alle Unzufriedenheit über das, was uns fehlt, scheint mir aus unserm Mangel an Dankbarkeit für das, was wir haben, zu entspringen.
Noch eine andere Betrachtung war mir von großem Nutzen und würde das unzweifelhaft einem Jeden sein, der in solche Trübsale wie die meinigen gerathen ist. Ich verglich oft meinen jetzigen Zustand mit den Erwartungen, die ich anfangs davon gehegt hatte, oder vielmehr mit der Lage, in die ich unfehlbar gerathen sein würde, wenn nicht Gottes gütige Vorsehung es wunderbar gefügt hätte, daß das Schiff so nahe an meine Küste angetrieben wurde, wo ich es nicht nur hatte erreichen können, sondern auch Alles, was ich daraus mitnehmen wollte, zu meiner Erleichterung und Bequemlichkeit sicher ans Land zu bringen vermocht hatte. Denn ohne dies hätte es mir ja an jedem Handwerkszeug zu meinen Arbeiten gefehlt, an jeder Waffe zu meiner Vertheidigung und an Pulver und Blei, um mir Nahrung zu verschaffen.
Ganze Stunden, ich möchte sagen ganze Tage verwendete ich darauf, mir in den lebhaftesten Farben auszumalen, was ich angefangen haben würde, wenn ich Nichts aus dem Schiffe gerettet hätte. Nichts als Fische und Schildkröten wären in diesem Falle zu meiner Nahrung vorhanden gewesen, und da ich diese erst nach längerer Zeit auffand, hätte ich wahrscheinlich schon früher verhungern oder, wäre das auch nicht geschehen, doch stets wie ein Wilder leben müssen. Wenn es mir z. B. gelungen wäre, durch List eine Ziege oder einen Vogel zu tödten, so hätte ich ja nicht gewußt, wie ich das Thier hätte aufschneiden oder abhäuten, oder das Fleisch von dem Fell und den Eingeweiden trennen, oder es zerlegen sollen. Es wäre mir nichts Anderes übrig geblieben, als es mit den Zähnen zu zernagen und mit den Nägeln zu zerreißen wie ein wildes Thier.
Solche Erwägungen machten mich sehr erkenntlich für die Güte der Vorsehung und sehr dankbar in meiner gegenwärtigen Lage, trotz all ihren Entbehrungen und all ihren Mißlichkeiten. Ich möchte das auch besonders Denen zur Nachachtung empfehlen, die geneigt sind, in ihrem Elend zu sagen:»Gibt es denn noch andere Leiden, die so groß sind wie die meinigen?«Mögen sie einsehen, wie viel schlimmer es Andere haben und sie selbst es haben könnten, wenn der Himmel es für gut befunden hätte. Wieder ein anderer Gedanke, der auch dazu beitrug, mein Herz mit Trost zu erfüllen, war der, daß ich meine Lage mit jener verglich, die ich verdient hatte, und in die von der Hand Gottes versetzt zu werden, ich sonach hätte erwarten müssen. Ich hatte ein schreckliches Leben geführt, völlig ohne Gotteserkenntniß und ohne Gottesfurcht. Von Vater und Mutter war ich zwar gut unterwiesen worden, auch hatten sie nicht unterlassen, mir schon frühzeitig eine heilige Scheu vor Gott und einen Begriff von meinen Pflichten und von dem, was der Zweck meines Daseins von mir forderte, beizubringen. Aber ach! ich war so früh in das Leben und Treiben der Seeleute gerathen, das vor allen anderen ein gottloses zu sein pflegt (obgleich ja gerade der Seemann immerfort die Allmacht Gottes in den Schrecken der Natur unmittelbar vor Augen hat), daß das Bischen Religion, was ich bisher noch gehabt hatte, von meinen Genossen vollends aus mir herausgelacht war. Dazu hatte sich die mir zur Gewohnheit gewordene Verachtung der Gefahr und des Todes gesellt und später der gänzliche Mangel an Gelegenheit, mit irgend einem anderen Wesen meines Gleichen zu verkehren und irgend etwas Gutes oder zum Guten Führendes zu hören.
So weit entfernt von allem Guten war ich gewesen, so ohne jeden Begriff von dem, was ich war und was ich sein sollte, daß ich bei den wunderbarsten Errettungen, die ich erfahren, wie z. B. bei meiner Flucht von Saleh, bei meiner Aufnahme auf dem portugiesischen Schiffe, bei dem Gelingen meiner Unternehmungen in Brasilien, bei dem Eintreffen meiner Ladung aus England u. s. w., nicht ein einziges Mal ein» Gott sei Dank!«auch nur gedacht, geschweige denn ausgesprochen hatte. Auch in der allergrößten Noth war es mir nie eingefallen, ihn anzurufen oder auch nur zu sagen:»Herr erbarme dich meiner!«Nein, nicht einmal den Namen Gottes hatte ich in den Mund genommen, es sei denn, um dabei zu fluchen oder ihn zu lästern.
Viele Monate hindurch war meine Seele schwer bekümmert gewesen, wenn ich über mein früheres böses und verstocktes Leben nachgedacht, wenn ich um mich geblickt und die besondere Fügung betrachtet hatte, die seit meiner Ankunft an diesem Orte über mir waltete, und wenn ich erwog, wie reich mich Gott mit Wohlthaten überschüttet hatte. Hatte er mich doch nicht nur gelinder gestraft, als meine Sünden verdienten, sondern auch noch überreichlich für mich gesorgt. Dieser Umstand bestärkte mich auch in der Hoffnung, daß meine Reue angenommen sei, und daß Gott mir Gnade geschenkt habe.
Solche Betrachtungen führten mich nicht allein zu einer völligen Ergebung in den Willen Gottes und alle seine Schickungen, sondern sogar zu einer aufrichtigen Dankbarkeit für meine gegenwärtige Lage. Ich erkannte nun klar, daß ich mich nicht beklagen dürfte, da mir ja das Leben geschenkt und ich nicht einmal nach Verhältniß meiner Sünden gestraft worden sei, daß ich so viele Wohlthaten genieße, die ich an diesem Orte nicht erwarten durfte. Ich sagte mir, ich müsse allen Kummer fahrenlassen und mich vielmehr freuen und alle Tage für mein tägliches Brod danken, welches mir nur durch eine Menge von Wundern bereitet werden konnte. War denn nicht das Wunder, durch welches ich gesättigt wurde, ebenso groß als das, durch welches Elias von den Raben gespeist wurde, ja, gehörte zu jenem nicht vielmehr eine ganze Reihenfolge von Wundern? Gab es im ganzen Bereich der unbewohnten Erde einen Ort, wohin verschlagen ich mich besser befunden haben würde als auf meiner Insel, wo ich zwar — und das war allerdings ein rechter Kummer — keine menschliche Gesellschaft, aber auch keine reißenden Thiere, keine gierigen Wölfe und Tiger gefunden, keine ungesunden oder giftigen Geschöpfe, deren Genuß mir schädlich werden konnte, keine Wilden, die mich umgebracht haben würden, angetroffen hatte? Wie ich hier einerseits ein Leben des Elendes führte, so war es andererseits doch auch wieder ein Leben der Gnade. Um es zu einem ganz glücklichen Leben zumachen, brauchte ich mich nur täglich durch die Erkenntniß der Güte Gottes und seiner Fürsorge für meine Bedürfnisse trösten zu lassen. Aber wirklich hörte ich, als ich in dieser Uebung erst einige Fortschritte gemacht hatte, auf, traurig zu sein.
Während der langen Zeit, die ich jetzt schon auf der Insel weilte, waren viele von den Sachen, die ich zu meinem Gebrauche mit ans Land genommen hatte, entweder ganz, oder wenigstens zum größten Theil aufgebraucht.
Meine Tinte hatte, wie ich früher bemerkte, schon seit einiger Zeit bis auf einen kleinen Rest, welchen ich nach und nach immer mehr mit Wasser verdünnte, bis man auf dem Papier kaum noch einen Schein von Schwärze wahrnehmen konnte, abgenommen. So lange sie vorhielt, benutzte ich sie, um die Tage des Monats, an welchen irgend mir etwas Bemerkenswertes begegnete, aufzunotiren. Als ich diese Daten mit meiner Vergangenheit verglich, bemerkte ich ein merkwürdiges Zusammentreffen der Tage in Bezug auf die verschiedenen Schicksale, die mich betroffen hatten. Wäre ich zu abergläubischer Beobachtung besonderer glück- oder unglückbringender Tage geneigter gewesen, so hätte sich hier Anlaß zu großer Verstärkung dieser Neigung geboten. Zuerst hatte ich ausgerechnet, daß ich an demselben Monatstage, an dem ich meinem Vater und meinen Verwandten durchgegangen und nach Hull entlaufen war, um mich dort einzuschiffen, später von dem türkischen Piratenschiff gefangen und zum Sklaven gemacht worden war. An dem Monatstage, wo ich aus dem Wrack des Schiffes auf der Rhede von Yarmouth gerettet worden, hatte ich später meine Flucht in dem Boote von Saleh ausgeführt. Ferner war mir an meinem Geburtstage, dem 30. September, das Leben, nach sechsundzwanzig Jahren, von Neuem auf so wunderbare Weise geschenkt worden, indem ich an die Insel getrieben war; und so hatte mein Leben der Sünde und mein Leben der Einsamkeit an demselben Tage seinen Anfang genommen.
Das Zweite, was außer der Tinte zu Ende ging, war mein Brod. Ich meine die Schiffszwiebacke, die ich aus dem Schiffe gerettet. Mit diesen hatte ich auf das allersparsamste gewirthschaftet und mir über ein Jahr lang nur Einen Zwieback täglich gestattet. Trotzdem mußte ich noch beinahe ein Jahr mich ohne Brod behelfen, bis ich solches aus selbst gebautem Korn bekam.
Auch meine Kleidungsstücke fingen an gewaltig in die Krümpe zu gehen. Von Wäsche besaß ich schon seit einer ganzen Weile nichts als eine Anzahl gewürfelter Hemden, die ich in den Kästen meiner Schiffsgenossen gefunden und sorgsam geschont hatte. Da ich oft wegen der Hitze nichts weiter als ein Hemd auf dem Leibe haben konnte, kam es mir sehr zu Statten, daß ich unter den Sachen der Schiffsmannschaft beinahe drei Dutzend von diesen Kleidungsstücken gefunden hatte. Auch einige dicke Wachtröcke der Matrosen waren noch vorhanden, aber die waren zu warm, um sie hier zu tragen. Allerdings glühete die Sonne oft so heiß, daß man meinen sollte, ich hätte überhaupt keine Kleidung nöthig gehabt. Jedoch hätte ich nicht ganz nackend gehen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Abgesehen davon, daß mir der Gedanke daran, obgleich ich allein lebte, unerträglich war, bestand auch noch der andere Grund, daß ich die Sonnenhitze viel besser vertragen konnte, wenn ich Etwas angezogen hatte. Die unmittelbare Hitze brannte mir die Haut wund, wenn ich hingegen ein Hemd trug, so brachte die Luft selbst darunter einige Bewegung hervor, und mir war unter demselben noch einmal so kühl, als ohne es. Ebensowenig durfte ich jemals wagen, ohne Hut oder Mütze in die Sonnenhitze hinauszugehen; denn diese brannte mit solcher Heftigkeit, daß sie mir sofort Kopfschmerzen verursachte, wenn sie mir direkt auf den Kopf schien. Dagegen verschwanden die Schmerzen gleich wieder, sobald ich meinen Hut aufsetzte.
Unter diesen Umständen hielt ich es für nöthig, die wenigen Lumpen, welche ich Kleider nannte, einigermaßen wieder in Stand zu setzen. Meine Westen hatte ich alle aufgetragen, daher beschloß ich zu versuchen, ob ich nicht aus den dicken Ueberröcken und aus dem, was ich sonst noch an Material besaß, mir Jacken anfertigen könnte. So machte ich mich nun ans Schneidern oder vielmehr ans Flicken. Ungeschickt genug stellte ich mich dazu an, das muß wahr sein. Indessen brachte ich doch zwei oder drei neue Westen ganz leidlich zu Stande und hoffte damit eine geraume Weile auszukommen. Was dagegen die Beinkleider betraf, so mußte ich mich damit fürs Erste auf das Allerdürftigste behelfen.
Ich habe früher erwähnt, daß ich die Felle aller vierfüßigen Thiere aufzubewahren pflegte. Ich hatte sie an Stangen aufgespannt in die Sonne gestellt. Hierdurch waren einige so trocken und hart geworden, daß sie nur wenig zu brauchen waren, andere aber schienen verwendbar zu sein. Das Erste, was ich mir daraus machte, war eine große Mütze. Ich kehrte die rauhe Seite des Felles nach Außen, zum Schutz gegen den Regen, und das Ding gelang mir so gut, daß ich mir später einen ganzen Anzug aus Thierfellen anfertigte; das heißt eine Weste und kurze Hosen. Die letzteren waren an den Knieen offen und gehörig weit, denn es kam mir mehr darauf an, kühl als warm dadurch gehalten zu werden. Ich darf nicht verschweigen, daß sie sich abscheulich ausnahmen. Denn war ich schon ein schlechter Zimmermann, so war ich doch ein noch schlechterer Schneider. Trotzdem konnte ich mich sehr gut damit behelfen. Ging ich aus und es fing an zu regnen, so ließ die rauhe Außenseite meiner Weste und Mütze das Wasser nicht eindringen, und ich blieb darin ganz trocken.
Ferner verwendete ich sehr viel Zeit und Mühe darauf, mir einen Sonnenschirm zu machen. Einen solchen wünschte und brauchte ich in der That sehr. In Brasilien hatte ich auch dergleichen verfertigen sehen, dort dienen sie zum Schutze gegen die große Hitze, und hier kam mir die Hitze mindestens ebenso groß, wenn nicht größer vor als dort, und die Insel lag ja auch dem Aequator näher. Da ich genöthigt war viel auszugehen, mußte mir ein Schirm nicht nur gegen die Sonne, sondern auch gegen den Regen von großem Nutzen sein. Ich gab mir die erdenklichste Mühe, und doch dauerte es sehr lange, bis ich ein solches Ding fertig gebracht hatte, was zusammenzuhalten versprach. Nachdem ich schon glaubte das richtige Verfahren entdeckt zu haben, mißglückten noch zwei oder drei Versuche, bis einer gelang, der mich zufrieden stellte. Die größte Schwierigkeit hatte die Einrichtung, durch die ich den Schirm zusammenlegen konnte, mir gemacht. Denn wenn ich ihn nur aufzuspannen, nicht aber auch zusammenzulegen und einzuziehen vermocht hätte, so würde ich ihn nicht anders als immer über dem Kopfe haben tragen können, und das ging doch nicht. Endlich gelang mir, wie gesagt, ein ziemlich zweckmäßiges Gestell, das ich mit Fellen, die Haare nach Außen gewendet, überzog, so daß der Regen wie von einem schrägen Dache ablief. Auch gegen die Sonne gewährte dieser Schirm so hinreichenden Schutz, daß ich jetzt in dem heißesten Wetter mit mehr Annehmlichkeit im Freien sein konnte als sonst bei kühlster Temperatur. Hatte ich ihn nicht nöthig, so legte ich ihn zusammen und trug ihn unter dem Arme.
Kapitel 8
So lebte ich nun in der größten Zufriedenheit; meine Seele fand ihre Ruhe in der gänzlichen Ergebung in Gottes Willen, und ich überließ mich unbedingt den Fügungen seiner Vorsehung. Das war besser als menschlicher Umgang für mich, und so oft ich anfing, die Entbehrung eines Gesprächs zu beklagen, fragte ich mich alsbald, ob nicht der Verkehr mit meinen eigenen Gedanken und sozusagen mit Gott selbst dem größten Vergnügen, das menschliche Gesellschaft gewähren kann, vorzuziehen sei.
Im Uebrigen wüßte ich nicht, daß in den nächstfolgenden fünf Jahren irgend etwas Außergewöhnliches vorgefallen wäre. Ich lebte in derselben Weise, in gleicher Lage und an demselben Orte wie bisher fort. Abgesehen von der jährlich wiederkehrenden Arbeit des Anbauens von Gerste und Reis und des Zubereitens der Rosinen, von welchen ich mir immer genug vorräthig hielt, um für ein Jahr im Voraus versorgt zu sein, und abgesehen von dem täglichen Ausgang mit meiner Flinte, bestand meine Beschäftigung hauptsächlich in dem Bau eines zweiten Canoe's. Endlich hatte ich denn auch eins fertig gebracht. Nachdem ich einen sechs Fuß breiten und vier Fuß tiefen Kanal gegraben, gelang es auch, dasselbe fast eine halbe Meile weit den Fluß hinabzuschaffen. Jenes erste, welches so unvernünftig groß geworden war, weil ich nicht gehörig vorher überlegt hatte, wie ich es von der Stelle bewegen sollte, und von dem ich endlich eingesehen, daß ich es weder an das Wasser, noch das Wasser zu ihm bringen könnte, hatte ich liegen lassen müssen, wo es lag, als eine Mahnung für mich, ein andermal klüger zu sein. Das war ich denn auch das zweite Mal wirklich gewesen. Wenn ich auch keinen ganz passenden Baum hatte finden können und keine dem Wasser näher gelegene Stelle als eine beinahe eine halbe Meile davon entfernte, so hatte ich doch bald gesehen, daß es diesmal gelingen würde, und daß ich das Unternehmen nicht wieder aufzugeben brauchte. Obgleich ich fast zwei Jahre darauf verwendete, ließ ich mich doch keine Mühe verdrießen, in der Hoffnung, endlich ein Boot zu haben, in dem ich mich auf die See begeben könnte. Als jedoch meine kleine Pirogue fertig war, fand sich, daß ihre Größe durchaus nicht genügte, um die Absicht, die mir beim Bau der ersten vorgeschwebt hatte, damit auszuführen; ich meine die Fahrt nach dem Festlande. Der Meeresarm, der mich von diesem trennte, war über vierzig Meilen breit, daher machte die Kleinheit des Fahrzeuges diesen Plan unmöglich, und ich dachte nicht weiter daran.
Da ich das Boot aber nun einmal hatte, nahm ich mir vor, darin eine Fahrt um die Insel zu unternehmen. Denn als ich früher zu Lande, wie ich es beschrieben habe, auf der andern Seite derselben gewesen war, hatten mir die bei dieser Gelegenheit gemachten Entdeckungen die größte Lust erweckt, auch noch weitere Theile der Küste kennen zu lernen. Deshalb beschäftigte mich jetzt, wo ich mich im Besitze eines Bootes sah, kein anderer Gedanke, als eine Segelfahrt um die Insel anzustellen. Zu diesem Zwecke, und um es an keiner Vorsicht und Ueberlegung fehlen zu lassen, errichtete ich einen kleinen Mast in meinem Boote und befestigte daran ein Segel, das ich aus einem der alten Schiffssegel angefertigt hatte, von denen ich einen großen Vorrath aufbewahrte. Als Mast und Segel angebracht waren, probirte ich das Boot und fand, daß es vortrefflich segelte. Dann brachte ich kleine Kästen oder Abschläge an beiden Enden des Fahrzeuges an, um nothwendige Gerätschaften, Lebensmittel, Schießbedarf u. s. w. darin trocken zu halten und vor dem Regen und dem Wellenschaum zu schützen. Ferner schnitt ich eine schmale lange Höhlung in die innere Seite des Bootes, wo hinein ich meine Flinte legen konnte, und versah sie mit einer Klappe, um das Gewehr vor der Nässe zu bewahren. Am unteren Ende meines Fahrzeugs befestigte ich hierauf meinen Sonnenschirm auf dieselbe Weise wie den Mast, damit er über meinem Kopfe ausgespannt gleich einem Zelt die Sonnenhitze von mir abhalten sollte.
Zunächst machte ich hin und wieder einen kleinen Ausflug in die See, wagte mich aber niemals weit hinaus und entfernte mich auch nicht sehr von der Flußmündung. Endlich aber beschloß ich, begierig, den Umfang meines Reiches kennen zu lernen, die Umsegelung zu unternehmen. Demgemäß verproviantirte ich mein Fahrzeug für die Reise mit zwei Dutzend meiner Brode, oder, richtiger gesagt, Gerstenkuchen, mit einem Topfe voll gerösteter Reiskörner, von denen ich häufig zu essen pflegte, ferner mit einer kleinen Flasche Rum und der Hälfte einer erlegten Ziege. Auch Pulver und Blei nahm ich mit, um weitere Ziegen schießen zu können, und versah mich ferner mit zwei von den großen Ueberröcken, die ich, wie ich vorher erwähnte, aus den Koffern der Seeleute gerettet hatte. Auf einem davon wollte ich liegen, mit dem andern gedachte ich mich des Nachts zuzudecken.
Es war am 6. November, im zehnten Jahre meiner Herrschaft, oder, wenn man will, meiner Gefangenschaft, als ich diese Reise antrat. Dieselbe dehnte sich viel länger aus, als ich erwartet hatte. Denn obgleich die Insel selbst nicht sehr groß war, entdeckte ich, auf der östlichen Seite angekommen, eine lange Felsenkette, die sich ungefähr zwei Seemeilen weit in das Meer erstreckte und theils über, theils unter dem Wasser fortlief, an deren Ende eine Sandbank, ebenfalls eine halbe Meile lang, trocken zu Tage lag, so daß ich mich genöthigt sah, diese Landspitze in einem weiten Umweg zu umschiffen.
Anfangs, als ich diese Entdeckung machte, war ich schon im Begriff, die Unternehmung aufzugeben, da ich nicht wußte, wie weit ich genöthigt sein würde in die See hinauszufahren, und ebensowenig, wie ich zurück kommen sollte. Ich ging deshalb vorläufig vor Anker. Denn auch eine Art von Anker hatte ich mir aus einem zerbrochenen Bootshaken, den ich vom Schiffe mitgebracht, verfertigt. Nachdem ich das Boot so befestigt hatte, nahm ich die Flinte, begab mich ans Land und erstieg einen Hügel, von dem ich eine Uebersicht über jene Landzunge zu haben glaubte. Wirklich ermaß ich von dort ihre ganze Ausdehnung und beschloß nun, die Umfahrt zu wagen.
Von dem Hügel, auf dem ich stand, erblickte ich eine starke und wahrhaft reißende Strömung, die von Westen nach Osten verlief und ganz nahe an jene Landspitze heran kam. Ich achtete um so mehr darauf, als ich Gefahr davon befürchtete. Denn wenn ich in die Strömung gerieth, konnte ich durch ihre Gewalt in die See hinausgetrieben werden und vielleicht nicht im Stande sein, die Insel wieder zu gewinnen. In der That glaube ich, daß, wäre ich nicht vorher auf den Hügel gestiegen, es so gekommen sein würde. Denn eine gleiche Strömung ging auf der anderen Seite der Insel, nur weiter vom Ufer entfernt, und ferner befand sich dicht an der Küste ein starker Strudel, so daß ich, wenn ich auch die Strömung vermieden hätte, unfehlbar in jenen gerathen wäre.
Dort lag ich nun zwei Tage lang. Der Wind blies ziemlich frisch aus Ostsüdost, und da das gerade die der Strömung entgegenlaufende Richtung war, verursachte er eine starke Braudung gegen die Spitze. Es schien mir deshalb gefährlich, mich zu nahe an der Küste zu halten, theils wegen der Brandung, theils, wenn ich mich zu weit davon entfernte, wegen der Strömung.
Am Morgen des dritten Tages war das Meer ruhig. Der Wind hatte sich über Nacht gelegt, und so wagte ich mich denn hinaus. Aber wiederum sollte ich ein warnendes Beispiel für unbesonnene und unwissende Seefahrer werden. Denn kaum war ich an der Spitze angelangt und nicht um eines Bootes Länge von der Küste entfernt, als ich mich auch schon in sehr tiefem Wasser und in einer so reißenden Strömung wie an einem Mühlenwehr befand. Mein Boot wurde mit solcher Gewalt fortgerissen, daß ich es trotz aller Anstrengung nicht einmal am Rande des Stromes halten konnte, sondern mich weiter und weiter von dem Strudel, der mir zur Linken blieb, abgetrieben sah. Kein Wind kam mir zu Hülfe und mit meinem Rudern konnte ich so gut als Nichts ausrichten. Ich fing an, mich für verloren zu halten; denn weil die Strömung auf beiden Seiten der Insel ging, wußte ich, daß ihre Enden sich einige Seemeilen weiter vereinigen mußten, und glaubte deshalb unfehlbar umkommen zu müssen. Indem mir nämlich keine Möglichkeit schien, sie zu vermeiden, hatte ich nur die sichere Aussicht des Todes, und zwar nicht durch das Wasser, denn das war ruhig genug, sondern durch den Hunger.
Allerdings hatte ich eine Schildkröte, die ich am Ufer gefunden, und die so groß war, daß ich sie kaum aufzuheben vermochte, in das Boot geworfen. Auch einen großen Krug frischen Wassers besaß ich, aber was half das Alles, wenn ich in den weiten Ocean getrieben wurde, wo sicherlich keine Küste, kein Festland und keine Insel im Umkreis von wenigstens tausend Meilen zu finden gewesen wäre.
Da erkannte ich nun, wie leicht es für Gottes Vorsehung ist, die elendeste Lage, in der der Mensch sein kann, zu einer noch elenderen zu machen. Ich blickte jetzt nach meiner öden, einsamen Insel zurück als nach dem lieblichsten Orte der Welt, und alle Glückseligkeit, die mein Herz sich wünschte, bestand darin, nur wieder dort sein zu können. Ich streckte meine Hände mit sehnlichem Verlangen danach aus:»O du glückliche Wüste!«sagte ich,»soll ich dich nie wiedersehen? Wohin werde ich elende Kreatur gerathen!«Dann machte ich mir Vorwürfe über mein undankbares Gemüth und über meine früheren Klagen in Bezug auf meine Einsamkeit. Was hätte ich nicht jetzt darum gegeben, wieder dort am Lande zu sein! So sehen wir nie unsere Lage im rechten Licht, bis sie uns durch den Gegensatz erleuchtet wird, noch auch wissen wir das, was wir besitzen, eher zu schätzen, als bis wir es verloren haben.
Es ist unmöglich, die Bestürzung zu beschreiben, in die ich gerieth, als ich mich von meiner geliebten Insel ab und beinahe zwei Seemeilen in den weiten Ocean getrieben sah. Ich verzweifelte völlig daran, jemals wieder mein Eiland zu erreichen. Nichtsdestoweniger jedoch arbeitete ich mich so lange ab, bis meine Kräfte beinahe erschöpft waren, indem ich das Boot so viel als möglich nach Norden, das heißt auf der dem Strudel zunächst liegenden Seite der Strömung zu halten suchte. Endlich um Mittag, als die Sonne gerade über meinem Haupte stand, kam es mir vor, als fühlte ich eine leichte Brise von Südsüdost her mir entgegen wehen. Das erleichterte mir das Herz ein wenig, und noch mehr erfreute es mich, als etwa eine halbe Stunde später ein hübscher kleiner Sturm zu sausen anfing.
Mittlerweile war ich erschrecklich weit von der Insel weg gerathen. Wäre nur die kleinste Wolke oder ein leichter Nebel mir in den Weg gekommen, so hätte es auf eine ganz unerwartete Weise um mich geschehen sein müssen. Denn ich hatte keinen Kompaß an Bord und würde daher nicht gewußt haben, wie ich nach der Insel zusteuern sollte, sobald sie mir nur ein einziges Mal aus dem Gesicht entschwunden wäre. Aber das Wetter blieb klar. Ich machte mich jetzt daran, meinen Mast wieder aufzurichten und das Segel auszubreiten, und hielt, so gut ich irgend konnte, die Richtung nach Norden, um nur aus der Strömung heraus zu kommen. Kaum hatte ich Segel und Mast in Ordnung, und kaum fing das Boot an, langsam dahinzugleiten, als ich an der Klarheit des Wassers bemerkte, daß eine Veränderung der Strömung in der Nähe sein müsse. Denn wo der Strom reißend ging, war das Wasser trübe, wo dagegen das Wasser sich aufhellte, ließ die Stärke der Strömung nach. Gleich darauf bemerkte ich etwa eine halbe Meile gen Osten eine Brandung gegen einige Felsen. Diese theilten den Strom, wie ich wahrnahm, und wie sein größerer Theil mehr nach Süden abfloß, so wurde der andere von dem Widerstande der Felsen zurückgeschlagen, bildete einen starken Strudel und strömte dann in raschem Fluß wieder nach Nordwesten zurück.
Nur wer es weiß, was es heißt, wenn Einem, der schon auf der Leiter steht, ein Aufschub der Exekution verkündet wird, oder wie Einem zu Muthe ist, der Räuberhänden, die ihm eben den Garaus machen wollen, entrinnt, oder wer sonst je in einer ähnlichen Lage gewesen ist, kann sich einen Begriff von der freudigen Ueberraschung machen, die ich jetzt erfuhr, und wie froh ich war, mein Boot in diesen Strudel leiten zu können. Da der Wind auch stärker zu wehen begann, breitete ich fröhlich meine Segel gegen ihn aus und lief lustig vor der Brise dahin, von dem starken Strom getragen.
Der Strudel brachte mich noch ungefähr eine Seemeile auf meinem Rückwege weiter, direkt nach der Insel hin, jedoch etwa zwei Meilen nördlich von der Strömung, die mich vorher abgetrieben hatte, so daß, als ich mich der Insel näherte, die nördliche Küste derselben vor mir lag, das heißt, das andere, dem, von welchem ich herkam, entgegengesetzte Inselende.
Ich legte etwas mehr als eine Seemeile mit Hülfe des Strudels zurück und bemerkte dann, daß er aufhörte und mir nicht weiter dienen konnte. Jetzt aber befand ich mich zwischen den beiden andern großen Strömungen, der südlichen, die mich vom Lande abgetrieben hatte, und der nördlichen, die ungefähr eine Seemeile weiter auf der anderen Seite floß. Hier in der Mitte, im Schutze der Insel, fand ich das Wasser ganz still und nach keiner Seite fließend. Da der Wind mir noch immer günstig wehte, so steuerte ich weiter direkt auf die Insel los, wenn ich gleich nicht so schnell vorwärts kam als bisher. Etwa um vier Uhr Nachmittags, als ich nur noch ungefähr eine Seemeile vom Lande entfernt war, entdeckte ich, daß die Felsenspitze, die durch ihren südlichen Vorsprung, an dem sich die Strömung brach, mein Mißgeschick herbeigeführt hatte, noch einen zweiten Strudel nach Norden bildete. Ich fand denselben sehr stark, aber er floß nicht gerade in derselben Richtung, in der mein Cours ging, nämlich nach Westen, sondern er strömte fast direkt nach Norden. Da sich aber ein frischer Wind erhoben hatte, segelte ich über den Strudel weg auf Nordwest haltend, und kam in Zeit von einer Stunde der Insel bis auf etwa eine Meile nahe, wo ich nun im ruhigen Wasser sehr bald landen konnte.
Am Ufer angekommen, fiel ich auf die Kniee nieder und dankte Gott für meine Errettung. Nun gab ich jeden Gedanken an ein Entrinnen in meinem Boote auf. Ich stärkte mich mit den Nahrungsmitteln, die ich bei mir führte, brachte mein Boot ganz nahe am Ufer in einer kleinen Bucht, die ich dort entdeckt hatte, unter einigen Bäumen in Sicherheit und legte mich hierauf zum Schlafen nieder, denn ich war begreiflicher Weise äußerst erschöpft von den Anstrengungen dieser Reise.
Jetzt gerieth ich in nicht geringe Verlegenheit durch die Erwägung, welchen Rückweg ich mit meinem Boote einschlagen sollte. Ich war in zu großer Gefahr gewesen und wußte zu gut, was es damit auf sich habe, um daran zu denken, den Weg, den ich gekommen war, auch wieder zurück zu nehmen. Wie es auf der anderen Seite (ich meine an der Westküste) aussah, wußte ich nicht, hatte auch keine Lust, noch einmal solche Abenteuer zu bestehen. Daher beschloß ich, in westlicher Richtung an der Küste entlang zu fahren und zu sehen, ob ich nicht irgend wo eine Bucht finde, wo ich meine Pirogue in Sicherheit ankern und von wo ich sie später wieder abholen könnte, wenn ich ihrer bedürfte. Nach einer Fahrt von ungefähr drei Meilen, längs der Küste, kam ich denn auch an eine vorzügliche Einfahrt, die anfangs etwa eine Meile breit war, weiter ins Land hinein aber sich verengerte, bis sie in einen ganz kleinen Fluß oder Bach auslief. Dort bildete sie einen sehr bequemen Hafen, und mein Boot lag darin, wie in einem eigens zu diesem Zwecke gebauten Dock. Nachdem ich angelegt und mein Fahrzeug ganz sicher befestigt hatte, ging ich ans Land, um mich umzusehen und auszuspähen, wo ich mich befände.
Hier bemerkte ich bald, daß ich nur ganz wenig über die Gegend hinaus gelangt war, die ich schon früher bei Gelegenheit meiner Fußreise nach dieser Küste berührt hatte. Daher nahm ich weiter nichts aus meinem Boote mit, als die Flinte und den Sonnenschirm (denn es war furchtbar heiß), und trat meine Wanderung an. Diese stach sehr angenehm von der Reise, die ich soeben beendigt hatte, ab. Am Abend erreichte ich meine alte Hütte, wo ich Alles so vorfand, wie ich es verlassen. Ich hielt nämlich in derselben immer gute Ordnung, weil ich sie, wie ich schon erwähnt, als meinen Landsitz betrachtete.
Nachdem ich über den Zaun gestiegen, legte ich mich in den Schatten nieder, um meine müden Glieder auszuruhen, und schlief ein. Aber wer, der diese Geschichte liest, kann sich meine Ueberraschung vorstellen, als ich durch eine Stimme aus dem Schlafe geweckt wurde, die mich wiederholt beim Namen rief:»Robin, Robin, Robin Crusoe, armer Robin Crusoe! Wo bist du, Robin Crusoe? Wo bist du? Wo bist du gewesen?«
Zuerst, da ich wegen meiner großen Ermüdung vom Rudern am Vormittag und von dem weiten Wege am Nachmittag sehr fest geschlafen, wurde ich nicht gleich ganz wach, sondern glaubte zwischen Schlafen und Wachen nur zu träumen, daß Jemand mit mir spreche. Als aber die Stimme fortfuhr, immerfort» Robin Crusoe, Robin Crusoe!«zu wiederholen, erwachte ich endlich völlig und war anfangs nicht wenig erschreckt, so daß ich in äußerster Bestürzung in die Höhe fuhr. Jedoch sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte, erblickte ich auch schon meinen Pol auf der Hecke sitzend und wußte nun sofort, daß er es gewesen war, der mich angerufen hatte. Gerade in solchen traurig fragenden Ausrufen pflegte ich zu ihm zu sprechen und sie ihm zu lehren. Er hatte sie auch so vollkommen gelernt, daß er oft, auf meinem Finger sitzend und seinen Schnabel dicht an mein Gesicht gelegt, ausrief:»Armer Robin Crusoe! Wo bist du? Wo bist du gewesen? Wie kommst du hierher?«und dergleichen mehr, was ich ihm beigebracht hatte. Indessen wenn ich auch jetzt wußte, daß es nur der Papagei war und daß es wirklich Niemand anders gewesen sein konnte, dauerte es doch eine ganze Weile, bis ich mich zu fassen vermochte. Es wunderte mich nämlich, daß das Thier hierher gekommen war. Sobald ich mich jedoch vollkommen überzeugt hatte, daß Niemand anders als mein getreuer Pol in meiner Nähe sei, erholte ich mich von meinem Schrecken, streckte meine Hand aus und rief ihn bei seinem Namen. Hierauf kam das zutrauliche Thier angeflogen, setzte sich, wie es gewohnt war, auf meinen Daumen und fuhr fort zu mir zu sprechen:»Armer Robin Crusoe! und wie kommst du hierher? Wo bist du gewesen?«als ob er hoch erfreut wäre, mich wieder zu sehen. Ich nahm ihn zu mir und begab mich denn nach Hause. Jetzt hatte ich für eine Zeitlang genug am Seefahren. Die Gefahr, in der ich geschwebt, gab mir für viele Tage Stoff zum stillen Nachdenken. Sehr froh würde ich gewesen sein, wenn ich mein Boot wieder auf dieser Seite der Insel gehabt hätte, doch wußte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, es herbeizuschaffen. Auf der Ostseite, der entlang ich gefahren war, durfte ich, wie ich wußte, nicht wagen es zu holen. Mein Herz stockte, und das Blut gerann mir in den Adern, wenn ich nur daran dachte. Wie es auf der andern Seite der Insel aussah, war mir unbekannt. Aber wenn die Strömung mit derselben Gewalt östlich nach der Küste hin sich bewegte, als sie an der andern Seite davon abtrieb, drohte mir ja dort gleiche Gefahr, mit dem Strome fort und an der Insel vorbeigerissen zu werden, wie ich vorher davon abgetrieben worden war. Mit diesem Gedanken tröstete ich mich über den zeitweiligen Verlust des Bootes, welches allerdings das Werk vieler, Monate langer Arbeit gewesen war, und das ich mit so besonders großer Mühe und so bedeutendem Zeitaufwand in das Meer geschafft hatte.
Nachdem ich jenes Verlangen bezwungen hatte, führte ich fast ein Jahr lang ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben. In meinem Gemüthe war ich nun ganz mit meiner Lage ausgesöhnt und vollkommen gewillt, mich allen Anordnungen der Vorsehung ruhig zu fügen. Ich fühlte mich wirklich in jeder Hinsicht ganz glücklich, wobei ich jedoch das Gefühl der Einsamkeit nicht in Anschlag bringe.
Während dieser Zeit vervollkommnete ich mich in allen mechanischen Fertigkeiten, zu deren Uebung mich meine Bedürfnisse genöthigt hatten. Ich glaube, ich hätte jetzt, vorkommenden Falls, einen ganz leidlichen Zimmermann vorstellen können, wobei natürlich zu bedenken ist, wie wenig Handwerkszeug mir zu Gebote stand.
Außerdem brachte ich es zu einer unerwarteten Verbesserung meines Thongeschirres. Seit ich darauf verfiel, den Thon auf einer Scheibe zu drehen, ging die Herstellung meiner Gefäße weit leichter von Statten, und dieselben wurden jetzt rund und wohlgestaltet, während ich früher nur unförmliche Dinger zu Stande gebracht hatte. Nie aber, glaube ich, war ich stolzer auf meine Geschicklichkeit, oder erfreuter über irgend eine Erfindung, als da es mir gelang, eine Tabakspfeife zu machen. Zwar stellte sie fertig geworden nur ein sehr häßliches, plumpes Ding dar, auch bestand sie nur aus gebranntem Thon wie die anderen Töpferwaaren, allein sie war hart und fest und ließ den Rauch, ganz wie es sich gehört, hindurch ziehen. Wie groß war mein Entzücken darüber! Ich hatte früher viel geraucht, auch waren Pfeifen auf dem Schiffe gewesen, aber ich hatte sie nicht mitgenommen, da mir unbekannt war, daß es auf der Insel Tabak gab. Nachher, als ich das Schiff aufs Neue durchsuchte, hatte ich keine mehr finden können.
Auch in Flechtarbeiten machte ich bedeutende Fortschritte und verfertigte einen Ueberfluß von allen möglichen Körben. Sie waren zwar nicht gerade schön, aber doch sehr handlich und bequem zur Aufbewahrung und zum Tragen vieler Sachen. Wenn ich zum Beispiel eine Ziege getödtet hatte, hing ich sie an einem Baum in der Höhe auf, zog sie ab, weidete sie aus, schnitt sie in Stücke und trug sie in einem meiner Körbe nach Hause. Ebenso machte ich's mit den Schildkröten, aus denen ich, nachdem ich sie aufgeschnitten, die Eier herausnahm und diese nebst einem oder zwei Stücken von dem Fleische, wie es für mich ausreichte, heimbrachte, während ich den Rest liegen ließ. Auch zur Aufbewahrung des Korns bediente ich mich großer tiefer Körbe. Sobald es trocken genug war, rieb ich es aus, siebte es durch und hob es dann in diesen Behältern auf.
Mit der Zeit bemerkte ich leider, daß mein Schießpulver bedeutend abnahm. Dies war ein unersetzlicher Mangel, deshalb überlegte ich, was ich anfangen sollte, wenn ich gar kein Pulver mehr hätte, auf welche Weise insbesondere ich dann Ziegen erlegen sollte. Ich hatte, wie bereits erzählt, im dritten Jahre meines hiesigen Aufenthalts eine junge Geis gefangen und aufgezogen. Meine Hoffnung, einen Bock dazu zu bekommen, hatte sich nicht erfüllt, und nachgerade war aus meinem Zicklein eine alte Ziege geworden. Ich hatte es nicht über mein Herz bringen können, sie zu schlachten, bis sie zuletzt an Altersschwäche gestorben war.
Da aber jetzt im elften Jahre meiner Anwesenheit auf der Insel, wie gesagt, meine Munition knapp zu werden begann, mußte ich auf eine Art und Weise, die Thiere lebendig einzufangen, sinnen. Vor Allem wünschte ich eine trächtige Mutterziege zu besitzen. Zu diesem Zwecke legte ich Schlingen, um sie darin zu verstricken, und ich glaube wohl, daß sich mehr als einmal welche darin fingen, aber die Stricke waren nicht gut, und Draht hatte ich nicht. Darum fand ich die Schlingen immer wieder zerrissen und den Köder aufgefressen.
Da beschloß ich endlich, den Fang in Gruben zu versuchen. Ich legte mehre tiefe Löcher an, und zwar an solchen Stellen, wo, wie ich beobachtet hatte, die Ziegen zu grasen pflegten; stellte darüber selbstverfertigte Hürden auf und beschwerte diese stark. Nun streute ich zuerst mehrmals Gerste und getrocknete Reiskörner aus, ohne die Falle anzubringen. Bald bemerkte ich auch an deutlichen Fußspuren, daß die Ziegen hineingegangen waren und das Korn gefressen hatten. Hierauf stellte ich in einer Nacht drei Fallen aus, die ich indessen am anderen Morgen alle unversehrt vorfand, trotzdem das Korn daraus verschwunden war. Das entmuthigte mich sehr, aber nachdem ich die Fallen verbessert, fand ich zuletzt, um die weiteren Einzelnheiten zu übergehen, als ich eines Morgens ausging, um nach meiner Vorrichtung zu sehen, in einer derselben einen alten großen Ziegenbock und in einer anderen drei junge Ziegen, eine männliche und zwei weibliche.
Was ich mit dem alten Bock anfangen sollte, wußte ich in der That nicht. Er war so wild, daß ich ihm nicht nahe zu kommen und ihn lebendig fortzubringen wagte, worauf es mir doch eben ankam. Zwar hätte ich ihn tödten können, doch das würde meinen Zweck nicht erfüllt haben. So ließ ich ihn denn laufen, und er rannte wie unsinnig davon. Damals wußte ich noch nicht, was ich später lernte, daß Hunger auch einen Löwen zähmen könne. Hätte ich ihn drei bis vier Tage ohne Nahrung in der Grube gelassen und ihm dann etwas Wasser und ein wenig Korn gebracht, so würde er so zahm wie die Ziegenlämmer geworden sein. Denn diese Art Thiere ist sehr gelehrig und leicht zu erziehen, wenn sie gehörig behandelt wird. Für diesmal ließ ich aber den Bock laufen und wendete mich zu den drei Lämmern, nahm eins nach dem andern heraus, band sie mit Stricken zusammen und brachte sie, obschon mit einiger Mühe, nach Hause.
Es dauerte eine geraume Zeit, ehe sie fressen wollten, aber durch einige zarte Körner, die ich ihnen hinstreute, ließen sie sich anlocken und fingen an zutraulich zu werden. Ich sah jetzt ein, daß, wenn ich mich für den Fall, daß mein Schießbedarf aufgebraucht sei, mit Ziegenfleisch versorgen wollte, das einzige Mittel sein würde, einige Ziegen aufzuziehen und zu zähmen und sie mit der Zeit wie eine Heerde Schafe auf meinem Hofe zu halten. Gleich darauf fiel mir jedoch ein, daß ich dann die zahmen von den wilden absperren müßte, da sie ja außerdem beim Heranwachsen immer wieder wild werden würden. Die einzige Art, dies möglich zu machen, schien mir, ein Stück Land wohl verschlossen durch eine Hecke zu umgrenzen, damit die darin befindlichen Thiere weder ausbrechen, noch die von draußen eindringen könnten.
Das war ein großes Unternehmen für ein einziges Paar Hände. Da ich aber die absolute Notwendigkeit desselben einsah, so machte ich mich sogleich an die Arbeit und suchte zuvörderst nach einem passenden Platze, wo die Thiere Nahrung und Trinkwasser und Schutz vor der Sonne finden könnten.
Wer sich auf dergleichen Dinge versteht, wird mich für sehr unvernünftig halten, wenn er hört, wie ich die Sache angriff. Nachdem ich nämlich eine alle diese Bedingungen erfüllende Stelle ausgesucht hatte, das heißt ein flaches offenes Stück Wiesenland, oder eine Savanna, wie die Ansiedler in den westlichen Kolonien es nennen, die von mehren kleinen Süßwasserrinnen durchschnitten und an einem Ende mit Wald bestanden war, begann ich aus übergroßer Vorsorge die Anlage meiner Hecke in der Weise, daß sie vollendet wenigstens zwei Meilen im Umkreis gehabt haben würde. Und doch war die Größe des Umfangs an sich dabei nicht das Schlimmste; denn wäre er auch zehn Meilen weit gewesen, so hätte ich wahrscheinlich doch Zeit genug gehabt, ihn auszuführen. Schlimmer aber war, daß mir nicht in den Sinn kam, wie meine Ziegen in einem so weiten Spielraum ja ebenso wild werden würden, als wenn ich ihnen die ganze Insel überlassen hätte, und daß ich sie in einem solchen Raume niemals würde einfangen können.
Die Hecke war bereits angefangen und, ich glaube, schon etwa fünfzig Schritte lang ausgeführt, als mir das Bedenken zuerst einfiel. Ich hielt sogleich mit dem Arbeiten inne und beschloß, vorläufig nur ein Stück Land von ungefähr 150 Ellen Länge und 100 Ellen Breite einzuschließen. Dies war ganz ausreichend für so viele Ziegen, als ich vernünftigerweise fürs Erste zu haben erwarten konnte, und wenn meine Heerde zunahm, konnte ich ja immer noch mehr Bodenfläche in die Umfassung hineinziehen.
An dies einigermaßen verständige Unternehmen machte ich mich nun mit gutem Muthe. Es dauerte etwa drei Monate, bis das erste Stück fertig umzäunt war. Bis dahin pflöckte ich die drei Lämmer an den besten Weidestellen an und ließ sie, um sie zahm zu machen, in möglichster Nähe von mir grasen. Zuweilen brachte ich ihnen einige Gerstenähren oder eine Handvoll Reis und ließ sie aus meiner Hand fressen, so daß, als die Einfassung fertig war und ich die Lämmer losband, sie mir auf dem Fuße folgten und nach einer Hand voll Korn hinter mir her blökten. Meine Einrichtung erfüllte ihren Zweck vollständig. und in etwa anderthalb Jahren hatte ich eine Heerde von zwölf Ziegen, einschließlich der Lämmer. Nach weiteren zwei Jahren waren es dreiundvierzig geworden, abgesehen von denen, die ich während dieser Zeit getödtet und zu meiner Nahrung verwendet hatte. Nach und nach legte ich fünf solcher eingezäunter Weideplätze an, in denen ich kleine Abtheilungen anbrachte, um die Thiere, die ich gerade gebrauchen wollte, hineinzutreiben. Die einzelnen Plätze brachte ich durch Gitterthüren mit einander in Verbindung.
Jetzt konnte ich nicht nur Ziegenfleisch, so viel ich immer essen mochte, haben, sondern obendrein Milch, und das war Etwas, was ich im Anfange nicht einmal für möglich gehalten hatte; daher gewährte es mir eine um so angenehmere Ueberraschung. Ich richtete jetzt eine förmliche Milchwirthschaft ein, denn ich gewann zuweilen vier bis acht Quart Milch an einem Tage. Die Natur lehrt jedes Geschöpf von der Nahrung, die sie ihm gibt, Gebrauch zu machen. So lernte auch ich, der nie eine Kuh, viel weniger eine Ziege gemolken oder die Bereitung von Butter und Käse mit angesehen hatte, wenn auch erst nach vielen mißglückten Versuchen, mit Leichtigkeit sehr gute Butter und Käse zu bereiten. Von nun an fehlte es mir daran nie mehr. Wie gnädig ist doch unser Gott gegen seine Geschöpfe, auch in den Lebenslagen, wo sie mitten ins Verderben gerathen zu sein scheinen! Wie kann er die bittersten Verhängnisse versüßen und uns Ursache geben, ihn für Kerker und Gefängnisse zu preisen! Welch ein reicher Tisch war hier in der Wüste für mich gedeckt, wo ich anfangs nichts als den Hungertod vor mir gesehen hatte!
Selbst ein Stoiker würde sich des Lächelns nicht haben erwehren können, hätte er mich und meine kleine Familie zum Mittagsmahle niedersitzen sehen. Da war zunächst meine Majestät, der Fürst und Herrscher der ganzen Insel. Das Leben meiner sämmtlichen Unterthanen stand unbedingt in meiner Gewalt. Ich konnte hängen, viertheilen, freilassen und gefangen halten, wen und wie ich wollte, und kein einziger Rebelle befand sich unter allen meinen Unterthanen. Man mußte es sehen, wie ich gleich einem König speiste, ganz allein, während meine Diener mir aufwarteten. Pol, als mein Günstling, genoß allein das Privileg, mit mir sprechen zu dürfen. Mein Hund, der inzwischen sehr alt und stumpf geworden war und leider nicht seines Gleichen auf der Insel gefunden hatte, um sein Geschlecht fortzupflanzen, saß stets zu meiner Rechten, und zwei Katzen, eine auf dieser, die andere auf jener Seite des Tisches, erwarteten ab und zu einen Brocken aus meiner Hand als ein Zeichen besonderer Gunst.
Es waren dies übrigens nicht mehr dieselben beiden Katzen, die ich mit ans Land gebracht hatte. Die lebten beide längst nicht mehr, und ich hatte sie eigenhändig in der Nähe meiner Wohnung begraben. Die eine von ihnen hatte sich aber, ich weiß nicht mit was für einer Art von Bestie gepaart und von ihrer Nachkommenschaft hatte ich zwei Junge aufgezogen, indessen die übrigen wild in den Wäldern umherliefen und mir auf die Dauer lästig fielen. Oftmals nämlich kamen sie in mein Haus und plünderten mich, bis ich mich endlich genöthigt sah, sie zu erschießen. Erst nachdem ich eine ganze Menge getödtet hatte, ließen sie mich endlich in Ruhe. Mit diesem Hofstaat und in dieser üppigen Weise lebte ich und entbehrte Nichts als Gesellschaft, und auch hiervon sollte ich einige Zeit später mehr als zu viel bekommen.
Wie ich schon bemerkt habe, wünschte ich sehr mein Boot bei mir zu haben, ohne daß ich jedoch Lust verspürte, mich seinetwegen wieder in Gefahren zu begeben. So dachte ich denn manchmal darüber nach, wie ich es herbeischaffen sollte, gab aber den Gedanken, es wieder zu bekommen, bald gänzlich auf. Eine sonderbare Unruhe trieb mich dagegen immerfort nach der Spitze der Insel, wo ich, wie erwähnt, bei meinem letzten Ausfluge auf den Hügel gestiegen war, um die Küste und den Lauf der Strömung zu übersehen. Das Verlangen, wieder dort zu sein, nahm alle Tage zu, bis ich endlich beschloß, die Reise dahin zu Lande zu machen, und zwar immer der Küste entlang. So begab ich mich denn abermals auf die Wanderschaft.
Hätte mich auf dieser irgend ein Landsmann von mir sehen können, er würde sich entweder vor mir entsetzt, oder ein großes Gelächter aufgeschlagen haben. Wenn ich zuweilen still stand und mich selbst betrachtete, so konnte ich nicht umhin, bei dem Gedanken zu lächeln, wie es wäre, wenn ich in einem solchen Aufzuge und in solchem Kostüm durch Yorkshire reisen wollte. Man stelle sich meine Erscheinung folgendermaßen vor:
Auf dem Kopfe trug ich eine hohe große unförmliche Mütze von Ziegenfell mit einer hinten lang herunterhängenden Krampe. Diese sollte sowohl die Sonne abhalten, als auch den Regen verhindern, mir hinten in den Nacken zu laufen. Denn Nichts ist in dieser Zone so schädlich, als wenn die Haut unter den Kleidern naß wird.
Ferner hatte ich eine kurze Jacke von Ziegenfell an, deren Schooß etwa bis über die Hüften herabfiel, und dazu ein Paar Kniehosen von demselben Stoffe. Diese letzteren waren aus der Haut eines alten Bockes gemacht, und die Haare hingen auf beiden Seiten herab, so daß meine Beinkleider wie lange Hosen bis über die Waden herunter reichten. Schuhe und Strümpfe besaß ich nicht, aber ich hatte mir dafür ein paar Dinger gemacht, die ich kaum zu benamen weiß. Es war eine Art von Stulpstiefeln, die hoch hinauf gingen und an den Seiten zugeschnürt waren gleich Kamaschen. Uebrigens hatten sie eine sehr uncivilisirte Form, wie überhaupt alle meine Kleidungsstücke höchst primitiv waren.
Außerdem trug ich einen breiten Gürtel von getrockneter Ziegenhaut, den ich anstatt einer Schnalle mit zwei Riemen aus demselben Stoffe befestigte. Daran hing in einer Art von Gehänge an Stelle eines Schwertes oder Dolches auf meiner einen Seite eine kleine Säge und auf der andern eine Hacke. Ein zweiter Lederriemen, etwas schmaler als der Gürtel, aber in derselben Art befestigt, hing mir über die Schulter, und daran unter dem linken Arm trug ich zwei Beutet, gleichfalls aus Ziegenfellen verfertigt, von denen der eine Pulver, der andere Kugeln und Schrot enthielt. Auf dem Rücken hatte ich einen Korb, auf der Schulter meine Flinte und über dem Kopfe meinen großen, plumpen, häßlichen Sonnenschirm, der übrigens nächst meiner Flinte das Nützlichste war, was ich bei mir führte. Was meine Gesichtsfarbe betraf, so war dieselbe nicht so mulattenhaft, als man sie wohl bei Jemandem hätte vermuthen sollen, der mit so geringer Fürsorge für dieselbe innerhalb der Wendekreise lebte. Meinen Bart hatte ich wachsen lassen, bis er eine Viertelelle lang war, aber da ich Scheeren und Rasirmesser in Menge besaß, hielt ich ihn jetzt ziemlich kurz geschnitten, ausgenommen den Schnurrbart, den ich zu einem langen türkischen Knebelbart gezogen hatte, wie ich ihn bei einigen Türken in Saleh gesehen. Die Mauren tragen nämlich keine solchen Bärte wie die Türken. Immerhin war Größe und Form meines Bartes abschreckend genug, und in England würde er für geradezu entsetzlich gegolten haben.
Uebrigens kam, da ja meine äußere Erscheinung von Niemandem beobachtet werden konnte, auf dies Alles wenig an. In jenem Aufzuge nun trat ich meine neue Reise an und blieb fünf bis sechs Tage fort. Zuerst wanderte ich der Küste entlang, direkt nach der Stelle, wo ich damals mit meinem Boote vor Anker gegangen war, um die Felsen zu erklettern. Da ich diesmal für kein Boot zu sorgen hatte, schlug ich einen nähern Weg zu Lande ein und erreichte dann auch auf diesem die erwähnte Höhe. Als ich von hier aus die vorspringende Felsenspitze überblickte, die ich vor Kurzem in meinem Boote hatte umfahren müssen, sah ich zu meiner Verwunderung das Meer ganz glatt und ruhig und gewahrte nichts von Brandung oder Wellen und Strömung, weder hier, noch an irgend einer andern Stelle. Ich konnte mir diese Erscheinung durchaus nicht erklären. Daher beschloß ich, sie eine Zeitlang zu beobachten, um zu entdecken, ob vielleicht die Ebbe und Flut einen Einfluß darauf habe. Bald überzeugte ich mich auch, wie sich die Sache verhielt. Wenn nämlich die Ebbe von Westen her eintrat, so vereinigte sie sich mit der starken Wassermasse eines großen Küstenstromes und brachte so jene Strömung hervor, welche, je nachdem der Wind mehr von Westen oder von Norden her wehte, der Küste näher oder entfernter floß. Nachdem ich bis gegen Abend gewartet und um die Zeit der Ebbe wieder den Felsen erstiegen hatte, sah ich die Strömung wieder ganz deutlich wie früher, nur weiter entfernt, fast eine halbe Seemeile von der Küste, während sie damals dicht an der Küste gegangen war und mich und mein Fahrzeug mit fortgerissen hatte, was unter andern Umständen nicht geschehen sein würde.
Diese Beobachtung überzeugte mich, daß ich nur auf den Eintritt der Ebbe und Flut zu achten brauchte, um mein Boot mit leichter Mühe um die Insel zurückführen zu können. Als ich aber an die Ausführung dachte, überfiel mich die Erinnerung an die früher überstandenen Gefahren dennoch mit solchem Schrecken, daß ich vorzog, einen anderen sicherern, wenn auch mühsameren Weg einzuschlagen. Dieser bestand darin, daß ich mir noch ein Canoe oder eine Pirogue zu bauen oder vielmehr zu hauen beschloß, um für jede Seite der Insel ein besonderes Fahrzeug zu haben.
Man muß sich erinnern, daß ich jetzt sozusagen zwei Ansiedelungen auf der Insel besaß. Erstens meine kleine Festung, d. h. das mit dem Wall umgebene Zelt, im Schutz des Felsens, mit der Höhle dahinter, die ich inzwischen zu mehren mit einander verbundenen Gemächern oder Kellern erweitert hatte. Der größte und trockenste dieser Räume, welche überdies eine Thür nach Außen hatten, war ganz angefüllt mit den früher erwähnten großen irdenen Gefäßen und mit vierzehn oder fünfzehn großen Körben, von denen jeder fünf bis sechs Scheffel hielt. In diesen bewahrte ich meine Vorräthe auf, besonders das Korn, theils in den Aehren, die dicht über dem Stroh abgeschnitten waren, theils ausgerieben, was ich mit den Händen zu bewerkstelligen pflegte.
Den sogenannten Wall hatte ich, wie früher erzählt ist, aus lauter langen Reisern und dünnen Stämmen aufgeführt, die aber jetzt alle zu Bäumen angewachsen waren und um diese Zeit bereits eine solche Höhe erreicht und sich so ausgebreitet hatten, daß Niemand dahinter eine menschliche Wohnung vermuthen konnte.
In der Nähe dieser meiner Wohnung, aber etwas weiter landeinwärts und niedriger gelegen, waren meine beiden Stücke Ackerland, welche ich stets in der gehörigen Bestellung und Kultur erhielt, und die mir alljährlich ihre Ernte lieferten. Als ich mich veranlaßt sah, mehr Getreide zu bauen, bediente ich mich dazu des angrenzenden gleich gut geeigneten Terrains.
Meine zweite Behausung war der sogenannte Landsitz. Auch dieser hatte sich zu einer ganz hübschen Ansiedelung entwickelt. Zunächst fand sich da die Laube, wie ich sie nannte. Ich erhielt dieselbe immer in gutem Stand, indem ich die umschließende Hecke, an die von Innen eine Leiter gelehnt war, stets in gleicher Höhe ließ. Die Bäume, die anfangs nichts als Stöcke gewesen, waren jetzt stark und hoch herangewachsen. Ich beschnitt sie so, daß sie sich ausbreiteten und mit ihrem dichten Laube erquickenden Schatten gaben. In der Mitte derselben ließ ich mein aus einem ausgespannten Stück Segeltuch errichtetes Zelt stehen, ohne daß es je der Ausbesserung oder Erneuerung bedurft hätte. Darunter hatte ich mir ein Sopha oder Ruhebett aus den Fellen erlegter Thiere und anderen weichen Gegenständen gemacht und darüber eine Decke, die ich aus unseren Schiffsbetten gerettet, ausgebreitet Neben dem Ruhebett hatte ich einen dicken Stock als Schutzwaffe stehen. Ich nahm dort mein Quartier, so oft ich Veranlassung fand, mich von meiner eigentlichen Wohnung zu entfernen.
Dicht daneben befanden sich die eingezäunten Weideplätze für mein Ziegenvieh. Da es mich unendliche Arbeit gekostet hatte, diese Räume in der beschriebenen Weise zu umschließen, war ich immer ängstlich darauf bedacht, die Umzäunungen in Ordnung zu erhalten, damit die Ziegen mir nicht entwischten. Niemals ging ich fort, ohne vorher mit vieler Mühe alle Oeffnungen der Hecke mit kleinen Stäben so dicht zu verschließen, daß die Umzäunung eher ein Gitter als eine Hecke zu nennen war und man kaum die Hand dazwischen durchstecken konnte. In der nächsten Regenzeit wuchsen diese Reiser alle zusammen und bildeten mit der Zeit eine starke Wand, ja sie wurden fester als ein gewöhnlicher Wall.
Dies Alles liefert den Beweis, daß ich nicht müßig war und keine Mühe scheute, Jegliches, was zu meiner Annehmlichkeit nothwendig erschien, herzurichten. Ich sah in meiner Heerde zahmer Hausthiere, die ich so nahe zur Hand hatte, einen lebendigen Vorrath von Fleisch, Milch, Butter und Käse, der für die ganze Dauer meines Aufenthalts auf der Insel, und wenn er auch noch vierzig Jahre währen sollte, vorhalten würde. Die Erhaltung derselben hing aber wesentlich davon ab, daß ich die Einzäunung möglichst vervollkommnete, damit die Heerde stets zusammen blieb. Diesen Zweck erreichte ich denn auch auf die erwähnte Art in dem Maße, daß ich, als die jungen Reiser, die ich so dicht gepflanzt, zu wachsen begannen, mich genöthigt sah, einige davon wieder abzureißen.
Hier war es auch, wo die Weintrauben wuchsen, die mir meine Wintervorräthe an Rosinen lieferten. Ich versäumte nicht, diese stets sehr sorgfältig zu konserviren, da sie den besten und wohlschmeckendsten Leckerbissen meiner ganzen Speisekarte bildeten. Sie waren wirklich nicht bloß schmackhaft, sondern auch im höchsten Grade heilsam, gesund, nahrhaft und äußerst erfrischend.
Da diese Ansiedelung etwa halbwegs zwischen meiner anderen Wohnung und dem Platze gelegen war, wo ich mein Boot befestigt hatte, so hielt ich mich gewöhnlich auf dem Wege nach letzterem eine Zeitlang dort auf. Denn ich pflegte mein Boot oft zu besuchen, um alles, was dazu gehörte, in der besten Ordnung zu erhalten. Auch fuhr ich manchmal zum Vergnügen darin aus, aber abenteuerliche Reisen wollte ich nicht wieder darin unternehmen, noch auch mich weiter als ein paar Steinwurfsweiten von der Küste entfernen. Denn ich war viel zu besorgt, wieder durch eine Strömung oder durch den Wind in unbekannte Gewässer verschlagen zu werden.
Kapitel 9
Jetzt gelange ich in dem Berichte von meinem einsamen Leben zu einem neuen Abschnitt.
Eines Tages, als ich gegen Mittag nach dem Boote ging, begab es sich, daß ich zu meiner größten Ueberraschung den Eindruck eines nackten menschlichen Fußes ganz deutlich in dem Sande des Ufers wahrnahm. Wie vom Donner gerührt, oder als hätte ich ein Gespenst gesehen, stand ich davor. Ich horchte, ich sah mich um, aber es war Nichts zu hören, noch zu erblicken. Ich erstieg einen Hügel, um mich weiter umschauen zu können, dann ging ich an der Küste auf und ab, aber es blieb Alles ohne Erfolg. Keine weiteren Fußspuren waren zu finden als jene eine. Ich ging zu ihr zurück, um zu sehen, ob nicht noch andere in der Nähe seien, oder ob ich mich vielleicht geirrt hätte. Aber Beides war nicht der Fall. Ich fand nur genau denselben Eindruck der Zehen, Fersen und übrigen Fußtheile. Wie die Spur dahin gekommen, wußte ich nicht und konnte es durchaus nicht begreifen. Eine Flut von wirren Gedanken stürmte auf mich ein, und völlig verstört und außer mir kam ich in meiner Festung an, ohne daß ich unterwegs, wie man zu sagen pflegt, den Boden unter meinen Füßen gefühlt hätte.
Es ist nicht zu beschreiben, in was für verschiedene Gestalten auf dem Wege meine erhitzte Einbildungskraft die Dinge verwandelte, was für eine Menge wilder Vorstellungen die Phantasie mir vorspiegelte und welche sonderbaren unerklärlichen Einfälle mir in den Sinn kamen. Als ich zu meiner Burg (denn diesen Namen hatte ich meiner Behausung gegeben) gelangt war, flüchtete ich hinein wie ein Verfolgter. Ob ich mittels der Leiter hineinstieg, weil das schneller ging, oder durch das Loch im Felsen, das ich meine Thür nannte, kroch, weiß ich heute noch nicht. Nie floh ein gehetzter Hase oder Fuchs in größerer Seelenangst seinem Zufluchtsort zu, als ich in jenem Augenblick.
Kein Schlaf kam diese Nacht in meine Augen; je weiter ich von der Ursache meines Schreckens entfernt war, um so größer wurden meine Befürchtungen. Zwar widerspricht das eigentlich der Natur der Sache und weicht von den gewöhnlichen Aeußerungen des Schreckens ab, aber ich war dermaßen in meinen entsetzten Gedanken über die Erscheinung befangen, daß sich mir Nichts als schauerliche Vorstellungen aufdrängten, wiewohl ich jetzt ziemlich weit von dem Anlaß meiner Furcht entfernt war.
Zuweilen bildete ich mir ein, der Teufel müsse sein Spiel hier haben, und diese Annahme war nicht ohne allen Grund. Denn wie sollte irgend ein anderes Wesen in menschlicher Gestalt hierher gekommen sein? Wo war das Schiff, das es hergeführt hatte? Warum waren keine anderen Fußspuren zu sehen? Dann aber kam mir wieder der Gedanke: Warum sollte der Satan menschliche Gestalt angenommen haben, nur um seinen Fußtritt hier zurückzulassen? Bald schien mir meine abergläubische Furcht auch deshalb lächerlich, weil ich bedachte, daß der Teufel mich ja auf unendlich viele andere Arten hätte erschrecken können als durch diesen einzelnen Fußtapfen. Denn da ich auf einer ganz anderen Seite der Insel wohnte, würde er doch gewiß nicht so dumm gewesen sein, eine Spur an einer Stelle zurückzulassen, wo zehntausend gegen eins zu wetten war, daß ich sie nie sehen würde, und am wenigsten im Sande, wo die erste Flutwelle bei einigem Winde sie sofort vernichten mußte. Alles dieses ließ sich weder mit der Sache selbst, noch mit den Vorstellungen, die wir gewöhnlich von der Schlauheit des Satans haben, zusammenreimen.
Solche Erwägungen benahmen mir allmählich die Furcht vor dem Teufel. Nun vermuthete ich dagegen, daß ich es mit noch gefährlicheren Wesen zu thun habe, nämlich mit einem oder mehren der wilden Bewohner jenes gegenüberliegenden Festlandes. Ich bildete mir ein, sie wären in ihrem Canoe in See gegangen und von widrigen Winden oder der Strömung an diese Küste verschlagen worden, dann aber wieder abgefahren, da es ihnen vielleicht ebensowenig auf dieser öden Insel gefallen haben möchte, wie es mir behagt haben würde, sie hier zu haben.
Während diese Gedanken meine Seele beunruhigten, empfand ich es sehr dankbar, daß ich so glücklich gewesen war, um jene Zeit nicht gerade an der fraglichen Stelle zu sein, und daß die Fremden mein Boot nicht gesehen hatten, weil sie sonst auf Bewohner der Insel hätten schließen müssen und vielleicht weiter nach mir geforscht hätten. Dann aber stiegen mir wieder schreckliche Gedanken auf und meine Einbildungskraft malte mir aus, daß die Wilden das Boot gefunden hätten und nun wüßten, daß die Insel bewohnt sei, und wie sie dann gewiß in großer Anzahl wiederkommen und mich überfallen würden. Und wenn sie auch mich selbst nicht finden konnten, so glaubte ich doch, sie würden meine Anlagen finden, meine Felder verwüsten und meine zahme Ziegenheerde hinwegführen, so daß ich endlich durch Mangel umkommen müßte.
So überwältigte meine Furcht wieder alle meine gläubige Hoffnung. Mein ganzes bisheriges Vertrauen auf Gott, welches auf so wunderbare Erfahrungen seiner Güte gegründet war, fiel nun über den Haufen, als ob er, der mich bisher durch Wunder ernährt hatte, nicht auch Macht habe, die Nahrungsmittel, die seine Gnade mir gespendet hatte, zu beschützen. Ich machte mir Vorwürfe über meinen Leichtsinn, daß ich nicht mehr Getreide jedes Jahr gesäet hatte, als was gerade bis zur nächsten Ernte ausreichend war, wie wenn kein Unfall mich jemals verhindern könnte, das Korn, was noch auf dem Felde stand, einzuheimsen. Dieser Vorwurf erschien mir so gerechtfertigt, daß ich mir vornahm, künftig immer Sorge zu tragen, auf zwei bis drei Jahre im Voraus versorgt zu sein, damit ich, was auch sonst kommen möge, wenigstens nicht zu verhungern brauchte.
Was für ein seltsames Gebilde der göttlichen Hand ist doch das Leben des Menschen! Durch wie verschiedene geheime Triebfedern werden seine Neigungen je nach den eben obwaltenden Umständen hin und her bewegt! Heute lieben wir das, was wir morgen vielleicht hassen; suchen das heute auf, was wir morgen vermeiden; wünschen jetzt, was wir gleich darauf fürchten, ja wovor wir beim bloßen Gedanken daran zittern. Das bewährte sich jetzt auch an mir auf das Alleraugenfälligste. Denn ich, dessen einziger Kummer darin bestanden hatte, daß ich aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen und verurtheilt schien, einsam und allein, nur umgeben von dem unermeßlichen Ocean zu leben, abgeschnitten von allem Verkehr und verdammt in einem sozusagen stummen Dasein zu existiren, als hätte der Himmel mich nicht für würdig gehalten, zu den Lebenden gezählt zu werden oder unter seinen übrigen Geschöpfen zu wandeln, ich, dem der Anblick eines Wesens meines Gleichen als eine Auferweckung vom Tode zum Leben hätte erscheinen müssen und als der größte Segen, den der Himmel, nächst der ewigen Erlösung selbst, mir hätte angedeihen lassen können, — ich erzitterte jetzt bei der bloßen Vorstellung, einen Menschen zu sehen, und hätte in die Erde sinken mögen bei der bloßen Vermuthung, bei dem stummen Zeichen, daß ein Mensch die Insel betreten hatte.
So wandelbar ist das Menschenherz. Als ich mich von meinem ersten Schrecken einigermaßen erholt hatte, stellte ich mancherlei merkwürdige Betrachtungen an. Ich bedachte, daß der allweise und allgütige Gott diese Lebenslage für mich ausersehen habe, und daß, da ich nicht voraussehen könne, welche Absichten die göttliche Weisheit mit allem diesem verfolge, es mir nicht zustehe, ihrer Anordnung zu widerstreben. Hatte denn Gott nicht über mich, als über sein Geschöpf, das unbestreitbare Recht unbedingter Verfügung, wie es ihm gefiel, und hatte ich ihn nicht überdies erzürnt und dadurch seine Gerechtigkeit herausgefordert, eine Strafe, wie er sie für angemessen hielt, über mich zu verhängen? War es nicht meine Schuldigkeit, mich seiner Ungnade zu unterwerfen, weil ich gegen ihn gesündigt hatte? Dann überdachte ich ferner, daß Gott, der ja nicht allein gerecht, sondern auch allmächtig ist, ebenso gut, wie er mich auf diese Weise strafte und heimsuchte, mich ja auch befreien könne, und daß, wenn er nicht für angemessen halte, das zu thun, es meine unzweifelhafte Pflicht sei, mich ganz unbedingt in seinen Willen zu ergeben; und wie es andererseits wieder meine Schuldigkeit sei, auf ihn zu hoffen, zu ihm zu beten und demüthig den täglichen Weisungen und Winken seiner Vorsehung zu gehorchen.
Diese Gedanken beschäftigten mich viele Stunden, Tage, ja, ich möchte sagen, Wochen und Monate. Auch noch eine besondere Wirkung solcher Betrachtungen auf mich will ich bei dieser Gelegenheit mittheilen. Als ich nämlich eines Morgens im Bette lag und durch meine Gedanken von der Gefahr, welche die Erscheinung von Wilden für mich mit sich brächte, sehr aufgeregt war, da fielen mir plötzlich wieder die Worte der heiligen Schrift ein:»Rufe mich an in der Noth und ich will dich erretten und du sollst mich preisen«. Da konnte ich nicht allein getrösteten Herzens fröhlich mein Lager verlassen, sondern ich fand auch Kraft und Muth, Gott inbrünstig um Errettung zu bitten. Als ich mein Gebet beendigt hatte, nahm ich meine Bibel zur Hand, und die ersten Worte, auf die meine Augen fielen, als ich sie aufschlug, waren:»Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn«.
Diese Worte gewährten mir unbeschreiblichen Trost. Ich legte mit dankbaren Gefühlen das Buch hin und war wenigstens für den Augenblick nicht mehr traurig.
Mitten in diesen Grübeleien, Aengsten und Betrachtungen fiel mir eines Tages ein, daß der Anlaß meiner Furcht möglicher Weise nichts weiter als eine meiner Einbildungen sein könnte. Die Spuren rührten ja vielleicht von meinen eigenen Füßen her; ich hatte sie vielleicht hervorgebracht, als ich aus meinem Boote ans Land gestiegen war. Dieser Gedanke trug auch ein wenig dazu bei, mich aufzuheitern, und ich fing an, mich selbst zu überreden, daß das Ganze nur eine Täuschung gewesen sei und kein anderer als mein eigener Fuß die Insel betreten habe. Warum sollte ich nicht auf jenem Wege von dem Boote hergekommen sein, da ich doch auf demselben nach dem Boote hingegangen war? Konnte ich doch keineswegs versichern, wohin ich getreten habe und wohin nicht. Am Ende, wenn es sich herausstellte, daß es wirklich mein eigner Fußtritt gewesen war, hatte ich die Rolle jener Narren gespielt, die Gespenster und Geistergeschichten erfinden und sich dann selbst am meisten davor entsetzen.
Erst jetzt fing ich an, wieder Muth zu fassen und mich hinaus zu wagen. Denn seit drei Tagen und Nächten hatte ich meine Festung keinen Augenblick verlassen, und schon begann ich Mangel zu leiden, da ich zu Hause wenig mehr als einige Gerstenkuchen und Wasser hatte. Ich wußte auch, daß es nöthig sei, meine Ziegen zu melken, welches Geschäft sonst gewöhnlich meine Abendunterhaltung bildete. Die armen Thiere empfanden die Vernachlässigung auch schon schmerzlich, und einigen war sie sogar so nachtheilig gewesen, daß ihre Milch fast versiegt war. So waffnete ich mich denn mit dem Glauben, jene Fußspuren rührten wirklich nur von einem meiner eigenen Füße her, und ich sei, wie man zu sagen pflegt, vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Bei meinem ersten Ausgang begab ich mich zunächst nach meinem Landsitz, um die Heerde zu melken. Wer damals gesehen hätte, wie furchtsam ich vorwärts schritt, wie oft ich mich umsah, wie ich beständig auf dem Sprunge war, meinen Korb von mir zu werfen und davon zu laufen, der würde gedacht haben, ich sei von einem bösen Gewissen geplagt oder durch etwas Ungeheures erschreckt worden; und das Letzte war ja auch wirklich der Fall.
Nachdem ich jedoch zwei oder drei Tage denselben Weg gemacht hatte, ohne irgend etwas Außergewöhnliches zu sehen, wurde ich ein Bischen kühner und die Ueberzeugung befestigte sich in mir, die Einbildung sei in der That die einzige Ursache meines Entsetzens gewesen. Völlig sicher konnte ich trotzdem mich nicht eher fühlen, als bis ich aufs Neue an jener Stelle der Küste gewesen war, den Fußtritt noch einmal angesehen und ihn mit meinem eigenen verglichen hatte. Dort angekommen aber überzeugte ich mich erstens, daß ich unmöglich beim Anlegen meines Bootes auch nur in die Nähe des Platzes gekommen sein konnte. Sodann ergab sich, daß mein Fuß, als ich ihn gegen die Spur abmaß, bei weitem nicht so groß war. Diese beiden Beobachtungen erfüllten mich aufs Neue mit den schrecklichsten Vorstellungen und machten mich wieder so furchtsam, daß ich zitterte wie ein Fieberkranker. Ich trat den Rückweg in dem festen Glauben an, ein Mensch oder mehre seien an jenem Platz gelandet, oder die Insel sei bewohnt, und ich könne unversehens überfallen werden. Wie ich mich davor schützen sollte, sah ich nicht ab.
Was für lächerliche Vorsätze faßt man doch unter dem Eindruck der Furcht! Diese Empfindung raubt dem Menschen alle Vertheidigungsmittel, die ihm die Vernunft zu seiner Rettung bieten würde. Das Erste, was ich vornehmen wollte, war, meine Zäune niederzureißen und alle mein zahmes Vieh in die Wälder zu jagen, in der Besorgniß, der Feind möchte es finden und dann vielleicht in der Hoffnung auf gleiche oder ähnliche Beute öfter wiederkommen. Aus demselben Grunde gedachte ich meine beiden Kornfelder umzugraben und nicht einen Halm darauf zu lassen. Auch meine Hütte und mein Zelt beschloß ich zu zerstören, damit man durchaus keine Spur des Bewohntseins der Insel fände und Niemand versucht würde, den Bewohnern selbst nachzuforschen.
Mit solchen Gedanken beschäftigte ich mich während der ersten Nacht nach meiner Rückkehr, als die Befürchtungen, die mich so überwältigt hatten, mir noch frisch in der Seele lebten und meinen Kopf mit wirren Bildern füllten. So ist die Furcht vor einer Gefahr oft tausendmal schrecklicher als die gegenwärtige Gefahr selbst. Wir tragen viel schwerer an der Last der Angst als an dem Uebel, das uns ängstigt. Das Schlimmste aber bei der Sache war, daß ich in dieser Noth nicht den Trost und die Ergebung festhielt, die mich sonst gestärkt hatten. Es ging mir wie Saul, wenn er klagt, daß nicht nur die Philister über ihn gekommen seien, sondern auch daß Gott ihn verlassen habe. Auch ich that jetzt nicht, was ich hätte thun sollen, mein Gemüth zu beruhigen. Ich rief nicht zu Gott in meiner Noth und verließ mich nicht wie früher, hinsichtlich meiner Verteidigung und Errettung, auf seine Vorsehung. Hätte ich das gethan, so wäre ich wenigstens mit frischerem Muthe dieser neuen Anfechtung entgegen gegangen und hätte sie wahrscheinlich leichter überwunden.
Die Verwirrung meiner Gedanken hielt mich die ganze Nacht wach. Erst gegen Morgen, durch die Aufregung meiner Gefühle müde gemacht und erschöpft, fiel ich in einen festen Schlaf und erwachte dann in viel ruhigerer Stimmung, als in der ich vorher gewesen war. Ich begann jetzt vernünftig nachzudenken. Nach langer Erwägung kam ich zu dem Schluß: diese so gar liebliche und fruchtbare Insel, die, wie ich gesehen, nicht weit vom Festlande abliege, könne nicht so durchaus verödet sein, als ich bisher geglaubt habe. Zwar werde sie schwerlich ständige Bewohner herbergen, aber zuweilen würden wohl Boote von der gegenüberliegenden Küste herüber kommen, die entweder absichtlich oder auch nur durch widrige Winde gezwungen hier landeten.
Freilich hatte ich bereits fünfzehn Jahre hier zugebracht und noch nie den leisesten Schatten einer menschlichen Gestalt gesehen. Daraus folgerte ich, daß, wenn jemals Leute hierher verschlagen sein sollten, sie sich wahrscheinlich immer sobald wie möglich wieder entfernt und nie daran gedacht hätten, sich hier niederzulassen. Demnach bestehe, so sagte ich mir weiter, die einzige mir drohende Gefahr in der zufälligen Landung einzelner verirrter Bewohner des Festlandes, welche aller Wahrscheinlichkeit nach gegen ihren Willen hierher verschlagen worden seien und die darum auch ohne Aufenthalt weiter zu kommen suchen und nur selten einmal über Nacht hier verweilen, sondern die nächste Flut und das Tageslicht für ihren Rückweg als Beistand benutzen würden. Also hätte ich weiter Nichts zu thun, als für den Fall, daß ich die Landung solcher Wilden hier erleben sollte, für einen sicheren Schlupfwinkel zu sorgen.
Jetzt bereuete ich bitter, die Höhle so groß gemacht zu haben, daß, wie ich erwähnte, noch eine Thür da, wo meine Befriedigung an den Felsen stieß, nach Außen führte. Nach reiflicher Ueberlegung beschloß ich, einen zweiten Wall zu errichten, in derselben Halbkreisform wie der erste, und zwar da, wo ich, wie seiner Zeit erwähnt ist, vor zwölf Jahren die doppelte Reihe Bäume gepflanzt hatte. Da diese ganz dicht zusammen standen, bedurfte es nur noch einiger Pfähle dazwischen, um sie noch enger zu verbinden. So war mein neuer Wall bald fertig. Ich hatte nun eine doppelte Mauer, und die äußere war überdies noch mit Holzscheiten, Schiffsketten und allen erdenklichen brauchbaren Dingen verwahrt. Ich hatte sieben kleine Löcher darin angebracht, ungefähr so groß, daß ich meinen Arm hindurchstecken konnte. An der inneren Seite verstärkte ich den Wall bis auf zehn Fuß Dicke, indem ich Erde aus meinem Keller holte, sie am Fuße der Wand ausschüttete und mit den Füßen fest trat. Durch jene Löcher steckte ich sodann die sieben, vom Schiff mitgebrachten Gewehre und legte sie wie Kanonen auf Lafetten, so daß ich alle sieben Geschütze in Zeit von zwei Minuten abzufeuern vermochte. Es bedurfte übrigens langer Monate, bis diese ganze Arbeit vollendet war, aber ich fühlte mich nicht eher sicher, als bis ich sie zu Stande gebracht hatte.
Hierauf besteckte ich den Boden außerhalb meiner Befestigung nach allen Richtungen mit Reisern und Schößlingen von dem weidenartigen schnellwachsenden Holze in einer solchen Ausdehnung, daß ich, glaub' ich, an zwanzigtausend Sprößlinge dazu verbrauchte. Unmittelbar um meine Festung ließ ich jedoch einen ziemlich großen Raum frei, damit ich etwaige Feinde kommen sehen könnte, und damit sie hinter den jungen Bäumen keinen Schutz fänden, wenn sie versuchen sollten, sich meiner Umfriedigung zu nähern.
Auf diese Weise war meine Wohnung innerhalb zweier Jahre von einem dichten Gehölz und nach fünf bis sechs Jahren von einem gewaltig dichten und starken Walde umgeben, der völlig undurchdringlich war. Niemand hätte dahinter jemals irgend etwas Besonderes, geschweige denn eine menschliche Wohnung vermuthet. Ich hatte keinen Zugang in meiner Einfriedigung freigelassen, sondern gelangte in dieselbe mittels zweier Leitern. Von diesen reichte die eine, die ich gegen eine niedrige Stelle des Felsens gelehnt hatte, bis an einen Vorsprung, auf dem Platz genug war, um eine zweite Leiter darauf anzubringen, so daß, wenn die beiden Leitern eingezogen waren, kein Mensch ohne die Gefahr einer Verletzung über den Wall gelangen konnte. Ueberdies hätte er dann auch erst noch die innere Umzäunung meiner Behausung zu passiren gehabt.
So hatte ich denn alle Vorkehrungen zu meiner Sicherheit, die menschliche Vorsicht ausdenken konnte, getroffen. Die Folge wird zeigen, daß sie nicht ganz unnütz gewesen waren, obgleich ich damals zu jenen Maßregeln lediglich durch die Vorspiegelungen meiner Furcht veranlaßt wurde.
Während der Beschäftigung mit diesen Arbeiten vernachlässigte ich meine andern Angelegenheiten auch nicht ganz. Besonders lag meine kleine Ziegenheerde mir sehr am Herzen. Die Thiere boten mir auf alle Fälle ein sehr schätzbares Hülfsmittel und lieferten mir schon jetzt ausreichenden Lebensunterhalt. Auch ersparten sie mir den Aufwand von Pulver und Blei, sowie die Anstrengung, die ich bei der Jagd auf die wilden Ziegen gehabt hatte. Ich wollte mir daher um jeden Preis diesen Vortheil wahren, um nicht genöthigt zu sein, noch einmal die Einzäunung aufs Neue zu beginnen.
Nach langer Ueberlegung sah ich für diese Sicherung nur zwei Möglichkeiten. Die eine bestand darin, daß ich an einer passenden Stelle eine unterirdische Höhle grub, um die Ziegen des Nachts da hineintreiben zu können; die zweite, daß ich einige Stückchen Land, weit auseinander und möglichst versteckt gelegen, mit Zäunen umgab und innerhalb jedes derselben etwa ein halbes Dutzend junger Ziegen hielt. Auf diese Weise konnte ich, wenn die Hauptheerde von irgend einem Unfall betroffen wurde, ohne viel Mühe und Zeitverlust mir wieder eine andere heranziehen. Der letztere Plan erschien mir der zweckmäßigste, wenngleich seine Ausführung viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen mußte.
Demgemäß suchte ich sorgfältig nach den verborgensten Plätzen auf der Insel und machte auch glücklich einen ausfindig, der so heimlich gelegen war, wie ich es nur wünschen konnte. Es war ein kleiner, feuchter Rasenfleck mitten im dichtesten Walde, da, wo ich mich einmal, wie früher erzählt ist, auf dem Rückweg von der Ostseite der Insel verirrt hatte. Hier fand ich einen freien Platz, etwa drei Morgen groß und dergestalt von Bäumen umgeben, daß dieser fast schon einen natürlichen Wildzaun bildete. Wenigstens erforderte die Anlegung des künstlichen dort bei weitem weniger Arbeit als an den Stellen, wo ich früher die Umfriedigungen angelegt hatte.
Ich machte mich unverzüglich an die Arbeit und hatte schon vor Ablauf eines Monats einen Zaun fertig gebracht, in welchem eine Heerde oder ein Rudel meiner Ziegen, die übrigens jetzt lange nicht mehr so wild waren als im Anfang, ganz sicher untergebracht werden konnte. Dahin versetzte ich nun zehn junge Ziegen und zwei Böcke und fuhr dann fort, den Zaun zu vervollkommnen, bis er ebenso fest war wie die andern. Doch nahm ich mir dabei die Zeit, und es dauerte daher lange, bis die Arbeit beendet war.
All diese Mühe wurde veranlaßt durch die Furcht, die mir die Spur eines einzigen menschlichen Fußtrittes eingeflößt hatte. Zwar hatte ich bis hierher noch kein Menschenkind außer mir auf der Insel wahrgenommen, aber dennoch befand ich mich seit zwei Jahren in einer solchen Aufregung, daß mein Leben sich bei weitem unbehaglicher als früher gestaltet hatte. Das wird Jedermann begreiflich finden, der jemals Furcht vor feindseligen Menschen empfunden hat.
Leider muß ich bekennen, daß die Unruhe meines Gemüthes auch nicht ohne Einfluß auf mein Leben im Glauben blieb. Denn die Angst und das Entsetzen bei dem Gedanken, den Wilden und Menschenfressern in die Hände zu fallen, drückte meinen Geist so nieder, daß ich selten in der Stimmung war, mich an Gott zu wenden. Wenigstens that ich es nicht mehr mit der andächtigen Sammlung und Ergebung der Seele wie sonst. Ich betete nur in großer Angst und Herzensunruhe, wie in beständiger Gefahr und in der fortwährenden Erwartung, im Laufe der Nacht ermordet zu werden und den Morgen nicht zu erleben. Aus Erfahrung kann ich bezeugen, daß Friede, Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit viel mehr zum Gebet stimmen als Schrecken und Angst. In der Furcht vor drohendem Unheil ist der Mensch ebensowenig zu der tröstlichen Ausübung der Gebetspflicht fähig, als er es auf dem Krankenbett zur Reue ist. Denn in jener Verfassung ist der Geist ebenso gestört wie dort der Körper, und die geistige Störung bringt nothwendig eine gleiche Unfähigkeit hervor wie die körperliche. Ja sogar eine noch größere, denn das Gebet ist ja eine ausschließlich geistige Thätigkeit.
Nachdem ich, um hier meine Erzählung wieder aufzunehmen, in der erwähnten Weise einen Theil meines kleinen lebendigen Inventars in Sicherheit gebracht hatte, durchwanderte ich die ganze Insel nach einem zweiten verborgenen Platze, um noch ein anderes Depot gleicher Art anzulegen. Diesmal gerieth ich weiter nach der Westspitze der Insel als je vorher, und da geschah es, daß ich, als ich einmal auf das Meer hinaus schaute, in weiter Entfernung ein Boot wahrzunehmen glaubte. In den Matrosenkoffern, die ich aus dem Schiffe gerettet, hatte ich auch zwei Ferngläser gefunden, von denen ich jedoch damals gerade keins bei mir trug. Das vermeintliche Fahrzeug war so entfernt, daß ich es nicht genau erkennen konnte, obgleich ich danach schaute, bis mir die Augen übergingen. Als ich, von dem Hügel herabgestiegen, das Boot nicht mehr sah, beschloß ich, nicht mehr an die Sache zu denken, nahm mir aber vor, nie mehr ohne ein Fernrohr in der Tasche auszugehen. Nachdem ich unterhalb des Hügels an das Ende der Insel gelangte, wo ich früher noch nie gewesen war, überzeugte ich mich, daß der Anblick einer menschlichen Fußspur nicht etwas so Außerordentliches sei, als ich mir bisher eingebildet hatte. Wäre ich nicht durch eine besondere Fügung gerade auf jener Seite der Insel, wo die Wilden nie hinzukommen pflegten, ans Land geworfen worden, so hätte ich längst wissen können, daß die Canoes vom Festlande, wenn sie sich etwas zu weit in die See hinaus gewagt hatten, sehr häufig die der meinigen entgegengesetzte Seite der Insel als Hafen benutzten. Nach ihren Seegefechten in Canoes pflegten nämlich die Sieger ihre Gefangenen an jene Küste zu bringen und sie nach ihrer schrecklichen Sitte gemäß (denn sie waren sämmtlich Cannibalen) dort zu tödten und zu verzehren. Doch hiervon wird später ausführlicher die Rede sein.
Von dem Hügel herab ans Ufer gelangt, das, wie gesagt die Südwestspitze der Insel bildete, blieb ich plötzlich starr vor Schrecken und Entsetzen stehen. Mit unbeschreiblichem Grauen fand ich dort den Boden mit Schädeln, Händen, Füßen und anderen Gliedmaßen menschlicher Leiber übersäet. Am meisten entsetzte mich eine Stelle, wo offenbar ein Feuer angezündet gewesen war, um das sich ein kreisförmiger Graben zog. Hier hatten sich augenscheinlich jene wilden Scheusale zu ihrem unmenschlichen Mahle, das aus den Leichnamen ihrer Mitmenschen bestand, niedergelassen gehabt.
Ich war so durch diesen Anblick vernichtet, daß ich eine ganze Weile gar nicht an eine Gefahr für mich selbst dachte. Meine Befürchtungen gingen unter in dem Gedanken an diese unmenschliche teuflische Brutalität und in dem Abscheu vor solcher Entwürdigung der menschlichen Natur. Zwar hatte ich von dergleichen Scheußlichkeiten oft gehört, aber noch nie hatte ich so unmittelbare Beweise für dieselben gehabt. Ich wandte mich von dem grausigen Schauspiel ab, mir wurde ganz übel und ich war einer Ohnmacht nahe. Meine Natur half sich jedoch.
Nachdem ich mich heftig übergeben hatte, fühlte ich mich etwas wohler, konnte es aber keinen Augenblick länger an diesem Orte aushalten. Ich kletterte so schnell als möglich wieder den Hügel hinan und eilte meiner Wohnung zu. Nachdem ich eine Strecke Weges hinter mir hatte, stand ich einen Augenblick still, um mich zu sammeln. Ein wenig zu mir gekommen, blickte ich inbrünstig gen Himmel und dankte Gott unter einem Strom von Thränen dafür, daß er mich in einem Welttheil hatte geboren werden lassen, wo solche schreckliche Geschöpfe wie die, deren Spuren mir soeben vor die Augen getreten waren, nicht existirten. Vor Allem dankte ich meinem Schöpfer auch dafür, daß er mir in der elenden Lage, in der ich mich befand, doch wenigstens die Erkenntniß seines Wesens und die Hoffnung seiner Gnade gewährt hatte. Dies Geschenk wog ja alles Elend, das ich schon erduldet hatte und noch erdulden konnte, reichlich auf.
In solch dankbarer Gemüthsstimmung ging ich nach Hause und wurde nun viel ruhiger über meine Sicherheit, als ich seit langer Zeit gewesen war. Ich hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß jene Elenden niemals die Insel in der Absicht beträten, dort Beute zu machen. Entweder begehrten sie Nichts, oder sie vermutheten Nichts hier. Denn gewiß waren sie oft in dem bewachsenen waldigen Theile gewesen, ohne etwas für sie Brauchbares anzutreffen. Achtzehn Jahre hatte ich nun beinahe hier verweilt, ohne in der ganzen Zeit auch nur eine einige Spur von menschlichen Wesen wahrzunehmen, und ebenso gut konnte ich daher noch einmal achtzehn Jahre unbemerkt wie bisher hier zubringen, wenn ich mich nicht selbst verrieth. Davor vermochte ich mich jedoch leicht zu hüten. Ich brauchte mich nämlich nur ganz still zu Haus zu halten, bis sich eine bessere Art Menschen als jene Cannibalen zeigen würde, mit denen ich in Verkehr treten könnte.
Mein Abscheu vor den scheußlichen Wilden und ihren unmenschlichen Sitten war so groß, daß ich fast zwei Jahre lang nach dem erzählten Vorfall nicht mein nächstes Gebiet verließ. Hierunter verstehe ich meine drei Ansiedelungen: die Burg, den Landsitz (meine sogenannte Villa) und die Anlagen im Walde. Diese letzteren suchte ich indessen nur auf, wenn ich nach meinen Ziegen sehen wollte. Da mein Entsetzen vor den höllischen Gesellen so stark war, daß ich ihren Anblick wie den des Teufels fürchtete, ging ich auch die ganze Zeit über nicht ein einziges Mal nach meinem Boot. Dagegen dachte ich daran, mir ein neues zu machen; denn ich konnte es nicht über mich gewinnen, jemals wieder einen Versuch zu wagen, das vorhandene um die Insel herum zu führen und mich so einer möglichen Begegnung zur See mit jenen Kreaturen auszusetzen. Wußte ich doch zu gut, was mein Loos sein würde, wenn ich ihnen in die Hände fiele.
Mit der Zeit aber wuchs auch meine Zuversicht, daß mir keine Gefahr drohe, von diesen Unmenschen entdeckt zu werden. Nach und nach schwand meine Furcht vor ihnen und ich fing an, wieder in derselben Weise wie früher zu leben. Nur mit dem Unterschiede, daß ich jetzt vorsichtiger war und meine Augen besser offen hielt als sonst, damit ich nicht einmal unversehens ihnen ins Gesicht käme. Besonders nahm ich mich mit dem Schießen in Acht, um mich nicht durch den Knall zu verrathen. Es kam mir jetzt besonders zu Statten, daß ich mich mit zahmen Ziegen versehen hatte und nicht mehr in den Wäldern herum zu jagen und zu schießen brauchte. Ich bemächtigte mich von nun an des Wildes nur noch mit Fallen und Schlingen, und in einem Zeitraum von zwei Jahren feuerte ich, glaub' ich, meine Flinte nicht ein einziges Mal ab, obgleich ich nie ohne sie ausging und überdies immer wenigstens zwei von den drei aus dem Schiffe mitgebrachten Pistolen in meinem Gürtel von Ziegenleder bei mir führte. Auch eins von den großen Messern, die ich aus dem Schiffe gerettet, hing ich, nachdem ich es geputzt und geschliffen, an einem besonderen Riemen stets um, so daß ich bei meinen Ausgängen ganz gefährlich anzuschauen war.
Eine Zeitlang nahmen die Dinge ihren ruhigen Fortgang und ich kehrte daher, jene Vorsichtsmaßregeln abgerechnet, wieder zu meiner früheren geregelten Lebensweise zurück. Alles vereinigte sich, um mir mehr und mehr zu beweisen, wie gut ich es immer noch im Vergleich mit Andern hätte, und wie gut meine Lage im Vergleich zu schlimmeren, in die Gott mich ja ebenso gut hätte versetzen können, sei. Die Menschen würden sich überhaupt weit weniger über ihr Geschick beklagen, wenn sie dasselbe nur stets mit noch ungünstigerem vergleichen wollten, anstatt sich immer mit Denen, die es besser haben, zu messen und dann zu murren und zu jammern.
Da ich in meiner jetzigen Lage wirklich Weniges vermißte, so muß ich glauben, daß die Furcht, welche mir die Wilden eingejagt hatten, und die Sorge, die ich auf meine Selbsterhaltung verwendete, meine Erfindungskraft in Bezug auf meine Bequemlichkeit vermindert hatte. Wenigstens einen schönen Plan, mit dem ich mich früher sehr viel beschäftigt, hatte ich jetzt ganz fallen lassen. Ich hatte nämlich an den Versuch gedacht, aus einem Theil meiner Gerste Malz zu bereiten und mir daraus Bier zu brauen. Allerdings war das ein närrischer Einfall und ich zog mich darüber oft selbst auf, denn ich konnte ja nicht übersehen, daß zum Bierbrauen noch manche Dinge gehörten, die ich unmöglich herbeizuschaffen vermochte. Fürs Erste nämlich Fässer, um das Gebräu aufzubewahren. Der schwierigen Aufgabe, mir solche zu verfertigen, opferte ich Tage, Wochen und Monate, ohne jeden Erfolg. Sodann fehlte mir der Hopfen, um das Bier vor dem Verderben zu bewahren, Hefen, um die Gährung hervorzubringen, und ein kupferner Kessel, um es darin zu kochen. Und dennoch würde ich, wären nicht die vielen Aengste und Schrecken über die Wilden dazwischen gekommen, die Ausführung meines Planes unternommen und vielleicht auch bewerkstelligt haben. Denn selten gab ich Etwas als unausführbar auf, wenn ich es einmal so weit ausgedacht hatte, daß ich überhaupt bis zum Anfang kam.
Damals jedoch hatte mein Erfindungsgeist eine ganz andere Richtung genommen. Tag und Nacht dachte ich über nichts Anderes nach, als wie ich jene Ungeheuer in ihren blutigen Belustigungen überfallen und wo möglich die dem Verderben geweiheten Schlachtopfer retten könnte. Es würde den Umfang, den ich meiner Erzählung bestimmt habe, überschreiten heißen, wollte ich alle die Listen beschreiben, die ich ersann und in Gedanken ausbrütete, um diese Geschöpfe zu vernichten oder sie wenigstens so in Furcht zu versetzen, daß sie nie wieder hierher kämen. Meine ganze Absicht mußte jedoch erfolglos bleiben, wenn ich sie nicht in eigner Person ausführte. Was aber konnte. ein einzelner Mann gegen vielleicht zwanzig oder dreißig mit Lanzen oder Bogen und Pfeilen (mit welchen sie so sicher zielten wie ich mit meiner Flinte) Bewaffnete ausrichten?
Zuweilen dachte ich daran, eine Mine unter der Stelle, wo die Cannibalen ihr Feuer zu machen pflegten, anzulegen und mit einigen Pfunden Pulver zu füllen, welches beim Anzünden des Feuers explodiren und Alles rings umher in die Luft sprengen sollte. Aber theils wollte ich doch nicht gern so viel Pulver daran wenden, da mein Vorrath bereits sehr zusammengeschmolzen war, und andererseits konnte ich ja auch nicht berechnen, ob die Explosion gerade zu einer solchen Zeit stattfinden würde, in welcher die Wilden dadurch in Gefahr gebracht werden müßten. Im besten Falle hätte es auch weiter nichts bewirken können, als daß ihnen das Feuer um die Ohren gezischt und sie erschreckt hätte, ohne sie dadurch auf die Dauer zu vertreiben.
Ich gab mit Rücksicht hierauf diesen Plan auf und beschloß, mich anstatt dessen nun mit meinen drei doppelt geladenen Gewehren an geeigneter Stelle in einen Hinterhalt zu legen und wenn die Wilden mitten in ihrer blutigen Thätigkeit wären, auf sie zu feuern. Dabei glaubte ich sicher, mit jedem Schuß wenigstens zwei bis drei von ihnen zu tödten oder zu verwunden. Wenn ich alsdann mit meinen drei Pistolen und meinem Schwerte über sie herfiele, so könnte ich sie, davon war ich überzeugt, alle, und wären es ihrer zwanzig, tödten.
Diese Gedanken beschäftigten mich mehre Wochen lang. Ich war so voll davon, daß ich oft von meinen Plänen träumte. Manchmal war es mir im Schlaf, als ob ich eben auf die Feinde Feuer gäbe. Ich wendete mehre Tage daran, geeignete Plätze für einen solchen Hinterhalt ausfindig zu machen, und besuchte sogar häufig die Stelle, wo ich die Reste der cannibalischen Mahlzeit gefunden hatte. Seit ich mich mit solchen Rachegedanken trug und einen ganzen Haufen von Menschen dem Untergange geweiht hatte, schwand mein Abscheu vor jenem Platze und vor den Spuren Derer, die so barbarisch waren, daß sie sich unter einander aufzufressen pflegten. Endlich machte ich auch einen Ort ausfindig, von welchem aus ich in völliger Sicherheit ihre Boote ankommen sehen, und noch ehe sie landeten, unbemerkt in ein Dickicht entfliehen konnte. Dort wußte ich einen hohlen Baum, der groß genug war, um mich vollständig zu verbergen und von dem aus ich alle ihre blutigen Handlungen beobachten und in aller Ruhe auf ihre Köpfe zielen konnte. Wenn sie nahe genug beisammen waren, so mußte es mir fast unmöglich sein, mein Ziel zu verfehlen und nicht wenigstens drei bis vier auf den ersten Schuß zu verwunden. Diesen Platz beschloß ich nun zum Ausgangspunkt meiner Unternehmungen zu machen. Ich setzte zwei Musketen und meine gewöhnliche Vogelflinte in Stand, lud die ersteren beiden mit einem Paar großen und mit vier bis fünf kleineren Kugeln von der Größe einer Pistolenkugel und die Vogelflinte mit einer Handvoll Schrot von der größten Sorte, that auch in jede meiner Pistolen ungefähr vier Kugeln und in dieser Ausrüstung, wohl versehen mit Munition für einen zweiten und dritten Schuß, bereitete ich mich auf meine Expedition vor.
Nachdem ich so meinen Plan gehörig durchdacht und in meiner Phantasie gewissermaßen bereits ausgeführt hatte, richtete ich meine Schritte alle Tage nach dem Gipfel des Hügels, der ungefähr drei Meilen von meiner Festung entfernt war, um zu sehen, ob ich nicht ein Boot auf dem Meere erspähen würde, das sich der Insel nähere. Nach einigen Monaten jedoch wurde ich dieser Anstrengung überdrüssig, da in dieser ganzen Zeit mein Wachehalten ohne irgend ein Resultat geblieben war. Auch nicht das Geringste hatte sich, so weit meine Augen und Ferngläser reichten, blicken lassen, weder an der Küste, noch in ihrer Nähe, noch auch auf dem weiten Meere.
So lange ich täglich den Weg nach dem Hügel machte, hielt auch mein Eifer für meinen Anschlag vor. Ich befand mich während der ganzen Zeit in einer durchaus geeigneten Stimmung zu einer so unverantwortlichen Schlächterei, wie es das Erschießen eines Haufens nackter Wilden gewesen sein würde. Die Natur ihrer Handlung hatte ich ganz und gar nicht weiter in meinen Gedanken erwogen, war vielmehr einzig meiner aufgeregten Leidenschaft und dem Abscheu gefolgt, den ich bei der Erinnerung an die unnatürlichen Sitten dieser Menschen empfand. Und doch hatte ja die Vorsehung selbst in weiser Anordnung sie ihren abscheulichen und verderblichen Begierden überlassen. Vielleicht waren sie schon seit Menschenaltern solchen grausamen und entsetzlichen Gebräuchen ergeben, wie sie nur völlig gottlose Naturen ersinnen können. Aber jetzt, wo ich, wie gesagt, meiner fruchtlosen Wege, die ich so lange und weithin alle Morgen gemacht hatte, müde war, änderte sich auch meine Ansicht von der Sache selbst. Ich fing an, mit ruhigerem und kühlerem Blute darüber nachzudenken. Welches Recht und welchen Beruf hatte ich denn, mich zum Richter und Henker dieser Menschen aufzuwerfen, welche der Himmel so lange Zeit hindurch ungestraft gelassen und sie gleichsam zu Vollziehern seiner Strafgerichte unter einander gemacht hatte? Was hatten diese Leute mir gethan? Was berechtigte mich, in ihre Streitigkeiten mich zu mischen und die Metzeleien zu rächen, die sie an einander verübten? So fragte ich mich oft. Das aber war sicher: die Wilden sahen die Sache nicht als ein Verbrechen an. Sie war nicht gegen ihr besseres Wissen und Gewissen. Sie selbst hatten keine Ahnung davon, daß sie dadurch ein Unrecht begingen und gegen Gottes Gebote sündigten. Ihnen war es ebensowenig eine Sünde, einen Kriegsgefangenen zu tödten, als uns, einen Ochsen zu schlachten, und Menschenfleisch schien ihnen ebenso eine naturgemäße Speise wie uns Hammelfleisch.
Nach einigem Nachdenken kam ich zu dem Schluß, daß ich Unrecht gehabt habe, diese Leute als Mörder in unserm Sinne anzusehen. Sie waren es ebensowenig wie die Christen, welche die in der Schlacht gemachten Gefangenen zum Tode verurtheilen, oder Schaaren von Kriegern ohne Gnade niedermetzeln, wenn sie auch ihre Waffen von sich geworfen und sich ergeben haben. Ferner sagte ich mir: Wenn auch der Gebrauch, den diese Cannibalen unter einander üben, noch so roh und unmenschlich sei, so gehe das mich doch gar Nichts an, da sie mir ja Nichts gethan hätten. Hätten sie mich überfallen und wäre es zu meiner Selbstvertheidigung nöthig, sie zu überfallen, so ließe sich das rechtfertigen. Aber da ich jetzt nicht in ihrer Gewalt sei und sie nicht einmal von meiner Existenz wüßten, folglich auch keinen Anschlag gegen mich zu machen vermöchten, so könnte ich auch nicht zu einem Ueberfall berechtigt sein. Ich würde mich durch einen solchen auf eine Stufe mit jenen Spaniern gestellt haben, die in ihrer Grausamkeit in Amerika Millionen von Wilden hinmordeten, welche zwar Götzendiener und Barbaren und in ihren Sitten zum Theil blutig und roh waren (wie sie denn z. B. ihren Götzen Menschenopfer brachten), die aber den Spaniern gegenüber doch als ganz unschuldige Leute erschienen. Ueber ihre Ausrottung wird jetzt nur mit größtem Abscheu und heftiger Entrüstung von den Spaniern selbst und von allen andern christlichen Nationen Europa's geurtheilt, als von einer Schlächterei, einer blutigen und unnatürlichen Grausamkeit, die unverantwortlich vor Gott und Menschen ist. Hat doch seitdem der bloße Name jenes Volkes bei allen Leuten von christlichem Mitgefühl einen schrecklichen Klang, und betrachtet man doch das Königreich Spanien als dadurch besonders ausgezeichnet, daß es von einer Menschenrace bewohnt wird, die jenes Mitleidsgefühl entbehrt, welches allgemein für das gewöhnlichste Zeichen einer edlen Gesinnung gilt.
Diese Erwägungen brachten mich zum Einhalt in meinen Vorkehrungen. Nach und nach sah ich das Unrechtmäßige meiner Absichten gegen die Wilden ein und erkannte, daß ich nur dann mich mit denselben befassen dürfe, wenn sie mich zuerst angriffen, und daß dem wo möglich vorzubeugen jetzt meine einzige Aufgabe sei. Zugleich machte ich mir klar, wie ich durch mein früheres Vorhaben, statt mich zu befreien, nur mein eigenes Verderben herbeigeführt haben würde. Denn falls es mir nicht gelang, sämmtliche Wilde, sowohl die, welche das nächste Mal, als auch die, welche jemals später auf die Insel kamen, zu tödten, und sobald nur ein Einziger entrann und seinen Landsleuten berichtete, was geschehen sei, so war es sicher, daß diese zu Tausenden kommen und den Tod ihrer Gefährten rächen würden. Mit Rücksicht auf dies Alles beschloß ich, da es weder vernünftig, noch klug sei, mich in die Angelegenheiten der Wilden zu mischen, nichts Anderes zu thun, als mich in jeder Weise vor diesen verborgen zu halten und ihnen nicht den mindesten Anlaß zu der Vermuthung zu geben, daß irgend ein Wesen in Menschengestalt auf der Insel hause.
Auch meine religiöse Weltanschauung unterstützte diesen Vorsatz der Klugheit, und so war ich auf die mannichfachste Weise davon überzeugt, daß ich nur pflichtmäßig handelte, wenn ich meine blutigen Pläne gegen die unschuldigen Menschen fallen ließe. Unschuldig nämlich in Bezug auf mich. Ihre Verbrechen richteten sie ja nur gegen einander. Es waren Nationalsünden, deren Bestrafung ich der Gerechtigkeit Gottes zu überlassen hatte, welcher die Vergehen der Völker richtet und am besten weiß, wie sie durch Strafen zu rächen und zu sühnen sind. Dies war mir jetzt so klar, daß ich mit größter Genugthuung darüber erfüllt wurde, Nichts von dem ausgeführt zu haben, was ich nun aus vielen Gründen als einen absichtlichen Mord ansah. Ich dankte Gott auf den Knien dafür, daß er mich vor Blutschuld bewahrt hatte. Ich flehete ihn inbrünstig an, mich nicht in die Hände der Wilden fallen und mich nur dann selbst Hand an sie legen zu lassen, wenn ich durch die Nothwendigkeit der Selbstvertheidigung einen entschiedenen Beruf dazu haben würde.
Kapitel 10
In dieser Stimmung verblieb ich fast ein volles Jahr. Ich war jetzt so weit entfernt davon, die Gelegenheit zu einem Ueberfall der unglücklichen Menschen herbeizuwünschen, daß ich während jenes ganzen Zeitraums nicht ein einziges Mal den Hügel erstieg. Ich wollte sie gar nicht ins Gesicht bekommen und überhaupt nicht wissen, ob sie auf der Insel seien, damit sich meine Pläne gegen sie nicht erneuerten und ich nicht durch irgend einen sich darbietenden Vortheil zu einem Angriff gegen sie herausgefordert würde.
Das Einzige, was ich that, war, daß ich das Boot von der anderen Inselseite entfernte und nach dem östlichen Theil brachte. Dort barg ich es in einer kleinen Bucht unter hohen Felsen, wohin, wie ich wußte, die Wilden wegen der Strömung mit ihren Canoes nicht kommen konnten. In meinem Boot führte ich alles dazu Gehörige mit fort, Mast und Segel und das ankerartige Ding, das ich mir, so gut es hatte gehen wollen, angefertigt hatte. Ich nahm dies Alles mit, um nicht das geringste Zeichen des Bewohntseins der Insel zurückzulassen.
Außerdem hielt ich mich, wie erwähnt, eingezogener als je und verließ meine Behausung selten, außer um meine Ziegen zu melken und meine kleine Heerde in den Wald zu treiben. Hier war ich, da er auf der entgegengesetzten Seite der Landungsstelle der Wilden lag, keiner Gefahr ausgesetzt. Soviel nämlich schien gewiß, daß diese bei ihren Besuchen der Insel nicht die Absicht hegten, auf derselben Etwas zu suchen, und daß sie daher sich nicht weit von der Küste zu entfernen pflegten. Sie waren, wie ich nicht bezweifelte, seitdem mich die Furcht behutsamer gemacht, wiederholt auf der Insel gewesen. Mit Entsetzen bedachte ich, in welcher Lage ich mich befunden haben würde, wäre ich bei einer solchen Gelegenheit auf die Cannibalen gestoßen und von ihnen zu einer Zeit entdeckt worden, in der ich einzig mit einer meist nur mit leichtem Schrot geladenen Flinte bewaffnet überall nach Beute herumzustreifen pflegte. Wie groß wäre mein Schrecken gewesen, wenn ich statt jener Fußspur plötzlich einen ganzen Haufen von Wilden gesehen hätte und von ihnen verfolgt worden wäre, wobei ihre Schnelligkeit mir ein Entrinnen gewiß unmöglich gemacht haben würde. Der Gedanke hieran ließ mir zuweilen das Herz erbeben und entmuthigte mich so, daß ich nur mit Mühe wieder Fassung gewann. Ich sagte mir, daß ich, wäre jener Fall eingetreten, völlig widerstandsunfähig und sicherlich nicht im Stande gewesen sein würde, das zu thun, was ich jetzt nach so langer Erwägung und Vorbereitung zu thun vermochte. Das ernstliche Nachdenken über die Sache machte mich geradezu und zuweilen für geraume Zeit melancholisch. Endlich aber lösten sich auch diese Erwägungen stets in Dank gegen die Vorsehung auf, die mich vor so vielen ungeahnten Gefahren errettet und mich vor einem Unheil bewahrt hatte, das ich selbst von mir abzuwenden schon deshalb nicht im Stande gewesen war, weil ich das Uebel weder geahnt, noch für möglich gehalten hatte.
Hierdurch wurde eine Betrachtung in mir wieder erweckt, die ich schon früher oft angestellt hatte, seitdem ich angefangen, die gnadenreichen Fügungen des Himmels in den Gefahren dieses Lebens zu erkennen. Wie wunderbar werden wir doch vielmals, ohne daß wir es wissen, vor Unheil bewahrt. Wenn wir uns in Unentschlossenheit befinden, wenn wir zweifeln und zögern, ob wir diesen oder jenen Weg einzuschlagen haben, dann leitet uns oft ein heimlicher Wink auf den einen Weg, während wir den anderen zu wählen beabsichtigt hatten. Ja, wenn Neigung oder ein Geschäftsanlaß uns dorthin zu gehen auffordern, so zwingt uns doch nicht selten eine eigentümliche Empfindung, deren Ursprung wir nicht kennen, mit unwiderstehlicher Macht zurück in die andere Bahn, und später erst wird es offenbar, daß wir, wären wir den selbsterwählten Weg gegangen, in unser Verderben gerannt sein würden. Auf diese und manche ähnliche Betrachtung baute ich später den Grundsatz, überall, wo ich solche geheime Winke und Hinweisungen, dieses oder jenes zu thun oder zu lassen, diesen oder jenen Weg einzuschlagen, empfand, der inneren Stimme zu folgen, wenn ich auch keinen andern Grund dafür hatte als eben nur jene geheime Empfindung. Ich könnte viele Beispiele aus meinem Leben anführen, in denen sich dieses Verfahren bewährte, und zwar besonders aus der späteren Zeit meines Aufenthalts auf der unglücklichen Insel. Denn bei vielen früheren Gelegenheiten hatte ich nicht darauf geachtet, weil ich damals noch die Dinge mit anderen Augen ansah als später. Aber es ist nie zu spät, um klug zu werden, und ich kann nur Jedermann rathen, mag er auch nicht so wunderbare Schicksale erleben wie ich, solche heimliche Winke der Vorsehung nicht zu verachten, wie unerklärlich sie auch immer sein mögen. Ueber ihren Ursprung will ich nicht streiten, auch kann ich davon keine Rechenschaft geben, aber gewiß sind sie doch ein Beweis des Verkehrs der Geister und eines geheimen Zusammenhanges zwischen denen, die noch im Körper wohnen, und den körperlosen, und zwar ein ganz unumstößlicher Beleg, wovon ich Gelegenheit haben werde, einige sehr merkwürdige Proben anzuführen, wenn ich von dem ferneren Verlauf meines einsamen Aufenthalts an diesem trübseligen Orte Bericht erstatte.
Der Leser wird sich schwerlich darüber wundern, daß die Sorgen, die fortwährende Gefahr, in der ich schwebte, und die Angst, die auf mir lastete, allen meinen Erfindungen und allen Plänen, die ich in Betreff meiner künftigen Annehmlichkeit und Bequemlichkeit ersonnen hatte, ein Ende machten. Der Gedanke an meine Sicherstellung beschäftigte mich jetzt mehr als die Sorge für meinen Unterhalt. Ich wagte nicht auch nur einen Nagel einzuschlagen oder ein Stück Holz zu spalten, aus Furcht, der Lärm, den es verursachte, könnte gehört werden. Noch viel weniger hätte ich mich erkühnt, eine Flinte abzufeuern. Mehr als alles Andere aber scheute ich, Feuer anzuzünden, aus Besorgniß, der Rauch, der bei Tage in weiter Ferne sichtbar war, könne mich verrathen. Aus diesem Grunde verlegte ich alle diejenigen Geschäfte, die Feuer erforderten, z. B. das Brennen der Töpfe und Pfeifen u. s. w., nach meiner neuen Wohnung im Walde, wo ich nach einigem Suchen zu meiner großen Beruhigung eine natürliche Höhle in der Erde entdeckte, die ziemlich tief war und in die sich sicherlich kein Wilder hinein gewagt haben würde.
Auf die Oeffnung dieser Höhle stieß ich am Fuße eines großen Felsens, als ich (ich würde sagen zufällig, wenn ich nicht hinlängliche Ursache hätte, alle solche Dinge jetzt der Vorsehung zuzuschreiben) einige dicke Aeste von den Bäumen hieb, um sie zu Kohlen zu brennen. Dies geschah in folgender Absicht: Ich fürchtete mich, wie gesagt, Rauch in der Nähe meiner Ansiedelung zu verursachen, und doch konnte ich nicht umhin, Brod zu backen, Fleisch zu kochen und dergleichen mehr. Darum verbrannte ich hier unter dem Rasen, wie ich es in England gesehen hatte, einiges Holz zu Kohlen und trug diese, nachdem ich das Feuer ausgelöscht, nach Hause, um alle die anderen Dienste, zu denen ich Feuer nöthig hatte, daselbst ohne Gefahr des Rauches verrichten zu können. Als ich nun einst wieder mit Holzhauen beschäftigt war, bemerkte ich hinter einem dichten Gesträuch eine Vertiefung. Ich wollte sehen, was darin sei, und als ich mühsam in die Oeffnung gelangt war, fand ich eine ziemlich große Höhle, hoch genug, daß ich und allenfalls neben mir noch ein Mann aufrecht darin stehen konnte. Jedoch kam ich schneller aus derselben, als ich hineingekommen war. Ich sah nämlich plötzlich, als ich tiefer in den dunkeln Raum hineinblickte, zwei hellglänzende Augen, über die ich im Zweifel war, ob sie einem Menschen oder dem Teufel selbst zugehörten. Sie blitzten wie zwei Sterne, indem sie den Lichtschimmer, der durch die Mündung der Höhle fiel, direkt zurückwarfen. Nach einer kleinen Weile erholte ich mich, schalt mich einen Narren und hielt mir vor, daß man sich vor dem Anblick des Teufels nicht fürchten dürfe, wenn man einsam zwanzig Jahre hindurch auf einer öden Insel zugebracht habe, und daß ich mir nicht einzubilden brauche, es sei in der Höhle etwas Fürchterlicheres als meine eigene Person. Hierauf nahm ich allen meinen Muth zusammen, ergriff ein brennendes Stück Holz und stürzte mich nochmals in die Vertiefung. Kaum aber hatte ich drei Schritte vorwärts gethan, als ich auch schon von Neuem, fast ebenso sehr wie vorhin, erschreckt wurde. Ich hörte nämlich einen lauten Seufzer wie von einem schmerzgequälten Menschen. Diesem Laute folgte ein unzusammenhängendes Geräusch, welches wie halb ausgesprochen Worte klang, und dann abermals ein tiefer Seufzer. Ich trat zurück und war dermaßen entsetzt, daß mich ein kalter Schweiß überlief. Hätte ich einen Hut auf dem Kopfe gehabt, so will ich nicht dafür stehen, daß ihn nicht mein zu Berge stehendes Haar abgeworfen hätte. Aber dennoch sammelte ich noch einmal meinen ganzen Muth und tröstete mich mit der Ueberzeugung, daß Gottes Macht überall gegenwärtig sei und mich beschützen könne. In diesem Gedanken ging ich abermals vorwärts und erblickte jetzt beim Scheine der Fackel, die ich hoch über meinem Kopfe hielt, einen ungeheuern, gräulichen alten Bock auf dem Boden der Höhle liegen. Er war, wie man zu sagen pflegt, just dabei, sein Testament zu machen und schnappte nach Luft, als ob er vor bloßer Altersschwäche sterbe. Ich stieß ihn ein wenig an, um zu sehen, ob ich ihn herausziehen könne, und er versuchte auch aufzustehen, hatte aber nicht mehr Kraft genug dazu. Meinetwegen, dacht' ich, bleib liegen, wo du bist. Denn ich sagte mir, wie er mich erschreckt habe, könne er auch einen Wilden erschrecken, wenn je einer von denen so kühn sein sollte, hier hinein zu kommen, so lange noch Leben in ihm wäre.
Nachdem ich meinen Schreck überwunden hatte, fing ich an mich umzuschauen. Jetzt sah ich, daß die Höhle, die mir vorher so groß erschienen, nur sehr klein war. Sie mochte ungefähr zwölf Fuß in der Tiefe messen und war von unregelmäßiger Form, weder rund, noch viereckig. Man sah, daß sie die Natur allein zum Baumeister gehabt hatte. Dagegen bemerkte ich, daß die Höhlung sich noch weiter nach Innen erstreckte, jedoch in so niedriger Höhe, daß ich auf allen Vieren hätte hineinkriechen müssen. Da ich nicht wußte, wohin ich gelangen würde, und da ich auch kein Licht bei mir hatte, beschloß ich, den andern Tag mit Lichtern und einem Feuerzeug, welches letztere ich mir aus dem Schloß eines Gewehres gemacht hatte, sowie mit einer Pfanne voll glühender Kohlen wieder zu kommen. Wirklich kehrte ich am folgenden Tage, ausgerüstet mit sechs langen Talglichtern aus meiner eigenen Fabrik (ich verfertigte nämlich sehr schöne aus Ziegenfett), zurück und kroch auf allen Vieren in jenem niedrigen Loche etwa zehn Schritte weit, welche Handlung mir als eine kühne That erschien, da ich nicht wußte, wie weit und wohin ich gelangen würde. Als ich durch den Engweg hindurch war, fand ich eine ungefähr zwanzig Fuß hohe Wölbung und hier bot sich mir ein so herrlicher Anblick, wie ich ihn nie zuvor auf der Insel gehabt hatte. Die Seitenwände und die Decke dieser Höhlung strahlten das Licht meiner beiden Kerzen hunderttausendfältig wieder. Was in dem Felsen war, ob Diamanten oder andere Edelsteine oder Gold, was ich beinahe vermuthete, weiß ich nicht. Der Raum, in dem ich mich befand, bildete die schönste Grotte, die man sich denken kann, obgleich er an sich völlig dunkel war. Der Boden war trocken und eben und mit einer Art von seinem losen Kies bestreut. Kein ekelhaftes oder giftiges Gethier ließ sich hier sehen, auch waren die Wände nicht im mindesten feucht. Der einzige Uebelstand bestand in der Engigkeit des Einganges, doch hielt ich das eher für einen Vorzug, da ja diese Höhle ein sicheres Versteck und einen Zufluchtsort für mich abgeben sollte.
Hoch erfreut über meine Entdeckung beschloß ich, unverzüglich einige der Gegenstände, an deren Erhaltung mir am meisten gelegen war, hierher zu transportiren. Vor Allem mein Pulvermagazin und meinen Vorrath an Waffen: zwei Vogelflinten, deren ich im Ganzen drei hatte, und die Musketen, von denen ich acht besaß. Fünf behielt ich in meiner Festung, wo sie an dem Außenwalle schußfertig wie Kanonen aufgestellt und zu gleicher Zeit bereit waren, auf einer Expedition sofort mitgenommen zu werden. Bei Gelegenheit des Transportes meiner Munition öffnete ich zufällig das Pulverfaß, das ich aus dem Meere, wo es Wasser gezogen, aufgefischt hatte. Da ergab sich nun, daß das Wasser etwa zwei bis drei Zoll tief auf jeder Seite in das Pulver eingedrungen war und dasselbe so zusammengeklebt und verhärtet hatte, daß das in der Mitte befindliche ganz wohl erhalten war, wie der Kern in einer Nußschaale. Ich fand in dem Fasse nahe an sechzig Pfund sehr guten Pulvers vor, was mir zu dieser Zeit eine sehr angenehme Ueberraschung war. So brachte ich denn alles in jene Grotte, und behielt nie mehr als zwei bis drei Pfund Pulver in meiner Wohnung, aus Angst vor einem Ueberfall irgend einer Art. Auch alles Kugelblei, was ich noch besaß, barg ich dort. Ich kam mir jetzt vor wie einer jener alten Riesen, die in unzugänglichen Höhlen und Felslöchern wohnten.»Wenn mich nun«, so redete ich mir ein,»die Wilden, und wären es ihrer fünfhundert, verfolgen, so wird es ihnen nicht gelingen, mich aufzufinden, oder wenn auch das geschieht, werden sie doch nicht wagen, mich hier anzugreifen. «Der alte Bock, den ich im Todeskampfe angetroffen hatte, starb schon den Tag, nachdem ich ihn entdeckt, in dem Vorderraum der Höhle. Da ich es leichter fand, ihn in ein dort gegrabenes großes Loch zu werfen und mit Erde zu bedecken, als ihn hinaus zu schleifen, begrub ich ihn daselbst, damit meine Nase nichts davon zu leiden habe.
Mein Aufenthalt auf der Insel ging jetzt bereits ins dreiundzwanzigste Jahr. Ich war auf ihr so eingebürgert und an meine Lebensweise so gewöhnt, daß ich, wenn ich nur mit einiger Sicherheit hätte annehmen dürfen, daß keine Wilden kommen und mich beunruhigen würden, ganz zufrieden gewesen wäre, den Rest meiner Tage bis zu dem Augenblick, wo ich mich zum Sterben niederlegen würde, wie der alte Ziegenbock in der Höhle hier zu verbringen. Sogar einige kleine Zerstreuungen und Vergnügungen waren mir jetzt geboten, die mir die Zeit viel angenehmer verstreichen ließen als früher. Erstens nämlich hatte ich meinen Pol, wie erwähnt, sprechen gelehrt und er war so vertraulich mit mir und sprach manche Worte so deutlich und klar, daß ich große Freude darüber hatte. Nicht weniger als sechsundzwanzig Jahre hat er mit mir zusammen gelebt; wie lange er dann noch nachher existirt haben mag, weiß ich nicht. Doch behauptet man, wie ich mich erinnere, in Brasilien, dergleichen Thiere lebten hundert Jahre; vielleicht ist denn auch der arme Pol noch am Leben und ruft bis auf den heutigen Tag noch nach dem armen Robinson Crusoe. Auch mein Hund war mir sechzehn volle Jahre hindurch ein sehr treuer und ergebener Gefährte, dann starb er an Altersschwäche. Was meine Katzen betrifft, so vermehrten sie sich, wie ich bereits erzählt, in dem Grade, daß ich mich genöthigt sah, eine Anzahl todt zu schießen, damit sie nicht mich sammt aller meiner Habe auffräßen. Mit der Zeit, als die beiden alten, die ich mitgebracht hatte, gestorben waren, und ich die andern immer von mir gejagt und ihnen kein Futter gegeben hatte, liefen sie zuletzt alle wild im Walde umher bis auf zwei oder drei besondere Lieblinge von mir, die ich zahm erhielt, deren Junge ich aber, so oft sie welche hatten, ertränkte. Jene gehörten dann ebenfalls zu meiner Familie. Außerdem hielt ich mir immer einige zahme Ziegenlämmer im Hause, die mir aus der Hand fraßen. Ferner besaß ich noch zwei andere Papageien. Auch diese sprachen ganz gut und konnten beide den Namen Crusoe rufen, wenn auch nicht so deutlich wie mein erster, da ich mir mit keinem von ihnen so viel Mühe gegeben hatte als mit jenem. Sodann waren einige zahme, dem Namen nach mir unbekannte Seevögel um mich, die ich an der Küste gefangen und denen ich die Flügel beschnitten hatte. Seit die jungen Reiser, die ich vor meiner Wohnung angepflanzt hatte, zu einem hübschen dichten Baumgarten herangewachsen waren, richteten sich diese Vögel unter den niedrigen Bäumen häuslich ein und brüteten dort, was sehr angenehm war.
So hätte ich denn mit meinem damaligen Leben sehr zufrieden sein können, wenn nur nicht die Furcht vor den Wilden gewesen wäre. Aber das Geschick hatte mit diesen gerade für mich seine besondere Absicht. Jeder, dem meine Geschichte in die Hände fällt, mag sich folgende sehr wichtige Lehre merken: Oftmals in unserm Lebenslauf wird gerade das Uebel, welches wir am meisten zu vermeiden streben und das, wenn es uns befallen hat, uns am allerunerträglichsten erscheint, gerade das Mittel und die Pforte unserer Befreiung, durch welche allein wir wieder aus dem Kummer erlöst werden können, in den wir gerathen sind. Ich könnte davon viele Beispiele anführen aus meinem wunderbaren Lebenslaufe, aber nirgends war es auffallender, als während der letzten Jahre meines einsamen Aufenthaltes auf der Insel.
Es war im Monat Dezember im dreiundzwanzigsten Jahre des letzteren. Um diese Jahreszeit, während der südlichen Sonnenwende (Winter kann ich sie nicht nennen), pflegte ich meine Ernte einzubringen und war deshalb mehr als sonst draußen auf dem Felde beschäftigt. Als ich nun eines Tages früh am Morgen, ehe es noch ganz hell geworden, ausging, sah ich zu meiner größten Ueberraschung einen Feuerschein auf dem Strande. Derselbe leuchtete etwa zwei Meilen entfernt aus der Gegend, wo ich schon früher die Spuren der Wilden bemerkt hatte, aber nicht wie damals auf der andern Seite der Insel, sondern zu meiner großen Bestürzung auf der, wo ich wohnte.
Sehr überrascht und geängstigt durch diesen Anblick, wagte ich nicht, aus meinen Anlagen hinauszugehen, aus Furcht, angefallen zu werden. Aber auch hier fand ich keine Ruhe. Ich quälte mich mit dem Gedanken, die Wilden würden die Insel durchstreifen, mein Korn, das theils noch auf dem Halm, theils schon geschnitten auf dem Felde stand, oder irgend etwas Anderes von meinen Einrichtungen und Verbesserungen finden und sofort daraus schließen, daß sich Jemand hier aufhalten müsse. Es war klar, daß sie in diesem Fall nicht eher nachgelassen hätten, bis sie mich aufgefunden haben würden. In verzweifelter Stimmung eilte ich zu meiner Behausung, zog die Leiter hinter mir ein und gab dem Außenwerk meiner Behausung ein so wildes und natürliches Aussehen, wie ich irgend konnte.
Sodann traf ich im Innern meine Vorbereitungen, um mich in Vertheidigungszustand zu setzen. Zunächst lud ich alle meine Kanonen, wie ich sie nannte, das heißt die Musketen, die auf meinem neuen Walle aufgestellt waren, sowie sämmtliche Pistolen. Ich war entschlossen, mich bis auf den letzten Athemzug zu wehren. Auch vergaß ich nicht, mich ernstlich dem göttlichen Schutze zu befehlen und Gott inbrünstig zu bitten, daß er mich aus den Händen dieser Barbaren erretten möge. Nachdem ich mich ungefähr zwei Stunden ruhig verhalten, fing ich an, sehr ungeduldig und begierig nach Nachrichten vom Feinde zu werden, denn leider hatte ich keine Kundschafter auszuschicken. Ich wartete noch eine Weile und sann darüber nach, was ich beginnen sollte, dann aber konnte ich die Ungewißheit nicht länger ertragen. Ich legte meine Leiter an den Abhang an, wo der Absatz war, den ich früher beschrieben habe, zog sie hinter mir wieder auf, legte sie nochmals an und erstieg so den Gipfel des Hügels. Hier zog ich mein Fernglas hervor, legte mich platt auf den Bauch und richtete meinen Blick nach der Stelle, an der ich das Feuer gesehen hatte. Bald erblickte ich denn auch nicht weniger als neun nackte Wilde um ein kleines Feuer gelagert. Das letztere konnten sie nicht angezündet haben, um sich zu wärmen, da das Wetter fürchterlich heiß war, vielmehr sollte es vermuthlich dazu dienen, um eines ihrer barbarischen Gerichte von Menschenfleisch, welches sie entweder lebend oder todt mitgebracht hatten, daran zu braten.
Die Fremdlinge führten zwei Boote bei sich, die sie auf den Strand gezogen hatten. Es war gerade die Zeit der Ebbe, und mir kam es so vor, als erwarteten jene nur die rückkehrende Flut, um wieder abzufahren. Man kann sich schwerlich vorstellen, in welche Bestürzung mich der Anblick dieser Gäste versetzte. Besonders überraschte mich der Umstand, daß die Wilden auf meiner Seite der Insel und überdies ganz in meine Nähe gekommen waren. Als ich mich aber überzeugte, daß ihr Kommen immer nur mit der Ebbe geschehen konnte, fing ich wieder an mich einigermaßen zu beruhigen, da ich einsah, daß ich zur Zeit der Flut stets mit vollkommener Sicherheit ausgehen dürfte, wenn sie nicht schon vorher auf der Insel waren. In dieser Gewißheit bin ich später auch ganz gelassen an meine Erntearbeiten gegangen.
Wie ich erwartet hatte, so geschah es. Sobald die Flut von Westen her eintrat, sah ich, wie sich die Wilden sämmtlich einschifften und hinwegruderten. Ich muß noch bemerken, daß sie etwa eine Stunde vor ihrem Aufbruch angefangen hatten zu tanzen. Obgleich ich aber durch mein Glas deutlich ihre Stellungen und Bewegungen beobachten konnte, vermochte ich doch trotz der schärfsten Aufmerksamkeit nicht zu erkennen (Kleider trugen sie nicht, waren vielmehr völlig nackt), ob es Männer oder Frauen seien.
Sobald ich sie in den Booten und unterwegs wußte, nahm ich zwei Flinten auf die Schultern, steckte zwei Pistolen in den Gürtel, hing mein großes Schwert ohne Scheide an mich und eilte, so schnell ich konnte, nach dem Hügel, von wo aus ich die ersten Spuren der Gäste entdeckt hatte. Dort angekommen, was erst nach zwei Stunden geschah, da ich, mit Waffen schwer beladen, nicht schnell zu laufen vermochte, machte ich die Entdeckung, daß noch weitere drei Canoes mit Wilden da gewesen waren, und gleich darauf erblickte ich sie auch alle zusammen auf der See, nach dem Festland zusteuernd. Der schrecklichste Anblick für mich war aber, als ich beim Hinabsteigen nach der Küste die entsetzlichen Spuren der Greuel fand, die sie dort ausgeführt hatten: Blut, Knochen und Fleischreste menschlicher Körper, die von diesen Elenden unter Tanz und Scherzen zerrissen und verzehrt waren. Ich fühlte mich dermaßen empört über den Anblick, daß ich mir ernstlich vornahm, die nächsten, die ich dort antreffen würde, nieder zu machen, wer und wie viele es auch seien.
Offenbar waren die Besuche, welche die Wilden der Insel in dieser Weise abstatteten, nur selten. Es vergingen über fünfzehn Monate, ehe wieder einige landeten. Wenigstens sah ich in der Zwischenzeit keinen der Cannibalen, auch nicht Fußtritte, noch irgend welche andere Spuren von ihnen. Während der Regenzeit schienen sie sich schon ohnehin nicht, wenigstens nicht weit, auf das Meer zu wagen. Dennoch brachte ich diese ganze Zeit in einem unbehaglichen Zustaude zu, weil ich in der beständigen Furcht schwebte, daß sie mich einmal unerwartet überfallen könnten. Es ergibt sich hieraus aufs Neue, daß die Erwartung des Uebels schlimmer ist als das Leiden selbst, zumal da man diese Erwartung oder Befürchtung auf keine Weise los werden kann.
Inzwischen war ich fortwährend von Mordlust erfüllt. Ich verbrachte meine Stunden, die ich besser hätte anwenden sollen, meistenteils damit, Pläne zu schmieden, wie ich die Wilden beschleichen und überfallen wollte, sobald sie sich wieder blicken lassen würden. Besonders hoffte ich, werde mir das gelingen, wenn sie wieder, wie das letzte Mal, in zwei Haufen getheilt wären. Dabei bedachte ich nicht, daß ich, wenn ich auch eine Abtheilung von vielleicht zehn oder zwölf getödtet hätte, früher oder später wieder eine und dann noch eine und sofort bis ins Unendliche würde haben tödten müssen, bis ich endlich kein geringerer, ja eigentlich ein weit schlimmerer Mörder gewesen wäre als diese Menschenfresser selbst.
Ich verlebte jetzt meine Tage in großer Angst und Gemüthsunruhe, immer darauf gefaßt, jenen unbarmherzigen Menschen in die Hände zu fallen. Wenn ich mich ja einmal hinauswagte, so geschah es nicht, ohne daß ich mich fortwährend mit der größten Angst und Vorsicht umsah. Nun erst lernte ich das Gut recht schätzen, welches ich in der zahmen Ziegenheerde besaß. Denn ich getraute mich unter keiner Bedingung, meine Flinte abzuschießen, besonders auf der Seite der Insel, wo die Wilden gewöhnlich landeten, um diese nur ja nicht zu alarmiren. So viel sah ich nämlich sicher voraus, daß sie, wenn sie auch anfangs vor mir die Flucht ergriffen, doch mit Hunderten von Fahrzeugen in wenigen Tagen wiederkommen würden, in welchem Falle das Schicksal, das mich erwartete, unschwer voraus zu wissen war.
Indessen vergingen wieder ein Jahr und drei Monate, ohne daß ich irgend etwas von den Wilden zu sehen bekam. Dann erst stieß ich abermals auf sie, wie ich sogleich berichten werde. Gewiß mochten sie auch in der Zwischenzeit einige Male dagewesen sein, aber entweder hatten sie sich nicht aufgehalten, oder sie waren wenigstens von mir unbemerkt geblieben. Endlich aber ereignete sich, und zwar, wenn ich richtig gerechnet habe, im Monat Mai des vierundzwanzigsten Jahres meines Inselaufenthaltes ein sehr merkwürdiges Zusammentreffen mit ihnen.
Die Aufregung meines Gemüths während des vorhergehenden Zeitraums von fünfzehn bis sechzehn Monaten war groß. Ich schlief unruhig, hatte immer schlechte Träume und fuhr oft in der Nacht aus dem Schlafe auf. Bei Tage drückte mich schwerer Kummer, und des Nachts träumte ich oft davon, wie ich die Wilden tödten und womit ich diese That rechtfertigen wollte. Es war um die Mitte des Mai, ich glaube am sechzehnten, so weit ich den Tag nach meinem dürftigen hölzernen Kalender bestimmen kann (denn ich machte noch immer die Zeichen an dem Pfahle). Den ganzen Tag hatte ein heftiger Sturmwind gewüthet, verbunden mit häufigem Blitz und Donner, und darauf war eine wüste Nacht gefolgt. Ich weiß nicht mehr genau alle einzelnen Umstände, aber gewiß ist, daß mich, während ich gerade in der Bibel las und in sehr ernsthafte Gedanken über meine gegenwärtige Lage vertieft war, plötzlich der Knall eines Flintenschusses, der mir von der See her zu kommen schien, erschreckte. Dies war nun eine ganz andere Art von Ueberraschung als alle die mir früher zu Theil gewordenen, und die Sorgen, die mich jetzt erfüllten, unterschieden sich daher auch sehr von meinen früheren. In der größten Eile sprang ich auf, stellte meine Leiter schleunigst an die Mitte des Felsens, zog sie, auf dem Felsvorsprung angekommen, mir nach und erstieg sie zum zweiten Male. Ich erreichte den Gipfel gerade in dem Augenblick, als ein feuriges Aufblitzen mich auf einen zweiten Schuß horchen hieß, den ich dann auch nach ungefähr einer halben Minute hörte. Aus dem Schalle konnte ich schließen, daß er von dorther komme, wo ich einst in meinem Boote von der Strömung fortgerissen worden war. Ich vermuthete alsbald, daß hier ein Schiff in Noth sein müsse und daß sich ein anderes Schiff in der Nähe befände, nach welchem diese Nothschüsse, um von ihm Hülfe zu erlangen, abgefeuert würden.
Ich hatte Geistesgegenwart genug, sofort daran zu denken, daß, wenn auch ich den bedrängten Leuten nicht helfen könnte, doch sie mich vielleicht zu erretten vermöchten. Darum trug ich so viel dürres Holz, als ich bei der Hand hatte, zusammen und steckte es, nachdem ich einen guten Haufen aufgethürmt, in Brand. Das Holz war trocken und flammte deshalb hell auf, brannte auch trotz des heftigen Windes ganz nieder. Ich zweifelte nun nicht, daß, wenn wirklich ein Schiff in der Nähe sei, die Leute an Bord das Feuer gesehen haben müßten. Dies war denn auch der Fall gewesen. Denn sobald die Flamme aufloderte, hörte ich wieder einen Schuß und dann noch mehre, alle aus derselben Richtung. Ich unterhielt das Feuer die ganze Nacht hindurch bis zum Tagesanbruch. Als es ganz hell geworden war und der Himmel sich aufgeheitert hatte, sah ich in weiter Ferne einen Gegenstand auf der See, gerade östlich von der Insel, konnte aber selbst mit Hülfe des Fernglases nicht unterscheiden, ob es ein Segel oder der Rumpf eines Schiffes sei, denn die Entfernung war zu groß und die Luft über dem Wasser noch immer etwas dunstig.
Den ganzen Tag über schaute ich vielmals nach jenem Ding aus. Ich bemerkte bald, daß es sich nicht bewegte, und schloß daraus, daß es ein vor Anker liegendes Schiff sei. Da ich begreiflicher Weise begierig war, darüber ins Klare zu kommen, ergriff ich meine Flinte und lief nach der Südseite der Insel zu dem Felsen, wo ich einst von der Strömung entführt worden war. Von dort aus konnte ich, da das Wetter jetzt ganz klar geworden, zu meinem großen Kummer ganz deutlich das Wrack eines Schiffes erkennen, welches in der Nacht auf den verborgenen Klippen, die ich damals mit meinem Boote entdeckt hatte, gestrandet war. Dieselben Klippen waren früher, indem sie die Gewalt der Strömung gebrochen und eine Art von Gegenstrom hervorgebracht hatten, das Mittel zu meiner Rettung aus der verzweifeltsten, hoffnungslosesten Lage, in der ich mich in meinem ganzen Leben befunden, geworden. So wird oftmals das, was dem Einen zum Heile dient, dem Anderen zum Verderben. Wie es schien, waren die Leute in jenem Schiffe, wer sie auch sein mochten, in diesen Gewässern unbekannt und deshalb in der Nacht von dem starken, aus Ost und Ostnordost wehenden Winde auf die gänzlich unter Wasser liegenden Klippen getrieben worden. Hätten sie die Insel gesehen, was wahrscheinlich nicht der Fall war, so würden sie, das nahm ich wenigstens an, versucht haben, sich mit Hülfe ihres Bootes an die Küste zu retten. Ihre Nothschüsse aber, besonders seit sie, wie ich vermuthete, mein Feuer gesehen hatten, gaben mir mancherlei zu denken. Anfangs glaubte ich, die Leute seien, als sie mein Licht erblickten, in ihr Boot gestiegen und auf die Insel zugesteuert, aber durch die sehr hochgehende See verschlagen worden. Dann sagte ich mir wieder, sie könnten ja auch ihr Boot schon früher eingebüßt haben, wie das auf mancherlei Weise möglich war, z. B. durch die über das Schiff schlagenden Sturzwellen, die es für die Seefahrer oft nöthig machten, das Boot zu zerhauen oder auseinander zu nehmen, oder es gar eigenhändig über Bord zu werfen. Zuweilen vermuthete ich wieder, sie hätten vielleicht ein anderes Schiff oder mehre in ihrer Begleitung gehabt, von denen sie auf ihre Nothsignale aufgenommen und mit fortgeführt seien. Dann einmal stellte ich mir vor, sie seien alle in ihrem Boote in See gegangen und von der Strömung, in der ich mich einst befunden hatte, in die offene See hinausgerissen worden; wo denn ein elender Untergang für sie unvermeidlich sein mußte. Vielleicht, redete ich mir ein, sind sie gerade jetzt dem Verschmachten nahe und hungrig genug, um sich unter einander aufzufressen.
Dies Alles aber waren nicht mehr als bloße Vermuthungen. Ich konnte in meiner Lage nichts Anderes thun, als das Elend der armen Leute beklagen und sie bemitleiden. Dies übte wenigstens die gute Wirkung auf mich, daß ich mich immer mehr zur Dankbarkeit gegen Gott veranlaßt fühlte, der mich so überschwänglich reich in meiner traurigen Lebenslage versorgt und der von der Mannschaft zweier Schiffe, die nun schon an diesen Küsten verunglückt waren, nur allein mein Leben gerettet hatte. Ich machte hier aufs Neue die Beobachtung, daß die göttliche Vorsehung uns sehr selten in eine so unglückliche Lage oder in so großes Elend bringt, daß wir nicht immer noch für eins oder das andere erkenntlich sein und auf Andere blicken können, denen es noch schlechter ergeht als uns. Dies Letztere war wohl unzweifelhaft der Fall mit jenen armen Leuten. Ich mußte annehmen, auch kein einziger von ihnen sei gerettet worden. Denn wie hätte das geschehen sollen, wenn nicht gerade ein anderes Schiff in der Nähe war, welches sie an Bord nahm; das aber dünkte mich sehr unwahrscheinlich, da ich nicht die geringste Spur eines weiteren Fahrzeugs bemerkt hatte.
Ich habe keine Worte, um die leidenschaftliche Sehnsucht auszudrücken, die sich trotz Allem meiner Seele beim Gedanken, daß mir die Erlösung vielleicht nahe gewesen, bemächtigte.»Ach«, so rief ich zuweilen aus,»daß doch nur ein Paar Seelen, oder wenigstens eine einzige aus dem Schiffe gerettet wäre und bei mir Zuflucht gesucht hätte; daß ich einen Gefährten, einen Mitmenschen hätte, der mit mir sprechen und mit mir fühlen könnte!«In der ganzen Zeit meines einsamen Lebens hatte ich nie so heiß und so sehnsüchtig nach menschlicher Gesellschaft verlangt und den Mangel daran nie so schmerzlich empfunden als gerade damals.
Es gibt in den menschlichen Neigungen und Wünschen geheime Triebfedern, die, wenn sie durch irgend ein erreichbares Ziel, oder sei es auch ein unerreichbares, welches dem Geiste nur durch die Einbildungskraft vorgezaubert ist, in Bewegung gesetzt sind, die Seele zu einem solchen ungestümen und begierigen Verlangen anregen, daß die Entbehrung des Ersehnten geradezu unerträglich erscheint. So ging es mir mit jenem Wunsche, daß nur ein einziger Mensch gerettet sein möchte!» Ach, wäre es auch nur Einer!«Ich wiederholte, glaube ich, diese Worte wohl tausendmal, und so ergriffen war ich von meinem Verlangen, daß ich die Hände bei jenen Worten zusammendrückend meine Finger mit solcher Gewalt gegen die innere Handfläche preßte, daß ich, hätte ich irgend einen weichen Gegenstand in der Hand gehalten, ihn unwillkürlich zerquetscht haben würde. Dabei biß ich die Zähne aneinander, daß sie knirschten und ich sie nicht sogleich wieder auseinander bringen konnte. Ich überlasse es den Gelehrten, diese Erscheinungen zu erklären und in ihren Ursachen und Wirkungen darzustellen, und beschränke mich darauf, die einfache Thatsache zu berichten. Sie setzte mich selbst in Erstaunen, als ich sie an mir erfuhr, ohne zu wissen, woher sie rührte. Ohne Zweifel war es die Wirkung meiner heißen Wünsche und der lebhaften Vorstellung, die ich mir von dem Glücke gemacht hatte, wieder einmal mit einem christlichen Glaubensgenossen zu verkehren. Aber es sollte nicht sein, das Schicksal jener Leute oder das meinige, oder unser beider, gestattete es nicht. Bis zum letzten Jahre meines Aufenthaltes auf der Insel erfuhr ich nicht einmal, ob Jemand aus dem Schiffe gerettet sei oder nicht, sondern erlebte nur den Kummer, daß ich nach einigen Tagen den Leichnam eines ertrunkenen Knaben fand, der auf der Seite der Insel, in deren Nähe der Schiffbruch Statt gefunden, auf den Strand gespült war. Die Leiche war bekleidet mit einer Matrosenjacke, einem Paar kurzen leinenen Hosen und einem blauen leinenen Hemde. Nichts aber gab mir auch nur eine Andeutung, welcher Nation der Verunglückte angehörte. In seinen Taschen hatte er nichts weiter als zwei Piaster und eine Tabakspfeife, welche letztere mir zehnmal so viel werth war als das Geld.
Da das Wetter ganz windstill war, hatte ich große Lust, mich in meinem Boote nach dem Wrack hinauszuwagen. Gewiß konnte ich daselbst noch einen oder den anderen Gegenstand, der mir nützlich war, finden. Doch das war es nicht, was mich so sehr zu der Unternehmung antrieb. Vielmehr war es die Möglichkeit, daß doch noch ein lebendes Wesen an Bord sein könne, dem ich nicht nur das Leben zu retten, sondern durch dessen Rettung ich mir selbst das Leben unendlich viel angenehmer zu machen vermöchte. Dieser Gedanke lag mir so sehr am Herzen, daß ich Tag und Nacht keine Ruhe fand, bis ich zu dem festen Entschluß gekommen war, die Fahrt zu unternehmen. Indem ich alles Uebrige in Gottes Hand legte, tröstete ich mich mit dem Glauben, ein so heftiger innerer Antrieb müsse von einer unsichtbaren Leitung ausgehen und dürfe nicht unterdrückt werden, und es würde unrecht sein, wenn ich die Fahrt nicht unternehmen wollte.
In dieser Gemüthsstimmung eilte ich nach meiner Behausung zurück und traf die Vorbereitungen zu der Reise. Ich nahm einen kleinen Vorrath an Brod, einen großen Topf mit Trinkwasser, einen Kompaß, eine Flasche Rum (denn davon hatte ich immer noch eine ziemlich große Menge) und einen Korb voll Rosinen und trug alle diese Dinge nach meinem Boote. Dann schöpfte ich das Wasser aus dem letzteren, machte es flott, packte die Sachen hinein und ging nach Haus, um noch Anderes zu holen. Meine zweite Ladung bestand aus einem großen Sack mit Reis, dem Sonnenschirm, den ich als Zelt benutzen wollte, einem weiteren Gefäß mit Trinkwasser und ungefähr zwei Dutzend meiner kleinen Brödchen oder Gerstenkuchen. Außerdem nahm ich noch eine Flasche Ziegenmilch und einen Käse mit. Alles dieses schaffte ich mit vieler Mühe, im Schweiße meines Angesichts, nach dem Boote, bat Gott um seinen Segen für die Fahrt und stieß dann vom Ufer ab. Zunächst ruderte ich das Canoe an der Küste entlang, bis ich die äußerste Nordspitze der Insel erreicht hatte. Von dort mußte ich in das offene Meer hinaus. Noch einmal wurde ich jetzt bedenklich, ob ich die Fahrt wagen solle oder nicht. Ich blickte auf die reißenden Strömungen, die in der Ferne zu beiden Seiten der Insel dahinliefen und mir die schreckliche Erinnerung an die Gefahr, in der ich einst geschwebt hatte, wach riefen. Mein Herz fing an zu zagen. Ich mußte mir sagen, daß ich, wenn ich in eine dieser Strömungen geriethe, weit hinaus in die See getrieben werden würde, vielleicht so weit, daß ich die Insel aus den Augen verlöre und sie gar nicht wieder zu erreichen vermöchte. Denn wenn sich auch nur der leiseste Wind erhob, mußte ich in meinem kleinen Fahrzeug unrettbar verloren sein. Diese Gedanken wirkten so niederdrückend auf mich, daß ich das Unternehmen vorläufig wieder aufgab. Ich befestigte mein Boot in einer kleinen Bucht, stieg aus und setzte mich auf einen niedrigen Erdhügel nachdenklich und ängstlich, zwischen Furcht und Hoffnung schwankend, nieder. Während ich so in Gedanken dasaß, bemerkte ich, daß die Flut eintrat und damit meine Abreise für viele Stunden unmöglich gemacht war. Dabei fiel mir plötzlich ein, daß es praktisch wäre, die höchste Stelle des Ufers, die ich finden könnte, zu ersteigen, um den Einfluß der Flut auf die verschiedenen Strömungen zu beobachten und zu sehen, ob es nicht möglich sei, daß ich, wenn ich von der einen Seite abgetrieben würde, durch eine andere Flutrichtung wieder von derselben Strömung zurückgerissen werde. Dieser Gedanke war nicht sobald in mir aufgestiegen, als ich auch schon einen kleinen Hügel ins Auge faßte, der eine hinreichend weite Aussicht nach beiden Seiten gewährte. Von dort konnte ich die Strömungen sowie die Flutrichtung deutlich übersehen und danach bestimmen, wie ich meinen Rückweg einzurichten habe. Ich fand denn auch, daß die während der Ebbe vorherrschende Strömung dicht an der Südspitze der Insel entsprang, während die Flutströmung von der Nordküste ausging. Demnach hatte ich also Nichts zu thun, als mich auf meinem Rückwege immer an der Nordseite zu halten, dann mußte die Fahrt gelingen.
Ermuthigt durch diese Beobachtung, beschloß ich am folgenden Morgen mit Eintritt der Ebbe aufzubrechen. Ich übernachtete in meinem Canoe, indem ich einen der früher erwähnten warmen Ueberröcke zur Decke nahm, und stach am nächsten Morgen in See. Zunächst fuhr ich eine Strecke geradeaus nach Norden, bis ich anfing die Wirkung der östlichen Strömung zu empfinden, die mich mit großer Schnelligkeit vorwärts brachte, ohne jedoch mich so zu überwältigen, wie die Strömung an der Südseite gethan, die mich aller Gewalt über mein Fahrzeug beraubt hatte. Mit meinem Ruder steuernd, eilte ich jetzt sehr schnell auf das Wrack los und hatte es in weniger denn zwei Stunden erreicht.
Es war ein trauriger Anblick, der sich mir hier darbot. Das Schiff, seiner Bauart nach ein spanisches, saß fest eingekeilt zwischen zwei Klippen. Das Verdeck war bis zur Mitte des Schiffes von den Wellen zertrümmert, das Vordertheil aber hing auf den Felsen und war mit solcher Gewalt auf dieselben gestoßen, daß der Haupt und Fockmast dem Bord gleichgemacht, das heißt kurz abgebrochen waren. Das Bugspriet war noch unversehrt und der Schiffsschnabel wie die nächstgelegenen Schiffstheile schienen noch ganz fest zu sein. Als ich mich näherte, erschien ein Hund auf dem Schiffe, der, als er meiner ansichtig wurde, bellte und heulte. Als ich ihn rief, sprang er ins Wasser, um zu mir zu schwimmen. Ich nahm ihn in das Boot, fand ihn aber schon halbtodt vor Hunger und Durst. Als ich ihm ein Stück Brod bot, fraß er es wie ein gieriger Wolf, der vierzehn Tage lang im Schnee geschmachtet hat, auf. Hierauf gab ich dem armen Thier etwas frisches Wasser, woran es, wenn ich es gelitten hätte, sich todt getrunken haben würde. Alsdann ging ich an Bord. Das Erste, was ich hier erblickte, waren zwei ertrunkene Männer, die in der Küche oder dem Vorderverdeck lagen und sich fest umschlungen hielten. Hieraus schloß ich, was auch das Wahrscheinlichste war, daß, als das Schiff aufgestoßen war, der Sturm die Wellen mit solcher Gewalt und so unaufhörlich über dasselbe hingejagt habe, daß die Leute es nicht hätten aushalten können und in dem fortwährend überströmenden Wasser ebenso erstickt wären, als ob sie ganz unter Wasser gelegen hätten. Außer dem Hunde befand sich nichts Lebendes auf dem Schiffe. Die sämmtliche Ladung war vom Wasser verdorben. Einige Fässer mit Getränken, ob Wein oder Branntwein wußte ich nicht, lagen unten in dem Vorrathsraume. Ich konnte sie bei dem niedrigen Wasserstande sehen, aber sie waren zu groß, als daß ich mich mit ihnen hätte befassen können. Auch einige Kisten sah ich, die den Matrosen gehört zu haben schienen. Von diesen brachte ich zwei, ohne zuvor ihren Inhalt zu untersuchen, in mein Boot.
Hätte das Schiff hinten fest gesessen und wäre das Vordertheil abgebrochen gewesen, so wäre meine Reise, wie ich überzeugt bin, sehr gewinnreich gewesen. Denn nach dem, was ich in den beiden Kisten fand, mußte ich annehmen, daß das Schiff große Reichthümer an Bord hatte. Nach dem Cours, den es eingehalten, mußte es von Buenos Ayres oder dem Rio de la Plata in Südamerika über Brasilien nach der Havanna und von dort nach dem mexikanischen Meerbusen und weiter vielleicht nach Spanien bestimmt gewesen sein. Es barg ganz sicher große Schätze, aber jetzt waren sie Niemandem etwas nütze. Was aus der übrigen Mannschaft geworden, habe ich nie in Erfahrung gebracht.
Außer den beiden Kisten fand ich ein kleines Fäßchen mit Spirituosen, etwa zwanzig Maß haltend, welches ich gleichfalls mit vieler Mühe in mein Boot brachte. In einer der Kajüten befanden sich mehre Gewehre und ein großes Pulverhorn mit ungefähr vier Pfund Pulver. Die Gewehre ließ ich, da ich sie nicht gebrauchen konnte, liegen, das Pulverhorn aber nahm ich mit. Dann eignete ich mir noch eine Feuerschippe und Zange, die ich sehr nöthig brauchte, zu, sowie zwei kleine messingne Kessel, einen kupfernen Chokoladentopf und ein Rösteisen. Mit dieser Ladung und in Begleitung des Hundes trat ich meinen Rückweg mit der eintretenden Flut an. Ich erreichte an demselben Abend etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang die Insel wieder, im höchsten Grade erschöpft und ermüdet, und beschloß, die Nacht über in meinem Boote zu bleiben und am andern Morgen meine Beute in der neuen Höhle unterzubringen, ohne sie vorher nach meiner Wohnung zu tragen.
Nachdem ich mich erfrischt hatte, brachte ich die ganze Ladung ans Ufer und stellte eine genaue Untersuchung damit an. In dem Fasse fand ich eine Art Rum, aber nicht solchen, wie man ihn in Brasilien hat; auch taugte er nichts mehr. Als ich dagegen an das Oeffnen der Kisten kam, fand ich darin einige mir außerordentlich willkommne Sachen. In der einen befand sich unter Anderm ein eleganter Kasten mit Flaschen von ungewöhnlicher Farbe, die mit feinen und sehr guten gebrannten Wassern angefüllt waren. Jede Flasche enthielt ungefähr drei Schoppen und war am Halse mit Silberpapier beklebt. Auch zwei Töpfe mit vortrefflichem Eingemachten fand ich, die so gut verschlossen waren, daß das Salzwasser nicht hatte hineindringen können. Der Inhalt zweier anderer solcher Gefäße dagegen war verdorben. Ferner entdeckte ich einige sehr gute, mir hochwillkommne Hemden, etwa anderthalb Dutzend weißer leinener Taschentücher und eine Anzahl bunter Halstücher. Die ersteren konnte ich gleichfalls sehr gut gebrauchen, denn es diente mir zu großer Erfrischung, wenn ich an heißen Tagen mein Gesicht damit abwischte. Außerdem stieß ich, als ich auf den Boden der Kiste kam, auf drei große Beutel mit Piastern, die zusammen ungefähr elfhundert Stück enthielten. In einem derselben befanden sich auch in ein Stück Papier gewickelt sechs Golddublonen und einige kleine Barren oder Stückchen rohen Goldes, von denen jedes wohl beinah ein Pfund wiegen mochte. Die zweite Kiste enthielt nur einige werthlose Kleidungsstücke. Sie mußte wohl dem Gehülfen des Waffenschmiedes angehört haben, denn es war zwar kein Pulver darin, aber sie barg drei kleine Büchsen mit feinem Schrot, was vermuthlich zum Laden der Vogelflinten gedient hatte.
Im Ganzen war der Gewinnst, den ich auf dieser Reise an Sachen von wirklichem Werth für mich gemacht hatte, nur gering. Denn was hätte ich zum Beispiel mit dem Golde anfangen sollen? Es war mir nicht mehr werth als der Sand, über den ich schritt, und ich hätte es gern alles für einige Paar englische Schuhe und Strümpfe gegeben, deren ich in der That äußerst bedürftig war, und die ich nun schon seit vielen Jahren nicht mehr an den Füßen getragen hatte. Zwar hatte ich auch zwei Paar Schuhe erbeutet, die ich den beiden Ertrunkenen, welche ich in dem Wrack gesehen, von den Füßen gezogen, und zwei Paar hatte ich überdies in einer der Kisten gefunden. Wenn sie mir aber auch im höchsten Grade angenehm waren, stachen sie doch gegen unsere englischen Schuhe, sowohl in Bezug auf Bequemlichkeit als hinsichtlich der Dauerhaftigkeit, sehr ab, denn sie waren eher Sandalen als Schuhe zu nennen. In der zweiten Matrosenkiste fand ich auch noch etwa fünfzig Piaster in Realen, aber kein Gold. Dieser Behälter mußte also wohl einem ärmeren Manne gehört haben als die erste Kiste, die das Eigenthum eines Officiers gewesen zu sein schien. Uebrigens brachte ich das Geld, obwohl es mir unnütz schien, dennoch in der Höhle in Sicherheit und verwahrte es da, wie ich auch alles andere von unserem eigenen Schiffe Mitgenommene dort aufgehoben hatte. Es war wirklich recht Schade, daß mir nicht der andere Theil des Schiffes zur Beute gefallen, denn ich bin überzeugt, daß ich mein Canoe daraus mehrmals mit Gold hätte beladen können, das bis zu einer etwaigen Rückkehr nach England in der Höhle sicher genug gelegen haben würde.
Als meine gesammte Ladung in Sicherheit ans Land gebracht war, kehrte ich zu meinem Canoe zurück und steuerte es der Küste entlang in die schon früher benutzte Bucht. Hier legte ich es an und eilte dann auf dem kürzesten Wege zu meiner alten Wohnung, wo ich Alles in friedlicher Ordnung fand. Von jetzt an pflegte ich der Ruhe, lebte in voriger Weise und beschäftigte mich mit meinen häuslichen Angelegenheiten. Einige Zeit hindurch war mein Leben völlig ungestört, ich übte jedoch größere Wachsamkeit als sonst, schaute öfter auf die See aus und verließ meine Wohnung seltener als früher. Nur nach dem östlichen Inseltheil ging ich ohne Furcht, wo ich sicher sein durfte, daß die Wilden dort niemals landeten, und wo ich ohne große Sicherheitsmaßregeln und ohne ein schweres Gewicht von Waffen und Munition zu tragen mich ergehen konnte.
Kapitel 11
In solcher Weise lebte ich beinahe zwei Jahre. Mein unseliger Kopf aber, der mir immer wieder bewies, daß er dazu geschaffen sei, meine übrige Person unglücklich zu machen, steckte während dieser ganzen Zeit voll von Plänen und Projekten, die Insel zu verlassen. Zuweilen gelüstete es mich auch, das gescheiterte Schiff aufs Neue zu besuchen, wiewohl mir die Vernunft sagte, daß dort Nichts mehr zu finden sei, das sich der Gefahr des Weges verlohne. Hätte ich damals das Boot, in welchem ich aus Saleh geflohen war, besessen, ich würde, glaub' ich, mich in demselben auf gut Glück dem Meere anvertraut haben. Mein Benehmen kann allen Denjenigen, welche mit der am weitesten verbreiteten Menschenplage behaftet sind, aus der meines Bedünkens die Hälfte alles irdischen Elends besteht, zur Warnung dienen. Ich meine die Unzufriedenheit mit der Lebenslage, in die Gott und die Natur uns versetzt haben. Denn um hier nicht auf meine erste Thorheit und die Rathschläge meines Vaters, deren Nichtbefolgung sozusagen meine Ursünde war, zurückzukommen, so hatte mich doch der Fehler gleicher Art in der Folgezeit allein in meine traurige Lage gerathen lassen. Hätte mir die Vorsehung, die mich in Brasilien mit so glücklichem Erfolg meine Pflanzung betreiben ließ, mit eingeschränkten Wünschen begnadigt, wäre ich zufrieden gewesen, nach und nach vorwärts zu kommen, so würde ich gewiß inzwischen zu einem der angesehensten Pflanzer in jenem Lande gediehen sein. Ja, ich bin überzeugt, daß ich nach den Verbesserungen, die ich binnen so kurzer Zeit in meiner Besitzung eingeführt, und der Ausdehnung, welche diese dort so rasch gewonnen hatte, jetzt ein Mann von mehr als hunderttausend Moidor gewesen wäre. War es etwa vernünftig, eine so geordnete Lebenslage und eine wohlgedeihende Pflanzung zu verlassen, um als Supercargo in Guinea Neger zu holen, während mit Geduld und mit der Zeit mein Vermögen in der neuen Heimat bald so weit zugenommen haben würde, daß ich die Sklaven dicht vor meiner Hausthür von denen hätte kaufen können, die ein ständiges Geschäft daraus machten, sie zu holen? Der Preisunterschied verlohnte wahrhaftig nicht die große Gefahr, in die ich mich damals begeben hatte. Allein, wie es gewöhnlich bei jungen Hitzköpfen der Fall ist, daß das Nachdenken über ihre Thorheit Jahre erfordert, um sie zur Einsicht zu bringen und daß sie nur durch theuer erkaufte Erfahrung klug werden, so war es auch mit mir gewesen. Leider aber wurzelte jener Fehler in meinem Charakter so tief, daß ich auch jetzt nicht in meiner Lage mich zufrieden geben konnte, sondern beständig über die Mittel brütete, ihr zu entrinnen. Es wird vielleicht dem Leser ergötzlich sein, hier einen Bericht zu erhalten über die ersten Ideen zu jenem thörichten Fluchtplan und über das, worauf sie sich gründeten.
Man stelle sich also vor, daß ich nach meinem letzten Besuche bei dem Wrack, in meine Festung eingeschlossen, während meine Fregatte wie gewöhnlich an sicherer Stelle im Wasser lag, meine gewohnte Lebensweise ruhig fortsetzte. Ich besaß mehr Vermögen als sonst, war aber darum nicht reicher. Ich hatte nicht mehr Nutzen davon als die Indianer von den peruanischen Schätzen, ehe die Spanier in ihr Land kamen.
Nun geschah es in einer regnerischen Märznacht, im einundzwanzigsten Jahre nach meiner Ankunft auf dieser öden Insel, daß ich, während ich in meiner Hängematte, völlig gesund, ohne Schmerz und Unbehagen und ohne mich physisch oder moralisch im Mindesten mehr als gewöhnlich unwohl zu fühlen, lag, die ganze Nacht hindurch kein Auge zu schließen vermochte. Eine unbeschreibliche Menge, ein wahrer Wirbel von Gedanken bewegte sich mir im Kopfe, diesem großen Tummelplatz der Seele. Ich überdachte die ganze Geschichte meines Lebens, von der Zeit vor meiner Landung auf der Insel an durch die lange Reihe von Jahren nach meiner Ankunft hindurch. Indem ich die letzteren in meiner Erinnerung durchging, verglich ich meinen glücklichen Zustand während der ersten Zeit meines Aufenthalts mit dem Leben voll Sorge und Angst, das ich geführt, seit ich die Fußspuren im Sande bemerkt hatte. Zwar glaubte ich jetzt nicht mehr, daß die Wilden nicht auch früher vielleicht hundertmal die Insel besucht hätten, aber ehedem war mir davon Nichts bewußt gewesen, und ich hatte in furchtloser Ruhe dahingelebt. Obgleich meine Gefahr früher die gleiche wie jetzt gewesen war, hatte sie doch, da ich sie nicht kannte, gar nicht für mich existirt. Diese Erwägung regte in mir allerlei gute Gedanken an. Vorzüglich den folgenden: Die Vorsehung hat es unendlich gut für die Menschheit eingerichtet, indem sie unserem Wissen und Erkennen so enge Schranken zog. Der Mensch wandelt inmitten von tausend Gefahren, die, wenn er sie wahrnehmen würde, seine Seele in Verzweiflung setzen müßten; aber er bleibt heiter und ruhig, weil die ihn umgebende Gefährdung seinen Augen verborgen bleibt.
Von dieser Reflexion gelangte ich zu der Betrachtung der Gefahr, in welcher ich in Wirklichkeit seit manchem Jahr auf dieser Insel geschwebt hatte. Im Vollgefühl der Sicherheit und gänzlicher Ruhe war ich meinen Weg gegangen, während vielleicht nur ein Hügel, ein hoher Baum, das zufällige Einbrechen der Nacht zwischen mir und dem elendesten Tode gestanden hatte. Denn ein solcher hätte mich sicher erreicht, falls ich den Cannibalen in die Hände gefallen wäre, die mit mir gerade so wenig Umstände gemacht haben würden als mit einer Ziege oder Schildkröte. Es wäre ungerecht gegen mich selbst, wollte ich leugnen, daß ich in jener Nacht mit aufrichtiger Dankbarkeit anerkannte, dem großen Erretter meine Bewahrung schuldig zu sein, ohne den ich unvermeidlich in die Gewalt der unbarmherzigen Wilden hätte gerathen müssen.
Nun drängten sich mir aber wieder neue Betrachtungen über diese Elenden auf, und die Frage trat mir nahe, wie es möglich sei, daß der allweise Weltenlenker einen Theil seiner menschlichen Geschöpfe in einem solchen Zustande der Bestialität und in Neigungen verharren lassen könne, die sogar unter denen des Thieres stehen, nämlich in der Lust, ihres Gleichen zu verzehren. Von dieser fruchtlosen Frage kam ich auf die weiteren: In welchem Theile der Welt mögen diese Unglücklichen wohnen? Von wie weit her mögen sie bis zu dieser Insel gekommen sein und weshalb haben sie sich wohl so weit gewagt? Welcher Art von Fahrzeugen bedienen sie sich wohl? und endlich: Warum sollte es für mich nicht möglich sein, ebenso gut von hier fortzukommen, als sie hierher gelangt sind?
Daran, was ich thun würde, wenn ich in das Land der Wilden gekommen sein würde, was aus mir werden würde, wenn ich in ihre Hände fiele und wie ich denen zu entgehen vermöchte, wenn die Cannibalen mich verfolgten, an alles dieses dachte ich für den Augenblick nicht. Nicht einmal der Gedanke kam mir, woher ich unterwegs Nahrung bekommen sollte, oder wohin ich eigentlich meinen Weg zu richten habe. Meine Seele war ganz und gar ausgefüllt von dem Plane, daß ich mit meinem Boot das Festland zu erreichen versuchen wolle. Ich betrachtete meine damalige Lage als die unseligste, die gedacht werden könne, und mit der verglichen nur der Tod schlimmer erscheine. Dabei wähnte ich, wenn ich nur die Küste des Festlandes erreicht hätte, würde ich gewiß schon einen Befreier antreffen, oder wenn ich, wie an der afrikanischen Küste, das Ufer entlang bis zu einer bewohnten Gegend schiffte, würde ich da sicherlich Hülfe finden. Vielleicht könnte mir ja auch irgend ein Christenschiff begegnen und mich aufnehmen, oder aber, wenn wirklich selbst das Schlimmste sich ereignen sollte, könnte es ja nur der Tod sein, der auf einmal all meinem Mißgeschick ein Ende machen würde.
Man vergesse hierbei nicht, daß diese Gedanken die Frucht meiner gänzlichen Gemüthsverstörung und meiner ungeduldigen Stimmung waren. Die Veranlassung zu dieser lag in der langen Reihe von Sorgen, die mich heimgesucht hatten, und in der Enttäuschung, die mir auf dem Wrack begegnet war, wo ich mich so nahe der Erfüllung meines sehnlichen Wunsches, mit Menschen zusammenzutreffen und von ihnen etwas Näheres über meinen Aufenthaltsort zu erfahren, geglaubt hatte. Meine Gemüthsruhe, meine Ergebung in Gottes Willen und das Harren auf gnädige Fügung des Himmels schienen damals gänzlich aus mir gewichen zu sein. Ich war nicht im Stande, meine Gedanken von der Reise nach dem Festland abzuwenden, so heftig und unwiderstehlich stürmten sie auf mich ein.
Mehre Stunden hindurch dauerte diese Aufregung meiner Seele. Mein Blut gerieth in fieberhafte Hitze, und die Pulse schlugen mir heftig. Endlich überkam meine erschöpfte Natur ein gesunder Schlaf. Man sollte denken, daß ich von meinen Plänen geträumt hätte, aber das geschah nicht. Mein Traum zeigte mir vielmehr Folgendes: Ich hatte am Morgen, wie gewöhnlich, meine Festung verlassen. Da beobachtete ich am Strande, wie elf Wilde in zwei Canoes landeten und einen andern Wilden mit sich schleppten, den sie schlachten wollten, um ihn zu fressen. Plötzlich sprang der Gefangene davon und rannte fort, um sich das Leben zu retten. Es schien mir im Traume, als komme er zu dem kleinen Gebüsch an meiner Festung. Ich zeigte mich ihm und ermuthigte ihn lächelnd, da ich ihn allein sah und nicht wahrnahm, daß die Andern ihn auf seiner Flucht verfolgten. Er kniete vor mir nieder und schien mich um Hülfe anzuflehen. Ich zeigte ihm meine Leiter, ließ ihn übersteigen und führte ihn in meine Höhle. Von da an war er mein Diener, und nun, wo ich mir diesen Mann gewonnen, sagte ich zu mir selbst: Jetzt darfst du dich getrost nach dem Festland hinwagen. Dieser Bursch soll dir als Lootse dienen; er wird dir angeben, wie du dir Lebensmittel verschaffen kannst, welche Orte du meiden mußt, um nicht gefressen zu werden, wohin du dich wagen darfst und wohin nicht. Mitten in diesen Gedanken wachte ich auf. Der Eindruck der Freude über meine geträumte Aussicht auf Errettung war so unaussprechlich stark, daß die Enttäuschung, welche folgte, als ich zu mir selbst kam und einsah, daß ich nur geträumt hatte, mich in die tiefste Trauer versetzte.
Indeß zog ich mir aus diesem Vorgang den Schluß, daß die einzige Möglichkeit, wie ich einen Fluchtversuch wagen dürfe, davon abhänge, daß ich einen Wilden in meine Gewalt bekäme. Das konnte aber nur mit einem der Gefangenen geschehen, die auf die Insel gebracht würden, um dort gefressen zu werden. Diesem Plan stellte sich jedoch wiederum eine große Schwierigkeit entgegen. Er schien nämlich nur dadurch ausführbar, daß ich einen ganzen Haufen von Wilden angriff und alle bis auf einen tödtete. Dies war nicht nur ein verzweifeltes Unternehmen, das leicht fehlschlagen konnte, sondern ich machte mir auch aufs Neue Skrupel über die Rechtlichkeit desselben. Ich bebte vor dem Gedanken zurück, so viel Blut zu vergießen, wenn es auch für meine Rettung geschähe. Es ist unnöthig, die schon früher dargelegten Bedenken, die ich gegen ein solches Vorhaben hegte, hier zu wiederholen. Aber obgleich ich jetzt darin ein neues Motiv zu haben glaubte, daß ich mir vorstellte, jene Menschen seien meine Todfeinde und würden mich fressen, wenn sie könnten, daher es Nothwehr im äußersten Grade sei, sie anzugreifen, und daß ich dabei nur zu meiner Selbsterhaltung handle, wenn ich so verführe, als ob sie mich wirklich schon angegriffen hätten, so schreckte mich der Gedanke, Menschenblut um meiner Befreiung willen zu vergießen, doch so sehr, daß ich geraume Zeit mich nicht mit ihm befreunden konnte. Dennoch gewann nach langen inneren Kämpfen das unendliche Verlangen nach Befreiung die Ueberhand, und ich beschloß, mich, koste es was es wolle, eines jener Wilden zu bemächtigen. Daher galt es jetzt, über den schwierigen Punkt nachzudenken, wie dieser Plan auszuführen sei. Da ich aber kein zweckmäßigeres Verfahren zu ersinnen vermochte, nahm ich mir endlich vor, Nichts weiter zu thun, als mich auf die Lauer zu legen, auszukunden, wenn die Wilden aus Land kämen, und dann, das Uebrige dem guten Glück überlassend, diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche die Gelegenheit von selbst darbieten würde.
Diesen Entschluß im Kopfe, stellte ich mich so oft als möglich auf Posten, und zwar eine so lange Zeit, daß ich es endlich herzlich müde wurde. Ueber anderthalb Jahre harrte ich und begab mich fast täglich während dieses Zeitraums nach der Westseite und der Südwestspitze der Insel, um nach den Canoes zu spähen, aber keins ließ sich blicken.
Das wirkte zwar sehr entmutigend auf mich, aber meine Unruhe steigerte sich dadurch nur. Statt daß früher meine Sehnsucht durch die Zeit abgestumpft worden war, verschärfte sie sich jetzt nur um so mehr, je länger es währte. Ich war ehedem nicht so begierig gewesen, den Anblick der Wilden zu vermeiden, als mich jetzt sehnlichst nach demselben verlangte. Ich bildete mir ein, einen oder gar mehre Wilde, wenn ich sie hätte, gänzlich zu meinen Sklaven machen und es dahin bringen zu können, daß sie mir ganz zu Willen und in keiner Weise gefährlich sein würden, und lange Zeit hindurch gefiel ich mir in solchen Träumereien, ohne daß sich jedoch eine Aussicht auf ihre Verwirklichung eröffnet hätte.
Da nun wurde ich nach mehr als anderthalb Jahren, als ich die Ausführung meines Planes schon fast aufgegeben hatte, eines Morgens früh durch den Anblick von nicht weniger als fünf Canoes, die auf meiner Inselseite am Ufer lagen, überrascht. Die dazu gehörige Mannschaft war zwar nicht zu sehen, aber die große Zahl der Fahrzeuge schien alle meine Hoffnungen zu nichte zu machen. Ich wußte, daß immer vier oder sechs, oft auch mehr Wilde in einem Boote zu sitzen pflegten, und sah nicht ab, wie ich es anfangen sollte, als einzelner Mann zwanzig bis dreißig dieser Feinde anzugreifen. So lag ich denn mißmuthig und unruhig in meiner Festung, traf jedoch alle früher ausgesonnenen Anstalten und war gerade schlagfertig, als sich etwas Seltsames ereignete. Nachdem ich nämlich eine gute Weile gewartet, ob sich kein Lärm vernehmen lasse, hatte ich meine Gewehre an den Fuß der Leiter gestellt und war dann zu dem Gipfel des Hügels hinaufgeklettert, wobei ich jedoch den Kopf so gebogen hielt, daß man mich auf keine Weise bemerken konnte. Von dort aus beobachtete ich mittelst meines Fernglases, daß die Anzahl der Wilden sich auf nicht weniger als dreißig Mann belief. Sie hatten ein Feuer angezündet und eine Mahlzeit von gebratenem Fleisch vor sich. Wie sie es zubereitet, oder was es für Fleisch war, wußte ich nicht. Sie tanzten gerade in wunderbaren Windungen und mit barbarischen Grimassen rund um das Feuer herum.
Da bemerkte ich plötzlich durch mein Glas, wie man zwei Unglückliche aus den Booten, wo sie, wie es schien, gefesselt gelegen hatten, herbeischleppte, um sie zu schlachten. Den Einen von Beiden sah ich alsbald durch eine Keule oder ein hölzernes Schwert getroffen niederstürzen. Zwei oder drei der Cannibalen fielen sogleich über ihn her, um ihn für die Mahlzeit zu zerschneiden. Unterdeß stand das andere Schlachtopfer zur Seite, harrend, bis die Reihe an es komme. Mit einem Male zuckte in dem armen Teufel, der sich ein wenig frei fühlte, die Liebe zum Leben auf, und er rannte mit unglaublicher Schnelligkeit geraden Wegs nach der Gegend hin, in der meine Behausung lag. Ich war zum Tode erschrocken, als er diese Richtung einschlug, besonders da ich zu bemerken glaubte, daß ihn der ganze Haufen verfolgte.
Jetzt erwartete ich mit Bestimmtheit, auch der andere Theil meines Traumes würde sich erfüllen und der Flüchtling werde Schutz in meinem Gebüsch suchen. Dagegen durfte ich nicht darauf rechnen, daß, wie ich geträumt, die andern Wilden ihm nicht nacheilen und ihn nicht finden würden. Doch blieb ich auf meinem Posten und mein Muth stieg, als ich sah, daß nur drei Leute Jenen verfolgten. Noch mehr freute ich mich bei der Wahrnehmung, daß er sie an Schnelligkeit weit übertraf, und daß er, wenn er den Lauf nur eine halbe Stunde lang aushalten könne, sich retten werde.
Zwischen den Wilden und meiner Festung befand sich die früher oft erwähnte Bucht, in die ich immer mein Floß gesteuert hatte. Es war klar, daß der arme Kerl diese durchschwimmen mußte, wenn er nicht in die Hände der Verfolger fallen sollte. Wirklich warf sich der Flüchtling, an dem Meeresarme angekommen, ohne Weiteres in das Wasser, durchschwamm die gerade durch die Flut angeschwollene Strömung in etwa dreißig Stößen und rannte dann, ans Land gelangt, mit ungemeiner Kraft und Flinkheit weiter. Als die drei Wilden zur Bucht kamen, schien es, daß nur zwei von ihnen schwimmen konnten, der dritte aber nicht. Dieser schaute den Andern, als sie sich in die Flut gestürzt, nach und ging dann langsam zurück, was, wie sich zeigen wird, sein Glück war. Die Beiden brauchten noch einmal so lange Zeit, um die Bai zu durchschwimmen, als der Entflohene.
In diesem Augenblick kam mir lebhaft und unwiderstehlich der Gedanke, daß jetzt die Zeit sei, mir einen Diener und in ihm vielleicht zugleich auch einen hülfreichen Freund zu verschaffen, und daß ich offenbar von Gott bestimmt sei, dem armen Teufel das Leben zu retten. Ich stieg in möglichster Eile die Leitern herunter, ergriff die am Fuß derselben stehenden zwei Gewehre, erkletterte in gleicher Hast wieder den Gipfel des Hügels, eilte von dort aus dem Meere zu und gelangte dadurch zwischen den Flüchtling und die Verfolger. Den ersteren rief ich laut an. Er schaute sich um und war im ersten Augenblick wahrscheinlich vor mir in gleicher Furcht wie vor Jenen. Ich gab ihm aber ein Zeichen, zu mir zu kommen, und ging unterdessen langsam den beiden Andern entgegen.
Plötzlich stürzte ich mich auf den Vordersten und schlug ihn mit dem Flintenkolben nieder. Ich scheute mich Feuer zu geben, damit es die Uebrigen nicht hören sollten, wiewohl sie es bei der großen Entfernung schwerlich vernommen haben würden und, da sie auch den Rauch nicht zu sehen vermochten, schwerlich hätten vermuthen können, was der Knall zu bedeuten habe. Nachdem ich den einen der Wilden zu Boden geschmettert, hielt der andere erschrocken inne. Als ich näher kam, bemerkte ich, daß er Bogen und Pfeile führte und gerade nach mir zielte. So war ich denn doch zum Schuß gezwungen, mit dem ich ihn auch sofort tödtete.
Der arme Flüchtling war, obgleich er seine beiden Feinde niedergestreckt sah, doch so durch Feuer und Knall meines Gewehrs entsetzt, daß er wie eine Bildsäule stand und sich nicht vom Fleck rührte. Dabei schien er aber eher geneigt, zu fliehen als zu mir zu kommen. Ich rief ihn nochmals an und winkte ihm herbeizukommen. Er machte einige Schritte vorwärts, blieb dann stehen, ging wieder einige Schritte und hielt hierauf abermals inne. Ich sah, wie er zitterte, als ob er ebenso sterben zu müssen glaube wie seine beiden Feinde. Auf mein Winken und meine Zeichen zur Ermuthigung kam er näher und kniete alle zehn bis zwölf Schritte nieder, um seine Dankbarkeit dafür anzudeuten, daß ich ihm das Leben gerettet. Ich sah ihn lächelnd und freundlich an und forderte ihn mit Winken auf, noch näher zu kommen. Endlich befand er sich dicht bei mir, kniete abermals nieder, küßte die Erde, legte den Kopf auf den Boden, ergriff meinen Fuß und stellte diesen auf seinen Kopf. Er wollte damit, wie es schien, andeuten, daß er für alle Zeit mein Sklave sein werde.
Ich hob ihn auf und suchte ihn zu ermuthigen, so gut ich konnte. Aber es gab jetzt noch mehr zu thun. Ich bemerkte nämlich, daß der Wilde, den ich zu Boden geschlagen, nicht todt, sondern nur betäubt war und anfing wieder zu sich zu kommen. Ich deutete auf ihn, zum Zeichen, daß er sich wieder erhole. Der Gerettete sprach hierauf einige Worte, die ich zwar nicht verstand, über die ich mich aber dennoch sehr freute. Denn sie waren der erste Ton einer Menschenstimme, die ich außer der meinigen seit mehr als fünfundzwanzig Jahren vernommen hatte. Doch war zu solchen Betrachtungen jetzt keine Zeit. Der zu Boden geschmetterte Wilde hatte sich nämlich so weit erholt, daß er sich aufrecht zu setzen vermochte. Mein Gefangener schien erschreckt, als ich aber mit meiner Flinte nach dem Andern zielte, machte er (den ich von jetzt an meinen Wilden nennen will) mir ein Zeichen, daß ich ihm meinen Säbel, der ohne Scheide an meiner Seite hing, geben sollte. Nachdem ich das gethan, eilte er sofort auf seinen Feind los und schlug ihm mit einem Hieb so geschickt den Kopf ab, daß es kein Scharfrichter in England rascher und besser hätte fertig bringen können. Mich wunderte das um so mehr, weil ich wohl annehmen durfte, daß er nie im Leben ein anderes als die bei den Wilden gebräuchlichen hölzernen Schwerter in Händen gehabt hatte. Doch erfuhr ich später, daß diese Holzschwerter so scharf und von so hartem Holz sind, daß man mit ihnen Köpfe und Arme auf einen Schlag abhauen kann. Nachdem er sein Werk vollbracht, kam mein Sklave lachend zu mir zurück und legte mit allerlei Grimassen, die ich nicht verstand, den Säbel nebst dem Kopf des Getödteten zu meinen Füßen nieder.
Am meisten hatte den geretteten Wilden in Erstaunen gesetzt, wie ich es angefangen, den andern Indianer aus so großer Entfernung zu tödten. Er machte mir ein Zeichen, daß ich ihn zu Jenem gehen lassen solle, wozu ich ihn auch durch Winke aufforderte. Als er zu ihm gekommen war, stand er verwundert da, betrachtete ihn, wendete ihn von einer Seite auf die andere und beschaute die Wunde, welche die Kugel hervorgebracht hatte. Diese schien in die Brust gegangen zu sein, ohne daß starker Blutverlust eingetreten war, denn der Getroffene war nach Innen verblutet und völlig todt.
Mein Sklave nahm ihm Bogen und Pfeile weg und kam damit zurück. Jetzt wandte ich mich zur Rückkehr und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, daß er mit mir kommen möge, da noch andere Verfolger nahen könnten. Er bedeutete mir, daß er die Todten in den Sand verscharren wolle, damit die Uebrigen sie nicht entdeckten, wenn sie hinter ihm her kämen. Sobald ich ihm durch Zeichen die Erlaubniß dazu gegeben, scharrte er sofort mit den Händen Löcher in den Sand und begrub Einen nach dem Andern binnen etwa einer Viertelstunde. Dann rief ich ihn und nahm ihn mit mir, ging aber statt zu meiner Festung nach meiner in dem abgelegenen Theile der Insel befindlichen Höhle. (Demnach ließ ich den Theil meines Traumes, in welchem der Flüchtling sich in mein Gebüsch verborgen hatte, sich nicht verwirklichen.) In der Höhle gab ich ihm Brod, ein Bündel Rosinen und einen Trunk Wassers, nach welchem er in Folge seines Laufs sehr gierig schien. Als er sich so erquickt hatte, bedeutete ich ihm, daß er sich schlafen legen solle. Ich zeigte ihm einen Ort, wo ein Haufen Reisstroh und eine Decke zu meinem eigenen zeitweiligen Gebrauch lag, und der arme Bursch hatte sich kaum darauf ausgestreckt, als er auch schon eingeschlafen war.
Er war ein stattlicher, hübscher Kerl, wohlgebaut, kräftig von Gliedern, schlank und wohl proportionirt. Nach meiner Berechnung zählte er etwa sechsundzwanzig Jahre. Seine Gesichtszüge waren männlich und ohne wilden Ausdruck. Besonders wenn er lächelte, hatte er die ganze Anmuth und Sanftmuth eines gebildeten Europäers. Sein Haar war lang und schwarz und nicht völlig gekräuselt; die Stirn hoch und breit und seine Augen sehr lebhaft und von einem funkelnden scharfen Ausdruck. Seine Hautfarbe war nicht völlig schwarz, sondern braungelb, aber nicht von jener häßlichen gelben, widerlichen Farbe, wie man sie bei den brasilianischen, virginischen und anderen Eingeborenen von Amerika sieht, sondern von einer Art glänzenden Olivenbrauns, das einen angenehmen, aber schwer beschreiblichen Anblick gewährte. Sein Gesicht war rund und voll, die Nase klein und nicht platt wie die der Neger, der Mund schön, die Lippen schmal, die Zähne wohlgereiht und weiß wie Elfenbein.
Nachdem er über eine halbe Stunde lang geschlafen oder richtiger geschlummert hatte, erwachte er und kam aus der Höhle zu mir in die dicht daneben befindliche Einfriedigung, wo ich gerade meine Ziegen molk. Sobald er mich erblickte, eilte er herbei, warf sich auf die Erde und suchte mir mit allen möglichen seltsamen Geberden seine Dankbarkeit zu bezeigen. Zuletzt legte er den Kopf auf die flache Erde und setzte, wie schon einmal, einen meiner Füße darauf. Kurz, er suchte durch Zeichen der Unterwürfigkeit und demüthigen Ergebenheit anzudeuten, daß er mir sein ganzes Leben hindurch treu zu dienen gewillt sei. Das Meiste von dem, was er sagen wollte, begriff ich auch, und ich gab ihm zu verstehen, daß ich mit ihm zufrieden sei.
Nicht lange darauf fing ich schon an, ihn im Sprechen zu unterrichten. Zunächst brachte ich ihm bei, daß er Freitag heißen solle, weil ich an diesem Tage ihm das Leben gerettet hatte. Ich lehrte ihn ferner mich» Herr «anzureden,»ja «und» nein «zu sagen und die Bedeutung beider Worte zu verstehen. Indem ich ihm Milch aus einem irdenen Topf zu trinken gab, zeigte ich ihm, wie ich selbst daraus trank und mein Brod darin eintauchte, reichte ihm dann ein Stück Brod, damit er es mir nachthue, und er that es auch sofort unter Zeichen, daß ihm das sehr wohl behage. Während der folgenden Nacht blieb ich mit ihm an jenem Orte, sobald aber der Tag angebrochen war, forderte ich ihn auf, mir zu folgen, da ich ihm Kleider geben wollte. Er schien sehr froh darüber zu sein, da er völlig nackt war. Als wir an die Stelle kamen, wo er die beiden Indianer verscharrt hatte, zeigte er mir den Platz und die Merkmale, die er angebracht, um ihn wiederzufinden, wobei er mir durch Zeichen zu verstehen gab, daß wir sie wieder ausgraben und dann essen wollten. Hierüber ließ ich ihn aber meine ganze Entrüstung merken, drückte meinen Schauder davor aus und that, als ob ich mich bei dem bloßen Gedanken daran übergeben müßte. Dann winkte ich ihm, mit fortzugehen, was er sofort in großer Unterwürfigkeit that. Ich führte ihn zunächst auf den Gipfel des Hügels, um nachzusehen, ob seine Feinde sich entfernt hätten. Durch mein Fernglas konnte ich deutlich den Ort, wo sie gelagert hatten, erkennen, aber es war weder Etwas von ihnen, noch von ihren Canoes zu bemerken. Offenbar hatten sie sich wegbegeben, ohne nach ihren zurückgebliebnen Kameraden zu suchen.
Diese Entdeckung stellte mich jedoch keineswegs zufrieden. Da ich jetzt muthiger und dem zufolge auch neugieriger war, nahm ich Freitag mit mir, gab ihm den Säbel in die Hand, Bogen und Pfeile auf den Rücken und ließ ihn außerdem für mich ein Gewehr tragen, während ich mich selbst mit zwei derselben bewaffnete. So ausgerüstet begaben wir uns nach dem Ort, wo die Wilden gewesen waren. Denn ich hatte große Lust mir genauere Kunde von ihrem Treiben zu verschaffen.
Als wir an ihre Lagerstelle kamen, bot sich mir ein Schauspiel, das mir vor Schauder das Blut gerinnen und das Herz stocken ließ, während es auf Freitag keinen besonderen Eindruck machte. Der Platz war nämlich ganz mit Menschengebeinen bedeckt und mit Blut förmlich gedüngt. Große Stücke Fleisch lagen halb verzehrt, zerrissen und beschmutzt umher. Mit Einem Wort, man sah alle Spuren des grausigen Triumphfestes, das die Wilden hier über ihre Feinde gefeiert hatten. Ich zählte drei Schädel, fünf Hände, die Knochen von drei oder vier Beinen und Füßen und eine Menge anderer Stücke menschlicher Leichname. Freitag gab mir zu verstehen, daß vier Gefangene herüber gebracht und drei davon gefressen seien, während er das vierte Opfer hätte abgeben sollen. Bei einer großen Schlacht zwischen jenen Wilden und deren Nachbarkönig, zu dessen Unterthanen er zu gehören schien, sei eine große Zahl von Gefangenen gemacht worden, welche sämmtlich zu verschiedenen Plätzen geschleppt seien, um verzehrt zu werden.
Ich befahl Freitag, die Schädelknochen, das Fleisch und die übrigen Reste auf einen Haufen zu schichten, ein großes Feuer anzuzünden und sie zu Asche zu verbrennen. Er schien noch immer große Lust zuhaben, Etwas von den Kadavern zu verspeisen, und geberdete sich noch ganz und gar wie ein Cannibale. Aber ich zeigte ihm so großen Abscheu bei dem bloßen Gedanken an eine solche Handlung, daß er sein Gelüst nicht verrathen durfte. Ich hatte ihm nämlich begreiflich gemacht, daß ich ihn niederschießen würde, wenn er sich erfreche, sein Verlangen zu befriedigen.
Nach einiger Zeit kehrten wir zu meiner Festung zurück. Dort gab ich Freitag vor Allem ein Paar leinene Hosen, die ich aus dem Koffer des oben erwähnten armen Kanoniers in dem Wrack genommen hatte. Nach einer kleinen Veränderung paßten sie ihm ganz gut. Dann machte ich ihm aus Ziegenfell, so gut ich es vermochte, ein Wamms, denn ich hatte mich jetzt zu einem ganz leidlichen Schneider ausgebildet. Ferner fertigte ich ihm aus Hasenfell eine Mütze, die ihm recht hübsch zu Gesicht stand, und so war er fürs Erste ziemlich gut bekleidet. Es machte ihm nicht wenig Vergnügen, sich beinahe so schön als sein Herr selbst equipirt zu sehen. Freilich sah er im Anfang in seinem Kostüm etwas sehr linkisch aus. Die Hosen schienen ihn zu geniren, und die Wammsärmel drückten ihn auf der Schulter und unterhalb der Arme. Nachdem ich aber die Stellen, über die er sich beklagte, etwas bequemer gemacht und er sich ein wenig an seine Kleidung gewöhnt hatte, behagte er sich ganz wohl darin.
Am nächsten Tag überlegte ich, wo ich ihn in Zukunft behausen wolle. Um ihm die gleiche Bequemlichkeit, wie ich sie selbst genoß, zu verschaffen, errichtete ich für ihn ein kleines Zelt auf dem freien Raum zwischen meinen beiden Festungswerken. Da man von hier aus in die Höhle gelangen konnte, zimmerte ich eine förmliche Bretterthür und setzte diese in die Oeffnung. Ich richtete es so ein, daß sie von Innen zu öffnen war, und verriegelte sie bei Nacht. Da ich Abends auch meine Leitern einzog, so konnte Freitag durchaus nicht in meine innerste Palissadirung gelangen, ohne so viel Lärm zu machen, daß ich hätte darüber erwachen müssen. Ueber meine erste Palissadenwand ragte jetzt ein Dach von langen Pfählen, das mein Zelt ganz bedeckte und sich an die Hügelseite lehnte. Statt mit Latten hatte ich es mit dünneren Stöcken kreuzweise belegt und darüber eine dichte Lage von Reisstroh, das dick wie Rohr war, gebreitet. In der Oeffnung, die für das Hineinsteigen mit der Leiter gelassen war, hatte ich eine Art Fallthür angebracht, die, wenn sie von Außen angegriffen wurde, sich nicht öffnete, sondern mit großem Geräusch herunterfallen mußte. Auch meine sämmtlichen Waffen nahm ich jede Nacht zu mir in den inneren Raum.
Diese Vorkehrungen wären aber sämmtlich nicht nöthig gewesen. Denn nie hat Jemand einen treueren, anhänglicheren und aufrichtigeren Diener gehabt, als Freitag mir war. Frei von schlimmen Leidenschaften, von allem mürrischen Wesen und von jeder Arglist, ganz und gar mir ergeben, liebte er mich wie das Kind seinen Vater. Ich kann sagen, daß er sein Leben für mich bei jeder Gelegenheit ohne Weiteres geopfert haben würde; denn die mannichfachsten Beweise haben mir das unzweifelhaft dargethan.
Ich habe oft mit Verwunderung meine Betrachtungen darüber angestellt, warum Gott es zulasse, daß ein so großer Theil seiner menschlichen Geschöpfe die Fähigkeiten und Anlagen ihrer Seele nicht benutzt. Er hat ihnen doch dieselben Geistesgaben verliehen wie uns, dieselbe Vernunft, dieselben Neigungen, die gleichen Empfindungen des Wohlwollens und der Dankbarkeit, das gleiche Gefühl für Gutes und Schlechtes und dieselbe Empfindung für Aufrichtigkeit und Treue. Wenn es dem Schöpfer gefallen hätte, ihnen die Gelegenheit zur Anwendung zu geben, so würden sie gewiß gerade so bereitwillig, ja noch bereitwilliger als wir sein, von ihren Gaben den rechten Gebrauch zu machen. Zuweilen machte mich auch der Gedanke traurig, wie schlecht dagegen wir unsere Anlagen verwenden, obgleich wir doch durch das große Licht der Offenbarung und durch die Kenntniß seines Wortes aufgeklärt sind. Auch das brachte mich zum Nachdenken, warum nach Gottes Rathschluß so viel Millionen Seelen dieser heilsamen Erkenntniß untheilhaftig bleiben, die, wenn ich nach meinem armen Sklaven urtheilen darf, sie besser anwenden würden als wir. Von hier aus gelangte ich zu weiteren Gedanken über das Walten der Vorsehung, und ich verirrte mich so weit, daß ich die göttliche Gerechtigkeit in der willkürlichen Anordnung der Dinge zu vermissen wagte, nach welcher jenes Licht Einigen aufgethan und Anderen verborgen ist, da doch von Beiden gleiche Pflichterfüllung gefordert wird. Doch schnitt ich diese Ideen durch die Erwägungen ab: Erstens, daß wir ja gar nicht wissen, nach welchem Grad der Erkenntniß und nach welchem Gesetze Jene gerichtet werden. Und ferner, daß, weil Gott nach seiner Natur nothwendig unendlich heilig und gerecht sein muß, es nicht anders sein könne, als daß jene armen Menschen, da sie zum Entferntsein von Gott verdammt sind, auch nur gerichtet werden können um der Sünden willen, die sie gegen diejenige Erkenntniß verbrochen haben, welche, wie die Schrift sagt, ein Gesetz in ihnen selbst ist. Sodann aber, daß, da wir Gott gegenüber nur der Lehm in der Hand des Töpfers sind, das Gefäß nicht sagen könne zu seinem Urheber:»Warum hast du mich also gebildet und nicht andere?«
Um jedoch auf meinen neuen Gefährten zurückzukommen, so gefiel mir derselbe außerordentlich. Ich erachtete es für meine Pflicht, ihn in Allem zu unterweisen, was ihn nützlich und geschickt machen könnte. Besonders gab ich mir Mühe, ihn sprechen und mich verstehen zu lehren. Er war der aufgeweckteste Schüler, den man sich denken kann, voll Heiterkeit, von emsigem Fleiße und so voll Freude, wenn er mich zu verstehen oder sich mir verständlich zu machen vermochte, daß ich mich sehr gern mit ihm unterhielt. Mein Leben gestaltete sich jetzt so angenehm, daß ich mir oft sagte, wenn mich nur die übrigen Wilden unangefochten ließen, wollte ich an eine Entfernung von meinem jetzigen Aufenthalt gar nicht mehr denken.
Einige Tage nach meiner Rückkehr in meine Festung nahm ich Freitag, da ich bedachte, daß ich, wenn ich ihm die cannibalische Lust am Verzehren von Menschenfleisch abgewöhnen wolle, ihm zuvor den Geschmack von anderm Fleisch beibringen müsse, früh Morgens mit in den Wald. Ich beabsichtigte nämlich, eines der von mir aufgezogenen Ziegenlämmer zu tödten und das Fleisch zu Hause zuzubereiten. Auf dem Wege aber bemerkte ich eine Ziege, die mit zwei jungen Lämmern im Schatten lag. Ich nahm Freitag am Arm, hieß ihn stille stehen, legte mein Gewehr an und schoß damit nach einem der Lämmer, daß es sofort todt hinfiel. Der arme Bursch, der mich früher schon aus einiger Entfernung seinen Feind, den Wilden, hatte tödten sehen, ohne zu wissen, wie ich das angefangen, war offenbar so erstaunt, daß ich glaubte, er würde vor Schrecken gleichfalls umsinken. Er sah gar nicht, daß ich das Lamm getödtet hatte, sondern er riß sein Wamms auf, um zu fühlen, ob nicht er selbst verwundet sei. Jedenfalls glaubte er, ich wolle ihn tödten, denn er kam herbei, kniete nieder, umfaßte meine Kniee und sagte Allerlei, von dem ich nur so viel verstand, daß er damit um Schonung seines Lebens flehen wolle.
Ich machte ihm bald begreiflich, daß ich ihm Nichts zu Leide thun werde, ergriff ihn bei der Hand, zeigte, indem ich ihn auslachte, auf das getödtete Lamm und winkte ihm, dasselbe zu holen. Während er noch verwundert dasselbe betrachtete, um zu wissen, wie das Thier erlegt war, lud ich aufs Neue mein Gewehr. In diesem Augenblick bemerkte ich einen habichtartigen Vogel, der in Schußweite auf einem Baume saß. Um Freitag einigermaßen begreiflich zu machen, was ich beabsichtigte, rief ich ihn wieder zu mir, zeigte auf den Vogel (es war ein Papagei) und dann wieder auf meine Flinte und auf die Erde unter dem Vogel, damit er sähe, wohin jener fallen solle. Dann gab ich Feuer und befahl ihm, dahin zu blicken, wo der getödtete Papagei lag. Trotz alledem stand Freitag aufs Neue ganz erschrocken da. Er schien um so mehr erstaunt, als er nicht gesehen, daß ich Etwas in das Gewehr gethan hatte. Daher wähnte er, ich besäße irgend ein geheimes Mittel der Vernichtung, womit man Menschen und Thiere in Nähe und Ferne tödten könne. Hätte ich es zugelassen, ich glaube, er würde mich und meine Flinte angebetet haben. Mehre Tage hindurch wagte er nicht, das Gewehr anzurühren, aber wenn er allein war, redete er es an und schwatzte mit ihm, als ob es ihm geantwortet habe. Später erfuhr ich von ihm, daß er es gebeten habe, ihn nicht zu tödten.
Nachdem bei jener Gelegenheit sein Erstaunen sich einigermaßen gelegt hatte, hieß ich ihn den geschossenen Vogel herbeiholen. Er zögerte etwas, denn der Papagei war anfangs nicht ganz todt gewesen und noch eine Strecke weit geflattert. Endlich brachte er ihn herbei, und jetzt lud ich, während er sich entfernt hatte, wiederum meine Flinte, um bei seiner Wiederkunft schußfertig zu sein. Da sich aber kein Thier für meinen Schuß zeigte, brachte ich das Lamm heim, zog ihm noch denselben Abend das Fell ab, zerlegte es, so gut es ging, und kochte, da ich jetzt ein geeignetes Gefäß befaß, darin etwas von dem Fleisch, bereitete auch davon sehr gute Bouillon. Nachdem ich selbst davon genossen, gab ich meinem Wilden auch von dem Fleisch zu essen, und es schien ihm sehr gut zu munden. Was ihn am meisten befremdete, war, daß er es mich mit Salz essen sah. Er gab mir zu verstehen, daß Salz nicht gut schmecke, steckte ein wenig davon in den Mund, schien dabei Ekel zu empfinden, spie es wieder aus und spülte sich danach den Mund mit frischem Wasser. Hierauf nahm ich meinerseits etwas Fleisch ohne Salz in den Mund und stellte mich gleichfalls, als ob ich es wieder ausspeien müßte, gerade weil es nicht gesalzen sei. Aber das half Nichts. Lange Zeit wollte er sich nicht dazu verstehen, Fleisch oder Bouillon mit Salz zu genießen, und auch später nahm er immer nur ein wenig von diesem Gewürz dazu.
Den nächsten Tag gab ich Freitag dann ein Stück geröstetes Fleisch von dem Lamm zu essen. Ich hatte das Rösten bewerkstelligt, wie ich es öfters von Leuten in England hatte thun sehen. Nachdem ich nämlich zwei Stäbe zu beiden Seiten des Feuers in den Boden gesteckt, legte ich einen dritten Stock darüber, hing an diesen das Fleisch mit einem Seil auf und ließ es sich daran fortwährend drehen. Freitag staunte dies Alles höchlich an. Als er von dem Fleisch genossen, drückte er auf die verschiedenste Weise sehr deutlich aus, wie gut es ihm behage, versicherte auch endlich, er wolle nie mehr Menschenfleisch essen, was ich mit Vergnügen hörte.
Am folgenden Tag ließ ich Freitag Gerste auskörnen und sie in der früher beschriebenen Weise reinigen. Bald verstand er es so gut wie ich selbst, besonders nachdem er begriffen hatte, daß es zu Brod bestimmt sei. Denn auch dieses zu bereiten hatte ich ihn gelehrt, und bald besaß Freitag in allen diesen Dingen gleiche Fertigkeit wie ich.
Ich überlegte nun, daß ich, da ich jetzt für zwei Magen statt für einen zu sorgen habe, auch ein größeres Stück Feld besäen müsse als früher. Daher begann ich ein weiteres Stück Land einzuzäunen, wobei mir Freitag sehr willig und ausdauernd half, nachdem ich ihm gesagt, daß es geschehe, um Brod genug für ihn und mich selbst zu bekommen. Er schien sehr erkenntlich dafür zu sein und gab mir zu verstehen, daß, da ich um seinetwillen viel mehr Mühe habe, er auch um so eifriger für mich arbeiten wolle, wenn ich ihm nur angeben wolle, was zu thun sei.
Kapitel 12
Das jetzt folgende Jahr war das angenehmste unter allen, die ich auf der Insel zugebracht habe. Freitag fing an, ganz gut sprechen zu lernen und verstand die Namen fast aller Gegenstände und aller Orte, nach denen ich ihn schickte. Er schwatzte ohne Unterlaß mit mir, und ich gebrauchte jetzt meine Zunge wieder sehr eifrig, nachdem ich so lange keine Gelegenheit sie zu benutzen gehabt hatte. Außer dem Vergnügen, mich mit ihm zu unterhalten, machte mir mein Gefährte auch in anderer Hinsicht viel Freude. Die einfache, unverstellte Redlichkeit seiner Seele offenbarte sich mir jeden Tag mehr, und ich begann, ihn von Herzen lieb zu gewinnen. Andrerseits faßte auch er eine solche Liebe zu mir, wie er sie früher wohl für kein anderes Wesen gefühlt haben mochte.
Einmal gelüstete es mich zu versuchen, ob er wohl ein starkes Verlangen nach der Rückkehr in seine Heimat habe. Da er jetzt genug Englisch verstand, um fast auf alle meine Fragen antworten zu können, fragte ich ihn, ob das Volk, zu dem er gehöre, nie eine Schlacht gewonnen habe. Lächelnd erwiederte er.»Ja, ja, wir immer fechten das Beste«, womit er sagen wollte, daß sein Volk immer siegreich kämpfe. Hierauf hatten wir folgendes Gespräch:»Wenn Ihr«, sagte ich,»immer das Beste fechtet, wie kommt es dann, Freitag, daß du gefangen genommen wurdest?«
Freitag:»Mein Volk trotzdem schlägt das Meiste«.
Ich:»Wie so schlagen? Wenn dein Volk sie schlägt, wie konntest du gefangen werden?«
Freitag:»Sie viel mehr waren als wir; sie eins, zwei, drei und mich gefangen haben. Mein Volk sie auch geschlagen haben, aber auf Platz, wo ich nicht war. Dort mein Volk gefangen haben eins, zwei, ein großes Tausend«.
Ich:»Aber weshalb haben die Deinigen dich nicht aus der Hand der Feinde befreit?«
Freitag:»Sie mit eins, zwei, drei und mir fortlaufen und in Canoe bringen. Mein Volk damals nicht hatten Canoe«.
Ich:»Nun, und was macht dein Volk mit den Gefangenen? Bringt es sie auch fort und frißt sie, wie Jene thun?«
Freitag:»Mein Volk ißt Mensch auch. Ißt sie Alle auf«.
Ich:»Wohin bringt Ihr sie denn?«
Freitag:»An andern Ort, wohin man will«.
Ich:»Kommt Ihr auch hierher?«
Freitag:»Ja, ja, hierher, auch an andern Platze«.
Ich:»Bist du denn auch schon mit hier gewesen?«
Freitag:»Ja, auch hier gewesen bin«. (Hierbei zeigte er nach der Nordwestseite der Insel, wo der gewöhnliche Landungsplatz seiner Landsleute zu sein schien.)
Hierdurch hatte ich also erfahren, daß Freitag unter jenen Wilden gewesen war, die früher auf den entfernteren Inseltheil zu kommen pflegten, und daß ihn ehedem ganz dieselbe Veranlassung, um derentwillen er selbst hierher gebracht war, dahin geführt hatte. Einige Zeit darauf, als ich Muth genug fühlte, mit ihm an jene Stelle zu gehen, erkannte er sie sofort wieder. Wie er mir sagte, war er einmal dort gewesen, als er und seine Leute zwanzig Männer, zwei Weiber und ein Kind verzehrt hatten. Die Zahl zwanzig verdeutlichte er mir, da er sie auf Englisch nicht aussprechen konnte, indem er die entsprechende Anzahl Steine in einer Reihe auf die Erde legte und mich aufforderte, sie zu zählen.
Das obige Gespräch habe ich hauptsächlich deshalb angeführt, weil es die Einleitung zu der folgenden Mittheilung Freitags abgab.
Nachdem ich ihn gefragt hatte, wie weit sein Land von unserer Insel sei und ob die Canoes nicht oft untergingen, erwiederte er, es sei keine Gefahr dabei, und nie sei eins verloren gegangen. Denn wenn man ein wenig nach der See hinkomme, so finde sich da eine Strömung, die sich Morgens immer in einer andern Richtung als des Nachmittags bewege. Damals glaubte ich, dies beziehe sich nur auf den Wechsel von Ebbe und Flut, später aber erfuhr ich, daß es von der Gewalt des Stromwechsels in dem mächtigen Orinokoflusse herrühre, in dessen Golf oder Mündung, wie mir nachmals bekannt wurde, unsre Insel lag. Jenes Land, das ich im Westen und Nordwesten bemerkt hatte, war nämlich die große Insel Trinidad, die nördlich vom Ausfluß des genannten Stromes liegt. Ich richtete von jetzt ab an Freitag tausenderlei Fragen über das Land, die Einwohner, die See, die Küsten und die benachbarten Nationen, und er sagte mir mit der größten Aufrichtigkeit Alles, was er darüber wußte. Durch meine Fragen nach den Namen der Nationen seines Stammes brachte ich jedoch nur den Namen» Caribs «aus ihm heraus. Hieraus entnahm ich leicht, daß es die Karaiben waren, deren Wohnsitze auf unsern Karten zwischen der Mündung des Orinoko bis nach Guyana und weiter bis St. Martin bezeichnet sind. Wie Freitag mir sagte, wohnten weit jenseits des Mondes, das heißt des Monduntergangs, was im Westen seines Landes sein mußte, weißbärtige Männer wie ich, wobei er auf meinen großen Backenbart zeigte. Dieselben hätten schon» viel Mensch «getödtet, wie er sich ausdrückte. Ich entnahm daraus, daß er die Spanier meinte, deren Grausamkeit in Amerika allerorten gewüthet hatte, und deren schlimmes Andenken sich bei allen jenen Nationen forterbte.
Ich fragte dann, wie ich es anfangen könne, von unsrer Insel zu jenen weißen Männern zu gelangen.»Ja ja«, antwortete er,»es gehen kann in zwei Canoes. «Ich verstand nicht, was er damit meinte, und brachte erst nach großen Anstrengungen heraus, daß er unter jener Bezeichnung ein großes Boot, das so umfangreich wie zwei Canoes sei, verstanden hatte.
Diese Unterredung erfreute mich sehr, und seitdem hielt ich die Hoffnung fest, früher oder später einmal die Gelegenheit zu finden, mit Hülfe dieses armen Wilden von meiner Insel zu entrinnen.
Während der langen Zeit, die Freitag jetzt bei mir verweilte, hatte ich, nachdem er mich völlig verstehen gelernt, auch nicht unterlassen, bei ihm den Grund einer religiösen Erkenntniß zu legen. Als ich ihn einst fragte, wer ihn geschaffen habe, mißverstand mich der arme Mensch gänzlich und glaubte, ich hätte gefragt, wer sein Vater sei. Nun griff ich die Sache anders an und fragte, wer die See, das Land, auf dem wir gingen, die Hügel und Wälder geschaffen habe. Er antwortete, das habe der alte Benamuckee gethan, der über alles Lebende herrsche. Von dieser großen Person aber vermochte er mir weiter Nichts zu sagen, als daß dieselbe sehr alt, wie er sich ausdrückte, viel älter als Wasser und Land, Mond und Sterne sei. Darauf fragte ich ihn, warum dieser alte Mann, wenn er alle Dinge geschaffen habe, nicht auch von allen angebetet werde. Mit sehr ernster Miene und mich unschuldig ansehend, entgegnete er:»Alle Dinge zu ihm sagen:»O!«Ich fragte ferner, wohin die Menschen, die in seinem Lande stürben, kämen. Er antwortete:»Sie alle kommen zu Benamuckee«. Auf meine Frage, ob die von ihnen Aufgefressenen auch dahin kämen, antwortete er mit Ja.
An diesem Punkte anknüpfend, begann ich nun, ihn in der Erkenntniß des wahrhaftigen Gottes zu unterweisen. Ich sagte ihm:»Der große Schöpfer aller Dinge wohnt da oben (wobei ich auf den Himmel zeigte). Er regiert die Welt kraft derselben Gewalt und Vorsehung, dadurch er sie geschaffen hat. Er ist allmächtig und kann uns Alles geben und Alles nehmen.«
Auf diese Weise öffnete ich allmählich meinem Gefährten die Augen. Er horchte mit großer Aufmerksamkeit und Freude auf meine Verkündigung, daß Jesus Christus gekommen sei, uns selig zu machen. Ich belehrte ihn, wie man zu Gott beten müsse, und daß er uns auch im Himmel erhöre. Eines Tages sagte mir Freitag: Wenn unser Gott uns sogar jenseits der Sonne verstünde, so müßte er ja größer sein als Benamuckee, denn der wohne nicht sehr weit und könne uns doch nicht hören, wenn wir nicht auf die hohen Berge stiegen, um mit ihm zu sprechen.
Meine Frage an Freitag, ob er denn selbst jemals dahin gegangen sei, um mit Benamuckee zu sprechen, verneinte er. Denn nie gingen junge Männer dahin, sondern nur die alten Leute, welche bei ihnen Oowokakee hießen. Dies waren, wie ich aus meinem Gefährten endlich herausbrachte, die Priester seines Volkes. Sie gingen, sagte er, dorthin, um» O «zu sagen (so bezeichnete er das Beten), und wenn sie zurückgekehrt seien, berichteten sie, was Benamuckee gesagt habe. Hierdurch erfuhr ich, daß sich sogar unter den unwissendsten Götzendienern der Welt eine Priesterkaste findet, und daß die kluge Politik, aus der Religion ein Geheimniß zu machen, um der Geistlichkeit die Verehrung des Volkes zu erhalten, sich nicht nur in der katholischen, sondern vielleicht in allen Religionen der Welt und sogar bei den rohesten und wildesten Barbaren findet.
Ich bemühte mich, Freitag über dieses Verhältniß aufzuklären, und sagte ihm, das Ersteigen der Berge durch die alten Männer unter dem Vorgeben, daß sie dort» O «zu ihrem Gotte Benamuckee sagen wollten, sei Betrug, noch mehr aber die Antwort, die sie angeblich von ihm zurückbrächten. Wenn sie überhaupt eine Antwort erhielten oder mit Jemandem dort oben sprächen, so könne das nur ein böser Geist sein. Hierauf vertiefte ich mich in ein langes Gespräch mit Freitag über den Teufel und seinen Ursprung, über seine Auflehnung gegen Gott und seine Feindschaft gegen den Menschen, sowie über die Ursache dieser Feindschaft. Ich theilte meinem Zögling mit, daß der Satan in den dunkeln Regionen der Welt hause, um sich statt Gottes anbeten zu lassen, mit wie vielfacher List er die Menschheit zu verderben suche, wie er geheime Wege zu unsern Leidenschaften und Vergnügungen habe, und daß er seine Schlingen gerade an diesen befestige, um uns durch unsere eigene Wahl zu vernichten.
Es ergab sich hierbei, daß Freitag weniger leicht die Mittheilungen über den Teufel als die früheren über Gott faßte. Die Natur selbst lieferte ihm die evidenten Beweise für die Nothwendigkeit einer großen ersten Ursache der Dinge, einer Alles lenkenden Gewalt, einer geheimen regierenden Vorsehung, und dafür, daß es billig und recht sei, diesem Wesen Verehrung zu zollen. Nichts dergleichen aber stand der Lehre von einem bösen Geiste zur Seite, von dessen Entstehung und Wesen, vor Allem aber von seiner Neigung zum Bösen selbst. Der arme Wilde trieb mich durch seine natürlichen und unschuldigen Fragen so in die Enge, daß ich ihm oft kaum zu antworten wußte.
Ich hatte ihm viel von Gottes Allmacht und seinem furchtbaren Widerwillen gegen die Sünde erzählt und mich darüber ausgelassen, wie Derjenige, welcher uns Alle geschaffen habe, uns und die ganze Welt auch in einem Augenblicke wieder zerstören könne, und dies Alles hatte Freitag mit großer Aufmerksamkeit und vollem Verständniß angehört. Hierauf sprach ich davon, daß der Teufel Gottes Feind im Menschenherzen sei, daß er seine ganze Bosheit und Geschicklichkeit anwende, um die guten Absichten der Vorsehung zu kreuzen und das Reich Christi auf Erden zu vernichten.»Wie?«unterbrach mich Freitag:»du doch sagst, Gott so stark, so groß sein, ist er denn nicht stärker viel und mächtiger als der Teufel?«—»Gewiß«, erwiederte ich,»Gott ist stärker als der Teufel, und deshalb beten wir zu Gott, daß er Jenen unter seine Füße trete, und uns stärke, seinen Versuchungen zu widerstehen, und daß seine fürchterlichen Pfeile von uns abprallen mögen.«
«Aber«, entgegnete Freitag,»wenn Gott ist so viel mächtiger als der Teufel, warum nicht todt ihn macht er, so daß er nicht kann schaden mehr?«
Diese Frage verdutzte mich ungemein. Zwar war ich ein Mann bei Jahren, aber nur ein sehr junger Doctor, schlecht befähigt zum Casuisten und zur Entwirrung verwickelter Fragen. Anfangs stellte ich mich, als ob ich Freitag nicht verstanden, und fragte ihn, was er eigentlich gesagt habe. Allein er war zu begierig auf eine Antwort, um sich seiner Frage nicht noch zu erinnern, und wiederholte sie alsbald in demselben gebrochenen Englisch. Inzwischen hatte ich mich ein wenig gesammelt und erwiederte:»Gott wird schließlich den Teufel schwer bestrafen, er hat ihn sich aufgespart für den jüngsten Tag, dann wird Satan in die Tiefe des Abgrundes geworfen werden, um immerdar im Feuer zu brennen«.
Hierdurch aber war Freitag keineswegs befriedigt.»Er sich ihn aufgespart für den jüngsten Tag«— wiederholte er kopfschüttelnd —»das ich nicht kann verstehen. Warum nicht todt macht er gleich Teufel? Warum so viel später?«
«Du kannst mich ebenso gut fragen«, antwortete ich,»warum Gott nicht dich und mich tödtet, wenn wir durch unsre Sünden ihn erzürnen. Wir werden eben erhalten, damit wir Buße thun und Gnade finden sollen.«
Freitag sann eine Weile nach.»Ah so!«entgegnete er sehr lebhaft,»also du, ich, Teufel, schlechte Alle aufbewahrt werden, Buße thun, Gott Allen verzeihen.«
Hier fühlte ich mich wiederum aus der Fassung gebracht. Ich erkannte jetzt deutlich, daß das natürliche Geistesvermögen vernünftige Geschöpfe zwar zu der Erkenntniß Gottes und der Verpflichtung, ihn als höchstes Wesen anzubeten, führen könne, daß aber nur göttliche Offenbarung uns zum Wissen von Jesu Christo, der durch ihn uns erkauften Erlösung und seiner Mittlerschaft zu bringen vermöge, sowie daß das Evangelium unsres Herrn und Heilands und der heilige Geist, der uns als ein Führer und Heiligmacher verheißen ist, die unumgänglich nöthigen Lehrer der Menschenseele über die Mittel zu unsrer Erlösung sind.
In dieser Ueberzeugung brach ich das damalige Gespräch zwischen mir und meinem Diener ab und entfernte mich eilig. Nachdem ich ihn zur Besorgung eines Auftrags an einen entlegenen Ort geschickt hatte, betete ich brünstig zu Gott, daß er mir die Kraft verleihen möge, diesen armen Wilden in der Heilslehre zu unterweisen, und daß er mit seinem Geiste mir beistehe, damit das Herz des armen unwissenden Menschen das Wissen von Gott und Christo aufnehme, und daß ich von Gottes Wort so reden könne, um den Wilden zu überzeugen, ihm die Augen zu öffnen und seine Seele zu retten.
Als Freitag zurückgekehrt war, hielt ich abermals ein langes Gespräch mit ihm. Ich sprach zu ihm von der Erlösung durch den Heiland der Welt und von dem himmlischen Evangelium, das uns Buße gegen Gott und Glauben an unsern Herrn Jesus Christus predige. Dann machte ich ihm so deutlich als möglich, warum unser Erlöser Knechtsgestalt angenommen und gekommen sei, die verirrten Schafe aus dem Hause Israel wiederzusuchen und dergleichen mehr.
Gott weiß, daß mehr guter Wille als Verstand in meiner Lehrmethode zum Vorschein kam. Ich muß eingestehen (und ein Gleiches werden wohl Alle, die in ähnliche Lage gerathen, von sich zu bekennen haben), daß ich erst durch das Lehren viele Dinge, die ich bisher entweder selbst nicht gewußt, oder wenigstens nicht genügend durchdacht hatte, lernte. Ich forschte jetzt mit mehr Eifer nach dem Wesen der Dinge als je zuvor, und so gab mir dieser arme Wilde, auch abgesehen von allen sonstigen Vortheilen, die ich durch ihn hatte, schon in dieser Hinsicht Anlaß zur Dankbarkeit. Mein Kummer lastete mir jetzt minder schwer auf dem Herzen und meine Behausung war mir jetzt über alle Maßen traulich geworden. Wenn ich bedachte, daß mein einsames Leben nicht nur mich selbst dazu gebracht hatte, zum Himmel aufblickend die Hand, die mich hierhergeführt, zu suchen, sondern daß ich jetzt auch das Werkzeug der Vorsehung geworden war zur Errettung des Lebens und der Seele eines armen Wilden und zu fernerer Unterweisung in der christlichen Wahrheit —, wenn ich an dieses Alles dachte, so erfüllte mir eine tiefinnerliche Freude die ganze Seele und ich jauchzte oft im Herzen darüber, daß ich auf diese Insel verschlagen worden war, während ich sonst in dieser Fügung die furchtbarste Trübsal, die mir hätte widerfahren können, erblicken zu müssen geglaubt hatte.
Diese dankbare Gemüthsstimmung dauerte von jetzt an in mir fort, und die Gespräche zwischen Freitag und mir machten die drei Jahre, die wir noch zusammenlebten, zu so vollkommen glücklichen, wie sie unter dem Monde überhaupt möglich sind. Mein Diener wurde ein guter Christ, ein besserer, als ich selbst war, obwohl ich, Gott sei Lob dafür, hoffen darf, daß wir Beide in gleichem Maße bußfertige und begnadigte Sünder waren. Wir hatten das Wort Gottes bei uns und waren von seinem Geiste, der uns unterwies, hier nicht weiter entfernt, als wenn wir in England selbst gelebt hätten. Ich gab mir Mühe, daß Freitag die heilige Schrift so gut verstehen lernte, als ich sie verstand, und er wiederum bewirkte durch seine bedeutsamen Fragen, daß ich viel besser in den Geist der Bibel eindrang, als es durch bloßes Lesen für mich möglich gewesen wäre.
An dieser Stelle kann ich nicht umhin, eine Erfahrung, die ich in jener einsamen Zeit meines Lebens machte, auszusprechen. Nämlich die: Es ist ein unaussprechlicher Segen darin gelegen, daß die Lehre von Gott und der Erlösung durch Jesum Christum, wie sie Gottes Wort enthält, so deutlich und klar ausgesprochen ist. Das bloße Lesen in der Schrift unterwies mich hinlänglich über meine Pflicht, das große Werk der aufrichtigen Buße zu beginnen, und dieselbe einfache Unterweisung reichte auch aus, um jene arme wilde Kreatur zu erleuchten und zu einem so wahrhaft christlich gesinnten Menschen zu machen, wie ich nur wenige im Leben gekannt habe.
Alle Streitigkeiten, Controversen und Zänkereien, welche in der Welt um die Religion gestritten sind, sei es in Bezug auf Spitzfindigkeiten der Lehre oder um das kirchliche Regiment, waren für uns unnütz, wie sie es überhaupt, so viel ich sehe, von je her für die ganze Welt gewesen sind. Wir hatten den einzigen sichern Führer zum Himmel, das Wort Gottes, und es fehlte uns, dem Herrn sei es gedankt, auch nicht der Beistand des heiligen Geistes, der in alle Wahrheit leitet und uns dem göttlichen Gesetz willig und gehorsam macht. Daher wüßte ich nicht zu sagen, was uns auch die gereifte Kenntniß über die strittigen Punkte in der Religion, die in der Welt so viel Verwirrung angerichtet haben, hätte nützen können. Doch ich habe jetzt den Faden meiner Geschichte wieder aufzunehmen.
Nachdem ich mit Freitag genau bekannt geworden war, und er fast Alles, was ich sagte, verstehen, auch geläufig, wenn auch nur in gebrochenem Englisch sprechen konnte, machte ich ihn mit meiner eigenen Geschichte bekannt, wenigstens mit dem, was sich auf meinen Aufenthalt auf der Insel bezog. Ich erzählte ihm, wie lange und in welcher Weise ich dort bisher gelebt hatte, weihte ihn in das Geheimniß der Anwendung von Pulver und Blei ein und lehrte ihn mit Schießwaffen umzugehen. Ich gab ihm auch ein Messer, worüber er sich ungemein freute, und fertigte ihm einen Gürtel an, an welchem ich eine Scheide befestigte, wie man sie in England für die Jagdmesser hat. An die Stelle eines solchen steckte ich ihm ein Beil hinein, das nicht nur eine gute Waffe, sondern auch für andere Gelegenheiten ein vortreffliches Werkzeug war.
Auch eine Beschreibung der europäischen Länder, besonders meiner Heimat England, gab ich ihm. Ich erzählte ihm, wie man dort lebt, Gott verehrt und gesellig mit einander verkehrt, schilderte ihm den englischen Welthandel und gab eine Beschreibung des zertrümmerten Schiffes, an dessen Bord ich gewesen war, und zeigte ihm auch die Stelle, wo es gelegen hatte. Ich wies ihm die Trümmer unsres Boots, in dem wir das Schiff verlassen, und das ich mit allen meinen Kräften nicht hatte von der Stelle bringen können. Jetzt war es ganz in Trümmer zerfallen. Bei dem Anblick der Ueberreste dieses Boots stand Freitag eine lange Weile schweigend und sinnend da. Auf meine Frage, worüber er nachdenke, antwortete er endlich:»Ich gesehen Boot, ein solches kommen an Ort meines Volkes«. Anfangs verstand ich ihn nicht. Endlich brachte ich durch weitere Fragen heraus, daß einst ein ähnliches Fahrzeug an die Küste seiner Heimat gelangt, das heißt durch den Sturm dahin getrieben sei. Wiewohl ich hieraus entnahm, daß ein europäisches Schiff an jenen Küsten gescheitert und ein davon losgerissenes Boot an den Strand geworfen sein müsse, fiel mir doch nicht ein zu fragen, ob denn auch Menschen von jenem Schiffe sich dorthin gerettet hätten und wohin sie gekommen seien. Vielmehr begnügte ich mich für jetzt damit, mir das Boot beschreiben zu lassen.
Freitag that dies verständlich genug. Mit einiger Wärme fügte er hinzu:»Wir weiße Männer vor Ertrinken gerettet haben«. Sofort fragte ich, ob sich denn in jenem Boote weiße Männer befunden hätten.»Ja«, erwiederte er,»Boot voll weiße Mann. «Als ich ihn nach der Anzahl derselben gefragt, zählte er an seinen Fingern siebzehn ab, und auf meine fernere Frage, was aus ihnen geworden, antwortete er:»Sie leben, wohnen bei mein Volk«.
Dies gab mir wiederum Mancherlei zu erwägen. Zunächst kam mir der Gedanke, diese Leute hätten zu dem Schiff gehört, welches im Angesicht meiner Insel (denn ich betrachtete sie jetzt als mein Eigenthum) gescheitert war. Ich dachte mir, sie hätten sich wohl, nachdem das Schiff am Felsen zertrümmert und von ihnen aufgegeben war, in dem Boot gerettet und seien an jener Insel unter den Wilden gelandet.
Als ich demzufolge eindringlicher danach gefragt hatte, was aus jenen Leuten geworden sei, versicherte Freitag, sie wären noch am Leben, hielten sich schon über vier Jahre bei seinen Landsleuten auf, und würden von diesen ganz in Frieden gelassen und mit Lebensmitteln versehen. Auf meine Frage, wie es denn geschehen sei, daß man sie nicht getödtet und gefressen habe, erwiederte er:»Nein, sie geworden Brüder von uns«. Ich verstand das so, daß man mit ihnen ein Bündniß geschlossen habe. Freitag fügte noch hinzu:»Mein Volk nicht essen Mensch, wenn nicht sie gefangen in Schlacht«.
Geraume Zeit nach diesem Gespräch befanden wir uns eines Tages auf dem Gipfel jenes Hügels an der Ostseite der Insel, von dem aus ich, wie früher erwähnt, an einem hellen Tage das Festland von Amerika entdeckt hatte. Das Wetter war sehr heiter. Freitag schaute aufmerksam nach dem Festlande hin, und plötzlich fing er an zu springen und zu tanzen und rief mich, da ich etwas entfernt von ihm stand, herbei. Ich fragte ihn, was es gäbe.»O Freude«, antwortete er,»dort ich sehe mein Land, dort wohnen mein Volk!«
Sein Gesicht glänzte dabei vor Lust, seine Augen funkelten und eine seltsame Begierde zeigte sich in seinen Mienen, als ob es ihn innig verlange, wieder in der Heimat zu sein. Diese Beobachtung machte mich nachdenklich und ließ mich nicht mehr so ruhig wie sonst in Bezug auf Freitag sein. Ich bezweifelte nicht, daß dieser, wenn er wieder zu seinem Volke zurückgekehrt sei, nicht nur seine ganze Religion, sondern auch alles Andere, was er mir dankte, vergessen und sogar sich so weit verirren würde, mit einer ganzen Menge seiner Landsleute hierher zurückzukehren, mich zu einer Mahlzeit zu verwenden und dabei vermutlich gerade so vergnügt zu sein als bei der Verschmausung der im Kriege gefangenen Feinde. Jedoch that ich mit solchem Verdacht dem armen Burschen großes Unrecht, wie ich später zu meinem Leidwesen eingesehen habe. Einige Wochen hindurch war ich in Folge meiner wachsenden Besorgniß vorsichtiger in Bezug auf ihn und nicht so freundlich und herzlich als früher, während doch die gute Seele in der That auch nicht einen Gedanken hegte, der sich nicht mit den strengsten Grundsätzen des Christentums und der Freundschaft und Dankbarkeit vertragen hätte.
So lange mein Verdacht gegen ihn währte, nahm ich ihn natürlich alle Tage scharf aufs Korn, um zu sehen, ob ihn wirklich die Gedanken, die ich bei ihm vermuthete, erfüllten. Da aber Alles, was er sagte, die treuherzigste Unschuld bezeugte, und da ich auch gar Nichts fand, was mein Mißtrauen hätte nähren können, gewann er mich endlich wieder ganz und gar. Er hatte übrigens nicht im Mindesten meine Unruhe bemerkt, und so konnte ich sicher sein, daß er mich nicht betrog.
Eines Tages, als wir bei nebeligem Wetter, welches unseren Blicken den Kontinent verhüllte, auf demselben Hügel standen, fragte ich Freitag:»Hast du nicht Lust wieder in deinem Lande und bei deinem Volke zu sein?«—»Ja«, erwiederte er,»ich viel froh sein würde, bei eigenem Volke zu sein.«—»Was würdest du dort machen?«fuhr ich fort;»wolltest du wieder ein Wilder werden, Menschenfleisch essen und als ein so wilder Mensch leben wie früher?«— Er sah nachdenklich vor sich hin, schüttelte den Kopf und antwortete:»Nein, nein, Freitag ihnen sagen würde, gut leben sollen, Gott anbeten, lehren ihnen essen Kornbrod, Fleisch von Ziegen, Milch, nicht essen Mensch wieder«.
«Aber«, entgegnete ich,»dann werden sie dich ja tödten!«Mit ernsthafter Miene erwiederte er:»Nein, sie nicht mich tödten, gern lernen wollen«. Er fügte hinzu, daß seine Landsleute auch schon Viel von den bärtigen Männern, die in jenem Boote gekommen seien, gelernt hätten. Als ich ihn hierauf fragte, ob er wieder zu den Seinigen zurückkehren wolle, antwortete er lächelnd, so weit könne er nicht schwimmen.»Ich will«, entgegnete ich,»dir ein Canoe anfertigen. «Ja, wenn ich mit ihm gehen würde, erwiederte er, dann wollte er heimkehren. Darauf ich:»Ich soll wirklich nach deinem Vaterlande gehen, um mich dort fressen zu lassen?«—»Nein, nein«, lautete seine Antwort,»ich nicht fressen lassen dich, ich machen werde, daß sie haben dich lieb. «Er meinte damit, daß er ihnen erzählen wollte, wie ich seine Feinde getödtet und ihm das Leben gerettet habe. Dann erzählte er, wie freundlich jene siebzehn weißen Männer, die Bartmänner, wie er sie nannte, bei seinem Volke behandelt wurden, nachdem sie durch Unglück an jenen Strand gerathen seien.
Seit dieser Zeit fühlte ich, wie ich nicht verhehlen will, Lust, die Ueberfahrt zu wagen, um mich wo möglich mit jenen bärtigen Männern, die, wie ich nicht zweifelte, Spanier oder Portugiesen waren, zu vereinigen. Es schien mir leicht, von dort aus, wenn ich erst auf dem Festlande und in civilisirter Gesellschaft sei, heimzukehren, wenigstens leichter als von hier aus, wo ich allein und hülflos auf einer vierzig Meilen vom Festland gelegenen Insel hauste.
Einige Tage später eröffnete ich mit Freitag wiederum ein auf denselben Plan bezügliches Gespräch. Ich versprach ihm ein Boot zu geben, damit er zu seinem Volke heimkehren könne. Dann führte ich ihn zu meinem Canoe, das auf der anderen Seite der Insel lag, zeigte es ihm, nachdem ich es vom Wasser befreit hatte (denn der Vorsicht wegen hatte ich es versenkt gehabt), und setzte mich mit ihm hinein. Freitag zeigte sich sofort sehr geschickt im Steuern und Rudern und brachte es fast so rasch von der Stelle wie ich.
Als wir uns in das Boot gesetzt hatten, sagte ich:»Nun, Freitag, wie ist's, wollen wir jetzt nach deinem Vaterland fahren?«Er machte ein sehr bedenkliches Gesicht und schien das Fahrzeug für eine so weite Reise zu klein zu finden. Hierauf theilte ich ihm mit, daß ich noch ein größeres besitze, und begab mich am nächsten Tag mit ihm an den Ort, wo das von mir zuerst gebaute Boot lag, das ich nicht hatte ins Wasser bringen können. Dieses sei, sagte Freitag, groß genug. Es war aber, da ich mich fast dreiundzwanzig Jahre lang nicht darum bekümmert hatte, von der Sonne so ausgedörrt, daß es Sprünge bekommen hatte und beinahe verfault war. Freitag versicherte mich, mit solch einem Boot lasse sich die Ueberfahrt ausführen, es würde» viel genug Trunk und Brod tragen«, wie er sich ausdrückte.
Seit dieser Zeit war ich wirklich entschlossen, mit Freitag nach dem Kontinent zu schiffen. Ich theilte ihm mit, daß wir uns ein ebenso großes Boot bauen wollten, um darin in sein Vaterland reisen zu können. Er erwiederte kein Wort und schaute ernst und traurig vor sich hin. Auf meine Frage, was das bedeuten solle, erwiederte er:»Warum du böse sein Freitag? Was haben ich gethan?«— Ich versicherte ihm, daß ich ihm nicht böse sei.»Nicht böse? Nicht böse?«wiederholte er mehre Male;»warum dann schicken Freitag zu meinem Volke?«—»Wie«, sagte ich,»hast du nicht selbst gewünscht dort zu sein?«—»Ja, ja«, entgegnete er,»ich wünschen, da zu sein alle Beide, nicht wünschen, da zu sein Freitag allein, nicht wünschen, da zu sein Herr allein.«
Kurz, er wollte Nichts vom Alleingehn wissen. Als ich die Frage an ihn gerichtet:»Freitag, was soll denn ich dort thun?«versetzte er rasch:»Du dort thun viel Gutes. Du lehren wilde Männer gut sein, nüchtern und vernünftig, du sie lehren Gott kennen, zu ihm beten und ein neues Leben anfangen«. —»Ach«, erwiederte ich,»Freitag, du weißt nicht, was du sagst, ich bin selbst nur ein armer, unwissender Mensch.«»Nein, nein«, entgegnete er,»du mich gelehrt hast Gutes, du sie auch lehren Gutes.«—»Nein, Freitag«, erwiederte ich,»du sollst ohne mich reisen. Laß mich hier mein einsames Leben fortführen wie früher.«
Bei diesen Worten sah er mich betroffen an, rannte fort, ergriff eines der Beile, die er gewöhnlich bei sich trug, kam zurück und gab es mir.»Was soll ich damit?«fragte ich.»Du todt machen Freitag«, antwortete er.»Weshalb soll ich dich denn tödten?«—»Weil du fortschicken wollen Freitag. Besser todt machen Freitag als wegschicken. «Er sagte dies sehr ernsthaft und mit Thränen in den Augen. So wurde ich von seiner großen Liebe und Festigkeit aufs Neue überzeugt und versicherte ihn deshalb jetzt und später noch oft, daß ich ihn nie von mir lassen werde, wenn er bei mir bleiben wolle.
Wie mir diese ganze Unterredung seine innige Liebe zu mir und seinen Entschluß, sich nie von mir zu trennen, bewiesen hatte, so erkannte ich jetzt auch, daß sein Verlangen ins Vaterland heimzukehren lediglich in der heißen Liebe zu seinem Volk und seiner Hoffnung, daß ich diesem Gutes thun werde, begründet war. Da nun meine Fluchtgedanken in den Unterredungen mit Freitag durch das, was er mir von den siebzehn weißen Männern erzählte, immer mehr genährt waren, machte ich mich mit ihm ohne Verzug ans Werk und spähte nach einem starken Baum, den ich fällen wollte, um daraus ein großes Canoe für unsre Reise zu bauen.
Es gab Bäume genug auf der Insel, um daraus eine kleine Flotte, und zwar nicht nur von Kähnen, sondern sogar von ziemlich großen Fahrzeugen erbauen zu können. Mein Hauptaugenmerk aber war darauf gerichtet, einen Baum in möglichster Nähe des Wassers zu finden, damit wir das Boot leicht flott zu machen vermöchten und nicht den früher begangenen Fehler wiederholten.
Endlich entdeckte Freitag, der viel mehr Holzkenntniß als ich besaß, einen geeigneten Baum; wie er hieß, weiß ich bis auf diesen Tag nicht anzugeben. Das Holz glich dem, welches wir Gelbholz nennen, und ähnelte dem Nicaraguaholz in Farbe und Geruch. Freitag schlug vor, den Baum durch Ausbrennen auszuhöhlen, ich zeigte ihm aber, wie das besser mit Werkzeugen zu bewerkstelligen sei, mit denen er dann auch sehr geschickt hantierte. Nach Ablauf eines Monats harter Arbeit war das Werk vollendet. Das Ding nahm sich sehr hübsch aus, besonders nachdem wir mit den Aexten, deren Gebrauch ich Freitag gelehrt hatte, die Außenseite des Baumes in wirkliche Bootsgestalt gebracht hatten. Hierauf brauchten wir jedoch noch vierzehn Tage, um es, so zu sagen, Zoll für Zoll, auf großen Walzen ins Wasser zu bringen. Als es flott war, erkannten wir, daß das Boot mit Leichtigkeit zwanzig Mann zu tragen vermochte.
Nicht wenig überraschte es mich zu sehen, wie geschickt und rasch Freitag das große Fahrzeug im Wasser zu bewegen und zu lenken verstand. Auf meine Frage, ob wir wohl darin die Ueberfahrt wagen dürften, sagte er:»Ja, wir können wagen recht gut, wenn auch weht großer Wind«. Meine weitere Absicht ging nun darauf, einen Mastbaum und ein Segel anzufertigen und das Boot mit Anker und Tau zu versehen. Ein Mast war leicht genug zu bekommen. Ich wählte mir eine schlanke junge Ceder, die sich in der Nähe befand, aus, denn an solchen Bäumen war auf der Insel Ueberfluß. Freitag mußte sich daran machen, sie zu fällen, und ich beschied ihn, welche Gestalt sie haben müsse. Die Sorge für das Segel mußte ich selbst übernehmen. Ich wußte, daß ich alte Segel oder wenigstens Segelstücke in Menge hatte. Da sie aber jetzt bereits sechsundzwanzig Jahre unbenutzt gelegen, und ich sie nicht sehr sorgsam aufbewahrt hatte, weil mir nie der Gedanke gekommen war, sie je gebrauchen zu können, glaubte ich, sie seien sämmtlich verfault. Mit den meisten war dies auch der Fall. Jedoch fand ich zwei noch leidlich aussehende Stücke, machte mich an die Arbeit und brachte mit großer Mühe und durch natürlich sehr langsame und plumpe Näherei (denn ich hatte ja keine Nadeln) endlich ein dreieckiges mißförmiges Ding heraus, das der Gestalt nach der Art ähnelte, die wir in England ein Hammelsbugsegel nennen. Man benutzt diese mit einem Segelbaum am unteren Ende und einem kleinen kurzen Spriet am oberen. Mit einem solchen Segel wußte ich am besten umzugehen, weil sich ein derartiges, wie ich früher erzählte, in dem Schiffe befunden hatte, in welchem ich von der afrikanischen Küste geflohen war.
Die letztere Arbeit (nämlich die Anfertigung des Mastes und der Segel) nahm noch fast zwei weitere Monate in Anspruch. Ich vervollständigte mein Werk, indem ich noch ein kleines Fock und ein Besansegel hinzufügte, für den Fall, daß wir gegen den Wind gingen. Vor Allem aber brachte ich ein Steuerruder am Sterne des Schiffes an. Ich war zwar nur ein Dilettant in Schiffsbauangelegenheiten, aber da ich den Nutzen und sogar die Nothwendigkeit eines solchen Dinges kannte, gab ich mir die größte Mühe und brachte es endlich auch leidlich zu Stande. In Folge der vielen fehlgeschlagenen Versuche aber kostete mich diese Arbeit, glaube ich, fast ebenso viel Anstrengung als die Erbauung des Boots selbst.
Nachdem dies Alles vollbracht war, hatte ich zunächst noch Freitag in der Lenkung des Boots zu unterweisen. Denn obwohl er sehr gut mit einem Canoe umzugehen verstand, wußte er doch Nichts von allem, was zum Segeln und Steuern gehört. Er staunte nicht wenig, als er mich das Boot hier- und dahin mit dem Steuer lenken und das Segel, je nach der Richtung, die wir einschlugen, sich blähen sah, und stand ganz verdutzt und überrascht dabei. Jedoch durch ein wenig Uebung machte ich ihn mit all diesen Dingen vertraut, und er wurde bald ein ganz geschickter Matrose, nur daß er vom Gebrauch des Kompasses keinen rechten Begriff erlangen konnte. Uebrigens war auch, da der Himmel in diesem Klima selten umnebelt und das Wetter nicht oft trübe ist, der Gebrauch jenes Hülfsmittels nur selten geboten. Man konnte sich des Nachts immer nach den Sternen richten, und des Tags sah man ja stets die Küste, ausgenommen während der Regenzeit, in welcher aber auch Niemand Lust haben konnte, sich auf das Meer zu wagen.
Ich hatte jetzt das siebenundzwanzigste Jahr meiner Gefangenschaft angetreten. Unter dieser Benennung darf ich freilich die letzten drei Jahre, in denen ich ein menschliches Wesen zur Gesellschaft gehabt hatte, eigentlich nicht mitbegreifen, denn während dieser Zeit war meine ganze Lebensweise eine völlig andere gewesen als sonst. Ich feierte den Jahrestag meiner Landung mit demselben Dankgefühl gegen Gott wie die früheren, ja die Empfindung der Dankbarkeit war jetzt in mir noch um Vieles höher als ehedem, da mir ja so viel neue Zeugnisse der göttlichen Fürsorge für mich zu Theil geworden waren, und ich sogar große Hoffnung auf wirkliche und baldige Erlösung gefaßt hatte. Denn es hatte sich jetzt in mir der unbewegliche Glaube festgesetzt, daß meine Befreiung nahe sei, und daß ich kein ganzes Jahr mehr an diesem Ort verbringen werde. Trotzdem aber versäumte ich mein Hauswesen darum keineswegs. Ich fuhr fort zu graben, zu pflanzen, meine Einzäunung zu pflegen, sammelte meine Trauben und that alles Nothwendige wie früher. Während der Regenzeit war ich natürlich gezwungen, mich mehr in meiner Wohnung zu halten. Unser Fahrzeug hatten wir so sicher als möglich in jener Bucht geborgen, die mir früher zum Landungsplatz für meine Flöße gedient hatte. Ich ließ das Boot bei der Flut auf das Land treiben und befahl Freitag ein kleines Dock zu graben, das groß genug war, um es zu fassen, und tief genug, daß es darin in Wasser schwimmen konnte. Dann zog ich während der Ebbe am Eingang des Docks einen festen Damm, um das Wasser abzuhalten, und so lag das Boot auch zur Flutzeit außerhalb der See. Um den Regen abzuhalten, legten wir eine Menge Zweige darüber, bis es so dicht wie ein Haus gedeckt war. Hierauf harrten wir ruhig dem November und Dezember entgegen, für welche Zeit ich die Ausführung unseres Planes beschlossen hatte.
Sobald die gute Jahreszeit wiedergekehrt war, betrieben wir täglich die Vorbereitungen zur Reise, und vor Allem legte ich eine Anzahl Lebensmittel als Proviant für die Fahrt zurück. Es war meine Absicht, nach ein oder zwei Wochen das Dock zu öffnen und das Boot auslaufen zu lassen.
Eines Morgens war ich gerade wieder mit jenen Vorkehrungen beschäftigt und hatte Freitag an den Strand geschickt, um eine Schildkröte zu suchen, denn eine solche verschafften wir uns jede Woche, um sowohl die Eier als auch das Fleisch zu genießen. Da auf einmal kehrte mein Gefährte, nachdem er sich noch nicht lange entfernt hatte, schleunigst zurück und kletterte so schnell über meine äußere Palissadenwand, als hätten seine Füße nicht die Erde berührt. Noch ehe ich ein Wort sprechen konnte, rief er mir zu:»O Herr, o Herr, o weh, o weh!«
Ich fragte:»Was gibt's denn?«—»O, dort, dort«, erwiederte er,»eins, zwei, drei Canoe, eins, zwei, drei. «Ich schloß daraus, es wären sechs, brachte aber durch erneuerte Fragen heraus, daß es nur drei seien.»Ruhig Blut, Freitag«, sagte ich und ermuthigte ihn, so gut ich vermochte. Der arme Bursch aber verharrte in seinem Entsetzen, denn er hatte sich fest in den Kopf gesetzt, die Wilden seien nur deshalb gekommen, um ihn zu suchen, zu schlachten und aufzufressen. Er zitterte so, daß ich nicht wußte, was ich mit ihm anfangen sollte.
Ich suchte ihn durch die Bemerkung zu trösten, daß ich ja in gleicher Gefahr wie er sei, und daß sie mich gerade so fressen würden wie ihn, daß wir aber uns muthig unserer Haut wehren wollten.»Bist du dazu Willens, Freitag?«fragte ich. — »Ich sie schießen werde«, antwortete er.»Aber dann wird kommen große Menge.«—»Das thut Nichts«, entgegnete ich.»Unsere Flinten werden die, welche wir nicht tödten, erschrecken. «Hierauf fragte ich, ob er, wenn ich ihm beistehen wolle, auch mich vertheidigen und Alles thun werde, was ich ihn heiße. Er antwortete:»Ich sterben, wenn du gebietest es, Herr«.
Darauf holte ich ihm einen tüchtigen Schluck Rum; denn ich hatte mit meinen Getränken so gut hausgehalten, daß mir noch ein hübsch Theil davon übrig geblieben war. Als er getrunken, befahl ich ihm, die zwei Vogelflinten, die wir gewöhnlich bei uns trugen, mit grobem Schrot (es war etwa so stark wie kleine Pistolenkugeln) zu laden. Ich selbst lud vier Musketen, jede mit fünf großen und zwei kleinen Kugeln, und jede meiner zwei Pistolen mit zwei Kugeln. An meine Seite hing ich wie gewöhnlich meinen großen Säbel ohne Scheide, und Freitag erhielt noch sein Beil zur Ausrüstung. Nachdem wir uns so bewaffnet, ergriff ich mein Fernglas und ging den Hügel hinauf, um zu sehen, ob ich von dort aus eine Wahrnehmung machen könnte. Da sah ich denn bald, daß sich nicht weniger als neunundzwanzig Wilde, drei Gefangene und drei Canoes eingefunden hatten. Ein Triumphfest über diese drei armen Geschöpfe schien der einzige Zweck der Gäste zu sein. Die Wilden waren, wie ich bemerkte, diesmal nicht an jener Stelle, von der aus Freitag die Flucht ergriffen hatte, sondern näher an meiner Bucht gelandet, wo die Küste niedrig war und von wo aus sich ein dichtes Gehölz fast bis unmittelbar an die See erstreckte. Der Schauder vor der unmenschlichen Absicht, in welcher die Elenden gekommen waren, erfüllte mich mit solcher Entrüstung, daß ich zu Freitag herabstieg und ihm ankündigte, ich sei entschlossen, die Wilden zu überfallen und sie sämmtlich zu tödten. Nachdem ich meinen Gefährten gefragt, ob er mir dabei Hülfe leisten wolle, versicherte er, der jetzt wieder einigermaßen zu sich gekommen und durch den Rum gestärkt war, mit heiterer Miene, er würde sofort in den Tod gehen, wenn ich es gebiete.
In dieser erbitterten Stimmung theilte ich nun die geladenen Waffen mit meinem Gefährten. Freitag erhielt eine Pistole, um sie in den Gürtel zu stecken, und drei Flinten, die er über die Schulter nehmen sollte. Ich nahm gleichfalls eine Pistole und die andern drei Gewehre, und so gerüstet zogen wir aus. Ich hatte eine kleine Flasche mit Rum zu mir gesteckt und Freitag einen großen Beutel mit Pulver und Kugeln eingehändigt. Er wurde angewiesen, sich dicht hinter mir zu halten, keine Bewegung zu machen und nicht eher zu schießen, bis ich es ihn geheißen, auch kein Wort laut werden zu lassen. Hierauf begaben wir uns in einem Umweg von ungefähr einer Meile nach der rechten Seite der Insel, um innerhalb des Gehölzes die Bucht zu überschreiten und auf Schußweite zu den Cannibalen heranzukommen, ehe sie uns entdeckten. Mein Fernglas hatte mir nämlich gezeigt, daß das leicht zu bewerkstelligen sei.
Unterwegs kehrten meine früheren Bedenken zurück, so daß meine Entschlossenheit einigermaßen gedämpft wurde. Nicht als ob ich mich vor der Ueberzahl gefürchtet hätte; den nackten, waffenlosen Menschen war ich, obwohl nur ein Einzelner, jedenfalls überlegen. Aber ich fragte mich, woher ich den Beruf, den Anlaß, oder gar die Verpflichtung habe, meine Hände in Blut zu tauchen und Menschen anzugreifen, die mir nie etwas zu Leide gethan hätten und vielleicht gar nicht daran dächten, mir Böses zu thun. Gegen mich hatten sie ja Nichts verbrochen, ihre barbarischen Gebräuche waren Unglück genug für sie selbst. Gott hatte sie mit den übrigen Bewohnern dieser Weltgegend in solcher Unvernunft und in so unmenschlichen Sitten gelassen, und ich war nicht zum Richter über ihre Handlungen und noch weniger zum Vollstrecker des Urtheils berufen. Wenn Gott es an der Zeit halte, sagte ich mir, würde er die Sache schon selbst in die Hand nehmen und sie durch eine allgemeine Züchtigung für ihre Nationalsünden strafen. Mich gehe das Nichts an, während freilich Freitag, als der erklärte Feind der Wilden, der mit ihnen auf dem Kriegsfuß lebte, berechtigt sei, sie anzugreifen. Von mir aber könne das nicht gelten.
Diese Gedanken machten mir während des ganzen Wegs so viel zu schaffen, daß ich endlich beschloß, mich vorläufig nur in die Nähe der Wilden zu begeben, um ihr barbarisches Fest zu beobachten und dann zu handeln, wie Gott mir es eingeben würde. Wenn sich Nichts ereignete, das mir einen entschiedneren Beruf, als ich ihn jetzt hätte, verleihe, wollte ich Nichts mit ihnen zu thun haben.
Mit diesem Entschluß betrat ich in möglichster Stille und mit aller Vorsicht das Gehölz. Freitag folgte mir dicht auf den Fersen. Ich ging bis an den Saum des Waldes auf der den Wilden zunächst gelegenen Seite. Nur ein einziges schmales Stück des Gebüsches trennte mich jetzt noch von ihnen. Ich rief leise Freitag an und gebot ihm, auf einen Baum an der Ecke des Waldes zu steigen und mir zu melden, ob er von dort aus deutlich wahrnehmen könne, was vorgehe. Er kam augenblicklich zurück mit der Nachricht, daß die Wilden von dort sehr gut beobachtet werden könnten; sie säßen alle um ihr Feuer herum und verzehrten das Fleisch eines ihrer Gefangenen; der andere liege in einiger Entfernung gebunden auf dem Sand und würde demnächst an die Reihe des Geschlachtetwerdens kommen.
Diese Nachricht brachte meine ganze Seele aufs Neue in Aufregung. Freitag sagte ferner, der Unglückliche sei keiner seiner Landsleute, sondern einer von den weißen bärtigen Männern, die, wie er mir erzählt, in dem Boote zu ihnen gekommen seien. Die bloßen Worte» weißer bärtiger Mann «machten mich schaudern. Ich erstieg den Baum und bemerkte durch mein Fernglas deutlich einen Mann von weißer Farbe, der auf dem Boden an Händen und Füßen mit Schlinggewächsen gefesselt lag und seiner Kleidung nach ein Europäer sein mußte.
Es befand sich noch ein anderer Baum und ein kleines Gebüsch jenseits desselben, etwa fünfzig Ellen näher bei den Wilden, und es schien möglich, dahin unbemerkt und auf einem kleinen Umweg bis auf halbe Schußweite von den Cannibalen zu gelangen. Wiewohl ich in höchstem Grade aufgeregt war, bezwang ich doch meine Leidenschaftlichkeit, ging einige zwanzig Schritt zurück und gelangte dann hinter fortlaufendem Gebüsch her zu jenem andern Baum. Von hier aus erreichte ich eine kleine Anhöhe, die mir auf ungefähr achtzig Ellen Entfernung völligen Ueberblick gewährte.
Ich hatte jetzt keinen Augenblick mehr zu verlieren. Neunzehn von den furchtbaren Unmenschen saßen dicht gedrängt neben einander und hatten eben zwei andere abgeschickt, um den armen Christen zu schlachten und wahrscheinlich seinen Leib Stück für Stück an das Feuer zu bringen.
Sie beugten sich just nieder, um ihm die Fesseln an den Füßen zu lösen. In diesem Augenblick wandte ich mich zu Freitag.»Jetzt«, rief ich ihm zu,»thue, wie ich dir sage. «Er antwortete, daß er bereit sei.»Mache es genau so«, rief ich ihm zu,»wie ich es dir angebe, und versäume Nichts. «Dann legte ich eine der Musketen und die Vogelflinte auf die Erde, und Freitag that dasselbe mit seinen Schußwaffen; hierauf zielte ich mit der anderen Muskete nach den Wilden, gebot meinem Gefährten dasselbe mit seinem Gewehre zu thun, kommandirte Feuer und drückte zu gleicher Zeit selbst ab.
Kapitel 13
Freitag hatte so viel besser als ich gezielt, daß er auf seiner Seite zwei von den Wilden getödtet und drei verwundet hatte, während von mir nur einer getödtet und zwei verletzt waren. Man kann sich denken, welch einen furchtbaren Schrecken die Wilden empfanden. Die Nichtgetroffenen sprangen auf, ohne zu wissen, wohin sie entrinnen oder wohin sie blicken sollten, da es ihnen unbekannt war, von woher das Verderben kam.
Freitag hielt die Augen unverwandt auf mich gerichtet, um zu sehen, was ich thun werde. Sofort nach dem ersten Schuß legte ich das Gewehr nieder und ergriff die Jagdflinte. Freitag, der mich den Hahn spannen und anlegen sah, that das Gleiche.»Bist du bereit?«rief ich ihm zu. — »Ja«, antwortete er. — »Dann in Gottes Namen los!«
Hiermit feuerte ich zum zweiten Mal unter die Bestürzten, ebenso Freitag. Da unsere Gewehre diesmal nur mit Schrot geladen waren, stürzten bloß zwei der Wilden, aber viele von ihnen waren verwundet, so daß sie mit gellendem Geheul, blutend und kläglich zugerichtet, wie wahnsinnig umherliefen. Drei davon sanken gleich darauf nieder, ohne jedoch völlig todt zu sein.
«Jetzt, Freitag«, rief ich, das abgefeuerte Gewehr niederlegend und das geladene Gewehr ergreifend,»folge mir!«Er that es mit Entschlossenheit. Ich eilte aus dem Gehölz und zeigte mich, während Freitag mir unmittelbar folgte. Sobald die Wilden mich gewahrten, schrie ich, mit Freitag vereint, aus Leibeskräften. Dann lief ich so schnell, als ich es mit der Waffenlast vermochte, geraden Wegs zu dem armen Schlachtopfer. Die beiden Henker, die sich eben an ihn hatten machen wollen, waren nach unserem ersten Schuß furchtbar erschrocken nach dem Strand gelaufen und in ein Canoe gesprungen. Drei von den Uebrigen hatten denselben Weg eingeschlagen. Ich befahl Freitag nach dieser Richtung zu eilen und Feuer auf sie zu geben. Augenblicklich rannte er bis auf etwa vierzig Ellen Entfernung zu ihnen hin und gab dann Feuer. Ich glaubte, er habe sie sämmtlich getödtet, denn ich sah sie Alle in dem Boot über einen Haufen fallen. Zwei von ihnen sprangen jedoch sofort wieder auf, während zwei andere getödtet waren und der dritte so verwundet, daß er wie todt in dem Boote liegen blieb.
Unterdessen zog ich mein Messer und durchschnitt die Bande an den Händen und Füßen des armen Opfers. Ich half dem unglücklichen Menschen auf und fragte ihn auf portugiesisch, wer er sei. Er antwortete auf lateinisch, er sei Christ, doch war er so schwach, daß er kaum gehen oder sprechen konnte. Ich reichte ihm meine Flasche, die ich aus der Tasche gezogen, und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, daß er trinken solle. Nachdem er es gethan, reichte ich ihm ein Stück Brod. Als er auch das verzehrt hatte, fragte ich ihn, was er für ein Landsmann sei. Er erwiederte:»Ein Spanier«, und gab dann, sobald er sich nur ein wenig erholt, durch alle möglichen Zeichen seine Dankbarkeit zu erkennen.
«Sennor«, erwiederte ich, so gut ich mich auf spanisch auszudrücken vermochte,»jetzt ist nicht Zeit zum Reden, sondern zum Fechten. Wenn Ihr noch so viel Kraft habt, ergreift diese Pistole und diesen Säbel. «Dankbar nahm er beides, und als ob die Waffen ihm neue Kraft verliehen hätten, stürzte er wie rasend auf seine Mörder. Im Nu hieb er zwei oder drei in Stücke. Denn die Ueberraschung durch den Knall unserer Gewehre hatte die armen Menschen so bestürzt gemacht, daß sie vor bloßer Furcht oder Verwunderung niederfielen und unfähig waren, einen Fluchtversuch zu machen. Das Gleiche war mit den fünf im Boot Befindlichen der Fall, auf die Freitag geschossen hatte. Nur drei davon waren verwundet hingesunken, die beiden Anderen aber vor Schrecken zu Boden gefallen.
Ich hielt jetzt mein Gewehr, ohne zu schießen, in der Hand, um, da ich dem Spanier meine Pistole und den Säbel gegeben, schußfertig zu bleiben. Freitag, dem ich zugerufen hatte, er solle nach dem Baum eilen, von dem aus er zuerst Feuer gegeben, um die abgeschossenen Gewehre dort zu holen, vollzog diesen Befehl sehr behend. Ich gab ihm hierauf meine Muskete und setzte mich nieder, um die übrigen Gewehre wieder zu laden, indem ich meine zwei Genossen aufforderte, sich davon zu holen, wenn es nöthig sei.
Während ich lud, entspann sich ein fürchterlicher Kampf zwischen dem Spanier und einem der Wilden. Der letztere griff jenen mit einem der hölzernen Schwerter an, mit denen er hatte geschlachtet werden sollen. Der Spanier hielt sich trotz seiner Schwäche so tapfer und brav als denkbar. Nachdem er aber geraume Zeit mit dem Indianer gefochten und ihm zwei große Wunden am Kopf beigebracht hatte, umfaßte ihn der Wilde, der ein großer starker Kerl war, warf ihn nieder und hatte ihm schon meinen Säbel aus der Hand gewunden, als der Spanier, diese Waffe klüglich fahren lassend, die Pistole aus dem Gürtel zog, den Wilden durch den Leib schoß und ihn, noch ehe ich zur Hülfe herbeikommen konnte, auf der Stelle tödtete.
Freitag, jetzt sich selbst überlassen, verfolgte die Flüchtigen, ohne eine andere Waffe als sein Beil zu haben. Mit diesem erschlug er die drei früher Verwundeten, die zu Boden gesunken waren, und Alle, die ihm noch sonst in den Weg kamen. Jetzt holte sich der Spanier bei mir ein Gewehr. Ich gab ihm eine der Vogelflinten, er verfolgte damit zwei Wilde und verwundete sie beide. Da er aber nicht laufen konnte, entkamen sie ihm in den Wald, wohin Freitag ihnen sofort nacheilte. Er tödtete den einen, der andere war aber trotz seiner Wunden flinker als er, stürzte sich ins Meer und schwamm mit Aufwand seiner ganzen Kraft zu den beiden im Canoe Zurückgebliebenen. Diese drei waren die Einzigen, die uns von den einundzwanzig Wilden entrannen. Was sie und die Uebrigen angeht, stellte sich das Ergebniß unseres Kampfes folgendermaßen:
| Durch unsere erste Salve fielen | 3 | ||
| Durch die zweite | 2 | ||
| Von Freitag im Canoe getödtet | 2 | ||
| Desgleichen dort verwundet und später getödtet | 2 | ||
| Durch Freitag im Wald erlegt | 1 | ||
| Von dem Spanier getödtet | 3 | ||
| An den Wunden hier und dort verblutet | 4 | ||
| Im Canoe entkommen (darunter Einer verwundet oder todt) | 4 | ||
| In Summa | 21 |
Die Flüchtlinge im Canoe ruderten mit allen Kräften, um aus unserer Schußweite zu kommen. Freitag gab mehre Male Feuer auf sie, schien jedoch keinen getroffen zu haben. Er zeigte große Lust, sie in einem ihrer Kähne zu verfolgen. Da ich sie mit Sorgen entfliehen sah, bei dem Gedanken, daß sie ihren Landsleuten Kunde von dem Geschehenen bringen und vielleicht zu mehren Hunderten wiederkommen und uns dann durch die Uebermacht bewältigen würden, willigte ich auch in sein Verlangen ein. Ich eilte nach einem der zurückgebliebenen Boote, sprang hinein und gebot Freitag mir zu folgen. Aber wie war ich überrascht, als ich in dem Fahrzeug einen unglücklichen Menschen, gleich dem Spanier an Händen und Füßen gebunden, liegen fand, der offenbar wie jener zum Schlachten bestimmt war. Er war halb todt vor Schrecken und begriff Nichts von dem, was vorging. Denn er hatte sich nicht über den Rand des Bootes emporrichten und umschauen können, und die festen Bande, die ihm den Kopf und die Fersen nahe zusammengeschnürt hielten, hatten ihn so gepeinigt, daß kaum noch ein Rest von Leben in ihm zu sein schien.
Ich durchschnitt sofort seine Bande und versuchte ihm aufzuhelfen. Aber er vermochte weder sich aufrecht zu halten, noch zu sprechen, sondern stöhnte nur jammervoll, weil er, wie es schien, glaubte, er werde nur losgebunden, um getödtet zu werden. Als Freitag herbeigekommen war, forderte ich ihn auf, den Unglücklichen anzureden und ihm seine Befreiung anzukündigen, indem ich zugleich meine Flasche an Freitag gab, damit er dem Aermsten einen Schluck Rum reiche. Der Trunk und die Kunde von seiner Errettung belebten den Gefangenen und er setzte sich aufrecht ins Boot. Als aber Freitag ihn sprechen hörte und ihm ins Gesicht sah, da hätte es Jeden zu Thränen rühren müssen, wie er den Gefangenen plötzlich umarmte, küßte, ihn an sich drückte und dabei schrie, lachte, jubelte, hüpfte und sang; wie er dann wieder heftig weinte, die Hände rang, sich Kopf und Gesicht schlug und hierauf wieder singend umhersprang, gleich einem Verrückten.
Es währte eine gute Weile, bis ich ihn dazu brachte, mir Rede zu stehen. Dann aber, als er endlich ein wenig zu sich gekommen war, sagte er mir, dieser Mensch sei Niemand anders als sein eigner Vater.
Es wäre nicht leicht zu beschreiben, wie mich der Anblick der Ausbrüche des Entzückens und der kindlichen Liebe des armen Wilden bei dem Wiedersehen seines Vaters und dessen Errettung vom Tode bewegte. Auch nicht entfernt aber vermöchte ich die närrischen Kundgebungen seiner Liebe zu schildern. Er sprang zahllose Male in das Boot und wieder heraus. Er setzte sich neben seinen Vater, preßte dessen Kopf an seine offene Brust und hielt ihn dicht daran gedrückt, wie eine Mutter ihren Säugling. Dann rieb er ihm die durch die Bande starr gewordenen Glieder und erwärmte sie in seinen Händen. Ich gab ihm aus meiner Flasche etwas Rum und hieß ihn damit die Extremitäten des Alten einzureiben, was diesem offenbar sehr gut that.
Dies Ereigniß hatte natürlich unserer Verfolgung der Wilden in dem anderen Canoe, die uns jetzt fast aus dem Gesichte waren, ein Ende gemacht. Und das war gut. Denn zwei Stunden später, noch ehe die Flüchtlinge den vierten Theil ihres Heimweges zurückgelegt haben konnten, erhob sich ein so starker Wind, und es stürmte ihrer Fahrt entgegen aus Nordwest die ganze Nacht hindurch so heftig, daß ich nothwendig annehmen mußte, das Boot der Flüchtlinge sei untergegangen, und sie selbst seien niemals wieder an ihre heimische Küste gelangt.
Um wieder auf Freitag zurück zu kommen, so war dieser dermaßen beschäftigt mit seinem Vater, daß ich ihn eine Zeitlang nicht abrufen mochte. Als ich ihn dann auf kurze Zeit für abkömmlich erachtete, rief ich ihn zu mir. — Er kam springend und lachend in vollem Entzücken herbei. Auf meine Frage, ob er seinem Vater etwas Brod gegeben, antwortete er kopfschüttelnd:»Nein, schlechter Hund ich, selbst Alles gegessen auf«. Hierauf reichte ich ihm aus meiner eignen Tasche ein Stück Brod, gab ihm auch für sich selbst etwas Rum, doch trank er nicht davon, sondern brachte Alles zu seinem Vater. Auch einige Rosinen reichte ich ihm. — Kaum hatte der Alte diese Dinge erhalten, als ich Freitag wieder aus dem Boot springen und so schnell davon rennen sah, als ob er behext sei. Er war der schnellste Läufer, der mir je vorgekommen ist. Im Nu schwand er mir aus den Augen, und wie laut ich auch rief und ihm nachschrie, es half Nichts. Nach einer Viertelstunde erst kehrte er langsam zurück, denn sein Lauf war gehemmt durch Etwas, was er in den Händen trug. Er war nämlich in unserer Behausung gewesen, um in einem Kruge für seinen Vater frisches Wasser zu holen. Außerdem hatte er einige Gerstenkuchen mitgebracht, die er mir gab, während er das Wasser seinem Vater reichte, nachdem ich jedoch, da ich gleichfalls sehr durstig war, auch davon einen kleinen Schluck genommen hatte. Dieser Trunk belebte den Alten mehr, als es mein Rum vermocht hatte, denn er war fast vor Durst umgekommen.
Nachdem der Greis getrunken und Freitag noch etwas Wasser übrigbehalten hatte, befahl ich ihm, das dem armen Spanier zu bringen, der desselben nicht minder bedürftig war. Auch von dem Brode schickte ich jenem, da ich sah, daß er vor Schwäche in dem Schatten eines Baumes auf einem grünen Platze niedergesunken war. Seine Glieder waren gleichfalls durch die Bande steif und geschwollen. Als Freitag zu ihm gekommen, erhob er sich, trank und aß von dem Brod. Nun ging auch ich zu ihm und reichte ihm eine Handvoll Rosinen. Er sah mir mit dem Ausdruck höchster Dankbarkeit ins Gesicht, war aber, wiewohl er sich in dem Gefecht so tapfer gehalten, jetzt so schwach, daß er nicht auf den Füßen stehen konnte. Er versuchte es wiederholt, aber vergebens, da ihn die angeschwollenen Beine zu sehr schmerzten. Ich ließ daher auch ihm durch Freitag die Glieder mit Rum einreiben.
Während Freitag diesem Befehl Folge leistete, sah ich, wie der gute Bursch alle paar Minuten den Kopf nach seinem Vater umwendete, um zu sehen, ob er noch an derselben Stelle sitze, auf der er ihn verlassen. Als er ihn plötzlich nicht mehr bemerkte, sprang er, ohne ein Wort zu sagen, auf und eilte so rasch, als ob er mit den Füßen den Erdboden nicht berühre, fort. Sobald er jedoch, an dem Ort, wo der Alte gesessen, angekommen, wahrgenommen hatte, daß dieser sich nur, um die geschwollenen Glieder zu ruhen, gelegt hatte, kehrte er sofort zurück.
Ich machte jetzt dem Spanier den Vorschlag, er möge sich von Freitag aufrichten, zu dem Boote bringen und darin nach unserer Wohnung fahren lassen, wo ich weiter für ihn Sorge tragen wollte. Freitag aber, ein starker Bursch wie er war, nahm den Fremden kurzer Hand auf den Rücken, trug ihn ins Canoe, setzte ihn neben seinen Vater, stieß das Boot ab und ruderte es trotz des widrigen Windes schneller an der Küste entlang, als ich gehen konnte. Nachdem er die Beiden in der Bucht sicher geborgen, holte er windschnell das andere Canoe und hatte auch dies fast noch eher, als ich an die Bucht gelangte, in diese hereingerudert. Er setzte mich nun über das Wasser und half dann unseren neuen Gefährten aus dem Boot.
Diese aber zeigten sich unfähig zum Gehen, und Freitag wußte nicht, was er jetzt anfangen sollte. Da verfiel ich auf ein Auskunftsmittel. Ich befahl Freitag, die Beiden an den Strand niederzusetzen, fertigte dann mit ihm eine Art Tragbahre an und so trugen wir die zwei Invaliden fort.
An die äußere Umfriedigung meiner Festung gelangt, stießen wir auf eine neue Schwierigkeit. Es war unmöglich die beiden Männer über jene zu bringen, und doch wollte ich meinen Zaun nicht zerstören. Aber auch hier ersann ich einen Ausweg. Binnen etwa zwei Stunden errichtete ich nämlich mit Freitag zwischen der ersten Umhegung und dem von mir angepflanzten Buschwerk aus alten Segeln und darüber gedeckten Baumzweigen ein hübsches Zelt, und unter diesem bereiteten wir aus dem vorhandenen brauchbaren Material, nämlich aus Reisstroh und mehren wollenen Decken, zwei Betten für unsere Gäste.
Meine Insel war jetzt auf einmal bevölkert, und ich glaubte einen förmlichen Reichthum an Unterthanen zu besitzen. Oft vergnügte mich von da an der Gedanke, daß meine Lage der eines Königs so sehr ähnlich sei. War ja doch das ganze Land mein Eigenthum, und hatte ich doch ein unbestreitbares Herrschaftsrecht an demselben! Meine Mitbewohner hatten sich mir vollkommen unterworfen, ich war ihr absoluter Herr und Gesetzgeber. Sie dankten mir sämmtlich ihr Leben und waren bereit, es, wenn's Noth thäte, auch für mich dahin zu geben. Merkwürdig schien mir, daß von meinen drei Unterthanen jeder sich zu einer andern Religion bekannte. Freitag war Protestant, sein Vater ein Heide und Cannibale, der Spanier ein Katholik. Uebrigens gewährte ich, beiläufig bemerkt, in meinen Besitzungen Jedermann völlige Gewissensfreiheit.
Sobald meine geretteten Gefangenen unter ihrem Obdach einen Ruheplatz gefunden hatten, sann ich auf eine Mahlzeit für sie. Ich befahl Freitag eine halb ausgewachsene Ziege aus meiner Heerde zu schlachten, theilte das Hinterviertel derselben in kleine Stücke, ließ es durch Freitag kochen und sieden und bereitete aus Fleisch und Bouillon, in die ich auch etwas Gerste und Reis that, ein vortreffliches Essen. Hierauf brachte ich Alles in das neue Zelt, setzte meinen Gästen einen Tisch vor, ließ mich daran mit ihnen nieder, und während ich mit ihnen das Zubereitete verzehrte, suchte ich sie möglichst zu erheitern und aufzumuntern. Freitag diente mir dabei als Dolmetscher, nicht nur seinem Vater, sondern auch dem Spanier gegenüber, denn dieser verstand die Sprache der Wilden vollkommen.
Nach unserem Mittags- oder richtiger Abendessen ließ ich durch Freitag in einem der Boote die in der Eile auf dem Schlachtfeld zurückgelassenen Feuerwaffen holen. Am nächsten Tage befahl ich ihm dann, die Leichen der Wilden, die der Sonne ausgesetzt waren und leicht unserer Gesundheit nachtheilig werden konnten, sowie auch die schrecklichen Reste des barbarischen Mahles zu begraben. Diese nämlich waren in großer Menge vorhanden. Ich selbst aber hätte mich nicht mit ihnen befassen, ja sogar nicht einmal ihren Anblick vertragen können, wenn ich zufällig des Weges gekommen wäre. Freitag vollzog meine Befehle pünktlich und vertilgte die Spuren der Wilden so gründlich, daß ich die Stelle, wo sie gelagert hatten, nur noch an dem dort befindlichen Vorsprung des Waldes zu erkennen vermochte.
In meiner Unterredung mit meinen zwei neuen Unterthanen ließ ich zunächst durch Freitag dessen Vater befragen, was er über die Flucht der Wilden in dem Canoe denke und ob er glaube, daß sie etwa mit einer Uebermacht zurückkehren würden. Der Alte sprach seine Meinung dahin aus, höchst wahrscheinlich seien die Wilden mit ihrem Boot untergegangen, der Sturm habe sie entweder im Wasser umkommen lassen oder an südlichere Küsten getrieben, wo sie dann sicherlich aufgefressen sein würden. Was sie aber thun würden, wenn sie glücklich nach Hause gelangt sein sollten, könne er nicht mit Bestimmtheit sagen, doch glaube er, sie hätten, durch die Art, in der sie angegriffen worden, durch den Lärm und das Feuer einen solchen Schrecken eingejagt bekommen, daß sie ihren Landsleuten eher melden würden, die Uebrigen seien durch Donner und Blitz als durch Menschenhand umgekommen, und daß sie die zwei, die ihnen erschienen seien, wohl für himmlische Geister, aber nicht für bewaffnete Männer halten würden. Er wisse dies daher, daß er sie in ihrer Sprache habe davon reden hören. In der That mußte es ja für die Aermsten unmöglich sein zu begreifen, wie ein sterblicher Mensch Feuer schleudern und Donner erschallen lassen und ohne die Hand zu heben aus der Ferne tödten könne, was ihnen Alles bei uns begegnet war.
Später erwies sich, daß der alte Mann Recht gehabt hatte. Wie ich nachmals von anderer Seite erfuhr, haben die Wilden nie wieder versucht, die Insel zu betreten. Der Bericht jener Entronnenen (die nämlich wirklich glücklich dem Sturm entgangen waren) hatte sie so in Erstaunen und Schrecken gesetzt, daß sie annahmen, wer nur auf jenes bezauberte Eiland einen Fuß setze, werde von den Göttern mit Feuer vernichtet. Da ich dies jedoch früher nicht wußte, lebte ich noch eine geraume Zeit hindurch in Furcht vor den Wilden und beobachtete möglichste Vorsicht, wiewohl ich mich jetzt, wo unserer Vier waren, ohne Weiteres jederzeit auch in freiem Felde an hundert solcher Feinde hätte wagen dürfen.
Sobald sich die Furcht vor der Wiederkehr der fremden Canoes ein wenig verloren hatte, fing ich wieder an, meinen früheren Plan in Betreff der Reise nach dem Festland zu überdenken. Freitags Vater hatte mich gleichfalls versichert, daß ich bei seinen Landsleuten seinetwegen auf eine gute Aufnahme rechnen dürfe. Aber meine Absichten wurden ein wenig gekreuzt durch ein ernstliches Gespräch mit dem Spanier. Denn von ihm erfuhr ich, daß noch sechzehn andere Spanier und Portugiesen sich bei jenen Wilden aufhielten, zu denen sie durch den Sturm verschlagen seien, und zu welchen sie, wenn sie auch mit ihnen in Frieden lebten, doch im Verhältniß voller Abhängigkeit bezüglich ihrer Nothdurft und sogar ihrer ganzen Existenz ständen. Durch vielerlei Fragen erfuhr ich, daß jenes Schiff, welches die Europäer getragen hatte, ein spanisches mit Pelzwaaren und Silber beladenes gewesen war. Es war in Rio de la Plata ausgerüstet und nach der Havanna bestimmt gewesen, wo es europäische Waaren gegen seine Ladung hatte einlösen sollen. Die Mannschaft hatte fünf Portugiesen aus einem gescheiterten Schiff an Bord genommen, fünf ihrer eigenen Leute waren ertrunken, als das Schiff verunglückte, und der Rest hatte sich unter unsäglichen Gefahren halb todt an die Cannibalenküste gerettet und dort jeden Augenblick erwartet, gefressen zu werden. Die wenigen Waffen, welche sie gerettet, waren vollkommen unbrauchbar gewesen, da die Wogen alles Pulver bis auf ein weniges, das sie zu ihren Speisen verwendeten, wie auch die Kugeln weggeschwemmt hatten.
Auf meine Frage, was aus diesen Unglücklichen werden würde, und ob sie denn nicht an die Flucht dächten, erwiederte der Spanier, sie hätten wohl oft darüber Rath gepflogen, aber da sie weder ein Fahrzeug, noch Mittel ein solches zu erbauen, noch auch irgend welchen Proviant besäßen, so hätten ihre Berathungen immer in Thränen und Verzweiflung geendet. Ich fragte ihn, wie seine Gefährten wohl einen Fluchtvorschlag aufnehmen würden. Dabei verhehlte ich aber nicht, daß ich bei einem solchen nicht geringe Furcht davor hege, daß sie sich treulos zeigen würden, wenn ich mich in ihre Hände gegeben hätte.»Denn«, setzte ich hinzu,»Dankbarkeit ist keine in dem Menschen regelmäßig wohnende Tugend, und die Menschen richten ihre Handlungsweise weniger oft nach den Wohlthaten, die sie empfangen, als nach dem Vortheil, den sie erwarten. Wenn ich, nachdem ich das Werkzeug zur Befreiung jener Fremden geworden bin, später von ihnen in Neu-Spanien zum Gefangenen gemacht werden sollte (wo jeder Engländer sicher ist, gewaltsamen Todes zu sterben), so wäre das doch eine böse Sache. Lieber will ich noch mich den Wilden überliefern und von denen fressen lassen, als in die unbarmherzigen Hände der Priester und der Inquisition fallen. Uebrigens«, fügte ich hinzu,»bin ich überzeugt, daß, wenn sie Alle hier wären, wir eine hinlänglich große Barke zu bauen vermöchten, in der wir südwärts nach Brasilien oder nordwärts nach der spanischen Küste gelangen könnten. Wenn sie mich aber dann, sobald ich ihnen Waffen gegeben, zwingen sollten, sie zu ihrem eigenen Volk zu begleiten, so würde das ein schlechter Lohn für meine Güte und eine schlimme Veränderung meiner Lage sein.«
Der Spanier antwortete mir in sehr vertrauenerweckender Weise, die Lage seiner Landsleute sei so elend, und das sei ihnen so sehr bewußt, daß sie, nach seiner Ueberzeugung, vor dem Gedanken zurückschauderu würden, undankbar gegen Jemanden zu handeln, der zu ihrer Befreiung beigetragen hätte. Wenn ich einwillige, wolle er mit Freitags Vater zu ihnen reisen, mit ihnen verhandeln und mir dann Antwort bringen. Er werde sie mit feierlichem Eid bekräftigen lassen, daß sie sich mir als ihrem Führer unbedingt unterwerfen wollten. Sie sollten auf die heiligen Sakramente und die Bibel schwören, um nur in ein solches christliches Land ihre Reise zu richten, das mir genehm wäre, und daß sie sich bis zur Landung daselbst ganz und gar meinen Befehlen unterordnen würden. Hierüber werde er mir einen schriftlichen Vertrag zurückbringen.
Dann versprach der Spanier weiter, er wolle mir selbst eidlich geloben, mich sein ganzes Leben lang nie zu verlassen, so lange ich es nicht selbst gebiete. Er werde bis zu seinem letzten Athemzug an meiner Seite bleiben, wenn sich etwa seine Landsleute den geringsten Treubruch zu Schulden kommen lassen sollten. Diese, versicherte er, seien sämmtlich sehr gebildete redliche Leute und sie befänden sich in unglaublich traurigen Umständen. Ohne Waffen, Kleider und Nahrungsmittel hingen sie gänzlich von der Gnade der Wilden ab. Die Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat hätten sie ganz aufgegeben, und sie würden sicherlich, wenn ich ihre Befreiung versuchen wollte, für mich leben und sterben.
Aus diese Versicherung hin beschloß ich denn ihre Befreiung zu wagen und den Spanier nebst dem Alten zur Unterhandlung abzuschicken. Als jedoch schon Alles bereit war, machte der Spanier selbst einen so klugen und von so viel Redlichkeit zeigenden Einwurf, daß ich nur zustimmen konnte und dem zufolge die Befreiung seiner Gefährten mindestens auf ein halbes Jahr hinausschob.
Die Sache verhielt sich so: Der Spanier war jetzt etwa einen Monat bei uns, und ich hatte ihn während dieser Zeit mit ansehen lassen, in welcher Weise ich unter Gottes Beistand für meinen Unterhalt sorgte. Er überschaute meinen Vorrath an Korn und Reis, der zwar für mich übrig ausreichte, aber doch nur bei der größten Sparsamkeit auch für meine jetzt auf vier Personen angewachsene Familie hinlänglich war. Noch weniger konnte er genügen für die Gefährten des Spaniers, wenn sie zu vierzehn, denn so viel lebten ihrer noch, herüber kamen. Am allerwenigsten aber würde der Vorrath ausgereicht haben, das zu erbauende Fahrzeug für die Reise nach einer der christlichen Kolonien von Amerika mit Proviant auszurüsten.
Deshalb rieth mir der Spanier, ihn und die beiden Andern ein so viel größeres Stück Land urbar machen zu lassen, als ich Korn zur Aussaat zu erübrigen vermöchte. Wir könnten dann eine weitere Erntezeit abwarten, um genügenden Getreidevorrath bei der Ankunft seiner Landsleute zu haben. Noth und Mangel würde diese leicht zur Unzufriedenheit reizen und ihnen den Gedanken nahe legen, sie seien nicht sowohl befreit, als nur von einer Bedrängniß in die andere gerathen.»Denkt an die Kinder Israel«, setzte der Spanier hinzu,»die anfangs über ihre Erlösung aus Aegyptenland jubelten, dann aber sogar gegen Gott, ihren Befreier, rebellirten, als ihnen das Brod in der Wüste ausgegangen war.«
Diese Vorsorge war so am Platze und der Rath so gut, daß er mir nothwendig zusagen mußte, und daß ich ihn nur als einen erfreulichen Beweis für die Treue des Spaniers ansehen konnte. So machten wir Vier uns dann alsbald daran, ein weiteres Stück Land, so gut es die hölzernen Werkzeuge gestatten wollten, umzugraben. In Monatsfrist, gerade zur Zeit der Aussaat, hatten wir so viel Bodenfläche vorbereitet, daß ich zweiundzwanzig Maß Gerste und sechzehn Maß Reis, d. h. Alles, was ich nur zu erübrigen vermochte, darauf aussäen konnte. Ja, wir behielten nicht einmal so viel Gerste übrig, als für unseren eignen Gebrauch bis zu der erst nach sechs Monaten zu erwartenden Ernte (hierbei rechne ich die Zeit der Beackerung mit, denn natürlich braucht das Korn in diesem Klima nicht sechs Monate, um heranzureifen) erforderlich war.
Da wir jetzt zahlreich genug waren und uns vor den Wilden, wenn sie nicht in sehr großer Uebermacht zu uns kamen, nicht zu fürchten brauchten, durchstreiften wir ungehindert, so oft es die Gelegenheit bot, die ganze Insel. Nachdem wir nun einmal den Plan zu unsrer Befreiung gefaßt hatten, war es, wenigstens für mich, unmöglich, das Sinnen auf die Mittel zu derselben auch nur kurze Zeit aus den Gedanken zu verlieren. So zeichnete ich mir denn vor Allem einige taugliche Bäume aus und ließ sie durch Freitag und seinen Vater unter der Aufsicht des Spaniers fällen. Ich zeigte ihnen, mit welcher unermüdlichen Anstrengung ich früher einen großen Baum in einzelne Bretter verarbeitet hatte, und ließ sie in gleicher Weise mehr als ein Dutzend Planken aus gutem Eichenholz anfertigen. Dieselben waren beinahe zwei Fuß breit, fünfunddreißig Fuß lang und zwei bis vier Zoll dick. Welche ungeheure Arbeit ihre Anfertigung erforderte, kann man sich denken.
Unterdessen bemühte ich mich auch, meine Ziegenheerde möglichst zu vergrößern. Freitag mußte abwechselnd den einen Tag mit mir, den andern mit dem Spanier ausgehen, bis wir über zwanzig Ziegenlämmer zur Aufzucht gefangen hatten. So oft wir nämlich eine Mutterziege erlegt hatten, brachten wir die Jungen zu der Heerde. Ferner, als die Zeit zur Traubenernte kam, ließ ich eine solche große Menge an den Bäumen aufhängen, daß wir, wenn wir in Alicante gewohnt hätten, wo die Rosinen in der Sonne getrocknet werden, gewiß sechzig bis achtzig Fässer damit hätten füllen können. (Neben dem Brod bildeten nämlich die Rosinen, die sehr nahrhaft sind, unsre Hauptspeise.)
Der Herbst hatte sich jetzt eingestellt, und wenn die diesmalige Ernte auch nicht die reichlichste war, die ich überhaupt auf der Insel erlebt hatte, so entsprach sie doch unserm Zweck. Denn aus den zweiundzwanzig Maß Gerste der Aussaat gewannen wir über zweihundertundzwanzig Maß. In gleichem Verhältniß stand der Reisertrag zur Saat. Dieser Vorrath hätte nun sicherlich bis zur nächsten Ernte ausgereicht, wenn auch alle sechzehn Spanier bei uns gewesen wären. Auch zur Ausrüstung für eine Reise bis zum entlegensten Theil von Amerika genügte er vollkommen. Sobald wir unser Getreide eingebracht hatten, fertigten wir neue große Körbe an, in die wir es dann füllten. Der Spanier stellte sich hierbei besonders gescheidt an. Er sprach seine Verwunderung aus, daß ich solches Flechtwerk nicht auch zur Einfriedigung meiner Wohnung angewendet habe, was ich jedoch für eine unnöthige Arbeit erklärte.
Da wir nun so gut verproviantirt waren für alle zu erwartenden Gäste, gestattete ich dem Spanier, nach dem Festland zu reisen, damit er mit seinen zurückgelassenen Gefährten unterhandle. Ich gab ihm eine schriftliche strenge Anweisung, Niemanden mitzubringen, der nicht in Gegenwart des Spaniers und des Vaters meines Freitag zuvor geschworen habe, in keiner Weise sich gegen den zu vergehen, der die Boten zu ihrer Befreiung ausgesendet habe, daß sie vielmehr mir beistehen und mich gegen jeden Angriff vertheidigen, sowie daß sie sich gänzlich meinen Befehlen unterwerfen wollten. Dies Schriftstück sollte ihnen zur Unterzeichnung vorgelegt werden. In welcher Weise eine solche bewerkstelligt werden könnte, da die Leute ja weder Feder, noch Tinte besaßen, hatten wir freilich außer Betracht gelassen.
Mit den erwähnten Anweisungen begaben sich denn die Spanier und Freitags Vater in einem der Boote, in denen sie zu der kannibalischen Mahlzeit der Wilden herübergebracht waren, auf die Reise. Jedem von ihnen gab ich ein Gewehr und Munition zu etwa acht Schüssen mit, unter der eindringlichen Ermahnung, gut damit hauszuhalten und nur bei entschiedener Nöthigung davon Gebrauch zu machen.
Diese Vorbereitungen zu meiner Befreiung nach mehr als siebenundzwanzig Jahren der Gefangenschaft auf dieser Insel waren mir eine köstliche Beschäftigung. Ich gab den Reisenden einen Vorrath von Brod und Rosinen mit, welcher für sie und die sämmtlichen Spanier auf viele Tage reichte, und wünschte ihnen von Herzen glückliche Reise. Wir kamen über ein Zeichen überein, an welchem ich sie bei ihrer Rückkehr schon in der Ferne erkennen könnte. Ihre Abfahrt geschah bei gutem Winde zur Zeit des Vollmonds, nach meiner Berechnung im Monat Oktober. Uebrigens hatte ich eine genaue Rechnung weder über die Tage, noch sogar über die Jahre geführt; hatte aber die letzteren, wie sich später zeigte, dennoch richtig gezählt.
Zu der Zeit, als ich schon etwa eine Woche lang auf die Rückkehr meiner Abgesandten wartete, trat ein gar merkwürdiges und unverhofftes Ereigniß ein, das mir ein so wichtiges war wie kein anderes, davon die Weltgeschichte berichtet.
Ich schlief eines Morgens fest in meiner Behausung, als Freitag hastig hereinstürzte mit dem lauten Ausruf:»Herr, Herr, sie sind da!«Sofort sprang ich auf und eilte, sobald ich angekleidet war, unbekümmert darum, ob ich mich einer Gefahr aussetze, durch mein jetzt ziemlich dicht gewordenes Gehölz. Wenn ich sage: unbekümmert um die Gefahr, so meine ich damit, daß ich gegen meine Gewohnheit ohne Waffen ausging. Nach der See ausschauend, gewahrte ich in einer Entfernung von etwa einer und einer halben Meile ein mit lateinischem Segel versehenes Langboot, das mit lustigem Winde nach der Insel zusteuerte. Es kam aber, wie ich sogleich bemerkte, nicht von jener Seite, auf der wir die Küste hatten liegen sehen, sondern von dem südlichsten Ende der Insel her.
Mit Rücksicht hierauf rief ich Freitag und befahl ihm, sich dicht neben mir zu halten, weil dies nicht die von uns Erwarteten sein könnten, und wir nicht wüßten, ob sie als Freunde oder Feinde kämen. Dann ging ich, um ein Fernglas zu holen, nahm die Leiter und bestieg den Gipfel des Hügels, wie ich zu thun pflegte, wenn ich ungesehen beobachten wollte. Kaum hatte ich den Hügel betreten, als ich deutlich ein Schiff, etwa zwei Meilen gegen Südost von mir, aber nur anderthalb Meilen von unserer Küste entfernt, vor Anker liegen sah. Ich erkannte das Fahrzeug deutlich als ein englisches, und auch das Langboot schien ein solches zu sein.
Mein Seelenzustand war unbeschreiblich. Wie unaussprechlich ich mich auch darüber freute, ein Schiff zu sehen, das vermuthlich mit Landsleuten von mir, also mit Freunden bemannt war, so überkamen mich doch ich weiß nicht was für Bedenken, die mir geboten, auf der Hut zu sein. Ich fragte mich zunächst, was wohl ein englisches Schiff in dieser Gegend, durch welche kein Weg hin oder zurück von einem englischen Handelsplatz führe, zu suchen haben könne. Stürme, die es hätten verschlagen haben können, hatten in jüngster Zeit nicht stattgefunden; deshalb nahm ich an, daß die Mannschaft, wenn sie wirklich aus Engländern bestände, schwerlich Gutes im Schilde führe,»und«, sagte ich mir,»es ist jedenfalls besser für dich, zu bleiben, wo du bist, als in die Hände von Dieben und Mördern zu fallen«.
Niemand verachte solche geheime Hinweisungen und Winke auf Gefahren, wenn sie ihm auch da zu Theil werden, wo er an ihre Begründung nicht glauben mag. Wer das Leben beobachtet hat, wird das Vorhandensein solcher Fingerzeige nicht leugnen. Unzweifelhaft sind sie Kundgebungen einer unsichtbaren Welt und eines Zusammenhangs der Geisterwelt mit der unsrigen, und warum sollen wir, wenn wir ihre Absicht, uns zu warnen, erkennen, sie nicht für die Bezeigungen freundlicher Genien höherer oder geringerer Art, die zu unserm Besten zu dienen bestimmt sind, halten?
Gerade das hier in Rede stehende Ereigniß bestätigte mir diese Ansicht. Denn wäre ich nicht durch jene geheime Mahnung, mag sie nun gekommen sein, woher sie wolle, vorsichtig gemacht worden, so wäre ich unvermeidlich zu Grunde gegangen und in ein viel größeres Elend gerathen als je zuvor, wie sich gleich zeigen wird.
Ich befand mich noch nicht lange auf meinem Posten, als ich das Boot nach meiner Küste steuern sah, wie wenn es dort einen bequemen Landungsplatz suche. Da es aber nicht nahe genug heran kam, gewahrte die Mannschaft nicht die früher von mir mit meinen Flößen benutzte Bucht, steuerte vielmehr nach einer Bai, die etwa eine halbe Meile von mir entfernt war. Das aber gereichte entschieden zu meinem Glück. Denn in jenem Falle würden die Fremden sozusagen dicht vor meiner Thür gelandet sein, meine Festung bald erstürmt und mich vielleicht aller meiner Habe beraubt haben. Sobald sie gelandet, bestätigte sich meine Vermuthung, daß sie Engländer seien, wenigstens in Bezug auf die meisten. Zwei davon hielt ich für Holländer, jedoch, wie sich nachher ergab, mit Unrecht. Von den elf Leuten, die ich erkannte, waren drei unbewaffnet und, wie es schien, gefesselt. Als die ersten vier oder fünf der Uebrigen ans Ufer gesprungen waren, führten sie jene drei wie Gefangene aus dem Boot. Einer derselben machte die leidenschaftlichen Geberden des Flehens und der Verzweiflung, die beiden Andern erhoben zuweilen die Hände und schienen gleichfalls bekümmert, obwohl nicht in so hohem Grade wie Jener.
Dieser Anblick machte mich bestürzt, und ich wußte nicht, wie ich ihn deuten sollte. Freitag rief mir in seinem gebrochenen Englisch zu:»O Herr, sieh, englische Mann essen Gefangene so gut wie wilde Mann«. —»Warum meinst du, daß sie die Gefangenen fressen wollen?«fragte ich. — »Ja«, erwiederte Freitag,»sie wollen essen sie.«»O nein«, entgegnete ich,»ich fürchte zwar, sie wollen sie ermorden, aber sie werden sie sicherlich nicht fressen.«
Während dessen hatte ich keine Ahnung davon, was wirklich werden sollte, stand vielmehr zitternd vor Schrecken über den Anblick da und erwartete jeden Augenblick, daß die drei Gefangenen getödtet werden würden. Einmal sah ich, wie einer der bewaffneten Schufte ein großes Messer oder Schwert erhob, um damit einen der Unglückseligen zu treffen. Jeden Augenblick meinte ich diesen unter dem Hiebe fallen zu sehen, und das Blut starrte mir dabei in den Adern. Ich wünschte von ganzem Herzen den Spanier und Freitags Vater zu mir, und es verlangte mich sehnlichst, unbemerkt auf Schußweite zu den Fremden zu schleichen und die Gefangenen zu erretten. Ich sah nämlich keine Feuerwaffen in den Händen Jener. Bald aber kam mir ein anderer Gedanke.
Nachdem ich nämlich einige Zeit beobachtet hatte, wie schmachvoll die drei Gefangenen von den übrigen Seeleuten behandelt wurden, sah ich, daß diese sich auf der Insel zerstreuten, als ob sie das Terrain recognosciren wollten. Die drei hätten jetzt freilich auch gehen können, wohin sie wollten, aber sie saßen mit verzweiflungsvollen Blicken nachdenklich auf der Erde. Das erinnerte mich daran, wie ich selbst einst bei meiner Ankunft auf der Insel verzweifelt umher geschaut und mich verloren gegeben hatte; wie ich aus Furcht, von den wilden Thieren gefressen zu werden, die Nacht hindurch auf dem Baume geblieben war, und wie ich damals so ganz und gar keine Ahnung von der Hülfe gehabt hatte, die mir in Folge gnädiger Fügung dadurch beschieden war, daß das Schiff durch Sturm und Wellen dem Lande sich näherte und mir lange Zeit Nahrung und Hülfsmittel gewährte. So saßen auch diese drei trostlosen Menschen dort ohne Ahnung davon, wie sicher und nahe ihnen Rettung und Hülfe sei, während sie sich schon für verloren glaubten und ihre Lage für eine völlig verzweiflungsvolle hielten. So wenig haben wir die Gabe, die Dinge dieser Welt vorherzusehen, und so viel Ursache hätten wir, heiter auf den großen Weltenlenker zu vertrauen, der seine Geschöpfe niemals gänzlich verläßt, sondern ihnen in der elendesten Lage immer doch Etwas gibt, für das sie dankbar sein müssen. Ist doch zuweilen gerade in dem, was wir für die Ursache unseres Verderbens halten, das Mittel zu unserer Errettung gelegen.
Zur Zeit, als die Fremden das Ufer betreten hatten, war gerade die Flut in ihr höchstes Stadium gelangt. Während sie aber mit den Gefangenen unterhandelt und dann sich zerstreut hatten, um die Gegend zu untersuchen, war die Flutzeit verstrichen und ihr Boot lag nun gänzlich auf dem Trockenen. Zwei in diesem zurückgebliebene Männer hatten, wie ich später erfuhr, zu viel Branntwein getrunken und waren eingeschlafen. Einer davon wachte zuerst auf, und da er das Boot auf dem Sand sitzen sah, rief er die Umherstreifenden zu Hülfe. Diese kamen auch sofort herbei, vermochten aber trotz aller Anstrengung das Fahrzeug, da es zu schwer war, und da das Ufer an jener Stelle aus feinem, tiefem, fast schlammartigem Sande bestand, nicht wieder flott zu machen.
Als ächte Seemänner (welche Menschenklasse vielleicht unter allen die sorgloseste ist) gaben sie ihre Bemühungen alsbald auf und trieben sich aufs Neue auf dem Lande umher. Einen von ihnen hörte ich seinem Kameraden in englischer Sprache zurufen:»Laßt's sein, Jack, die Flut wird's schon wieder flott machen«. Diese Aeußerung klärte mich über den wichtigen Punkt völlig auf, mit was für Landsleuten wir es zu thun hatten. Inzwischen hielt ich mich fortwährend wohlverborgen und wagte mich aus meiner Festung nicht weiter heraus, als auf den Gipfel des Hügels. Denn ich wußte, daß vor mindestens zehn Stunden das Boot nicht wieder flott gemacht werden konnte. Bis dahin aber mußte es schon völlig dunkel sein, und ich konnte dann gefahrloser die Bewegungen der Fremden beobachten und ihre etwaigen Unterredungen behorchen.
Fürs Erste machte ich mich jetzt kampffertig, jedoch mit mehr Umsicht als sonst, da ich wußte, daß ich es diesmal mit einer ganz andern Art von Gegnern zu thun hatte als früher. Ich befahl auch Freitag, den ich inzwischen zu einem vortrefflichen Schützen herangebildet, sich mit Waffen zu versehen. ergriff selbst zwei Jagdflinten und gab ihm drei Gewehre. Mein Aussehen war in der That geeignet, Furcht zu erregen. Ich sah schrecklich aus in meinem Rock von Ziegenfell und mit der früher beschriebenen Mütze auf dem Kopfe, den bloßen Säbel an der Seite, zwei Pistolen im Gürtel und eine Flinte über jede Schulter.
Kapitel 14
Obwohl ich anfangs entschlossen war, vor Einbruch der Nacht Nichts zu unternehmen, änderte ich doch bald meinen Plan. Gegen zwei Uhr nämlich, als die Hitze den höchsten Grad erreicht hatte, bemerkte ich, daß die Seeleute sämmtlich einzeln in den Wald gegangen waren, wahrscheinlich um dort einen Mittagsschlaf zu halten. Die drei unglücklichen Gefangenen aber, zu sorgenvoll, um den Schlummer finden zu können, saßen im Schatten eines großen Baumes etwa eine Viertelmeile von mir entfernt. Dort vermochten sie, wie ich glaubte, von keinem der Uebrigen gesehen zu werden, und darauf hin beschloß ich, mich ihnen zu zeigen und sie über ihr Schicksal zu befragen. Sofort machte ich mich in dem oben beschriebenen Aufzug auf den Weg, Freitag folgte eine Strecke hinter mir, gleichfalls fürchterlich anzuschauen, wenn auch nicht ganz so ungeheuerlich wie ich. Ich näherte mich den Fremden, so weit es ging, ohne bemerkt zu werden, und rief dann, ehe mich einer erblickt hatte, in spanischer Sprache, ihnen laut zu:»Wer seid Ihr, Leute?«Sie stutzten bei dem Laut, aber in weit größere Verwirrung geriethen sie noch, als sie mich in meinem sonderbaren Aufzug erblickten. Sie antworteten nicht und wollten eben sich auf die Flucht begeben, als ich ihnen auf englisch zurief:»Gentlemen, fürchtet Euch nicht vor mir! Vielleicht ist Euch ein Freund näher, als Ihr es gehofft habt«. —»Dann muß er geraden Wegs vom Himmel geschickt sein«, sagte traurig einer der Gefangenen zu mir,»denn in unserer Lage ist Menschenhülfe ein Ding der Unmöglichkeit.«»Alle und jede Hülfe kommt vom Himmel, Herr«, entgegnete ich.»Aber wollt Ihr nicht einem Euch Unbekannten den Weg zeigen, wie Euch aus der großen Noth, in der Ihr Euch zu befinden scheint, zu helfen steht? Ich sah Euch hier landen, und als Ihr, wie es schien, die rohen Menschen um Gnade batet, bemerkte ich, daß einer derselben sein Schwert zog, Euch zu tödten.«
Dem armen Menschen rannen jetzt die Thränen vom Gesicht, und zitternd mit Mienen, als sei er vom Donner gerührt, antwortete er:»Spricht Gott selbst zu mir oder ein Mensch? Habe ich einen Sterblichen vor mir oder einen Engel?«—»Darüber macht Euch keine Gedanken«, entgegnete ich.»Wenn ein Engel Gottes zu Eurer Errettung geschickt wäre, so würde er in besseren Kleidern gekommen sein wie ich und auch andere Waffen tragen, als Ihr an mir seht. Ich bitte Euch, gebt alle Furcht auf. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch wie andere, und zwar ein Engländer, und beabsichtige Euch beizustehen. Ihr seht, ich habe zwar nur Einen Diener; wir besitzen aber Waffen und Munition. Sagt uns gerade heraus, ob wir Euch nützen können. Was für ein Schicksal ist es, das Euch betroffen hat?«
«Unser Schicksal zu erzählen, Herr«, erwiederte er,»würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, während unsre Mörder so nahe sind. Kurz heraus gesagt, Herr, ich war Kapitän jenes Schiffes, und meine Mannschaft hat gegen mich eine Meuterei unternommen. Nur mit Mühe ist sie davon abgebracht worden, mich zu ermorden, und endlich haben sie mich nebst diesen beiden Männern, von denen der eine mein Steuermann, der andere einer meiner Schiffspassagiere war, an diesem öden Eiland ausgesetzt. Wir glaubten hier sterben zu müssen, da wir den Ort für unbewohnt hielten, und auch jetzt wissen wir nicht, wie wir Errettung finden sollen.«
«Wo sind Eure Feinde, diese Bestien, hingekommen?«fragte ich. — »Dort liegen sie, Herr«, erwiederte er, indem er auf ein Baumdickicht zeigte.»Mein Herz zittert vor Furcht, daß sie uns gesehen und Euch sprechen gehört haben. Wenn das der Fall ist, werden sie uns sicherlich Alle ermorden.«
«Haben sie Feuerwaffen?«fragte ich. Er antwortete, sie hätten nur zwei Flinten bei sich, eine dritte sei im Boote zurückgeblieben.»Nun gut«, erwiederte ich,»dann überlaßt mir das Uebrige. Ich sehe, sie liegen Alle im Schlaf, und es ist mir eine Leichtigkeit, sie zu tödten. Oder sollen wir sie lieber zu Gefangenen machen?«Er entgegnete, es seien zwei verzweifelte Schurken unter ihnen, denen Gnade widerfahren zu lassen eine bedenkliche Sache sei. Wenn man jedoch erst diese in der Gewalt habe, so würden die anderen, wie er glaube, freiwillig zu ihrer Pflicht zurückkehren. Auf meine Aufforderung, jene Beiden näher zu bezeichnen, bemerkte der Fremde, daß er dies aus der Entfernung nicht wohl vermöge; übrigens werde er sich meinen Anordnungen in jeder Weise unterwerfen.»Nun denn«, erwiederte ich,»so wollen wir uns aus dem Bereich ihrer Augen und Ohren zurückziehen, damit sie nicht erwachen, und dann können wir das Weitere beschließen. «Hierauf folgten mir die Fremden willig, bis der Wald uns verbarg.
«Hört mich an, Herr«, sagte ich, als wir im Dickicht angekommen waren.»Wenn ich mich um Eure Befreiung in Gefahr begebe, seid Ihr dann auch bereit, Euch zwei Bedingungen gänzlich zu unterwerfen?«Er kam meinen Vorschlägen zuvor durch die Erwiederung, daß sowohl er wie sein Schiff, wenn er es wieder in seine Gewalt bekommen sollte, ganz und gar meinen Befehlen untergeben sein solle. Und wenn er auch sein Schiff nicht wieder gewinnen sollte, werde er doch für mich leben und sterben, in welchen Theil der Welt ich ihn auch schicken möchte. Die beiden Andern sprachen sich in gleicher Weise aus.
«Nun wohl«, antwortete ich.»Meiner Bedingungen sind nur zwei. Die erste: daß Ihr, so lange Ihr auf dieser Insel weilt, Euch keinerlei Autorität anmaßen, auch, wenn ich Euch Waffen einhändige, diese jederzeit zurückliefern und weder zu meinem, noch der Meinigen Schaden anwenden wollt, sowie daß Ihr während dieser ganzen Zeit meinen Befehlen Folge leistet. Zweitens: daß Ihr, wenn Ihr Euer Schiff wieder bekommt, mich und meinen Gefährten in freier Ueberfahrt nach England zu bringen versprecht.«
Der Kapitän gab mir alle möglichen und erdenklichen Versicherungen, daß er diese sehr billigen Bedingungen erfüllen und überdies sein ganzes Leben mir ergeben sein, auch seinen Dank, wo es nur angehe, bethätigen werde.»Nun denn«, erwiederte ich,»hier sind drei Musketen mit Pulver und Blei für Euch; sagt mir jetzt, was für ein Verfahren Ihr für das zweckmäßigste erachtet. «Er bezeigte aufs Neue seine Erkenntlichkeit, entgegnete aber, daß er sich ganz meinen Anordnungen unterwerfen wolle. Ich bemerkte ihm hierauf, daß ich zwar jeden Angriff für eine gewagte Sache hielte, dennoch aber als das unserer Situation Angemessenste ansähe, daß wir mit Einem Male Feuer auf die ganze Bande gäben, während diese im Schlafe liege.»Wenn dann«, setzte ich hinzu,»einige bei dieser ersten Salve nicht todt bleiben und sich ergeben wollen, so können wir ihnen das Leben schenken und so die Wirkung unserer Schüsse ganz in die Hände der Vorsehung legen.«
Der Kapitän entgegnete mit großer Ruhe, wenn er es vermeiden könne, so würde er gern unterlassen, sie zu tödten; aber jene beiden unverbesserlichen Schufte, welche auch allein die Meuterei in seinem Schiffe angestiftet hätten, könnten uns, wenn sie entrinnen sollten, ins Verderben stürzen; sie würden nämlich dann an Bord gehen, die ganze Schiffsmannschaft herbeiholen und uns vernichten.»Dann«, entgegnete ich,»rechtfertigt die Nothwendigkeit meinen Rathschlag, da er den einzigen Weg, uns das Leben zu retten, öffnet. «Weil ich den Kapitän aber immer noch abgeneigt sah, Blut zu vergießen, trug ich ihm auf, sich mit seinen beiden Gefährten aufzumachen und das zu thun, was ihnen selbst das Angemessenste schien.
Mitten in diesem Gespräch waren einige von den Schiffsleuten erwacht, und wir sahen, daß zwei von ihnen augenblicklich auf den Füßen standen. Der Kapitän verneinte meine Frage, ob einer von ihnen zu den Rädelsführern der Empörten gehöre.»Gut«, sagte ich,»so mögen sie entfliehen. Die Vorsehung scheint sie aufgeweckt zu haben, um sie zu retten. Jetzt«, fuhr ich fort,»ist es Eure Schuld, wenn die Uebrigen uns entrinnen. «Hierdurch ermuthigt, nahm er die von mir ihm eingehändigte Muskete zur Hand und eine Pistole in den Gürtel und ging mit seinen beiden Kameraden, von denen jeder gleichfalls von mir mit einer Flinte bewaffnet war, ab.
Die Letzteren machten bei ihrer Entfernung einiges Geräusch. Einer von den wachgewordenen Seemännern wendete sich hierauf um und rief, als er sie herbeikommen sah, den andern herbei. Aber es war bereits zu spät, denn in demselben Augenblick gaben jene beiden Feuer, während der Kapitän klüglich seinen Schuß zurückbehielt. Die Zwei hatten so trefflich auf jene früher erwähnten Schurken gezielt, daß der eine von diesen auf der Stelle todt blieb, der andere aber schwer verwundet wurde. Der Letztere hatte noch so viel Kraft, aufspringen und laut um Hülfe rufen zu können; der Kapitän aber eilte zu ihm und rief: es sei zu spät, Menschenbeistand anzuflehen, er solle lieber Gott anrufen, daß er seiner Schurkenseele gnädig sei. Bei diesen Worten schlug er ihn mit dem Gewehrkolben nieder, daß er kein Glied mehr regte.
Es blieben noch drei der Feinde übrig, von denen aber einer gleichfalls schon leicht verwundet war. Inzwischen war ich herbeigekommen, und als die Gegner die Größe der Gefahr und die Vergeblichkeit des Widerstands einsahen, baten sie um Gnade. Der Kapitän versprach ihnen das Leben zu schenken, wenn sie ihm ihre Reue über die Verrätherei, deren sie sich schuldig gemacht, verbürgen könnten und wenn sie ferner schwören wollten, ihm treuen Beistand zum Wiedergewinnen des Schiffes und zur Rückkehr nach Jamaika zu leisten, woher sie gekommen waren. Sie gaben darauf sämmtlich jede Versicherung aufrichtiger Reue, die man nur verlangen konnte, und der Kapitän äußerte mir deshalb den Wunsch, ihnen das Leben zu schenken. Ich hatte Nichts dagegen einzuwenden, machte aber zur Bedingung, daß die Gefangenen an Hand und Fuß gefesselt bleiben müßten, so lange sie auf der Insel verweilen würden.
Inzwischen hatte ich Freitag mit dem Steuermann des Kapitäns nach dem Boot geschickt, um es in Sicherheit zu bringen und die Segel und Ruder fortzuschaffen. Bald darauf kamen drei von den umherschweifenden Seeleuten, die sich zu ihrem Glück von den Uebrigen getrennt hatten, durch unsere Schüsse herbeigerufen in unsere Nähe. Als sie sahen, daß der Kapitän aus ihrem Gefangenen ihr siegreicher Gebieter geworden, ließen auch sie sich willig binden, und so war denn unser Sieg vollständig.
Jetzt erst bot sich die Gelegenheit für mich und den Kapitän, den Bericht von unserem gegenseitigen Schicksal auszutauschen. Ich begann und erzählte ihm meine ganze Geschichte, die er mit Aufmerksamkeit und Verwunderung anhörte. Vorzüglich interessirte es ihn zu erfahren, in welcher wunderbaren Weise ich mit Lebensmitteln und Munition versehen worden war. Mein wunderreicher Lebensgang rührte ihn tief. Der Gedanke überkam ihn, daß ich auch zu seiner eigenen Errettung erhalten worden sei, die Thränen rannen ihm über das Gesicht, und er vermochte nicht ein Wort mehr zu sprechen. Darauf führte ich ihn und seine beiden Gefährten nach meiner Wohnung, und zwar auf dem Wege, auf welchem ich diese selbst verlassen hatte, nämlich über den Hügel. Dort ließ ich sie Alle mit dem, was ich an Lebensmitteln vorräthig hatte, erfrischen und zeigte ihnen die sämmtlichen Anstalten, die ich während meines langen Aufenthalts zu meiner Bequemlichkeit getroffen hatte.
Dies Alles erfüllte sie mit höchstem Erstaunen. Der Kapitän bewunderte besonders die Befestigung meiner Wohnung, und wie vollkommen ich meinen Zufluchtsort durch das kleine Wäldchen versteckt hatte. Ich hatte es vor nun beinahe zwanzig Jahren angelegt, und es war, da die Bäume hier viel rascher als in England wachsen, schon stattlich groß und so dick geworden, daß man es nur durch den von mir gebahnten gewundenen Pfad passiren konnte.
Ich erzählte ihm, daß ich außer dieser Burg, die meine Residenz darstelle, wie die Fürsten gewöhnlich, auch einen Landsitz habe, den ich ihm gelegentlich zeigen wollte. Für jetzt war aber unsere nächste Aufgabe, das Schiff wieder in unsere Gewalt zu bekommen. Der Kapitän gestand, daß er durchaus nicht wisse, was dazu für Maßregeln zu ergreifen seien. Es befänden sich nämlich noch dreizehn Mann an Bord, die, weil sie sich auf eine Empörung eingelassen, alle ihr Leben dem Gesetz verfallen wüßten und daher in verzweifelter Situation wären. Es sei ihnen bekannt, daß sie bei ihrer Rückkunft nach England sofort auf die Galeeren oder auf die englischen Kolonien gebracht würden, und daher sei ein Angriff auf sie bei unserer geringen Zahl unmöglich.
Die Ansicht des Kapitäns erschien mir bei einigem Nachdenken nur zu wohl begründet. Jedenfalls aber mußte ein rascher Entschluß gefaßt werden, sowohl um die Schiffsleute in eine Schlinge zu locken, als sie von einer Landung abzuhalten, die unsere Vernichtung nach sich gezogen haben würde. Ich bedachte, daß die Schiffsmannschaft sicherlich, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden und dem Boot geworden sei, binnen Kurzem in ihrem anderen Boot zur Insel kommen, vielleicht Waffen mitbringen und uns dann überlegen sein würde. Deshalb schlug ich als erste Maßregel vor, das Boot, welches auf dem Sande lag, seeuntüchtig zu machen. Wir begaben uns sofort an Bord desselben und nahmen die Waffen und was sich sonst an Gegenständen darin befand, heraus. Zu den letzteren gehörte eine Flasche Branntwein, eine andere mit Rum, etwas Schiffszwieback, ein Pulverhorn und ein großes, fünf bis sechs Pfund schweres Stück Zucker in Segeltuch eingewickelt. Alles dies war mir sehr willkommen, besonders aber der Branntwein und Zucker, die ich seit vielen Jahren entbehrt hatte.
Als diese Dinge an Land gebracht waren (die Ruder, der Mast, das Segel und das Steuerruder hatten wir bereits vorher weggeschafft), bohrten wir ein großes Loch in den Boden des Fahrzeugs, so daß dieses keinesfalls weggebracht werden konnte, wenn auch die Schiffsleute in noch so großer Anzahl kommen sollten. Auf die Wiedergewinnung des Schiffes rechnete ich jetzt kaum noch. Dagegen hoffte ich, das Boot würde, wenn es jene Leute zurückgelassen hätten, sich leicht wieder so weit herstellen lassen, daß wir darin nach den Lewardsinseln gelangen und unterwegs die Spanier, die ich nicht vergessen hatte, aufnehmen könnten.
Während wir noch über unsern Operationsplan beriethen und mit großer Anstrengung das Boot so weit an den Strand gezogen hatten, daß es die Flut nicht sollte mitführen können, und nachdem das Loch in demselben so groß gemacht war, daß der Leck so leicht nicht gestopft werden konnte, hörten wir plötzlich von dem Schiff einen Schuß und bemerkten, daß das Boot durch allerlei Signale dorthin zurückgerufen werden sollte. Wiederholtes Feuern und Signalisiren blieb jedoch fruchtlos. Jetzt sah ich mit Hülfe meines Fernglases, daß die Mannschaft ein anderes Boot aussetzte und es durch einige Leute nach der Insel hinrudern ließ. Bei seinem Herankommen erkannten wir, daß sich nicht weniger als zehn Mann darin befanden, welche sämmtlich Feuerwaffen bei sich führten.
Da das Schiff fast zwei Meilen vom Lande entfernt lag, hatten wir Zeit genug, unsere Beobachtungen zu machen und sogar die Gesichter der Männer im Boot zu erkennen. Denn da die Wellen sie etwas östlich von der Stelle, wo das früher gelandete Boot lag, abgetrieben hatten, und sie daher eine Strecke der Küste entlang steuerten, um an demselben Punkte wie jenes an Land zu kommen, konnten wir die Mannschaft genau beobachten. Der Kapitän kannte die Charakterbeschaffenheit der sämmtlichen Leute im Boot. Drei von ihnen, sagte er, seien sehr wackere Leute, die nach seiner Ueberzeugung nur durch Gewalt und Furcht von den Uebrigen in die Verschwörung gezogen worden seien.»Der Bootsmann aber«, setzte er hinzu,»welcher das Kommando zu haben scheint, und alle Uebrigen, außer jenen Dreien, gehören zu den Schlimmsten unter dem ganzen Schiffsvolk und werden ohne Zweifel in ihrer Desperation Alles wagen.«
Ich lächelte hierüber und erwiederte, Menschen in unserer Lage sollten über die Furcht hinaus sein. Jede denkbare Situation sei besser als die unsrige, und was auch erfolge, Leben oder Tod, würde sicherlich für uns eine Befreiung mit sich führen. Ich fragte, ob er, nachdem er den Bericht über meine Lebensumstände vernommen, nicht glaube, daß es sich für mich verlohne, an eine Erlösung aus meiner Lage Alles zu setzen.»Wohin ist Euer Glaube gekommen«, fuhr ich fort,»der Euch vor Kurzem noch so erhob, daß ich erhalten sei, um Euch zu erretten? Meines Bedünkens ist es nur ein einziger Umstand in unserer Situation, der mißlich zu sein scheint.«
«Was meint Ihr damit?«fragte er.
«Nichts Anderes, als daß, wie Ihr sagt, einige brave Jungens unter den Leuten sind, die gerettet zu werden verdienen. Wäre die ganze Sippe niederträchtig, so würde ich glauben, Gott habe sie von den Uebrigen nur deshalb abgesondert, um sie in unsere Hände zu liefern. Denn verlaßt Euch darauf, jeder Mensch, der an diesen Strand kommt, steht in unserer Gewalt und soll leben oder sterben, je nachdem er sich gegen uns benimmt. «Diese mit heiterer Miene gesprochenen Worte ermuthigten den Kapitän bedeutend, und so machten wir uns denn getrost an unsere Aufgabe.
Sobald das vom Schiff ausgesandte Boot uns zuerst in Sicht gekommen war, hatten wir Sorge getragen, die Gefangenen zu trennen. Zwei davon, denen der Kapitän weniger als den Uebrigen traute, wurden unter der Führung Freitags und eines der drei von uns befreiten Männer in meine Höhle entsendet, wo sie entfernt genug waren, um nicht gehört oder entdeckt werden zu können. Aus dieser hätten sie sich, auch selbst wenn sie ihrer Fesseln ledig geworden wären, nicht durch das Gehölz finden können. Dort wurden sie mit Lebensmitteln versehen und in Banden zurückgelassen, nachdem ihnen angekündigt war, daß sie, wenn sie sich ganz ruhig verhielten, nach einigen Tagen die Freiheit erhalten sollten, daß sie aber bei dem geringsten Fluchtversuch gnadelos dem Tod verfallen würden. Sie versprachen, ihre Gefangenschaft geduldig zu ertragen und zeigten sich dankbar für die gute Behandlung, die man ihnen dadurch widerfahren lasse, daß man ihnen Lebensmittel und Licht gewährt habe. Freitag hatte ihnen nämlich einige von unsern selbstverfertigten Kerzen zurückgelassen und sie dann glauben gemacht, daß er als Schildwache vor dem Eingang der Grotte zurückbleibe.
Die übrigen Gefangenen wurden noch besser behandelt. Zwei blieben jedoch gebunden, weil auch ihnen der Kapitän nicht völlig traute. Die andern beiden wurden unter meinen Befehl gestellt, nachdem sie feierlich gelobt hatten, mit uns zu leben und zu sterben. Wir waren jetzt mit ihnen und den drei braven Leuten zusammen sieben gut bewaffnete Männer, und ich zweifelte nicht, daß wir mit den zehn Ankömmlingen ganz leicht fertig werden würden, besonders da der Kapitän versichert hatte, es seien mehre ehrenwerthe Leute unter ihnen.
Sobald die Fremden zu der Stelle gekommen waren, wo ihr anderes Boot lag, ließen sie das ihrige an den Strand auflaufen, sprangen ans Land und zogen ihr Fahrzeug hinter sich her. Mir war das ganz erwünscht, denn ich hatte schon gefürchtet, sie würden ihr Boot in einiger Entfernung von der Küste vor Anker legen und Wache darin zurücklassen, so daß wir uns desselben nicht bemächtigen könnten. Kaum gelandet, eilten Jene zu ihrem andern Boot und sahen mit großem Erstaunen, daß es gänzlich ausgeplündert und mit einem großen Leck durchbohrt war.
Nachdem die Neuangekommenen eine Weile über die Ursache dieser Beschädigung nachgesonnen hatten, ließen sie aus Leibeskräften mehre Male ein brüllendes Halloh erschallen, um von ihren Gefährten gehört zu werden. Es blieb jedoch vergeblich. Hierauf bildeten sie einen Kreis und feuerten aus ihrem Kleingewehr eine solche Salve ab, daß die Wälder rings umher ein lautes Echo vernehmen ließen. Auch dies fruchtete Nichts. Die in der Höhle eingeschlossenen Gefangenen hörten das Schießen nicht, und die bei uns Befindlichen vernahmen es zwar recht gut, durften aber keine Antwort geben.
Hierüber waren die Schiffsleute so erstaunt und befremdet, daß sie, wie wir später erfuhren, beschlossen, sofort nach dem Schiffe zurückzukehren und die Nachricht dahin zu bringen, die Mannschaft sei ermordet und das Langboot seeuntüchtig gemacht. Dem gemäß brachten sie das Fahrzeug, in dem sie gekommen waren, alsbald wieder in See und begaben sich an Bord desselben.
Hierüber aber erschrak der Kapitän aufs Aeußerste; er glaubte nämlich, die Schiffsmannschaft würde nach der Rückkehr der Abgesandten ihre Kameraden verloren geben und wieder in See gehen, so daß er das Schiff, das er wieder zu erlangen gehofft, unfehlbar verlieren werde. Bald aber sollte er durch ein anderes Ereigniß noch mehr in Furcht gesetzt werden.
Die Leute waren noch nicht lange mit dem Boot abgestoßen, als wir sie ans Land zurückkehren sahen, offenbar gewillt, etwas Anderes zu unternehmen. Sie hatten, wie es schien, nach gepflogener Berathung beschlossen, daß drei Mann in dem Boot zurückbleiben, die Uebrigen aber auf die Insel zurückkehren und nach ihren Gefährten suchen sollten. Dies gab der Sache für uns eine sehr unangenehme Wendung, und wir wußten im Augenblick nicht, was wir beginnen sollten. Denn wenn wir uns auch jener sieben Mann, die sich am Lande befanden, bemächtigten, so half das nicht viel, wenn wir das Boot entrinnen ließen. Die darin Befindlichen nämlich wären dann gewiß sofort zu dem Schiff zurückgerudert und mit den dort Zurückgebliebenen sicherlich alsbald unter Segel gegangen, wo dann von einem Wiederbekommen des Fahrzeugs für uns keine Rede mehr sein konnte. Indessen hatten wir keine andere Wahl, als den Verlauf der Dinge ruhig abzuwarten.
Sobald die sieben Mann an Land gegangen waren, hatten die drei in dem Boot befindlichen dieses eine geraume Strecke weit vom Ufer abgesteuert und sich dort vor Anker gelegt, um auf die Andern zu warten. Damit aber war es für uns unmöglich geworden, an das Boot zu gelangen. Die ans Ufer Gelangten hielten sich dicht zusammen und bewegten sich nach der Spitze des kleinen Hügels, unter welchem meine Behausung lag. Wir konnten sie deutlich erkennen, während sie dagegen uns nicht zu bemerken vermochten. Es mußte uns erwünscht sein, daß sie entweder näher zu uns herankämen, oder sich weiter von uns entfernten. In jenem Falle hätten wir auf sie feuern, im andern hätten wir uns sicher zurückziehen können. Als sie den Hügel erstiegen hatten, von dem man weit aus über die Thäler und Wälder nach der am tiefsten gelegenen Nordostseite der Insel zu schauen vermochte, schrieen und riefen sie so lange, bis sie ermüdet waren. Dann setzten sie sich, ohne sich weit vom Ufer hinweg zu wagen, oder sich von einander zu entfernen, unter einen Baum, um Rath zu halten. Hätten sie sich dort dem Schlaf überlassen, wie es früher die andere Truppe gethan, so wäre das sehr vortheilhaft für uns gewesen; aber sie waren zu sehr in Furcht, um schlafen zu können, wiewohl sie keine bestimmte Vorstellung von den ihnen drohenden Gefahren hatten.
Jetzt brachte der Kapitän einen sehr zweckmäßigen Vorschlag zur Sprache.»Vielleicht«, meinte er,»werden diese Gesellen zu dem Entschluß kommen, eine neue Salve zu geben, um von ihren Kameraden gehörten werden, und dann wollen wir in dem Augenblick, wo ihre Gewehre abgefeuert sind, über sie herfallen; sicherlich werden sie sich uns in dieser Lage ergeben, und wir bekommen sie auf diese Weise ohne Blutvergießen in unsere Gewalt.«— Ich billigte diesen Plan für den Fall, daß wir den Leuten nahe genug seien, um zu ihnen gelangen zu können, ehe sie ihre Gewehre wieder zu laden vermöchten. Aber eben diese Voraussetzung fand nicht statt, und so lagen wir noch eine geraume Zeit unentschlossen, was wir unternehmen sollten.
Endlich erklärte ich mich dahin, daß sich meines Bedünkens vor Einbruch der Nacht gar Nichts thun ließe. Vielleicht könnten wir dann, wenn unsere Feinde nicht in das Boot zurückkehren sollten, zwischen sie und das Ufer gelangen und dann die im Boot Befindlichen durch List ans Land locken.
Nachdem wir eine geraume Zeit in großer Ungeduld gewartet hatten, waren wir sehr unangenehm überrascht, als wir die sieben Mann nach langer Berathung aufstehen und nach dem Meere hingehen sahen. Es schien, als ob der Ort, an dem sie sich befanden, ihnen so unheimlich vorkäme, daß sie beschlossen hätten, an Bord des Schiffes zurückzukehren, ihre Gefährten verloren zu geben und ihre Reise fortzusetzen.
Als ich sie nach dem Ufer hingehen sah, war ich überzeugt, daß sie alle weitern Nachforschungen aufgegeben hätten. Der Kapitän theilte diese Ansicht und war dadurch nicht wenig erschreckt. Mir aber kam alsbald eine List in den Sinn, die sich bewährte und die Fremden wirklich wieder zur Umkehr vom Strande bewog. Ich ließ nämlich Freitag und den Steuermann des Kapitäns über die kleine Bucht im Westen setzen, von dort nach der Stelle, wo Freitag den Wilden entronnen war, gehen und befahl ihnen, sobald sie auf die daselbst etwa eine halbe Meile von uns befindliche Anhöhe gekommen seien, aus Leibeskräften zu rufen, bis die Seeleute es vernommen hätten. Wenn diese Antwort gegeben, sollten jene beiden das Schreien wiederholen, dann in einem Bogen fortlaufend immer das Halloh der Fremden erwiedern, diese möglichst weit auf solche Weise in das Innere der Insel und in die Wälder locken und dann auf einem Umwege, den ich ihnen angab, zu uns zurückkehren.
Die Fremden waren gerade im Begriff, in das Boot zu steigen, als Freitag und sein Begleiter ihr Halloh anstimmten. Sofort antworteten jene und eilten der Küste entlang westwärts, dem Ort zu, von woher die Stimmen schallten. Auf ihrem Wege sahen sie sich durch die Bucht gehemmt, in der gerade das Flutwasser stand, so daß sie nicht hinüber konnten. Sofort riefen sie, ganz wie ich es voraus gesehen, den im Boot Befindlichen zu, herbeizukommen und sie überzusetzen. Kaum war diese Aufforderung ergangen, so sah ich, wie das Boot, das eine weite Strecke die Bucht hinaufgerudert war, in einer Einbiegung des Ufers landete, worauf von den drei früher darin Befindlichen einer mit den sieben Anderen lief und nur zwei in dem Fahrzeug zurückblieben, nachdem sie dieses an dem Stamm eines kleinen Baumes am Ufer befestigt hatten.
Dies war es aber gerade, was ich gewünscht hatte. Sofort nahm ich die bei mir befindlichen Leute mit, setzte so, daß ich von den Männern bei dem Boot nicht bemerkt werden konnte, über die Bucht und überraschte die Beiden, ehe sie es sich versahen. Der Eine von ihnen lag am Ufer, der Andere befand sich noch im Boot. Jener, im halben Schlaf begriffen, wollte sich erheben, aber der Kapitän, der uns voraus war, eilte auf ihn los und schlug ihn nieder. Dann rief er dem im Boote Befindlichen zu, er solle sich ergeben oder er sei des Todes.
Es bedurfte keiner großen Ueberredung, um diesen vom Widerstand abzuhalten, als er sich uns fünf Männern gegenüber und seinen Gefährten kampfunfähig sah. Ueberdies gehörte er auch, wie es schien, zu den drei Leuten, die nicht so schwer betheiligt an der Meuterei waren als das übrige Schiffsvolk, daher er nicht nur sich völlig ergab, sondern sich uns auch später als aufrichtiger Bundesgenosse bewährte.
Unterdessen hatten Freitag und der Steuermann den Andern gegenüber ihre Sache so gut gemacht, daß diese durch Rufen und Antworten von einem Hügel zum andern und von einem Gehölz ins andere gelockt worden und nicht nur herzlich müde, sondern auch vom Boot weit genug entfernt waren, um es vor der Dunkelheit nicht wieder erreichen zu können. Nicht minder brachten auch unsre Freunde, bei ihrer Rückkehr zu uns, eine tüchtige Müdigkeit mit.
Jetzt blieb uns nichts Anderes zu thun, als die Nacht abzuwarten und dann die Fremden zu überfallen, wo wir sicher sein durften, uns ihrer bemächtigen zu können. Es waren kaum einige Stunden nach Freitags Rückkehr verstrichen, als auch Jene den Rückweg zu ihrem Boote nahmen. Schon geraume Zeit, ehe sie herankamen, hörten wir die Vordersten den Zurückgebliebenen zurufen. Diese antworteten mit Klagerufen über ihre Lahmheit und Müdigkeit und versicherten, daß sie kaum noch vorwärts könnten. Endlich langten sie bei dem Boot an. Aber wie groß war ihr Befremden, als sie dieses durch die Ebbe auf dem Sand fest gemacht sahen, ihre beiden Leute aber nicht mehr darin fanden. Wir hörten sie eine klägliche Unterhaltung führen; sie jammerten darüber, daß sie auf ein verzaubertes Eiland gerathen seien; entweder, sagten sie, müsse es hier Eingeborene geben, durch die ihnen Allen ein grausamer Tod drohe, oder es müßten Teufel und böse Geister hier wohnen, von denen sie entführt und vernichtet werden würden.
Hierauf stimmten sie aufs Neue ihr lautes Halloh an und forderten ihre Gefährten bei Namen auf, herbeizukommen; aber es erfolgte keine Antwort. Einige Zeit darauf sahen wir sie in der Dämmerung mit vor Verzweiflung gerungenen Händen herumirren, dann in das Boot zurückkehren, um auszuruhen, bald darauf wieder am Ufer umherlaufen und dies Thun immer aufs Neue wiederholen.
Meine Leute hatten große Lust, sofort in der Dunkelheit über sie herzufallen, aber ich wollte meiner Sache ganz gewiß sein, um so wenig als möglich Menschenleben opfern zu müssen. Vor Allem aber war ich abgeneigt, das Leben eines meiner eigenen Leute aufs Spiel zu setzen. Ein Verlust in Bezug auf diese lag um so näher, als die Andern gut bewaffnet waren. Daher beschloß ich zu erwarten, ob die Feinde sich nicht etwa trennen würden. Um sie sicherer in meiner Gewalt zu behalten, gedachte ich unsern Hinterhalt mehr in ihre Nähe zu verlegen, und deshalb befahl ich Freitag und dem Kapitän, auf Händen und Füßen, zur Erde geduckt, sich so nahe als möglich zu ihnen zu schleichen, ehe sie sich schußfertig machten.
Meine Gefährten waren noch nicht lange an ihrem Posten angekommen, als sich der Bootsmann, der Haupträdelsführer bei der Meuterei und zugleich derjenige, welcher jetzt am muthlosesten von Allen schien, mit zwei Andern von dem Schiffsvolk dem Kapitän und meinem Freitag näherte. Der erstere, als er vermuthete, daß dieser Hauptschuft ihm in das Garn laufe, konnte sich kaum gedulden, bis er ihm nahe genug war, so daß ihn jener genau erkennen konnte. Denn bis dahin hatte der Kapitän nur nach der Stimme vermuthet, daß es dieser Schurke sei. Als die drei aber ziemlich in ihre Nähe gekommen waren, standen der Kapitän und Freitag auf und gaben Feuer. Der Bootsmann blieb auf der Stelle todt, und einer von den beiden andern Leuten fiel, durch den Leib getroffen, neben ihm nieder, starb aber erst einige Stunden später; der dritte dagegen entfloh.
Sobald die Schüsse geknallt hatten, rückte ich mit meiner ganzen, jetzt aus acht Mann bestehenden Armee vor. Ich selbst als Generalissimus voran, Freitag als mein Generallieutenant, der Kapitän und seine beiden Leute und unsre drei Kriegsgefangenen, die wir mit Waffen versehen hatten, folgten. Da wir uns den Schiffsleuten in der Dunkelheit näherten, vermochten sie unsre Anzahl nicht zu erkennen. Ich ließ den in dem Boot zurückgebliebenen Mann, der jetzt einer von den Unsrigen war, jene bei Namen rufen, um zu versuchen, ob sie mit sich unterhandeln und sich zur Ergebung bereit finden lassen würden. Die Sache lief auch ab, wie ich es wünschte. Begreiflich genug, daß die Leute, mit Rücksicht auf ihre böse Lage, sich gern zur Kapitulation verstanden. Als der von mir Beauftragte, so laut er vermochte, einem seiner Kameraden zugerufen:»Tom Smith, Tom Smith«, antwortete dieser augenblicklich:»Bist du es, Robinson?«—»Ja wohl, Tom Smith! legt um Gottes willen Eure Waffen nieder und ergebt Euch, oder Ihr seid Alle im nächsten Augenblick des Todes.«
«Wem sollen wir uns denn ergeben? Was sind es für Leute?«fragte Smith wiederum.
«Sie sind hier bei mir«, entgegnete Jener.»Es ist unser Kapitän mit fünfzig Mann, die Euch diese zwei Stunden lang herumgehetzt haben. Der Bootsmann ist todt, Will Fry ist verwundet und ich bin gefangen. Wenn Ihr Euch nicht ergebt, seid Ihr sämmtlich verloren.«
«Wenn sie uns Pardon verheißen«, erwiederte Tom Smith,»dann wollen wir uns ergeben.«
«Ich will gehen und fragen.«
Hierauf rief der Kapitän selbst:»Smith, du kennst meine Stimme, wenn Ihr sofort die Waffen ablegt und Euch ergebt, soll Euch Allen das Leben geschenkt sein, ausgenommen Will Atkins«.
Jetzt schrie dieser Will Atkins:»Um Gottes willen, Kapitän, schenkt mir auch Gnade! Was habe denn ich gerade gethan? Die Andern haben ja ebenso schlecht gehandelt als ich!«
Dies war jedoch nicht die Wahrheit. Wie es schien, hatte dieser Mensch bei dem Ausbruch der Meuterei die erste Hand an den Kapitän gelegt und ihn, nachdem er ihm die Hände gebunden, barbarisch behandelt und mit Schimpfworten beleidigt. Der Kapitän antwortete ihm, er solle die Waffen auf Gnade oder Ungnade niederlegen, sein Geschick würde von der Entscheidung des Gouverneurs abhängen. Mit diesem Namen bezeichnete mein Freund nämlich mich.
Um es kurz zu machen: die Männer legten ihre Waffen nieder und baten, daß wir ihnen das Leben schenken möchten. Ich schickte hierauf jenen, der mit ihnen vorher unterhandelt hatte, nebst zwei Anderen zu ihnen und ließ sie binden. Hierauf erst kam meine große Armee von fünfzig Mann, die, jene drei inbegriffen, jetzt wieder auf acht herabgeschmolzen war, zum Vorschein und bemächtigte sich der Fremden und ihres Bootes. Ich selbst hielt mich nebst einem Begleiter aus Politik noch fern.
Unsere nächste Sorge war nun, das Boot auszubessern, um zu versuchen, ob wir des Schiffes habhaft werden könnten. Der Kapitän beschäftigte sich jedoch zunächst damit, mit den Empörern zu unterhandeln. Er warf ihnen die Schändlichkeit ihres Verfahrens gegen ihn und die Nichtswürdigkeit dessen, was sie zuletzt gegen ihn beabsichtigt hätten, vor und zeigte ihnen, wie sie durch diese Handlungen nothwendig am Ende in das Elend und Verderben, vielleicht gar auf die Galeeren hätten gerathen müssen. Sie schienen auch voll Reue zu sein und baten flehentlich um ihr Leben. Hierauf erklärte er, sie seien nicht seine Gefangenen, sondern die des Befehlshabers dieser Insel. Sie hätten zwar gemeint, ihn an ein ödes, menschenleeres Eiland auszusetzen, aber Gottes Gnade habe es so gefügt, daß es bewohnt sei und einen Engländer zum Gouverneur habe. Wenn es diesem beliebe, könne er sie sämmtlich hängen lassen; da er ihnen aber Pardon versprochen, so werde er sie vermutlich nach England schicken und dem Arme der Gerechtigkeit überliefern, mit Ausnahme des Atkins. Dieser solle sich, so laute der Befehl des Gouverneurs, auf seinen Tod vorbereiten, da er am nächsten Morgen baumeln müsse.
Dies Alles war zwar freie Erfindung des Kapitäns, brachte aber doch die erwünschte Wirkung hervor. Atkins fiel auf die Kniee und bat den Kapitän, sich bei dem Gouverneur für sein Leben zu verwenden. Die Andern alle flehten, daß man sie um Gottes willen nicht nach England schicken möge.
Jetzt kam mir der Gedanke, daß der Augenblick unserer Befreiung nahe sei. Es müsse, dachte ich mir, eine Leichtigkeit sein, diese Leute dahin zu bringen, daß sie uns mit Freuden den Besitz des Schiffes verschafften. Nachdem ich mich in die Dunkelheit zurückgezogen hatte, damit sie vorläufig nicht erführen, was für eine Art von Gouverneur hier herrsche, rief ich den Kapitän herbei. Ich verstellte dabei meine Stimme so, daß es klang, als käme sie aus einer großen Ferne. Einer der Leute wurde beordert, meinen Befehl weiter zu tragen und dem Kapitän zu melden, daß ihn der Kommandant zu sich entbiete. Sofort erwiederte der Kapitän:»Sage Sr. Excellenz, ich würde alsbald kommen«. Dies bestärkte die Gefangenen noch mehr in ihrem Wahn, und sie glaubten sämmtlich, der Gouverneur halte mit seinen fünfzig Mann irgendwo an einer entfernten Stelle der Insel.
Nachdem sich der Kapitän zu mir begeben hatte, theilte ich ihm mit, es sei mein Plan, mich jetzt sofort des Schiffes zu bemächtigen. Diese Absicht behagte ihm ungemein, und wir beschlossen, sie gleich am nächsten Morgen in Ausführung zu bringen. Damit das aber um so besser geschehen könne, schlug ich dem Kapitän vor, die Gefangenen zu theilen. Ich beauftragte ihn, Atkins und zwei andere von den Hauptübelthätern gefesselt nach der Höhle zu schicken, wo die Uebrigen lagen. Zu diesem Transport wurden Freitag und die beiden mit dem Kapitän an das Land gekommenen Leute verwendet. Diese brachten die Gefangenen in die Höhle als wie in einen Kerker, und in der That war der Aufenthaltsort, besonders für Menschen in solcher Lage, schlimm genug. Die übrigen Schiffsleute ließ ich nach meiner oftbeschriebenen Laube bringen. Da diese umzäunt und die Gefangenen in Fesseln waren, bot der Ort Sicherheit genug für ihre Verwahrung.
Zu den letzteren schickte ich am folgenden Morgen den Kapitän, damit er mit ihnen unterhandle, das heißt, sie auf die Probe stelle und mir Bericht erstatte, ob auf ihre Mitwirkung zur Wiedererlangung des Schiffes zu rechnen sei. Er hielt ihnen das durch sie gegen ihn begangene Verbrechen nochmals vor und wies sie darauf hin, in welch traurige Lage sie selbst in Folge dessen gekommen seien. Denn wenn der Gouverneur ihnen auch für den jetzigen Augenblick das Leben geschenkt habe, so würden sie doch, falls man sie nach England schickte, sicherlich gehängt werden. Jedoch wolle er sie versichern, daß, wenn sie bei einer so rechtmäßigen Handlung, wie die Wiedereroberung des Schiffes sei, Beistand leisteten, der Gouverneur ihnen vollen Pardon geben werde.
Man kann sich leicht vorstellen, wie begierig diese Bedingung von den Leuten in ihrer Situation angenommen wurde. Sie fielen auf die Kniee und versprachen unter den kräftigsten Betheuerungen dem Kapitän, ihm bis zum letzten Blutstropfen treu zu bleiben und, wenn sie ihm die Rettung ihres Lebens verdankten, mit ihm durch die ganze Welt zu gehen; sie wollten ihm in aller Zukunft wie ihrem leiblichen Vater anhangen.
Der Kapitän erwiederte:»Gut, ich werde gehen, dem Gouverneur Eure Worte melden und versuchen, was ich thun kann, um ihn zur Einwilligung zu bewegen«.
So brachte er mir denn Bericht über die Stimmung der Leute. Er versicherte überzeugt zu sein, daß man ihnen trauen dürfe. Um jedoch meiner Sache gewisser zu sein, befahl ich dem Kapitän, wieder zu den Gefangenen zurückzukehren und ihnen zu sagen, er habe, zum Beweis, daß man nicht ihrer Aller benöthigt sei, den Auftrag, nur fünf Mann von ihnen zu seinem Beistand auszuwählen; die beiden andern nebst den drei in die Burg, nämlich in meine Höhle, Geschickten werde der Gouverneur als Bürgen für die Treue der Uebrigen zurückbehalten. Handelten die fünf Auserlesenen treulos, so würden die Geiseln sämmtlich lebendig in Ketten am Strande aufgehängt werden. Diese bedenkliche Aussicht sollte nämlich den Gefangenen beweisen, daß der Gouverneur nicht spaße. Uebrigens blieb ihnen keine Wahl, und es lag jetzt gerade so sehr im Interesse der Zurückbleibenden als des Kapitäns, die fünf Auserwählten zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten.
Kapitel 15
Unsere Streitkräfte wurden nun für die Unternehmung folgendermaßen in Gruppen geordnet. Zur ersten gehörte der Kapitän, sein Steuermann und sein Passagier; zur zweiten die beiden zuerst gefangen Genommenen, denen ich auf des Kapitäns Empfehlung die Freiheit gegeben und Waffen anvertraut hatte; zur dritten die zwei Andern, welche ich bis daher gefesselt in der Laube gehalten, aber jetzt gleichfalls auf des Kapitäns Veranlassung losgelassen hatte; die vierte Abtheilung bildete nur der einzeln im Boot gefangene Mann; endlich bestand die fünfte aus den zuletzt befreiten Gefangenen. So waren es im Ganzen dreizehn Leute; die fünf in der Höhle und die beiden Geiseln blieben zurück.
Der Kapitän erklärte auf meine Frage seine Bereitwilligkeit, sich mit dieser Mannschaft an Bord des Schiffes zu wagen. Was mich selbst und Freitag anging, so hielt ich es nicht für zweckmäßig, mit auf das Unternehmen auszuziehen. Denn da wir sieben Mann zurückbehielten, hatten wir genug damit zu schaffen, sie getrennt zu halten und mit Lebensmitteln zu versehen. Die fünf in der Höhle sollten nach meiner Absicht streng eingeschlossen gehalten werden. Freitag ging zweimal täglich zu ihnen, um ihnen zu essen zu bringen.
Die übrigen beiden Gefangenen mußten die Vorräthe bis zu einer gewissen Stelle tragen, und Freitag nahm sie dann in Empfang.
Nachdem ich mich zu den beiden Geiseln begeben, theilte ihnen der Kapitän, der mich begleitete, mit, ich sei vom Gouverneur beauftragt, über sie zu wachen. Der Gouverneur habe angeordnet, daß sie keinen Schritt ohne meine Erlaubniß thun dürften; wenn sie dem zuwider handelten, würden sie ins Gefängniß geworfen und in Ketten gelegt werden. So erschien ich, da ich mich nicht als der Gouverneur zu erkennen geben wollte, jetzt als eine dritte Person und sprach bei jeder möglichen Gelegenheit von dem Befehlshaber der Insel, von der Garnison, dem Gefängniß und dergleichen Dingen.
Für den Kapitän boten sich jetzt als nächste und wichtigste Aufgaben die Ausrüstung seiner zwei Boote, die Verstopfung des Lecks in dem einen und die Bemannung beider. Er ernannte seinen Passagier zum Kapitän für das eine Fahrzeug und gab ihm vier Mann bei. Er selbst nebst seinem Steuermann und fünf weiteren Leuten begab sich in das andere. Sie machten ihre Sache so vortrefflich, daß sie schon um Mitternacht an das Schiff herankamen. Als sie sich auf Rufweite demselben genähert, ließ der Kapitän die Leute an Bord durch Robinson anrufen und ihnen verkündigen, sie hätten ihre Kameraden und das Boot wieder, aber es sei viel Zeit darauf gegangen, bis sie dieselben gefunden. Mit solchem und ähnlichem Geschwätz hielt er die Schiffsmannschaft hin, bis unsere Leute unter dem Schiffe beigelegt hatten. Sobald der Kapitän und der Steuermann den Fuß auf das Deck setzten, schlugen sie auch sofort den zweiten Steuermann und den Schiffszimmermann mit ihren Gewehrkolben nieder. Unsere Leute zeigten sich sehr zuverlässig. Sie versicherten sich der ganzen auf dem Haupt- und dem Quarterdeck befindlichen Mannschaft; dann verschlossen sie die Luken, um diejenigen, welche sich im untern Schiffsraum befanden, in demselben zu halten. Jetzt nahete auch das andere Boot, die Bemannung legte am Vordertheil an und nahm das Vorderdeck sowie die in die Küche führende Dachluke in Besitz und machte drei darin befindliche Leute zu Gefangenen.
Hierauf, nachdem das Deck gänzlich gesäubert war, befahl der Kapitän dem Steuermann, mit drei Leuten in die Kajüte einzubrechen. Dort hatte der neu ernannte Rebellenkapitän mit zwei Männern und einem Schiffsjungen Feuerwaffen ergriffen. Kaum hatte der Steuermann mit seinen Gefährten die Thür gespalten, so gab der neue Kapitän mit seinen Gefährten muthig Feuer auf sie, zerschmetterte dem Steuermann mit einer Musketenkugel den Arm und verwundete noch zwei von der Mannschaft, ohne jedoch einen einzigen zu tödten. Unser Steuermann rief zwar um Hülfe, stürzte indessen trotz seiner Verwundung in die Kajüte und schoß den neuen Kapitän mit einer Pistole durch den Kopf, daß die Kugel durch den Mund eindrang und hinter dem Ohr herausschlug. Der Mensch sank lautlos zusammen; darauf ergaben sich die Uebrigen, und das Schiff war somit ohne weiteren Verlust von Menschenleben in unserem Besitze.
Sobald der Sieg gewonnen war, ließ der Kapitän sieben Kanonenschüsse abfeuern, als das Signal, welches nach unserer Verabredung mir den günstigen Erfolg des Unternehmens verkündigen sollte. Man kann sich denken, mit welcher Freude ich die Salve vernahm, nachdem ich bis beinahe zwei Uhr Morgens am Strande wachend gesessen hatte. Erst als ich das Signal gehört, legte ich mich nieder und schlief nach der großen Anstrengung des Tages sogleich fest ein. Plötzlich aber wurde ich durch einen Flintenschuß geweckt und hörte, nachdem ich eilig aufgestanden war, die Stimme eines Mannes rufen:»Herr Gouverneur, Herr Gouverneur!«Ich erkannte sogleich die Stimme des Kapitäns. Als ich den Gipfel des Hügels erstiegen hatte, fand ich ihn dort stehen. Er deutete nach dem Schiff hin und sagte, indem er mich in die Arme schloß:»Mein theurer Freund und Erretter, dort ist Euer Fahrzeug, denn es gehört Euch ebenso wie mir nebst Allem, was es enthält«.
Ich richtete die Augen nach dem Schiff und sah es etwa eine halbe Meile vom Lande vor Anker liegen. Nachdem nämlich unsre Leute sich desselben bemächtigt hatten, waren die Anker alsbald gelichtet worden, und da das Wetter ruhig war, hatten sie das Fahrzeug gerade gegenüber der Mündung des kleinen Baches festgelegt. Da sich gerade die Flut erhoben, hatte der Kapitän in dem Langboot bis nahe an die Stelle gelangen können, wo ich einst mit meinen Flößen gelandet war, und so hatte er unmittelbar vor meiner Thür aussteigen können. Ich war vor Ueberraschung einer Ohnmacht nahe. Denn ich sah jetzt Alles, was zu meiner Rettung nöthig war, sozusagen wie mit Händen zu greifen vor mir und ein großes Schiff in völliger Bereitschaft, mich zu tragen, wohin ich Lust hatte. Eine Weile lang war ich nicht im Stande, ein Wort zu sprechen. Ich hielt mich, um nicht umzufallen, an dem Kapitän fest, der seine Arme um mich geschlungen hatte. Als er meine Verwirrung gewahrte, zog er sogleich eine Flasche aus seiner Tasche und ließ mich einen herzstärkenden Trunk nehmen, den er zu diesem Zwecke mitgenommen. Darauf setzte ich mich auf die Erde und kam allmählich wieder zu mir selbst, vermochte jedoch lange Zeit noch nicht ein Wort zu äußern. Inzwischen war der gute Kapitän in einer gerade so großen Aufregung als ich, wenn auch nicht in Folge der Ueberraschung. Er überhäufte mich mit tausend Ausdrücken der Zärtlichkeit, um mich wieder zum Bewußtsein zu bringen, aber der Freudenstrom flutete so gewaltig in meiner Brust, daß er alle meine Sinne mit sich fortriß. Endlich brach er in Thränen hervor und dann erst gewann ich die Sprache wieder. Jetzt schloß ich meinerseits meinen Erretter in die Arme, und wir jubelten vereint.
«Ich sehe Euch«, so sagte ich zu ihm,»als meinen vom Himmel gesendeten Erretter an, und die ganze Begebenheit erscheint mir als eine Kette von Wundern. Solche Ereignisse legen uns Zeugniß ab dafür, daß die verborgene Hand einer Vorsehung die Welt lenkt, und sie beweisen aufs Sicherste, daß die Augen einer unbegrenzten Macht in den entlegensten Winkel der Welt dringen, und daß diese Macht dem Unglücklichen Hülfe schicken kann, wenn sie nur will. «Ich unterließ auch nicht gegen den Himmel mein Herz in Dankbarkeit zu erheben, und wer hätte hier auch versäumen können, Dem zu danken, der nicht nur in wunderbarer Weise in solcher Wildniß und so trostloser Lage für mich Sorge getragen hatte, sondern aus dessen Hand jetzt auch allein die Erlösung gekommen war!
Als wir eine Weile hindurch uns unterhalten, theilte mir der Kapitän mit, er habe von dem, was das Schiff an Ladung geborgen und was von den Schurken, die es eine Weile in Besitz gehabt hätten, übrig gelassen sei, mir einige kleine Erfrischungen mitgebracht. Dann rief er den Leuten im Boote zu, sie sollten die Sachen für den Gouverneur aus Land bringen. Das war aber eine Ladung so groß, als ob ich nicht die Absicht hätte, mit den Leuten mich einzuschiffen, sondern als wenn ich auf der Insel bleiben und Jene allein ziehen lassen wolle. Da kam zuerst ein Flaschenkorb mit ausgezeichneten Spirituosen zum Vorschein, darunter sechs große Flaschen Madeira, deren jede zwei Quart enthielt; ferner befanden sich darunter zwei Pfund vorzüglichen Tabaks, zwölf Viertel Ochsenpökelfleisch und sechs Viertel Schweinefleisch, ein Sack voll Erbsen und ungefähr hundert Pfund Schiffszwieback. Auch war dabei eine Kiste mit Zucker, eine andere mit Mehl, ein Sack voll Limonen, zwei Flaschen Limonensyrup und eine Menge andere Dinge. Sodann aber, und das war mir tausendmal mehr werth als das Uebrige, hatte der Kapitän mir mitgebracht sechs reine neue Hemden, sechs sehr gute Halstücher, zwei Paar Handschuhe, ein Paar Schuhe, einen Hut, ein Paar Strümpfe und einen sehr guten vollständigen Anzug, der dem Kapitän selbst gehörte und nur wenig abgenutzt war. Kurz, mein Freund kleidete mich vom Kopf bis zu den Füßen. Jedermann kann sich denken, wie angenehm mir ein solches Geschenk in meiner Lage sein mußte, und dennoch vermag sich Niemand vorzustellen, wie unbehaglich, linkisch und verlegen ich mich anfangs fühlte, als ich diese Kleider angelegt hatte.
Nach unserer gegenseitigen Beglückwünschung, und nachdem jene guten Dinge alle in meine kleine Behausung gebracht waren, hielten wir Rath darüber, was mit unsern Gefangenen zu thun sei. Es war nämlich wohl zu erwägen, ob wir sie mit uns nehmen sollten oder nicht. Besonders galt das von zweien darunter, die unverbesserlich und widerspenstig im höchsten Grade waren. Der Kapitän versicherte, er kenne sie als solche Schurken, daß keine Wohlthat sie zur Treue vermögen würde. Wenn wir sie mitnehmen wollten, so könne es nur so geschehen, daß sie, wie es Verbrechern zieme, in Ketten gelegt und der ersten besten englischen Kolonie, wo wir ans Land gingen, überliefert würden. Mit Rücksicht auf die Besorgnisse meines Freundes sagte ich ihm zu, ich wolle es übernehmen, die beiden in Rede stehenden Leute dahin zu bringen, daß sie selbst darum bitten sollten, auf der Insel zurückbleiben zu dürfen.»Das wäre mir sehr erfreulich«, entgegnete der Kapitän.»Gut«, erwiederte ich,»so will ich sie holen lassen und statt Eurer mit ihnen redend
Hierauf schickte ich Freitag und die beiden Geiseln, welche, nachdem ihre Kameraden sich treu bewährt hatten, gleichfalls von den Fesseln befreit waren, nach der Höhle und ließ sie die fünf Gefangenen in ihren Banden nach der Laube bringen. Bald darauf trat ich in meinem neuen Anzug dort ein, und zwar jetzt wieder in der Würde des Gouverneurs. Als wir alle versammelt waren, und der Kapitän sich gleichfalls eingefunden hatte, ließ ich die Gefangenen vorführen und hielt eine Ansprache an sie. Ich bemerkte darin, daß ihre schurkenhafte Handlungsweise mir vollständig bekannt sei. Ich wisse, daß sie mit dem Schiff entflohen und noch auf anderen Raub ausgegangen seien, daß aber die Vorsehung sie in ihrer eignen Schlinge gefangen und sie selbst in die von ihnen für Andere bereitete Grube habe fallen lassen. Auf meine Anordnung, sagte ich, sei das Schiff wieder erobert und liege jetzt auf der Rhede; sie würden demnächst ihren neuen Kapitän an der großen Raa baumeln sehen, auf daß er den gerechten Lohn seiner Schurkerei empfange. Hierauf fragte ich, was sie vorzubringen hätten dagegen, daß ich sie nicht gleichfalls als auf der That ertappte Seeräuber bestrafe, wozu mich meine amtliche Stellung unzweifelhaft berechtige.
Einer von ihnen antwortete im Namen der Uebrigen, sie hätten darauf Nichts weiter zu erwiedern, als daß ihnen bei ihrer Gefangennehmung Schonung ihres Lebens versprochen sei und daß sie mich demüthig um Gnade anflehten.
Darauf ich:»Ich weiß in der That nicht, was für eine Art von Gnade ich Euch erzeigen könnte. Denn was mich selbst angeht, so habe ich beschlossen, die Insel mit allen meinen Leuten zu verlassen und mich mit dem Kapitän nach England einzuschiffen. Der letztere kann Euch nicht mitnehmen, außer als Gefangene in Ketten, damit Euch für Eure Meuterei und die Desertion mit dem Schiffe der Prozeß gemacht wird. Das aber führt, wie Ihr selbst wissen werdet, nothwendig zum Galgen. Deshalb weiß ich nichts Besseres für Euch, als daß Ihr Euch entschließt, hier auf der Insel Euer Glück zu machen. Ist das der Fall, so bin ich nicht abgeneigt, da ich die Macht habe, über die Insel zu verfügen, Euch das Leben zu schenken, wenn Ihr glaubt, dasselbe auf diesem Eilande fristen zu können.«
Die Gefangenen schienen außerordentlich dankbar hierfür zu sein und versicherten mich, sie wollten es weit lieber riskiren, hierzubleiben, als in England gehängt zu werden. Daher ließ ich es hierbei sein Bewenden haben. Der Kapitän jedoch schien Schwierigkeit zu machen, als ob er die Gefangenen nicht hier lassen dürfe. Das ärgerte mich ein wenig, und ich bemerkte ihm, die Leute seien meine Gefangenen und nicht die seinigen. Wenn ich ihnen einmal Begnadigung zugesagt hätte, so sei ich auch gut für mein Wort. Wenn er es nicht zufrieden sei, so würde ich sie in Freiheit setzen, wie ich sie gefunden hätte, dann möge er sie sich wieder einfangen, wenn es ihm gelänge. Sodann ließ ich die dankerfüllten Gefangenen losbinden, befahl ihnen, sich in die Wälder zurückzuziehen und die Stelle wieder aufzusuchen, woher sie vor Kurzem gekommen seien; ich versprach ihnen einige Feuerwaffen und Munition zurückzulassen und ihnen Anweisung zu geben, wie sie ein ganz bequemes Leben führen könnten.
Hierauf bereitete ich mich vor, an Bord zu gehen, die folgende Nacht jedoch wollte ich noch auf der Insel verweilen und forderte daher den Kapitän auf, sich nach dem Schiffe zu begeben, dort Alles in Ordnung zu bringen, am nächsten Morgen das Boot für mich ans Land zu schicken und den erschossenen Kapitän an die Raa aufzuhängen, daß ihn die Leute auf der Insel sehen könnten.
Nachdem der Kapitän sich entfernt hatte, hieß ich die freigegebenen Gefangenen zu mir kommen und begann ein ernstliches Gespräch mit ihnen über ihre Zukunft.»Ihr habt«, sagte ich ihnen,»das Richtige gewählt; hätte Euch der Kapitän mitgenommen, so würdet Ihr sicherlich in England aufgehängt worden sein. Seht dort den Kapitän an der Schiffsraa baumeln. Das gleiche Loos hätte Euch erwartet.«
Sie erklärten Alle, daß sie sehr gern zurückblieben. Hierauf erzählte ich ihnen von meiner Ankunft und meinen Erlebnissen auf der Insel, zeigte ihnen meine Festungswerke, gab ihnen an, wie ich mein Brod bereitet, mein Getreide gesäet, meine Trauben behandelt hatte, kurz, ich wies sie auf Alles hin, was zu ihrer Behaglichkeit dienen konnte. Auch von den sechzehn Spaniern, deren Ankunft zu erwarten sei, sagte ich ihnen, ließ einen Brief an dieselben zurück und nahm den Verbannten das Versprechen ab, mit denselben alle meine Vorräthe zu theilen.
Dann gab ich ihnen meine Feuergewehre, fünf Musketen und drei Vogelflinten. Ferner erhielten sie drei Säbel und anderthalb Faß Pulver, denn so viel besaß ich noch, da ich nach den ersten Jahren nur wenig mehr gebraucht hatte. Auch beschrieb ich ihnen, wie ich die Ziegen behandelt, sie fett gemacht und gemolken und wie ich Butter und Käse bereitet hatte. Ich versprach, den Kapitän zu bereden, daß er ihnen noch weitere zwei Pulverfäßchen zurücklasse, sowie einige Sämereien, die mir sehr schwer abgegangen seien. Auch den Beutel mit Erbsen, den der Kapitän für mich mitgebracht hatte, gab ich ihnen und ermahnte sie, Sorge zu tragen, daß dieselben eingelegt würden und gehörigen Ertrag lieferten.
Nachdem dies Alles besorgt war, begab ich mich am nächsten Tage an Bord. Wir bereiteten uns vor, sofort unter Segel zu gehen, lichteten jedoch noch nicht an demselben Abend die Anker. Am nächsten Morgen früh kamen zwei von den Zurückgelassenen an das Schiff herangeschwommen, erhoben ein großes Klagegeschrei und baten um Gottes willen, an Bord genommen zu werden, wenn der Kapitän sie auch aufhängen lassen würde, denn sonst würden die drei Anderen sie ermorden. Der Kapitän erwiederte, er könne Nichts ohne meine Zustimmung thun. Nachdem ich dann noch einige Schwierigkeiten gemacht und ihnen das feierliche Versprechen der Besserung abgenommen, wurden sie an Bord gelassen und tüchtig durchgepeitscht. Sie zeigten sich später als ordentliche und ruhige Gesellen.
Einige Zeit darauf schickten wir zur Flutzeit das Boot an Land und ließen den Zurückgebliebenen die versprochenen Gegenstände überbringen, zu denen der Kapitän auf meine Veranlassung noch ihre Koffer und Kleidungsstücke gefügt hatte. Sie nahmen Alles dankbar auf. Auch ermuthigte ich sie, indem ich versprach, ihnen, wenn es in meiner Macht stünde, ein Schiff zuzuschicken, das sie mitnähme, und daß ich sie überhaupt nicht vergessen würde.
Beim Abschied von der Insel nahm ich als Erinnerungszeichen mit mir an Bord die große Ziegenfellmütze, die ich mir selbst gemacht hatte, sowie meinen Sonnenschirm und einen meiner Papageis. Auch das früher erwähnte Geld vergaß ich nicht. Es hatte so lange nutzlos dagelegen, daß es ganz schwarz geworden war und erst, nachdem es ein wenig gerieben worden, wieder für Silber gelten konnte. Ferner that ich auch das in dem Wrack des spanischen Schiffs gefundene Geld zu meinen Habseligkeiten.
So verließ ich denn (wie ich aus dem Schiffskalender ersah) am 19. December des Jahres 1684 das Eiland, nachdem ich achtundzwanzig Jahre zwei Monate und neunzehn Tage darauf zugebracht hatte. Meine Befreiung aus dieser zweiten Gefangenschaft fand an demselben Monatstage statt wie meine Flucht in dem Langboot von den Mohren zu Saleh. Nach langer Fahrt und nach fünfunddreißigjähriger Abwesenheit betrat ich am 11. Juni des Jahres 1685 wiederum die englische Erde.
Ich war in meinem Vaterlande aller Welt so fremd geworden, als ob ich nie mit Jemandem dort bekannt gewesen wäre. Meine treue Hauswirthin und Wohlthäterin, der ich mein Geld anvertraut hatte, lebte noch, war aber in großes Mißgeschick gerathen und befand sich, zum zweiten Male Wittwe geworden, in sehr dürftigen Umständen. Ich beruhigte sie in Bezug auf das, was sie mir schuldete, versicherte, daß ich sie darum nicht in Sorgen setzen wolle, erleichterte vielmehr zum Dank für ihre alte Liebe und Treue ihre Lage so gut, als meine geringen Mittel es damals gestatteten. Es war zwar nur wenig, was ich für sie thun konnte, doch sagte ich ihr zu, daß ich ihre frühere Freundlichkeit nicht vergessen werde. Das habe ich denn, wie an seiner Stelle erzählt werden soll, auch gehalten, sobald ich in die Lage kam, sie unterstützen zu können.
Bald darauf begab ich mich in die Grafschaft York. Mein Vater und meine Mutter waren gestorben, und von meiner ganzen Familie lebte Niemand mehr als zwei von meinen Schwestern und zwei Kinder des einen meiner Brüder. Da man mich schon seit langer Zeit für todt gehalten, war ich auch bei der Erbtheilung des väterlichen Nachlasses nicht berücksichtigt worden. So hatte ich denn so viel als Nichts zu meinem Lebensunterhalt, denn das wenige Geld, was ich bei mir führte, konnte nicht hinreichen, mir eine Existenz zu gründen.
Jetzt aber erfuhr ich einen unerwarteten Beweis von Dankbarkeit. Der Schiffskapitän, den ich nebst seinem Schiff und dessen Ladung so glücklich gerettet, hatte dem Schiffseigner einen getreuen Bericht von der Art, wie ich ihn und sein Fahrzeug erhalten hatte, abgestattet. Dieser nebst einigen andern betheiligten Kaufleuten forderten mich hierauf zu einer Zusammenkunft auf, sagten mir in dieser auf höfliche Weise ihren Dank und machten mir ein Geschenk von beinahe zweihundert Pfund Sterling.
Als ich nach reiflicher Ueberlegung einsah, wie wenig auch dieses Geld zur Sicherung meiner Existenz genügen könne, beschloß ich nach Lissabon zu reisen, um zu versuchen, ob ich dort nicht Kunde über den Zustand meiner Plantage in Brasilien erhalten und erfahren könne, was aus meinem Compagnon geworden sei. Bezüglich des letzteren mußte ich annehmen, daß er mich schon Jahre lang für todt gehalten habe. So schiffte ich mich denn nach Lissabon ein und kam im April daselbst an. Freitag begleitete mich getreulich auf allen meinen Fahrten und bewährte sich bei jeder Gelegenheit als ein zuverlässiger Diener. In der portugiesische Hauptstadt machte ich zu meiner großen Freude meinen alten Freund, jenen Schiffskapitän, ausfindig, der mich einst an der afrikanischen Küste in sein Fahrzeug aufgenommen hatte. Er war inzwischen ein Greis geworden, hatte das Seeleben aufgegeben und sein Schiff seinem auch schon bejahrten Sohne übergeben, welcher noch immer nach Brasilien Handel trieb. Der alte Mann erkannte mich anfangs nicht, wie auch ich ihn nur mit Mühe wieder erkannte. Jedoch erinnerte ich mich sehr bald seiner Züge, und auch in dem Gedächtniß des Kapitäns tauchte die Erinnerung an mich, sobald ich meinen Namen genannt, wieder auf.
Nachdem wir uns herzlich begrüßt, war begreiflicher Weise meine erste Frage nach meiner Plantage und nach meinem Compagnon. Der Alte erwiederte, er selbst sei seit fast neun Jahren nicht in Brasilien gewesen; bei seiner letzten Abreise von dort habe aber mein Compagnon noch gelebt; dagegen seien die beiden Leute, die ich ihm beigeordnet, um meine Interessen zu wahren, schon damals todt gewesen. Indeß glaube er, daß ich gute Kunde über das Wachsthum meiner Pflanzung erhalten würde. Denn nachdem man allgemein angenommen, ich sei bei einem Schiffbruch ertrunken, hätten meine beiden Vertrauensmänner die Berechnung über die Einkünfte meiner Pflanzung dem Fiscalprocurator übergeben, der für den Fall, daß ich nicht zurückkehre und es einfordere, mein Eigenthum zu einem Drittel an den König, zu zwei Dritteln an das Kloster des heiligen Augustinus abgeliefert habe; an das letztere, damit es zu Almosen und für die katholische Mission unter den Indianern verwendet werde. Käme ich aber oder ein von mir Bevollmächtigter, um die Hinterlassenschaft zu fordern, so würde dieselbe zurückerstattet werden, ausgenommen die zu mildthätigen Zwecken bereits verwendeten Beträge, welche nicht ersetzt werden könnten. Dabei versicherte er mich, der königliche Beamte, der die Staatseinkünfte zu verwalten habe, wie auch der Vorsteher jenes Klosters hätten stets mit großer Sorgfalt darauf gehalten, daß der Verwalter des Vermögens, das heißt mein Compagnon, alljährlich eine genaue Rechnung über die Einkünfte habe ablegen müssen, von denen sie dann die mir gehörige Hälfte pflichtschuldigst in Abzug gebracht hätten.
Ich fragte hierauf den Kapitän, ob er nicht wisse, daß und wie sich meine Pflanzung vergrößert habe, und ob er glaube, es verlohne sich der Mühe, daß ich sie einmal selbst in Augenschein nehme; ferner auch, ob, wenn ich dort hingekommen wäre, meiner Absicht, die mir gebührende Hälfte in Empfang zu nehmen, sich kein Hinderniß in den Weg stellen werde.
Hierauf erwiederte der Kapitän Folgendes: Er könne zwar nicht genau sagen, bis zu welchem Umfang sich die Pflanzung vergrößert habe, soviel aber wisse er, daß mein Partner von dem bloßen Ertrag der Hälfte sehr reich geworden sei. So viel er sich erinnern könne, meine er gehört zu haben, daß das dem Könige zugefallene Drittel meines Theiles, das, wie es schiene, einem andern Kloster oder einer Stiftung zugewiesen sei, jährlich über zweihundert Moidor betrage. Was die Wiedereinsetzung in den vollen Besitz meines Vermögens angehe, so sei dieselbe gar nicht zu bezweifeln, da mein Compagnon noch am Leben sei und meine Berechtigung bezeugen könne, wie ja auch mein Name in die königlichen Register und in das Staatsgrundbuch eingetragen sei. Auch die Nachkommen meiner zwei Bevollmächtigten seien sehr ehrbare und geachtete Leute und in besten Vermögensumständen. Wie er glaube, würden sie mir nicht nur zur Wiedererlangung meines Eigenthumes behülflich sein, sondern ich würde auch noch eine ansehnliche Geldsumme in ihren Händen finden, die mir gehöre, als Ertrag der Farm, seitdem diese von den Erblassern jener Männer in meinem Auftrag beaufsichtigt worden, bis zu dem Zeitpunkt, in dem jene, wie oben erwähnt, ihr Mandat niedergelegt hätten, was seinem Bedünkens vor etwa zwölf Jahren geschehen sei.
Ueber diesen Bericht war ich ein wenig betroffen und mißzufrieden. Ich fragte den alten Kapitän, wie es denn gekommen sei, daß meine Bevollmächtigten in solcher Weise über mein Vermögen hätten disponiren können, während ich doch, wie er wisse, ein Testament errichtet und darin ihn, den portugiesischen Kapitän, zum Universalerben eingesetzt hätte.
Er erwiederte, das sei zwar richtig; aber mein Tod sei nicht erwiesen gewesen, und er habe nicht eher als Testamentsvollstrecker verfahren können, bis irgend ein sicherer Bericht über mein Ableben vorgelegen haben würde. Ueberdies sei er auch nicht Willens gewesen, sich mit Dingen in so weiter Ferne zu befassen. Daher habe er nur mein Testament einregistriren lassen und seine Forderung angemeldet. Wäre er über meinen Tod oder darüber, daß ich noch lebe, sicher unterrichtet gewesen, so würde er durch einen Bevollmächtigten das Ingenio (so werden in Brasilien die Zuckerplantagen genannt) haben in Besitz nehmen lassen, welchen Auftrag sein jetzt in Brasilien befindlicher Sohn leicht hätte vollziehen können.
«Aber«, fügte der alte Mann hinzu,»ich habe Euch auch noch eine weitere Mittheilung zu machen, die Euch vielleicht weniger willkommen sein wird als die früheren. Da nämlich Euer Compagnon und Eure Bevollmächtigten ebenso wie alle anderen Leute glaubten, Ihr wäret gänzlich verschollen, so boten mir dieselben an, sie wollten mir auf Eure Rechnung die Renten der ersten sechs oder acht Jahre auszahlen, was ich denn auch angenommen habe. In jener Zeit aber waren gerade große Aufwendungen zur Vergrößerung der Plantage, z. B. zum Anbauen eines Ingenio, zum Ankauf von Sklaven und dergleichen mehr, nöthig gewesen, und daher belief sich damals der Ertrag bei weitem nicht so hoch, als es später der Fall war. Uebrigens«, so schloß der Kapitän,»werde ich Euch getreulich über das von mir in Empfang Genommene und über die Art, wie ich es verwendet habe, Rechnung ablegen.«
Nach einigen Tagen brachte mir denn auch mein alter Freund die Berechnung über die Einkünfte meiner Plantage aus den ersten sechs Jahren. Dieselbe war von meinem Compagnon und dem Mitbevollmächtigten unterzeichnet, und der Ertrag war dem Alten jedesmal in Naturalien überliefert worden, z. B. in Tabaksrollen, Zucker (nach Kisten berechnet), Rum, Syrup und was sonst aus einer Zuckerpflanzung gewonnen wird. Ich ersah aus der Rechnung, daß die Einkünfte alljährlich um ein Beträchtliches gestiegen waren. Da aber, wie erwähnt, die Unkosten bedeutend gewesen, so hatte sich die Einnahme anfangs nicht hoch belaufen. Nichtsdestoweniger konnte mir der alte Kapitän mittheilen, daß er mir vierhundertundsiebzig Moidor in Gold schulde, abgesehen von fünfzehn doppelten Rollen Tabak und sechzig Kisten mit Zucker, die in seinem Schiffe verloren gegangen seien, als er, etwa elf Jahre nach meiner Abreise von Brasilien, auf der Heimfahrt nach Lissabon Schiffbruch gelitten habe.
Der gute Alte erging sich hierauf in Klagen über sein Mißgeschick, das ihn genöthigt, mein Geld zum Ersatz seiner Verluste und zum Ankauf der Teilhaberschaft an einem neuen Schiff zu verwenden.»Jedoch«, fügte er hinzu,»sollt Ihr, alter Freund, in Eurer bedrängten Lage nicht darunter leiden, und sobald mein Sohn heimgekehrt ist, werde ich Euch vollständig befriedigen. «Hierbei holte er einen alten Beutel hervor und händigte mir hundertundsechzig portugiesische Moidor in Gold ein. Dann übergab er mir die Dokumente über seinen Antheil an dem Schiff, mit welchem sein Sohn nach Brasilien gegangen war und das ihm zu einem, seinem Sohne zum andern Viertel eigen gehörte. Die Urkunden sollten mir nämlich als Sicherheit für den Rest meiner Forderung dienen.
Die Ehrlichkeit und Freundlichkeit des alten Mannes hatten mir jedoch das Herz so bewegt, daß ich es nicht vermochte, sein Anerbieten anzunehmen. Die Erinnerung an das, was er für mich gethan, wie er mich einst in sein Schiff aufgenommen, wie großmüthig er sich bei jeder Gelegenheit gegen mich gezeigt und wie redlich er auch jetzt wieder mir gegenüber handelte, rührte mich so, daß ich mich kaum des Weinens enthalten konnte. Ich fragte ihn, ob es denn seine Lage erlaube, daß er sich für den Augenblick einer so großen Summe entäußere, und ob es ihn auch nicht in Verlegenheit setze. Er erwiederte, allerdings könne er nicht leugnen, daß es ihm ein wenig schwer falle. Allein es sei ja mein Geld, und ich würde es wohl noch nöthiger haben als er.
Alles, was der alte Mann sagte, hatte einen so herzlichen Ausdruck, daß ich nur mit Mühe dabei meine Thränen bezwang. Ich nahm nur hundert Stück von den Moidoren an, bat um Feder und Tinte, um dem Kapitän eine Quittung auszustellen, gab ihm hierauf den Rest zurück und erklärte, daß ich, wenn ich jemals wieder in Besitz meiner Pflanzung käme, ihm auch die andere Summe wieder zurückerstatten würde. Dies ist denn auch nachmals von mir geschehen. Die Urkunde über seinen Antheil an dem Schiffe seines Sohnes weigerte ich mich entschieden anzunehmen.»Wenn ich einmal des Geldes benöthigt sein werde«, sagte ich,»so weiß ich, daß Ihr ehrlich genug seid, es mir wieder zu bezahlen; bedarf ich es aber nicht und erhalte ich dasjenige wieder, worauf Ihr mir Hoffnung macht, so will ich nie auch nur einen Pfennig davon zurück haben.«
Hierauf fragte der alte Mann, ob er die nöthigen Schritte thun solle, damit ich wiederum in den Besitz meiner Plantage käme. Auf meine Erwiederung, daß ich selbst nach Brasilien zu gehen gedächte, antwortete er:»Das könnt Ihr freilich thun, wenn Ihr Lust dazu habt; aber auch ohne das gibt es Mittel genug, Euer Recht zu sichern und Euch direkt den Besitz Eurer Einkünfte zu verschaffen«. Da nun gerade auf der Rhede von Lissabon Schiffe nach Brasilien segelfertig lagen, ließ er meinen Namen in ein öffentliches Register eintragen und stellte in eidlicher Form ein Zeugniß aus, daß ich noch am Leben und daß ich diejenige Person sei, welche ehedem das Land zu der bewußten Pflanzung angekauft habe.
Diese Urkunde ließ er von einem Notar ordnungsmäßig unterzeichnen, und ich sendete sie hierauf, mit einer Vollmacht und einem von der Hand des Kapitäns abgefaßten Schreiben begleitet, an einen jenem bekannten brasilianischen Kaufmann. Bis eine Antwort über meine Angelegenheit eintreffe, sollte ich, so schlug der Kapitän vor, bei ihm wohnen.
Jene Vollmacht wurde in allergenauester Weise vollzogen. Noch vor Ablauf von sieben Monaten empfing ich ein dickes Packet von den Hinterbliebenen meiner Mandatare, nämlich jener Kaufleute, für deren Rechnung ich hatte nach Afrika gehen sollen. Das Packet enthielt folgende Briefe und Papiere:
Erstens ein Contocorrent über die Einkünfte meiner Pflanzung seit dem Rechnungsabschluß zwischen den Erblassern der Absender und meinem alten portugiesischen Kapitän, welche Abrechnung vor sechs Jahren stattgefunden hatte. Die Berechnung ergab einen Saldo von tausendeinhundertundsiebzig Moidor zu meinen Gunsten.
Zweitens eine Rechnung über weitere vier Jahre, während deren die Correspondenten mein Vermögen verwaltet hatten, bis zu dem Zeitpunkt, in welchem das Gouvernement meine Güter als die einer verschollenen oder, wie der Kunstausdruck lautet, als einer juristisch todten Person eingezogen hatte. Diese Rechnung ergab, da die Pflanzung sich inzwischen vergrößert hatte, für mich den Betrag von dreitausendzweihunderteinundvierzig Moidor.
Drittens eine Rechnung des Priors jenes Augustinerklosters, welcher länger als vierzehn Jahre hindurch einen Theil meiner Einkünfte bezogen hatte. Der Prior zeigte in redlicher Gewissenhaftigkeit an, daß nach Abzug des für das Hospital Verwendeten noch achthundertundzweiundsiebzig Moidor übrig seien, die mir als Eigenthum gehörten. Was dagegen den Antheil des Königs anlange, so würde davon Nichts zurückerstattet werden.
Ferner enthielt das Packet auch ein Schreiben meines Compagnons, welcher mir herzlich Glück dazu wünschte, daß ich noch am Leben sei, und mir Bericht erstattete über die Vergrößerung meiner Pflanzung und deren jährlichen Ertrag. Auch genaue Angaben über die Ackerzahl der Plantage, über die Art ihrer Bebauung und wie viel Sklaven darauf gehalten würden, enthielt der Brief. Mein Partner hatte darin zweiundzwanzig Kreuze gemalt mit der Bemerkung, daß er ebenso viel Ave Maria's zur heiligen Jungfrau gebetet habe, aus Dankbarkeit dafür, daß ich noch am Leben sei. Auch lud er mich sehr dringend ein, nach Brasilien zu kommen und mein Eigenthum in Besitz zu nehmen. Einstweilen sollte ich ihm Auftrag geben, an wen er, so lange ich nicht selbst käme, meine Güter zu überliefern habe. Das Schreiben schloß mit den herzlichsten Versicherungen seiner Freundschaft und mit Grüßen seiner Familie. Als Geschenke waren demselben beigefügt sieben schöne Pantherfelle, die mein Compagnon, wie es schien, von Afrika erhalten, wohin er noch ein zweites Schiff abgesendet hatte, dem, wie es schien, eine bessere Reise beschieden gewesen war als einst mir. Auch fünf Kisten mit ausgezeichneten Delikatessen hatte mein Associé beigepackt nebst hundert ungeprägten Goldstücken, die beinahe so groß waren als Moidore. Mit demselben Schiff übersendeten die zwei Hinterbliebenen meiner Mandatare eintausendzweihundert Kisten mit Zucker und den Rest meines ganzen Guthabens in Gold.
Jetzt konnte ich wohl mit Recht sagen: Hiobs Ende ist besser gewesen als sein Anfang. Es ist unmöglich die Bewegung zu beschreiben, in die mein Herz gerieth, als ich jene Briefe las, und besonders als ich meinen ganzen Reichthum um mich versammelt hatte. Denn da die Schiffe von Brasilien immer flottenweise kommen, so langten mit den Briefen zugleich auch meine Güter an, und die letzteren lagen bereits sicher im Hafen, als mir erst die Briefe zu Handen kamen. Ich wurde bleich und unwohl vor Gemütsbewegung, und hätte der alte Mann nicht rasch einen Trunk zur Herzstärkung herbeigeholt, ich glaube, die plötzliche Freude würde mich überwältigt und auf der Stelle getödtet haben. Sogar nachher fühlte ich mich noch einige Stunden hindurch förmlich krank, bis ein herbeigeschaffter Arzt, nachdem er die Ursache meines Unwohlseins erfahren hatte, einen Aderlaß verordnete. Nach diesem bekam ich Erleichterung und fühlte mich besser; ich bin aber überzeugt, daß ich, wäre nicht auf solche Weise meinen Lebensgeistern Luft verschafft worden, vor übermäßiger Freude gestorben sein würde.
Ich sah mich nun plötzlich im Besitze von mehr als fünftausend Pfund Sterling in baarem Geld und eines Landgutes, wie ich es wohl nennen kann, in Brasilien. Das letztere ertrug mir auch über tausend Pfund jährlich, so sicher wie nur irgend ein Grundstück in England. Kurz, ich war jetzt in einer so guten Lage, daß ich kaum wußte, wie ich mich darin benehmen und wie ich sie recht genießen sollte. Das Erste, was ich that, war, daß ich meinen Hauptwohlthäter belohnte, den guten alten Kapitän, der zuerst in meinem Unglück Mitleid gezeigt hatte und von Anfang an gütig und bis zum Ende ehrlich und treu gegen mich gewesen war. Ich zeigte ihm Alles, was ich zugesandt erhalten hatte, und sagte ihm, daß ich es, nächst der göttlichen, Alles lenkenden Vorsehung, allein ihm zu danken habe, und daß es jetzt an mir sei, ihn reichlich zu belohnen.
Vor Allem gab ich ihm die hundert Goldstücke wieder, die ich von ihm erhalten hatte. Dann ließ ich einen Notar kommen und durch ihn einen in den bestimmtesten Ausdrücken gehaltenen Verzicht oder Nachlaßvertrag über die vierhundertundsiebzig Goldkronen, welche der Kapitän mir schuldig zu sein behauptete, aufsetzen. Ferner stellte ich eine Vollmacht aus, die jenen berechtigte, die jährlichen Einkünfte meiner Pflanzung für mich in Empfang zu nehmen. Das Dokument wies nämlich meinen Compagnon an, die Zahlungen an den Kapitän zu leisten und dieselben mit den regelmäßigen Postschiffen in meinem Namen an letzteren zu schicken. Die Vollmacht schloß mit einer Clausel, durch welche ich dem Kapitän hundert Goldstücke auf Lebenszeit aus den Erträgen der Waaren aussetzte und seinem Sohne nach ihm fünfzig, gleichfalls auf Lebenszeit. So vergalt ich meinem alten Freunde, was er an mir gethan hatte.
Es blieb mir nun zunächst zu überlegen, welchen Weg ich zur Verwerthung des Besitztums einschlagen sollte, das die Vorsehung so unerwartet mir anvertraut hatte. Wie viel mehr Sorgen überkamen mich jetzt als während meines stillen Lebens auf der Insel! Damals hatte ich Nichts, als was ich bedurfte; jetzt war ich zu großem Reichthum gelangt und mußte für dessen Erhaltung sorgen. Nun bot sich mir keine Höhle mehr, wo ich mein Geld verstecken konnte, kein Platz, wo es ohne Schloß und Riegel liegen durfte, bis es verschimmelte und verrostete, ehe irgend Jemand es angerührt hätte. Im Gegentheil wußte ich durchaus nicht, wo ich mein Geld hinlegen, oder wem ich es anvertrauen sollte. Mein alter Gönner, der ehrliche Kapitän, war die einzige Zuflucht, die mir blieb.
Zwar schien es zweckmäßig, daß ich mich zunächst zur Erledigung meiner brasilianischen Angelegenheiten dorthin begebe, aber vorläufig war gar nicht an eine Reise dahin zu denken, so lange ich nicht meine Geschäfte hier geordnet und meine Schätze sichern Händen übergeben hatte. Anfangs dachte ich an meine alte Freundin, die Wittwe, deren Ehrlichkeit ich kannte und von der ich wußte, daß sie treu gegen mich sein würde. Aber sie war alt und arm und konnte möglicherweise in Schulden gerathen sein. So blieb mir also nichts Anderes übrig, als selbst nach England zurückzukehren und meine Sachen dahin mitzunehmen.
Einige Monate gingen indessen darüber hin, ehe ich diesen Entschluß faßte. Jetzt, wo ich dem alten Kapitän seine früheren Wohlthaten reichlich und zu seiner Befriedigung vergolten hatte, gedachte ich auch der obengenannten armen Frau, deren Mann mein erster Wohlthäter gewesen und mir, so lange es ihm möglich gewesen war, mit Rath und That beigestanden hatte. Ich veranlaßte zunächst einen lissaboner Kaufmann, an seinen Korrespondenten in London zu schreiben, daß er ihr einen Wechsel auszahle, die Frau aufsuche und ihr in meinem Namen hundert Pfund in Gold überbringe, auch freundlich mit ihr rede und sie in ihrer Armuth mit der Versicherung tröste, daß sie, so lange ich lebe, noch fernere Unterstützungen erhalten werde. Zugleich sandte ich jeder meiner beiden in England wohnenden Schwestern hundert Pfund. Zwar lebten diese nicht in Dürftigkeit, aber sie waren doch auch nicht in glänzenden Verhältnissen. Die eine war verheirathet gewesen und jetzt Wittwe, die andere wurde von ihrem Manne nicht so gut behandelt, wie sie es verdiente.
Unter allen meinen Freunden und Verwandten jedoch wußte ich keinen, dem ich mein ganzes Vermögen anzuvertrauen gewagt hätte, so daß ich hätte nach Brasilien reisen und mein Hab und Gut in sicheren Händen zurücklassen können. Dieser Umstand machte mir große Sorgen. Früher war ich schon einmal Willens gewesen, mich ganz in Brasilien niederzulassen, denn ich hatte ja dort gewissermaßen meine Heimat. Aber allerlei religiöse Bedenken, von denen ich gleich mehr sagen werde, hatten mich damals davon zurückgehalten. Jetzt war es nicht die Religion in erster Linie, was mich bewog, nicht dahin zu reisen. So wenig ich mir früher Skrupel darüber gemacht hatte, mich öffentlich zu der Konfession des Landes zu halten, so lange ich dort lebte, ebensowenig würde ich jetzt davor Bedenken getragen haben. Nur daß ich, seitdem ich mehr darüber nachgedacht hatte, zuweilen, wenn es sich darum handelte, dort zu leben und zu sterben, anfing zu bereuen, daß ich mich jemals zur katholischen Kirche gehalten hatte. Ich hielt jetzt diesen Glauben nicht mehr für den besten, in dem man sterben kann.
Aber, wie gesagt, war dies nicht der Hauptgrund, der mich von der Reise nach Brasilien abhielt. Vielmehr lag dieser darin, daß ich wirklich nicht wußte, wem ich meine zurückbleibenden Sachen übergeben sollte. Daher beschloß ich endlich, sie mit nach England zu nehmen. Dort hoffte ich irgend eine zuverlässige Bekanntschaft zu machen, oder einen Verwandten aufzufinden, dem ich trauen könnte. So bereitete ich mich denn darauf vor, mit meinem ganzen Reichthum nach England zu reisen.
Ehe ich aber die Reise in die Heimat antrat, benutzte ich die eben abgehende Schiffspost nach Brasilien zur Beantwortung der treuen und gewissenhaften Berichte, die ich von dort erhalten hatte. An den Prior des Augustinerklosters schrieb ich einen Dankbrief für seine redliche Handlungsweise und für das Anerbieten der achthundertundzweiundsiebzig Goldkronen, indem ich auf dieselben verzichtete. Fünfhundert davon bestimmte ich dem Kloster, die übrigen dreihundertzweiundsiebzig sollten nach seinem Ermessen unter die Armen vertheilt werden. Daneben bat ich den guten Pater um seine Fürbitte für mich.
Alsdann verfaßte ich ein Schreiben an meine beiden Bevollmächtigten, worin ich ihnen meine volle Anerkennung für ihre große Gewissenhaftigkeit und Treue aussprach. Geschenke irgend einer Art konnte ich ihnen nicht anbieten, denn über dergleichen waren sie erhaben. Endlich schrieb ich noch an meinen Compagnon, lobte seinen Fleiß in der Verbesserung der Pflanzung und seine Zuverlässigkeit in Bezug auf den wachsenden Ertrag und gab ihm Anweisungen über die fernere Verwaltung meines Antheils, mit Rücksicht auf die Rechte, die ich meinem alten Freunde, dem Kapitän, zugestanden hatte. Diesem sollte mein Compagnon Alles, was mir zukommen würde, übersenden, bis er mündlich Weiteres von mir hören würde. Ferner theilte ich ihm mit, daß es meine Absicht sei, nicht nur vorübergehend zu ihm zu kommen, sondern mich sogar für den Rest meines Lebens ganz bei ihm niederzulassen. Dem Briefe fügte ich ein schönes Geschenk von italienischem Seidenzeug für seine Frau und seine beiden Töchter (der Sohn des Kapitäns hatte mir gesagt, daß er solche habe) bei, nebst zwei Stücken seinen Tuches, von dem besten, was ich in Lissabon bekommen konnte, sowie fünf Stücke schwarzen Wollenzeuges und brabanter Spitzen von beträchtlichem Werthe.
Nachdem ich diese Angelegenheiten geordnet, meine Ladung verkauft und mein ganzes Besitzthum in gute Wechsel umgetauscht hatte, überlegte ich, welchen Weg ich nach England einschlagen sollte. Ich war zwar hinlänglich an das Reisen zur See gewöhnt, dennoch aber fühlte ich eine große Abneigung dagegen, diesmal den Seeweg einzuschlagen. Einen bestimmten Grund dafür konnte ich freilich nicht angeben, aber meine Abneigung steigerte sich so, daß ich noch mehrmals, sogar als mein Gepäck schon eingeschifft war, meinen Entschluß änderte.
Es ist wahr, ich hatte schon viel Unglück auf der See gehabt, und die Erinnerung daran mochte wohl meinem Widerwillen zu Grunde liegen. Man sollte nie so starke Impulse des eigenen Gefühls in dergleichen wichtigen Lebensaugenblicken geringschätzen. Zwei von den Schiffen, die ich mir zur Reise ausersehen (in einem derselben hatte ich meine Sachen bereits eingeschifft gehabt, und bezüglich des anderen war ich schon mit dem Kapitän über die Reisebedingungen völlig einig gewesen) hatten auch wirklich Unglück auf der Reise; das eine wurde von den Arabern genommen, das andere scheiterte bei Torbay und die gesammte Mannschaft bis auf drei Leute ertrank. So wäre ich denn in jedem dieser Schiffe übel daran gewesen, und es ist schwer zu sagen, in welchem am schlimmsten.
Ein mir seit Langem bekannter Lootse, dem ich in meiner Bedrängniß mich anvertraute, drang ernstlich darauf, daß ich nicht zur See reisen sollte. Entweder, so rieth er mir, solle ich zu Lande bis nach Corogna und von dort über den Meerbusen von Biscaya nach Rochelle gehen, von wo aus die Reise nach Paris leicht und sicher sei, und dann weiter über Calais nach Dover reisen, oder aber sollte ich mich nach Madrid begeben und den ganzen Weg durch Frankreich zu Lande machen. Ich war so gegen jede Wasserreise eingenommen, daß ich mich entschloß, das Letztere zu wählen. Da ich weder Eile hatte, noch die Kosten zu scheuen brauchte, so war dies auch bei weitem der angenehmste Weg. Zur Erhöhung der Annehmlichkeit führte mir mein alter Kapitän einen Engländer zu, den Sohn eines lissaboner Kaufmanns, der sich bereit erklärte, mich zu begleiten. Später fanden sich noch zwei englische Kaufleute und zwei junge Portugiesen (welche letztere übrigens nur bis Paris mitgingen), so daß wir zusammen sechs Herren und fünf Diener waren. Die zwei Kaufleute und die beiden Portugiesen begnügten sich zu je zweien mit einem Diener, um die Kosten zu sparen; was mich selbst betraf, so hatte ich neben Freitag, der zu landesunkundig war, um diese Stelle unterwegs versehen zu können, als Bedienten einen englischen Matrosen angenommen.
So reisten wir denn von Lissabon ab. Unsere Reisegesellschaft war sehr gut beritten und bewaffnet. Wir bildeten eine förmliche kleine Kompagnie, und meine Gefährten thaten mir die Ehre an, mich zum Hauptmann derselben zu ernennen, und zwar erstens, weil ich der Aelteste von uns sei, und zweitens, weil ich zwei Bedienten hätte. In der That war ja auch von mir die Veranlassung zu der ganzen Reise ausgegangen.
Wie ich den Leser nicht mit dem Inhalt meiner Seetagebücher behelligt habe, will ich ihn auch nicht mit der ausführlichen Beschreibung meiner Landreise langweilen. Einige Abenteuer aber, die uns auf der langwierigen und beschwerlichen Reise begegnet sind, mag ich doch nicht ganz übergehen.
Kapitel 16
In Madrid angekommen, wünschten wir einige Zeit dort zu verweilen, um den spanischen Hof und alle Merkwürdigkeiten zu sehen, weil wir sämmtlich fremd in Spanien waren. Da jedoch der Sommer sich schon zum Ende neigte, mußten wir uns beeilen, weiter zu kommen. Wir verließen Madrid um die Mitte des Oktober. An der Grenze von Navarra wurden wir an mehren Orten unterwegs durch die Nachricht erschreckt, es sei so viel Schnee auf der französischen Seite des Gebirgs gefallen, so daß schon mehre andere Reisende sich genöthigt gesehen hätten, nach Pampelona zurückzukehren, nachdem von ihnen mit der äußersten Gefahr der vergebliche Versuch gemacht sei, vorzudringen.
In Pampelona selbst angekommen, fanden wir diese Aussagen bestätigt. Mir, der ich seit langer Zeit an ein heißes Klima gewöhnt gewesen war und in Ländern gelebt hatte, wo ich kaum irgend welche Kleidung an mir leiden konnte, war diese Kälte unerträglich. Auch wurde dieselbe dadurch noch empfindlicher, daß sie uns so plötzlich überfiel; denn kaum zehn Tage vorher waren wir erst aus Altkastilien gekommen, wo es nicht nur warm, sondern sogar sehr heiß gewesen war. Unmittelbar darauf aber empfanden wir jetzt einen so scharfen, schneidend kalten Wind, der von den Pyrenäen her wehte, daß wir ihn kaum aushielten und in Gefahr geriethen, Finger und Zehen zu erfrieren.
Der arme Freitag erschrak förmlich, als er die Berge völlig mit Schnee bedeckt sah und die Kälte fühlte; denn so Etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen oder empfunden. Zum Ueberfluß schneite es, während wir in Pampelona waren, ohne Unterlaß und in größter Heftigkeit und Dauer. Wie die Leute sagten, war der Winter diesmal ungewöhnlich früh eingetreten.
Die Wege, die schon vorher schwer zu passiren gewesen waren, wurden jetzt gänzlich unzugänglich. Der Schnee lag stellenweise undurchdringlich hoch, und da er nicht, wie das in den nördlichen Ländern der Fall ist, hart gefroren war, so gerieth man bei jedem Schritt in Gefahr, lebendig begraben zu werden. Wir mußten daher nicht weniger als zwanzig Tage in Pampelona bleiben. Als ich aber den Winter immer entschiedener herankommen sah und eine Besserung des Wetters immer unwahrscheinlicher wurde (in ganz Europa herrschte der strengste Winter seit Menschengedenken), schlug ich vor, wir wollten nach Fontarabia gehen und uns dort nach Bordeaux einschiffen, von wo aus die Fahrt nur ganz kurz sein würde. Während wir noch diesen Plan überlegten, kamen vier Franzosen an, welche auf der französischen Seite der Pässe ebenso aufgehalten worden waren, wie wir auf der spanischen, dann aber einen Führer gefunden hatten, welcher sie durch das Land bis an die Grenze von Languedoc und von dort aus auf solchen Wegen über das Gebirge geführt hatte, daß sie gar nicht viel vom Schnee zu leiden gehabt hatten. Wo sie je auf irgend eine größere Anhäufung von Schnee gestoßen seien, sagten sie, sei er so hart gefroren gewesen, daß er sie und ihre Pferde getragen habe. Wir schickten nach dem Führer dieser Leute, und er übernahm es, uns denselben Weg ohne Schneegefahr zu leiten, vorausgesetzt, daß wir hinreichend bewaffnet seien, um uns gegen wilde Thiere zu schützen. Denn, bemerkte er, bei diesen starken Schneefällen zeigten sich häufig Wölfe am Fuße des Gebirges, die aus Mangel an Nahrung auf dem schneebedeckten Boden sehr grimmig zu sein pflegten. Wir versicherten, genügend ausgerüstet zu sein, um es mit dieser Art Bestien aufzunehmen, wenn er uns nur gegen eine andere Art zweibeiniger Wölfe versichern wollte, welche, wie wir gehört hätten, sehr gefährlich seien, besonders auf der französischen Seite des Gebirges. Er beruhigte uns, daß wir Nichts der Art auf dem Wege zu befürchten hätten, den er uns führen würde, und darauf hin erklärten wir uns bereit, ihm zu folgen. Auch zwölf andere Herren, mit ihren Bedienten, Franzosen und Spanier, die den Uebergang vergeblich versucht hatten, schlossen sich uns jetzt an.
Am 15. November brachen wir mit unserem Führer von Pampelona auf. Ich war nicht wenig erstaunt, als er, anstatt vorwärts zu gehen, denselben Weg, etwa zwanzig Meilen, rückwärts verfolgte, auf welchem wir von Madrid her gekommen waren. Nachdem wir über zwei Flüsse gesetzt waren und die Ebene erreicht hatten, fanden wir uns wieder in einem warmen Klima, wo das Land blühend und kein Schnee zu sehen war. Plötzlich aber wendete unser Geleitsmann sich links und näherte sich dem Gebirge auf einem andern Wege. Die Berge und Abgründe vor uns sahen schauerlich aus, aber unser Führer machte so viele Umwege und führte uns in solchen mäandrischen Schlangenlinien, daß wir ganz unmerklich die Höhe überschritten, ohne viel vom Schnee belästigt zu sein. Auf einmal zeigte er uns die fruchtbaren Provinzen Languedoc und Gascogne, ganz grün und blühend, aber in weiter Ferne, von der uns noch eine geraume Strecke Weges trennte.
Wir wurden jetzt einigermaßen dadurch in unserem Behagen gestört, daß es eine ganze Nacht und einen Tag so stark schneite, daß wir nicht weiter reisen konnten. Unser Führer beruhigte uns aber mit der Versicherung, es würde bald Alles überstanden sein. So stiegen wir denn, unserem Manne vertrauend, immer in nördlicher Richtung weiter hinab. Eines Abends, etwa zwei Stunden vor Einbruch der Nacht, als unser Führer gerade etwas vorangegangen und augenblicklich nicht in Sicht war, brachen plötzlich aus einem Hohlweg, der in einem dichten Walde endigte, drei ungeheure Wölfe hervor, denen ein Bär folgte. Zwei von den Wölfen stürzten sich auf den Führer, und wäre er nur wenig entfernter von uns gewesen, so würde er unfehlbar zerrissen worden sein, ehe wir ihm hätten zu Hülfe kommen können. Der eine Wolf stürzte sich auf das Pferd, während der andere den Mann mit solcher Heftigkeit anfiel, daß dieser nicht Zeit oder auch nicht Geistesgegenwart genug hatte, seine Pistole hervorzuziehen. Vielmehr schrie er nur aus Leibeskräften nach uns um Hülfe. Ich gebot Freitag, der mir zunächst ritt, nachzusehen, was es gäbe. Sobald jener den Führer erblickte, schrie er ebenso laut als letzterer:»Ach, Herr! Ach, Herr!«Aber ein tapferer Bursch, wie er war, ritt er sofort zu dem armen Menschen hin und schoß dem Wolf, der ihn angefallen hatte, eine Pistole vor den Kopf. Es war ein Glück für den Führer, daß gerade Freitag ihm zu Hülfe kam, der, von seinem Vaterlande her an diese Art Thiere gewöhnt, sich nicht vor ihnen fürchtete. Er machte sich dicht heran und schoß aus der Nähe, während jeder Andere von uns aus einer größeren Entfernung gefeuert und dann vielleicht entweder den Wolf verfehlt, oder den Mann selbst der Gefahr des Erschießens ausgesetzt haben würde.
Das Ereigniß war übrigens schlimm genug, um auch einen Tapferern als mich zu erschrecken. Wir entsetzten uns sämmtlich, als sich auf den Knall von Freitags Pistole von beiden Seiten ein schauerliches Geheul der Wölfe erhob. Das Echo der Berge verdoppelte den Laut so, daß er uns den Eindruck machte, als ob wir von einer großen Menge solcher Bestien umgeben seien. Wahrscheinlich waren ihrer auch in der That nicht so wenige, daß wir nicht alle Ursache gehabt hätten, uns zu fürchten. Indessen hatte, nachdem Freitag den einen Wolf erlegt, der andere das Pferd sogleich losgelassen und die Flucht ergriffen. Da er glücklicherweise den Kopf des Pferdes angefallen, wo ihm das Zaumzeug zwischen die Zähne gerathen war, hatte er noch nicht viel Schaden gethan. Der Mann jedoch war schwer verletzt. Das hungrige Thier hatte ihn zweimal gebissen, zuerst in den Arm und dann etwas oberhalb des Knies, und er war eben im Begriff gewesen vom Pferde zu fallen, als Freitag dazu kam und den Wolf erschoß.
Man kann sich leicht vorstellen, daß wir alle bei dem Schuß von Freitags Pistole unsern Zug beschleunigten und so schnell, als die sehr mangelhafte Beschaffenheit des Weges es gestattete, zur Stelle ritten, um zu sehen, was vorgefallen sei. Sobald wir aus den Bäumen, die uns vorher an der freien Aussicht gehindert hatten, heraustraten, übersahen wir im Augenblick, wie die Sachen standen, und daß Freitag den armen Führer schon befreit hatte. Doch erkannten wir nicht alsbald, was für ein Thier das getödtete war.
Niemals aber ist wohl ein Kampf so kühn und in so überraschender Weise ausgefochten worden, als der, welcher nun zwischen Freitag und dem Bären folgte. Obgleich wir anfangs für Freitag fürchteten und sehr erschrocken waren, so bot dieses Gefecht doch für uns alle das unterhaltendste Schauspiel, welches man sich nur denken kann. Der Bär ist ein schweres, plumpes Geschöpf und kann nicht so springen wie der Wolf, der schlank und leicht gebaut ist. Daher wird des Bären Verhalten hauptsächlich durch zwei Eigenschaften bestimmt. Er fällt Menschen für gewöhnlich nicht an, wenn ihn nicht das Uebermaß des Hungers treibt, wie es damals der Fall war, wo der Boden über und über mit Schnee bedeckt lag. Wenn du einem Bären im Walde begegnest und ihn nicht beachtest, so wird er sich auch nicht um dich bekümmern; du mußt jedoch ihn sehr höflich behandeln und ihm den Vortritt lassen, denn er ist ein sehr vornehmer Herr und wird um keines Fürsten willen auch nur einen Schritt von seinem Wege abweichen. Fürchtet man sich, so thut man am besten, ihn gar nicht anzusehen und ruhig weiter zu gehen. Denn wenn man stehen bleibt und ihn fest ansieht, so nimmt er das übel. Wirft man aber mit irgend Etwas nach ihm und trifft ihn, wäre es auch nur mit einem fingerlangen Stückchen Holz, so fühlt er sich beleidigt und setzt Alles bei Seite, um Rache zu nehmen. In diesem Falle nämlich verlangt er Satisfaktion. Dies ist die eine seiner Eigenschaften; die andere besteht darin, daß er, einmal gereizt, nicht ablassen wird, dich Tag und Nacht zu verfolgen, bis er sich gerächt hat. Er verfolgt seinen Beleidiger unermüdlich Tag und Nacht, bis er ihn endlich eingeholt hat.
Als wir herzukamen, hatte Freitag bereits unsern Führer gerettet und war eben beschäftigt, ihm vom Pferde zu helfen. Der arme verwirrte und äußerst erschrockene Mensch schien mehr entsetzt als schwer verwundet zu sein. Plötzlich sahen wir den Bären aus dem Walde treten, ein ungeheures Thier, bei weitem der größte, den ich je gesehen habe. Wir waren alle nicht wenig überrascht, als aber Freitag ihn erblickt, bemerkten wir sofort den Ausdruck von Freude und Muth auf seinem Gesichte.»Oho!«rief er und zeigte auf das Thier hin.»Ach, Herr! mir geben Erlaubniß, ich ihm die Hand drücken, ich Euch lachen machen will.«
Ich war verwundert, den Burschen so vergnügt zu sehen.»Du Narr«, sagte ich,»er wird dich auffressen.«»Mich auffressen! mich fressen!«wiederholte Freitag;»ich ihn fressen, ich Euch gut lachen machen; Ihr alle hierbleiben, ich Euch Etwas zeigen will. «Damit kauerte er nieder, zog im Nu seine Stiefel aus, legte ein Paar Sandalen (flache Schuhe, wie die Wilden sie tragen) dafür an, die er in der Tasche bei sich hatte, gab meinem andern Diener sein Pferd zu halten und eilte wie der Wind mit seiner Flinte davon.
Der Bär marschirte ruhig vorwärts, ohne sich um irgend Jemanden zu bekümmern. Als Freitag ziemlich nah an ihn herangekommen war, rief er ihn an, als ob das Thier ihn verstehen könnte.»Höre, höre!«rief Freitag,»ich mit dir sprechen will. «Wir folgten von ferne. Seit wir uns auf der gascogner Seite des Gebirges befanden, waren wir in eine weite große Haide eingetreten, wo der Boden ziemlich flach und eben und mit vielen hier und da zerstreut stehenden Bäumen bepflanzt war. Freitag blieb dem Bären dicht auf den Fersen und hielt gleichen Schritt mit ihm. Jetzt hob er einen großen Stein auf, warf nach ihm und traf ihn gerade an den Kopf. Das schadete der Bestie aber nicht mehr, als hätte er gegen die Wand geworfen. Dennoch erfüllte es Freitags Zweck. Der Bursch war so furchtlos, daß er den Wurf nur gethan, um den Bären auf sich zu hetzen und uns dadurch zu vergnügen. Als das Thier den Wurf fühlte und seinen Feind erblickte, machte es Kehrt und wendete sich mit verteufelt langen Sätzen gegen jenen. Ein Pferd hätte sich in einen hübschen Galopp setzen müssen, um ihm nachzukommen. Hierauf lief Freitag fort, in der Richtung, als wolle er bei uns Schutz suchen. Wir alle machten uns bereit, zugleich auf den Bären zu schießen und meinen Diener zu retten. Doch war ich ungehalten auf diesen, daß er den Bären gereizt, während dieser ruhig seinen Weg in einer anderen Richtung verfolgt hatte. Besonders ärgerte ich mich darüber, daß er, nachdem er den Bären auf uns gehetzt, fortgelaufen war. Ich rief ihm zu:»Du Schlingel, willst du uns auf diese Manier lachen machen? Schnell auf dein Pferd, damit wir die Bestie todtschießen können«. Er antwortete:»Nicht schießen, nicht schießen; stille stehen, Ihr lachen sollen«; und dabei lief der behende Bursch zwei Schritte, wenn der Bär einen machte, drehte sich plötzlich nach der Seite um, und eine große Eiche erblickend, wie sie seinem Zweck entsprach, winkte er uns, zu folgen. Nun verdoppelte er seine Eile und kletterte behende auf den Baum, nachdem er seine Flinte fünf bis sechs Schritte von sich entfernt auf den Boden gelegt hatte. Der Bär erreichte den Baum bald. Wir folgten von Weitem. Zunächst blieb das Thier bei der Flinte stehen, roch daran, ließ sie dann liegen und kletterte, trotz seiner gewaltigen Schwere, wie eine Katze den Baum hinan. Ich war entsetzt über die vermeintliche Thorheit meines Freitag und konnte bis jetzt durchaus nichts Lächerliches an der Sache finden.
Sobald wir den Bären in den Baum klettern sahen, ritten wir alle näher heran und sahen Freitag an dem dünnen Ende eines großen Astes hängen und den Bären auf halbem Wege eben dahin gekommen. Jetzt gelangte die Bestie an die Stelle, wo der Ast anfing schwächer zu werden.»Aha!«rief Freitag uns zu,»jetzt sehen, wie den Bären ich tanzen lehre«, dabei wiegte und schaukelte er den Zweig, daß der Bär anfing zu schwanken, innehielt und anfing sich nach dem Rückzug umzusehen. Nun lachten wir wirklich herzlich. Aber Freitag hatte noch lange nicht genug. Als er das Thier innehalten sah, rief er es von Neuem an, als ob es Englisch verstehe:»Wie, du nicht weiter kommst? Bitte weiter kommen!«Er hörte jetzt auf zu schaukeln und den Ast zu schütteln, und der Bär, als habe er wirklich verstanden, was Freitag gesagt hatte, begab sich wieder ein wenig vorwärts. Dann fing jener aufs Neue an zu schütteln, bis der Bär abermals stillestand. Wir meinten, jetzt sei es Zeit, ihm eins auf den Pelz zu brennen, und riefen Freitag zu, er möge sich still halten, damit wir auf den Bären schießen könnten. Er aber rief eifrig:»O bitte, bitte! nicht schießen, ich schon schießen werde, wenn Zeit«.
Kurz gesagt, Freitag tanzte so lange, und der Bär balancirte so komisch, daß wir wirklich herzlich lachen mußten. Immer aber konnten wir noch nicht begreifen, was der Bursch eigentlich vorhabe. Anfangs glaubten wir, er habe es darauf abgesehen, den Bären abzuschütteln, dazu aber war dieser zu schlau, denn er ging nie so weit vor, daß er hätte herunterfallen können, sondern hielt sich beständig ganz fest mit seinen großen Tatzen und Füßen. Wir konnten nicht einsehen, was eigentlich daraus werden und worauf der Spaß hinauslaufen sollte. Bald aber brachte uns Freitag außer Zweifel darüber. Als er sah, daß der Bär sich ganz fest an den Zweig geklammert hielt und sich nicht verlocken ließ, weiter vorwärts zu kommen, rief er:»Gut, gut, wenn du nicht weiter kommen, ich selbst gehen will; wenn du nicht zu mir kommen, ich gehen und zu dir kommen werde«. Damit kletterte er bis an das äußerste, dünnste Ende des Zweiges vor, welches sich unter seiner Last bog, und ließ sich auf diese Weise langsam zur Erde nieder, indem er den Zweig tief genug hinabzog, um auf seine Füße springen zu können. Dann lief er dahin, wo seine Flinte lag, nahm dieselbe auf und blieb stehen.
«Nun, Freitag«, rief ich ihm zu,»was soll's jetzt werden? Warum schießest du ihn nicht todt?«—»Nicht schießen«, sagte Freitag,»noch nicht. Wenn jetzt schießen, nicht treffen; warten, Euch nochmal lachen machen. «Und wirklich, das that er, wie man sogleich sehen wird. Denn als der Bär seinen Feind sich nicht mehr gegenüber sah, trat auch er seinen Rückzug von dem Zweige an, aber sehr bedächtig, sich bei jedem Schritte umsehend und rückwärts gehend, bis er die Mitte des Baumes erreicht hatte, dann ließ er sich gleichfalls rückwärts an dem Stamm herunter, indem er sich mit den Vorderpfoten festhielt und einen Fuß nach dem andern sehr langsam weiter bewegte. Jetzt nun, als der Bär eben seine erste Hintertatze auf den Boden setzte, trat Freitag dicht an ihn heran, legte die Mündung seines Flintenlaufes in sein Ohr und schoß ihn todt. Dann drehte sich der Schelm um, um zu sehen, ob wir auch lachten, und da er uns ansah, daß wir uns wirklich sehr amüsirten, brach er selbst in ein lautes Gelächter aus.»So wir Bären todt machen in meinem Lande«, sagte Freitag.»So tödtet ihr sie?«erwiederte ich,»wie ist denn das möglich? ihr habt ja gar keine Flinten.«—»Nein«, erwiederte er,»keine Flinten, aber schießen mit viel großen Pfeilen.«
Die Sache hatte uns zwar viel Vergnügen gemacht, aber was das Schlimme dabei war, wir befanden uns jetzt in einer ganz wilden Gegend mit einem verwundeten Führer und wußten nicht, was wir anfangen sollten. In meinen Ohren klang noch immer das Geheul der Wölfe, und wirklich, ausgenommen das Geräusch, welches ich einst an der afrikanischen Küste hörte (wovon seiner Zeit erzählt ist), habe ich nie etwas Anderes gehört, was mich mit gleichem Entsetzen erfüllt hätte.
Dieser Umstand und das Herannahen des Abends trieb uns vorwärts, sonst würden wir gewiß, wie Freitag gern wollte, das Fell des Bären abgezogen haben, denn es war wohl werth, mitgenommen zu werden. Da wir aber noch beinahe drei Meilen zurückzulegen hatten und unser Führer zur Eile ermahnte, so ließen wir das ungeheure Thier liegen und setzten unsere Reise fort.
Der Boden war noch immer mit Schnee bedeckt, wenn auch nicht mehr so tief und so gefährlich wie auf den Bergen. Die Raubthiere waren, wie wir später hörten, von Hunger getrieben in den Wald und die Ebene herabgekommen, um Nahrung zu suchen. In den Dörfern hatten sie großen Schaden angerichtet, das Landvolk überfallen und viele Schafe und Pferde und sogar einige Menschen getödtet. Noch eine gefährliche Stelle blieb uns zu passiren, von der unser Führer uns sagte, daß, wenn überhaupt noch Wölfe in der Umgegend wären, wir sie dort antreffen würden. Dies war eine kleine, von allen Seiten mit Wald umgebene Ebene, an die sich ein langer schmaler Hohlweg anschloß, durch den wir mußten, um den Wald zu verlassen und das Dorf zu erreichen, wo wir übernachten wollten. Es war eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, als wir in das Gehölz eintraten. Bald darauf erreichten wir die Ebene. Bis jetzt hatten wir weiter nichts gesehen, als daß auf einer kleinen Lichtung, die nicht über zwei Klafter breit war, fünf große Wölfe in vollem Laufe einer hinter dem andern her über den Weg setzten, als ob sie einer Beute nachjagten und dieselbe schon im Auge hätten. Sie nahmen keine Notiz von uns und waren in wenigen Augenblicken aus unserem Gesichtskreis verschwunden. Unser Führer, der, beiläufig gesagt, ein erbärmlicher Feigling war, ermahnte uns, uns bereit zu halten, denn er glaubte, es seien noch mehr Wölfe im Anzuge. Wir hielten unsere Waffen in Bereitschaft und blickten aufmerksam umher, sahen aber keine Wölfe weiter, bis wir aus dem Walde, der fast eine halbe Meile lang war, heraus und in die Ebene gelangt waren. Sobald wir uns im Freien befanden, gab es Allerlei zu sehen. Das Erste, was uns in die Augen fiel, war ein todtes Pferd. Das arme Thier war von den Wölfen zerrissen, und zwölf der Bestien waren noch damit beschäftigt, nicht sowohl davon zu fressen, als vielmehr die Knochen abzunagen, denn das Fleisch hatten sie schon alles verschlungen. Wir hielten es nicht für rathsam, sie bei ihrem Mahle zu stören, und ihrerseits achteten sie auch nicht viel auf uns. Freitag wollte auf sie schießen, aber ich verbot es ihm entschieden, denn ich fürchtete, daß wir bald mehr zu thun bekommen würden, als es bis jetzt den Anschein hatte.
Wir hatten die Ebene noch nicht zur Hälfte hinter uns, als wir auch schon in dem Walde zur Linken ein schreckliches Wolfsgeheul hörten und gleich darauf etwa hundert Stück der Bestien geraden Wegs auf uns zukommen sahen. Sie liefen fast alle in gerader Linie neben einander, so regelmäßig wie ein von geschulten Offizieren kommandiertes Regiment Soldaten. Ich wußte nicht recht, auf welche Weise wir sie empfangen sollten, doch hielt ich es für das Beste, wenn wir gleichfalls eine geschlossene Linie bildeten. In einem Augenblick waren wir denn auch in einer solchen aufgestellt. Damit aber so wenig wie möglich Pausen eintraten, ordnete ich an, daß zuerst nur der je zweite Mann feuern und die Anderen, die nicht geschossen hätten, sich bereit halten sollten, gleich darauf eine zweite Salve folgen zu lassen, wenn der Feind fortfahren würde vorzudringen. Diejenigen, welche zuerst geschossen hätten, sollten sich dann nicht damit aufhalten, ihre Gewehre wieder zu laden, sondern inzwischen ihre Pistolen in Bereitschaft halten; denn wir waren jeder mit einer Büchse und ein Paar Pistolen bewaffnet. Nach diesem Plane waren wir im Stande sechs Salven abzufeuern, jedesmal die Hälfte von uns zugleich. Indessen fürs Erste wurde das gar nicht nöthig; denn nach den ersten Schüssen machte der Feind Halt und schien sowohl vom Knall als vom Feuer erschreckt zu sein. Vier der Wölfe stürzten an den Köpfen getroffen zu Boden und mehre andere waren verwundet und liefen blutend davon, so daß wir die Spuren auf dem Schnee bemerken konnten. Als ich sah, daß sie stutzten, sich aber nicht sogleich zurückzogen, fiel mir ein, daß ich einmal gehört hatte, auch die wildesten Thiere fürchteten sich vor der menschlichen Stimme. Ich forderte daher unsere ganze Gesellschaft auf, aus vollem Halse zu schreien. Die Angabe bestätigte sich, denn auf unser Geschrei wendeten sich die Bestien um und begannen sich zu entfernen. Hierauf ließ ich eine zweite Ladung hinter ihnen hergeben, auf welche sie sich in Galopp setzten und in den Wald rannten. Wir hatten jetzt Zeit unsere Gewehre wieder zu laden, was wir, um uns nicht aufzuhalten, im Weiterreiten thaten. Kaum waren wir aber damit fertig und wieder zu neuer Vertheidigung gerüstet, als wir auch schon einen schrecklichen Lärm in demselben Walde zur Linken vernahmen, nur weiter entfernt in der Richtung, die wir einzuschlagen hatten.
Jetzt brach die Dämmerung herein und das verschlimmerte unsere Lage sehr. Der Lärm wuchs und ließ sich bald als das Heulen und Bellen dieser höllischen Geschöpfe unterscheiden. Auf einmal erblickten wir drei Rudel Wölfe, eins zur Linken, eins hinter uns und ein drittes vor uns, so daß wir ganz umringt zu sein schienen. Da sie uns aber nicht angriffen, setzten wir unsern Weg fort, so schnell uns die Pferde tragen konnten. Der Weg war aber sehr beschwerlich und wir konnten daher nicht starken Trab reiten. Auf diese Art gelangten wir nur langsam an den Eingang desjenigen Gehölzes, das wir am Ende der Ebene zu passiren hatten.
Wie groß war aber unser Entsetzen, als wir beim Näherkommen eine unzählige Menge Wölfe gerade in dem Eingang des Passes stehen sahen. Plötzlich vernahmen wir von einer andern Richtung her den Knall einer Flinte, und als wir dahinaus uns umsahen, sprang ein Pferd mit Sattel und Zaum heraus, mit Windeseile fliehend, und sechzehn bis siebzehn Wölfe hinterher in vollem Laufe. Das Pferd hatte zwar einen Vorsprung vor ihnen, aber da wir vermutheten, es würde nicht lange in diesem Tempo aushalten können, so zweifelten wir nicht, daß sie es zuletzt doch noch einholten, was gewiß auch geschehen ist. Bald darauf bot sich uns ein grauenvoller Anblick. Nach der Richtung hinreitend, wo das Pferd herausgekommen war, fanden wir den Leichnam eines andern Pferdes und zweier Menschen, welche von den gierigen Thieren zerrissen worden waren. Einer der Männer war ohne Zweifel derselbe, den wir die Flinte hatten abschießen hören, denn dicht neben ihm lag ein eben abgefeuertes Gewehr, dem Manne selbst aber war der Kopf und der Oberkörper abgefressen. Wir wußten vor Schrecken nicht, was wir thun sollten. Die Thiere brachten uns aber bald zum Entschluß, indem sie sich, nach Beute hungrig, um uns versammelten. Ich glaube wahrhaftig, es waren ihrer an die dreihundert. Zu unserem Vortheil aber lagen gerade am Eingang in den Wald einige große Baumstämme, die im letzten Sommer gefällt und zum Transport dorthin gelegt schienen. Ich zog meine kleine Truppe innerhalb dieser Holzstöcke zusammen und befahl, nachdem wir uns in einer Reihe hinter einem der größten aufgestellt, daß Alle absitzen, die Stämme als eine Brustwehr benutzen und die Pferde in der Mitte eines Dreiecks einschließen sollten. Diese Vorkehrung bewährte sich sogleich; denn in unerhörter Wuth griffen uns die Bestien alsbald an. Sie kamen brüllend auf uns zu und erkletterten den Holzstoß, der uns zur Brustwehr diente, um sich geraden Weges auf ihre Beute loszustürzen. Ihre Wuth war wahrscheinlich besonders dadurch hervorgerufen, daß sie unsere Pferde hinter uns sahen, auf welche sie es besonders abgesehen hatten. Ich befahl meinen Leuten, wie vorhin zu schießen, einer um den andern, und sie zielten auch so sicher, daß sie gleich beim ersten Schusse eine Anzahl der Wölfe tödteten. Es war jedoch nothwendig, ein ununterbrochenes Feuer zu erhalten; denn wie die Teufel stürmten die Bestien vor, die Hinteren immer den Vorderen nachdrängend.
Als wir die zweite Salve abgeschossen hatten, hielten sie ein wenig inne, und ich hoffte schon, sie würden weichen, aber es war nur eine augenblickliche Pause, denn alsbald drangen andere vorwärts. So schossen wir nun zwei Pistolenschüsse ab und hatten, glaube ich, in diesen vier Salven siebzehn oder achtzehn von ihnen getödtet und noch einmal so viel gelähmt. Dennoch rückten sie von Neuem vor. Da ich fürchtete, wir würden unsere Munition zu schnell verschießen, rief ich meinen zweiten Diener (nicht Freitag, denn der war besser verwendet, er hatte nämlich immer mit größter Gewandtheit seine und meine Büchse wieder geladen, während wir kämpften), gab ihm ein Pulverhorn und gebot ihm, einen langen Strich des Holzstoßes damit zu bestreuen. Das that er denn und hatte nur eben Zeit davon zu eilen, als die Wölfe auch schon heran kamen. Sobald einige von ihnen auf das Pulver traten, feuerte ich eine Pistole auf das Pulver ab und steckte es damit in Brand. Diejenigen von den Thieren, die schon auf dem Holzstoß waren, wurden arg verbrannt, und sechs oder sieben von ihnen stürzten oder sprangen vielmehr von dem Feuer gereizt und geängstigt zwischen uns. Mit diesen wurden wir im Augenblick fertig, die übrigen aber waren so erschreckt von dem Feuerblitz, welchen die Nacht (denn es war inzwischen fast ganz finster geworden) noch schrecklicher erscheinen ließ, daß sie ein wenig zurückwichen. Darauf befahl ich unsre letzten Pistolen auf einmal abzuschießen und dann ein Geschrei zu erheben. Nun machten die Wölfe Kehrt. Wir warfen uns sofort auf etwa zwanzig verwundete, die sich auf dem Boden wälzten, und bearbeiteten sie mit unsern Schwertern. Dies erfüllte vollständig unsern Zweck, denn das Geheul und Gebrüll, welches sie anstimmten, wurde von ihren Gefährten sehr wohl verstanden, so daß sie alle flohen und uns verließen.
Wir hatten Alles in Allem ungefähr sechzig Stück getödtet. Wäre es Tag gewesen, würden wir noch mehr erlegt haben. Da das Schlachtfeld nun wieder gesäubert war, setzten wir unsern Weg alsbald weiter fort, denn es blieb uns noch immer beinah eine Meile zurückzulegen. Wir hörten die Raubthiere in den Wäldern heulen und winseln, während wir vorwärts ritten, und zuweilen glaubten wir auch einige zu sehen, aber der Schnee blendete so, daß wir unserer Sache nicht gewiß waren. So gelangten wir denn in ungefähr einer Stunde nach dem Ort, wo wir übernachten sollten. Wir fanden die Bewohner in großer Aufregung und unter den Waffen. Wie es schien, hatten die Wölfe und einige Bären in der vorigen Nacht den Ort überfallen und großen Schrecken verbreitet, daher sich die Leute genöthigt sahen, Tag und Nacht, besonders aber während der letztern, um Vieh und Menschen zu schützen, Wache zu halten.
Am nächsten Morgen war unser Führer so krank, seine Glieder waren so sehr angeschwollen und die beiden Wunden schmerzten ihn dermaßen, daß er nicht weiter mitreiten konnte. Wir sahen uns daher genöthigt, einen anderen Geleitsmann anzunehmen, der uns nach Toulouse bringen sollte. Dort fanden wir warmes Wetter und ein blühendes fruchtbares Land, frei von Schnee und von Wölfen. Als wir in Toulouse unsere Abenteuer erzählten, sagten die Leute, das sei etwas ganz Gewöhnliches in der großen Haide am Fuße des Gebirges, besonders wenn der Boden mit Schnee bedeckt läge. Sie waren verwundert, daß wir einen Führer gefunden hätten, der uns bei der strengen Jahreszeit diesen Weg geführt, und sagten, es wäre erstaunlich, daß wir nicht alle umgekommen seien. Als wir ihnen erzählten, wie wir uns aufgestellt hatten und die Pferde in die Mitte genommen, tadelten sie das sehr und sagten, es wäre fünfzig gegen eins zu wetten gewesen, daß wir alle auf diese Art zerrissen werden würden. Denn gerade der Anblick der Pferde pflege die Wölfe so wüthend zu machen, und sie hätten es auf diese besonders abgesehen. Zu andern Zeiten fürchteten sie sich vor Flintenschüssen, aber wenn sie durch den furchtbaren Hunger grimmig wären, machte sie die Begierde, an die Pferde zu gelangen, unempfindlich gegen jede Gefahr. Nur durch das unausgesetzte Feuern und durch die Pulvermine seien wir ihrer Herr geworden. Wären wir dagegen ruhig auf unseren Pferden sitzen geblieben und hätten wir im Reiten gekämpft, so würden sie die Pferde nicht so ausschließlich als ihre Beute angesehen haben, als in jenem Falle, wo diese keine Menschen auf dem Rücken zu tragen hatten. Ferner, sagten sie uns noch, wenn wir, zum Aeußersten gedrängt, uns alle zusammengestellt und die Pferde preisgegeben hätten, so würden die Wölfe mit solcher Gier über die Thiere hergefallen sein, daß wir sicher davon gekommen wären, besonders da wir mit Gewehren versehen und so zahlreich gewesen seien. Ich meinerseits hatte mich nie in meinem Leben in solcher Gefahr gefühlt, als da ich die dreihundert Teufel so heulend und mit gähnenden Rachen auf uns losstürzen sah und keinen Schutz- und Zufluchtsort entdecken konnte. Ich hatte mich schon gänzlich verloren gegeben, und ich glaube, es wird mich nicht gelüsten, je wieder diese Berge zu übersteigen. Lieber noch will ich tausend Meilen zu See machen, und sollte ich auch in jeder Woche einen Sturm erleben.
Von meiner Reise durch Frankreich habe ich nichts Ungewöhnliches zu berichten, außer was andere Reisende bereits viel interessanter erzählt haben, als ich es vermöchte. Von Toulouse ging ich nach Paris, von dort, ohne mich lange aufzuhalten, weiter nach Calais. Hierauf landete ich am 14. Januar nach einer außerordentlich kalten und anstrengenden Reise in Dover.
Nachdem ich nun wieder an dem Ausgangspunkt aller meiner Reisen angelangt war, befand ich mich binnen Kurzem auch im Besitz meines ganzen neu erworbenen Reichthums; denn die Wechsel, welche ich mitgebracht hatte, wurden mir bereitwilligst ausbezahlt.
Meine beste Anleitung und mein Geheimerath war die gute alte Wittwe, die aus Dankbarkeit für das Geld, welches ich ihr geschickt hatte, keine Mühe scheute und keine Sorge zu groß fand, um mir zu dienen. Ich vertraute ihr auch so unbedingt, daß ich ganz ruhig über die Sicherheit meines Eigenthums lebte. In der unwandelbaren Redlichkeit dieser guten Frau habe ich stets ein wahres Glück für mich gesehen.
Bald darauf kam mir der Gedanke, meine Güter in der Verwahrung meiner Freundin zu lassen und mich nach Lissabon und von da nach Brasilien einzuschiffen. Diesmal aber stellte sich mir als Hauptbedenken die Religion in den Weg. Schon während ich mich noch in der Fremde aufgehalten und besonders in meiner Einsamkeit waren mir einige Zweifel über den katholischen Glauben aufgestiegen. Ich wußte, daß ich mich nicht nach Brasilien begeben, am wenigsten aber mich dort gänzlich niederlassen könne, wenn ich nicht entschlossen sei, mich ohne Rückhalt in den Schooß der katholischen Kirche zu begeben; es hätte denn sein müssen, daß ich Lust trüge, mich für meine Ueberzeugungen zu opfern, ein religiöser Märtyrer zu werden und durch die Inquisition zu sterben. Daher entschied ich mich denn dafür, in der Heimat zu bleiben und von hier aus, wenn es möglich sei, über meine Pflanzung zu disponiren.
In dieser Absicht schrieb ich an meinen alten Freund in Lissabon, dessen Antwort dahin lautete, daß er mit Leichtigkeit von dort aus die Anordnungen über mein Eigenthum treffen könnte. Wenn ich ihm aber erlauben wolle, dasselbe in meinem Namen jenen beiden in Brasilien als Kaufleute lebenden Nachkommen meiner Bevollmächtigten, welche den Werth meiner Besitzung genau kennten, an Ort und Stelle wohnten und, wie er wisse, sehr reich seien, zum Kaufe anzubieten, so würden diese, wie er glaube, sich gern dazu bereit finden lassen. Er zweifle auch nicht, daß ich mindestens vier- bis fünftausend Piaster bei dem Verkauf gewinnen würde.
Hiermit war ich völlig einverstanden. Ich gab dem Kapitän Auftrag, die Offerte zu machen, und als nach Ablauf von acht Monaten das Schiff zurückgekehrt war, meldete er mir, daß jene Beiden das Anerbieten angenommen und dreiunddreißigtausend Piaster einem ihrer Correspondenten in Lissabon mit dem Auftrag zur Auszahlung überschickt hätten.
Ich unterzeichnete hierauf den mir von Lissabon überschickten Kaufkontrakt in aller Form Rechtens und schickte ihn an meinen alten Freund, der mir dafür zweiunddreißigtausend und achthundert spanische Thaler als Kaufsumme für meine Plantage in Wechseln übermachte. Bei dem Verkauf war ein Rest des Kaufgeldes zurückbehalten, der als Rentenkapital für jene hundert Moidor, die ich für den alten Kapitän, und für die fünfzig Moidor, die ich für dessen Sohn auf Lebenszeit ausgesetzt hatte, dem Vertrag gemäß auch ferner auf meiner Plantage haften sollten.
So habe ich denn Bericht erstattet von dem ersten Theil meines schicksal- und abenteuerreichen Lebens, eines Lebens, das ein gar wunderbares Gewebe der Vorsehung darstellt, und das so reich an Abwechselung war, wie es die Welt wohl nur selten wird aufweisen können. In Thorheit war es begonnen, aber dennoch hatte es bei weitem glücklicher geendet, als irgend ein Theil desselben mir zu hoffen das Recht gegeben hätte.
Man sollte nun wohl glauben, in meiner jetzt so guten Vermögenslage sei ich darüber hinaus gewesen, noch an weitere Wagnisse zu denken; und das würde auch in der That wohl der Fall gewesen sein, wenn nicht gewisse Umstände obgewaltet hätten. Ich war nun einmal an ein unstätes Leben gewöhnt, hatte weder Familie, noch ausgedehnte Verwandtschaft, noch auch, trotz meines Reichthums, sonstigen großen Verkehr. Dazu kam, daß ich, wiewohl ich meine Pflanzung in Brasilien verkauft hatte, doch die Erinnerung an dieses Land nicht aus dem Sinne schlagen konnte und große Lust trug, wieder einmal dahin einen Ausflug zu machen. Besonders lebhaft aber war mein Verlangen, meine Insel einmal wiederzusehen und zu erfahren, ob die armen Spanier sich dort befänden und wie sie von jenen zurückgelassenen Schuften behandelt worden seien. Meine treue Freundin aber, die Wittwe, rieth mir sehr von einer weiteren Reise ab und vermochte auch so viel über mich, daß sie mich fast sieben Jahre lang von meinem Plane, über See zu gehen, abhielt.
Während dieser Zeit nahm ich mich zunächst meiner beiden Neffen an, der Kinder des einen meiner Brüder. Der Aelteste besaß etwas Vermögen, das ich, nachdem ich ihn standesgemäß erzogen, durch ein Vermächtniß auf meinen Todesfall vermehrte. Den Anderen ließ ich zum Seekapitän ausbilden, und als ich ihn nach Ablauf von fünf Jahren zu einem verständigen, tapfern und unternehmungslustigen jungen Mann herangewachsen sah, übergab ich ihm ein gutes Schiff und schickte ihn über See. Gerade dieser junge Bursch aber war es, der mich später, trotzdem ich über das Schwabenalter längst hinaus war, zu neuen Abenteuern verleitete.
Inzwischen aber hatte ich mich in England auch selbst häuslich eingerichtet. Was das Wichtigste ist, ich hatte eine vorteilhafte und mich völlig befriedigende Ehe geschlossen, aus der mir drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, geboren wurden. Als aber der Tod mir mein Weib geraubt hatte und mein Neffe gerade zu derselben Zeit von einer mit gutem Erfolg bestandenen Reise nach Spanien zurückgekehrt war, gewannen meine Lust in die Fremde und sein Zureden die Ueberhand und veranlaßten mich, in dem Schiff meines Neffen als Privatkaufmann nach Ostindien zu reisen. Es geschah dies in dem Jahre 1694.
Auf dieser Reise besuchte ich denn auch die junge Kolonie auf meiner Insel. Ich fand dort meine Nachfolger, die Spanier, und ließ mir genauen Bericht über ihre und der zurückgebliebenen Verbrecher Lebensweise erstatten. Die armen Spanier waren von diesen anfangs schlecht behandelt worden. Dann hatte eine Aussöhnung stattgefunden, hierauf neue Veruneinigung und abermalige Versöhnung, der dann wieder Zwietracht gefolgt war. Endlich waren die Spanier gezwungen gewesen, Gewalt anzuwenden, hatten auch die Kerle unterworfen, sie aber dann mit Großmuth behandelt. Wollte man diese Geschichte in ihren Einzelnheiten berichten, sie würde so viel Mannichfaltigkeit und wunderbare Ereignisse auszuführen haben als meine eigne. Besonders interessant war der Bericht von den Kämpfen der Kolonisten mit den Karaiben, welche einige Male auf der Insel gelandet waren, und ferner die Mittheilungen über die auf dem Eiland eingeführten Verbesserungen. Fünf von den Kolonisten hatten auch einmal einen Einfall auf das Festland gewagt und elf Männer und fünf Weiber als Gefangene von dort heimgebracht. Durch die letzteren war die Insel bei meiner Ankunft mit etwa zwanzig Kindern bevölkert.
Ich verweilte auf der Insel gegen drei Wochen. Bei meiner Abreise ließ ich zur Unterstützung der Bewohner allerlei nothwendige Dinge zurück, insbesondere Waffen, Pulver, Schrot, Kleider, Werkzeuge und dergleichen mehr, sowie auch zwei Handwerksleute, die ich von England mitgebracht hatte, nämlich einen Zimmermann und einen Schmied.
Außerdem theilte ich die Insel unter die Bewohner ein, behielt für mich zwar das Eigenthumsrecht am Ganzen, überwies aber jedem der Kolonisten gerade die Landstrecken, die ihm am erwünschtesten waren. Nachdem ich dies Alles in Ordnung gebracht und die Bewohner verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, nahm ich von dieser Abschied.
Von hier aus nach Brasilien gelangt, schickte ich eine dort angekaufte Barke mit weiteren Leuten nach meiner Kolonie. Daneben übersendete ich an diese außer anderen Hülfsmitteln auch sieben Frauenzimmer, die mir sowohl für Dienstleistungen, als auch zu Frauen für Diejenigen, die Lust danach trügen, geeignet schienen. Den Engländern hatte ich versprochen, von ihrer Heimat aus einige Frauen und eine ansehnliche Ladung mit brauchbaren Dingen zu schicken, wenn sie sich der Pflanzung gehörig annehmen wollten. Diese Zusage aber hatte ich später nicht halten können, wiewohl sich die Leute sehr ordentlich und fleißig zeigten, nachdem sie erst einmal bemeistert und ihnen ihre besonderen Grundstücke angewiesen waren. Ich übersendete ihnen von Brasilien aus fünf Kühe, darunter drei trächtige, sowie auch einige Schafe und Schweine, die bei meinem nächsten Besuch auf der Insel sich beträchtlich vermehrt hatten.
Hiervon jedoch und auch darüber, wie einmal dreihundert Karaiben einen Ueberfall auf die Insel gemacht und die Pflanzungen verwüstet hatten, wobei die Kolonisten zwei Gefechte mit ihnen hatten bestehen müssen, in deren erstem sie unterlegen waren und einer von ihnen seinen Tod gefunden hatte, worauf sie aber, nachdem ein Sturm die Canoes der Feinde zerstört, den Rest von diesen durch Hunger und Waffen vernichtet hatten; wie dann die Pflanzung aufs Neue in Ordnung gebracht war und in welcher Weise die Kolonisten ferner ihr Leben auf der Insel geführt hatten — über diese Dinge, sage ich, sowie auch von einigen sehr seltsamen Begebenheiten, die ich selbst auf meinen weiteren Fahrten zehn Jahre später erlebt habe, berichte ich vielleicht noch einmal in Zukunft.
ENDE