
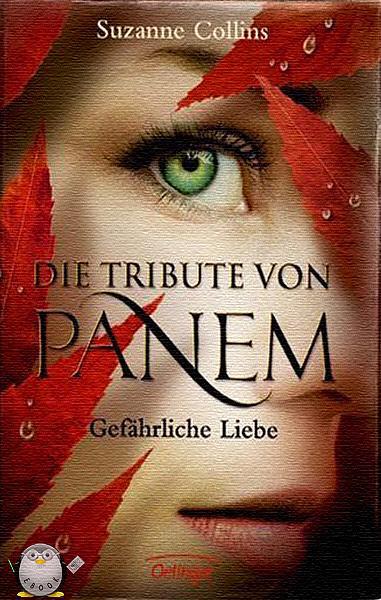
Gefaehrliche Liebe
Book Jacket
Series: Die Tribute von Panem [2]
Tags: Roman
Die siebzehnjährige Katniss hat die grausamen Hungerspiele überlebt, zusammen mit ihrem Freund Peeta. Das bedeutet ein eigenes Haus in ihrem Heimatdistrikt 12, außerdem genug zu essen für ihre Familien. Aber all das kann Kat nur kurz genießen: Sie muss als Siegerin öffentlich für das verhasste Kapitol posieren und weiter mit Peeta das Liebespaar spielen. Auf der Tour der Sieger durch die unterjochten Distrikte werden die beide Zeugen von brutaler Gewalt, aber sie entdecken auch Anzeichen für einen Aufstand. Und dann schlägt das Kapitol mit voller Wucht zu: Um jeden Widerstand zu brechen, werden die Teilnehmer der diesjährigen Hungerspiele aus den Reihen aller früheren Sieger ausgelost – und Kat und Peeta müssen zurück in die Arena. Gegen zweiundzwanzig erfahrene Kämpfer treten sie an, aber mit gegenteiligen Zielen: Während Peeta Kat schützen will, wird Kat diesmal alles tun, damit Peeta überlebt. Allerdings haben sie beide keine Ahnung davon, was inzwischen hinter den Kulissen geschieht … Mit dem ersten Teil ihrer „Tribute“-Trilogie, Die-Tribute-Panem-Tödliche-Spiele, ist Suzanne Collins bereits ein Weltbestseller gelungen. Kann da der zweite Band in der nun schon bekannten Panem-Welt ebenso spannend, aufregend und überraschend sein? Er kann. Das liegt vor allem an Kat, der wunderbaren Heldin dieser Geschichte. Aber auch daran, dass die Autorin immer wieder unglaubliche, aber dennoch glaubwürdige Wendungen aus dem Hut zaubert. Das einzige Problem bei diesem Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen kann, wenn man sich einmal festgelesen hat: Das vorläufige Ende stellt alles auf den Kopf – und wie es weitergeht, erfahren wir erst im dritten Band!
Suzanne Collins
Die Tribute von PANEM
Gefährliche Liebe
Roman
Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Hunger Games. Catching Fire«
TUX - ebook 2010
Band 1: Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele
Band 2: Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe
Die Tribute von PANEM
Gefährliche Liebe
Teil 1
Der Funke
1
Ich halte die Thermoskanne in der Hand, obwohl sich die Wärme des Tees längst in der eisigen Luft verflüchtigt hat. Meine Muskeln sind vor Kälte ganz starr. Wenn jetzt ein Rudel wilder Hunde auftauchen würde, stünden die Chancen, dass ich auf dem Baum wäre, ehe sie mich angreifen, nicht besonders gut. Ich müsste eigentlich aufstehen, herumlaufen und die Steifheit aus den Gliedern vertreiben. Stattdessen sitze ich da, reglos wie der Stein unter mir, während das Morgenlicht allmählich durch den Wald bricht. Gegen die Sonne kann ich nichts ausrichten. Ich kann nur hilflos zusehen, wie sie mich in einen Tag hineinzieht, vor dem mir seit Monaten graut.
Gegen Mittag werden sie alle in mein neues Haus im Dorf der Sieger einfallen. Reporter und Kamerateams aus dem Kapitel werden nach Disktrikt 12 kommen und auch Effie Trinket, meine alte Betreuerin, wird da sein. Ich überlege, ob Effie wohl immer noch die alberne rosa Perücke trägt oder ob sie extra für die Tour der Sieger eine andere künstliche Farbe zur Schau trägt. Und noch mehr Menschen werden auf mich warten. Eine Gruppe von Dienern, die mich während der langen Zugfahrt rundum versorgen. Ein Vorbereitungsteam, das mich für die öffentlichen Auftritte zurechtmacht. Und mein Stylist und Freund Cinna, der die hinreißenden Kostüme entworfen hat, dank deren das Publikum bei den Hungerspielen überhaupt erst auf mich aufmerksam geworden ist.
Ginge es nach mir, würde ich versuchen, die Hungerspiele aus meiner Erinnerung zu streichen. Nie mehr davon sprechen. So tun, als wären sie nur ein schlimmer Traum gewesen. Doch die Tour der Sieger macht das unmöglich. Das Kapitol hat sie, strategisch günstig, fast genau zwischen den jährlichen Spielen eingeplant, damit das Grauen frisch und lebendig bleibt. Nicht nur, dass sie die Bewohner der Distrikte dazu zwingen, sich jedes Jahr wieder an den eisernen Griff des Kapitols zu erinnern - wir müssen ihn auch noch feiern. Und in diesem Jahr bin ich einer der Stars der Show. Ich werde von einem Distrikt zum anderen reisen müssen, vor der jubelnden Menge stehen, die mich insgeheim verabscheut, ich werde den Familien ins Gesicht sehen müssen, deren Kinder ich getötet habe …
Die Sonne steigt beharrlich weiter, also zwinge ich mich aufzustehen. Meine Gelenke rebellieren, und mein linkes Bein war so lange eingeschlafen, dass ich einige Minuten auf und ab gehen muss, bis ich wieder Gefühl darin habe. Ich war drei Stunden im Wald, aber da ich nicht ernsthaft versucht habe, etwas zu jagen, kann ich keinen Erfolg vorweisen. Für meine Mutter und meine kleine Schwester Prim ist das auch nicht mehr nötig. Sie können es sich jetzt leisten, Fleisch beim Metzger in der Stadt zu kaufen, auch wenn es keinem von uns besser schmeckt als frisches Wild. Doch mein bester Freund Gale Hawthorne und seine Familie sind auf frische Beute angewiesen und ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich mache mich auf den Weg, eineinhalb Stunden dauert es, unsere Fallen abzulaufen. Als wir noch zur Schule gingen, hatten wir nachmittags Zeit, gemeinsam die Fallen abzulaufen, zu jagen und zu sammeln, und waren immer noch rechtzeitig zum Tauschen auf dem Markt. Aber jetzt, da Gale im Kohlebergwerk arbeitet und ich den ganzen Tag nichts zu tun habe, habe ich diese Aufgabe übernommen.
In diesem Augenblick hat Gale schon beim Bergwerk gestempelt, ist mit dem Förderkorb in schwindelerregende Tiefen gefahren und schlägt die Kohle aus der Erde. Ich weiß, wie es dort unten zugeht. Jedes Jahr in der Schule mussten wir mit der Klasse die Bergwerke besichtigen, das war Teil des Unterrichts. Als ich noch klein war, war es nur unangenehm. Die klaustrophobischen Tunnel, die schlechte Luft, die erstickende Dunkelheit von allen Seiten. Doch nachdem mein Vater und einige andere Bergarbeiter bei einer Explosion ums Leben gekommen waren, konnte ich mich kaum noch überwinden, den Förderkorb zu betreten. Der jährliche Ausflug wurde für mich zum Horrortrip. Zweimal wurde mir vorher so übel, dass meine Mutter mich zu Hause behielt, weil sie dachte, ich hätte die Grippe.
Ich denke an Gale, der nur im Wald richtig lebendig ist, im Wald mit der frischen Luft, der Sonne und dem sauberen Wasser. Ich weiß nicht, wie er das aushält. Oder … doch, ich weiß es. Er hält es aus, weil er nur so für seine Mutter und seine beiden jüngeren Brüder und die Schwester sorgen kann. Und hier sitze ich mit einem Haufen Geld, mehr als genug für unsere beiden Familien, und er weigert sich, auch nur das kleinste bisschen anzunehmen. Selbst das Fleisch von mir zu nehmen, kostet ihn Überwindung, obwohl er ganz bestimmt für meine Mutter und Prim gesorgt hätte, wenn ich bei den Spielen getötet worden wäre. Ich sage ihm, dass er mir damit einen Gefallen tut und dass es mich verrückt machen würde, den ganzen Tag herumzusitzen. Trotzdem bringe ich das Fleisch nie vorbei, wenn er zu Hause ist. Was kein Problem ist, da er täglich zwölf Stunden arbeitet.
Ich bekomme Gale jetzt nur noch sonntags zu Gesicht, wenn wir uns im Wald treffen, um gemeinsam zu jagen. Das ist immer noch der beste Tag der Woche, aber nicht mehr so wie früher, als wir uns alles erzählen konnten. Selbst das haben die Spiele kaputt gemacht. Ich hoffe immer noch, dass wir eines Tages wieder so ungezwungen zusammen sein können, doch im Grunde weiß ich, dass das nicht geht. Es gibt kein Zurück.
Die Fallen bringen gute Beute - acht Kaninchen, zwei Eichhörnchen und einen Biber, der in ein Drahtgeflecht geschwommen ist, das Gale erfunden hat. Im Fallenstellen ist er einfach genial. Er befestigt sie an heruntergebogenen jungen Bäumen, sodass Raubtiere nicht an die Beute herankommen, er tarnt feine Auslösemechanismen mit schweren Ästen und webt undurchdringliche Reusen zum Fangen von Fischen. Während ich durch den Wald gehe und jede Falle sorgfältig wieder aufstelle, weiß ich, dass mein Blick für die Balance nie an seinen heranreichen wird, an seinen Instinkt dafür, wo das Beutetier den Weg kreuzt. Das ist mehr als Erfahrung. Er ist ein Naturtalent. So wie ich noch bei fast völliger Dunkelheit auf ein Tier zielen und es mit einem einzigen Pfeil treffen kann.
Als ich wieder an dem Maschendrahtzaun bin, der Distrikt 12 umgibt, steht die Sonne schon recht hoch am Himmel. Wie immer lausche ich kurz, doch kein verräterisches Summen von elektrischem Strom ist zu hören. Eigentlich hört man es fast nie, obwohl der Zaun rund um die Uhr unter Strom stehen müsste. Ich zwänge mich durch die Lücke unter dem Zaun und komme auf der Weide heraus, nur einen Steinwurf von zu Hause entfernt. Meinem alten Zuhause. Wir dürfen es behalten, weil es offiziell für meine Mutter und meine Schwester bestimmt ist. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, müssten sie dorthin zurückkehren. Doch zurzeit sind sie beide glücklich im neuen Haus im Dorf der Sieger untergebracht, und ich bin die Einzige, die das gedrungene Häuschen benutzt, in dem ich aufgewachsen bin. Für mich ist es mein eigentliches Zuhause.
Jetzt gehe ich dorthin, um mich umzuziehen. Tausche die alte Lederjacke meines Vaters gegen einen feinen Wollmantel, der mir an den Schultern immer zu eng vorkommt. Die weichen, ausgetretenen Jagdstiefel gegen ein Paar teurer, maschinell gefertigter Schuhe, die meine Mutter für jemanden in meiner Stellung angemessener findet. Pfeil und Bogen habe ich in einem hohlen Baumstamm im Wald verstaut. Obwohl die Zeit drängt, setze ich mich für ein paar Minuten in die Küche. Sie wirkt verlassen ohne Feuer im Herd und ohne Tischtuch. Ich trauere meinem alten Leben nach. Wir kamen kaum über die Runden, aber ich wusste, wohin ich gehörte, ich wusste, wo mein Platz in dem festen Gefüge unseres Lebens war. Ich würde gern dorthin zurückkehren, im Nachhinein kommt es mir so sicher vor im Vergleich zu jetzt, da ich so reich bin und so verhasst bei den Machthabern im Kapitol.
Ein Maunzen an der Hintertür lässt mich aufhorchen. Ich mache auf, und da steht Butterblume, Prims räudiger alter Kater. Ihm gefällt das neue Haus so wenig wie mir, und wenn meine Schwester in der Schule ist, verzieht er sich immer. Wir konnten uns nie besonders gut leiden, doch die Abneigung gegen das neue Haus verbindet uns. Ich lasse ihn herein, gebe ihm ein Stück Biberfett und kraule ihn sogar ein bisschen zwischen den Ohren. »Du bist hässlich, das weißt du, oder?«, sage ich. Butterblume stupst gegen meine Hand, er will weiter gestreichelt werden, aber wir müssen los. »Na komm.« Ich hebe ihn mit einer Hand hoch, greife mit der anderen meine Jagdtasche und nehme beide mit hinaus auf die Straße. Der Kater befreit sich mit einem Satz und verschwindet unter einem Busch.
Die Schuhe drücken an den Zehen, während ich über den Ascheweg gehe. Ich nehme die Abkürzung durch kleine Gassen und Hintergärten und bin im Nu bei Gales Haus. Seine Mutter Hazelle steht am Waschbecken in der Küche und sieht mich durchs Fenster. Sie trocknet sich die Hände an der Schürze und kommt an die Tür.
Ich kann Hazelle gut leiden. Habe Hochachtung vor ihr. Bei der Explosion, die meinen Vater das Leben kostete, starb auch ihr Mann, und sie blieb mit drei Jungen zurück und einem Baby im Bauch, das jeden Tag zur Welt kommen konnte. Keine Woche nach der Geburt zog sie schon durch die Straßen und suchte Arbeit. Der Bergbau kam nicht infrage, schließlich musste sie für das Baby sorgen, doch es gelang ihr, Arbeit als Wäscherin für einige Kaufleute aus der Stadt zu bekommen. Im Alter von vierzehn wurde Gale, ihr ältester Sohn, der Haupternährer der Familie. Er hatte sich bereits für Tesserasteine eintragen lassen, das bescherte ihnen eine bescheidene Ration an Getreide und Öl im Tausch dafür, dass sein Name mehrfach in die Lostrommel für die Ziehung der Tribute wanderte. Hinzu kam, dass er auch damals schon ein geschickter Fallensteller war. Aber das allein hätte nicht ausgereicht, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren, und so schrubbte Hazelle sich die Finger auf dem Waschbrett wund bis auf die Knochen. Im Winter waren ihre Finger immer so rot und rissig, dass sie beim geringsten Anlass anfingen zu bluten. Das wäre immer noch so, hätte meine Mutter nicht eine spezielle Salbe dagegen entwickelt. Doch Hazelle und Gale sind entschlossen, den anderen Kindern, dem zwölfjährigen Rory, dem zehnjährigen Vick und der sechsjährigen Posy, die Tesserasteine zu ersparen.
Hazelle lächelt, als sie die Beute sieht. Sie packt den Biber am Schwanz und wiegt ihn in der Hand. »Das gibt einen schönen Eintopf.« Anders als Gale hat sie kein Problem mit unserem Jagdabkommen.
»Hat auch einen schönen Pelz«, sage ich. Es ist tröstlich, hier bei Hazelle zu sein. Über die Vorzüge der Beute zu sprechen wie eh und je. Sie schenkt mir einen Becher Kräutertee ein und ich lege dankbar meine eiskalten Hände darum. »Weißt du, als ich von der Jagd kam, dachte ich mir, ich könnte doch Rory ab und zu mal mitnehmen. Nach der Schule. Könnte ihm beibringen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht.«
Hazelle nickt. »Das war gut. Gale würde ja gern, aber er hat nur die Sonntage, und ich glaub, die hält er sich lieber für dich frei.«
Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Wangen flammend rot werden. Das ist natürlich albern. Kaum jemand kennt mich besser als Hazelle. Sie weiß, wie ich mit Gale verbunden bin. Bestimmt haben viele Leute geglaubt, wir würden später einmal heiraten, auch wenn ich nie daran gedacht habe. Doch das war vor den Spielen. Bevor mein Mittribut Peeta Mellark verkündet hat, er sei unsterblich in mich verliebt. Unsere Liebesgeschichte wurde in der Arena zu unserer wichtigsten Überlebensstrategie.
Allerdings war es für Peeta nicht bloß eine Strategie. Was es für mich war, weiß ich nicht so genau. Aber dass es für Gale eine einzige Qual war, das weiß ich inzwischen. Meine Brust schnürt sich zusammen, als ich daran denke, dass Peeta und ich auf der Tour der Sieger wieder als Liebespaar auftreten müssen.
Ich stürze den Tee hinunter, obwohl er zu heiß ist, und schiebe schnell den Stuhl zurück. »Ich muss jetzt los. Muss mich für die Kameras herrichten.«
Hazelle umarmt mich. »Genieß das Essen.«
»Ganz bestimmt«, sage ich.
Als Nächstes mache ich auf dem Hob halt, wo ich früher den meisten Handel getrieben habe. Vor langer Zeit wurde im Hob Kohle gelagert, später dann wurde er zum Treffpunkt für zwielichtige Geschäfte, bis schließlich ein richtiger Schwarzmarkt entstand. Er zieht kriminelle Elemente an und deshalb gehöre ich wohl auch dorthin. Wer in den Wäldern um Distrikt 12 herum jagt, bricht mindestens ein Dutzend Gesetze und riskiert die Todesstrafe.
Auch wenn sie es nie erwähnen, verdanke ich den Leuten vom Schwarzmarkt eine Menge. Gale hat mir erzählt, dass Greasy Sae, die alte Frau, die Suppe verkauft, während der Spiele eine Sammlung für Peeta und mich ins Leben gerufen hat. Sie sollte eigentlich auf den Schwarzmarkt beschränkt sein, doch viele Leute hörten davon und steuerten etwas bei. Ich weiß nicht genau, wie viel es war, und die Preise für die Sponsorengeschenke in der Arena waren unglaublich hoch. Doch soweit ich weiß, hat es mir das Leben gerettet.
Es ist immer noch merkwürdig, den Eingang mit einer leeren Jagdtasche zu betreten, ohne etwas zum Tauschen, und stattdessen den schweren Geldbeutel an der Hüfte zu spüren. Ich versuche, so viele Stände wie möglich zu besuchen und meine Einkäufe gleichmäßig zu verteilen: Kaffee, Brötchen, Eier, Garn und Öl. Schließlich kommt mir noch die Idee, drei Flaschen klaren Schnaps bei einer einarmigen Frau namens Ripper zu kaufen. Sie war Opfer eines Bergwerksunfalls und clever genug, sich trotzdem durchzuschlagen.
Der Schnaps ist nicht für meine Familie bestimmt, sondern für Haymitch, der bei den Spielen Peetas und mein Mentor war. Haymitch ist mürrisch, grob und meistens betrunken. Aber er hat ganze Arbeit geleistet - mehr als das, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele durften zwei Tribute gewinnen. Also ganz gleich, wie Haymitch ist, ich habe auch ihm viel zu verdanken. Und zwar für den Rest meines Lebens. Ich besorge den Schnaps, weil er vor ein paar Wochen mal keinen mehr hatte und es auch keinen zu kaufen gab, woraufhin er Entzugserscheinungen bekam. Er zitterte und schrie irgendwelche schrecklichen Erscheinungen an, die nur er sehen konnte. Prim erschrak zu Tode, und mir machte es, ehrlich gesagt, auch keinen Spaß, ihn so zu sehen. Seitdem horte ich das Zeug sozusagen, für den Fall, dass es mal wieder einen Engpass geben sollte.
Cray, der Oberste Friedenswächter, runzelt die Stirn, als er mich mit den Flaschen sieht. Er ist ein älterer Mann mit ein paar silbernen Haarsträhnen, die er schräg über den knallroten Kopf gekämmt hat. »Das Zeug ist zu stark für dich, Mädchen.« Er muss es ja wissen. Abgesehen von Haymitch trinkt Cray mehr als alle, die ich kenne.
»Ach, meine Mutter braucht es für ihre Medizin«, sage ich leichthin.
»Tja, damit kann man alles abtöten«, sagt er und knallt eine Münze für eine Flasche auf den Tresen.
Als ich zu Greasy Saes Stand komme, hieve ich mich auf den Tresen und bestelle etwas Suppe, die nach einer Mischung aus Flaschenkürbis und Bohnen aussieht. Während ich esse, kommt ein Friedenswächter namens Darius und bestellt auch eine Portion. Von den Gesetzeshütern ist er mir noch der liebste. Er ist nicht so ein Wichtigtuer und meistens zu einem Spaß aufgelegt. Er dürfte in den Zwanzigern sein, sieht jedoch kaum älter aus als ich. Irgendetwas an seinem Lächeln und seinen roten Haaren, die in alle Richtungen abstehen, lässt ihn jungenhaft wirken.
»Müsstest du nicht schon im Zug sitzen?«, fragt er.
»Ich werde um zwölf abgeholt«, sage ich.
»Müsstest du nicht besser aussehen?«, fragt er flüsternd, aber so, dass es jeder hören kann. Obwohl ich nicht in der Stimmung bin, muss ich über seine Neckerei lächeln. »Vielleicht eine Schleife im Haar oder so?« Er zieht kurz an meinem Zopf und ich schiebe seine Hand weg.
»Keine Sorge. Wenn sie mit mir fertig sind, wirst du mich nicht wiedererkennen«, sage ich.
»Gut«, sagt er. »Zeig zur Abwechslung mal ein bisschen Stolz auf deinen Distrikt, Miss Everdeen. Hm?« Er schaut Greasy Sae im Spaß missbilligend an und schüttelt den Kopf, dann geht er zu seinen Freunden.
»Die Suppenschale krieg ich aber wieder!«, ruft Greasy Sae ihm nach, aber sie lacht dabei, deshalb klingt es nicht besonders streng. »Kommt Gale dich verabschieden?«, fragt sie mich.
»Nein, er stand nicht auf der Liste«, sage ich. »Aber ich hab ihn Sonntag gesehen.«
»Ach, ich hätte gedacht, dass er auf der Liste steht. Wo er doch dein Cousin ist«, sagt sie ironisch.
Das ist ein weiterer Teil der Lügengeschichte, die sie sich im Kapitol ausgedacht haben. Als Peeta und ich bei den Hungerspielen unter die letzten acht kamen, wurden Reporter losgeschickt, die persönliche Geschichten über uns bringen sollten. Als sie nach meinen Freunden fragten, haben alle auf Gale verwiesen. Aber das konnten sie nicht schreiben, denn in der Arena spielte ich ja die Liebesgeschichte, und da konnte ich nicht Gale als besten Freund haben. Er sah zu gut aus, zu männlich, und er war kein bisschen bereit, für die Kameras zu lächeln und den netten Jungen von nebenan zu spielen. Und wir sehen uns tatsächlich ganz schön ähnlich. Wir haben das typische Aussehen des Saums. Dunkle glatte Haare, olivfarbene Haut. Also hat irgendein Schlaukopf ihn zu meinem Cousin ernannt. Ich wusste nichts davon, bis wir wieder zu Hause waren, auf dem Bahnsteig, und meine Mutter sagte: »Deine Cousins können es kaum erwarten, dich wiederzusehen!« Da drehte ich mich um und sah Gale und Hazelle und die Kinder - was blieb mir anderes übrig, als mitzuspielen?
Greasy Sae weiß, dass wir nicht verwandt sind, aber selbst manche Leute, die uns schon jahrelang kennen, scheinen es vergessen zu haben.
»Ich kann es kaum erwarten, es hinter mir zu haben«, flüstere ich.
»Ich weiß«, sagt Greasy Sae. »Aber du musst da durch, um es hinter dir zu haben. Also sieh zu, dass du nicht zu spät kommst.«
Als ich mich auf den Weg zum Dorf der Sieger mache, fängt es ein wenig an zu schneien. Das Dorf liegt nur einen knappen Kilometer von dem Platz im Stadtzentrum entfernt, aber es scheint wie eine völlig andere Welt.
Es ist eine eigene kleine Gemeinde, die um eine schöne Grünfläche herum errichtet wurde, dazwischen blühende Sträucher. Zwölf Häuser, jeweils so groß, dass zehn von der Sorte hineinpassen würden, in der ich aufgewachsen bin. Neun davon stehen leer, wie immer schon. Die drei, die bewohnt sind, gehören Haymitch, Peeta und mir.
Die Häuser, in denen meine Familie und Peeta leben, haben eine warme, lebendige Ausstrahlung. Licht hinter den Fenstern, Rauch aus dem Schornstein, leuchtende Maisbüschel, mit denen der Eingang zum bevorstehenden Erntefest geschmückt ist. Haymitchs Haus dagegen wirkt, obwohl der Hausmeister sich um alles kümmert, trostlos und verwahrlost. Vor der Haustür mache ich mich auf den Dreck gefasst, der mich drinnen erwartet.
Unwillkürlich rümpfe ich die Nase. Haymitch weigert sich, jemanden zum Saubermachen hineinzulassen, und er selbst putzt nicht gerade gründlich. Im Lauf der Jahre haben sich die Gerüche von Schnaps und Erbrochenem, gekochtem Kohl und angebranntem Fleisch, ungewaschenen Kleidern und Mäusedreck zu einem Gestank vermischt, der mir die Tränen in die Augen treibt. Ich bahne mir einen Weg durch weggeworfene Verpackungen, Glasscherben und Knochen bis zu der Stelle, wo Haymitch normalerweise zu finden ist. Er sitzt am Küchentisch, die Arme über die Holzplatte ausgebreitet, das Gesicht in einer Schnapspfütze, und schnarcht, was das Zeug hält.
Ich rüttele ihn an der Schulter. »Aufstehen!«, sage ich laut, denn inzwischen weiß ich, dass man ihn auf die sanfte Tour nicht wach bekommt. Für einen Moment setzt sein Schnarchen aus, wie ein kurzes Zögern, dann geht es wieder los. Ich rüttele ihn fester. »Aufstehen, Haymitch! Heute beginnt die Tour der Sieger!« Mit Gewalt öffne ich das Fenster und sauge die frische Luft tief ein. Dann stapfe ich durch den Müll auf dem Boden, fördere eine Kaffeekanne aus Blech zutage und fülle sie am Waschbecken mit Wasser. Der Ofen ist noch nicht ganz aus, und ich schaffe es, den wenigen glühenden Kohlen eine Flamme zu entlocken. Ich schütte Kaffeepulver in die Kanne, so viel, dass es auf jeden Fall ein gutes, starkes Gebräu ergibt, und stelle sie zum Kochen auf den Ofen.
Haymitch ist immer noch weggetreten. Da alles andere nichts genützt hat, fülle ich eine Schale mit eiskaltem Wasser, kippe sie ihm über den Kopf und bringe mich in Sicherheit. Er stößt einen kehligen, animalischen Laut aus. Er springt auf, wobei der Stuhl drei Meter nach hinten fliegt, und schwingt ein Messer. Ich hatte vergessen, dass er immer mit dem Messer in der Hand schläft. Ich hätte es ihm aus der Hand nehmen sollen, aber ich hatte zu vieles zu bedenken. Er flucht wie ein Kesselflicker und schlägt mehrmals um sich, ehe er zu sich kommt. Mit dem Hemdsärmel wischt er sich über das Gesicht und dreht sich dann zu mir um. Ich hocke auf dem Fenstersims, für den Fall, dass ich schnell Reißaus nehmen muss.
»Was soll das?«, fährt er mich an.
»Du hast gesagt, ich soll dich wecken, eine Stunde bevor die Kameras kommen«, erkläre ich. »Was?«, sagt er. »Es war deine Idee«, sage ich.
Jetzt scheint er sich zu erinnern. »Wieso bin ich klatschnass?«
»Ich hab dich nicht wach gekriegt«, sage ich. »Hey, wenn du verhätschelt werden willst, musst du Peeta fragen.«
»Was soll er mich fragen?« Beim bloßen Klang seiner Stimme bekomme ich im Bauch einen Knoten aus lauter unangenehmen Gefühlen: schlechtes Gewissen, Trauer, Angst. Und Sehnsucht. Ich kann ruhig zugeben, dass die auch hineinspielt. Aber gegen die anderen Gefühle hat sie keine Chance.
Ich schaue Peeta an, während er zum Tisch kommt. Die Sonnenstrahlen fangen sich im glitzernden Schnee in seinem blonden Haar. Er sieht stark und gesund aus, so ganz anders als der kranke, halb verhungerte Junge, den ich aus der Arena kenne, und sein Hinken fällt kaum noch auf. Er legt ein frisch gebackenes Brot auf den Tisch und hält Haymitch die Hand hin.
»Ob du mich wecken kannst, ohne dass ich mir eine Lungenentzündung hole«, sagt Haymitch und gibt Peeta das Messer. Er zieht sein dreckiges Hemd aus, sodass ein nicht minder dreckiges Unterhemd zum Vorschein kommt, und reibt sich mit einem trockenen Zipfel ab.
Peeta lächelt und spült Haymitchs Messer mit klarem Schnaps aus einer Flasche ab, die auf dem Boden steht. Er wischt das Messer am Hemd sauber und schneidet das Brot in Scheiben. Peeta versorgt uns alle mit frischen Backwaren. Ich jage. Er backt. Haymitch trinkt. Jeder von uns beschäftigt sich auf seine Weise, um die Gedanken an unsere gemeinsame Zeit als Mitstreiter in den Hungerspielen fernzuhalten. Erst als er Haymitch die Brotkante gereicht hat, sieht Peeta mich zum ersten Mal an. »Möchtest du auch ein Stück?«
»Nein, ich hab auf dem Hob gegessen«, sage ich. »Aber vielen Dank.« Meine Stimme klingt fremd, so förmlich. Wie immer, wenn ich mit Peeta spreche, seit die Kameras unsere glückliche Heimkehr gefilmt haben und wir in unser richtiges Leben zurückgekehrt sind.
»Keine Ursache«, erwidert er steif.
Haymitch wirft sein Hemd mitten in das Durcheinander. »Brrr! Ihr beide müsst euch aber noch ordentlich aufwärmen, bevor die Show losgeht.«
Da hat er natürlich recht. Das Publikum erwartet die beiden Turteltäubchen, die die Hungerspiele gewonnen haben. Nicht zwei Menschen, die einander kaum in die Augen sehen können. Aber ich sage nur: »Geh dich mal waschen, Haymitch.« Dann schwinge ich mich zum Fenster hinaus, springe nach unten und gehe über die Wiese nach Hause.
Der Schnee bleibt jetzt liegen und meine Füße hinterlassen eine Spur. Vor der Haustür befreie ich meine Schuhe von dem nassen Zeug. Meine Mutter hat Tag und Nacht geschuftet, damit alles schön ist für die Kameras, da will ich ihren glänzenden Fußboden nicht gleich wieder dreckig machen. Ich bin kaum im Haus, da kommt sie schon auf mich zu und fasst mich am Arm, als wollte sie mich aufhalten.
»Keine Sorge, ich ziehe sie hier aus«, sage ich und lasse die Schuhe auf der Fußmatte stehen.
Meine Mutter lacht ein eigenartiges, heiseres Lachen und nimmt mir die prall gefüllte Jagdtasche von der Schulter. »Es ist ja nur Schnee. Hast du einen schönen Spaziergang gemacht?«
»Spaziergang?« Sie weiß, dass ich die halbe Nacht im Wald verbracht habe. Da sehe ich den Mann, der hinter ihr in der Küchentür steht. Ein einziger Blick auf seinen maßgeschneiderten Anzug und sein chirurgisch perfektioniertes Gesicht verrät mir, dass er aus dem Kapitol kommt. Irgendetwas stimmt nicht. »Das war eher ein Schlittern. Es wird jetzt richtig glatt draußen.«
»Du hast Besuch«, sagt meine Mutter. Ihr Gesicht ist zu blass, und in ihrer Stimme höre ich die Angst, die sie zu verbergen sucht.
»Ich dachte, wir erwarten sie erst gegen Mittag.« Ich tue so, als ob ich nichts bemerke. »Ist Cinna schon da, um mir beim Umziehen zu helfen?«
»Nein, Katniss, es ist …«, setzt meine Mutter an.
»Bitte hier entlang, Miss Everdeen«, sagt der Mann. Er zeigt in Richtung Flur. Es ist merkwürdig, durch das eigene Haus geleitet zu werden, aber ich hüte mich, etwas dazu zu sagen.
Im Gehen lächele ich meine Mutter über die Schulter hinweg zuversichtlich an. »Bestimmt noch ein paar Anweisungen für die Tour der Sieger.« Sie haben mir schon alle möglichen Informationen über die Reiseroute und die Etikette in den unterschiedlichen Distrikten zukommen lassen. Doch als ich auf die Tür zum Arbeitszimmer zugehe, eine Tür, die ich bis zu diesem Moment noch nie geschlossen gesehen habe, fangen meine Gedanken an zu rasen. Wer ist da drin? Was wollen sie von mir? Warum ist meine Mutter so blass?
»Gehen Sie nur hinein«, sagt der Mann vom Kapitol, der mir durch den Flur gefolgt ist.
Ich drehe den Messingknauf herum und trete ein. Meine Nase nimmt Rosen wahr und gleichzeitig Blut. Ein kleiner weißhaariger Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt, steht mit dem Rücken zu mir und liest in einem Buch. Er hebt einen Finger, als wollte er sagen: Einen Moment noch. Dann dreht er sich um und mein Herz setzt einen Schlag aus.
Ich schaue in die Schlangenaugen von Präsident Snow.
2
Für mich gehört Präsident Snow vor Marmorsäulen und riesige Flaggen. Es ist verstörend, ihn hier im Zimmer inmitten alltäglicher Dinge zu sehen. Als würde man den Deckel von einem Topf nehmen und darin statt Suppe eine Viper mit aufgerissenem Maul vorfinden.
Was kann er hier wollen? Meine Gedanken rasen zurück zu den Eröffnungstagen vergangener Siegertouren. Ich erinnere mich daran, die siegreichen Tribute zusammen mit ihren Mentoren und Stylisten gesehen zu haben. Auch einige hohe Repräsentanten der Regierung tauchten gelegentlich auf. Doch Präsident Snow habe ich noch nie gesehen. Er ist bei Feierlichkeiten im Kapitol anwesend. Und das war’s.
Wenn er die ganze Reise von seiner Stadt hierher gemacht hat, kann das nur eins bedeuten. Ich stecke in ernsten Schwierigkeiten. Und mit mir auch meine Familie. Es schaudert mich bei dem Gedanken, wie nah meine Mutter und meine Schwester diesem Mann sind, der mich verabscheut. Der mich immer verabscheuen wird. Denn ich habe ihn bei seinen sadistischen Hungerspielen ausgetrickst, habe das Kapitol lächerlich gemacht und damit seine Macht untergraben.
Dabei habe ich nichts getan, als Peeta und mir selbst das Leben zu retten. Dass das gleichzeitig ein rebellischer Akt war, war reiner Zufall. Doch wenn das Kapitol verfügt, dass nur ein Tribut gewinnen kann, und jemand so dreist ist, diese Regel infrage zu stellen, ist das wohl an sich schon eine Rebellion. Ich konnte mich nur verteidigen, indem ich so tat, als hätte meine leidenschaftliche Liebe zu Peeta mir den Verstand geraubt. Deshalb durften wir beide überleben. Und zu Siegern gekürt werden. Durften nach Hause zurückkehren und feiern und in die Kameras winken und wurden in Ruhe gelassen. Bis jetzt.
Vielleicht ist es das neue Haus oder der Schreck, ihn zu sehen, oder dass wir beide wissen, er könnte mich von jetzt auf gleich töten lassen; jedenfalls komme ich mir so vor, als wäre ich der Eindringling. Als wäre das hier sein Zuhause und ich der ungebetene Gast. Deshalb begrüße ich ihn auch nicht und biete ihm keinen Platz an. Ich sage kein Wort. Im Grunde behandele ich ihn so, als wäre er wirklich eine Schlange, eine Giftschlange. Reglos stehe ich da, den Blick auf ihn geheftet, und schmiede Fluchtpläne.
»Ich glaube, wir können die ganze Situation sehr vereinfachen, wenn wir uns darauf einigen, einander nicht zu belügen«, sagt er. »Was denkst du?«
Ich denke, dass meine Zunge festgefroren ist und dass ich unmöglich sprechen kann, aber ich überrasche mich selbst und antworte mit fester Stimme: »Ja, ich glaube, damit würden wir Zeit sparen.«
Präsident Snow lächelt und zum ersten Mal fallen mir seine Lippen auf. Ich hatte Schlangenlippen erwartet, also gar keine. Aber seine Lippen sind außergewöhnlich voll, die Haut spannt. Ich frage mich, ob er sich den Mund hat operieren lassen, damit er attraktiver aussieht. Wenn ja, war es Zeit-Verschwendung, denn er ist nicht die Spur attraktiv. »Meine Berater hatten Sorge, du könntest Schwierigkeiten machen, aber du hast nicht vor, Schwierigkeiten zu machen, oder?«, fragt er.
»Nein«, sage ich.
»Das habe ich ihnen auch gesagt. Ich habe gesagt, ein Mädchen, das so viel auf sich nimmt, um sein Leben zu retten, wird kein Interesse daran haben, es leichtfertig wegzuwerfen. Und sie wird auch an ihre Familie denken. An die Mutter, die Schwester und all die … Cousins.« An der Art, wie er das Wort »Cousins« dehnt, merke ich, er weiß, dass Gale und ich nicht richtig verwandt sind.
Jetzt liegen die Tatsachen also auf dem Tisch. Vielleicht ist es besser so. Mit unbestimmten Drohungen komme ich nicht gut zurecht. Ich will lieber wissen, woran ich bin.
»Setzen wir uns doch.« Präsident Snow setzt sich an den großen Schreibtisch aus glänzendem Holz, an dem Prim ihre Hausaufgaben macht und meine Mutter die Haushaltsplanung. Ebenso wie er nicht einfach in unser Haus kommen dürfte, hat er auch kein Recht, diesen Platz einzunehmen. Und doch hat er jedes Recht. Ich setze mich vor den Tisch auf einen der geschnitzten Stühle mit hoher Lehne. Er ist für jemand Größeren als mich gemacht, ich berühre den Boden nur mit den Zehen.
»Ich habe ein Problem, Katniss«, sagt Präsident Snow. »Ein Problem, das in dem Moment auftauchte, als du in der Arena die giftigen Beeren hervorgeholt hast.«
Er meint den Moment, in dem ich mir dachte, dass die Spielmacher, vor die Wahl gestellt, Peeta und mir beim Selbstmord zuzusehen - womit es keinen Sieger gegeben hätte - oder uns beide am Leben zu lassen, sich für die zweite Möglichkeit entscheiden würden.
»Wenn Seneca Crane, der Oberste Spielmacher, ein wenig Grips gehabt hätte, hätte er dich auf der Stelle in die Luft gejagt. Doch er hatte leider eine sentimentale Ader. Deshalb bist du hier. Kannst du dir denken, wo er ist?«, fragt er.
Ich nicke, denn so, wie er es sagt, ist klar, dass Seneca Crane hingerichtet wurde. Jetzt, da nur der Schreibtisch uns trennt, ist der Geruch von Rosen und Blut noch stärker. Präsident Snow trägt eine Rose am Revers, die immerhin auf die Quelle des Blumendufts hinweist, allerdings muss sie genmanipuliert sein, denn keine echte Rose riecht so. Aber was das Blut angeht … keine Ahnung.
»Danach konnten wir nichts tun, als dich dein kleines Theater zu Ende spielen zu lassen. Und du hast dich wirklich recht gut gemacht als liebestolles Schulmädchen. Die Leute im Kapitol waren ziemlich überzeugt. Leider sind in den Distrikten nicht alle auf dein Schauspiel hereingefallen«, sagt er.
Für einen kurzen Moment muss sich die Verwirrung in meinem Gesicht gespiegelt haben, denn er geht darauf ein.
»Das kannst du natürlich nicht wissen. Du hast keinen Zugang zu Informationen über die Stimmung in anderen Distrikten. Doch in einigen wurde dein kleiner Beerentrick als Herausforderung gedeutet, nicht als Akt der Liebe. Und wenn ausgerechnet ein Mädchen aus Distrikt 12 das Kapitol herausfordern kann und so einfach davonkommt, was sollte andere dann davon abhalten, dasselbe zu tun?«, sagt er. »Was sollte zum Beispiel einen Aufstand verhindern?«
Es dauert einen Augenblick, bis ich den letzten Satz begreife.
»Es hat Aufstände gegeben?«, frage ich. Die Vorstellung erschreckt mich, gleichzeitig spüre ich so etwas wie freudige Erregung.
»Noch nicht. Aber wenn es so weitergeht, wird es dazu kommen. Und Aufstände führen, wie man weiß, zur Revolution.« Präsident Snow reibt eine Stelle über der linken Augenbraue, genau dort, wo ich auch immer Kopfschmerzen bekomme. »Kannst du ermessen, was das bedeuten würde? Wie viele Menschen sterben würden? Das Elend der Überlebenden? Was für Probleme man mit dem Kapitol auch haben mag - wenn es in seiner Strenge nur kurz nachlassen würde, dann würde das gesamte System zusammenbrechen, das kannst du mir glauben.«
Ich bin verblüfft, wie offen und aufrichtig das klingt. Als hätte er vor allem das Wohlergehen der Bürger von Panem im Auge, während ihm doch nichts ferner liegt. Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehme, die folgenden Worte zu sagen, aber ich tue es. »Das System muss sehr wacklig sein, wenn eine Handvoll Beeren es zum Einsturz bringen kann.«
Lange Zeit ist es still und er sieht mich nur an. Dann sagt er: »Es ist wacklig, aber nicht so, wie du denkst.«
Es klopft an der Tür und der Mann vom Kapitol streckt den Kopf herein. »Die Mutter lässt fragen, ob Sie Tee möchten.«
»Oh ja. Ich hätte gern einen Tee«, sagt der Präsident. Die Tür geht weiter auf, und da steht meine Mutter, sie bringt ein Tablett mit einem Teeservice aus Porzellan, das sie bei ihrer Heirat mit in den Saum genommen hat. »Stellen Sie es bitte hierhin.« Er legt sein Buch auf die Ecke des Tisches und klopft auf die Tischmitte.
Meine Mutter setzt das Tablett ab. Darauf stehen eine Teekanne und Tassen, Sahne und Zucker und ein Teller mit Keksen. Sie sind wunderhübsch verziert mit pastellfarbenen Zuckerblumen. Das kann nur Peetas Werk sein.
»Was für ein willkommener Anblick! Wissen Sie, es ist merkwürdig, wie oft vergessen wird, dass auch Präsidenten essen müssen«, sagt Präsident Snow liebenswürdig. Immerhin wirkt meine Mutter nach seinen Worten nicht mehr ganz so nervös.
»Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen? Ich kann etwas Sättigenderes kochen, wenn Sie hungrig sind«, bietet sie an.
»Nein, besser als dies hier könnte es gar nicht sein. Vielen Dank«, sagt er, eine deutliche Aufforderung, uns wieder allein zu lassen. Meine Mutter nickt, wirft mir einen Blick zu und geht. Präsident Snow schenkt uns beiden Tee ein, nimmt sich Sahne und Zucker und rührt dann lange in seiner Tasse. Ich spüre, dass er gesagt hat, was er zu sagen hatte, und auf meine Antwort wartet.
»Ich wollte keine Aufstände verursachen«, sage ich.
»Das glaube ich dir. Es spielt keine Rolle. Dein Stylist hat sich hinsichtlich der Wahl deines Kostüms als Prophet erwiesen. Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen stand - von dir ist ein Funke ausgegangen, der sich, wenn wir uns nicht darum kümmern, zu einem Inferno auswachsen könnte, das Panem zerstört«, sagt er.
»Warum bringen Sie mich jetzt nicht einfach um?«, platze ich heraus.
»Öffentlich?«, fragt er. »Das hieße nur Öl ins Feuer gießen.«
»Dann lassen Sie es wie einen Unfall aussehen«, sage ich.
»Wer sollte das glauben?«, fragt er. »Du bestimmt nicht, wenn du Zuschauer wärst.«
»Dann sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich werde es tun«, sage ich.
»Wenn es nur so einfach wäre.« Er nimmt einen Blumenkeks und betrachtet ihn. »Wie hübsch. Hat deine Mutter die selbst gebacken?«
»Peeta.« Und zum ersten Mal merke ich, dass ich seinem Blick nicht standhalten kann. Ich nehme die Tasse, stelle sie jedoch zurück, als ich merke, wie sie an die Untertasse klirrt. Um es zu überspielen, nehme ich schnell einen Keks.
»Peeta. Wie ist sie denn, die Liebe deines Lebens?«, fragt er.
»Gut«, sage ich.
»Wann genau hat er gemerkt, wie gleichgültig er dir wirklich ist?«, fragt er und tunkt seinen Keks in den Tee.
»Er ist mir nicht gleichgültig«, sage ich.
»Aber vielleicht bist du nicht ganz so hingerissen von dem jungen Mann, wie du das Land glauben machen wolltest«, erklärt er.
»Wer sagt das?«, frage ich.
»Ich«, sagt der Präsident. »Und wenn ich der Einzige wäre, der seine Zweifel hat, wäre ich nicht hier. Wie geht es dem feschen Cousin?«
»Ich weiß nicht … ich …« Mein Widerwillen gegen dieses Gespräch, dagegen, dass ich mit Präsident Snow über meine Gefühle für zwei der Menschen spreche, die mir am meisten bedeuten, lässt meine Stimme ersterben.
»Sprich nur, Katniss. Ihn kann ich leicht umbringen, wenn wir keine glückliche Lösung finden. Du tust ihm keinen Gefallen damit, dass du jeden Sonntag mit ihm in den Wald verschwindest.«
Wenn er das weiß, was weiß er dann noch alles? Und woher weiß er es? Viele Leute könnten ihm erzählt haben, dass Gale und ich sonntags zusammen auf die Jagd gehen. Kreuzen wir nicht am Ende jedes Sonntags schwer bepackt mit Wild auf? Ist das nicht schon seit Jahren so? Die eigentliche Frage ist, was seiner Meinung nach in den Wäldern hinter Distrikt 12 passiert. Bestimmt haben sie uns dort nicht aufgespürt. Oder doch? Kann uns jemand gefolgt sein? Das erscheint mir unmöglich. Jedenfalls kein Mensch. Kameras? Bis zu diesem Augenblick ist mir das nie in den Sinn gekommen. Der Wald war für uns immer ein sicherer Ort - der Ort, wo uns das Kapitol nicht erreichen konnte, wo wir bedenkenlos sagen konnten, was wir fühlten, so sein konnten, wie wir waren. So war es jedenfalls vor den Spielen. Wenn sie uns seitdem beobachtet haben, was haben sie gesehen? Zwei Menschen auf der Jagd, die ketzerische Bemerkungen über das Kapitol machen, das schon. Aber nicht zwei Verliebte, wie Präsident Snow anzudeuten scheint. Was das angeht, sind wir auf der sicheren Seite. Es sei denn … es sei denn …
Es ist nur ein Mal passiert. Es kam schnell und überraschend, aber es ist doch passiert.
Nachdem Peeta und ich von den Spielen zurückkamen, vergingen mehrere Wochen, bis ich Gale wieder allein traf. Erst waren da die obligatorischen Feierlichkeiten. Ein Festessen für die Sieger, zu dem nur die ranghöchsten Leute eingeladen waren. Ein Feiertag für den gesamten Distrikt mit Gratisessen und Entertainern aus dem Kapitol. Der Pakettag, der erste von zwölf, an dem jeder im Distrikt ein Essenspaket bekam. Das war das Schönste für mich. Zu sehen, wie all die hungrigen Kinder im Saum herumliefen und Gläser mit Apfelmus schwenkten, Dosen mit Fleisch, sogar Süßigkeiten. Zu Hause warteten noch Getreidesäcke und Ölkannen, die waren zu schwer zu tragen. Zu wissen, dass sie ein Jahr lang jeden Monat so ein Paket bekommen würden. Das war einer der wenigen Momente, in denen ich es richtig gut fand, dass ich die Spiele gewonnen hatte.
In dieser Zeit der Feierlichkeiten, als die Reporter jeden meiner Schritte festhielten, während ich im Mittelpunkt stand und allen dankte und Peeta für das Publikum küsste, da hatte ich keinen Augenblick für mich. Nach ein paar Wochen hatte sich die Lage endlich beruhigt. Die Kamerateams und Reporter packten ihre Sachen und reisten wieder ab. Das Verhältnis zwischen Peeta und mir wurde so kühl, wie es seither ist. Ich zog mit meiner Familie in unser Haus im Dorf der Sieger. Der Alltag in Distrikt 12 - Arbeiter in die Bergwerke, Kinder in die Schule - ging wieder seinen gewohnten Gang. Ich wartete, bis ich dachte, dass die Luft jetzt wirklich rein war, und eines Sonntags stand ich, ohne irgendjemandem ein Wort zu sagen, mehrere Stunden vor Sonnenaufgang auf und zog los in den Wald.
Es war immer noch warm genug, um ohne Jacke zu gehen. Ich nahm eine Tasche mit besonderem Essen mit, kaltes Hühnchen und Käse und Brot vom Bäcker und Orangen. In unserem alten Haus zog ich mir die Jagdstiefel an. Wie üblich stand der Zaun nicht unter Strom, sodass es ein Leichtes war, in den Wald zu schlüpfen und Pfeile und Bogen zu schnappen. Ich ging zu Gales und meinem Ort, dort, wo wir am Morgen der Ernte, bei der ich für die Spiele ausgelost worden war, unser Frühstück geteilt hatten.
Ich wartete mindestens zwei Stunden und dachte schon, dass er mich in den Wochen, die vergangen waren, aufgegeben hätte. Oder dass ich ihm nichts mehr bedeutete. Dass er mich sogar hasste. Und die Vorstellung, ihn für immer verloren zu haben, meinen besten Freund, den Einzigen, dem ich je meine Geheimnisse anvertraut hatte, tat so weh, dass ich es nicht ertragen konnte. Nicht nach all dem, was passiert war. Ich spürte, wie meine Augen sich mit Tränen füllten und meine Kehle eng wurde, wie immer, wenn ich kurz davor bin, zu weinen.
In dem Moment schaute ich auf, und da stand er, drei Meter entfernt, und sah mich nur an. Ohne darüber nachzudenken, sprang ich auf, schlang die Arme um ihn und stieß einen merkwürdigen Laut aus, in dem sich Lachen, Atemlosigkeit und Weinen mischten. Er hielt mich so fest, dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte, aber es dauerte wirklich lange, bis er mich losließ, und auch da nur, weil ihm kaum etwas anderes übrig blieb, denn ich hatte einen wahnsinnig lauten Schluckauf bekommen und musste unbedingt etwas trinken.
Wir machten an dem Tag dasselbe wie früher auch immer. Zusammen frühstücken. Jagen und fischen und sammeln. Über die Leute in der Stadt reden. Aber nicht über uns, sein neues Leben im Bergwerk, meine Zeit in der Arena. Nur über andere Dinge. Als wir schließlich an der Lücke im Zaun ankamen, die dem Hob am nächsten ist, glaubte ich wohl wirklich daran, dass es wieder so sein könnte wie früher. Dass wir so weitermachen könnten wie bisher. Ich hatte Gale das ganze Wild zum Handeln gegeben, weil wir zu Hause jetzt so viel zu essen hatten. Ich sagte, ich würde nicht mit zum Hob kommen, obwohl ich sehr gern gegangen wäre, aber meine Mutter und meine Schwester wüssten nicht einmal, dass ich auf der Jagd sei, und fragten sich bestimmt schon, wo ich steckte. Und gerade als ich vorschlug, dass ich die tägliche Runde an den Fallen entlang übernehmen könnte, nahm er mein Gesicht in die Hände und küsste mich.
Es traf mich völlig unvorbereitet. Man hätte meinen können, dass ich nach den vielen Stunden, die ich mit Gale verbracht hatte - da ich ihn erzählen und lachen und finster blicken gesehen hatte -, über seine Lippen genau Bescheid gewusst hätte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so warm auf meinen anfühlen würden. Oder dass diese Hände, die so komplizierte Fallen stellen konnten, ebenso gut mich einfangen könnten. Ich glaube, ich stieß einen kehligen Laut aus, und ich erinnere mich dunkel an meine Hände, fest zusammengeballt, die auf seiner Brust lagen. Dann ließ er mich los und sagte: »Ich musste das tun. Wenigstens ein Mal.« Und dann war er weg.
Obwohl die Sonne schon unterging und meine Familie sich bestimmt Sorgen machte, setzte ich mich an einen Baum neben dem Zaun. Ich überlegte, wie es mir mit dem Kuss ging, ob er mir gefallen hatte oder ob ich mich darüber ärgerte, aber ich erinnerte mich nur an das Gefühl von Gales Lippen auf meinen und den Duft von Orangen, der immer noch an seiner Haut haftete. Es hatte keinen Sinn, diesen Kuss mit den vielen Küssen zu vergleichen, die ich mit Peeta getauscht hatte. Ich war mir immer noch nicht darüber im Klaren, ob auch nur einer davon zählte. Schließlich ging ich nach Hause.
In dieser Woche kümmerte ich mich um die Fallen und brachte das Fleisch zu Hazelle. Doch Gale sah ich erst am folgenden Sonntag wieder. Ich hatte eine komplette Rede im Kopf, dass ich keinen Freund wollte und niemals heiraten würde, aber ich brauchte sie gar nicht. Gale tat so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Vielleicht wartete er darauf, dass ich etwas sagte. Oder dass ich ihn auch küsste. Stattdessen tat ich ebenfalls so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Aber es hatte ihn gegeben. Gale hatte eine unsichtbare Schranke zwischen uns zerstört und mit ihr meine Hoffnung, wir könnten zu unserer alten, unkomplizierten Freundschaft zurückkehren. Wenn ich auch so tat, als ob, ich konnte seine Lippen nie mehr so ansehen wie früher.
All das geht mir blitzschnell durch den Kopf, während Präsident Snow mich mit seinem Blick durchbohrt, nachdem er gedroht hat, Gale zu töten. Wie dumm von mir, zu denken, das Kapitol würde mich nicht mehr beachten, wenn ich erst einmal zu Hause wäre! Ich hatte zwar keine Ahnung von möglichen Aufständen. Aber ich wusste, dass sie im Kapitol wütend auf mich waren. Anstatt die gebührende Vorsicht walten zu lassen, was tat ich da? Aus der Sicht des Präsidenten habe ich Peeta ignoriert und vor dem ganzen Distrikt demonstriert, dass ich Gale vorziehe. Und damit kundgetan, dass ich das Kapitol wirklich verspottet habe. Mit meinem unbedachten Verhalten habe ich Gale und seine Familie, meine Familie und auch Peeta in Gefahr gebracht.
»Bitte tun Sie Gale nichts«, flüstere ich. »Er ist nur ein Freund. Wir sind schon seit Jahren befreundet. Mehr ist nicht zwischen uns. Außerdem halten uns jetzt sowieso alle für Cousin und Cousine.«
»Mich interessiert nur, wie das dein Verhältnis zu Peeta beeinflusst und damit die Stimmung in den Distrikten«, sagt er.
»Bei der Tour der Sieger wird es so sein wie immer. Ich werde genauso in ihn verliebt sein wie vorher«, sage ich. »Wie jetzt«, verbessert Präsident Snow mich. »Wie jetzt«, bestätige ich.
»Aber wenn die Aufstände abgewendet werden sollen, wirst du noch überzeugender sein müssen«, sagt er. »Diese Tour ist deine letzte Chance, das Blatt zu wenden.«
»Ich weiß. Und es wird mir gelingen. Ich werde alle in den Distrikten davon überzeugen, dass ich nicht das Kapitol herausfordern wollte, sondern verrückt vor Liebe war«, sage ich.
Präsident Snow erhebt sich und tupft die Wulstlippen mit einer Serviette ab. »Du musst dir ein höheres Ziel stecken, für den Fall, dass du es nicht erreichst.«
»Wie meinen Sie das? Was für ein höheres Ziel soll ich mir stecken?«, frage ich.
»Überzeuge mich«, sagt er. Er lässt die Serviette sinken und nimmt wieder sein Buch. Ich schaue ihn nicht an, als er zur Tür geht, deshalb zucke ich zusammen, als er mir ins Ohr flüstert: »Übrigens, ich weiß von dem Kuss.« Dann fällt die Tür hinter ihm ins Schloss.
3
Der Geruch von Blut … er lag in seinem Atem. Was macht er bloß?, denke ich. Trinkt er es? Ich stelle mir vor, wie er Blut aus einer Teetasse trinkt. Wie er einen Keks hineintunkt und ihn rot triefend herauszieht.
Draußen vorm Fenster kommt ein Auto in Gang, sanft und leise wie das Schnurren einer Katze, dann verschwindet es in der Ferne. Es stiehlt sich davon, wie es gekommen ist, unbemerkt.
Das Zimmer scheint sich in langsamen, schiefen Kreisen zu drehen, ich frage mich, ob ich womöglich ohnmächtig werde. Ich beuge mich vor und stütze mich mit einer Hand am Schreibtisch ab. In der anderen halte ich noch immer Peetas wunderhübschen Keks. Ich glaube, es war eine orangefarbene Lilie darauf, doch jetzt sind nur noch Krümel in meiner Faust. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihn zerdrückt habe, aber ich musste mich wohl an irgendetwas festhalten, während meine Welt aus den Fugen geriet.
Ein Besuch von Präsident Snow. Distrikte kurz vor dem Aufstand. Eine direkte Morddrohung gegen Gale, auf die weitere folgen werden. Alle, die ich liebe, todgeweiht. Und wer weiß, wer noch für meine Taten bezahlen muss? Wenn ich bei der Tour der Sieger das Blatt nicht wende. Die Unzufriedenen besänftige und den Präsidenten beruhige. Und wie? Indem ich überall im Land jeden Zweifel daran ausräume, dass ich Peeta Mellark liebe.
Das schaffe ich nicht, denke ich. So gut bin ich nicht. Peeta ist der Gute, der Liebenswürdige. Er kann die Leute von allem überzeugen. Ich schweige lieber, halte mich zurück, überlasse das Reden so weit wie möglich ihm. Aber nicht Peeta soll seine Zuneigung unter Beweis stellen, sondern ich.
Ich höre den leichten, schnellen Schritt meiner Mutter im Flur. Sie darf das nicht erfahren, denke ich. Nichts von alldem. Ich halte die Hände über das Tablett und wische mir schnell die Kekskrümel von den Fingern. Zittrig trinke ich einen Schluck Tee.
»Ist alles in Ordnung, Katniss?«, fragt sie.
»Alles gut. Wir haben es im Fernsehen nie gesehen, aber der Präsident besucht die Sieger immer vor der Tour, um ihnen Glück zu wünschen«, sage ich fröhlich.
Ich sehe ihr an, wie erleichtert sie ist. »Ach so. Ich dachte schon, es gäbe irgendwelche Schwierigkeiten.«
»Nein, gar nicht«, sage ich. »Aber ich kriege Schwierigkeiten, wenn das Vorbereitungsteam sieht, wie meine Augenbrauen schon wieder zugewachsen sind.« Meine Mutter lacht, und ich denke daran, dass ich damals, als ich mit elf Jahren die Sorge für die Familie übernahm, eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen habe. Und dass ich meine Mutter immer werde beschützen müssen.
»Soll ich dir schon mal dein Bad einlassen?«, fragt sie.
»Ja, gern«, sage ich, und ich sehe, wie froh sie über die Antwort ist.
Seit ich wieder zu Hause bin, gebe ich mir große Mühe, das Verhältnis zu meiner Mutter zu verbessern. Anstatt jedes Hilfsangebot abzulehnen, wie ich es jahrelang aus Wut getan habe, bitte ich sie jetzt ab und zu um einen Gefallen. Ich lasse sie das ganze Geld verwalten, das ich gewonnen habe. Erwidere ihre Umarmungen, anstatt sie bloß über mich ergehen zu lassen. In der Arena ist mir klar geworden, dass ich sie nicht länger für etwas bestrafen darf, woran sie nicht schuld ist, vor allem nicht für die schrecklichen Depressionen, in die sie nach dem Tod meines Vaters versunken ist. Manchmal sind die Menschen einfach machtlos gegen das, was mit ihnen geschieht.
Wie ich zum Beispiel, in diesem Moment.
Außerdem hat sie bei meiner Rückkehr in den Distrikt etwas ganz Wunderbares getan. Nachdem unsere Freunde und Verwandten Peeta und mich am Bahnhof begrüßt hatten, durften uns die Reporter ein paar Fragen stellen. Einer fragte meine Mutter, was sie von meinem neuen Freund halte, und sie antwortete, Peeta sei zwar ein Traum von einem jungen Mann, aber ich sei noch nicht alt genug, um überhaupt einen Freund zu haben. Daraufhin warf sie Peeta einen durchdringenden Blick zu. Von der Presse gab es viel Gelächter und Bemerkungen wie: »Da hat aber einer ein Problem«, und Peeta ließ meine Hand los und trat einen Schritt zur Seite. Das dauerte nicht lange - der Druck, sich anders zu verhalten, war zu groß -, doch wir hatten jetzt einen Vorwand, ein wenig zurückhaltender zu sein als im Kapitol. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich von Peeta, seit die Kameras verschwunden sind, nicht mehr allzu viel gesehen habe.
Ich gehe hinauf ins Badezimmer, wo mich eine Wanne mit dampfendem Wasser erwartet. Meine Mutter hat einen kleinen Beutel getrocknete Blumen hinzugegeben, die ihren Duft verströmen. Keiner von uns ist den Luxus gewohnt, einen Wasserhahn aufzudrehen und eine unbegrenzte Menge warmes Wasser zur Verfügung zu haben. In unserem Haus im Saum gab es nur kaltes Wasser, und wenn man baden wollte, musste man das Wasser über dem Feuer erwärmen. Ich ziehe mich aus, lasse mich in das seidenweiche Wasser gleiten - meine Mutter hat auch irgendein Öl hineingetan - und versuche, alles zu ordnen.
Die erste Frage ist, wem ich davon erzählen soll, wenn überhaupt jemandem. Natürlich nicht meiner Mutter und Prim, sie wären krank vor Sorge. Gale auch nicht. Selbst wenn ich mit ihm sprechen könnte. Was sollte er damit anfangen? Wenn er allein wäre, könnte ich versuchen, ihn zur Flucht zu überreden. Ganz sicher würde er im Wald überleben. Aber er ist nicht allein und er würde seine Familie niemals im Stich lassen. Und mich auch nicht. Wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich ihm irgendwie erklären, weshalb unsere Sonntage der Vergangenheit angehören müssen, aber darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Nur über den nächsten Schritt. Außerdem ist Gale schon so wütend auf das Kapitol, dass ich manchmal glaube, er organisiert seinen eigenen Aufstand. Da brauche ich ihn jetzt wirklich nicht noch zusätzlich anzustacheln. Nein, von denen, die ich in Distrikt 12 zurücklasse, kann ich es keinem erzählen.
Es gibt aber noch drei Menschen, denen ich mich anvertrauen könnte. Zunächst einmal Cinna, meinem Stylisten. Aber ich fürchte, dass Cinna jetzt schon in Gefahr ist, und ich möchte ihn nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen, indem ich ihn auf meine Seite ziehe. Dann Peeta, der bei diesem Theater mein Partner sein wird - aber wie sollte ich ein solches Gespräch anfangen? Du, Peeta, weißt du noch, als ich dir erzählt hab, ich hatte nur so getan, als ob ich in dich verliebt wäre? Tja, also, das musst du unbedingt vergessen und dich jetzt ganz besonders verliebt aufführen, sonst bringt der Präsident womöglich Gale um. Ausgeschlossen. Abgesehen davon wird Peeta seine Sache sowieso gut machen, ob er nun weiß, was auf dem Spiel steht, oder nicht. Bleibt noch Haymitch. Der unleidliche, streitsüchtige Trunkenbold Haymitch, dem ich vor nicht allzu langer Zeit eine Schüssel eiskaltes Wasser über den Kopf gekippt habe. Als mein Mentor bei den Spielen war es seine Aufgabe, für mein Überleben zu sorgen. Hoffentlich betrachtet er das immer noch als seinen Job.
Ich lasse mich ganz ins Wasser gleiten, blende die Geräusche um mich herum aus. Jetzt müsste die Badewanne sich ausdehnen, dann könnte ich schwimmen, wie an heißen Sommertagen mit meinem Vater im Wald. Das waren ganz besondere Tage. Wir verließen dann schon frühmorgens das Haus und wanderten tiefer in den Wald hinein als sonst, bis zu einem kleinen See, den er bei der Jagd einmal entdeckt hatte. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich schwimmen gelernt habe, so klein war ich, als er es mir beibrachte. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich immer getaucht bin, im Wasser Purzelbäume schlug und herumplanschte. An den schlammigen Grund des Sees unter meinen Zehen. Den Duft von Blüten und Laub. Wie ich mich auf dem Rücken treiben ließ, so wie jetzt, und in den blauen Himmel schaute, während das Waldgezwitscher vom Wasser ausgeblendet wurde. Er erlegte Wasservögel, die am Ufer nisteten, ich suchte im Gras nach Eiern, und wir beide gruben im seichten Wasser nach Katniss-Knollen, dem Pfeilkraut, nach dem er mich benannt hat. Abends, wenn wir nach Hause kamen, tat meine Mutter so, als würde sie mich nicht wiedererkennen, weil ich so sauber war. Dann bereitete sie ein großartiges Essen aus gebratener Ente und gebackenen Knollen mit Soße.
Mit Gale bin ich nie zu dem See gegangen. Ich hätte es tun können. Es ist ein langer Weg dorthin, aber die Wasservögel sind so leichte Beute, dass man die verlorene Jagdzeit wieder wettmacht. Doch ich wollte den Ort mit niemandem teilen, den Ort, der nur meinem Vater und mir gehörte. Nach den Spielen, als ich wenig zu tun hatte, war ich ein paarmal da. Es war immer noch schön, dort zu schwimmen, aber die Ausflüge haben mich eher deprimiert. Der See hat sich in den letzten sechs Jahren erstaunlich wenig verändert, während ich kaum wiederzuerkennen bin.
Selbst unter Wasser höre ich den Tumult. Autohupen, laute Begrüßungen, Türenknallen. Das kann nur bedeuten, dass meine Begleiter eingetroffen sind. Ich habe gerade noch Zeit, mich abzutrocknen und einen Bademantel überzuziehen, bevor mein Vorbereitungsteam ins Badezimmer platzt. Eine Intimsphäre gibt es nicht. Was meinen Körper angeht, haben wir keine Geheimnisse voreinander, die drei und ich.
»Katniss, deine Augenbrauen!«, kreischt Venia sofort, und trotz des Unheils, das über mir schwebt, muss ich ein Lachen unterdrücken. Ihre blauen Haare stehen in spitzen Zacken vom Kopf ab, und ihre goldenen Tattoos, bisher nur über den Augenbrauen, schlängeln sich jetzt bis unter die Augen. All das verstärkt den Eindruck, dass ich sie wirklich erschreckt habe.
Octavia kommt und klopft Venia beruhigend auf den Rücken, ihr kurvenreicher Körper wirkt neben Venias dünnem, eckigem besonders füllig. »Na, na. Die kriegst du doch im Nu wieder hin. Aber was soll ich bloß mit diesen Nägeln anstellen?« Sie packt meine Finger und drückt sie zwischen ihren erbsgrünen Händen ganz platt. Nein, ihre Haut ist im Moment nicht richtig erbsgrün. Eher von einem hellen Immergrün. Bestimmt ist das im Kapitol gerade die neueste Mode. »Katniss, du hättest mir wirklich ein wenig Material übrig lassen können!«, jammert sie.
Sie hat recht. In den letzten Monaten habe ich meine Nägel völlig heruntergekaut. Ich hatte überlegt, es mir abzugewöhnen, aber mir fiel kein vernünftiger Grund ein. »Tut mir leid«, murmele ich. Darüber, was das für mein Vorbereitungsteam bedeuten würde, habe ich nicht groß nachgedacht.
Flavius hebt ein paar Strähnen meiner nassen, wirren Haare hoch. Er schüttelt missbilligend den Kopf, sodass seine orangefarbenen Korkenzieherlocken wippen. »Hat irgendjemand diese Haare berührt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?«, fragt er streng. »Du weißt doch, wir haben dich vor allem gebeten, deine Haare in Ruhe zu lassen.«
»Ja!«, sage ich, dankbar, ihnen zeigen zu können, dass ich nicht völlig achtlos war. »Ich meine, nein, keiner hat sie geschnitten. Daran hab ich gedacht.« Nein, habe ich nicht. Die Frage hatte sich gar nicht gestellt. Seit ich zurück war, habe ich sie einfach, wie eh und je, zu einem Zopf geflochten.
Das scheint sie zu besänftigen, und sie küssen mich alle, setzen mich in meinem Schlafzimmer auf einen Stuhl, und dann plappern sie, wie üblich, unaufhörlich, ohne sich darum zu scheren, ob ich zuhöre. Während Venia meine Augenbrauen wieder in Form bringt, Octavia mir künstliche Fingernägel verpasst und Flavius irgendein Zeug in meine Haare massiert, erfahre ich alles über das Kapitol. Wie toll die Spiele waren, wie öde es seitdem ist, dass sie es alle gar nicht erwarten können, bis Peeta und ich am Ende der Tour der Sieger wieder vorbeikommen. Danach wird es nicht mehr lange dauern, bis sich das Kapitol auf das Jubel-Jubiläum vorbereitet.
»Ist das nicht spannend?«
»Hast du nicht ein unverschämtes Glück?«
»In deinem allerersten Jahr als Siegerin darfst du schon Mentorin bei einem Jubel-Jubiläum sein!«
In der allgemeinen Aufregung überschneiden sich ihre Worte.
»Doch, ja«, sage ich ausdruckslos. Mehr bringe ich nicht zustande. Schon in einem gewöhnlichen Jahr ist es ein Albtraum, Mentor der Tribute zu sein. Ich kann nicht mehr an der Schule vorbeigehen, ohne mich zu fragen, wen ich wohl betreuen muss. Aber zu allem Übel ist dies das Jahr der fünfundsiebzigsten Hungerspiele und damit ein Jubel-Jubiläum. Alle fünfundzwanzig Jahre ist es so weit, dann wird die Niederlage der Distrikte ganz besonders großartig gefeiert, und als besonderer Spaß wartet noch eine spezielle Grausamkeit auf die Tribute. Natürlich habe ich das noch nie miterlebt. Doch in der Schule habe ich mal gehört, dass das Kapitol zum zweiten Jubel-Jubiläum die doppelte Anzahl Tribute in die Arena geschickt hat. Die Lehrer haben das Thema nicht weiter vertieft, was erstaunlich ist, schließlich machte in dem Jahr Haymitch Abernathy aus unserem Distrikt 12 das Rennen.
»Haymitch kann sich schon mal darauf gefasst machen, dass er so richtig im Mittelpunkt stehen wird«, kreischt Octavia.
Haymitch hat mir gegenüber noch nie von seiner eigenen Zeit in der Arena gesprochen. Ich würde ihn auch nie danach fragen. Und falls ich seine Spiele je als Wiederholung gesehen habe, war ich wohl noch zu klein, um mich daran zu erinnern. Aber dieses Jahr wird das Kapitol ihn am Vergessen hindern. Im Grunde ist es ganz gut, dass Peeta und ich bei dem Jubiläum als Mentoren zur Verfügung stehen, denn Haymitch wird garantiert sturzbetrunken sein.
Nachdem sie sich hinreichend über das Jubel-Jubiläum ausgelassen haben, tauschen sie sich endlos lange über ihr unsäglich belangloses Leben aus. Wer was über wen auch immer gesagt hat, was für Schuhe sie gerade gekauft haben und dann noch eine lange Geschichte von Octavia darüber, was für ein Fehler es gewesen sei, dass die Gäste auf ihrer Geburtstagsfeier Federschmuck tragen sollten.
Schon bald brennt die Haut unter meinen Augenbrauen, meine Haare sind glatt und seidig und meine Nägel bereit für den Lack. Anscheinend ist das Team angewiesen, nur meine Hände und mein Gesicht zu behandeln, alles andere wird bei dem kalten Wetter wohl bedeckt sein. Flavius würde zu gern sein eigenes Markenzeichen, lila Lippenstift, bei mir anwenden, gibt sich dann aber doch mit Rosa zufrieden. An der Farbpalette, die Cinna festgelegt hat, sehe ich, dass wir auf mädchenhaft machen, nicht auf sexy. Gut so. Wenn ich versuchen müsste, aufreizend auszusehen, würde ich nie jemanden von irgendetwas überzeugen. Das hat Haymitch sehr deutlich gemacht, als er mich nach den Spielen für das Interview vorbereitet hat.
Meine Mutter kommt herein, ein wenig schüchtern, und sagt, Cinna habe sie gebeten, dem Vorbereitungsteam zu zeigen, wie sie mir am Tag der Ernte das Haar frisiert hat. Sie sind begeistert und schauen fasziniert zu, wie meine Mutter die komplizierte Frisur genau erklärt. Im Spiegel sehe ich, wie sie mit ernstem Gesicht jede ihrer Bewegungen verfolgen und wie eifrig sie bei der Sache sind, als sie es selbst probieren dürfen. Alle drei behandeln meine Mutter respektvoll und freundlich, und jetzt schäme ich mich dafür, dass ich mich ihnen immer so überlegen fühle. Wer weiß, wie ich wäre oder worüber ich reden würde, wenn ich im Kapitol aufgewachsen wäre? Vielleicht hätte ich dann auch nichts Schlimmeres zu bereuen, als dass die Gäste zu meiner Geburtstagsfeier in Federkostümen gekommen sind.
Als meine Frisur fertig ist, gehe ich hinunter ins Wohnzimmer, wo ich Cinna treffe. Sein bloßer Anblick stimmt mich ein wenig hoffnungsfroher. Er sieht aus wie immer, einfache Kleider, kurze braune Haare, nur ein Hauch goldener Eyeliner. Wir umarmen uns und um ein Haar wäre ich mit der Geschichte über Präsident Snow herausgeplatzt. Aber nein, ich habe beschlossen, es zuerst Haymitch zu erzählen. Er wird am besten wissen, wen ich damit belasten kann. Aber es ist so leicht, mit Cinna zu reden. In letzter Zeit haben wir oft telefoniert, denn mit dem Haus haben wir gleichzeitig auch ein Telefon bekommen. Es ist eigentlich ein Witz, weil praktisch niemand, den wir kennen, eins besitzt. Peeta ja, aber ihn rufe ich natürlich nicht an. Haymitch hat seins schon vor Jahren aus der Wand gerissen. Meine Freundin Madge, die Tochter des Bürgermeisters, hat zu Hause ein Telefon, aber wenn wir uns unterhalten wollen, tun wir das persönlich. Am Anfang wurde das Ding fast gar nicht benutzt. Dann rief Cinna regelmäßig an, um an meinem Talent zu arbeiten.
Von jedem Sieger wird erwartet, dass er ein Talent hat. Ein Hobby, das man pflegt, da man ja weder zur Schule gehen noch arbeiten muss. Es kann eigentlich alles sein, alles, wovon sich in einem Interview erzählen lässt. Peeta hat tatsächlich ein Talent, er kann malen. Jahrelang hat er die Torten und Kekse in der Bäckerei seiner Familie verziert. Aber jetzt, da er reich ist, kann er es sich leisten, richtige Farbe auf Leinwand zu pinseln. Ich habe kein Talent, mal abgesehen von illegalem Jagen, aber das gilt nicht. Oder vielleicht Singen, was ich nicht in einer Million Jahren für das Kapitol tun würde. Meine Mutter hat versucht, mich für die unterschiedlichsten Hobbys von einer Liste, die Effie Trinket ihr geschickt hat, zu begeistern. Kochen, Blumenbinden, Flötenspiel. Nichts davon hat geklappt, während Prim für alle drei Talent hatte. Schließlich hat Cinna sich eingeschaltet und angeboten, meine Leidenschaft für Modedesign zu entwickeln, die wirklich erst entwickelt werden musste, da sie bis dahin gar nicht existierte. Aber ich habe zugestimmt, weil ich auf diese Weise mit Cinna reden konnte, und er versprach, die ganze Arbeit zu machen.
Jetzt drapiert er mein Wohnzimmer mit Kleidern, Stoffen und Skizzenbüchern voller Zeichnungen, die er angefertigt hat. Ich nehme eins der Skizzenbücher und schaue ein Kleid an, das ich angeblich entworfen habe. »Also, ich finde mich wirklich vielversprechend«, sage ich.
»Zieh dich an, du nichtsnutziges Ding«, sagt er und wirft mir ein Bündel Kleider zu.
Ich interessiere mich zwar nicht für Design, aber ich liebe die Kleidung, die Cinna für mich entwirft. So wie diese hier. Eine locker fallende schwarze Hose aus dickem, warmem Stoff.
Ein bequemes weißes T-Shirt. Ein Pulli aus grüner, blauer und grauer lämmchenweicher Wolle. Lederne Schnürstiefel, die meine Zehen nicht einquetschen.
»Hab ich meine Kleider selbst entworfen?«
»Nein, es ist dein Ziel, deine eigenen Kleider zu entwerfen und wie ich zu sein, dein großes Mode-Idol«, sagt Cinna. Er reicht mir einen kleinen Stapel Karten. »Das liest du aus dem Off, während die Kleider gefilmt werden. Lass es so klingen, als ob es dich wirklich interessiert.«
In diesem Moment kommt Effie Trinket mit kürbisfarbener Perücke auf dem Kopf herein und mahnt alle: »Vergesst mir nicht den Zeitplan!« Sie küsst mich auf beide Wangen und winkt das Kamerateam herein, dann sagt sie mir, was ich zu tun habe. Effie allein ist es zu verdanken, dass wir im Kapitol immer pünktlich waren, also tue ich ihr den Gefallen. Ich hüpfe herum wie eine Marionette, halte Kleider hoch und sage sinnlose Sätze wie »Ist das nicht super?«. Während ich begeistert von meinen Karten ablese, nehmen die Tontechniker mich auf, um meine Kommentare später einfügen zu können. Dann werde ich hinausgeworfen, damit die Kameraleute in Ruhe meine beziehungsweise Cinnas Entwürfe filmen können.
Prim ist für das Ereignis extra früher von der Schule nach Hause gekommen. Jetzt steht sie in der Küche und wird von einem anderen Team interviewt. Sie sieht wunderschön aus in einem himmelblauen Kleid, das ihre Augen zur Geltung bringt; die blonden Haare sind mit einem Band in der gleichen Farbe zurückgebunden. Sie beugt sich auf den Spitzen ihrer glänzenden weißen Stiefel ein wenig vor, als wollte sie abheben wie …
Wumm! Es ist ein Gefühl, als hätte mir jemand gegen die Brust geschlagen. Natürlich nicht wirklich, aber der Schmerz ist so real, dass ich einen Schritt zurückweiche. Ich mache die Augen ganz fest zu und sehe nicht Prim - ich sehe Rue, das zwölfjährige Mädchen aus Distrikt 11, meine Verbündete in der Arena. Sie konnte fliegen wie ein Vogel, von Baum zu Baum, sie fand auf den zartesten Ästen Halt. Rue, die ich nicht gerettet habe. Die ich sterben ließ. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Boden liegt, den Speer im Bauch …
Wen noch werde ich nicht vor der Rache des Kapitols retten können? Wer wird noch sterben, wenn ich Präsident Snow nicht zufriedenstelle?
Ich merke, dass Cinna versucht, mir einen Mantel anzuziehen, also hebe ich die Arme. Ich spüre, wie Pelz mich umhüllt. Er stammt von einem Tier, das ich noch nie gesehen habe. »Hermelin«, sagt Cinna, als ich über den weißen Ärmel streiche. Lederhandschuhe. Ein knallroter Schal. Etwas Pelziges bedeckt meine Ohren. »Du bringst Ohrenschützer wieder in Mode.«
Ich hasse Ohrenschützer, denke ich. Mit den Dingern kann man schlecht hören, und seit ich in der Arena bei einer Explosion auf einem Ohr taub geworden war, verabscheue ich sie noch mehr. Nach meinem Sieg hat das Kapitol mein Ohr wiederhergestellt, aber ich merke, dass ich es immer noch oft überprüfe.
Meine Mutter kommt herbeigelaufen, sie verbirgt etwas in den Händen. »Als Glücksbringer«, sagt sie.
Es ist die Brosche, die Madge mir gegeben hat, bevor ich in die Spiele gezogen bin. Ein fliegender Spotttölpel in einem goldenen Ring. Ich wollte die Brosche Rue schenken, doch sie hat sie nicht angenommen. Sie sagte, wegen der Brosche habe sie beschlossen, mir zu vertrauen. Cinna steckt sie am Knoten des Schals fest.
Effie Trinket kommt herbei und klatscht in die Hände. »Alle mal herhören! Wir machen gleich die erste Außenaufnahme -die Sieger begrüßen einander zu Beginn der wunderbaren Tour. Los, Katniss, strahlendes Lächeln bitte, du freust dich wahnsinnig, klar?« Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sie mich zur Tür hinausschiebt.
Im ersten Moment kann ich nichts sehen, denn jetzt hat es richtig angefangen zu schneien. Dann erkenne ich Peeta, der aus der Haustür kommt. Ich habe die Anweisung von Präsident Snow im Kopf: »Überzeuge mich.« Und ich weiß, dass ich es tun muss.
Ich setze mein strahlendstes Lächeln auf und gehe auf Peeta zu. Dann renne ich los, als könnte ich keine Sekunde länger warten. Er fängt mich auf und wirbelt mich herum, rutscht plötzlich aus - er hat sein künstliches Bein noch nicht ganz in der Gewalt -, und wir fallen in den Schnee, ich auf ihn drauf, und dann küssen wir uns, zum ersten Mal seit Monaten. Es ist ein Kuss voller Pelz und Schnee und Lippenstift, doch darunter spüre ich die Ruhe, die Peeta immer ausstrahlt. Und ich weiß, dass ich nicht allein bin. Sosehr ich ihn auch verletzt habe, er wird mich vor den Kameras nicht bloßstellen. Wird mich nicht mit einem halbherzigen Kuss bestrafen. Er passt immer noch auf mich auf. Genau wie in der Arena. Bei dem Gedanken würde ich am liebsten weinen. Doch ich helfe ihm auf, hake mich mit meiner behandschuhten Hand bei ihm unter und ziehe ihn vergnügt mit.
Der Rest des Tages ist ein verschwommenes Durcheinander aus dem Weg zum Bahnhof, dem Abschied von allen, dem abfahrenden Zug, dem Abendessen mit dem alten Team - Peeta und ich, Effie und Haymitch, Cinna und Portia, Peetas Stylistin -, ein himmlisches Abendessen, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dann bin ich in einen Schlafanzug und einen riesigen Bademantel gehüllt, sitze in meinem vornehmen Abteil und warte darauf, dass die anderen schlafen gehen. Ich weiß, dass Haymitch noch stundenlang wach sein wird. Er schläft nicht gern, wenn es draußen dunkel ist.
Als im Zug alles ruhig scheint, ziehe ich meine Pantoffeln an und tapse zu seiner Tür. Ich muss mehrmals anklopfen, ehe er kommt, fluchend, als wäre er überzeugt, dass ich schlechte Neuigkeiten bringe.
»Was willst du?«, fragt er, und der Weindunst, den er verströmt, haut mich fast um.
»Ich muss mit dir reden«, flüstere ich.
»Jetzt?«, fragt er. Ich nicke. »Hoffentlich hast du einen guten Grund.« Er wartet, aber ich habe das Gefühl, dass jedes Wort, das wir in einem Zug des Kapitols sagen, aufgezeichnet wird. »Und?«, sagt er schroff.
Der Zug bremst ab, und ganz kurz denke ich, Präsident Snow hat mich beobachtet und es nicht gutgeheißen, dass ich mich Haymitch anvertraue, und deshalb hat er beschlossen, mich auf der Stelle zu töten. Doch wir halten nur an, weil der Zug Treibstoff braucht.
»Hier im Zug ist es so stickig«, sage ich.
Es ist ein harmloser Satz, aber ich sehe, wie Haymitch die Augen schmal macht, er hat verstanden. »Dagegen weiß ich was.« Er schiebt sich an mir vorbei und torkelt durch den Gang zu einer Tür. Als er sie mühsam geöffnet hat, schlägt uns eine Schneewolke entgegen. Er stolpert hinaus und landet auf dem Boden.
Eine Dienerin vom Kapitol eilt herbei, um zu helfen, doch Haymitch gibt ihr gutmütig zu verstehen, dass sie wieder gehen kann, und taumelt weiter. »Brauch bloß ein bisschen frische Luft. Nur einen kleinen Moment.«
»Entschuldigung. Er ist betrunken«, sage ich. »Ich hole ihn rein.« Ich springe hinunter und stolpere hinter ihm an den Gleisen entlang. Meine Pantoffeln werden im Schnee klatschnass, während er mich ans Ende des Zuges führt, damit uns niemand hören kann. Dann wendet er sich zu mir.
»Was ist los?«
Ich erzähle ihm alles. Von dem Besuch des Präsidenten, von Gale und dass wir alle sterben müssen, wenn ich versage.
Sein Gesicht wird nüchterner, scheint im Licht der roten Schlusslichter zu altern. »Dann darfst du eben nicht versagen.«
»Wenn du mir bloß helfen kannst, diese Tour zu überstehen …«, setze ich an.
»Nein, Katniss, es geht nicht nur um die Tour«, sagt er.
»Wie meinst du das?«, frage ich.
»Selbst wenn du es schaffst, kommen sie doch in ein paar Monaten wieder und holen uns alle zu den Spielen ab. Du und Peeta, ihr werdet Mentoren sein, jedes Jahr von nun an. Und jedes Jahr werden sie auf die Liebesgeschichte zurückkommen und alle Einzelheiten deines Privatlebens breittreten, und du kannst nichts anderes tun, als bis ans Ende deiner Tage mit diesem Jungen zu leben.«
Seine Worte treffen mich mit voller Wucht. Selbst wenn ich es möchte, wird es für mich nie ein Leben mit Gale geben. Ich werde nie allein leben dürfen. Ich muss für immer in Peeta verliebt sein. Das Kapitol wird darauf bestehen. Ein paar Jahre darf ich vielleicht noch mit meiner Mutter und Prim zusammenwohnen, weil ich ja erst siebzehn bin. Und dann … und dann …
»Verstehst du, was ich sagen will?«, drängt er.
Ich nicke. Er will sagen, dass es nur eine mögliche Zukunft gibt, wenn ich dafür sorgen möchte, dass meine Lieben und ich selbst am Leben bleiben. Ich werde Peeta heiraten müssen.
4
Schweigend trotten wir zurück zum Zug. Im Gang vor meinem Abteil klopft Haymitch mir auf die Schulter und sagt: »Du könntest es viel schlechter treffen.« Dann geht er weiter zu seinem Abteil, die Weinfahne weht hinter ihm her.
In meinem Abteil ziehe ich die durchweichten Pantoffeln, den nassen Bademantel und den Schlafanzug aus. In den Schubladen sind noch mehr Schlafanzüge, doch ich krieche einfach in Unterwäsche unter die Bettdecke. Ich starre in die Dunkelheit und denke über das Gespräch mit Haymitch nach. Alles, was er gesagt hat, stimmt: die Erwartungen des Kapitols, meine Zukunft mit Peeta, sogar seine letzte Bemerkung. Natürlich könnte ich es viel schlechter treffen als mit Peeta. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Eine der wenigen Freiheiten, die wir in Distrikt 12 haben, ist das Recht, zu heiraten, wen wir wollen, oder auch gar nicht zu heiraten. Und jetzt haben sie mir selbst das noch genommen. Ich frage mich, ob Präsident Snow wohl darauf bestehen wird, dass wir Kinder bekommen. Wenn wir welche bekommen, werden sie sich jedes Jahr der Ernte stellen müssen. Und wäre das nicht ein Spektakel, wenn das Kind nicht nur eines Siegers, sondern gleich zweier Sieger für die Arena auserwählt würde? Es ist schon öfter vorgekommen, dass Kinder von Siegern in den Ring mussten. Dann gibt es jedes Mal große Aufregung, und die Leute sagen, dass diese Familie wirklich kein Glück hat. Aber es kommt so oft vor, dass es nicht nur mit Glück zu tun haben kann. Gale ist davon überzeugt, dass es Absicht ist; dass das Kapitol die Auslosung manipuliert, um die Dramatik zu steigern. Wenn man bedenkt, für wie viel Ärger ich gesorgt habe, dann dürfte jedem meiner Kinder ein Auftritt in den Spielen garantiert sein.
Ich denke an Haymitch, der unverheiratet ist, keine Familie hat und die Welt mit Alkohol ausblendet. Er hätte jede Frau im Distrikt haben können. Und wählte die Abgeschiedenheit. Nicht Abgeschiedenheit - das klingt zu friedlich. Eher so etwas wie Einzelhaft. Wusste er nach seiner Erfahrung in der Arena, dass das besser war, als die Alternative zu riskieren? Ich habe einen Vorgeschmack auf diese Alternative bekommen, als am Tag der Ernte Prims Name aufgerufen wurde und ich sah, wie sie zur Bühne ging, geradewegs in den Tod. Doch als Schwester konnte ich mich an ihrer Stelle melden, was unserer Mutter nicht erlaubt war.
Panisch versuche ich einen Ausweg zu ersinnen. Ich kann es nicht zulassen, dass Präsident Snow mich zu diesem Los verdammt. Und wenn ich mir das Leben nehmen müsste. Aber vorher würde ich versuchen zu fliehen. Was würden sie tun, wenn ich einfach abtauchen würde? In den Wald verschwinden und nie mehr herauskommen würde? Wäre es vielleicht sogar denkbar, alle meine Lieben mitzunehmen und mitten in der Wildnis ein neues Leben anzufangen? Höchst unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Ich schüttele den Kopf, um die Gedanken zu ordnen. Jetzt ist nicht der richtige Moment, um wilde Fluchtpläne zu schmieden. Ich muss mich auf die Tour der Sieger konzentrieren. Das Schicksal zu vieler Menschen hängt davon ab, dass ich eine überzeugende Vorstellung liefere.
Das Morgengrauen kommt vor dem Schlaf und dann klopft auch schon Effie an meine Tür. Ich ziehe die erstbesten Sachen an, die auf der Kommode liegen, und schleppe mich in den Speisewagen. Ich verstehe nicht, weshalb ich früh aufstehen soll, da es ohnehin ein Reisetag ist, aber dann erfahre ich, dass die Verschönerung gestern nur für den Weg zum Bahnhof war. Heute macht sich das Vorbereitungsteam noch mal richtig an die Arbeit.
»Wozu? Bei der Kälte sieht man doch sowieso nichts«, murre ich.
»In Distrikt 11 ist es aber nicht kalt«, sagt Effie.
Distrikt 11. Unsere erste Station. Ich würde lieber in einem anderen Distrikt anfangen, denn in 11 war Rue zu Hause. Aber so läuft das nicht bei der Tour der Sieger. Normalerweise geht es in Distrikt 12 los, dann werden der Reihe nach alle Distrikte durchlaufen, bis die Reise schließlich ins Kapitol führt. Der Distrikt des Siegers wird ausgespart und kommt ganz zum Schluss dran. Sonst veranstaltet Distrikt 12 immer die am wenigsten spektakuläre Feier - für gewöhnlich nur ein Essen für die Tribute und eine Siegesfeier auf dem Platz, bei der niemand so aussieht, als würde er sich amüsieren. In diesem Jahr wird Distrikt 12 zum ersten Mal seit Haymitchs Sieg die Endstation der Tour sein und das Kapitol spendiert die Feier, da ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir hier so schnell wie möglich verschwinden, damit alles vorbereitet werden kann.
Ich versuche das Essen zu genießen, wie Hazelle es mir geraten hat. Die Leute in der Küche wollen mir offenbar eine Freude machen. Sie haben mein Leibgericht gekocht, Lammeintopf mit Backpflaumen, und andere Köstlichkeiten. Auf dem Tisch warten an meinem Platz Orangensaft und ein Becher dampfend heißer Kakao. Ich esse eine Menge, und das Mahl ist tadellos, aber ich kann nicht sagen, dass ich es genieße. Außerdem ärgert es mich, dass sich außer Effie und mir niemand blicken lässt. »Wo sind die anderen alle?«, frage ich.
»Ach, wer weiß, wo Haymitch ist«, sagt Effie. Mit Haymitch hatte ich sowieso nicht gerechnet, der geht wahrscheinlich gerade schlafen. »Cinna war gestern lange auf, er musste einen Waggon für deine Kleider organisieren. Er hat bestimmt über hundert für dich. Deine Abendgarderobe ist exquisit. Und Peetas Team schläft vermutlich noch.«
»Muss er nicht vorbereitet werden?«, frage ich.
»Nicht so wie du«, sagt Effie.
Was soll das heißen? Es heißt, dass ich den Vormittag damit verbringen werde, mir die Haare vom Körper reißen zu lassen, während Peeta ausschlafen kann. Ich hatte nicht groß darüber nachgedacht, aber in der Arena haben wenigstens einige der Jungs ihre Körperbehaarung behalten, von den Mädchen dagegen kein einziges. Jetzt erinnere ich mich an Peetas Behaarung, als ich ihn am Bach gewaschen habe. Sehr blond im Sonnenlicht, nachdem ich den Schlamm und das Blut erst einmal abgespült hatte. Nur sein Gesicht blieb vollkommen glatt. Nicht einer von den Jungs bekam einen Bart, obwohl viele alt genug waren. Ich frage mich, was sie wohl mit ihnen angestellt haben.
Wenn ich mich schon groggy fühle, so scheint mein Vorbereitungsteam in noch schlimmerer Verfassung zu sein. Sie stürzen den Kaffee hinunter und tauschen kleine bunte Pillen. Soweit ich weiß, stehen sie nie vor dem Mittag auf, es sei denn, es gibt eine Art nationalen Notstand, wie zum Beispiel meine behaarten Beine. Ich war so froh, als die Haare wieder wuchsen. Als wären sie ein Zeichen dafür, dass alles wieder wie immer werden könnte. Ich streiche mit den Fingern über den weichen, gekräuselten Flaum auf meinen Beinen und überlasse mich dem Team. Keiner von ihnen ist zu dem üblichen Geplapper aufgelegt, deshalb höre ich, wie jedes einzelne Härchen herausgerissen wird. Ich muss mich in einer Wanne mit einer dicken, unangenehm riechenden Lotion baden, während mein Gesicht und meine Haare mit Cremes ein gekleistert werden. Dann zwei weitere Bäder mit anderen, nicht so ekelhaften Zusätzen. Ich werde gerupft und geschrubbt und massiert und gesalbt, bis ich mir vorkomme wie ein Hühnchen.
Flavius fasst mir mit einer Hand unters Kinn und seufzt. »Es ist ein Jammer, dass Cinna gesagt hat, bei dir darf nichts verändert werden.«
»Ja, wir könnten wirklich etwas Besonderes aus dir machen«, sagt Octavia.
»Wenn sie älter ist«, sagt Venia fast grimmig. »Dann muss er es erlauben.«
Was? Dass sie meine Lippen aufspritzen wie die von Präsident Snow? Mir die Brüste tätowieren? Meine Haut magenta färben und mir Edelsteine einsetzen? Mir Verzierungen ins Gesicht ritzen? Mir gebogene Krallen verpassen? Oder Schnurrhaare? All das und noch viel mehr habe ich bei verschiedenen Leuten im Kapitol gesehen. Wissen sie wirklich nicht, wie abgedreht das auf andere wirkt?
Die Vorstellung, den Geschmacksverirrungen meines Vorbereitungsteams ausgeliefert zu sein, ist nur eine weitere Sorge von vielen, die mich beschäftigen - mein geschundener Körper, Schlafmangel, die drohende Zwangsehe und der Horror, dass ich die Forderungen von Präsident Snow nicht werde erfüllen können. Als ich zum Mittagessen komme, wo Effie, Cinna, Portia, Haymitch und Peeta schon ohne mich angefangen haben, bin ich zu niedergeschlagen, um zu reden. Sie schwärmen vom Essen und davon, wie wunderbar sie im Zug schlafen können. Alle sind ganz aus dem Häuschen über die Tour der Sieger. Na ja, alle bis auf Haymitch. Er hat einen Kater und knabbert an einem Muffin. Ich habe auch keinen großen Hunger, entweder weil ich heute Morgen zu viel schweres Zeug in mich hineingestopft habe oder weil ich so unglücklich bin. Ich rühre in meiner Brühe herum und esse nur ein, zwei Löffel davon. Ich kann Peeta - meinen zukünftigen Mann - nicht einmal ansehen, obwohl ich weiß, dass er keine Schuld an alldem trägt.
Die anderen merken, dass etwas nicht stimmt, und versuchen mich ins Gespräch einzubeziehen, aber ich bin abweisend. Irgendwann hält der Zug. Unser Kellner berichtet uns, dass es diesmal nicht nur wegen Treibstoff ist - irgendein Zugteil ist defekt und muss ausgetauscht werden. Es wird mindestens eine Stunde dauern. Das bringt Effie in Rage. Sie holt ihren Plan heraus und berechnet, wie diese Verzögerung jedes Ereignis bis zum Ende unseres Lebens beeinflussen wird. Schließlich ertrage ich es nicht mehr, mir das anzuhören.
»Das interessiert doch keinen, Effie!«, sage ich schroff. Alle am Tisch starren mich an, sogar Haymitch, der doch auf meiner Seite sein müsste, weil Effie ihm auf die Nerven geht. Sofort fühle ich mich in die Enge getrieben. »Absolut keinen!«, sage ich, stehe auf und verlasse den Speisewagen.
Auf einmal kommt es mir stickig vor im Zug und mir ist regelrecht mulmig. Ich suche den Ausgang, mache die Tür gewaltsam auf - wobei ich irgendeinen Alarm auslöse, den ich ignoriere - und springe hinaus in der Erwartung, im Schnee zu landen. Doch die Luft fühlt sich warm und mild auf der Haut an. Die Bäume haben noch grüne Blätter. Wie weit südlich sind wir an einem Tag gereist? Ich laufe an den Schienen entlang, blinzele ins grelle Sonnenlicht und bereue schon, was ich zu Effie gesagt habe. Sie kann ich kaum dafür verantwortlich machen, dass ich in der Zwickmühle stecke. Eigentlich müsste ich zurückgehen und mich entschuldigen. Mein Ausbruch war der Gipfel an schlechtem Benehmen und gutes Benehmen ist für Effie sehr wichtig. Doch meine Füße gehen weiter am Gleis entlang, am Ende des Zuges vorbei und immer noch weiter. Eine Stunde Verspätung. Ich kann mindestens zwanzig Minuten in eine Richtung gehen und wieder zurück, dann habe ich trotzdem noch reichlich Zeit. Aber nach ein paar Hundert Metern lasse ich mich auf dem Boden nieder, bleibe dort sitzen und schaue in die Ferne. Wenn ich Pfeil und Bogen hätte, würde ich dann einfach weitergehen?
Nach einer Weile höre ich hinter mir Schritte. Bestimmt Haymitch, der mich zusammenstauchen will. Nicht, dass ich es nicht verdient hätte, aber ich will es trotzdem nicht hören. »Ich bin nicht in der Stimmung für eine Lektion«, sage ich warnend zu dem Gras vor meinen Füßen.
»Ich versuche es kurz zu machen.« Peeta setzt sich neben mich.
»Ich dachte, du wärst Haymitch«, sage ich.
»Nein, der kämpft immer noch mit seinem Muffin.« Ich sehe, wie Peeta seine Prothese in die richtige Position bringt. »Schlechter Tag, was?«
»Es ist nichts«, sage ich.
Er holt tief Luft. »Hör mal, Katniss, ich wollte schon länger mit dir darüber reden, wie ich mich im Zug benommen hab. Ich meine, im letzten Zug - der, mit dem wir nach Hause gefahren sind. Ich wusste, dass zwischen Gale und dir etwas war. Ich war schon eifersüchtig auf ihn, bevor ich dich überhaupt offiziell kennenlernte. Und es war unfair, dich auf das festzunageln, was in den Spielen passiert ist. Das tut mir leid.«
Seine Entschuldigung überrumpelt mich. Es stimmt, dass er mir die kalte Schulter gezeigt hat, nachdem ich ihm gestand, dass ich ihm in der Arena etwas vorgespielt hatte. Aber das werfe ich ihm nicht vor. In der Arena habe ich auf Teufel komm raus den Liebesengel gespielt. Es gab Momente, in denen ich mir nicht sicher war, was ich für ihn empfand. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher.
»Mir tut es auch leid«, sage ich. Ich weiß nicht so recht, was mir eigentlich leidtut. Vielleicht, dass ich ihn jetzt möglicherweise wirklich zerstören werde.
»Dir braucht überhaupt nichts leidzutun. Du hast nur versucht, uns beiden das Leben zu retten. Aber ich will nicht, dass wir so weitermachen - dass wir uns im richtigen Leben ignorieren und uns dann zusammen in den Schnee fallen lassen, sobald eine Kamera in der Nähe ist. Ich hab mir gedacht, wenn ich nicht mehr so, hm, verletzt bin, dann könnten wir doch versuchen, einfach Freunde zu werden«, sagt er.
Wie es aussieht, sind alle meine Freunde zum Sterben verdammt, aber wenn ich Peeta zurückweise, rettet ihn das auch nicht. »Gut«, sage ich. Nach seinem Angebot geht es mir schon besser. Ich komme mir nicht mehr so verlogen vor. Es wäre schön gewesen, wenn er damit früher herausgerückt wäre - bevor ich erfuhr, dass Präsident Snow anderes im Sinn hat, und die Möglichkeit, einfach Freunde zu sein, zunichtegemacht wurde. Doch zumindest freue ich mich, dass wir wieder miteinander reden.
»Also, was ist los?«, fragt er.
Ich kann es ihm nicht sagen. Ich zupfe am Unkraut.
»Dann fangen wir mit was Einfacherem an. Ist es nicht komisch, dass ich weiß, du würdest dein Leben für mich aufs Spiel setzen … aber deine Lieblingsfarbe nicht kenne?«, sagt er.
Ein Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. »Grün. Und deine?«
»Orange«, sagt er.
»Orange? Wie Effies Haare?«, frage ich.
»Ein bisschen gedeckter«, erwidert er. »Eher so wie … der Sonnenuntergang.«
Der Sonnenuntergang. Sofort habe ich ein Bild vor Augen, den Rand der untergehenden Sonne, den Himmel, der in warmen Orangetönen gestreift ist. Wunderschön. Ich erinnere mich an den Lilienkeks, und jetzt, da Peeta wieder mit mir redet, fällt es mir schwer, nicht mit der ganzen Geschichte von Präsident Snow herauszuplatzen. Aber ich weiß, dass Haymitch das nicht gut fände. Ich halte mich lieber an unverfängliche Themen.
»Übrigens schwärmen ja alle von deinen Bildern. Schade, dass ich sie nicht gesehen habe«, sage ich.
»Ich hab einen ganzen Waggon voll.« Er steht auf und reicht mir eine Hand. »Komm.«
Das fühlt sich gut an, seine Finger wieder mit meinen verschränkt, nicht für die anderen, sondern aus Freundschaft. Hand in Hand gehen wir zurück zum Zug. An der Tür fällt es mir ein: »Ich muss erst zu Effie und mich entschuldigen.«
»Keine falsche Zurückhaltung«, sagt Peeta.
Als wir wieder im Speisewagen sind, wo die anderen immer noch essen, entschuldige ich mich so überschwänglich bei Effie, dass ich denke, es ist zu viel des Guten, doch für sie reicht es wahrscheinlich gerade eben, um meinen Fauxpas wieder wettzumachen. Immerhin nimmt sie die Entschuldigung gutmütig an. Sie sagt, sie verstehe schon, dass ich unter großem Druck stehe. Und dann redet sie nur ganze fünf Minuten davon, dass sich ja einer um den Zeitplan kümmern müsse. Ich bin also glimpflich davongekommen.
Als Effie fertig ist, gehe ich mit Peeta ein paar Wagen weiter und er zeigt mir seine Bilder. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Größere Versionen der Blumenkekse vielleicht. Aber das hier ist etwas vollkommen anderes. Peeta hat die Spiele gemalt.
Manche Bilder wären für jemanden, der nicht mit ihm in der Arena war, nicht sofort zu deuten. Wasser, das durch die Spalten in unserer Höhle tröpfelt. Der ausgetrocknete Tümpel. Zwei Hände, seine eigenen, die nach Wurzeln graben. Andere Bilder würde jeder Betrachter gleich erkennen. Das goldene Füllhorn. Clove, wie sie Messer in ihrer Jacke verstaut. Eine der Mutationen, unverkennbar die blonde mit den grünen Augen, die Glimmer darstellt; knurrend kommt sie auf uns zu. Und da bin ich. Ich bin überall. Wie ich hoch oben auf einem Baum sitze. Wie ich ein Hemd an die Felsen im Bach schlage. Wie ich bewusstlos in einer Blutlache liege. Ein Bild kann ich nicht einordnen - vielleicht habe ich so ausgesehen, als er hohes Fieber hatte -, da tauche ich aus einem silbergrauen Nebel auf. »Wie findest du sie?«, fragt er.
»Grauenhaft«, sage ich. Ich kann beinahe das Blut riechen, den Dreck, den künstlichen Atem der Mutation. »Ich versuche die ganze Zeit, die Arena zu vergessen, und du erweckst sie wieder zum Leben. Wie kommt es, dass du dich so genau an alles erinnerst?«
»Ich sehe es jede Nacht«, sagt er.
Ich weiß, was er meint. Albträume - die mir schon vor den Spielen nicht fremd waren - plagen mich jetzt immer, wenn ich schlafe. Dagegen ist das altbekannte Bild, das von meinem Vater, wie er in der Mine in Fetzen gerissen wird, selten geworden. Stattdessen erlebe ich verschiedene Variationen der Ereignisse in der Arena. Mein aussichtsloser Versuch, Rue zu retten. Peeta, wie er verblutet. Glimmers aufgedunsener Körper, der sich unter meinen Händen auflöst. Cato, dem die Mutationen ein entsetzliches Ende bereiten. Das sind meine häufigsten Besucher. »Ich auch. Hilft das? Wenn du sie malst?«
»Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab dadurch etwas weniger Angst, abends schlafen zu gehen, jedenfalls sage ich mir das. Aber sie sind nicht verschwunden.«
»Vielleicht verschwinden sie nie. So wie bei Haymitch«, sage ich. Haymitch spricht nicht darüber, aber ganz bestimmt ist das der Grund dafür, dass er nicht im Dunkeln schlafen will.
»Kann sein. Aber für mich ist es besser, mit einem Pinsel in der Hand aufzuwachen als mit einem Messer«, sagt er. »Findest du sie echt grauenhaft?«
»Ja. Aber sie sind außergewöhnlich. Wirklich«, sage ich. Und das stimmt auch. Trotzdem, ich will sie nicht mehr ansehen. »Möchtest du mal mein Talent sehen? Cinna hat das super hingekriegt.«
Peeta lacht. »Später.« Der Zug setzt sich langsam in Bewegung, und durchs Fenster sehe ich, wie das Land an uns vorbeizieht. »Komm, wir sind fast in Distrikt 11. Das schauen wir uns mal an.«
Wir gehen durch bis zum letzten Waggon. Dort gibt es Sessel und Sofas, auf denen man sitzen kann, aber das Beste ist, dass sich die Heckscheiben so hochschieben lassen, dass man im Freien fährt, an der frischen Luft, und man kann weit in die Landschaft blicken. Endlose Felder, auf denen Rinderherden weiden. So ganz anders als unsere dicht bewaldete Heimat. Der Zug verlangsamt die Fahrt, und ich denke schon, dass wir gleich wieder halten, als sich vor uns ein Zaun erhebt. Er ist mindestens zehn Meter hoch und oben mit gemeinem Stacheldraht versehen - dagegen wirkt unser Zaun in Distrikt 12 geradezu läppisch. Schnell nehme ich den unteren Teil des Zauns in Augenschein, der aus gewaltigen Metallplatten besteht. Dort könnte man nicht drunter durchschlüpfen, sich nicht davonstehlen, um zu jagen. Dann sehe ich die Wachtürme, sie sind in gleichmäßigem Abstand aufgestellt und mit bewaffneten Wachen versehen. In dem Feld mit Wildblumen wirken sie fehl am Platz.
»Es ist ganz anders hier«, sagt Peeta.
Rue hatte mir bereits den Eindruck vermittelt, dass in Distrikt 11 die Regeln härter durchgesetzt werden. Aber so etwas hätte ich mir nie vorgestellt.
Jetzt fangen die Felder an, sie reichen, so weit das Auge blicken kann. Männer, Frauen und Kinder mit Strohhüten gegen die Sonne richten sich auf, drehen sich zu uns, recken einen Moment lang den Rücken und schauen dem vorbeifahrenden Zug nach. In der Ferne sehe ich Obstplantagen, und ich frage mich, ob Rue dort wohl gearbeitet hat, ob sie dort die Früchte von den zartesten Ästen ganz oben im Baum gepflückt hat. Kleine Ansiedlungen von Hütten hier und dort - im Vergleich zu ihnen sind die Häuser im Saum nobel -, doch sie sind alle verlassen. Für die Ernte werden wohl alle Hände gebraucht.
Es nimmt gar kein Ende. Ich kann kaum fassen, wie groß Distrikt 11 ist. »Was glaubst du, wie viele Leute hier leben?«, fragt Peeta. Ich schüttele den Kopf. In der Schule haben wir nur gelernt, dass es ein großer Distrikt ist, mehr nicht. Keine konkreten Bevölkerungszahlen. Aber die jungen Leute, die wir jedes Jahr in den Übertragungen sehen, wie sie auf die Auslosung der Tribute warten, können nur ein kleiner Teil derer sein, die hier leben. Wie machen sie das? Treffen sie eine Vorauswahl? Losen sie die Teilnehmer im Vorhinein aus und sorgen dafür, dass sie unter den Zuschauern sind? Wie kam es dazu, dass Rue auf der Bühne landete, niemand bei ihr, der ihren Platz hätte einnehmen können, nur der Wind?
Die Weite ermüdet mich allmählich, die Endlosigkeit der Landschaft. Als Effie kommt und sagt, wir sollen uns umziehen, protestiere ich nicht. Ich begebe mich in mein Abteil und lasse mich vom Vorbereitungsteam frisieren und schminken. Cinna kommt mit einem hübschen Kleid herein, orange mit einem Herbstblattmuster. Die Farbe wird Peeta gefallen.
Effie ruft Peeta und mich zu sich und erklärt uns noch ein letztes Mal den Tagesablauf. In manchen Distrikten fahren die Sieger durch die Stadt, während die Bewohner ihnen zujubeln. Doch in Distrikt 11 ist unser Auftritt auf den Hauptplatz beschränkt - vielleicht, weil es keine nennenswerte Stadt gibt, nur einzelne Siedlungen, oder vielleicht, weil sie während der Erntezeit nicht so viele Leute erübrigen wollen. Der Auftritt findet vor dem Justizgebäude statt, einem riesigen Marmorbau. Er muss einmal sehr prächtig gewesen sein, aber die Spuren der Zeit sind unübersehbar. Selbst im Fernsehen kann man erkennen, dass die bröckelnde Fassade von Efeu überwuchert und das Dach eingesunken ist. Der Platz selbst ist von heruntergekommenen Läden gesäumt, die meisten Geschäfte sind aufgegeben. Wo auch immer die Gutsituierten in Distrikt 11 leben, hier jedenfalls nicht.
Unsere Vorstellung wird auf dem Ding stattfinden, das Effie als Veranda bezeichnet, einer gefliesten Fläche zwischen dem Eingang und der Treppe, beschattet von einem Säulendach. Erst sollen Peeta und ich vorgestellt werden, dann wird der Bürgermeister von Distrikt 11 uns zu Ehren eine Rede verlesen, und wir antworten mit einem Dank, der vom Kapitol schon vorgefertigt wurde. Hatte ein Sieger Verbündete unter den toten Tributen, wird es als guter Stil betrachtet, ein paar persönliche Worte hinzuzufügen. Ich müsste eigentlich etwas über Rue sagen und auch über Thresh, doch jedes Mal, wenn ich zu Hause versucht habe, etwas zu schreiben, starrte mich ein leeres Blatt Papier an. Es fällt mir schwer, über sie zu sprechen, ohne die Fassung zu verlieren. Zum Glück hat Peeta einen kurzen Text vorbereitet, der mit ein paar kleinen Änderungen für uns beide gelten kann. Am Ende der Feierlichkeiten bekommen wir irgendeine Tafel überreicht, und dann können wir uns ins Justizgebäude begeben, wo ein Festessen gegeben wird.
Während der Zug in den Bahnhof von Distrikt 11 einfährt, ändert Cinna ein paar letzte Feinheiten an meinem Outfit. Er tauscht das orangefarbene Haarband gegen eines in Goldmetallic und steckt mir die Spotttölpelbrosche, die ich in der Arena getragen habe, ans Kleid. Auf dem Bahnsteig steht kein Empfangskomitee, nur eine Gruppe von acht Friedenswächtern, die uns in den hinteren Teil eines gepanzerten Wagens führen. Effie rümpft die Nase, als die Tür hinter uns zuknallt. »Also wirklich, als ob wir alle Verbrecher wären«, sagt sie.
Nicht wir alle, Effie, denke ich. Nur ich.
Auf der Rückseite des Justizgebäudes werden wir aus dem Wagen gelassen, und dann sollen wir schnell hineingehen. Ich rieche, dass ein köstliches Mahl bereitet wird, aber das kann die Gerüche von Muff und Fäulnis nicht ausblenden. Sie haben uns keine Zeit gelassen, uns umzuschauen. Während wir auf dem kürzesten Weg zum Eingang gehen, höre ich, wie draußen auf dem Platz die Nationalhymne angestimmt wird. Jemand klemmt mir ein Mikrofon an. Peeta nimmt meine linke Hand. Der Bürgermeister stellt uns vor, während die gewaltige Tür ächzend aufgeht.
»Strahlendes Lächeln!«, sagt Effie und stößt uns an. Wir bewegen die Füße vorwärts.
Jetzt. Jetzt muss ich alle überzeugen, wie verliebt ich in Peeta bin, denke ich. Die feierliche Zeremonie ist ziemlich straff geplant, und ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Es ist nicht die passende Situation für einen Kuss, doch vielleicht kann ich einen unterbringen.
Es gibt lauten Applaus, aber keine Jubelrufe, Jauchzer und Pfiffe wie im Kapitol. Wir gehen über die schattige Veranda, bis das Dach zu Ende ist und wir auf einer breiten Marmortreppe in der grellen Sonne stehen. Als meine Augen sich an das Licht gewöhnt haben, sehe ich, dass die Häuser mit Flaggen geschmückt sind, die ihren heruntergekommenen Zustand ein wenig kaschieren. Es ist rappelvoll auf dem Platz, aber das ist nur ein Bruchteil der Menschen, die hier leben.
Wie üblich ist unterhalb der Bühne für die Familien der toten Tribute ein eigenes Podium errichtet worden. Auf Threshs Seite stehen nur eine alte, bucklige Frau und ein großes, muskulöses Mädchen, bestimmt seine Schwester. Auf Rues Seite … Ich bin auf Rues Familie nicht vorbereitet. Ihre Eltern, die Trauer noch frisch in den Gesichtern. Die fünf jüngeren Geschwister, die ihr so ähnlich sehen. Der zarte Knochenbau, die leuchtend braunen Augen. Wie ein Schwärm kleiner dunkler Vögel.
Der Applaus verebbt und der Bürgermeister hält die Rede auf uns. Zwei kleine Mädchen kommen mit gigantischen Blumensträußen. Peeta sagt seine vorgefertigten Worte, und ich merke, wie ich die Lippen bewege, um das Ende zu sprechen. Zum Glück haben meine Mutter und Prim sie mir so eingetrichtert, dass ich sie im Schlaf singen könnte.
Peeta hat seine persönlichen Kommentare auf eine Karte geschrieben, aber er holt sie nicht hervor. Stattdessen erzählt er in seiner einfachen, gewinnenden Art, wie Thresh und Rue unter die letzten acht gekommen sind, wie sie mir das Leben gerettet haben - und damit auch ihm - und dass wir das nie wiedergutmachen können. Dann zögert er, bevor er etwas hinzufügt, das nicht auf der Karte steht. Vielleicht, weil er dachte, dass Effie ihm nicht erlauben würde, es zu sagen. »Auch wenn es in keiner Weise Ihren Verlust ersetzen kann, möchten wir zum Zeichen unseres Danks den Familien der Tribute aus Distrikt 11 zeit unseres Lebens jedes Jahr einen Monatsanteil unseres Preises zukommen lassen.«
Unwillkürlich halten die Zuschauer die Luft an und sprechen leise miteinander. Was Peeta getan hat, ist ohne Beispiel. Ich weiß nicht einmal, ob es legal ist. Das weiß er vermutlich auch nicht, deshalb hat er lieber gar nicht erst gefragt. Die beiden Familien starren uns nur sprachlos an. Ihr Leben hat sich für immer verändert, als sie Thresh und Rue verloren haben, doch dieses Geschenk wird es erneut verändern. Von dem Monatspreis eines Tributs kann eine Familie mühelos ein Jahr lang leben. Solange wir leben, werden sie keinen Hunger leiden.
Ich schaue zu Peeta und er lächelt mich traurig an. Ich habe Haymitchs Stimme im Ohr: »Du könntest es viel schlechter treffen.« In diesem Augenblick ist es unmöglich, sich vorzustellen, wie ich es besser treffen könnte. Das Geschenk … es ist großartig. Als ich mich auf die Zehenspitzen stelle und ihn küsse, wirkt das kein bisschen gezwungen.
Der Bürgermeister kommt zu uns und überreicht jedem von uns eine Tafel, so groß, dass ich meinen Blumenstrauß ablegen muss, um sie zu halten. Die Zeremonie ist schon fast vorüber, als ich merke, wie eine von Rues Schwestern mich anstarrt. Sie muss etwa neun sein und ist fast Rues Ebenbild, sie steht sogar genauso da, die Arme leicht abgespreizt. Trotz der guten Neuigkeiten über den Preis wirkt sie nicht froh. Im Gegenteil, sie schaut mich vorwurfsvoll an. Ist es, weil ich Rue nicht gerettet habe?
Nein. Es ist, weil ich ihr immer noch nicht gedankt habe, denke ich.
Eine Welle der Scham überspült mich. Das Mädchen hat recht. Wie kann ich stumm und tatenlos dastehen und Peeta alles sagen lassen? Wäre Rue die Siegerin gewesen, hätte sie meinen Tod niemals sang-und klanglos hingenommen. Ich denke daran, wie ich sie in der Arena mit Blumen bedeckt habe, wie wichtig es mir war, dass ihr Tod nicht unbemerkt blieb. Doch diese Geste bedeutet gar nichts, wenn ich sie jetzt nicht untermauere.
»Warten Sie!« Ich stolpere nach vorn, drücke die Tafel an die Brust. Ich habe meine Redezeit verstreichen lassen, doch jetzt muss ich etwas sagen. Das bin ich Rue einfach schuldig. Selbst wenn ich meinen Preis ganz den Familien überlassen hätte, wäre das keine Entschuldigung für mein Schweigen am heutigen Tag. »Bitte warten Sie.« Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber als ich erst einmal rede, strömen mir die Worte aus dem Mund, als hätte ich sie schon lange im Kopf gehabt.
»Ich möchte den Tributen von Distrikt 11 danken«, sage ich. Ich schaue zu den beiden Frauen auf Threshs Seite. »Ich habe nur ein einziges Mal mit Thresh gesprochen. Für ihn hat das ausgereicht, um mich zu verschonen. Ich kannte ihn nicht, aber ich hatte immer Hochachtung vor ihm. Vor seiner Stärke. Weil er die Spiele nach seinen eigenen Regeln gespielt hat und sich nichts hat aufzwingen lassen. Die Karrieros wollten ihn von Anfang an auf ihre Seite ziehen, aber er wollte nicht. Dafür hatte er meine Hochachtung.«
Zum ersten Mal hebt die bucklige Frau - ist sie Threshs Großmutter? - den Kopf und ein leises Lächeln umspielt ihre Lippen.
Im Publikum ist es jetzt still geworden, so still, dass ich mich frage, wie das überhaupt möglich ist. Sie müssen alle den Atem anhalten.
Ich wende mich zu Rues Familie. »Bei Rue jedoch habe ich das Gefühl, sie zu kennen, und sie wird immer bei mir sein. Alles Schöne erinnert mich an sie. Ich sehe sie in den gelben Blumen, die auf der Weide an meinem Haus wachsen. Ich sehe sie in den Spotttölpeln, die auf den Bäumen singen. Doch vor allem sehe ich sie in meiner Schwester, Prim.« Meine Stimme ist wacklig, aber ich habe es fast geschafft. »Ich danke euch für eure Kinder.« Ich hebe das Kinn, als ich mich an das Publikum wende. »Und ich danke euch allen für das Brot.«
Ich stehe da, fühle mich gebrochen und klein, zahllose Blicke sind auf mich gerichtet. Sehr lange bleibt es still. Dann pfeift jemand aus der Menge Rues Spotttölpelmelodie. Die vier Töne, mit denen in den Obstplantagen das Ende des Arbeitstages eingeläutet wurde. In der Arena bedeuteten sie Sicherheit. Als die Melodie verklingt, sehe ich, woher der Pfiff kam: von einem hutzligen alten Mann in einem verblichenen roten Hemd und Latzhose. Unsere Blicke treffen sich.
Was dann passiert, ist kein Zufall. Es vollzieht sich so vollkommen synchron, dass es unmöglich ein spontaner Akt sein kann. Jeder Einzelne im Publikum legt die drei mittleren Finger der linken Hand auf die Lippen und streckt sie dann zu mir aus. Das ist unser Zeichen aus Distrikt 12, mein letzter Abschiedsgruß an Rue in der Arena.
Hätte es das Gespräch mit Präsident Snow nicht gegeben, würde diese Geste mich womöglich zu Tränen rühren. Doch da ich seinen Befehl, die Distrikte zu beruhigen, noch in den Ohren habe, erfüllt sie mich mit Furcht. Was wird er von diesem öffentlichen Gruß an das Mädchen halten, das dem Kapitol die Stirn geboten hat?
Auf einmal wird mir klar, was ich da getan habe. Ohne dass es meine Absicht war - ich wollte nur meine Dankbarkeit ausdrücken -, habe ich etwas Gefährliches ausgelöst. Einen Akt des Widerstands in Distrikt 11. Genau das, was ich verhindern soll!
Ich überlege, womit ich das Geschehene zunichtemachen, es widerlegen könnte, doch da wird mit einem leichten Knacken mein Mikrofon abgeschaltet, und der Bürgermeister ergreift das Wort. Peeta und ich nehmen noch einen letzten Applaus in Empfang. Er führt mich zurück zur Tür, er merkt gar nicht, dass etwas nicht stimmt.
Mir ist ganz komisch und ich muss einen Augenblick stehen bleiben. Kleine Lichtfetzen tanzen vor meinen Augen. »Alles in Ordnung?«, fragt Peeta.
»Nur ein bisschen schwindelig. Die Sonne war so grell«, sage ich. Ich sehe seinen Blumenstrauß. »Ich hab meine Blumen vergessen«, murmele ich.
»Ich hol sie«, sagt er.
»Das mach ich schon«, sage ich.
Hätte ich die Blumen nicht vergessen, wäre ich nicht stehen geblieben, dann wären wir jetzt wohlbehalten im Justizgebäude. Stattdessen sehe ich von der schattigen Veranda aus alles mit an.
Zwei Friedenswächter ziehen den alten Mann, der gepfiffen hat, hinauf auf die Treppe. Zwingen ihn vor der Menge auf die Knie. Und jagen ihm eine Kugel in den Kopf.
5
Der Mann ist gerade erst auf dem Boden zusammengesunken, als eine Wand aus weißen Friedenswächtern uns die Sicht versperrt. Mehrere Soldaten haben ihre Maschinengewehre auf uns gerichtet, während sie uns zurück zur Tür schieben.
»Wir gehen ja schon!«, sagt Peeta und schubst den Friedenswächter, der mich bedrängt, weg. »Wir haben verstanden, okay? Komm, Katniss.«
Er legt mir einen Arm um die Schultern und führt mich zurück ins Justizgebäude. Der Friedenswächter folgt uns im Abstand von ein oder zwei Schritten. Kaum sind wir drin, schlägt die Tür zu, und wir hören die Stiefel des Friedenswächters, der zurück zu der Menge geht.
Auf dem Bildschirm, der an der Wand angebracht ist, sieht man nur ein Grieselbild. Darunter warten Haymitch, Effie, Portia und Cinna mit ängstlichen, angespannten Gesichtern.
»Was ist passiert?« Effie kommt schnell auf uns zu. »Nach Katniss’ wundervoller Rede hatten wir keinen Empfang mehr, und dann meinte Haymitch, er hätte einen Schuss gehört. Ich hab gesagt, das kann nicht sein, aber wer weiß? Es gibt ja überall Verrückte!«
»Es ist nichts passiert, Effie. Ein alter Lkw hatte eine Fehlzündung«, sagt Peeta ruhig.
Noch zwei Schüsse. Sie werden durch die Tür kaum gedämpft. Für wen waren die? Threshs Großmutter? Eine von Rues kleinen Schwestern?
»Ihr beide. Kommt mit«, sagt Haymitch. Peeta und ich folgen ihm und lassen die anderen zurück. Jetzt, da wir im Gebäude in Sicherheit sind, interessieren sich die Friedenswächter, die um das Justizgebäude herum aufgestellt sind, nicht mehr sonderlich für unser Treiben. Wir gehen eine prächtige marmorne Wendeltreppe hinauf. Oben liegt ein langer Flur, der mit einem abgetretenen Teppich ausgelegt ist. Eine Flügeltür steht offen und lockt uns in das erste Zimmer. Die Wände sind bestimmt sieben Meter hoch. An der Decke Stuck mit Früchten und Blumen, kleine Putten mit Flügeln schauen aus allen Ecken auf uns herab. Vasen mit Blüten verströmen einen süßlichen Duft, von dem mir die Augen jucken. Unsere Abendkleider hängen an einer Garderobe an der Wand. Der Raum ist für uns vorbereitet, doch wir haben kaum unsere Geschenke abgelegt, als Haymitch uns die Mikrofone von der Brust reißt, sie hinter ein Sofakissen stopft und uns weiterwinkt.
Soweit ich weiß, ist Haymitch erst ein Mal hier gewesen, bei seiner eigenen Siegertour vor mehreren Jahrzehnten. Doch entweder hat er ein bemerkenswertes Gedächtnis oder zuverlässige Instinkte, denn er führt uns durch ein Labyrinth aus gewundenen Treppenhäusern und immer schmaler werdenden Fluren. Manchmal muss er stehen bleiben und eine Tür mit Gewalt öffnen. An dem widerstrebenden Quietschen der Angeln merkt man, dass die Türen lange nicht geöffnet wurden. Schließlich steigen wir eine Leiter zu einer Falltür hoch. Als Haymitch sie zur Seite schiebt, finden wir uns in der Kuppel des Justizgebäudes wieder. Sic ist riesig und vollgestopft mit kaputten Möbeln, Bücherstapeln, Balken und rostigen Waffen. Alles ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt, hier ist seit Jahren nichts passiert. Durch vier schmuddelige quadratische Fenster rund um die Kuppel versucht sich das Licht hindurchzukämpfen. Haymitch schließt die Falltür mit dem Fuß und schaut uns an. »Was ist los?«, fragt er.
Peeta erzählt alles, was auf dem Platz geschehen ist. Der Pfiff, der Gruß, unser Zögern auf der Veranda, der Mord an dem alten Mann. »Was hat das zu bedeuten, Haymitch?«
»Das kannst besser du erzählen«, sagt Haymitch zu mir.
Das sehe ich anders. Ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn ich es erzähle. Aber ich erkläre Peeta alles, so ruhig ich kann. Ich erzähle von Präsident Snow, von den Unruhen in den Distrikten. Nicht einmal den Kuss von Gale lasse ich aus. Ich erkläre, dass wir alle in Gefahr sind, dass das ganze Land in Gefahr ist wegen meines Beerentricks. »Auf dieser Tour sollte ich alles wieder geraderücken. Alle, die Zweifel hatten, sollte ich davon überzeugen, dass ich aus Liebe gehandelt habe. Damit sich die Lage wieder beruhigt. Stattdessen hab ich heute erreicht, dass sie drei Menschen getötet haben, und jetzt werden alle auf dem Platz bestraft.« Mir ist so elend, dass ich mich auf ein Sofa setzen muss, auch wenn die Sprungfedern und die Füllung herausgucken.
»Dann hab ich auch alles noch schlimmer gemacht. Indem ich ihnen das Geld geschenkt habe«, sagt Peeta. Plötzlich schlägt er so fest gegen eine Lampe, die wacklig auf einer Kiste steht, dass sie quer durch das Zimmer fliegt. Klirrend fällt sie zu Boden. »Damit muss Schluss sein! Auf der Stelle! Mit diesem … diesem Spiel, das ihr beide da spielt, dass ihr euch Geheimnisse erzählt, aus denen ihr mich raushaltet, als wäre ich zu unwichtig oder zu blöd oder zu schwach, um damit fertigzuwerden.«
»So ist es nicht, Peeta …«, setze ich an.
»Genau so ist es!«, brüllt er. »Ich hab auch Menschen, die mir am Herzen liegen, Katniss! Freunde und Verwandte in Distrikt 12, die genauso tot sein werden wie deine, wenn wir diese Geschichte nicht hinkriegen. Nach allem, was wir in der Arena zusammen durchgemacht haben, hab ich da nicht wenigstens die Wahrheit verdient?«
»Bei dir kann man sich immer darauf verlassen, dass du deine Sache gut machst, Peeta«, sagt Haymitch. »Du weißt genau, wie du dich vor der Kamera darstellen musst. Das wollte ich nicht stören.«
»Also, da hast du mich aber überschätzt. Denn heute hab ich’s ja gründlich vermasselt. Was glaubst du, was jetzt mit Rues und Threshs Familien passiert? Meinst du, sie bekommen ihren Anteil an unserem Preis? Meinst du, ich hab ihnen eine strahlende Zukunft gesichert? Ich glaub, die können froh sein, wenn sie den Tag überleben!« Peeta schleudert noch etwas durchs Zimmer, eine Skulptur. So habe ich ihn noch nie erlebt.
»Haymitch, er hat recht«, sage ich. »Es war ein Fehler, dass wir es ihm nicht gesagt haben. Auch schon im Kapitol.«
»Selbst in der Arena hattet ihr beide schon ein spezielles System, oder?«, fragt Peeta. Er klingt jetzt ruhiger. »Und ich war nicht eingeweiht.«
»Nein, das stimmt nicht. Jedenfalls nicht offiziell. Ich hab nur daran, was Haymitch mir geschickt oder nicht geschickt hat, gemerkt, was er von mir wollte«, sage ich.
»Tja, die Chance hatte ich nicht. Mir hat er nämlich nie irgendwas geschickt, bis du aufgetaucht bist«, sagt Peeta.
Darüber habe ich noch gar nicht groß nachgedacht. Wie es auf Peeta gewirkt haben muss, als ich in der Arena auftauchte und Brandsalbe und Brot bekommen hatte, während er, der an der Schwelle zum Tod stand, leer ausgegangen war. Als hielte Haymitch mich auf Peetas Kosten am Leben.
»Hör mal, Junge …«, setzt Haymitch an.
»Spar dir den Atem, Haymitch. Mir ist schon klar, dass du dich für einen von uns entscheiden musstest. Und ich hätte selbst gewollt, dass du dich für sie entscheidest. Aber das hier ist was anderes. Da draußen sind Menschen gestorben. Und wenn wir es nicht sehr geschickt anstellen, wird es weitere Tote geben. Wir wissen alle, dass ich vor der Kamera besser bin als Katniss. Mit mir braucht keiner meine Rolle zu üben. Aber ich will wissen, worauf ich mich einlasse«, sagt Peeta.
»Ab jetzt werde ich dich immer auf dem Laufenden halten«, verspricht Haymitch.
»Das will ich dir auch geraten haben«, sagt Peeta. Er schaut mich noch nicht mal an, als er aus dem Zimmer geht.
Der Staub, den er aufgewirbelt hat, sinkt an anderen Stellen hinab. Auf meine Haare, meine Augen, meine glänzende Goldbrosche.
»Hattest du dich wirklich für mich entschieden, Haymitch?«, frage ich. »Ja«, sagt er.
»Warum? Du kannst ihn doch besser leiden.« »Das stimmt. Aber überleg mal - bevor sie die Regeln geändert haben, konnte ich nur darauf hoffen, einen von euch lebend da rauszuholen«, sagt er. »Und da er entschlossen war, dich zu beschützen, dachte ich mir, zu dritt schaffen wir es vielleicht, dich nach Hause zu holen.«
»Ach so.« Mehr bringe ich nicht heraus.
»Da siehst du, was für Entscheidungen du mal treffen musst. Wenn wir hier lebend rauskommen«, sagt Haymitch. »Du wirst es noch lernen.«
Nun ja, eins habe ich heute auf jeden Fall gelernt. Das hier ist keine größere Version von Distrikt 12. Unser Zaun ist unbewacht und steht selten unter Strom. Unsere Friedenswächter sind zwar lästig, aber nicht so brutal. Die Schwierigkeiten bei uns lösen eher Erschöpfung aus als Wut. Hier in Distrikt 11 leiden die Menschen größere Not und sie sind verzweifelter. Präsident Snow hat recht. Ein Funke könnte ausreichen, um sie zu entflammen.
Für mich geht jetzt alles so schnell, dass ich nicht mehr mitkomme. Die Warnung, die Schüsse, die Erkenntnis, dass ich vielleicht etwas sehr Folgenschweres in Gang gesetzt habe. Das ist alles so absurd. Es wäre etwas anderes, wenn ich geplant hätte, Unruhe zu stiften, aber so … Wie hab ich es bloß geschafft, so ein Chaos anzurichten?
»Komm schon. Wir dürfen beim Abendessen nicht fehlen«, sagt Haymitch.
Ich bleibe so lange unter der Dusche, bis sie mich rufen, weil ich noch angekleidet werden muss. An dem Vorbereitungsteam scheinen die Ereignisse des Tages vollkommen vorbeigegangen zu sein. Sie freuen sich alle auf das Abendessen. In den Distrikten sind sie wichtig genug, um dabei sein zu dürfen, im Kapitol werden sie fast nie zu den entscheidenden Partys eingeladen. Während sie darüber spekulieren, was es wohl zu essen gibt, sehe ich immer noch den alten Mann vor mir, wie ihm der Kopf weggesprengt wird. Ich achte gar nicht darauf, was sie mit mir anstellen, bis ich fertig bin und mich im Spiegel anschaue. Ein trägerloses zartrosa Kleid fällt mir bis auf die Schuhe. Meine Haare sind zurückgesteckt und kringeln sich auf meinem Rücken.
Cinna kommt von hinten zu mir und legt mir eine silbern schimmernde Stola um die Schultern. Er fängt meinen Blick im Spiegel auf. »Gefällt es dir?«
»Es ist wunderschön. Wie immer«, sage ich.
»Zeig mal, wie es mit einem Lächeln aussieht«, sagt er freundlich. Das ist seine Art, mich daran zu erinnern, dass gleich die Kameras wieder dabei sein werden. Ich schaffe es, die Mundwinkel hochzuziehen. »Na also.«
Als wir uns alle treffen, um zum Essen zu gehen, merke ich, dass Effie verstimmt ist. Bestimmt hat Haymitch ihr nicht erzählt, was auf dem Platz passiert ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn Cinna und Portia Bescheid wüssten, doch es scheint ein unausgesprochenes Einverständnis darüber zu geben, dass man schlechte Nachrichten besser von Effie fernhält. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie von dem Problem Wind bekommt.
Sie geht den Plan für den Abend durch, dann fegt sie das Blatt beiseite. »Und dann können wir endlich wieder in den Zug und weg von hier«, sagt sie.
»Stimmt irgendwas nicht, Effie?«, fragt Cinna.
»Es gefällt mir nicht, wie wir hier behandelt werden. Wie sie uns in Lastwagen pferchen und von der Bühne drängen. Und dann hab ich mich vor etwa einer Stunde mal im Justizgebäude umgeschaut. Ich verstehe ja eine ganze Menge von Architektur«, sagt sie.
»Ach ja, davon hab ich schon gehört«, sagt Portia, bevor das Schweigen zu lange andauert.
»Also hab ich mich ein bisschen umgeschaut, weil Distriktruinen in diesem Jahr total angesagt sind. Da kamen zwei Friedenswächter und haben mich zurück in unsere Wohnung geschickt. Einer hat mir sogar das Gewehr an die Brust gehalten!«, sagt Effie.
Das nehme ich als unmittelbare Reaktion darauf, dass Haymitch, Peeta und ich uns zuvor aus dem Staub gemacht hatten. Immerhin hat der Gedanke, dass Haymitch recht hatte, etwas Beruhigendes. Dass niemand die verstaubte Kuppel überwachen würde, wo wir miteinander geredet haben. Obwohl sie das ab jetzt ganz bestimmt tun werden.
Effie sieht so bekümmert aus, dass ich sie spontan umarme. »Das ist ja schrecklich, Effie. Vielleicht sollten wir gar nicht zu dem Essen gehen. Wenigstens, bis sie sich entschuldigt haben.« Ich weiß, dass sie nie zustimmen würde, aber bei dem Vorschlag bessert sich ihre Laune erheblich, sie fühlt sich ernst genommen.
»Nein, ich schaff das schon. Mit Höhen und Tiefen fertigzuwerden, gehört zu meinem Job. Und ihr zwei dürft nicht um euer Abendessen kommen. Aber danke für das Angebot, Katniss.«
Effie stellt uns für unseren Auftritt auf. Erst die Vorbereitungsteams, dann sie, die Stylisten und Haymitch. Peeta und ich kommen natürlich zum Schluss.
Irgendwo unten fangen Musiker an zu spielen. Als die Spitze unserer kleinen Prozession die Treppe hinuntergeht, fassen Peeta und ich uns bei den Händen.
»Haymitch sagt, ich hätte dich nicht anbrüllen dürfen. Du hast nur seine Anweisungen befolgt«, sagt Peeta. »Und es ist ja nicht so, als hätte ich in der Vergangenheit nicht auch mal etwas vor dir verborgen.«
Ich erinnere mich an den Schock, als Peeta vor ganz Panem seine Liebe zu mir gestand. Haymitch hatte davon gewusst und mir nichts gesagt. »Ich glaube, nach dem Interview damals hab ich auch das eine oder andere demoliert«, sage ich.
»Nur einen Blumenkübel«, erwidert er.
»Und deine Hände. Aber jetzt haben wir das nicht mehr nötig, oder? Unaufrichtig zueinander zu sein«, sage ich.
»Nein«, sagt Peeta. Wir stehen oben auf der Treppe und lassen Haymitch fünfzehn Stufen Vorsprung, wie Effie gesagt hat. »War es wirklich das einzige Mal, dass du Gale geküsst hast?«
Ich bin so perplex, dass ich ihm antworte. »Ja.« Hat ihn diese Frage tatsächlich gequält, nach all dem, was heute passiert ist?
»Fünfzehn. Los jetzt«, sagt er.
Ein Scheinwerfer trifft uns und ich setze mein breitestes Lächeln auf.
Wir gehen die Treppe hinunter und begeben uns in den Sog aus immer gleichen Abendessen, Festlichkeiten und Zugfahrten. Jeden Tag dasselbe. Aufwachen. Anziehen. Durch jubelnde Menschenmengen fahren. Eine Rede auf uns anhören. Mit einer Dankesrede antworten, aber nur mit der, die das Kapitol vorgegeben hat, keine persönlichen Worte mehr. Manchmal eine kleine Rundfahrt: ein kurzer Blick auf das Meer in dem einen Distrikt, riesige Wälder in einem anderen, hässliche Fabriken, Weizenfelder, stinkende Raffinerien. Abendgarderobe anziehen. Festessen. Zum Zug.
Während der Feierlichkeiten sind wir immer ernst und respektvoll, aber ständig in Kontakt, mit den Händen oder mit den Armen. Beim Abendessen sind wir halb wahnsinnig vor Liebe zueinander. Wir küssen uns, wir tanzen, lassen uns dabei erwischen, wie wir uns zu zweit davonstehlen wollen. Im Zug leiden wir stumm, während wir uns unsere Wirkung ausmalen.
Selbst ohne persönliche Ansprachen, die das Volk aufrühren könnten - überflüssig zu erwähnen, dass unsere Reden in Distrikt 11 vor der Ausstrahlung herausgeschnitten wurden -, ist zu spüren, dass etwas in der Luft liegt, wie das Brodeln in einem Topf, der jeden Moment überzukochen droht. Nicht überall. Mancherorts macht das Publikum den Eindruck einer müden Viehherde, wie er auch in Distrikt 12 bei den Siegesfeierlichkeiten für gewöhnlich vorherrscht. Doch anderswo - besonders in den Distrikten 8, 4 und 3 - zeigt sich Begeisterung in den Gesichtern der Menschen, als sie uns sehen, und unter der Begeisterung lauert Wut. Wenn sie meinen Namen skandieren, ist das eher ein Ruf nach Rache als ein Jubeln. Wenn die Friedenswächter einschreiten, um die aufmüpfige Menge zu beruhigen, leistet sie eher Widerstand, als dass sie sich zurückzieht. Und ich weiß, dass ich dagegen machtlos bin. Kein Liebestheater, und wäre es noch so glaubwürdig, könnte diese Welle aufhalten. Wenn es ein Akt des zeitweiligen Wahnsinns von mir war, Peeta diese Beeren hinzuhalten, dann sind diese Leute auch zum Wahnsinn bereit.
Cinna muss meine Kleider um die Taille herum enger machen. Das Vorbereitungsteam ist besorgt wegen der Ringe unter meinen Augen. Effie gibt mir Schlaftabletten, doch sie helfen nicht. Jedenfalls nicht gut genug. Ich döse ein, um aus Albträumen aufzuschrecken, die häufiger und schlimmer geworden sind. Einmal hört Peeta, der nachts durch den Zug wandert, mich schreien, während ich mich aus dem Schleier der Medikamente zu kämpfen versuche, die die schlimmen Träume nur verlängern. Er schafft es, mich wach zu rütteln und zu beruhigen. Dann kommt er zu mir ins Bett und hält mich in den Armen, bis ich wieder eingeschlafen bin. Von da an weigere ich mich, die Tabletten zu schlucken. Aber ich lasse ihn jede Nacht in mein Bett. Wir überstehen die Dunkelheit wie in der Arena, aneinandergeschmiegt, immer auf der Hut vor Gefahren, die überall lauern können. Weiter passiert nichts, aber schon bald wird im Zug über unser Arrangement geklatscht.
Als Effie mir davon erzählt, denke ich: Gut so. Vielleicht dringt es ja bis zu Präsident Snow durch. Ich sage ihr, wir würden versuchen, ein wenig diskreter zu sein, aber wir denken gar nicht daran.
Die Auftritte in Distrikt 2 und dann in 1 sind auf ihre ganz eigene Weise grauenhaft. Cato und Clove, die beiden Tribute aus Distrikt 2, hätten es beide nach Hause schaffen können, wenn Peeta und ich nicht gewonnen hätten. Das Mädchen aus Distrikt 1, Glimmer, und den Jungen habe ich persönlich umgebracht. Während ich versuche, seine Familie nicht anzusehen, erfahre ich, dass er Marvel hieß. Wie ist es möglich, dass ich das nicht wusste? Wahrscheinlich habe ich vor den Spielen nicht darauf geachtet und hinterher wollte ich es gar nicht mehr wissen.
Als wir im Kapitol ankommen, sind wir verzweifelt. Wir haben endlose Auftritte vor einem Publikum, das uns anhimmelt. Hier besteht keine Gefahr eines Aufstands, hier bei den Privilegierten, bei denen, deren Namen zur Ernte nie in die Lostrommel wandern, deren Kinder nie für die vermeintlichen Verbrechen sterben, die vor Generationen begangen wurden. Im Kapitol brauchen wir niemanden von unserer Liebe zu überzeugen, wir klammern uns nur an die schwache Hoffnung, ein paar Zweifler in den Distrikten zu erreichen. Was wir auch tun, es kommt uns zu wenig vor, zu spät.
Als wir wieder in unserem alten Quartier im Trainigscenter sind, mache ich den Vorschlag mit dem öffentlichen Heiratsantrag. Peeta ist einverstanden, aber danach verschwindet er für lange Zeit in seinem Zimmer. Haymitch sagt, ich soll ihn in Ruhe lassen.
»Ich dachte, er wollte es sowieso«, sage ich.
»Aber nicht so«, sagt Haymitch. »Er wollte, dass es echt ist.«
Ich gehe in mein Zimmer und lege mich ins Bett, ich versuche, nicht an Gale zu denken, und denke doch an nichts anderes.
An diesem Abend quasseln wir uns auf der Bühne vor dem Trainingscenter durch einen ganzen Fragenkatalog. Caesar Flickerman in seinem glitzernden nachtblauen Anzug, die Haare, Lider und Lippen immer noch taubenblau gefärbt, führt uns fehlerfrei durch das Interview. Als er uns nach der Zukunft fragt, kniet Peeta nieder, schüttet mir sein Herz aus und bittet mich, ihn zu heiraten. Natürlich nehme ich seinen Antrag an. Caesar ist außer sich, das Publikum im Kapitol flippt aus, Aufnahmen von Menschen überall in Panem zeigen ein Volk im Glück.
Präsident Snow höchstpersönlich macht einen Überraschungsbesuch, um uns zu gratulieren. Er drückt Peeta die Hand und klopft ihm anerkennend auf die Schulter. Er umarmt mich, hüllt mich in den Geruch aus Blut und Rosen und drückt mir einen schmatzigen Kuss auf die Wange. Als er sich zurückzieht, die Finger in meinen Arm gräbt und mir ins Gesicht lächelt, wage ich es, die Brauen zu heben. Sie stellen die Frage, die ich nicht über die Lippen bringe. Habe ich es geschafft? Hat es gereicht? Hat es gereicht, dass ich dir alles gegeben habe, dass ich das Spiel weitergespielt und versprochen habe, Peeta zu heiraten ?
Zur Antwort schüttelt er fast unmerklich den Kopf.
6
In dieser winzigen Bewegung erkenne ich das Ende der Hoffnung, die beginnende Zerstörung all dessen, was mir lieb ist auf der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie meine Strafe ausfällt, wie weit das Netz ausgeworfen wird, doch am Ende wird höchstwahrscheinlich nichts mehr übrig sein. Also sollte man meinen, dass ich in diesem Moment am Boden zerstört sein müsste. Aber es ist ganz merkwürdig. Ich empfinde vor allem eine Art Erleichterung. Dass ich das Spiel aufgeben kann. Dass die Frage, ob ich dieses Unternehmen gewinnen kann, beantwortet ist, selbst wenn die Antwort ein dröhnendes Nein ist. Und wenn verzweifelte Zeiten verzweifelte Maßnahmen erfordern, dann kann ich mich so verzweifelt aufführen, wie ich will.
Allerdings nicht hier, noch nicht jetzt. Das Wichtigste ist, dass ich zurück in den Distrikt 12 komme, denn zu meinem Plan werden auf jeden Fall meine Mutter und meine Schwester, Gale und seine Familie gehören. Und Peeta, wenn ich ihn überreden kann mitzukommen. Auch Haymitch setze ich auf die Liste. Das sind die Menschen, die ich mitnehmen muss, wenn ich in die Wildnis fliehe. Wie ich sie überzeugen soll, wo wir im tiefsten Winter hinkönnen, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, das sind unbeantwortete Fragen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, was zu tun ist.
Anstatt also weinend zu Boden zu sinken, merke ich, dass ich so aufrecht und selbstbewusst dastehe wie seit Wochen nicht. Mein Lächeln ist zwar etwas idiotisch, aber nicht gezwungen. Und als Präsident Snow das Publikum zum Schweigen bringt und sagt: »Was halten Sie davon, wenn die beiden hier im Kapitol ihre Hochzeit feiern?«, da verwandle ich mich mühelos in das Mädchen, das vor Freude fast ausrastet.
Caesar Flickerman fragt den Präsidenten, ob er schon einen Termin ins Auge gefasst habe.
»Oh, ehe wir uns auf einen Termin festlegen, sollten wir uns lieber mit Katniss’ Mutter einigen«, sagt der Präsident. Das Publikum grölt und der Präsident legt einen Arm um mich. »Wenn alle im Land es ganz fest wollen, dann kommst du vielleicht unter die Haube, bevor du dreißig bist.«
»Wahrscheinlich müssen Sie dafür ein neues Gesetz erlassen«, sage ich kichernd.
»Wenn’s weiter nichts ist«, sagt der Präsident mit einem verschwörerischen Grinsen.
Ach, wie wir zwei uns miteinander amüsieren.
Das Fest, das im Bankettsaal von Präsident Snows Anwesen stattfindet, sucht seinesgleichen. Die weit über zehn Meter hohe Decke ist in einen Nachthimmel verwandelt worden und die Sterne sehen genauso aus wie zu Hause. Vom Kapitol aus sehen sie vermutlich auch so aus, aber wer weiß? In der Stadt ist immer zu viel Licht, um die Sterne zu sehen. Irgendwo in der Mitte zwischen dem Fußboden und der Decke schweben die Musiker auf etwas, das aussieht wie bauschige weiße Wolken, aber ich kann nicht erkennen, was sie in der Luft hält. Statt der großen Tische sind überall im Saal Sofas und Sessel gruppiert, einige um Kamine herum, andere an duftenden Blumengärten oder Teichen mit exotischen Fischen, und die Gäste können in aller Bequemlichkeit essen und trinken und tun, was ihnen gefällt. In der Mitte des Saals ist eine große geflieste Fläche, die zum Tanzen, als Bühne für die unterschiedlichsten Künstler und einfach als Treffpunkt für die extravagant gekleideten Gäste dient.
Doch der eigentliche Star des Abends ist das Essen. Tafeln voller Köstlichkeiten sind an den Wänden entlang aufgebaut. Alles, was man sich nur vorstellen kann, steht dort bereit, Speisen, die man sich nie hätte träumen lassen. Ganze gebratene Rinder, Schweine und Ziegen, die sich noch am Spieß drehen. Riesige Platten mit Geflügel, gefüllt mit herrlichen Früchten und Nüssen. Meerestiere, die mit Soßen beträufelt sind oder darauf warten, in würzige Dips getunkt zu werden. Zahllose Käsesorten, verschiedene Brote, Gemüse, Desserts; Kaskaden von Wein und Ströme von Spirituosen, auf denen die Flammen züngeln.
Mit meinem Kampfgeist ist auch mein Appetit wieder erwacht. Nachdem ich wochenlang vor lauter Sorgen kaum essen konnte, habe ich jetzt einen Riesenhunger.
»Ich will alles probieren, was es gibt«, sage ich zu Peeta.
Ich sehe ihm an, dass er versucht, meine Miene zu deuten, den Wandel nachzuvollziehen. Er weiß ja nicht, dass ich in den Augen von Präsident Snow versagt habe, deshalb kann er nur schlussfolgern, dass ich glaube, wir hätten es geschafft. Vielleicht sogar, dass ich mich über unsere Verlobung wirklich ein bisschen freue. Seine Verwirrung spiegelt sich in seinem Blick, aber nur kurz, denn wir werden gefilmt. »Dann lass es lieber langsam angehen«, sagt er.
»Na gut, nicht mehr als einen Bissen von jedem Gericht«, sage ich. Ich werde meinem Vorsatz schon an dem ersten Tisch mit rund zwanzig Suppen untreu, als ich eine cremige Kürbissuppe mit geraspelten Nüssen und kleinen schwarzen Samen probiere. »Die könnte ich den ganzen Abend essen!«, rufe ich. Aber das tue ich nicht. Bei einer klaren grünen Brühe, deren Geschmack sich nur mit dem Wort »frühlingshaft« beschreiben lässt, werde ich erneut schwach, und dann noch einmal, als ich ein rosafarbenes, mit Himbeeren getupftes Schaumsüppchen koste.
Gesichter tauchen auf, Namen werden ausgetauscht, Fotos geknipst, Küsschen auf Wangen gehaucht. Meine Spotttölpelbrosche hat anscheinend eine neue Mode ins Leben gerufen, mehrere Leute kommen zu mir, um mir ihre Accessoires zu zeigen. Der Vogel ist auf Gürtelschnallen zu sehen, auf Seidenrevers gestickt, sogar an intimen Stellen eintätowiert. Alle wollen das Zeichen der Siegerin tragen. Ich kann nur ahnen, wie das Präsident Snow zur Weißglut bringen muss. Aber was kann er tun? Die Spiele sind so gut angekommen, hier, wo die Beeren nur für das verzweifelte Mädchen stehen, das den Geliebten retten will.
Peeta und ich suchen keine Gesellschaft, ganz von selbst kommen die Leute zu uns. Wir sind die Hauptattraktion auf dem Fest. Ich tue so, als wäre ich hocherfreut, aber die Leute vom Kapitol interessieren mich kein bisschen. Sie lenken mich nur vom Essen ab.
Jeder Tisch hält neue Verlockungen bereit und selbst mit der Alles-nur-einmal-probieren-Regel werde ich schnell satt. Ich nehme mir einen kleinen gebratenen Vogel, beiße hinein und Orangensoße breitet sich auf meiner Zunge aus. Köstlich. Doch den Rest dränge ich Peeta auf, weil ich noch mehr probieren möchte, und die Vorstellung, Essen wegzuwerfen, wie es hier so viele Leute gedankenlos tun, ist mir ein Graus. Nach etwa zehn Tischen bin ich satt, dabei haben wir nur einen kleinen Teil der Gerichte durchprobiert.
Genau in dem Moment kommt mein Vorbereitungsteam auf uns zugestürmt. Sie sind ganz außer sich von dem Alkohol und vor Begeisterung darüber, bei so einer großen Sache dabei zu sein.
»Warum isst du nichts?«, fragt Octavia.
»Hab ich schon, jetzt kriege ich nichts mehr runter«, sage ich. Alle lachen, als wäre es das Albernste, was sie je gehört haben.
»Davon lässt man sich doch nicht abhalten!«, sagt Flavius. Sie führen uns zu einem Tisch, auf dem kleine Weingläser stehen, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt sind. »Trinkt das!«
Als Peeta ein Glas nimmt, um einen Schluck zu trinken, flippen sie aus.
»Doch nicht hier!«, schreit Octavia.
»Du musst es dadrin trinken«, sagt Venia und zeigt auf eine Tür, die zu den Toiletten führt. »Sonst landet doch alles auf dem Boden!«
Peeta schaut wieder auf das Glas, bis er begreift. »Du meinst, dass ich mich davon übergeben muss?«
Mein Vorbereitungsteam lacht hysterisch. »Na klar, damit du weiteressen kannst«, sagt Octavia. »Ich war schon zweimal dadrin. Alle machen das, wie soll man so ein Festessen sonst genießen?«
Ich bin sprachlos, ich starre auf die hübschen kleinen Gläser und denke an Octavias Worte. Peeta stellt sein Glas mit einer Präzision zurück, als könnte es explodieren. »Komm, Katniss, wir tanzen.«
Musik dringt durch die Wolken herab, während er mich von dem Team und dem Tisch wegführt und mit mir zur Tanzfläche geht. Von zu Hause kennen wir nur wenige Tänze, solche, die zu Fidein und Flöten passen und für die man ziemlich viel Platz braucht. Doch Effie hat uns einige Tänze gezeigt, die im Kapitol beliebt sind. Die Musik ist langsam und traumgleich, also zieht Peeta mich in seine Arme, und wir drehen uns im Kreis, fast ohne Schritte. Diesen Tanz könnte man auf einem Kuchenteller tanzen. Eine Weile schweigen wir. Dann spricht Peeta mit gepresster Stimme.
»Da macht man mit, denkt sich, man kommt damit Idar und vielleicht sind sie doch nicht so übel, und dann …« Er verstummt.
Ich muss an die ausgemergelten Kinder auf unserem Küchentisch denken, an meine Mutter, die das verschreibt, was die Eltern nicht haben. Mehr zu essen. Jetzt, da wir reich sind, wird sie ihnen einiges mit nach Hause geben. Aber damals hatten wir oft nichts, was sie ihnen hätte geben können, und häufig kam für das Kind ohnehin jede Hilfe zu spät. Und hier im Kapitol übergeben sich die Leute, um sich die Bäuche nur zum Spaß erneut vollschlagen zu können. Nicht weil sie körperlich oder seelisch krank wären, nicht weil das Essen verdorben wäre. Das macht man eben so auf einem Fest. Es wird erwartet. Gehört zum Vergnügen dazu.
Einmal, als ich bei Hazelle vorbeiging, um ihr Wild zu bringen, war Vick mit einem schlimmen Husten zu Hause. Da der Kleine zu Gales Familie gehört, bekommt er mehr zu essen als neunzig Prozent der Bevölkerung von Distrikt 12. Trotzdem redete er eine Viertelstunde davon, dass sie eine Dose Maissirup vom Pakettag aufgemacht hätten, dass jeder einen Löffel voll aufs Brot bekommen habe und dass es im Laufe der Woche vielleicht noch mehr geben werde. Und Hazelle hatte gesagt, sie könne ihm vielleicht ein bisschen Sirup in den Tee tun gegen den Husten, aber er fand das ungerecht, wenn die anderen nicht auch etwas bekämen. Wenn es schon bei Gale so zugeht, wie muss es dann erst in den anderen Häusern sein?
»Peeta, die bringen uns her, damit wir uns zu ihrer Unterhaltung bis auf den Tod bekämpfen«, sage ich. »Im Vergleich dazu ist das hier doch gar nichts.«
»Ich weiß. Ich weiß ja. Aber manchmal halte ich es einfach nicht mehr aus. Bis … bis ich nicht mehr weiß, was ich tun werde.« Er schweigt, dann flüstert er: »Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, Katniss.«
»Was meinst du?«, frage ich.
»Vielleicht hätten wir nicht versuchen sollen, die Unruhen in den Distrikten zu unterdrücken«, sagt er. Schnell schaue ich nach links und rechts, doch niemand scheint es gehört zu haben. Die Kameraleute haben sich an einen Tisch mit Meeresfrüchten locken lassen, und die tanzenden Paare um uns herum sind entweder zu betrunken oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um etwas zu merken.
»Tut mir leid«, sagt er. Richtig so. Hier ist nicht der Ort, um solche Gedanken auszusprechen.
»Spar dir das für zu Hause auf«, sage ich.
In diesem Moment kommt Portia mit einem großen Mann an, der mir vage bekannt vorkommt. Sie stellt ihn als Plutarch Heavensbee vor, den neuen Obersten Spielmacher. Plutarch fragt Peeta, ob er mich für einen Tanz entführen dürfe. Peeta hat jetzt wieder sein Kameragesicht aufgesetzt und reicht mich freundlich weiter, warnt den Mann jedoch, mich nicht zu sehr in Beschlag zu nehmen.
Ich will nicht mit Plutarch Heavensbee tanzen. Will nicht seine Hände spüren, eine an meiner Hand, eine auf meiner Hüfte. Ich bin es nicht gewohnt, angefasst zu werden, außer von Peeta oder meiner Familie, und Spielmacher rangieren bei mir, was meinen Wunsch nach Körperkontakt angeht, irgendwo unter Maden. Immerhin scheint er das zu spüren und hält mich auf Armeslänge von sich, während wir uns auf dem Tanzboden drehen.
Wir plaudern über das Fest, über die Unterhaltung, das Essen, und dann macht er einen Witz darüber, dass er seit dem Training einen weiten Bogen um Punsch mache. Ich verstehe nicht, was er meint, bis mir klar wird, dass er derjenige ist, der rückwärts in eine Schüssel mit Punsch gestolpert ist, als ich während des Trainings einen Pfeil auf die Spielmacher abgeschossen habe. Eigentlich nicht auf die Spielmacher. Ich habe ihrem Spanferkel den Apfel aus dem Maul geschossen. Aber ich habe sie erschreckt.
»Ach, Sie sind das …« Ich lache bei der Erinnerung daran, wie er in den Punsch geplatscht ist.
»Ja. Und es wird Sie freuen zu hören, dass ich mich immer noch nicht richtig davon erholt habe«, sagt Plutarch.
Ich würde gern erwidern, dass zweiundzwanzig tote Tribute sich auch nicht mehr von den Spielen erholen werden, an deren Planung er beteiligt war. Doch ich sage nur: »Gut. Dann sind Sie dieses Jahr also der Oberste Spielmacher? Das ist ja bestimmt eine große Ehre.«
»Unter uns gesagt, gab es nicht viele Kandidaten für den Job«, sagt er. »So eine große Verantwortung für den Ausgang der Spiele.«
Ja, und der letzte Verantwortliche ist tot, denke ich. Natürlich weiß er Bescheid über Seneca Crane, aber er wirkt ganz ungerührt. »Planen Sie schon das Jubel-Jubiläum?«, frage ich.
»Oh ja. Die Vorbereitungen laufen selbstverständlich schon seit Jahren. Arenen werden nicht an einem Tag erbaut. Doch über die besondere Würze der Spiele, wenn wir es einmal so nennen wollen, wird jetzt entschieden. Ob Sie es glauben oder nicht, heute Nacht habe ich eine Strategiebesprechung«, sagt er.
Plutarch tritt einen Schritt zurück und zieht eine goldene Taschenuhr aus der Westentasche. Er klappt den Deckel auf, und als er sieht, wie spät es ist, runzelt er die Stirn. »Ich muss gleich gehen.« Er dreht die Uhr so herum, dass ich das Zifferblatt sehen kann. »Um Mitternacht geht es los.«
»Das ist aber spät für …«, setze ich an, doch da fällt mir etwas auf. Plutarch fährt mit dem Daumen über das Kristallglas der Uhr und ganz kurz flackert ein Bild auf. Es ist ein Spotttölpel. Genau wie die Brosche an meinem Kleid. Nur dass dieser wieder verschwindet. Plutarch klappt die Uhr zu.
»Das ist eine sehr schöne Uhr«, sage ich.
»Oh, sie ist mehr als schön. Sie ist einmalig«, sagt er. »Falls jemand nach mir fragen sollte, sagen Sie bitte, ich sei zu Bett gegangen. Die Besprechungen sollen geheim bleiben. Doch ich dachte mir, Ihnen könnte ich davon erzählen.«
»Ja. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben«, sage ich.
Als wir uns die Hände reichen, verbeugt er sich leicht, eine übliche Geste hier im Kapitol. »Nun denn, wir sehen uns im nächsten Sommer bei den Spielen, Katniss. Alles Gute für Ihre Verlobung und viel Glück mit Ihrer Mutter.«
»Das kann ich brauchen«, sage ich.
Plutarch verschwindet, und ich schlendere auf der Suche nach Peeta durch die Menge, während fremde Menschen mir gratulieren. Zu meiner Verlobung, zu meinem Sieg bei den Spielen, zur Farbe meines Lippenstifts. Ich antworte ihnen, doch in Wirklichkeit denke ich daran, wie Plutarch mir stolz seine schöne, einmalige Taschenuhr gezeigt hat. Irgendetwas daran war merkwürdig. Fast heimlichtuerisch. Aber warum? Vielleicht denkt er, jemand könnte seine Idee klauen, einen Spotttölpel auf einer Uhr aufblitzen zu lassen. Ja, wahrscheinlich hat er ein Vermögen dafür bezahlt, und jetzt kann er sie keinem zeigen, weil er befürchtet, dass jemand ein billiges Imitat anfertigen lässt. Nur im Kapitol kann er sie sehen lassen.
Als ich Peeta finde, bewundert er gerade einen Tisch mit kunstvoll dekorierten Torten. Die Bäcker sind extra aus der Küche gekommen, um mit ihm über Zuckerguss und Co. zu fachsimpeln; sie überschlagen sich fast, um seine Fragen zu beantworten. Auf seine Bitte hin stellen sie eine Auswahl kleiner Torten zusammen, die er mit nach Distrikt 12 nehmen kann, um ihre Arbeit in Ruhe zu studieren.
»Effie sagte, wir müssen um eins im Zug sein. Ich frage mich, wie spät es wohl ist«, sagt er und schaut in die Runde.
»Kurz vor Mitternacht«, sage ich. Ich nehme eine Schokoladenblume von einer Torte und knabbere daran, über Manieren mache ich mir jetzt gar keine Gedanken.
»Es ist Zeit, Danke und Auf Wiedersehen zu sagen«, flötet Effie an meiner Seite. In einem Moment wie diesem liebe ich sie für ihre zwanghafte Pünktlichkeit. Wir sammeln Cinna und Portia ein, und Effie führt uns herum, damit wir uns von den wichtigen Leuten verabschieden können, dann scheucht sie uns zur Tür.
»Müssen wir uns nicht bei Präsident Snow bedanken?«, fragt Peeta. »Schließlich ist es sein Haus.«
»Ach, er ist nicht so ein Partylöwe. Zu beschäftigt«, sagt Effie. »Ich habe schon dafür gesorgt, dass er morgen die nötigen Karten und Geschenke bekommt. Da seid ihr ja!« Effie winkt zwei Dienern des Kapitols zu, die einen alkoholisierten Haymitch in ihrer Mitte haben.
In einem Wagen mit getönten Scheiben fahren wir durch die Straßen des Kapitols. Die Vorbereitungsteams folgen uns in einem anderen Wagen. Die Scharen der feiernden Menschen sind so dicht, dass wir nur langsam vorankommen. Doch Effie hat alles bis ins Kleinste geplant und um Punkt eins sind wir wieder im Zug und verlassen den Bahnhof.
Haymitch wird in seinem Abteil abgelegt. Cinna bestellt Tee, und wir setzen uns alle an den Tisch, während Effie mit ihren Zeitplänen raschelt und uns daran erinnert, dass wir uns immer noch auf der Tour befinden. »Wir müssen an das Erntefest in Distrikt 12 denken. Daher schlage ich vor, dass wir jetzt unseren Tee trinken und dann direkt ins Bett gehen.« Niemand widerspricht.
Als ich die Augen wieder öffne, ist es früher Nachmittag. Mein Kopf ruht auf Peetas Arm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er letzte Nacht hereingekommen ist. Ich drehe mich um, vorsichtig, um ihn nicht zu stören, aber er ist schon wach.
»Keine Albträume«, sagt er. »Was?«, frage ich.
»Letzte Nacht hattest du keine Albträume«, sagt er.
Das stimmt. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit habe ich durchgeschlafen. »Aber ich habe etwas geträumt«, erwidere ich und versuche mich zu erinnern. »Ich bin einem Spotttölpel durch den Wald gefolgt. Ganz lange. In Wirklichkeit war er Rue. Als er sang, hatte er ihre Stimme.«
»Wohin hat sie dich geführt?«, fragt Peeta und streicht mir die Haare aus der Stirn.
»Ich weiß nicht. Wir sind nicht angekommen«, sage ich. »Aber ich war glücklich.«
»Du hast auch geschlafen, als ob du glücklich wärst«, sagt er.
»Peeta, wieso merke ich es nie, wenn du einen Albtraum hast?«, frage ich.
»Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich weine oder um mich schlage oder so. Ich wache einfach auf und bin wie gelähmt vor Panik«, sagt er.
»Dann weck mich doch«, sage ich und denke daran, dass ich ihn in meinen schlechten Nächten oft zwei-oder dreimal wecke. Und dass es dann oft ganz lange dauert, bis ich mich wieder beruhigt habe.
»Das ist nicht nötig. Meine Albträume handeln meistens davon, dass ich dich verliere«, sagt er. »Wenn ich merke, dass du da bist, geht es mir schon wieder gut.«
Uff. Peeta sagt so etwas einfach dahin und es trifft mich wie ein Schlag in den Magen. Er hat mir nur eine ehrliche Antwort auf meine Frage gegeben. Er drängt mich nicht, darauf etwas zu erwidern, irgendeine Liebeserklärung zu machen. Trotzdem fühle ich mich schrecklich, als hätte ich ihn gemein ausgenutzt. Habe ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir zum ersten Mal unmoralisch vorkommt, ihn hier in meinem Bett zu haben. Was schon paradox ist - schließlich sind wir jetzt offiziell verlobt.
»Wenn wir erst zu Hause sind und ich wieder allein schlafe, wird das schlimmer«, sagt er.
Stimmt ja, wir sind fast zu Hause.
Für Distrikt 12 steht heute ein Abendessen im Haus von Bürgermeister Undersee auf dem Programm und morgen während des Erntefests eine Siegesfeier auf dem Platz. Das Erntefest wird immer am letzten Tag der Tour gefeiert, doch normalerweise bedeutet es ein Essen zu Hause oder mit ein paar Freunden, wenn man es sich leisten kann. Dieses Jahr wird es eine öffentliche Veranstaltung sein, und da das Kapitol alles spendiert, wird sich der ganze Distrikt den Bauch vollschlagen können.
Die Vorbereitung wird zum größten Teil im Haus des Bürgermeisters stattfinden, denn jetzt müssen wir uns für die Auftritte im Freien wieder in Pelze hüllen. Am Bahnhof bleiben wir nur kurz, wir lächeln und winken, während wir uns ins Auto zwängen. Nicht einmal unsere Familien bekommen wir vor dem Abendessen zu Gesicht.
Ich bin froh, dass das Essen beim Bürgermeister stattfindet und nicht im Justizgebäude, wo die Gedenkfeier für meinen Vater abgehalten wurde und wo ich mich nach der Ernte so qualvoll von meiner Familie verabschieden musste. Das Justizgebäude ist zu sehr mit Trauer verbunden.
Das Haus von Bürgermeister Undersee dagegen gefällt mir, besonders seit seine Tochter Madge und ich Freundinnen sind. In gewisser Weise waren wir das schon immer. Offiziell wurden wir es, als sie sich persönlich von mir verabschiedet hat, bevor ich in die Spiele ziehen musste. Da hat sie mir die Spotttölpelbrosche als Glücksbringer gegeben. Als ich wieder zu Hause war, haben wir uns hin und wieder getroffen. Es stellte sich heraus, dass auch Madge viele leere Stunden füllen muss. Am Anfang war es ein bisschen krampfig, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Andere Mädchen in unserem Alter habe ich über Jungs reden hören oder über andere Mädchen oder über Mode. Madge und ich tratschen nicht gern und Kleider finde ich sterbenslangweilig. Doch nach einigen missglückten Anläufen begriff ich, dass sie für ihr Leben gern in den Wald wollte, also habe ich sie ein paarmal mitgenommen und ihr gezeigt, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht. Sie versucht mir Klavierspielen beizubringen, aber ich höre lieber zu, wenn sie spielt. Manchmal esse ich bei ihr zu Hause oder sie bei mir. Madge gefällt es bei mir besser. Ihre Eltern scheinen nett zu sein, aber ich glaube nicht, dass Madge sie oft zu Gesicht bekommt. Ihr Vater hat als Oberhaupt von Distrikt 12 jede Menge zu tun, und ihre Mutter leidet häufig unter heftigen Kopfschmerzen, die sie tagelang ans Bett fesseln.
»Vielleicht solltet ihr sie mal ins Kapitol bringen«, sagte ich einmal, als es wieder so schlimm war. An dem Tag spielten wir nicht Klavier, denn selbst über zwei Stockwerke hinweg war das Geräusch für ihre Mutter schmerzhaft. »Die würden sie wieder hinkriegen, jede Wette.«
»Ja. Aber ins Kapitol geht man nicht, außer man ist eingeladen«, sagte Madge unglücklich. Auch die Privilegien eines Bürgermeisters sind begrenzt.
Als wir zum Haus des Bürgermeisters kommen, kann ich Madge nur kurz drücken, bevor Effie mich in den zweiten Stock scheucht, damit ich mich umziehe. Nachdem ich zurechtgemacht und in ein langes Silberkleid gehüllt bin, muss ich immer noch eine Stunde bis zum Abendessen totschlagen, also stehle ich mich davon, um Madge zu suchen.
Ihr Zimmer liegt im ersten Stock, wo sich auch mehrere Gästezimmer und das Arbeitszimmer ihres Vaters befinden. Ich strecke den Kopf zur Tür des Arbeitszimmers hinein, um ihrem Vater Guten Tag zu sagen, doch er ist nicht da. Der Fernseher läuft vor sich hin und ich sehe Bilder von Peeta und mir auf dem Fest im Kapitol gestern Abend. Wie wir tanzen, essen und uns küssen. Das läuft in diesem Moment in jedem Haushalt von Panem. Den Zuschauern muss das tragische Liebespaar aus Distrikt 12 schon zum Hals raushängen. So geht es mir jedenfalls.
Ich gehe aus dem Zimmer, als ich plötzlich ein Piepsen höre. Ich drehe mich um und sehe, wie der Bildschirm des Fernsehers schwarz wird. Dann blinken die Worte »AKTUELLER BERICHT AUS DISTRIKT 8« auf. Ich weiß instinktiv, dass das nicht für meine Augen bestimmt ist, sondern nur für die des Bürgermeisters. Ich müsste jetzt gehen. Und zwar schnell. Stattdessen trete ich näher an den Fernseher heran.
Jetzt erscheint eine Sprecherin, die ich noch nie gesehen habe. Sie hat grau meliertes Haar und eine heisere, herrische Stimme. Sie sagt, dass die Zustände sich verschlimmern und dass Alarmstufe 3 ausgerufen wurde. Zusätzliche Truppen würden nach Distrikt 8 geschickt, die gesamte Textilproduktion sei eingestellt worden.
Dann ein Schnitt von der Sprecherin zum zentralen Platz von Distrikt 8. Ich erkenne ihn, weil ich vor einer Woche noch dort war. Von den Dächern wehen immer noch Flaggen mit meinem Gesicht darauf. Darunter spielt sich ein Riesenchaos ab. Schreiende Menschen sind auf dem Platz, die Gesichter hinter Tüchern und selbst gemachten Masken versteckt, sie werfen mit Ziegelsteinen. Häuser stehen in Flammen. Friedenswächter schießen in die Menge, töten wahllos.
Ich habe so etwas noch nie gesehen, aber es kann nur eins bedeuten. Ich sehe das, was Präsident Snow einen Aufstand genannt hat.
7
Ein Lederbeutel mit Essen und eine Thermoskanne mit heißem Tee. Ein Paar mit Fell gefutterte Handschuhe, die Cinna dagelassen hat. Drei Zweige, von den kahlen Bäumen abgebrochen, liegen im Schnee und zeigen in die Richtung, in die ich gehen werde. Diese Sachen hinterlasse ich Gale am ersten Sonntag nach dem Erntefest an unserem Treffpunkt.
Ich bin immer weiter durch die kalten, nebligen Wälder gelaufen, auf einem Weg, den Gale nicht kennen wird, der für meine Füße jedoch leicht zu finden ist. Er führt zum See. Ich vertraue nicht mehr darauf, dass unser üblicher Treffpunkt Abgeschiedenheit bietet, doch genau das und noch mehr brauche ich, um Gale heute mein Herz auszuschütten. Aber wird er überhaupt kommen? Wenn nicht, habe ich keine Wahl, dann muss ich mitten in der Nacht zu ihm gehen. Es gibt etwas, das er wissen muss … Er muss mir helfen, es zu verstehen …
In dem Moment, als ich begriff, was ich bei Bürgermeister Undersee im Fernsehen sah, ging ich zur Tür und durch den Flur. Gerade rechtzeitig, denn kurz darauf kam der Bürgermeister die Treppe hoch. Ich winkte ihm zu.
»Suchst du Madge?«, fragte er freundlich.
»Ja. Ich möchte ihr mein Kleid zeigen«, sagte ich.
»Na, du weißt ja, wo du sie findest.« In dem Augenblick kam wieder das Piepsen aus seinem Büro. Seine Miene wurde ernst. »Entschuldige mich bitte«, sagte er. Er ging in sein Arbeitszimmer und machte die Tür fest hinter sich zu.
Ich wartete im Flur, bis ich mich wieder gefasst hatte. Erinnerte mich daran, dass ich mich normal benehmen musste. Dann ging ich zu Madge. Sie saß in ihrem Zimmer an der Kommode vor einem Spiegel und kämmte sich das blond gewellte Haar. Sie trug dasselbe hübsche weiße Kleid wie am Tag der Ernte. Sie sah mich im Spiegel und lächelte. »Schau dich an. Als kämst du direkt von den Straßen im Kapitol.«
Ich trat näher. Meine Finger berührten den Spotttölpel. »Selbst meine Brosche passt jetzt. Spotttölpel sind im Kapitol total angesagt, durch dich. Willst du die Brosche wirklich nicht zurückhaben?«, fragte ich.
»Quatsch, ich hab sie dir geschenkt«, sagte Madge. Sie band die Haare mit einem festlichen Goldband zurück.
»Woher hast du sie eigentlich?«, fragte ich.
»Sie hat meiner Tante gehört«, sagte sie. »Aber ich glaube, sie ist schon lange im Familienbesitz.«
»Merkwürdig, ausgerechnet ein Spotttölpel«, sagte ich. »Ich meine, wegen der Rebellion. Da haben die Schnattertölpel dem Kapitol doch einen Strich durch die Rechnung gemacht.«
Die Schnattertölpel waren Mutationen, genetisch veränderte männliche Vögel, die das Kapitol erschaffen hatte, um Rebellen im Distrikt auszuspionieren. Die Vögel konnten sich viele Wörter merken und sie wiederholen, deshalb wurden sie in die aufständischen Gebiete geschickt, damit sie dem Kapitol berichten konnten, was dort geredet wurde. Die Rebellen bekamen das spitz und setzten die Schnattertölpel gegen das Kapitol ein, indem sie ihnen lauter Lügen erzählten. Als das herauskam, ließ man die Schnattertölpel aussterben. Binnen weniger Jahre kamen sie in der Wildnis nicht mehr vor, doch zuvor hatten sie sich mit weiblichen Spottdrosseln gepaart und eine ganz neue Art erschaffen.
»Aber Spotttölpel sind nie als Waffe eingesetzt worden«, sagte Madge. »Sie sind nur Singvögel. Oder?«
»Ja, das stimmt wohl«, sagte ich. Aber dem ist nicht so. Eine Spottdrossel ist nur ein Singvogel. Ein Spotttölpel ist ein Tier, das es nach dem Willen des Kapitols gar nicht geben dürfte. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass der streng überwachte Schnattertölpel so schlau sein würde, sich an die Wildnis anzupassen, seinen genetischen Code weiterzugeben, sich in neuer Gestalt weiterzuentwickeln. Sie hatten nicht mit seinem Lebenswillen gerechnet.
Während ich jetzt durch den Schnee stapfe, sehe ich die Spotttölpel, wie sie von Zweig zu Zweig hüpfen, während sie die Melodien anderer Vögel aufschnappen, sie nachahmen und in etwas Neues verwandeln. Wie immer erinnern sie mich an Rue. Ich denke an den Traum, den ich letzte Nacht im Zug hatte, als ich sie in Gestalt eines Spotttölpels sah und ihr folgte. Hätte ich doch noch ein wenig länger geschlafen und herausgefunden, wohin sie mich führen wollte.
Zum See ist es ein ganz schöner Marsch, keine Frage. Wenn Gale sich überhaupt entscheidet, mir zu folgen, wird er sich darüber ärgern, dass er so viel Energie verschwendet, die er besser auf die Jagd verwenden könnte. Es war auffällig, dass zu dem Festessen im Haus des Bürgermeisters seine Familie gekommen ist, er selbst aber nicht. Hazelle sagte, er sei krank, das war offensichtlich gelogen. Beim Erntefestival konnte ich ihn auch nicht entdecken. Vick hat mir erzählt, er sei auf der Jagd. Das stimmte wahrscheinlich.
Nach einigen Stunden komme ich zu einem alten Haus nah am Ufer des Sees. »Haus« ist vielleicht übertrieben. Es besteht nur aus einem Zimmer, ungefähr vier Quadratmeter groß. Mein Vater meinte, dass es hier vor langer Zeit viele Häuser gab - man kann noch Teile der Fundamente sehen - und dass die Leute herkamen, um am See zu spielen und zu fischen. Dieses Haus hat die anderen überlebt, weil es aus Beton erbaut wurde. Der Boden, das Dach, die Decke. Nur eines der vier Glasfenster ist erhalten, es ist mit der Zeit wellig und trüb geworden. Strom und fließend Wasser gibt es nicht, aber der Kamin funktioniert noch, und in einer Ecke ist Holz aufgestapelt, das mein Vater und ich vor Jahren gesammelt haben. Ich zünde ein kleines Feuer an, der Nebel dürfte den verräterischen Rauch verbergen. Während das Feuer anfangt zu brennen, fege ich den Schnee weg, der sich unter den Fenstern ohne Scheiben angesammelt hat; ich benutze dafür einen Reisigbesen, den mein Vater mir gemacht hat, als ich ungefähr acht war und hier Vater-Mutter-Kind gespielt habe. Ich setze mich auf die kleine Betonplatte des Kamins, lasse mich am Feuer auftauen und warte auf Gale.
Überraschend schnell taucht er auf. Er trägt einen Bogen über der Schulter und an seinem Gürtel hängt ein toter Truthahn. Gale steht in der Tür, als überlegte er, ob er hereinkommen soll oder nicht. Er hält den ungeöffneten Lederbeutel mit Essen in den Händen, die Thermoskanne, Cinnas Handschuhe. Geschenke, die er nicht annehmen will, weil er so wütend auf mich ist. Ich weiß genau, wie es in ihm aussieht. Habe ich nicht dasselbe mit meiner Mutter gemacht?
Ich schaue ihm in die Augen. Seine Wut kann nicht ganz überdecken, wie verletzt er ist, wie verraten er sich wegen meiner Verlobung mit Peeta fühlt. Dieses Treffen heute ist meine letzte Chance, Gale nicht für immer zu verlieren. Ich könnte ihm stundenlang alles erklären und selbst dann noch könnte er mich zurückweisen. Stattdessen komme ich direkt zum Hauptpunkt meiner Verteidigung.
»Präsident Snow hat mir persönlich damit gedroht, dich töten zu lassen«, sage ich.
Gale hebt die Augenbrauen, aber richtig ängstlich oder überrascht sieht er nicht aus. »Sonst noch jemanden?«
»Nun ja, er hat mir nicht direkt eine Liste überreicht. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass unsere beiden Familien betroffen sind«, sage ich.
Jetzt kommt er doch zum Kamin. Er hockt sich vor das Feuer und wärmt sich auf. »Es sei denn?«
»Kein >es sei denn<, so, wie es jetzt aussieht«, sage ich. Das müsste ich natürlich genauer erklären, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sitze ich nur da und starre bedrückt ins Feuer.
Nach einer Weile bricht Gale das Schweigen. »Tja, danke für die Warnung.«
Ich drehe mich zu einer schroffen Erwiderung um, als ich das Funkeln in seinen Augen sehe. Ich hasse mich dafür, dass ich lächeln muss. An der Situation ist nichts Komisches, aber es ist wohl ein bisschen viel auf einmal. Sie werden uns alle auslöschen, ganz gleich, was passiert. »Ich hab einen Plan, weißt du.«
»Ja, der ist bestimmt klasse«, sagt er. Er schmeißt mir die Handschuhe auf den Schoß. »Da. Ich will keine abgelegten Handschuhe von deinem Verlobten haben.«
»Er ist nicht mein Verlobter. Das ist Teil der Komödie. Und die Handschuhe sind auch nicht von ihm. Sie haben Cinna gehört«, sage ich.
»Dann gib sie wieder her«, sagt er. Er zieht die Handschuhe an, bewegt die Finger und nickt anerkennend. »Wenigstens werde ich mit warmen Händen sterben.«
»Sehr optimistisch. Du weißt ja gar nicht, was passiert ist«, sage ich.
»Lass hören«, sagt er.
Ich fange mit dem Abend an, als Peeta und ich zu den Siegern der Hungerspiele gekrönt wurden und Haymitch mich vor dem Zorn des Kapitols warnte. Ich erzähle von der Sorge, die mich nicht losließ, selbst als ich schon zu Hause war, von Präsident Snows Besuch, den Morden in Distrikt 11, den Spannungen in der Bevölkerung, dem allerletzten Rettungsversuch durch die Verlobung, der Andeutung des Präsidenten, dass es nicht gereicht hat, von meiner Überzeugung, dass ich werde büßen müssen.
Gale unterbricht mich kein einziges Mal. Während ich erzähle, steckt er die Handschuhe in die Tasche und bereitet aus dem Kissen im Lederbeutel eine Mahlzeit für uns. Er röstet Brot und Käse, entkernt Äpfel, legt Kastanien zum Rösten ins Feuer. Ich beobachte seine Hände, seine schönen, geschickten Finger. Narbig, so wie meine waren, ehe im Kapitol meine Haut geglättet wurde, aber stark und flink. Diese Hände sind kräftig genug, Kohle zu hauen, und fein genug, komplizierte Fallen zu bauen. Es sind Hände, denen ich vertraue.
Ich halte inne und trinke einen Schluck Tee aus der Thermoskanne, ehe ich von meiner Heimkehr erzähle.
»Da hast du ja ein ganz schönes Durcheinander angerichtet«, sagt er.
»Ich bin noch gar nicht fertig«, erwidere ich.
»Ich hab vorerst genug gehört. Überspring den Rest und erzähl von deinem Plan«, sagt er.
Ich atme tief durch. »Wir hauen ab.«
»Was?«, sagt er. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet.
»Wir gehen in den Wald und fliehen«, sage ich. Seine Miene ist undurchdringlich. Wird er mich auslachen, meine Idee als idiotisch abtun? Beunruhigt stehe ich auf, ich mache mich auf eine Auseinandersetzung gefasst. »Du hast selbst gesagt, wir könnten es tun! An dem Morgen der Ernte. Da hast du gesagt …«
Er kommt auf mich zu, und ich merke, wie ich hochgehoben werde. Das Zimmer dreht sich, und ich muss die Arme um seinen Hals legen, damit ich nicht das Gleichgewicht verliere. Er lacht, er ist glücklich.
»Hey!«, rufe ich abwehrend, aber ich lache auch.
Gale setzt mich wieder ab, lässt mich jedoch nicht los. »Gut, dann hauen wir ab«, sagt er.
»Wirklich? Du hältst mich nicht für verrückt? Du kommst mit?« Jetzt drückt das Gewicht mich nicht mehr ganz so nieder, ich habe es auf Gales Schultern abgeladen.
»Doch, ich halte dich für verrückt, aber ich komme trotzdem mit«, sagt er. Er meint es ernst. Nicht nur das, er findet es gut. »Wir können es schaffen, das weiß ich. Lass uns abhauen und nie wiederkommen!«
»Meinst du wirklich?«, frage ich. »Das wird ganz schön schwer, mit den Kleinen und so. Ich möchte nicht zehn Kilometer in den Wald laufen und du musst dann …«
»Ich meine es wirklich. Ganz und gar, vollkommen, hundertprozentig.« Er senkt den Kopf, legt seine Stirn an meine und zieht mich näher an sich. Seine Haut, sein ganzer Körper strahlt Wärme aus, weil er so nah am Feuer war, und ich schließe die Augen, sauge seine Wärme ein. Ich atme den Geruch von schneenassem Leder, Rauch und Äpfeln ein, den Geruch all der Wintertage, die wir vor den Spielen miteinander verbracht haben. Ich versuche nicht, mich zu befreien. Warum auch? Seine Stimme wird zu einem Flüstern. »Ich liebe dich.«
Deshalb also.
Ich sehe so etwas nie kommen. Es geht zu schnell. Im einen Moment schlage ich einen Fluchtplan vor und im nächsten … soll ich auf so etwas reagieren. Ich gebe die wohl schlimmstmögliche Antwort: »Ich weiß.«
Das klingt schrecklich. Als glaubte ich, er könnte gegen seine Gefühle nichts machen, und als erwiderte ich sie nicht. Gale will sich aus der Umarmung befreien, doch ich halte ihn fest. »Ich weiß! Und du … du weißt, was du mir bedeutest.« Das ist nicht genug. Er löst sich aus meinem Griff. »Gale, ich kann im Moment an niemanden so denken. Seit Prims Name bei der Ernte gezogen wurde, kann ich jeden Tag, jeden wachen Augenblick an nichts anderes denken als an meine Angst. Da ist gar kein Raum für etwas anderes. Wenn wir irgendwo in Sicherheit wären, würde ich vielleicht anders empfinden. Ich weiß es nicht.«
Ich sehe, wie er die Enttäuschung hinunterschluckt. »Dann hauen wir also ab. Wir werden es herausfinden.« Er dreht sich wieder zum Feuer, wo die Kastanien anfangen zu brennen. Schnell holt er sie heraus auf den Kaminboden. »Meine Mutter wird sich nicht so leicht überzeugen lassen.«
Ich glaube, er will immer noch mitkommen. Aber die Freude ist verflogen, hat einer allzu bekannten Anspannung Platz gemacht. »Meine auch nicht. Ich muss es ihr einfach begreiflich machen. Ich nehme sie auf einen langen Spaziergang mit. Sie muss einsehen, dass wir anders nicht überleben können.«
»Sie wird es verstehen. Ich hab die Spiele oft zusammen mit ihr und Prim angeschaut. Sie wird es dir nicht abschlagen«, sagt Gale.
»Hoffentlich nicht.« In wenigen Sekunden scheint es im Haus zwanzig Grad kälter geworden zu sein. »Haymitch wird die härteste Nuss.«
»Haymitch?« Gale vergisst die Kastanien. »Du willst ihn doch nicht fragen, ob er mitkommt?«
»Das muss ich, Gale. Ich kann ihn und Peeta nicht zurücklassen, sie würden …« Ich verstumme, als ich seine finstere Miene sehe. »Was ist?«
»Tut mir leid. Mir war nicht klar, dass wir so viele sein würden«, sagt er schroff.
»Sie würden die beiden zu Tode foltern, um rauszukriegen, wo ich bin«, sage ich.
»Und Peetas Familie? Die würden doch nie mitkommen. Im Gegenteil, wahrscheinlich könnten sie es gar nicht abwarten, uns zu verraten. Und bestimmt ist er so schlau, dass er das kapiert. Wenn er sich nun entscheidet, hierzubleiben?«, fragt er.
Ich versuche, unbeteiligt zu klingen, aber meine Stimme überschlägt sich. »Dann bleibt er eben.«
»Du würdest ihn zurücklassen?«, fragt Gale.
»Ja, um Prim und meine Mutter zu retten«, antworte ich. »Ich meine, nein! Ich werde ihn dazu bringen, mitzukommen.«
»Und mich, würdest du mich zurücklassen?« Gales Miene ist jetzt wie versteinert. »Nur für den Fall, dass ich zum Beispiel meine Mutter nicht überreden kann, drei kleine Kinder im Winter mit in die Wildnis zu schleppen.«
»Hazelle sagt nicht Nein. Sie ist vernünftig«, sage ich.
»Aber wenn nicht, Katniss. Was dann?«, will er wissen.
»Dann musst du sie eben zwingen, Gale. Glaubst du, ich denke mir das alles nur aus?« Jetzt bin ich auch wütend und werde lauter.
»Nein. Ich weiß nicht. Vielleicht will der Präsident dich nur manipulieren. Ich meine, er richtet deine Hochzeit aus. Du hast ja gesehen, wie die Massen im Kapitol reagiert haben. Ich glaube nicht, dass er es sich leisten kann, dich umzubringen. Oder Peeta. Wie soll er sich da rauswinden?«, sagt Gale.
»Bei dem Aufstand in Distrikt 8 hat er bestimmt Besseres zu tun, als meine Hochzeitstorte auszusuchen!«, rufe ich.
Kaum sind die Worte heraus, möchte ich sie auch schon wieder zurücknehmen. Sie wirken augenblicklich auf Gale - seine Wangen werden rot, seine grauen Augen leuchten. »In Distrikt 8 gibt es einen Aufstand?«, fragt er gedämpft.
Ich versuche zurückzurudern. Ihn zu beschwichtigen, so, wie ich die Distrikte versucht habe zu beschwichtigen. »Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Aufstand ist. Es gibt Unruhen. Die Leute auf den Straßen …«
Gale fasst mich bei den Schultern. »Was hast du gesehen?«
»Nichts! Ich hab es nicht selbst gesehen. Ich hab nur was gehört.« Wie immer ist es zu wenig, zu spät. Ich gebe auf und erzähle es ihm. »Ich hab beim Bürgermeister was im Fernsehen gesehen. Was ich eigentlich nicht sehen sollte. Da war eine Menschenmenge und Feuer, und die Friedenswächter haben Leute über den Haufen geschossen, aber es gab Widerstand …« Ich beiße mir auf die Lippe und versuche mit Mühe, die Szene weiter zu beschreiben. Stattdessen spreche ich die Worte aus, die mich seitdem quälen. »Und ich bin schuld, Gale. Weil ich das mit den Beeren in der Arena gemacht habe. Wenn ich mich einfach umgebracht hätte, wäre das alles nicht passiert. Peeta wäre nach Hause gekommen und hätte weiterleben können und alle anderen wären auch in Sicherheit gewesen.«
»In was für einer Sicherheit?«, sagt er, sanfter jetzt. »In der Sicherheit, zu verhungern? Wie Sklaven zu arbeiten? Ihre Kinder zur Ernte zu schicken? Du hast den Leuten nichts angetan - du hast ihnen eine Chance gegeben. Sie müssen nur den Mut haben, sie zu ergreifen. In den Bergwerken habe ich schon etwas gehört. Einige wollen kämpfen. Verstehst du nicht? Es passiert! Endlich passiert es! Wenn es in Distrikt 8 einen Aufstand gibt, warum nicht auch hier? Warum nicht überall? Das könnte es sein, das, was wir …«
»Hör auf! Du weißt ja nicht, was du da sagst. Die Friedenswächter außerhalb von Distrikt 12, die sind nicht wie Darius, nicht mal wie Cray! Denen bedeutet ein Menschenleben weniger als nichts!«, sage ich.
»Deshalb müssen wir mitkämpfen«, erwidert er scharf.
»Nein! Wir müssen fort von hier, bevor sie uns und jede Menge anderer Menschen auch noch umbringen!« Jetzt schreie ich wieder, ich verstehe nicht, was er hat. Warum sieht er nicht, was so offensichtlich ist?
Gale schiebt mich unsanft weg. »Dann hau doch ab. Ich gehe nicht in hunderttausend Jahren.«
»Eben wolltest du noch gern mitkommen. Ich verstehe nicht, was ein Aufstand in Distrikt 8 ausmacht, außer dass unsere Flucht dadurch noch dringlicher wird. Du bist ja nur sauer wegen …« Nein, ich kann ihm jetzt nicht Peeta ins Gesicht schleudern. »Was ist mit deiner Familie?«
»Was ist mit den anderen Familien, Katniss? Mit denen, die nicht weglaufen können? Begreifst du nicht? Jetzt kann es nicht mehr darum gehen, unser Leben zu retten. Nicht, wenn die Rebellion angefangen hat!« Gale schüttelt den Kopf, er macht keinen Hehl aus seinem Ärger über mich. »Du könntest so viel tun.« Er wirft mir Cinnas Handschuhe vor die Füße. »Ich hab meine Meinung geändert. Ich will nichts haben, was im Kapitol gemacht wurde.« Und damit ist er verschwunden.
Ich schaue auf die Handschuhe. Nichts, was im Kapitol gemacht wurde? War das auf mich gemünzt? Meint er, ich bin jetzt auch bloß noch ein Produkt des Kapitols und deshalb unberührbar? Ich werde wütend, es ist so ungerecht. Aber in die Wut mischt sich Angst davor, was für eine Verrücktheit er wohl als Nächstes anstellt.
Ich lasse mich neben das Feuer sinken, ich brauche etwas Tröstliches, um den nächsten Schritt planen zu können. Ich beruhige mich mit dem Gedanken, dass Revolutionen nicht an einem Tag gemacht werden. Vor morgen kann Gale nicht mit den Bergarbeitern sprechen. Wenn ich es vorher zu Hazelle schaffe, kann sie ihm vielleicht den Kopf zurechtrücken.
Aber jetzt kann ich nicht zu ihr. Falls er da ist, würde er mich aussperren. Vielleicht heute Nacht, wenn alle anderen schlafen … Hazelle hat oft bis in die Nacht mit ihrer Wäsche zu tun. Dann könnte ich zu ihr gehen, ans Fenster klopfen und ihr erklären, was los ist, damit sie Gale vor einer Dummheit bewahrt.
Mein Gespräch mit Präsident Snow im Arbeitszimmer fällt mir wieder ein.
»Meine Berater hatten Sorge, du könntest Schwierigkeiten machen, aber du hast nicht vor, Schwierigkeiten zu machen, oder?«, fragt er.
»Nein«, sage ich.
»Das habe ich ihnen auch gesagt. Ich habe gesagt, ein Mädchen, das so viel auf sich nimmt, um sein Leben zu retten, wird kein Interesse daran haben, es leichtfertig wegzuwerfen.«
Ich denke daran, wie hart Hazelle gearbeitet hat, um ihre Familie zu retten. Bestimmt wird sie in dieser Frage auf meiner Seite sein. Oder?
Es muss jetzt schon bald Mittag sein und die Tage sind so kurz. Nach Anbruch der Dunkelheit sollte man nicht im Wald sein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich trete die Überreste meines kleinen Feuers aus, räume die Essensreste weg und stecke Cinnas Handschuhe unter den Gürtel. Ich werde sie wohl noch eine Weile behalten. Für den Fall, dass Gale seine Meinung ändert. Ich denke an seine Miene, als er sie weggeworfen hat. Wie sehr er sie abgelehnt hat und auch mich …
Ich stapfe durch den Wald bis zu meinem alten Haus, wo immer noch Licht brennt. Mein Gespräch mit Gale war ein harter Rückschlag, aber ich bin weiterhin entschlossen, aus Distrikt 12 zu fliehen. Als Nächstes nehme ich mir vor, Peeta zu suchen. Er hat auf der Tour ja teilweise dasselbe gesehen wie ich, vielleicht habe ich da mit ihm leichteres Spiel als mit Gale. Ich laufe ihm in die Arme, als er gerade aus dem Dorf der Sieger kommt.
»Auf der Jagd gewesen?«, fragt er. Ich sehe ihm an, dass er das für keine gute Idee hält.
»Nicht direkt. Gehst du in die Stadt?«, frage ich.
»Ja. Meine Familie erwartet mich zum Abendessen«, sagt er.
»Ich kann dich ja wenigstens begleiten.« Die Straße vom Dorf der Sieger zum zentralen Platz wird kaum benutzt. Dort kann man einigermaßen gefahrlos reden. Aber irgendwie bringe ich die Worte nicht über die Lippen. Bei Gale bin ich so kläglich gescheitert. Ich nage an meinen rissigen Lippen. Mit jedem Schritt kommen wir näher zum Platz. So bald wird sich vielleicht keine Gelegenheit mehr bieten. Ich hole tief Luft und lasse die Worte heraussprudeln. »Peeta, wenn ich dich bitten würde, mit mir aus dem Distrikt zu fliehen, würdest du es tun?«
Peeta fasst mich am Arm, hält mich an. Er braucht mir nicht ins Gesicht zu schauen, um sich zu vergewissern, dass ich es ernst meine. »Kommt drauf an, weshalb du fragst.«
»Ich habe Präsident Snow nicht überzeugt. In Distrikt 8 gibt es einen Aufstand. Wir müssen hier raus«, sage ich.
»Wen meinst du mit >wir<? Nur dich und mich? Nein. Wer soll noch mitkommen?«, fragt er.
»Meine Familie. Deine, wenn sie mitkommen wollen. Haymitch vielleicht«, sage ich.
»Und Gale?«, fragt er.
»Ich weiß nicht. Vielleicht hat er andere Pläne«, sage ich.
Peeta schüttelt den Kopf und lächelt mich betrübt an. »Das hat er garantiert. Klar, Katniss, ich komme mit.«
Ich sehe einen Hoffnungsschimmer. »Wirklich?«
»Ja. Aber ich glaube kein bisschen, dass du fliehen wirst«, sagt er.
Ich reiße mich los. »Dann kennst du mich aber schlecht. Halt dich bereit. Es kann jeden Moment so weit sein.« Ich laufe los und er folgt mir im Abstand von ein oder zwei Schritten.
»Katniss«, sagt Peeta. Ich verlangsame meine Schritte nicht. Wenn er die Idee nicht gut findet, will ich es nicht wissen, denn ich habe keine andere. »Katniss, bleib stehen.« Ich kicke einen schmutzigen gefrorenen Schneeklumpen vom Weg und warte, bis Peeta mich eingeholt hat. Mit dem Kohlenstaub sieht alles besonders hässlich aus. »Ich komme wirklich mit, wenn du das willst. Ich meine nur, wir sollten lieber mit Haymitch darüber reden. Nicht, dass wir für die Menschen hier alles noch schlimmer machen.« Er schaut hoch. »Was ist das?«
Ich hebe den Kopf. Ich war so mit meinen eigenen Sorgen beschäftigt, dass ich die merkwürdigen Geräusche, die vom Platz her kommen, gar nicht bemerkt habe. Ein Zischen, ein Knall, Menschen, die aufstöhnen.
»Komm weiter«, sagt Peeta, plötzlich mit harter Miene. Ich weiß nicht, warum. Ich kann das Geräusch nicht einordnen, habe keine Ahnung, was da los ist. Aber für ihn bedeutet es etwas Schlimmes.
Als wir auf den Platz kommen, sehe ich, dass irgendetwas los ist, aber die Menschen stehen so gedrängt, dass man nichts erkennen kann. Peeta steigt auf eine Kiste an der Wand des Süßwarengeschäfts und reicht mir eine Hand, während er über den Platz schaut. Ich bin schon fast oben, als er mir plötzlich den Weg verstellt. »Runter. Weg hier!« Er flüstert, doch seine Stimme ist hart und drängend.
»Was ist?«, frage ich und versuche, auf die Kiste zu steigen.
»Lauf nach Hause, Katniss! Ich bin sofort bei dir, ich schwöre es!«, sagt er.
Was es auch ist, es muss furchtbar sein. Ich reiße mich von seiner Hand los und zwänge mich durch die Menge. Die Leute sehen mich, erkennen mein Gesicht, dann werden sie panisch. Hände schieben mich zurück. Stimmen zischen.
»Hau ab hier, Mädchen.«
»Machst es nur schlimmer.«
»Was willst du? Sollen sie ihn umbringen?«
Aber jetzt klopft mein Herz schon so schnell und heftig, dass ich sie kaum höre. Ich weiß nur, dass das, was da mitten auf dem Platz wartet, für mich bestimmt ist. Als ich mich schließlich durchgekämpft habe und auf den offenen Platz gelange, sehe ich, dass ich recht habe. Und dass Peeta recht hatte. Und die Stimmen hatten auch recht.
Gale ist mit den Handgelenken an einen Holzpfahl gebunden. Über ihm hängt der Truthahn, den er geschossen hatte, ein Nagel geht durch den Hals des Tiers. Gales Jacke ist zu Boden geworfen worden, das Hemd haben sie ihm vom Leib gerissen. Er kniet bewusstlos auf der Erde, nur die Stricke an den Handgelenken halten ihn. Was einmal sein Rücken war, ist ein rohes, blutiges Stück Fleisch.
Hinter ihm steht ein Mann, den ich noch nie gesehen habe, doch die Uniform kenne ich. Sie gehört unserem Obersten Friedenswächter. Aber das hier ist nicht der alte Cray. Dieser Mann ist groß und muskulös und seine Hose hat ordentliche Bügelfalten.
Die Einzelteile wollen sich nicht zu einem Bild zusammenfügen, bis ich sehe, wie er den Arm mit der Peitsche hebt.
8
»Nein!«, schreie ich und mache einen Satz nach vorn. Der herabsausende Arm lässt sich nicht mehr aufhalten, und ich weiß instinktiv, dass ich nicht die Kraft habe, ihn abzuwehren. Stattdessen werfe ich mich genau zwischen Gale und die Peitsche. Ich reiße die Arme hoch, um seinen geschundenen Köper so gut wie möglich zu schützen, da ist nichts, was den Schlag ablenken könnte. Mit voller Wucht trifft er mich auf der linken Gesichtshälfte.
Der Schmerz ist grausam und unmittelbar. Gezackte Lichtblitze erscheinen vor meinen Augen und ich falle auf die Knie. Mit einer Hand halte ich mir die Wange, während ich mich mit der anderen abstütze, um nicht umzukippen. Ich spüre schon, wie der Striemen dick wird und wie mein Auge zuschwillt. Die Steine unter mir sind nass von Gales Blut, der Geruch des Blutes liegt schwer in der Luft. »Hören Sie auf! Sie bringen ihn um!«, kreische ich.
Ganz kurz sehe ich das Gesicht meines Angreifers. Hart, mit tiefen Furchen, einem brutalen Mund. Graue Haare, der Kopf fast kahl rasiert, die Augen so schwarz, dass sie nur aus Pupillen zu bestehen scheinen, eine lange gerade Nase, rot von der Eiseskälte. Der kräftige Arm geht wieder hoch, jetzt hat der Mann mich im Visier. Meine Hand fährt an meine Schulter, jetzt ein Pfeil, aber natürlich sind meine Waffen im Wald verstaut. Ich beiße die Zähne zusammen und warte auf den nächsten Hieb.
»Aufhören!«, befiehlt da jemand. Es ist Haymitch, er stolpert über einen am Boden liegenden Friedenswächter. Darius. Eine gewaltige lilafarbene Beule schiebt sich auf seiner Stirn durch das rote Haar. Er ist bewusstlos, aber er atmet noch. Was ist passiert? Hat er versucht, Gale zu helfen, bevor ich kam?
Haymitch achtet nicht auf ihn und zieht mich grob hoch. »Na super.« Er fasst mir unter das Kinn. »Sie hat nächste Woche ein Fotoshooting, Hochzeitskleider vorführen. Was soll ich ihrem Stylisten erzählen?«
Ich sehe ein Zeichen des Erkennens über das Gesicht des Mannes mit der Peitsche huschen. Warm eingepackt, wie ich bin, ungeschminkt, den Pferdeschwanz nachlässig unter den Mantel gesteckt, bin ich wohl nicht ohne Weiteres als Siegerin der letzten Hungerspiele zu erkennen. Vor allem nicht mit einer geschwollenen Gesichtshälfte. Haymitch dagegen ist seit Jahren regelmäßig im Fernsehen zu sehen und ihn vergisst man nicht so leicht.
Der Mann lässt die Peitsche auf die Hüfte sinken. »Sie hat die Bestrafung eines geständigen Verbrechers gestört.«
Alles an diesem Mann, seine herrische Stimme, sein merkwürdiger Akzent, ist eine einzige Warnung vor einer unbekannten, schrecklichen Gefahr. Woher kommt er? Aus Distrikt 11 ? 3? Aus dem Kapitol selbst?
»Und wenn sie das verdammte Justizgebäude in die Luft gesprengt hätte! Gucken Sie sich ihre Wange an! Meinen Sie, die ist in einer Woche kameratauglich?«, fährt Haymitch den Mann an.
Die Stimme des Mannes ist immer noch kalt, doch ich höre leisen Zweifel heraus. »Das ist nicht mein Problem.«
»Nein? Na, das wird es aber noch, Freundchen. Wenn ich nach Hause komme, rufe ich als Erstes im Kapitol an«, sagt Haymitch. »Um rauszukriegen, wer Sie ermächtigt hat, das hübsche kleine Gesicht meiner Siegerin zu vermurksen!«
»Er hat gewildert. Was geht es das Mädchen überhaupt an?«, sagt der Mann.
»Er ist ihr Cousin.« Peeta nimmt jetzt meinen anderen Arm, aber sanft. »Und sie ist meine Verlobte. Wenn Sie ihn haben wollen, müssen Sie erst mal uns beide kleinkriegen.«
Wahrscheinlich sind wir drei die Einzigen im Distrikt, die so einen Auftritt zustande bringen. Wenn auch nur kurz, denn diese Sache wird ein Nachspiel haben. Aber im Augenblick will ich nichts als Gales Leben retten. Der neue Oberste Friedenswächter schaut zu seiner Truppe. Erleichtert entdecke ich dort die bekannten Gesichter, alte Freunde vom Hob. Ich sehe ihnen an, dass ihnen die Vorstellung nicht gefällt.
Eine Friedenswächterin tritt mit steifen Schritten vor, sie heißt Purnia und isst regelmäßig am Stand von Greasy Sae. »Ich glaube, für ein erstes Vergehen hat er genügend Hiebe erhalten. Es sei denn, Sie verhängen die Todesstrafe, die wir durch ein Erschießungskommando vollziehen würden.«
»Ist das hier das übliche Verfahren?«, fragt der Oberste Friedenswächter.
»Ja«, sagt Purnia, und mehrere nicken. Garantiert weiß das überhaupt keiner, denn wenn jemand mit einem Truthahn auf dem Hob auftaucht, ist das übliche Verfahren, dass sich alle um die Keulen reißen.
»Nun gut, Mädchen. Dann schaff deinen Cousin von hier fort. Und wenn er wieder zu sich kommt, erinnere ihn daran, dass ich, sollte er noch einmal im Gebiet des Kapitols wildern, höchstpersönlich das Erschießungskommando versammeln werde.« Darauf wischt der Oberste Friedenswächter mit der Hand über die Peitsche und bespritzt uns mit Blut. Dann wickelt er sie ordentlich auf und geht davon.
Die meisten anderen Friedenswächter folgen ihm in loser Formation. Eine kleine Gruppe bleibt zurück und hebt Darius an Armen und Beinen hoch. Ich fange Purnias Blick auf und sage lautlos »Danke«, ehe sie geht. Sie gibt keine Antwort, doch ich weiß, dass sie mich verstanden hat.
»Gale.« Ich drehe mich um, fummele an den Knoten, mit denen seine Handgelenke zusammengebunden sind. Jemand reicht ein Messer durch und Peeta durchtrennt die Seile. Gale sinkt auf dem Boden zusammen.
»Bringt ihn lieber zu deiner Mutter«, sagt Haymitch.
Wir haben keine Trage, doch die alte Frau am Kleiderstand verkauft uns das Brett, das ihr als Verkaufstheke dient. »Erzählt bloß keinem, wo ihr das herhabt«, sagt sie und packt schnell ihre restlichen Sachen zusammen. Der Platz ist jetzt fast leer, die Angst ist stärker als das Mitgefühl. Nach dem, was gerade passiert ist, kann ich es niemandem verdenken.
Als wir Gale mit dem Gesicht nach unten auf das Brett legen, sind nur noch eine Handvoll Leute übrig, die ihn tragen können. Haymitch, Peeta und ein paar Bergarbeiter, die in derselben Mannschaft arbeiten wie Gale, heben ihn hoch.
Ein Mädchen namens Leevy, das im Saum ganz bei uns in der Nähe wohnt, fasst mich am Arm. Meine Mutter hat ihrem kleinen Bruder letztes Jahr das Leben gerettet, als er die Masern hatte. »Brauchst du Hilfe auf dem Rückweg?« Der Blick ihrer grauen Augen ist ängstlich, aber entschlossen.
»Nein, aber kannst du Hazelle holen? Sie herschicken?«, frage ich.
»Ja«, sagt Leevy und läuft sofort los.
»Leevy!«, rufe ich. »Sie soll die Kinder nicht mitbringen.«
»Nein, ich bleibe bei ihnen«, sagt sie.
»Danke.« Ich nehme Gales Jacke und laufe hinter den anderen her.
»Kühl das mit Schnee«, befiehlt Haymitch über die Schulter hinweg. Ich nehme eine Handvoll Schnee und halte ihn an die Wange; das betäubt den Schmerz ein wenig. Mein linkes Auge tränt jetzt heftig und in dem Dämmerlicht kann ich nur den Stiefeln vor mir hinterherlaufen.
Während wir gehen, höre ich, wie Bristel und Thorn, Gales Kollegen, die Geschichte Stück für Stück erzählen. Offenbar war Gale zu Cray gegangen, wie er es schon hundertmal gemacht hat, weil er weiß, dass Cray für einen Truthahn immer einen guten Preis zahlt. Doch statt Cray hat er den neuen Obersten Friedenswächter angetroffen, einen Mann, von dem irgendwer sagte, er heiße Romulus Thread. Was mit Cray passiert ist, weiß niemand. Heute Morgen noch hat er auf dem Hob klaren Schnaps gekauft, da hatte er offenbar noch das Sagen im Distrikt, aber jetzt ist er unauffindbar. Thread hat Gale sofort verhaftet, und da Gale mit einem toten Truthahn in der Hand dastand, konnte er wenig zu seiner Verteidigung vorbringen. Es sprach sich schnell herum, dass er in der Klemme steckte. Er wurde auf den Platz gebracht, zu einem Schuldgeständnis gezwungen und zu einer Auspeitschung verurteilt, die sofort vollzogen wurde. Als ich kam, hatte er schon mindestens vierzig Peitschenhiebe hinter sich. Ungefähr bei dreißig verlor er das Bewusstsein.
»Ein Glück, dass er nur den Truthahn bei sich hatte«, sagt Bristel. »Wenn er seinen üblichen Fang gehabt hätte, war es ihm noch viel schlimmer ergangen.«
»Er hat Thread erzählt, er hätte den Truthahn gefunden, als er im Saum rumlief. Das Vieh war über den Zaun geflogen und er hätte es mit einem Stock abgestochen. Immer noch ein Verbrechen. Aber wenn sie gewusst hätten, dass er mit Waffen im Wald war, hätten sie ihn garantiert umgebracht«, sagt Thom.
»Was ist mit Darius?«, fragt Peeta.
»Nach ungefähr zwanzig Hieben ist er eingeschritten und hat gesagt, es sei genug. Nur hat er es nicht so geschickt und förmlich gemacht wie Purnia. Er hat Thread am Arm gepackt und da hat Thread ihm mit dem Griff der Peitsche auf den Kopf gehauen. Für Darius sieht es nicht besonders rosig aus«, sagt Bristel.
»Es sieht wohl für keinen von uns besonders rosig aus«, sagt Haymitch.
Es fängt an zu schneien, dicke nasse Flocken, dadurch kann ich noch schlechter sehen. Ich stolpere hinter den anderen her bis zu unserem Haus, lasse mich mehr von meinen Ohren leiten als von meinen Augen. Meine Mutter, die natürlich auf mich gewartet hat, nachdem ich einen langen Tag ohne Erklärung weggeblieben bin, versucht zu begreifen, was sie sieht.
»Neuer Oberster«, sagt Haymitch, und sie nickt nur kurz, als würde das alles erklären.
Wie immer erfüllt mich Ehrfurcht, als ich sehe, wie sie sich von der Frau, die mich ruft, damit ich eine Spinne töte, in eine Frau verwandelt, die immun ist gegen Angst. Wenn man ihr einen kranken oder sterbenden Menschen bringt… ich glaube, das sind die einzigen Momente, in denen meine Mutter weiß, wer sie ist. Im Nu ist der lange Küchentisch abgeräumt, ein steriles weißes Tuch wird darüber ausgebreitet und Gale hinaufgelegt. Meine Mutter gießt Wasser aus einem Kessel in eine Schüssel und lässt Prim verschiedene Medikamente aus dem Arzneischrank holen. Getrocknete Kräuter und Tinkturen und im Laden gekaufte Flaschen. Ich beobachte die Hände meiner Mutter, die langen, schmal zulaufenden Finger, die etwas in die Schüssel bröseln und Tropfen dazugeben. Sie tränkt ein Tuch in der heißen Flüssigkeit und weist Prim an, frisches Wasser aufzusetzen.
Meine Mutter schaut zu mir. »Bist du im Auge getroffen worden?«
»Nein, es ist nur zugeschwollen«, erkläre ich.
»Pack noch mal Schnee drauf«, sagt sie. Aber es gibt Wichtigeres als mich, das ist deutlich.
»Kannst du ihn retten?«, frage ich. Sie sagt nichts, während sie das Tuch auswringt und es in die Luft hält, damit es ein wenig abkühlt.
»Keine Bange«, sagt Haymitch. »Vor Crays Zeit wurde hier eine Menge gepeitscht. Wir haben sie immer alle zu deiner Mutter gebracht.«
An eine Zeit vor Cray kann ich mich nicht erinnern, an eine Zeit, als es einen Obersten Friedenswächter gab, der häufigen Gebrauch von der Peitsche machte. Da muss meine Mutter in meinem Alter gewesen sein und noch bei ihren Eltern in der Apotheke gearbeitet haben. Selbst damals hatten ihre Hände schon heilende Kräfte.
Ganz sanft beginnt sie das zerfetzte Fleisch auf Gales Rücken zu säubern. Ich fühle mich elend, nutzlos, der restliche Schnee tropft von meinem Handschuh und bildet auf dem Fußboden eine Pfütze. Peeta setzt mich in einen Sessel und hält mir ein Tuch mit frischem Schnee an die Wange.
Haymitch schickt Bristel und Thom nach Hause, und ich sehe, dass er ihnen Münzen in die Hand drückt, bevor sie gehen. »Keine Ahnung, was mit eurer Mannschaft passiert«, sagt er. Sie nicken und nehmen das Geld.
Da kommt Hazelle, atemlos, die Wangen gerötet und Schnee im Haar. Stumm setzt sie sich auf einen Hocker am Tisch, nimmt Gales Hand und drückt sie an die Lippen. Nicht einmal auf sie reagiert meine Mutter. Sie ist in diese gewisse Sphäre eingetreten, in der nur sie und der Patient Platz haben, hin und wieder auch Prim. Wir anderen können warten.
Trotz ihrer kundigen Hände dauert es lange, bis die Wunden gesäubert sind, bis das, was von der zerfetzten Haut noch zu retten ist, halbwegs hergerichtet, bis eine Salbe aufgetragen und ein leichter Verband umgelegt ist. Als das Blut weniger wird, sehe ich, wo jeder einzelne Peitschenhieb aufgekommen ist, und spüre den Nachhall in dem einen Striemen in meinem Gesicht. Ich multipliziere meinen eigenen Schmerz mit zwei, mit drei, mit vierzig und kann nur hoffen, dass Gale vorerst nicht zu Bewusstsein kommt. Das ist natürlich zu viel verlangt. Als die letzten Verbände angelegt werden, kommt ein Stöhnen über seine Lippen. Hazelle streicht ihm übers Haar und flüstert etwas, während meine Mutter und Prim ihren kärglichen Vorrat an Schmerzmitteln in Augenschein nehmen, Schmerzmittel, wie normalerweise nur Ärzte sie haben. Sie sind schwer zu bekommen, teuer und immer begehrt. Die stärksten muss meine Mutter für die schlimmsten Schmerzen aufbewahren, doch was sind die schlimmsten Schmerzen? Für mich sind es immer die Schmerzen, die gerade akut sind. Wenn ich zu bestimmen hätte, wären die Schmerzmittel in einem Tag aufgebraucht, weil ich es kaum ertragen kann, jemanden leiden zu sehen. Meine Mutter versucht sie für diejenigen aufzuheben, die im Sterben liegen, um ihnen den Abschied von der Welt zu erleichtern.
Da Gale wieder zu Bewusstsein kommt, entscheiden sie sich für eine Kräutermischung, die er schlucken kann. »Das reicht ganz bestimmt nicht«, sage ich. Sie starren mich an. »Das reicht nicht, ich weiß, wie es sich anfühlt. Damit kommt man ja kaum gegen Kopfschmerzen an.«
»Wir kombinieren es mit Schlafsirup, Katniss, dann schafft er das schon. Die Kräuter sind eher gegen die Entzündung …«, erklärt meine Mutter ruhig.
»Jetzt gib ihm schon die Medizin!«, schreie ich sie an. »Na los! Wer bist du überhaupt, dass du meinst, du könntest entscheiden, wie viel Schmerzen er ertragen kann!«
Gale bewegt sich unruhig, als er meine Stimme hört, er streckt die Arme nach mir aus. Durch die Bewegung tritt frisches Blut aus den Wunden und befleckt die Verbände, Gale stößt einen Schmerzenslaut aus.
»Bringt sie raus«, sagt meine Mutter. Haymitch und Peeta tragen mich buchstäblich aus dem Zimmer, während ich meine Mutter übel beschimpfe. Sie drücken mich auf ein Bett in einem der Gästezimmer und halten mich fest, bis ich mich nicht mehr wehre.
Während ich daliege und schluchze und die Tränen sich aus dem Schlitz quälen, der mein Auge ist, höre ich, wie Peeta Haymitch im Flüsterton von Präsident Snow und dem Aufstand in Distrikt 8 erzählt. »Sie will, dass wir alle fliehen«, sagt er, doch falls Haymitch dazu eine Meinung hat, behält er sie für sich.
Nach einer Weile kommt meine Mutter herein und behandelt mein Gesicht. Dann hält sie meine Hand und streichelt meinen Arm, während Haymitch ihr erzählt, was mit Gale passiert ist.
»Dann geht es also wieder los?«, sagt sie. »Wie damals?«
»Sieht ganz so aus«, sagt er. »Wer hätte gedacht, dass wir dem alten Cray mal nachtrauern würden?«
Cray wäre so oder so unbeliebt gewesen, weil er eine Uniform trug, aber außerdem wurde er im Distrikt für die Gewohnheit verabscheut, hungernde junge Frauen gegen Geld in sein Bett zu locken. In richtig schlechten Zeiten versammelten sich die Hungrigsten abends vor seiner Tür und wetteiferten um die Gelegenheit, ihren Körper für ein paar Münzen zu verkaufen und damit ihre Familien über Wasser zu halten. Wäre ich älter gewesen, als mein Vater starb, wäre ich vielleicht eine von ihnen geworden. Stattdessen lernte ich, wie man jagt.
Ich weiß nicht genau, was meine Mutter meint, wenn sie sagt, dass es wieder losgeht, aber ich habe zu große Schmerzen und zu viel Wut im Bauch, um zu fragen. Doch ich habe verstanden, dass wieder schlechte Zeiten kommen könnten, denn als es an der Tür klingelt, springe ich sofort aus dem Bett. Wer kann das zu dieser späten Stunde sein? Es gibt nur eine Möglichkeit. Die Friedenswächter.
»Sie kriegen ihn nicht«, sage ich.
»Vielleicht sind sie ja hinter dir her«, sagt Haymitch.
»Oder hinter dir«, erwidere ich.
»Ist nicht mein Haus«, bemerkt Haymitch. »Aber ich geh trotzdem zur Tür.«
»Nein, ich gehe schon«, sagt meine Mutter ruhig.
Doch dann folgen wir alle ihr durch den Flur zu dem durchdringenden Klingeln an der Tür. Sie öffnet, aber da steht kein Trupp von Friedenswächtern, sondern eine einzelne, verschneite Gestalt. Madge. Sie reicht mir eine kleine feuchte Pappschachtel.
»Die sind für deinen Freund«, sagt sie. Ich nehme den Deckel von der Schachtel ab und sehe sechs Ampullen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. »Sie gehören meiner Mutter. Sie hat gesagt, ich kann sie nehmen. Bitte gib sie ihm.« Sie läuft zurück in den Schneesturm, ehe ich sie zurückhalten kann.
»Verrücktes Mädchen«, murmelt Haymitch, während wir, meine Mutter voran, in die Küche gehen.
Was meine Mutter Gale auch verabreicht hat, ich hatte recht, es war nicht genug. Er beißt die Zähne zusammen und seine Haut glänzt vor Schweiß. Meine Mutter füllt eine Spritze mit der Flüssigkeit aus einer Ampulle und injiziert sie in seinen Arm. Fast augenblicklich entspannen sich seine Züge.
»Was ist das für ein Zeug?«, fragt Peeta.
»Es kommt aus dem Kapitol. Man nennt es Morfix«, sagt meine Mutter.
»Ich wusste gar nicht, dass Madge Gale kennt«, sagt Peeta.
»Wir haben ihr immer Erdbeeren verkauft«, erkläre ich fast wütend. Worüber bin ich eigentlich wütend? Ganz bestimmt nicht darüber, dass sie die Medizin gebracht hat.
»Die muss sie aber wirklich gern mögen«, sagt Haymitch.
Das ist es, was mich fuchst. Die Andeutung, da könnte etwas zwischen Gale und Madge sein. Das gefällt mir gar nicht.
»Sie ist meine Freundin.« Mehr sage ich nicht.
Jetzt, da Gale mit dem Schmerzmittel entschwebt ist, wirken alle ernüchtert. Prim drängt uns ein wenig Eintopf und Brot auf. Hazelle wird zum Übernachten eingeladen, aber sie muss nach Hause zu ihren anderen Kindern. Haymitch und Peeta sind bereit zu bleiben, doch meine Mutter schickt sie nach Hause ins Bett. Sie weiß, dass das bei mir zwecklos wäre, also nimmt sie es hin, dass ich mich um Gale kümmere, während sie und Prim sich ausruhen.
Als ich mit Gale allein in der Küche bin, nehme ich Hazelles Platz auf dem Hocker ein und halte seine Hand. Nach einer Weile finden meine Finger sein Gesicht. Ich berühre Stellen seines Körpers, die zu berühren ich bisher nie einen Grund hatte. Seine dichten dunklen Augenbrauen, die Wölbung seiner Wange, die Linie seiner Nase, die Mulde unten am Hals. Ich fahre über seine Bartstoppeln und gelange schließlich zu den Lippen. Weich und voll, leicht aufgesprungen. Sein Atem wärmt meine kalte Haut.
Sehen alle Menschen im Schlaf jünger aus? Denn in diesem Moment könnte er der Junge sein, dem ich vor Jahren im Wald in die Arme gelaufen bin, der Junge, der mir vorwarf, ich hätte aus seinen Fallen gestohlen. Was für ein Gespann wir waren - vaterlos, ängstlich und doch wild entschlossen, unsere Familien zu retten. Verzweifelt, aber von jenem Tag an nicht mehr allein, denn wir hatten einander gefunden. Ich denke an hundert Augenblicke im Wald - wie wir eines Nachmittags gemächlich fischen, wie ich ihm das Schwimmen beibringe, wie er mich nach Hause trägt, als ich mir das Knie verdreht habe. Wir haben uns aufeinander verlassen, einander Rückendeckung gegeben, uns gegenseitig gezwungen, mutig zu sein.
Zum ersten Mal stelle ich mir die Situation umgekehrt vor. Ich stelle mir vor, Gale hätte sich bei der Ernte freiwillig gemeldet, um Rory zu retten, er wäre aus meinem Leben gerissen worden, der Geliebte eines fremden Mädchens geworden, um zu überleben, und dann mit ihr zurückgekehrt. Wäre in ein Haus neben ihr eingezogen. Hätte ihr einen Heiratsantrag gemacht.
Der Hass, den ich für ihn empfinde und für das imaginäre Mädchen, der Hass auf alles ist so echt und unmittelbar, dass er mir die Luft abschnürt. Gale gehört mir. Ich gehöre ihm. Alles andere ist undenkbar. Warum musste er erst halb totgepeitscht werden, damit ich es begreife?
Weil ich selbstsüchtig bin. Und feige. Ich bin ein Mädchen, das, wenn es sich wirklich mal nützlich machen könnte, wegläuft, um am Leben zu bleiben, und alle, die nicht mitkommen können, leiden und sterben lässt. Das ist das Mädchen, das Gale heute im Wald getroffen hat.
Kein Wunder, dass ich die Spiele gewonnen habe. Kein anständiger Mensch gewinnt je die Spiele.
Du hast Peeta gerettet, denke ich schwach.
Aber jetzt stelle ich selbst das infrage. Ich wusste sehr wohl, dass mein Leben in Distrikt 12 unerträglich gewesen wäre, wenn ich diesen Jungen hätte sterben lassen.
Ich lege den Kopf auf die Tischkante, überwältigt von Selbsthass. Wäre ich doch in der Arena gestorben. Hätte Seneca Crane mich doch in die Luft gejagt, wie er es nach Präsident Snows Meinung hätte tun sollen, als ich Peeta die Beeren hinhielt.
Die Beeren. Mir wird bewusst, dass die Antwort auf die Frage, wer ich bin, in dieser Handvoll giftiger Früchte liegt. Wenn ich sie herausgeholt habe, weil ich wusste, dass ich verstoßen werde, wenn ich ohne Peeta zurückkehre, bin ich zu verachten. Wenn ich es getan habe, weil ich ihn liebe, bin ich zwar selbstsüchtig, aber es wäre verzeihlich. Doch wenn ich es getan habe, um dem Kapitol die Stirn zu bieten, bin ich etwas wert. Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß, was in dem Moment in mir vorging.
Könnte es sein, dass die Leute in den Distrikten recht haben? Dass es ein Akt der Rebellion war, wenn auch unbewusst? Denn im tiefsten Innern weiß ich doch, dass es nicht reicht, wegzulaufen und mich, meine Familie und meine Freunde in Sicherheit zu bringen. Selbst wenn ich könnte. Es würde nichts ändern. Es würde nicht verhindern, dass Menschen so etwas angetan wird wie Gale heute.
Das Leben in Distrikt 12 unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem in der Arena. An einem bestimmten Punkt darf man nicht mehr weglaufen, dann muss man sich umdrehen und sich dem stellen, der einen tot sehen will. Aber man muss den Mut aufbringen, es zu tun, das ist die Kunst. Für Gale ist es keine Kunst. Er ist der geborene Rebell. Ich bin diejenige, die Fluchtpläne schmiedet.
»Es tut mir so leid«, flüstere ich. Ich beuge mich vor und küsse ihn.
Seine Lider flattern und er schaut mich durch einen Opiumschleier an. »Hey, Kätzchen.«
»Hey, Gale«, sage ich.
»Ich dachte, du wärst schon weg«, sagt er.
Die Wahl fällt mir nicht schwer. Ich kann wie ein gejagtes Tier im Wald sterben oder ich kann hier bei Gale sterben. »Ich gehe nirgendwohin. Ich bleibe hier und mache eine Menge Ärger.«
»Ich auch«, sagt Gale. Er bringt noch ein kurzes Lächeln zustande, bevor die Drogen ihn wieder in die Tiefe ziehen.
9
Jemand rüttelt mich an der Schulter und ich setze mich auf. Ich war mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen. Die Falten des weißen Tuchs haben sich in meine unverletzte Wange eingegraben. Die andere, die Thread geschlagen hat, pocht schmerzhaft. Gale ist ohnmächtig, doch seine Finger halten meine umschlossen. Ich rieche frisches Brot, und als ich meinen steifen Hals drehe, sehe ich Peeta, der mich unendlich traurig anschaut. Ich habe das Gefühl, dass er uns schon eine ganze Weile beobachtet.
»Komm, leg dich ins Bett, Katniss. Ich kümmere mich jetzt um ihn«, sagt er.
»Peeta. Was ich gestern gesagt habe, das mit der Flucht …«, setze ich an.
»Ich weiß«, sagt er. »Du brauchst nichts zu erklären.«
Ich sehe die Brotlaibe im schneefahlen Morgenlicht auf der Anrichte liegen. Die dunklen Schatten unter seinen Augen. Ich frage mich, ob er überhaupt geschlafen hat. Jedenfalls nicht viel. Ich denke daran, wie er gestern eingewilligt hat, mit mir wegzulaufen, wie er mir beigestanden hat, um Gale zu beschützen, wie er sein Schicksal ganz in meine Hände legt und so wenig dafür zurückbekommt. Was ich auch mache, ich tue jemandem weh. »Peeta …«
»Geh einfach ins Bett, ja?«, sagt er.
Ich taste mich die Treppe hinauf, krieche unter die Decke und schlafe augenblicklich ein. Irgendwann schleicht sich Clove, das Mädchen aus Distrikt 2, in meinen Traum. Sie verfolgt mich, drückt mich zu Boden und zieht ein Messer. Als sie mir ins Gesicht schneidet, gräbt es sich tief in meine Wange und hinterlässt eine klaffende Wunde. Dann verwandelt Clove sich allmählich, ihre Nase formt sich zu einer Schnauze, dunkles Fell sprießt auf ihrer Haut, ihre Fingernägel werden zu langen Klauen, nur die Augen bleiben unverändert. Sie wird zu einer Mutation, einem der Wolfswesen aus dem Kapitol, die uns in der letzten Nacht in der Arena terrorisiert haben. Sie wirft den Kopf in den Nacken und stößt ein langes, unheimliches Heulen aus, das von anderen Mutationen in der Nähe aufgegriffen wird. Jetzt leckt Clove das Blut ab, das aus meiner Wunde fließt, jede Berührung ihrer Zunge jagt mir einen neuen Schmerz über das Gesicht. Ich stoße einen erstickten Schrei aus und schrecke aus dem Schlaf, schwitzend und zitternd zugleich. Ich wiege die verletzte Wange in der Hand und sage mir, dass nicht Clove, sondern Thread mir die Wunde zugefügt hat. Jetzt würde ich gern von Peeta gehalten werden, aber da fällt mir ein, dass ich mir das nicht mehr wünschen darf. Ich habe mich für Gale und die Rebellion entschieden, und eine Zukunft mit Peeta ist der Plan des Kapitols, nicht meiner.
Die Schwellung an meinem Auge ist zurückgegangen, ich kann es ein wenig öffnen. Ich ziehe die Vorhänge auf und sehe, dass aus dem Schneesturm ein richtiger Blizzard geworden ist. Es gibt nur das Weiß und das Heulen des Windes, das dem der mutierten Wölfe erstaunlich ähnlich ist.
Der Blizzard mit seinen heftigen Winden und den Schneewehen kommt mir gerade recht. Vielleicht kann er die eigentlichen Wölfe, auch bekannt als Friedenswächter, von meiner Tür fernhalten. Ein paar Tage zum Nachdenken. Um mir einen Plan zu überlegen. Mit Gale und Peeta und Haymitch in Reichweite. Dieser Blizzard ist ein Geschenk.
Ehe ich hinuntergehe, um mich dem neuen Leben zu stellen, nehme ich mir jedoch noch ein bisschen Zeit und führe mir vor Augen, was auf mich zukommt. Vor kaum einem Tag war ich noch entschlossen, mitten im Winter mit meinen Lieben in die Wildnis zu gehen, wohl wissend, dass das Kapitol uns wahrscheinlich verfolgen würde. Ein im besten Fall gewagtes Unternehmen. Und jetzt bin ich im Begriff, mich einer noch riskanteren Sache zu verschreiben. Wenn man gegen das Kapitol kämpft, ist eine rasche Vergeltung gewiss. Ich muss darauf gefasst sein, dass sie mich jeden Moment verhaften können. Es wird an der Tür klopfen, genau wie letzte Nacht, und ein Trupp von Friedenswächtern wird mich wegschleppen. Vielleicht werden sie mich foltern. Verstümmeln. Mir auf dem öffentlichen Platz eine Kugel in den Kopf jagen, und dann hätte ich noch Glück, weil das wenigstens schnell geht. Das Kapitol hat unendlich viele Todesarten auf Lager. All das stelle ich mir vor und ich habe schreckliche Angst, aber ganz ehrlich: Es hat sowieso schon in meinem Hinterkopf gelauert. Ich war ein Tribut bei den Spielen. Der Präsident hat mir gedroht. Man hat mir mit der Peitsche ins Gesicht geschlagen. Sie haben es sowieso schon auf mich abgesehen.
Jetzt kommt das Schwierigere. Ich muss der Tatsache ins Auge blicken, dass meine Familie und meine Freunde dieses Los womöglich teilen müssen. Prim. Ich brauche nur an Prim zu denken und meine Entschlusskraft ist dahin. Es ist meine Aufgabe, sie zu beschützen. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf, und mein Atem geht so schnell, dass ich den ganzen Sauerstoff aufbrauche und anfange, nach Luft zu schnappen. Ich kann es nicht zulassen, dass das Kapitol Prim wehtut.
Und dann begreife ich. Das haben sie schon getan. Sie haben ihren Vater in diesen verdammten Bergwerken umgebracht. Haben tatenlos zugesehen, wie sie fast verhungert wäre. Haben sie als Tribut ausgewählt, und sie musste zuschauen, wie ihre Schwester auf Leben und Tod in den Spielen kämpfte. Sie hat schon viel mehr durchlitten als ich mit zwölf. Und selbst das verblasst gegen das Leben, das Rue geführt hat.
Ich schiebe die Decke weg und sauge die kalte Luft ein, die durch die Fensterscheiben dringt.
Prim … Rue … sind nicht gerade sie der Grund dafür, dass ich versuchen muss zu kämpfen? Weil das, was ihnen angetan wurde, so verkehrt ist, so unrecht und gemein, dass ich keine Wahl habe? Weil keiner das Recht hat, sie so zu behandeln, wie sie behandelt worden sind?
Ja. Daran muss ich immer denken, wenn die Angst mich zu überwältigen droht. Was ich auch vorhabe, was auch immer wir ertragen müssen, es wird für sie sein. Rue kann ich nicht mehr helfen, aber vielleicht ist es noch nicht zu spät für die fünf kleinen Gesichter, die auf dem Platz in Distrikt 11 zu mir aufgeschaut haben. Nicht zu spät für Rory und Vick und Posy. Nicht zu spät für Prim.
Gale hat recht. Wenn die Leute den Mut aufbringen, könnte das jetzt die Chance sein. Und er hat recht damit, dass ich, da ich das alles in Gang gesetzt habe, ganz viel bewirken könnte.
Auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau das sein soll. Aber der Entschluss, nicht zu fliehen, ist ein entscheidender erster Schritt.
Ich gehe unter die Dusche, und an diesem Morgen stellt mein Gehirn keine Proviantlisten für die Wildnis auf, es versucht sich vorzustellen, wie sie in Distrikt 8 den Aufstand organisiert haben. So viele, die dem Kapitol so deutlich die Stirn bieten. War das überhaupt geplant, oder ist es einfach ausgebrochen, nach Jahren voller Hass und Bitterkeit? Wie könnten wir so etwas hier auf die Beine stellen? Würden die Leute in Distrikt 12 mitmachen oder würden sie ihre Türen verschließen? Gestern hat sich der Platz im Nu geleert, nachdem Gale ausgepeitscht worden war. Aber kommt das nicht daher, dass wir uns alle machtlos fühlen und nicht wissen, was wir tun sollen? Wir brauchen jemanden, der uns führt, der uns versichert, dass es möglich ist. Und ich glaube nicht, dass ich dieser Jemand bin. Ich war vielleicht ein Katalysator für die Rebellion, aber ein Anführer sollte jemand mit Überzeugung sein, und ich bin ja selbst gerade erst bekehrt. Jemand mit bedingungslosem Mut, und ich arbeite immer noch daran, überhaupt Mut aufzubringen. Jemand mit klaren, schlagkräftigen Worten, und ich bringe so oft keinen Ton heraus.
Worte. Ich denke an Worte und ich denke an Peeta. Daran, dass die Leute immer alles begeistert aufnehmen, was er sagt. Er könnte eine Menschenmenge mobilisieren, wenn er wollte. Er würde die richtigen Worte finden. Aber diese Idee ist ihm bestimmt noch nie gekommen.
Ich gehe nach unten, wo meine Mutter und Prim Gale pflegen, der immer noch schwach ist. Er sieht so aus, als ob die Wirkung der Arznei nachlässt. Ich mache mich auf einen weiteren Streit gefasst, versuche jedoch, ruhig zu sprechen. »Kannst du ihm nicht noch eine Spritze geben?«
»Das mache ich, wenn es nötig ist. Wir wollten es erst mit Schneebalsam versuchen«, sagt meine Mutter. Sie hat die Verbände abgenommen. Man kann förmlich sehen, wie die Hitze von seinem Rücken abstrahlt. Sie legt ein sauberes Tuch über sein wundes Fleisch und nickt Prim zu.
Prim kommt zu ihr und rührt etwas in einer großen Schüssel, das aussieht wie Schnee. Doch es ist hellgrün und hat einen süßen, sauberen Duft. Schneebalsam. Behutsam gibt sie etwas davon auf das Tuch. Fast kann ich hören, wie Gales geschundene Haut zischt, als sie mit der Schneemischung in Berührung kommt. Seine Augen öffnen sich flatternd, verdutzt, dann seufzt er erleichtert.
»Ein Glück, dass wir Schnee haben«, sagt meine Mutter.
Ich stelle mir vor, wie es sein muss, sich im Hochsommer von Peitschenschlägen zu erholen, bei sengender Hitze, mit lauwarmem Leitungswasser. »Wie hast du das in den warmen Monaten gemacht?«, frage ich.
Eine Falte erscheint zwischen den Augenbrauen meiner Mutter. »Da hab ich die Fliegen verscheucht.«
Bei der Vorstellung dreht sich mir der Magen um. Sie füllt Schneebalsam in ein Taschentuch und ich halte es an den Striemen auf meiner Wange. Sofort legt sich der Schmerz. Es ist der kalte Schnee, ja. Doch auch die Kräutersäfte, die meine Mutter hinzugefügt hat, wirken betäubend. »Oh. Das tut gut. Warum hast du ihm das nicht gestern Abend schon gegeben?«
»Die Wunde musste sich erst setzen«, sagt sie.
Ich verstehe nicht ganz, was das bedeutet, aber solange es funktioniert, wie kann ich sie da infrage stellen? Sie weiß schon, was sie tut, meine Mutter. Plötzlich habe ich Gewissensbisse wegen gestern, wegen der schrecklichen Sachen, die ich ihr an den Kopf geworfen habe, als Peeta und Haymitch mich aus der Küche gezerrt haben. »Es tut mir leid. Dass ich dich gestern so angeschrien habe.«
»Ich hab schon Schlimmeres gehört«, sagt sie. »Du hast ja gesehen, wie die Leute sind, wenn jemand Schmerzen leidet, den sie lieben.«
Jemand, den sie lieben. Die Worte betäuben meine Zunge, als wäre sie in Schneebalsam eingewickelt worden. Natürlich, ich liebe Gale. Aber was für eine Art Liebe meint sie? Was meine ich, wenn ich sage, dass ich Gale liebe? Ich weiß es nicht. Letzte Nacht habe ich ihn geküsst, in einem Moment, als meine Gefühle sich überschlugen. Aber bestimmt weiß er das nicht mehr. Oder? Hoffentlich nicht. Wenn doch, würde das alles nur noch komplizierter machen, und ich kann wirklich nicht ans Küssen denken, wenn ich eine Rebellion anzetteln soll. Ich schüttele den Kopf ein wenig, um klarer denken zu können. »Wo ist Peeta?«, frage ich.
»Als wir hörten, dass du aufwachst, ist er nach Hause gegangen. Er wollte sein Haus während des Sturms nicht unbeaufsichtigt lassen«, sagt meine Mutter.
»Ist er gut nach Hause gekommen?«, frage ich. Bei einem solchen Schneesturm kann man sich auf wenigen Metern verirren und im Nichts landen.
»Ruf ihn doch an, dann weißt du’s«, sagt sie.
Ich gehe ins Arbeitszimmer, das ich seit der Begegnung mit Präsident Snow weitgehend gemieden habe, und wähle Peetas Nummer. Es klingelt ein paarmal, dann geht er dran.
»Hi. Ich wollte nur wissen, ob du gut nach Hause gekommen bist«, sage ich.
»Katniss, ich wohne drei Häuser von dir entfernt«, sagt er.
»Ich weiß, aber bei dem Wetter …«, sage ich.
»Also, es geht mir gut. Danke der Nachfrage.« Es folgt eine lange Pause. »Wie geht es Gale?«
»Ganz gut. Meine Mutter und Prim behandeln ihn gerade mit Schneebalsam«, sage ich.
»Und dein Gesicht?«, fragt er.
»Ich hab auch ein bisschen abgekriegt«, antworte ich. »Hast du Haymitch heute schon gesehen?«
»Ich war bei ihm. Er war sturzbetrunken. Aber ich hab Feuer gemacht und ihm etwas Brot dagelassen«, sagt er.
»Ich wollte mit … mit euch beiden reden.« Mehr wage ich nicht zu sagen, nicht hier am Telefon, das garantiert abgehört wird.
»Da musst du wohl warten, bis das Wetter sich beruhigt«, sagt er. »Vorher wird sowieso nicht viel passieren.« »Nein, nicht viel«, sage ich.
Es dauert zwei Tage, bis sich der Sturm ausgetobt hat, und danach liegen überall Schneeberge, die höher sind als ich. Ein weiterer Tag, bis der Weg vom Dorf der Sieger zum Platz geräumt ist. Ich helfe so lange Gale zu pflegen, halte mir Schneebalsam an die Wange und versuche, mich an alles über den Aufstand in Distrikt 8 zu erinnern, was ich weiß, denn es könnte für unsere Sache hilfreich sein. Die Schwellung in meinem Gesicht geht zurück, jetzt habe ich nur noch eine juckende Wunde, die langsam verheilt, und ein sehr blaues Auge. Trotzdem frage ich bei der ersten Gelegenheit Peeta, ob er mich in die Stadt begleitet.
Wir wecken Haymitch und schleifen ihn mit. Er beschwert sich, aber nicht so wie sonst. Wir wissen alle drei, dass wir über das sprechen müssen, was passiert ist, und in unseren Häusern im Dorf der Sieger wäre das viel zu gefährlich. Wir warten sogar, bis das Dorf ein ganzes Stück hinter uns liegt, ehe wir überhaupt etwas sagen. Während wir gehen, betrachte ich die drei Meter hohen Schneewände, die zu beiden Seiten des schmalen Weges aufragen, und frage mich, ob sie wohl auf uns einstürzen.
Schließlich bricht Haymitch das Schweigen. »Dann machen wir uns jetzt alle auf ins große Unbekannte, wie?«, sagt er zu mir.
»Nein«, sage ich. »Jetzt nicht mehr.«
»Sind dir die Fehler in deinem Plan aufgefallen, Süße?«, fragt er. »Irgendwelche neuen Ideen?«
»Ich will einen Aufstand organisieren«, sage ich.
Haymitch lacht nur. Es ist noch nicht mal ein fieses Lachen und deshalb umso beunruhigender. Es zeigt, dass er mich überhaupt nicht ernst nimmt. »Also, ich brauch jetzt was zu trinken. Aber halt mich auf dem Laufenden, wie du vorgehen willst«, sagt er.
»Was hast du denn für einen Plan?«, fahre ich ihn an.
»Mein Plan besteht darin, dafür zu sorgen, dass eure Hochzeit perfekt über die Bühne geht«, sagt Haymitch. »Ich hab angerufen und einen neuen Fototermin ausgemacht, ohne allzu viele Einzelheiten zu verraten.«
»Du hast doch gar kein Telefon«, sage ich.
»Effie hat es reparieren lassen«, sagt er. »Weißt du, dass sie mich gefragt hat, ob ich dich gern verraten würde? Ich hab ihr gesagt, je eher, desto besser.«
»Haymitch.« Ich höre selbst, dass ich anfange zu betteln.
»Katniss.« Er ahmt meinen Tonfall nach. »Das haut nicht hin.«
Wir verstummen, als eine Gruppe von Männern mit Schneeschippen an uns vorbei in Richtung Dorf der Sieger geht. Vielleicht können sie etwas gegen die drei Meter hohen Schneewände ausrichten. Als sie außer Hörweite sind, sind wir schon zu nah am Platz. Wir bleiben alle drei gleichzeitig stehen.
Während des Schneesturms wird sowieso nicht viel passieren. Darin waren Peeta und ich uns einig. Aber wir lagen vollkommen falsch. Der Platz ist verwandelt worden. Eine riesige Flagge mit dem Wappen von Panem ziert das Justizgebäude. Friedenswächter in makellos weißen Uniformen marschieren über das ordentlich gefegte Kopfsteinpflaster. Auf den Dächern sind weitere Friedenswächter und besetzen Maschinengewehrnester. Das Schlimmste ist eine Reihe neuer Konstruktionen mitten auf dem Platz: ein offizieller Pfahl für Auspeitschungen, mehrere Pranger und ein Galgen.
»Thread arbeitet schnell«, sagt Haymitch.
Ein paar Straßen weiter sehe ich ein großes Feuer lodern. Keiner von uns muss es aussprechen. Das kann nur der Hob sein, der in Flammen aufgeht. Ich denke an Greasy Sae, an Ripper, an all meine Freunde, die sich dort ihr Brot verdienen.
»Haymitch, du glaubst doch nicht, dass die alle noch dadrin …« Ich kann nicht zu Ende sprechen.
»Nein, so dumm sind die nicht. Das wärst du auch nicht, wenn du schon länger hier wärst«, sagt er. »Na, ich geh jetzt mal lieber zur Apotheke und gucke, wie viel Reinigungsalkohol die erübrigen können.«
Er trottet über den Platz davon und ich schaue Peeta an. »Wofür braucht er den denn?« Dann begreife ich. »Wir müssen verhindern, dass er das Zeug trinkt. Sonst bringt er sich um oder wird mindestens blind. Ich hab zu Hause noch etwas klaren Schnaps beiseitegelegt.«
»Ich auch. Vielleicht kommt er damit hin, bis Ripper sich neue Geschäftswege überlegt hat«, sagt Peeta. »Ich muss jetzt nach meiner Familie sehen.«
»Ich muss zu Hazelle.« Auf einmal mache ich mir Sorgen. Ich hätte gedacht, sie würde bei uns vor der Tür stehen, sobald der Schnee geräumt wäre. Aber bisher ist sie nicht aufgetaucht.
»Ich komme mit. Bei der Bäckerei schaue ich dann auf dem Heimweg vorbei«, sagt er.
»Danke.« Plötzlich habe ich große Angst davor, was ich vorfinden könnte.
Die Straßen sind fast verlassen, was zu dieser Tageszeit nicht so ungewöhnlich wäre, wenn die Leute in den Bergwerken wären, die Kinder in der Schule. Aber das sind sie nicht. Hinter den Eingangstüren und durch die Ritzen in den Rollläden sehe ich Gesichter, die uns beobachten.
Ein Aufstand, denke ich. Was bin ich für ein Dummkopf. Der Plan hat einen Fehler, den weder Gale noch ich erkannt haben, wir waren beide blind. Wenn man einen Aufstand machen will, muss man gegen das Gesetz verstoßen, sich der Obrigkeit widersetzen. Wir und unsere Familien haben das ein Leben lang getan. Wir haben gewildert, auf dem Schwarzmarkt gehandelt, uns im Wald über das Kapitol lustig gemacht. Doch die meisten Bewohner von Distrikt 12 würden nicht mal das Risiko eingehen, auf dem Schwarzmarkt einzukaufen. Und ich erwarte von ihnen, dass sie sich mit Pflastersteinen und Fackeln auf dem Platz versammeln? Schon der Anblick von Peeta und mir reicht aus, dass sie ihre Kinder von den Fenstern wegzerren und die Vorhänge zuziehen.
Hazelle ist zu Hause und pflegt eine sehr kranke Posy. Ich sehe die Flecken auf ihrem Körper, es sind die Masern. »Ich konnte sie nicht allein lassen«, sagt Hazelle. »Ich wusste ja, dass Gale die bestmögliche Pflege bekommt.«
»Natürlich«, sage ich. »Es geht ihm schon viel besser. Meine Mutter meint, in ein paar Wochen kann er wieder in die Bergwerke.«
»Vielleicht sind die dann noch gar nicht wieder in Betrieb«, sagt Hazelle. »Es heißt, dass sie bis auf Weiteres geschlossen wurden.« Sie schaut beunruhigt zu ihrem leeren Waschzuber.
»Haben sie dir auch den Laden dichtgemacht?«, frage ich.
»Nicht offiziell«, erklärt Hazelle. »Aber alle haben jetzt Angst, mir etwas zu geben.«
»Vielleicht wegen des Schnees«, sagt Peeta.
»Nein, Rory hat heute Morgen schnell eine Runde gemacht. Offenbar gibt es nichts zu waschen«, sagt Hazelle.
Rory schlingt die Arme um Hazelle. »Das wird schon.«
Ich nehme eine Handvoll Geld aus der Tasche und lege es auf den Tisch. »Meine Mutter wird etwas für Posy schicken.«
Als wir draußen sind, wende ich mich zu Peeta. »Geh du nach Hause. Ich will noch beim Hob vorbei.«
»Ich begleite dich«, sagt er.
»Nein. Du hast durch mich schon genug Scherereien«, sage ich.
»Und wenn ich jetzt nicht mit dir beim Hob vorbeischaue … dann wird alles wieder gut?« Lächelnd nimmt er meine Hand. Zusammen schlängeln wir uns durch die Straßen des Saums, bis wir zu dem brennenden Gebäude kommen. Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, dort Friedenswächter aufzustellen. Sie wussten, dass niemand versuchen würde, es zu retten.
Die Hitze der Flammen lässt den Schnee ringsum schmelzen, ein schwarzes Rinnsal läuft mir über die Schuhe. »Das ist der ganze Kohlenstaub von früher«, sage ich. In jeder Ritze und in jeder Spalte hat er gesteckt. War in die Bodendielen eingegraben. Es ist ein Wunder, dass das Ding nicht schon längst in Flammen aufgegangen ist. »Ich möchte nach Greasy Sae sehen.«
»Nicht heute, Katniss. Ich glaube, wir helfen niemandem, wenn wir bei ihnen reinschneien«, sagt er.
Wir gehen zurück zum Platz. Ich kaufe bei Peetas Vater ein bisschen Kuchen, während sie Belanglosigkeiten über das Wetter austauschen. Niemand erwähnt die hässlichen Folterwerkzeuge wenige Meter vor der Ladentür. Als wir den Platz verlassen, fällt mir noch auf, dass ich unter den Friedenswächtern kein einziges bekanntes Gesicht sehe.
In den folgenden Tagen wird alles nur noch schlimmer. Die Bergwerke bleiben zwei Wochen lang geschlossen und da hungert schon der halbe Distrikt. Die Anzahl der Kinder, die sich für Tesserasteine eintragen, schnellt in die Höhe, doch oft genug bekommen sie ihr Getreide gar nicht. Lebensmittel werden allmählich knapp, und selbst die Leute, die Geld haben, kehren mit leeren Händen aus den Geschäften zurück. Als die Bergwerke wieder öffnen, werden die Löhne gekürzt, die Arbeitszeiten verlängert, die Arbeiter werden an offensichtlich gefährlichen Stellen eingesetzt. Das für den Pakettag versprochene Essen, sehnlichst erwartet, trifft verdorben und von Ratten verseucht ein. Die Werkzeuge auf dem Platz kommen oft zum Einsatz. Menschen werden herbeigeschleift und für Vergehen bestraft, über die so lange hinweggesehen wurde, dass wir sie schon gar nicht mehr als solche betrachtet hatten.
Gale geht nach Hause, ohne dass wir noch einmal über die Rebellion gesprochen hätten. Aber irgendetwas sagt mir, dass alles, was er sieht, ihn in seinem Entschluss zurückzuschlagen nur noch bestärken wird. Die schlimmen Zustände in den Bergwerken, die gequälten Menschen auf dem Platz, der Hunger in den Gesichtern seiner Familie. Rory hat sich für Tesserasteine eingetragen, worüber Gale noch nicht mal sprechen kann, und es reicht immer noch nicht, weil Lebensmittel nicht jederzeit zu haben sind und immer teurer werden.
Der einzige Lichtblick ist, dass ich Haymitch überreden kann, Hazelle als Haushälterin anzustellen. So hat sie ein wenig zusätzliches Geld und Haymitch eine höhere Lebensqualität. Es ist merkwürdig, sein Haus so frisch und sauber zu sehen, mit warmem Essen auf dem Herd. Er merkt es kaum, weil er eine ganz andere Schlacht führt. Peeta und ich haben versucht, den Schnaps, so gut es ging, einzuteilen, aber er ist fast alle, und als ich Ripper das letzte Mal gesehen habe, stand sie am Pranger.
Wenn ich durch die Straßen gehe, komme ich mir vor wie eine Aussätzige. Alle meiden mich in der Öffentlichkeit. Doch zu Hause habe ich reichlich Gesellschaft. Immer neue Lieferungen von Kranken und Verletzten werden in die Küche zu meiner Mutter gebracht und sie nimmt schon lange kein Geld mehr für die Behandlungen. Ihr Vorrat an Heilmitteln ist so knapp geworden, dass sie die Patienten bald nur noch mit Schnee behandeln kann.
Der Wald ist natürlich verboten. Strengstens. Ohne jede Einschränkung. Nicht mal Gale stellt das jetzt infrage. Doch eines Morgens tue ich es. Und es ist nicht das Haus voller Kranker und Sterbender, das mich unter dem Zaun hindurchtreibt, es sind nicht die blutenden Rücken, die ausgemergelten Gesichter der Kinder, die marschierenden Stiefel, es ist nicht das allgegenwärtige Elend. Es ist eine Kiste mit Hochzeitskleidern, die eines Abends ankommt, darin eine Nachricht von Effie, in der sie schreibt, mit dieser Auswahl sei Präsident Snow persönlich einverstanden.
Die Hochzeit. Will er das wirklich durchziehen? Wozu soll das seinem verqueren Denken nach gut sein? Haben die Leute im Kapitol irgendetwas davon? Eine Hochzeit ist ihnen versprochen worden, eine Hochzeit sollen sie bekommen. Und dann bringt er uns um? Als Lektion für die Distrikte? Ich weiß es nicht. Ich werde daraus nicht schlau. Ich wälze mich im Bett hin und her, bis ich es nicht mehr aushalte. Ich muss hier raus. Wenigstens für ein paar Stunden.
Ich taste in meinem Schrank herum, bis ich die wasserdichte Winterausrüstung finde, die Cinna mir für meine Freizeit während der Siegertour gemacht hat. Wasserdichte Stiefel, ein Schneeanzug, der mich von Kopf bis Fuß bedeckt, Thermohandschuhe. Ich liebe meine alte Jagdkleidung, aber für den Marsch, den ich im Sinn habe, ist diese Hightechausrüstung besser geeignet. Auf Zehenspitzen gehe ich nach unten, packe mir die Jagdtasche mit Proviant voll und stehle mich aus dem Haus. Ich schleiche durch Seitenstraßen und abgelegene Gassen, bis ich zu der Lücke im Zaun in der Nähe von Fleischer Rooba gelange. Weil viele Arbeiter auf dem Weg zu den Bergwerken hier endangkommen, wimmelt es im Schnee von Fußspuren. Da fallen meine gar nicht auf. Sosehr Thread die Sicherheit verstärkt hat, den Zaun hat er vernachlässigt. Vielleicht dachte er sich, das raue Wetter und die wilden Tiere würden schon ausreichen, um die Menschen innerhalb der Grenzen zu halten. Trotzdem verwische ich hinter dem Maschendrahtzaun meine Spuren, bis sie sich zwischen den Bäumen verlieren.
Der Tag bricht gerade an, als ich mir Pfeil und Bogen schnappe und durch den hohen Schnee im Wald stapfe. Aus irgendeinem Grund will ich es unbedingt bis zum See schaffen. Vielleicht, um mich von ihm zu verabschieden und von meinem Vater, der glücklichen Zeit, die wir dort verbracht haben, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie zurückkehren werde. Vielleicht auch nur, um noch mal richtig durchzuatmen. In gewisser Weise ist es fast egal, ob sie mich erwischen, wenn ich den See nur noch einmal sehen kann.
Ich brauche für den Weg doppelt so lange wie sonst. Die Klamotten von Cinna halten die Wärme sehr gut; als ich ankomme, bin ich schweißnass unter dem Schneeanzug, während mein Gesicht taub ist vor Kälte. Die Wintersonne, die vom Schnee reflektiert wird, hat meinen Augen einen Streich gespielt, und ich bin so erschöpft und in meine trüben Gedanken vertieft, dass ich die Zeichen nicht bemerke. Den Rauchfaden, der aus dem Schornstein kommt, die frischen Fußspuren, den Geruch von dampfenden Kiefernnadeln. Ich bin schon wenige Meter vor der Tür des Betonhauses, als ich abrupt stehen bleibe. Und zwar nicht wegen des Rauchs oder der Fußspuren oder des Geruchs. Sondern wegen des unverkennbaren Klickens einer Waffe hinter mir.
Instinkt. Intuition. Ich drehe mich um und spanne den Bogen, obwohl ich schon weiß, dass meine Chancen schlecht stehen. Ich sehe die weiße Friedenswächter-Uniform, das spitze Kinn, die hellbraune Iris, in der mein Pfeil landen wird. Doch die Waffe fällt zu Boden und die unbewaffnete Frau hält mir mit der behandschuhten Hand etwas hin.
»Halt!«, schreit sie.
Ich schwanke, ich kann diesen Wandel nicht einordnen. Vielleicht haben sie den Befehl, mich lebend zu fangen, damit sie mich durch Folter dazu bringen können, alle zu verraten, die ich kenne. Na, dann viel Glück, denke ich. Meine Finger sind schon fast entschlossen, den Pfeil loszulassen, als ich den Gegenstand in dem Handschuh sehe. Es ist ein kleines weißes Brot, flach und rund. Eigentlich eher ein Kräcker. Grau und pappig am Rand. Doch in der Mitte ist ganz deutlich ein Bild zu erkennen.
Es ist mein Spotttölpel.
Teil 2
Das Jubiläum
10
Das verstehe ich nicht. Mein Vogel in Brot gebacken. Anders als die schicken Darstellungen, die ich im Kapitol gesehen habe, ist das hier ganz bestimmt kein modisches Accessoire. »Was ist das? Was soll das bedeuten?«, frage ich schroff, immer noch bereit zu töten.
»Es bedeutet, dass wir auf deiner Seite sind«, sagt hinter mir jemand mit bebender Stimme.
Ich habe sie nicht gesehen, als ich kam. Sie muss im Haus gewesen sein. Ich lasse mein Ziel nicht aus den Augen. Vielleicht ist die Neue bewaffnet, aber ganz bestimmt will sie nicht das verräterische, meinen Tod verkündende Klicken ertönen lassen, denn sie weiß, dass ich dann auf der Stelle ihre Gefährtin umbringen würde. »Komm herum, damit ich dich sehen kann«, befehle ich.
»Sie kann nicht, sie ist …«, setzt die Frau mit dem Kräcker an.
»Komm herum!«, brülle ich. Ich höre einen Schritt und ein schleifendes Geräusch. Ich höre, wie mühsam sie sich bewegt. Die zweite Frau, oder vielleicht sollte ich besser von einem Mädchen sprechen, denn sie ist etwa in meinem Alter, humpelt in mein Blickfeld. Sie ist mit einer schlecht sitzenden Friedenswächter-Uniform bekleidet, inklusive weißem Pelzmantel, doch die Kleider sind mehrere Nummern zu groß für ihre schmächtige Gestalt. Sie scheint keine Waffe dabeizuhaben. Ihre Hände sind damit beschäftigt, eine improvisierte Krücke zu halten, die aus einem abgebrochenen Ast gemacht ist. Mit der Spitze ihres rechten Stiefels kommt sie nicht über den Schnee, deshalb zieht sie den Fuß nach.
Ich betrachte das Gesicht des Mädchens, knallrot von der Kälte. Sie hat schiefe Zähne und einen Erdbeerfleck über einem ihrer schokoladenbraunen Augen. Das ist keine Friedenswächterin. Und sie stammt auch nicht aus dem Kapitol.
»Wer seid ihr?«, frage ich argwöhnisch, aber weniger angriffslustig.
»Ich heiße Twill«, sagt die Frau. Sie ist älter. Fünfunddreißig vielleicht. »Und das ist Bonnie. Wir sind aus Distrikt 8 geflohen.«
Distrikt 8! Dann wissen sie von dem Aufstand!
»Woher habt ihr die Uniformen?«, frage ich.
»Ich hab sie aus der Fabrik geklaut«, sagt Bonnie. »Wir stellen sie dort her. Allerdings war diese für … für jemand anders gedacht. Deshalb passt sie mir nicht.«
»Das Gewehr stammt von einem toten Friedenswächter«, sagt Twill, als sie meinem Blick folgt.
»Der Kräcker in deiner Hand. Mit dem Vogel. Was soll das?«, frage ich.
»Weißt du das nicht, Katniss?« Bonnie wirkt ernsthaft überrascht.
Sie haben mich erkannt. Natürlich haben sie mich erkannt. Mein Gesicht ist nicht verdeckt, ich stehe hier hinter der Grenze von Distrikt 12 und richte einen Pfeil auf sie. Wer sollte ich sonst sein? »Ich weiß, dass der Vogel genauso aussieht wie der auf der Brosche, die ich in der Arena getragen hab.«
»Sie weiß es nicht«, sagt Bonnie leise. »Vielleicht weiß sie gar nichts davon.«
Auf einmal möchte ich, dass es so aussieht, als wüsste ich Bescheid. »Ich weiß, dass ihr in Distrikt 8 einen Aufstand hattet.«
»Ja, deshalb mussten wir weg«, sagt Twill.
»Na, weg seid ihr jetzt ja. Was habt ihr vor?«, frage ich.
»Wir wollen nach Distrikt 13«, antwortet Twill.
»13?«, sage ich. »13 gibt es nicht. Der wurde von der Landkarte getilgt.«
»Vor fünfundsiebzig Jahren«, sagt Twill.
Bonnie verlagert das Gewicht auf der Krücke und zuckt vor Schmerz zusammen.
»Was ist mit deinem Bein?«, frage ich.
»Ich hab mir den Fuß verknackst. Die Stiefel sind mir zu groß«, sagt Bonnie.
Ich beiße mir auf die Lippe. Mein Instinkt sagt mir, dass sie die Wahrheit sagen. Und hinter dieser Wahrheit stecken viele Informationen, die ich gern hätte. Doch bevor ich den Bogen sinken lasse, gehe ich auf Twill zu und nehme ihr das Gewehr ab. Dann zögere ich einen Moment, denke an einen anderen Tag hier im Wald, als Gale und ich ein Hovercraft gesehen haben, das aus dem Nichts auftauchte und zwei junge Leute einfing, die vor dem Kapitol auf der Flucht waren. Der Junge wurde von einem Speer durchbohrt. Das rothaarige Mädchen wurde, wie ich später im Kapitol herausfand, verstümmelt und als stumme Dienerin, Avox genannt, angestellt. »Ist jemand hinter euch her?«
»Wir glauben nicht. Wahrscheinlich denken sie, wir wären bei einer Fabrikexplosion ums Leben gekommen«, sagt Twill. »Reines Glück, dass das nicht passiert ist.«
»Gut, dann kommt mit rein«, sage ich mit einer Kopfbewegung zu dem Betonhaus. Ich folge ihnen mit dem Gewehr.
Bonnie geht sofort zum Kamin und lässt sich auf dem Mantel eines Friedenswächters nieder, der davor ausgebreitet ist. Sie hält die Hände nah an die schwache Flamme, die an einem Ende eines verkohlten Holzscheits brennt. Bonnie ist so blass, dass ihre Haut durchsichtig ist, ich sehe das Feuer durch ihr Fleisch hindurch. Twill versucht, den Mantel, der wohl ihr gehört, dem zitternden Mädchen umzulegen.
Sie haben eine große Blechdose entzweigeschnitten, die Kante ist gefährlich gezackt. Sie steht in der Asche, darin eine Handvoll Kiefernnadeln, die im Wasser dampfen.
»Kocht ihr Tee?«, frage ich.
»Wir wissen nicht so genau. Vor ein paar Jahren hab ich mal bei den Hungerspielen gesehen, wie jemand so was mit Kiefernnadeln gemacht hat. Jedenfalls glaube ich, dass es Kiefernnadeln waren«, sagt Twill mit gerunzelter Stirn.
Ich denke an unseren Besuch in Distrikt 8, eine hässliche Industriegegend, wo es nach Abgasen stank und die Leute in heruntergekommenen Wohnungen hausten. Kaum ein Grashalm zu sehen. Absolut keine Gelegenheit, zu lernen, wie es in der Natur zugeht. Es ist ein Wunder, dass die beiden so weit gekommen sind.
»Nichts mehr zu essen?«, frage ich.
Bonnie schüttelt den Kopf. »Wir haben mitgenommen, so viel wir konnten, aber es gab so wenig zu essen. Es ist schon eine ganze Weile alle.« Bei dem Zittern in ihrer Stimme schwinden meine letzten Vorbehalte. Sie ist nur ein unterernährtes, verletztes Mädchen, das vor dem Kapitol flieht.
»Na, dann ist heute euer Glückstag«, sage ich und lasse meine Jagdtasche zu Boden fallen. Im ganzen Distrikt hungern die Menschen und wir haben immer noch mehr als genug. Deshalb habe ich die Sachen in letzter Zeit ein bisschen verteilt. Ich habe meine Prioritäten: Gales Familie, Greasy Sae und einige andere Schwarzmarkthändler, denen der Laden dichtgemacht wurde. Meine Mutter hat auch noch ein paar Leute, vor allem Patienten, denen sie helfen möchte. Heute Morgen habe ich meine Tasche absichtlich mit Essen vollgestopft, damit meine Mutter die geplünderte Speisekammer sieht und annimmt, dass ich meine Runde zu den Notleidenden mache. Damit wollte ich Zeit gewinnen, um zum See zu gehen, ohne dass sie sich Sorgen macht. Das Essen wollte ich am Abend nach meiner Rückkehr verteilen, aber jetzt sehe ich, dass das ausfallen muss.
Ich hole zwei frische, mit Käse überbackene Brötchen aus der Tasche. Seit Peeta weiß, dass das meine Lieblingsbrötchen sind, haben wir davon immer jede Menge zu Hause. Ich werfe Twill eins zu und lege das andere Bonnie in den Schoß, da ich bezweifle, dass sie es in ihrem Zustand auffangen kann, und ich möchte nicht, dass das Ding im Feuer landet.
»Oh«, sagt Bonnie. »Ist das alles für mich?«
In meinem Innern zuckt es, als ich an eine andere Stimme denke. Rue. In der Arena. Als ich ihr das Gruslingbein gegeben habe. »Ich hab noch nie ein ganzes Bein für mich allein gehabt.« Das Staunen der chronisch Hungrigen.
»Ja, iss es auf«, sage ich. Bonnie hält das Brötchen, als könnte sie nicht recht glauben, dass es echt ist, dann gräbt sie immer wieder die Zähne hinein, sie kann nicht aufhören. »Es ist besser, wenn du kaust.« Sie nickt und versucht, langsamer zu essen, aber ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so ein Loch im Bauch hat. »Ich glaube, euer Tee ist fertig.« Schnell nehme ich die Blechdose aus der Asche. Twill kramt zwei Blechtassen aus ihrem Rucksack und ich schenke den Tee aus und stelle ihn zum Abkühlen auf den Boden. Sie kauern sich zusammen, essen, pusten in ihre Tassen und trinken winzige Schlucke von dem brühend heißen Tee, während ich mich um das Feuer kümmere. Ich warte, bis sie sich das Fett von den Fingern lecken, dann frage ich: »Also, was habt ihr erlebt?« Und sie fangen an zu erzählen.
Seit den Hungerspielen war die Unzufriedenheit in Distrikt 8 immer größer geworden. In gewissem Maß war sie natürlich immer da gewesen. Nur genügte es jetzt nicht mehr zu reden, und die Idee, zur Tat zu schreiten, wurde vom Wunsch zur Realität. In den Textilfabriken, die Panem beliefern, ist es immer laut von den Maschinen, und bei dem Lärm war es ein Leichtes, etwas weiterzusagen, Lippen dicht an einem Ohr, Worte unbemerkt, ungehindert. Twill unterrichtete an der Schule, Bonnie war eine ihrer Schülerinnen, und nach Schulschluss rissen sie zusammen noch eine Vierstundenschicht in der Fabrik ab, die sich auf Uniformen für die Friedenswächter spezialisiert hatte. Bonnie, die in der kalten Fertigungskontrolle arbeitete, brauchte Monate, bis sie die beiden Uniformen beschafft hatte, einen Stiefel hier, eine Hose da. Sie waren für Twill und ihren Mann gedacht, denn wenn der Aufstand größere Kreise ziehen und erfolgreich sein sollte, mussten sie die Nachricht selbstverständlich über Distrikt 8 hinaus verbreiten.
An dem Tag, als Peeta und ich unseren Auftritt bei der Tour der Sieger hatten, fand eine Art Generalprobe statt. Die Leute in der Menge stellten sich in ihren Gruppen auf, an den Gebäuden, die sie ins Visier nehmen wollten, wenn der Aufstand ausbrach. Das war der Plan: die Zentren der Macht in der Stadt zu übernehmen, also das Justizgebäude, das Hauptquartier der Friedenswächter und das Kommunikationszentrum auf dem Platz. Und anderswo im Distrikt: die Eisenbahn, den Kornspeicher, das Elektrizitätswerk und das Waffenlager.
Der Abend meiner Verlobung, der Abend, an dem Peeta auf die Knie fiel und im Kapitol vor laufenden Kameras seine unsterbliche Liebe zu mir gestand, das war der Abend, an dem der Aufstand begann. Das Interview mit Caesar Flickerman auf unserer Tour der Sieger bot einen optimalen Deckmantel. Es war Pflichtprogramm für alle, und so hatte das Volk von Distrikt 8 einen Vorwand, nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen zu sein. Sie versammelten sich zum Zuschauen entweder auf dem Platz oder an verschiedenen Treffpunkten in der Stadt. Normalerweise wäre ein solches Treiben zu verdächtig gewesen. So jedoch waren alle zur vorgeschriebenen Zeit, um acht Uhr, zur Stelle, als die Masken aufgesetzt wurden und die Hölle ausbrach.
Anfangs wurden die Friedenswächter von der Menge überwältigt, auf einen solchen Massenaufstand waren sie nicht vorbereitet. Das Kommunikationszentrum, der Kornspeicher und das Elektrizitätswerk wurden sämtlich eingenommen. Die Rebellen nahmen die Waffen der toten Friedenswächter an sich. Es gab Hoffnung, dass das Ganze keine Wahnsinnstat war, dass es, wenn sich die Nachricht in den anderen Distrikten verbreitete, irgendwie möglich wäre, die Regierung zu stürzen.
Doch dann schlug das Kapitol zurück. Friedenswächter kamen zu Tausenden. Hovercrafts zerbombten die Stützpunkte der Rebellen. In dem Chaos, das folgte, waren die Leute schon froh, wenn sie es lebend nach Hause schafften. In weniger als achtundvierzig Stunden war die Stadt bezwungen. Dann wurde sie eine Woche lang abgeriegelt. Keine Lebensmittel, keine Kohle, Ausgangssperre. Nur einmal war im Fernsehen etwas anderes als Schnee zu sehen, das war, als diejenigen, die als Rädelsführer verdächtigt wurden, auf dem Platz gehängt wurden. Dann, eines Nachts, als der gesamte Distrikt zu verhungern drohte, kam plötzlich der Befehl, wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Für Bonnie und Twill bedeutete das, dass sie wieder in die Schule mussten. Weil eine Straße durch die Bombardierung unzugänglich war, kamen sie zu spät zu ihrer Schicht in der Fabrik, und so waren sie hundert Meter entfernt, als das Gebäude in die Luft flog und alle, die darin waren, ums Leben kamen - darunter Twills Mann und Bonnies ganze Familie.
»Irgendjemand muss dem Kapitol gesteckt haben, dass der Plan für den Aufstand dort entstanden ist«, sagt Twill mit schwacher Stimme.
Die beiden flohen zu Twill nach Hause, wo die Uniformen der Friedenswächter noch warteten. Sie kratzten so viel Proviant wie möglich zusammen, bedienten sich bei Nachbarn, von denen sie wussten, dass sie tot waren, und schafften es zum Bahnhof. In einem Lager in der Nähe der Gleise zogen sie sich die Uniformen der Friedenswächter an und schafften es in dieser Verkleidung bis zu einem mit Stoff beladenen Güterwagen. Der Zug hatte Distrikt 6 zum Ziel, sie flohen unterwegs während eines Tankstopps und gelangten vor zwei Tagen ins Randgebiet von Distrikt 12, wo sie einen Halt einlegen mussten, als Bonnie sich den Knöchel verstauchte.
»Ich verstehe, weshalb ihr auf der Flucht seid, aber was erwartet ihr euch in Distrikt 13?«, frage ich.
Bonnie und Twill wechseln einen nervösen Blick. »Das wissen wir nicht genau«, sagt Twill.
»Da sind doch nur Trümmer«, sage ich. »Wir haben alle die Aufnahmen gesehen.«
»Das ist es ja. Solange wir in Distrikt 8 zurückdenken können, zeigen sie immer dieselben Aufnahmen«, erklärt Twill.
»Wirklich?« Ich versuche mich zu erinnern, mir Bilder von Distrikt 13 vor Augen zu führen, die ich aus dem Fernsehen kenne.
»Du weißt doch, dass sie immer das Justizgebäude zeigen?«, fährt Twill fort. Ich nicke. Ich habe es schon tausendmal gesehen. »Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du ihn erkennen. Ganz oben rechts.«
»Wen denn?«, frage ich.
Twill zeigt wieder ihren Kräcker mit dem Vogel. »Einen Spotttölpel. Nur für einen kurzen Moment, wie er vorbeifliegt. Jedes Mal derselbe.«
»In Distrikt 8 denken wir, dass sie immer wieder dasselbe Bildmaterial zeigen, weil sie das, was da wirklich los ist, nicht zeigen können«, sagt Bonnie.
Ich schnaube ungläubig. »Und auf dieser Grundlage wollt ihr nach Distrikt 13? Wegen einer Aufnahme von einem Vogel? Glaubt ihr etwa, ihr findet dort eine neue Stadt mit Leuten, die darin flanieren? Und dass das für das Kapitol völlig in Ordnung ist?«
»Nein«, sagt Twill ernst. »Wir glauben, dass die Leute unter die Erde gezogen sind, als über der Erde alles zerstört war. Wir glauben, dass sie es geschafft haben zu überleben. Und wir glauben, das Kapitol lässt sie in Ruhe, weil vor den Dunklen Tagen die wichtigste Industrie in Distrikt 13 die Entwicklung von Atomwaffen war.«
»Sie haben Grafit gefördert«, sage ich. Doch dann halte ich inne, denn das ist eine Information, die ich aus dem Kapitol habe.
»Es gab dort ein paar kleine Minen, das stimmt. Aber nicht genug, um eine Bevölkerung dieser Größenordnung zu rechtfertigen. Das ist wohl das Einzige, was wir ganz sicher sagen können«, sagt Twill.
Mein Herz schlägt zu schnell. Und wenn sie nun recht haben? Könnte es stimmen? Gibt es vielleicht außer der Wildnis noch einen Ort, an den man fliehen könnte? Wo man in Sicherheit wäre? Wenn es in Distrikt 13 eine Gemeinschaft gibt, wäre es dann besser, dorthin zu gehen, wo ich vielleicht etwas bewirken könnte, anstatt hier auf den Tod zu warten? Andererseits … wenn es in Distrikt 13 Menschen mit mächtigen Waffen gibt …
»Warum haben sie uns dann nicht geholfen?«, sage ich zornig. »Wenn es stimmt, warum lassen sie uns so leben? Mit dem Hunger und den Morden und den Spielen?« Auf einmal hasse ich diese angebliche unterirdische Stadt in Distrikt 13 und die Leute, die dahocken und uns beim Sterben zusehen. Sie sind nicht besser als das Kapitol.
»Das wissen wir nicht«, flüstert Bonnie. »Im Moment klammern wir uns einfach an die Hoffnung, dass es sie gibt.«
Das katapultiert mich wieder in die Wirklichkeit. Es ist nur eine Illusion. Distrikt 13 gibt es nicht, weil das Kapitol es nie zulassen würde. Wahrscheinlich irren sie sich, was die Fernsehbilder angeht. Spotttölpel sind ungefähr so selten wie Steine. Und auch genauso hart im Nehmen. Wenn sie damals den Bombenangriff auf Distrikt 13 überlebt haben, geht es ihnen jetzt vermutlich besser denn je.
Bonnie hat kein Zuhause. Ihre Familie ist tot. Sie kann unmöglich nach Distrikt 8 zurückkehren oder in einem anderen Distrikt Fuß fassen. Natürlich hat die Vorstellung von einem unabhängigen, blühenden Distrikt 13 für sie eine große Anziehungskraft. Ich bringe es nicht über mich, ihr zu sagen, dass sie einem Traum hinterherjagt, der so wenig greifbar ist wie ein Rauchfaden. Vielleicht können sie und Twill sich im Wald irgendwie ein Leben aufbauen. Ich glaube nicht daran, aber sie sind so bemitleidenswert, dass ich versuchen muss, ihnen zu helfen.
Zuerst gebe ich ihnen das gesamte Essen, das ich im Rucksack habe, vor allem Getreide und getrocknete Bohnen; damit können sie eine ganze Weile auskommen, wenn sie gut haushalten. Dann nehme ich Twill mit in den Wald und versuche ihr die Grundbegriffe der Jagd zu erklären. Sie besitzt eine Waffe, die bei Bedarf Sonnenlicht in tödliche Strahlen umwandeln kann und die also unendlich lange einsetzbar ist. Als Twill ihr erstes Eichhörnchen erlegt, ist das arme Tier ganz verkohlt, weil sein Körper mit voller Wucht getroffen wurde. Doch ich zeige ihr, wie man es häutet und ausnimmt. Mit ein bisschen Übung wird sie es schon lernen. Ich schnitze eine neue Krücke für Bonnie. Im Haus ziehe ich mein zweites Paar Socken aus und gebe es ihr, sie soll die Socken vorn in die Stiefel stecken und nachts anziehen. Schließlich bringe ich ihnen noch bei, wie man ein ordentliches Feuer macht.
Sie wollen Einzelheiten über die Situation in Distrikt 12 erfahren und ich erzähle ihnen von dem Leben unter Thread. Ich merke, dass das für sie wichtige Informationen sind, die sie den Leuten in Distrikt 13 überbringen wollen, und ich spiele mit, um ihnen nicht die Hoffnung zu nehmen. Doch als es am späten Nachmittag zu dämmern beginnt, habe ich keine Zeit mehr, sie weiter aufzubauen.
»Ich muss jetzt gehen«, sage ich.
Sie danken mir überschwänglich und umarmen mich.
Tränen laufen Bonnie über die Wangen. »Ich kann es gar nicht glauben, dass wir dich wirklich kennengelernt haben. Alle reden nur von dir, seit …«
»Ich weiß, ich weiß. Seit ich die Beeren herausgeholt habe«, sage ich müde.
Den Heimweg nehme ich kaum wahr, obwohl nasser Schnee fällt. Mir schwirrt der Kopf von den neuen Informationen über den Aufstand in Distrikt 8 und der unwahrscheinlichen und doch verlockenden Möglichkeit, dass es Distrikt 13 geben könnte.
Die Schilderungen von Bonnie und Twill haben eines bestätigt: Präsident Snow hat mich zum Narren gehalten. Selbst alle Küsse und Zärdichkeiten der Welt hätten die Bewegung, die in Distrikt 8 entstanden war, nicht aufhalten können. Ja, die Sache mit den Beeren war der entscheidende Funke gewesen, doch das Feuer konnte ich nicht eindämmen. Das muss er gewusst haben. Weshalb ist er dann zu mir nach Hause gekommen, warum hat er mir befohlen, die Menschen von meiner Liebe zu Peeta zu überzeugen? Offensichtlich war das eine List, mit der er mich ablenken und von weiteren aufrührerischen Aktionen in den Distrikten abhalten wollte. Und natürlich die Leute im Kapitol unterhalten. Die Hochzeit ist wahrscheinlich nur ein notwendiges Extra.
Ich bin fast am Zaun, als ein Spotttölpel sich auf einem Zweig niederlässt und mir etwas vorsingt. Bei seinem Anblick wird mir bewusst, dass ich gar nicht genau erfahren habe, weshalb der Vogel auf dem Kräcker war und was für eine Bedeutung er hat.
»Es bedeutet, dass wir auf deiner Seite sind«, hat Bonnie gesagt. Es gibt Menschen, die auf meiner Seite sind? Auf was für einer Seite? Bin ich unbeabsichtigt das Gesicht der Rebellion, auf die sie hoffen? Ist der Spotttölpel auf meiner Brosche zum Symbol des Widerstands geworden? Wenn dem so ist, geht es meiner Seite nicht sonderlich gut. Man braucht sich bloß anzuschauen, was in Distrikt 8 passiert ist.
Ich verstaue meine Waffen in dem hohlen Baumstamm in der Nähe meines alten Hauses im Saum und gehe auf den Zaun zu. Ein Knie habe ich schon am Boden, um auf die Weide zu kriechen, und ich bin mit meinen Gedanken immer noch so sehr bei den Ereignissen des Tages, dass ich erst durch den plötzlichen Schrei einer Eule zu mir komme.
In der Dämmerung sieht der Maschendrahtzaun so harmlos aus wie immer. Was meine Hand dennoch zurückzucken lässt, ist ein Geräusch wie das Summen in einem Baum mit mehreren Jägerwespennestern. Es verrät, dass der Zaun unter Strom steht.
11
Instinktiv mache ich einen Satz zurück und verstecke mich zwischen den Bäumen. Ich bedecke den Mund mit dem Handschuh, damit mein Atem nicht als weißer Hauch in der eisigen Luft zu sehen ist. Adrenalin strömt durch meinen Körper und fegt all die Bedenken des Tages aus meinen Gedanken, während ich mich auf die unmittelbare Gefahr vor mir konzentriere. Was soll das? Hat Thread den Zaun als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme eingeschaltet? Oder weiß er irgendwoher, dass ich ihm heute durchs Netz geschlüpft bin? Ist er entschlossen, mich außerhalb von Distrikt 12 auflaufen zu lassen, damit er mich festnehmen und einsperren kann? Will er mich auf den Platz zerren und an den Pranger stellen oder auspeitschen oder hängen lassen?
Ganz ruhig, befehle ich mir. Es ist nicht das erste Mal, dass der Zaun unter Strom steht, wenn ich wieder zurück in den Distrikt will. Im Lauf der Jahre ist das ein paarmal vorgekommen, aber da war immer Gale bei mir. Wir haben uns dann einfach einen gemütlichen Baum gesucht und dort oben gewartet, bis der Strom wieder abgeschaltet wurde, was früher oder später immer geschah. Wenn ich mich verspätete, lief Prim sogar jedes Mal schon zur Weide, um nachzusehen, ob der Zaun unter Strom stand, damit meine Mutter sich nicht unnötig sorgen musste.
Doch heute würde meine Familie nie darauf kommen, dass ich im Wald sein könnte. Ich habe sogar versucht, sie auf die falsche Fährte zu setzen. Wenn ich nicht auftauche, werden sie sich also auf jeden Fall Sorgen machen. Und in gewisser Weise mache ich mir selbst auch Sorgen, denn so sicher bin ich mir nicht, dass es nur Zufall ist - ausgerechnet an dem Tag, an dem ich in den Wald zurückkehre, wird der Strom eingeschaltet. Ich dachte, niemand hätte mich gesehen, als ich unter dem Zaun hindurchgeschlüpft bin, aber wer weiß? Spione gibt es immer. Irgendjemand hat verraten, dass Gale mich genau hier geküsst hat. Allerdings war das am helllichten Tag und damals war ich noch nicht so vorsichtig. Gibt es hier womöglich Überwachungskameras? Das habe ich mich schon einmal gefragt. Weiß Präsident Snow deshalb von dem Kuss? Es war dunkel, als ich mich davongestohlen habe, und ich hatte mir einen Schal um das Gesicht geschlungen. Doch die Liste derjenigen, die man verdächtigen könnte, verbotenerweise in den Wald zu gehen, ist vermutlich nicht lang.
Ich spähe durch die Bäume, am Zaun vorbei, auf die Weide. Ich sehe nichts als den nassen Schnee, der hier und dort von den Lichtern aus den Fenstern am Rand des Saums erhellt wird. Keine Friedenswächter in Sicht, keine Anzeichen dafür, dass ich gejagt werde. Ob Thread nun weiß, dass ich den Distrikt heute verlassen habe, oder nicht, mein Ziel muss dasselbe sein: ungesehen auf die andere Seite des Zauns zu gelangen und so zu tun, als wäre ich nie weg gewesen.
Jede Berührung mit dem Maschendrahtzaun oder mit dem Stacheldraht darüber hätte einen tödlichen Stromschlag zur Folge. Ich bezweifle, dass ich mich unter dem Zaun hindurchgraben kann, ohne entdeckt zu werden, und der Boden ist sowieso festgefroren. Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Irgendwie muss ich versuchen hinüberzugelangen.
Ich gehe am Waldrand entlang und suche nach einem geeigneten Baum mit einem langen, hohen Ast. Nach etwa eineinhalb Kilometern komme ich zu einem alten Ahorn, bei dem es glücken könnte. Der Stamm ist jedoch zu dick und zu glatt, um hinaufzuklettern, und er hat keine niedrigen Äste. Ich klettere auf einen benachbarten Baum und mache einen gewagten Sprung auf den Ahorn, beinahe hätte ich an der glatten Rinde den Halt verloren. Doch ich schaffe es, mich festzuhalten, und schiebe mich auf einem Ast, der über den Zaun ragt, langsam vorwärts.
Als ich hinunterschaue, weiß ich wieder, wieso Gale und ich lieber im Wald gewartet haben, als den Zaun in Angriff zu nehmen. Wenn man nicht verkohlt werden will, muss man mindestens sieben Meter Höhe erreichen. Mein Ast ist bestimmt acht Meter hoch. Das ist eine gefährliche Höhe zum Springen, selbst für jemanden, der jahrelange Übung hat. Doch was bleibt mir übrig? Ich könnte nach einem anderen Ast Ausschau halten, aber jetzt ist es schon fast dunkel. Es schneit immer noch, der Mond wird kaum Licht spenden. Hier ist wenigstens ein Schneeberg unter mir, der meine Landung abfedert. Selbst wenn ich einen anderen Ast fände, was zu bezweifeln ist, wer weiß, wo ich dann hineinspringen würde? Ich hänge mir die leere Jagdtasche um den Hals und lasse mich langsam hinab, bis ich mich nur noch mit den Händen am Ast festhalte. Einen Augenblick lang nehme ich allen Mut zusammen. Dann lasse ich los.
Ich spüre, wie ich falle, dann komme ich mit einem heftigen Ruck auf, der mir die Wirbelsäule hochfährt. Eine Sekunde später knalle ich mit dem Hinterteil auf den Boden. Ich liege im Schnee und untersuche den Schaden. Auch ohne aufzustehen, merke ich an dem Schmerz in der linken Hüfte und im Steißbein, dass ich verletzt bin. Die Frage ist nur, wie sehr. Ich hoffe, dass es nur Prellungen sind, aber als ich mich aufrappele, fürchte ich, dass ich mir auch etwas gebrochen habe. Laufen kann ich immerhin, also marschiere ich los und versuche, so wenig wie möglich zu humpeln.
Meine Mutter und Prim können nicht wissen, dass ich im Wald war. Ich muss mir irgendein Alibi beschaffen, wie dürftig auch immer. Ein paar Geschäfte auf dem Platz haben noch geöffnet, also gehe ich in eines hinein und kaufe weißen Stoff für Verbände. Wir haben sowieso fast keine mehr. In einem anderen Geschäft kaufe ich eine Tüte Pfefferminzbonbons für Prim. Ich stecke mir eins in den Mund, spüre, wie es auf meiner Zunge zergeht, und merke, dass es das Erste ist, was ich heute esse. Eigentlich hatte ich am See etwas essen wollen, aber als ich sah, in welcher Verfassung Bonnie und Twill waren, kam es mir nicht richtig vor, ihnen auch nur einen Bissen wegzunehmen.
Als ich zu Hause ankomme, kann ich mit der linken Ferse überhaupt nicht mehr auftreten. Meiner Mutter werde ich erzählen, ich sei beim Versuch, eine undichte Stelle im Dach unseres alten Hauses zu reparieren, abgerutscht. Was die fehlenden Lebensmittel angeht, werde ich mich einfach bedeckt halten, an wen ich sie verteilt habe. Ich schleppe mich zur Tür und stelle mich darauf ein, am Feuer zusammenzuklappen. Stattdessen erwartet mich ein weiterer Schock.
Zwei Friedenswächter, ein Mann und eine Frau, stehen in der Tür zu unserer Küche. Die Frau bleibt ungerührt, doch ich sehe eine Spur von Überraschung über das Gesicht des Mannes huschen. Sie haben nicht mit mir gerechnet. Sie wissen, dass ich im Wald war und dort in der Falle sitzen müsste.
»Hallo«, sage ich unbeteiligt.
Meine Mutter taucht hinter den beiden auf, bleibt jedoch auf Abstand. »Da ist sie ja, gerade rechtzeitig zum Abendessen«, sagt sie eine Spur zu fröhlich. Ich komme viel zu spät zum Essen.
Ich überlege, ob ich die Stiefel ausziehen soll, wie ich es sonst immer mache, aber das kann ich kaum schaffen, ohne dass meine Verletzungen auffallen. Also setze ich nur die nasse Kapuze ab und schüttele den Schnee aus dem Haar. »Kann ich etwas für Sie tun?«, frage ich die Friedenswächter.
»Der Oberste Friedenswächter Thread schickt uns mit einer Nachricht für Sie«, sagt die Frau.
»Sie haben stundenlang gewartet«, fügt meine Mutter hinzu.
Sie haben darauf gewartet, dass ich es nicht schaffe zurückzukehren. Als Bestätigung dafür, dass ich durch einen Stromschlag getötet wurde oder im Wald gefangen bin, und dann hätten sie meine Familie in die Mangel nehmen können.
»Dann muss es ja eine wichtige Nachricht sein«, sage ich.
»Dürfen wir fragen, wo Sie waren, Miss Everdeen?«, fragt die Frau.
»Fragen Sie lieber, wo ich nicht war«, sage ich in genervtem Ton. Ich gehe in die Küche und zwinge mich, normal aufzutreten, obwohl jeder Schritt die reinste Qual ist. Ich gehe zwischen den Friedenswächtern hindurch und schaffe es einigermaßen bis zum Tisch. Ich schleudere meine Tasche hin und wende mich zu Prim, die stocksteif am Kamin steht. Haymitch und Peeta sind auch da, sie sitzen jeder in einem Schaukelstuhl und spielen Schach. Waren sie zufällig hier oder haben die Friedenswächter sie »eingeladen«? So oder so bin ich froh, sie zu sehen.
»Also, wo warst du nicht?«, fragt Haymitch gelangweilt.
»Ich hab nicht mit dem Ziegenmann darüber gesprochen, Prims Ziege zu decken, weil mir jemand eine vollkommen falsche Wegbeschreibung gegeben hat«, sage ich eindringlich zu Prim.
»Hab ich nicht«, sagt Prim. »Ich hab es dir genau erklärt.«
»Du hast gesagt, er wohnt am westlichen Eingang des Bergwerks«, sage ich.
»Am östlichen Eingang«, verbessert mich Prim.
»Du hast ganz eindeutig gesagt, am westlichen Eingang, darauf hab ich nämlich gefragt: >Neben der Abraumhalde?<, und du hast Ja gesagt.«
»Neben der Abraumhalde am östlichen Eingang«, sagt Prim geduldig.
»Nein. Wann willst du das gesagt haben?«, frage ich.
»Gestern Abend«, mischt Haymitch sich ein.
»Sie hat wirklich >östlich< gesagt«, fügt Peeta hinzu. Er guckt zu Haymitch und sie lachen. Ich schaue Peeta wütend an und er versucht, zerknirscht auszusehen. »Tut mir leid, aber ich hab’s dir ja schon immer gesagt. Du hörst einfach nicht zu, wenn dir jemand etwas erklärt.«
»Garantiert haben dir die Leute heute auch gesagt, dass er da nicht wohnt, und du hast wieder nicht zugehört«, sagt Haymitch.
»Halt die Klappe, Haymitch«, sage ich und lasse damit durchblicken, dass er recht hat.
Haymitch und Peeta prusten los und Prim gestattet sich ein Lächeln.
»Na schön. Dann soll sich doch jemand anders darum kümmern, wie wir das blöde Vieh gedeckt kriegen«, sage ich, und da lachen sie noch mehr. Und ich denke: Deshalb haben sie es so weit gebracht, Haymitch und Peeta. Die lassen sich durch nichts aus der Fassung bringen.
Ich schaue die Friedenswächter an. Der Mann lächelt, doch die Frau ist nicht überzeugt. »Was ist in der Tasche?«, fragt sie schneidend.
Ich weiß, dass sie auf Wild oder Pflanzen hofft. Etwas, das mich eindeutig verrät. Ich kippe den Inhalt auf den Tisch. »Bitte sehr.«
»Oh, gut«, sagt meine Mutter, als sie den Stoff sieht. »Wir haben kaum noch Verbände.«
Peeta kommt zum Tisch und macht die Bonbontüte auf. »Mmmh, Pfefferminz«, sagt er und steckt sich eins in den Mund.
»Das sind meine.« Ich versuche die Tüte zu schnappen. Er wirft sie Haymitch zu, der sich eine Handvoll in den Mund stopft, ehe er die Tüte an die kichernde Prim weiterreicht. »Keiner von euch hat Bonbons verdient!«, sage ich.
»Wieso, weil wir recht haben?« Peeta nimmt mich in die Arme. Ich stoße einen kleinen Schmerzenslaut aus, als mein Steißbein protestiert. Ich versuche es wie Empörung klingen zu lassen, aber Peeta weiß, dass ich Schmerzen habe, das sehe ich an seinem Blick. »Na gut, Prim hat >westlich< gesagt. Ich hab es klar und deudich gehört. Und wir sind alle Idioten. Wie wär’s damit?«
»Schon besser«, sage ich und erwidere seinen Kuss. Dann schaue ich zu den Friedenswächtern, als würde mir plötzlich wieder einfallen, dass sie da sind. »Sie haben eine Nachricht für mich?«
»Von unserem Obersten Friedenswächter Thread«, sagt die Frau. »Er lässt Ihnen mitteilen, dass der Zaun um Distrikt 12 von nun an rund um die Uhr unter Strom steht.«
»War das nicht schon immer so?«, frage ich ein wenig zu unschuldig.
»Er dachte, Sie möchten es vielleicht auch Ihrem Cousin ausrichten«, sagt die Frau.
»Vielen Dank. Ich werde es ihm sagen. Bestimmt können wir jetzt alle besser schlafen, da der Sicherheitsdienst dieses Versäumnis behoben hat.«
Jetzt treibe ich es ein bisschen zu weit, das weiß ich, aber es verschafft mir eine gewisse Befriedigung, das zu sagen.
Die Frau reckt das Kinn. Für sie ist es ganz und gar nicht nach Plan gelaufen, aber sie hat keine weiteren Anweisungen. Sie nickt mir kurz zu und geht davon, den Mann im Schlepptau. Als meine Mutter die Tür geschlossen hat, lasse ich mich an den Tisch sinken.
»Was hast du?«, fragt Peeta und hält mich fest.
»Ach, ich hab mir den linken Fuß gestoßen. An der Ferse. Und mein Steißbein hatte auch einen schlechten Tag.« Er führt mich zu einem Schaukelstuhl und ich lasse mich auf das gepolsterte Kissen sinken.
Meine Mutter zieht mir die Schuhe aus. »Was ist passiert?«
»Ich bin ausgerutscht und hingefallen«, sage ich. Vier Augenpaare sehen mich ungläubig an. »Auf einer vereisten Stelle.« Wir wissen alle, dass das Haus wahrscheinlich verwanzt ist und wir es nicht riskieren können, offen miteinander zu sprechen. Nicht hier, nicht jetzt.
Meine Mutter zieht mir die Socke aus und betastet meine linke Ferse. Ich zucke zusammen. »Da könnte etwas gebrochen sein«, sagt sie. Sie untersucht den anderen Fuß. »Der hier scheint in Ordnung zu sein.« Sie stellt fest, dass ich am Steißbein eine schlimme Prellung habe.
Prim bekommt den Auftrag, meinen Schlafanzug und Bademantel zu holen. Als ich mich umgezogen habe, bereitet meine Mutter eine Schneepackung für meine linke Ferse vor und legt meinen Fuß auf einen niedrigen Hocker. So verspeise ich drei Teller Eintopf und einen halben Laib Brot, während die anderen am Tisch sitzen und essen. Ich starre ins Feuer, denke an Bonnie und Twill und hoffe, dass der schwere nasse Schnee meine Spuren verdeckt hat.
Prim kommt und setzt sich neben mir auf den Boden, sie lehnt den Kopf an mein Knie. Wir lutschen Pfefferminzbonbons und ich streiche ihr die weichen blonden Haare hinter das Ohr. »Wie war’s in der Schule?«, frage ich.
»Ganz gut. Wir haben etwas über Nebenerzeugnisse bei der Kohleherstellung gelernt«, sagt sie. Eine Weile starren wir ins Feuer. »Willst du deine Hochzeitskleider mal anprobieren?«
»Nicht heute Abend. Vielleicht morgen«, sage ich.
»Warte, bis ich nach Hause komme, ja?«, sagt sie.
»Klar.« Wenn sie mich nicht vorher verhaften.
Meine Mutter gibt mir eine Tasse Kamillentee mit einer Dosis Schlafsirup und sofort werden meine Lider schwer. Sie verbindet meinen schlimmen Fuß, und Peeta bietet sich an, mich ins Bett zu bringen. Erst versuche ich mich an seine Schulter zu lehnen, aber ich bin so wacklig auf den Beinen, dass er mich einfach hochhebt und nach oben trägt. Er deckt mich zu und wünscht mir eine gute Nacht, doch ich fasse seine Hand und halte ihn fest. Eine Nebenwirkung von Schlafsirup ist, dass man Hemmungen verliert, als hätte man Schnaps getrunken, und ich weiß, dass ich meine Zunge hüten muss. Doch ich möchte nicht, dass er geht. Ich möchte sogar, dass er zu mir ins Bett kommt, dass er heute Nacht da ist, wenn die Albträume zuschlagen. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz benennen kann, weiß ich, dass ich ihn nicht darum bitten darf.
»Geh noch nicht. Nicht bevor ich einschlafe«, sage ich.
Peeta setzt sich an den Bettrand und wärmt meine Hand mit seinen Händen. »Dachte schon fast, du hättest dich anders entschieden. Als du nicht zum Abendessen kamst.«
Ich bin benebelt, aber ich kann mir denken, was er meint. Als der Zaun eingeschaltet wurde und ich nicht auftauchte und die Friedenswächter warteten, da dachte er, ich wäre abgehauen, womöglich mit Gale.
»Nein, das hätte ich dir erzählt«, sage ich. Ich ziehe seine Hand zu mir heran und lege meine Wange an seinen Handrücken. Ich atme den leichten Duft nach Zimt und Dill von den Broten ein, die er heute gebacken hat. Ich würde ihm gern von Bonnie und Twill erzählen, von dem Aufstand und der Vision von Distrikt 13, aber das ist zu gefährlich, und ich merke, wie ich abdrifte. Ich bringe nur noch einen einzigen Satz heraus. »Bleib bei mir.«
Während der Schlafsirup mich mit seinen Ranken in den Schlaf hinabzieht, höre ich noch, wie Peeta etwas zurückflüstert, aber ich verstehe es nicht richtig.
Meine Mutter lässt mich bis zum Mittag schlafen, dann weckt sie mich, damit sie meine Ferse untersuchen kann. Sie verordnet mir eine Woche Bettruhe, und ich widerspreche nicht, weil es mir so miserabel geht. Nicht nur wegen der Ferse und des Steißbeins. Mein ganzer Körper schmerzt vor Erschöpfung. Also lasse ich es zu, dass meine Mutter mich verarztet, mir das Frühstück ans Bett und eine zusätzliche Decke bringt. Dann liege ich nur da, schaue aus dem Fenster in den Winterhimmel, grübele darüber nach, wie um alles in der Welt die Geschichte ausgehen wird. Ich denke viel an Bonnie und Twill und an den Stapel weißer Brautkleider unten; ich frage mich, ob Thread wohl herausfindet, wie ich zurückgekommen bin, und ob er mich verhaften wird. Es ist komisch, denn er könnte mich auch einfach so verhaften, wegen früherer Vergehen, aber vielleicht braucht er irgendetwas Unwiderlegbares, weil ich ja jetzt die Siegerin bin. Und ich überlege, ob Präsident Snow wohl in Kontakt mit Thread steht. Den alten Cray hat er wohl kaum je offiziell wahrgenommen, aber gibt er Thread jetzt, da ich so ein landesweites Problem bin, ganz genaue Anweisungen, was zu tun ist? Oder handelt Thread in eigener Regie? Wie dem auch sei, ganz bestimmt wären sie sich darin einig, dass man mich hier im Distrikt innerhalb der Grenzen des Zauns einsperren muss. Selbst wenn ich eine Möglichkeit fände zu fliehen - zum Beispiel ein Seil an dem hohen Ast des Ahorns befestigen und auf die andere Seite klettern -, so könnte ich meine Familie und meine Freunde nicht mitnehmen. Außerdem habe ich Gale sowieso versprochen, zu bleiben und zu kämpfen.
Wenn es in den nächsten Tagen an die Tür klopft, zucke ich jedes Mal zusammen. Aber keine Friedenswächter tauchen auf, um mich zu verhaften, und allmählich legt sich die Anspannung. Und dann beruhigt es mich, als Peeta beiläufig erwähnt, dass der Zaun teilweise nicht mehr unter Strom steht, weil Trupps damit beschäftigt sind, den Maschendraht am Boden zu schließen. Offenbar denkt Thread, ich sei irgendwie unter dem Zaun hindurchgeschlüpft, trotz des lebensgefährlichen Stroms. So hat der Distrikt eine Verschnaufpause, und die Friedenswächter haben einmal etwas anderes zu tun, als Menschen zu quälen.
Peeta kommt jeden Tag vorbei, er bringt mir Käsebrötchen und hilft mir, an dem Familienbuch zu arbeiten. Es ist ein altes Stück aus Pergament und Leder. Eine naturheilkundige Vorfahrin mütterlicherseits hat es vor vielen Jahren angelegt. Seite für Seite sind darin Pflanzen in Tuschezeichnungen dargestellt, dazu die Beschreibung ihres medizinischen Nutzens. Mein Vater hat einen Teil über essbare Pflanzen hinzugefügt, mein Ratgeber, mit dem ich uns nach seinem Tod das Überleben gesichert habe. Ich wollte schon lange mein eigenes Wissen in dem Buch festhalten. Alles, was ich aus Erfahrung oder von Gale gelernt habe, und die Informationen, die ich beim Training für die Spiele aufgeschnappt habe. Ich habe es nicht getan, weil ich keine Künstlerin bin und die Bilder ganz genau gezeichnet sein müssen. Und an dieser Stelle kommt Peeta ins Spiel. Manche der Pflanzen kennt er schon, von anderen haben wir getrocknete Vorlagen, und wieder andere muss ich ihm beschreiben. Er fertigt Skizzen auf Schmierpapier an, bis ich zufrieden bin, dann darf er sie in das Buch übertragen. Anschließend schreibe ich sorgfältig alles auf, was ich über die jeweilige Pflanze weiß.
Es ist eine stille Arbeit, die meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und mich von den vielen Problemen ablenkt. Ich schaue gern seinen Händen zu, während er arbeitet, wie er eine weiße Seite mit ein paar Tuschestrichen zum Blühen bringt, wie er dem Buch, das bisher nur schwarz und gelblich war, Farbe verleiht. Wenn er sich konzentriert, nimmt sein Gesicht einen ganz bestimmten Ausdruck an. Sein sonst so gelassener Blick wird intensiv und fern, als wäre eine ganze Welt in ihm verborgen. Diesen Ausdruck habe ich schon öfter aufblitzen sehen: in der Arena oder wenn er zu einer Menschenmenge spricht oder als er in Distrikt 11 die Gewehre der Friedenswächter von mir wegschob. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Und ich kann kaum den Blick von seinen Wimpern wenden, die normalerweise nicht so auffallen, weil sie ganz hell sind. Doch von Nahem, wenn das Sonnenlicht ins Zimmer fällt, sind sie hellgolden und so lang, dass ich mich frage, wieso sie sich nicht verheddern, wenn er blinzelt.
Eines Nachmittags, als Peeta gerade eine Blüte schraffiert, schaut er so plötzlich auf, dass ich zusammenfahre, als hätte er mich dabei ertappt, wie ich ihn heimlich beobachte, was ich auf seltsame Weise vielleicht auch getan habe. Doch er sagt nur: »Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir etwas Normales zusammen machen.«
»Ja«, sage ich. Unsere ganze Beziehung ist durch die Spiele verdorben worden. »Normal« kam darin nicht vor. »Auch mal schön.«
Jeden Nachmittag trägt er mich nach unten, damit ich ein bisschen Abwechslung habe, und ich gehe allen damit auf die Nerven, dass ich den Fernseher einschalte. Normalerweise sehen wir nur fern, wenn es vorgeschrieben ist, weil die Mischung aus Propaganda und Darstellungen der Macht des Kapitols - zum Beispiel Ausschnitte von vierundsiebzig Jahren Hungerspielen - so abscheulich ist. Aber jetzt halte ich nach etwas Besonderem Ausschau. Nach dem Spotttölpel, auf den Bonnie und Twill all ihre Hoffnungen gründen. Mir ist klar, dass es wahrscheinlich idiotisch ist, aber dann möchte ich es auch widerlegen können. Und die Vorstellung von einem blühenden Distrikt 13 für immer aus meinen Gedanken verbannen.
Den ersten Hinweis entdecke ich in einem Bericht über die Dunklen Tage. Man sieht die schwelenden Überreste des Justizgebäudes in Distrikt 13, und ich erhasche so eben noch die schwarz-weiße Unterseite vom Flügel eines Spotttölpels, der oben rechts durch das Bild fliegt. Das ist aber noch kein Beweis. Es ist nur eine alte Aufnahme, die zu einer alten Geschichte gehört.
Ein paar Tage später jedoch fällt mir etwas anderes auf. Der Nachrichtensprecher liest eine Meldung über Grafitknappheit, welche sich auf die Produktion in Distrikt 3 auswirke. Es folgt ein Bericht, angeblich der Originalfilm einer Reporterin, die, in einen Schutzanzug gehüllt, vor den Ruinen des Justizgebäudes in Distrikt 13 steht. Durch ihre Maske hindurch berichtet sie, eine Untersuchung habe heute leider ergeben, dass die Minen in Distrikt 13 immer noch zu giftig seien, um sich ihnen zu nähern. Ende des Beitrags. Doch kurz vor dem Schnitt zurück zu dem Nachrichtensprecher sehe ich denselben Flügel desselben Spotttölpels aufblitzen, unverkennbar.
Die Reporterin wurde einfach in das alte Bildmaterial hineinmontiert. Sie ist überhaupt nicht in Distrikt 13. Und das wirft die Frage auf: Was ist dort?
12
Von da an fällt es mir schwerer, ruhig im Bett liegen zu bleiben. Ich will etwas tun, will mehr über Distrikt 13 herausfinden oder dabei helfen, das Kapitol zu stürzen. Stattdessen sitze ich da, stopfe Käsebrötchen in mich hinein und schaue Peeta beim Zeichnen zu. Hin und wieder kommt Haymitch vorbei und bringt Neuigkeiten aus der Stadt, immer schlechte. Noch mehr Menschen, die bestraft werden oder vor Hunger umfallen.
Der Winter ist allmählich auf dem Rückzug, als mein Fuß wieder einsatzfähig ist. Meine Mutter verordnet mir Übungen und ich darf schon ein bisschen allein laufen. Eines Nachts nehme ich mir beim Schlafengehen fest vor, am nächsten Morgen in die Stadt zu gehen, doch als ich aufwache, grinsen mich Venia, Octavia und Flavius an.
»Überraschung!«, kreischen sie. »Wir sind früher gekommen!«
Nach dem Peitschenschlag hatte Haymitch ihren Besuch bei mir um einige Monate verschoben, damit die Wunde verheilen konnte. Ich hatte frühestens in drei Wochen mit ihnen gerechnet. Aber ich tue so, als freute ich mich darüber, dass endlich das Fotoshooting für die Hochzeit stattfindet. Meine Mutter hat alle Kleider aufgehängt, sie sind also einsatzbereit, aber ehrlich gesagt, habe ich bisher noch kein einziges anprobiert.
Nach dem üblichen Gezeter über mein desolates Außeres machen die drei sich sofort an die Arbeit. Ihr Augenmerk gilt vor allem meinem Gesicht, obwohl ich finde, dass meine Mutter es ganz gut hinbekommen hat. Nur einen blassrosa Streifen habe ich noch über dem Wangenknochen. Nicht alle wissen von dem Peitschenschlag, also erzähle ich ihnen, ich sei auf dem Eis ausgerutscht und hätte mir die Wange aufgeratscht. Da wird mir bewusst, dass ich dieselbe Ausrede für die Fußverletzung benutzt habe, wegen der mir die hohen Absätze Probleme bereiten werden. Aber Flavius, Octavia und Venia sind von Natur aus gutgläubig, ich bin also auf der sicheren Seite.
Da ich nicht mehrere Wochen, sondern nur einige Stunden lang ohne Körperbehaarung sein muss, benutzen sie kein Wachs, sondern den Rasierer. Trotzdem muss ich in eine Wanne mit irgendeinem Zeug steigen, aber wenigstens stinkt es nicht, und ehe ich michs versehe, sind schon meine Frisur und mein Make-up dran. Wie immer haben sich die drei lauter Neuigkeiten zu erzählen, die ich versuche auszublenden. Aber dann macht Octavia eine Bemerkung, die mich aufhorchen lässt. Sie habe für eine Party keine Garnelen bekommen können, sagt sie, eigentlich nur nebenbei, trotzdem verblüfft es mich.
»Wieso konntest du keine Garnelen bekommen? Gibt es die zu dieser Jahreszeit nicht?«, frage ich.
»Ach, Katniss, schon seit Wochen sind keine Meeresfrüchte zu haben!«, sagt Octavia. »Weil das Wetter in Distrikt 4 so schlecht ist, weißt du.«
Mir schwirrt der Kopf. Keine Meeresfrüchte. Seit Wochen. Aus Distrikt 4. Die kaum verhohlene Wut der Menge während der Tour der Sieger. Und auf einmal bin ich mir ganz sicher, dass es in Distrikt 4 einen Aufstand gegeben hat.
Beiläufig frage ich, welche Härten dieser Winter noch mit sich gebracht hat. Sie sind es nicht gewohnt, auf etwas zu verzichten, deshalb ist es für sie schon bemerkenswert, wenn einmal etwas nicht zu haben ist. Bis ich bereit zum Ankleiden bin, haben sie mir so viel von den Schwierigkeiten vorgejammert, bestimmte Sachen zu bekommen - von Krebsfleisch über Musikchips bis hin zu Bändern -, dass ich mir ausrechnen kann, welche Distrikte sich möglicherweise im Aufstand befinden. Meeresfrüchte aus Distrikt 4. Elektrogeräte aus Distrikt 3. Und natürlich Stoffe aus Distrikt 8. Der Gedanke an eine Rebellion von solchem Ausmaß lässt mich schaudern vor Angst und Erregung.
Ich würde gern noch mehr Fragen stellen, aber da kommt Cinna, umarmt mich und begutachtet mein Make-up. Sofort fällt sein Blick auf die Narbe. Ich habe das Gefühl, dass er mir die Glatteis-Geschichte nicht so ganz abkauft, aber er sagt nichts dazu. Er pudert mein Gesicht noch ein wenig nach, und das bisschen, was man von dem Striemen noch sehen kann, verschwindet.
Unten ist das Wohnzimmer ausgeräumt und für die Aufnahmen ausgeleuchtet worden. Effie gefällt sich darin, alle herumzukommandieren und darauf zu achten, dass wir im Zeitplan bleiben. Das ist wohl auch gut so, denn es gibt sechs Brautkleider und auf jedes Kleid muss alles andere abgestimmt werden: Kopfbedeckung, Schuhe, Schmuck, Frisur, Make-up, Kulisse und Beleuchtung. Cremefarbene Spitze, rosa Rosen und Ringellocken. Elfenbeinfarbener Satin, Goldtattoos und grüne Blätter. Diamantenkleid, Juwelenschleier und Mondschein. Schwere weiße Seide, Ärmel vom Handgelenk bis zum Boden, Perlen. Sobald eine Aufnahme gelungen ist, bereiten wir schon die nächste vor. Ich komme mir vor wie ein Teig, der immer wieder geknetet und neu geformt wird. Meiner Mutter gelingt es, mir ein bisschen zu essen und ein paar Schluck Tee zu geben, während die anderen sich an mir zu schaffen machen, doch als alles erledigt ist, bin ich trotzdem ausgehungert und erschöpft. Ich hoffe, jetzt ein wenig Zeit mit Cinna verbringen zu können, aber Effie scheucht alle zur Tür hinaus, und ich muss mich mit dem Versprechen zu telefonieren begnügen.
Es ist Abend geworden, und von all den verrückten Schuhen tut mir der Fuß weh, also verwerfe ich die Idee, in die Stadt zu gehen. Stattdessen begebe ich mich nach oben, entferne die Make-up-Schichten und wasche Festiger und Farbe aus den Haaren, dann gehe ich wieder nach unten, um die Haare am Feuer trocknen zu lassen. Prim, die rechtzeitig von der Schule nach Hause gekommen ist, um die letzten beiden Kleider zu sehen, plaudert darüber mit meiner Mutter. Sie scheinen beide richtig zufrieden mit dem Fotoshooting zu sein. Als ich ins Bett falle, wird mir klar, dass sie glauben, mir könne jetzt nichts mehr passieren. Sie glauben, das Kapitol sieht mir mein Verhalten bei Gales Auspeitschung nach, denn für jemanden, der sowieso umgebracht werden soll, würde ja niemand so einen Aufwand treiben. Genau.
In meinem Albtraum trage ich das seidene Brautkleid, aber es ist zerrissen und matschverschmiert. Ich renne durch den Wald und dabei verfangen sich die langen Ärmel immer wieder in Dornen und Zweigen. Das Rudel der mutierten Tribute kommt immer näher, bis sie mich mit ihrem heißen Atem und ihren triefenden Lefzen überwältigen und ich schreiend erwache.
Weil es schon fast Morgen ist, versuche ich erst gar nicht, wieder einzuschlafen. Außerdem muss ich heute wirklich hier raus und mit jemandem reden. Gale wird im Bergwerk sein, unerreichbar. Aber ich muss mit Haymitch oder Peeta oder irgendjemandem die Last all dessen teilen, was ich seit dem Tag am See erlebt habe. Gesetzlose auf der Flucht, Zäune unter Strom, ein unabhängiger Distrikt 13, Lieferschwierigkeiten im Kapitol. Alles.
Ich frühstücke mit meiner Mutter und Prim und gehe dann hinaus auf der Suche nach jemandem, dem ich mich anvertrauen kann. Draußen ist es warm, eine Hoffnung auf Frühling liegt in der Luft. Frühling wäre bestimmt eine gute Zeit für einen Aufstand. Wenn der Winter überstanden ist, fühlen die Menschen sich nicht mehr so schutzlos. Peeta ist nicht zu Hause. Wahrscheinlich ist er bereits in der Stadt. Aber Haymitch steht zu meiner Überraschung um diese Zeit schon in der Küche. Ohne anzuklopfen, gehe ich hinein. Ich höre Hazelle im ersten Stock, sie wischt den Boden in dem jetzt blitzsauberen Haus. Haymitch ist nicht volltrunken, aber allzu nüchtern wirkt er auch nicht gerade. Die Gerüchte, dass Ripper ihre Geschäfte wieder aufgenommen hat, scheinen zu stimmen. Gerade denke ich, dass Haymitch sich lieber ins Bett legen sollte, als er einen Gang in die Stadt vorschlägt.
Haymitch und ich haben gelernt, in Stichworten miteinander zu sprechen. In wenigen Minuten bringe ich ihn auf den neuesten Stand und erfahre, dass es auch in den Distrikten 7 und 11 Aufstände gibt. Wenn ich mit meinen Annahmen richtig liege, hat fast die Hälfte der Distrikte zumindest versucht zu rebellieren.
»Meinst du immer noch, dass es hier nicht klappen würde?«, frage ich.
»Jetzt noch nicht. Die anderen Distrikte sind viel größer. Selbst wenn sich da die Hälfte der Leute in ihren Häusern verkriecht, haben die Rebellen eine Chance. Hier in 12 müssen schon alle mitmachen, sonst ist es zwecklos«, sagt er.
Daran habe ich noch nicht gedacht. Dass wir einfach nicht genug Leute sind. »Aber vielleicht irgendwann?«, beharre ich.
»Vielleicht. Aber wir sind klein, wir sind schwach, und wir entwickeln keine Atomwaffen«, sagt Haymitch mit leisem Sarkasmus. Meine Geschichte über Distrikt 13 hat keinen riesigen Eindruck auf ihn gemacht.
»Was glaubst du, was sie tun werden, Haymitch? Mit den aufständischen Distrikten?«, frage ich.
»Tja, du hast ja gehört, was sie in 8 getan haben. Du hast gesehen, was sie hier getan haben, und das ganz ohne Provokation«, sagt Haymitch. »Falls die Sache wirklich aus dem Ruder läuft, dann hätten sie bestimmt kein Problem damit, noch einen Distrikt zu vernichten, wie sie es mit 13 gemacht haben. Als abschreckendes Beispiel, verstehst du?«
»Dann glaubst du also, 13 ist wirklich zerstört worden? Aber Bonnie und Twill hatten doch recht mit der Aufnahme von dem Spotttölpel«, sage ich.
»Schon, aber was beweist das? Eigentlich gar nichts. Es könnte jede Menge Gründe dafür geben, dass sie altes Filmmaterial verwenden. Wahrscheinlich sieht es beeindruckender aus.
Und es ist auch viel einfacher, oder? Nur ein paar Knöpfe im Schneideraum drücken, anstatt den langen Flug dorthin zu machen und zu drehen«, sagt er. »Dass Distrikt 13 sich irgendwie wieder aufgerappelt hat und dass das Kapitol dabei wegschaut, klingt wie eins von diesen Gerüchten, an die sich Verzweifelte gern klammern.«
»Ich weiß. War nur so eine Hoffnung«, sage ich.
»Genau. Weil du verzweifelt bist«, sagt Haymitch.
Ich widerspreche nicht, denn natürlich hat er recht.
Prim kommt von der Schule nach Hause und sprudelt nur so über vor Aufregung. Die Lehrer in der Schule haben gesagt, dass es heute Abend Pflichtfernsehen gibt. »Bestimmt deine Fotoaufnahmen!«
»Das kann nicht sein, Prim. Die haben sie doch erst gestern gemacht«, erwidere ich.
»Das hat aber jemand gehört«, sagt sie.
Ich hoffe, dass sie sich irrt. Ich hatte noch keine Zeit, Gale darauf vorzubereiten. Seit der Auspeitschung sehe ich ihn nur, wenn er zu meiner Mutter kommt, damit sie nachschaut, wie seine Wunden verheilen. Häufig muss er sieben Tage die Woche im Bergwerk arbeiten. Wenn ich ihn einmal zurück in die Stadt begleitet habe und wir ein paar Minuten für uns hatten, habe ich herausgehört, dass die beginnenden Unruhen in Distrikt 12 durch Threads hartes Durchgreifen unterdrückt worden sind. Gale weiß, dass ich nicht mehr vorhabe zu fliehen. Aber er wird auch wissen, dass ich, wenn wir in 12 keinen Aufstand machen, Peetas Frau werden muss. Wie wird er es aufnehmen, wenn er mich im Fernsehen sieht, wie ich in prächtigen Brautkleidern posiere?
Als wir uns um halb acht vor dem Fernseher versammeln, stelle ich fest, dass Prim recht hat. Da ist tatsächlich Caesar Flickerman vor einer Menschenmenge am Trainingscenter und erzählt dem dankbaren Publikum von meiner bevorstehenden Hochzeit. Er präsentiert Cinna, der bei den Spielen wegen seiner Kostüme für mich über Nacht zum Star wurde, und nach einer Minute freundlichem Geplänkel wird unsere Aufmerksamkeit auf eine riesige Leinwand gelenkt.
Jetzt verstehe ich, wie sie es geschafft haben, mich gestern zu fotografieren und heute bereits die Sondersendung zu bringen. Ursprünglich hatte Cinna zwei Dutzend Brautkleider entworfen. Seitdem ist die Auswahl der Entwürfe immer kleiner geworden, die Kleider wurden geschneidert und die Accessoires ausgewählt. Anscheinend konnten die Leute im Kapitol in jedem Stadium über ihre Favoriten abstimmen. Als abschließender Höhepunkt werden Aufnahmen von mir in den endgültigen sechs Kleidern präsentiert, die sich garantiert im Handumdrehen in die Sendung einfügen ließen. Jede Aufnahme wird von der Menge bejubelt. Die Zuschauer kreischen und juchzen, wenn ihre Lieblingskleider gezeigt werden, andere Kleider buhen sie aus. Da die Leute abgestimmt und vermutlich auch Wetten abgeschlossen haben, sind sie an meinem Brautkleid hochinteressiert. Es ist ein absurdes Spektakel, wenn ich bedenke, dass ich mir noch nicht mal die Mühe gemacht habe, ein Kleid anzuprobieren, ehe die Kameras auftauchten. Caesar verkündet, dass man seine Stimme bis morgen zwölf Uhr mittags abgeben kann.
»Sorgen wir dafür, dass Katniss Everdeen mit Stil heiratet!«, brüllt er in die Menge. Ich will den Fernseher schon ausschal ten, aber da sagt Caesar, wir sollen dranbleiben für das nächste große Ereignis des Abends. »Genau, in diesem Jahr jähren sich die Hungerspiele zum fünfundsiebzigsten Mal, und das heißt, das dritte Jubel-Jubiläum steht bevor!«
»Was soll das?«, fragt Prim. »Es sind doch noch Monate bis dahin.«
Wir schauen zu unserer Mutter, deren Blick ernst und abwesend wirkt, als würde sie sich an etwas erinnern. »Wahrscheinlich wird die Karte verlesen.«
Die Nationalhymne ertönt, und als Präsident Snow die Bühne betritt, ist meine Kehle vor Ekel wie zugeschnürt. Ihm folgt ein Junge im weißen Anzug, der einen schlichten Holzkasten trägt. Die Hymne verklingt und Präsident Snow beginnt mit seiner Rede. Er erinnert uns an die Dunklen Tage, aus denen die Hungerspiele hervorgegangen sind. Als die Gesetze für die Spiele aufgestellt wurden, so sagt der Präsident, schrieben sie vor, dass alle fünfundzwanzig Jahre ein Jubel-Jubiläum gefeiert werden solle. Dann sollte es eine großartigere Version der Spiele geben, um die Erinnerung an jene aufzufrischen, die in den Aufständen der Distrikte getötet worden waren.
Deutlicher könnten seine Worte nicht sein, denn ich nehme an, dass sich mehrere Distrikte gerade im Aufstand befinden.
Dann erzählt Präsident Snow uns von den vergangenen Jubel-Jubiläen. »Am fünfundzwanzigsten Jahrestag, als Erinnerung für die Rebellen daran, dass ihre Kinder sterben mussten, weil sie den Weg der Gewalt beschritten hatten, wurde in jedem Distrikt eine Wahl abgehalten, in der darüber entschieden wurde, welche Tribute den jeweiligen Distrikt vertreten sollten.«
Ich frage mich, was für ein Gefühl das gewesen sein muss.
Die jungen Menschen auszusuchen, die gehen müssen. Von den eigenen Nachbarn ausgeliefert zu werden, das muss noch schlimmer sein, als wenn man bei der Ernte ausgelost wird.
»Beim fünfzigsten Jubiläum«, fährt der Präsident fort, »musste jeder Distrikt, als Erinnerung daran, dass für jeden Bewohner des Kapitols zwei Rebellen starben, doppelt so viele Tribute entsenden.«
Ich stelle mir vor, ich hätte es mit siebenundvierzig statt mit dreiundzwanzig Gegnern zu tun. Schlechtere Chancen, weniger Hoffnung und am Ende noch mehr Tote. Das war das Jahr, in dem Haymitch gewonnen hat …
»Ich hatte eine Freundin, die in dem Jahr gehen musste«, sagt meine Mutter leise. »Maysilee Donner. Ihre Eltern waren die Besitzer des Süßwarengeschäfts. Sie haben mir danach ihren Singvogel geschenkt. Einen Kanarienvogel.«
Prim und ich tauschen einen Blick. Es ist das erste Mal, dass wir von Maysilee Donner hören. Vielleicht, weil meine Mutter wusste, dass wir würden erfahren wollen, wie sie gestorben ist.
»Und jetzt begehen wir in allen Ehren das dritte Jubel-Jubiläum«, sagt der Präsident. Der kleine, weiß gekleidete Junge tritt vor, hält dem Präsidenten den Kasten hin und hebt den Deckel hoch. Wir sehen lauter vergilbte Briefumschläge in ordentlichen Reihen. Die, die sich das Prinzip des Jubel-Jubiläums ausgedacht haben, waren davon ausgegangen, dass die Hungerspiele ewig währen würden. Der Präsident nimmt einen Umschlag aus dem Kasten, auf dem deutlich eine »75« zu lesen ist. Er fährt mit dem Finger unter die Lasche und zieht eine kleine Karte heraus. Ohne zu zögern, liest er: »Am fünfündsiebzigsten Jahrestag werden als Erinnerung für die Rebellen daran, dass nicht einmal die Stärksten unter ihnen die Macht des Kapitols überwinden können, die männlichen und weiblichen Tribute aus dem bestehenden Kreis der Sieger ausgelost.«
Meine Mutter stößt einen leisen Schrei aus, und Prim verbirgt das Gesicht in den Händen, doch ich komme mir eher so vor wie jemand aus dem Publikum, das ich im Fernsehen sehe. Leicht verdattert. Was soll das heißen? Der bestehende Kreis der Sieger?
Dann begreife ich, was es heißt. Jedenfalls für mich. Distrikt 12 hat nur drei Sieger, aus denen man auswählen kann. Zwei männlich. Einer weiblich …
Ich muss wieder in die Arena.
13
Mein Körper reagiert schneller als mein Verstand, und ich renne zur Tür hinaus, über den Rasen in die Dunkelheit hinter dem Dorf der Sieger. Vom Wasser des durchweichten Bodens werden meine Strümpfe nass und ich spüre den schneidenden Wind, doch ich bleibe nicht stehen. Wohin? Wohin soll ich laufen? In den Wald natürlich. Ich bin schon am Zaun, als das Summen mich daran erinnert, wie sehr ich in der Falle sitze. Keuchend weiche ich zurück, mache auf dem Absatz kehrt und renne wieder los.
Kurz darauf befinde ich mich auf Händen und Knien im Keller eines der unbewohnten Häuser im Dorf der Sieger. Durch die Kellerschächte über mir scheinen schwache Streifen von Mondlicht herein. Mir ist kalt, ich bin nass und erschöpft, doch mein Fluchtversuch hat die Hysterie, die in mir aufsteigt, kein bisschen gedämpft. Wenn sie nicht herauskann, werde ich daran ersticken. Ich knülle mein T-Shirt vor der Brust zusammen, stopfe es mir in den Mund und schreie los. Ich weiß nicht, wie lange das so geht. Doch als ich aufhöre, habe ich fast keine Stimme mehr.
Auf der Seite zusammengekauert liege ich da und starre auf die Flecken des Mondlichts auf dem Zementboden. Zurück in die Arena. Zurück an den Ort der Albträume. Dort soll ich hin. Ich muss zugeben, dass ich das nicht habe kommen sehen.
Ich habe vieles andere gesehen. Wie ich öffentlich gedemütigt, gefoltert und hingerichtet werde. Wie ich durch die Wildnis fliehe, während Friedenswächter und Hovercrafts hinter mir her sind. Wie ich Peeta heirate und unsere Kinder in die Arena gezwungen werden. Doch nie habe ich daran gedacht, dass ich selbst wieder an den Spielen teilnehmen müsste. Warum nicht? Weil es das noch nie gegeben hat. Sieger sind bei der Ernte für immer aus dem Spiel. Das ist die Regel, wenn man gewonnen hat. Bis jetzt.
Ich finde eine Art Plane, wie man sie für Malerarbeiten benutzt, und nehme sie als Decke. In der Ferne ruft jemand meinen Namen. Doch im Moment erlaube ich mir, noch nicht mal an die zu denken, die ich am meisten liebe. Ich denke nur an mich. Und an das, was mir bevorsteht.
Die Plane ist steif, aber sie hält warm. Meine Muskeln entspannen sich, mein Herzschlag wird langsamer. Ich sehe den Holzkasten in den Händen des kleinen Jungen, sehe, wie Präsident Snow den vergilbten Umschlag herauszieht. Kann dies wirklich das Jubel-Jubiläum sein, wie es vor fünfundsiebzig Jahren niedergeschrieben wurde? Das kommt mir unwahrscheinlich vor. Es ist eine allzu passende Antwort auf die Probleme, denen sich das Kapitol heute gegenübersieht. Damit können sie mich loswerden und gleichzeitig alle Distrikte auf einen Streich bezwingen.
Ich habe die Stimme von Präsident Snow im Ohr. »Am fünfundsiebzigsten Jahrestag werden als Erinnerung für die Rebellen daran, dass nicht einmal die Stärksten unter ihnen die Macht des Kapitols überwinden können, die männlichen und weiblichen Tribute aus dem bestehenden Kreis der Sieger ausgelost.«
Ja, die Sieger sind unsere Stärksten. Sie haben die Arena überlebt und sich aus der Schlinge der Armut gewunden, die den Übrigen die Luft abschnürt. Sie, oder sollte ich sagen wir, sind die Verkörperung von Hoffnung, wo es keine Hoffnung gibt. Und jetzt sollen dreiundzwanzig von uns getötet werden, zum Zeichen, dass selbst diese Hoffnung eine Illusion war.
Ein Glück, dass ich erst im letzten Jahr gewonnen habe. Sonst würde ich alle anderen Sieger kennen, nicht nur aus dem Fernsehen, sondern weil sie bei allen Spielen zu Gast sind. Selbst wenn sie nicht als Mentoren arbeiten, wie Haymitch es immer muss, kommen die meisten von ihnen jedes Jahr zu diesem Ereignis ins Kapitol. Bestimmt sind viele von ihnen miteinander befreundet. Während es bei mir nur einen einzigen Freund geben wird, den ich womöglich töten muss - Peeta oder Haymitch. Peeta oder Haymitch!
Ich setze mich kerzengerade auf und werfe die Plane ab. Was habe ich da gerade gedacht? Eine Situation, in der ich Peeta oder Haymitch töten würde, ist völlig undenkbar. Aber einer von den beiden wird mit mir in der Arena sein, das ist eine Tatsache. Vielleicht haben sie sogar schon ausgehandelt, wer von ihnen gehen wird. Wenn doch der andere ausgelost wird, kann der eine freiwillig seinen Platz einnehmen. Ich weiß schon, wie es kommen wird. Peeta wird Haymitch bitten, ihn um jeden Preis mit mir in die Arena ziehen zu lassen. Um meinetwillen. Damit er mich beschützen kann.
Ich stolpere durch den Keller und suche nach einem Ausgang. Wie bin ich hier überhaupt hereingekommen? Ich taste mich die Treppe hinauf in die Küche und sehe, dass die Scheibe in der Tür eingeschlagen ist. Deshalb fühlt meine Hand sich also an, als ob sie blutet. Schnell laufe ich wieder hinaus in die Nacht, direkt zu Haymitchs Haus. Er sitzt allein am Küchentisch, eine halb leere Flasche Schnaps in einer Hand, das Messer in der anderen. Sturzbetrunken.
»Ah, da ist sie ja. Fix und fertig. Hast du endlich eins und eins zusammengezählt, Süße? Hast du kapiert, dass du da nicht allein reingehst? Und jetzt kommst du, um mich … was zu fragen?«, sagt er.
Ich gebe keine Antwort. Das Fenster steht weit offen, und der Wind ist so schneidend, als wäre ich draußen.
»Der Junge hatte es leichter, das gebe ich zu. Er war schneller hier, als ich die Flasche öffnen konnte. Hat mich um eine weitere Chance gebeten, in die Arena zu gehen. Aber was willst du mir schon sagen?« Er ahmt meine Stimme nach. »Geh an seiner statt, Haymitch, denn wenn schon, dann soll lieber Peeta den Rest seines Lebens erleben als du?«
Ich beiße mir auf die Lippe, denn jetzt, da er es ausgesprochen hat, muss ich mir eingestehen, dass ich genau das will. Dass Peeta lebt, selbst wenn es Haymitchs Tod bedeutet. Nein, das will ich nicht. Er ist natürlich ein grässlicher Kerl, aber er gehört jetzt zur Familie. Wieso bin ich hergekommen?, denke ich. Was will ich hier überhaupt?
»Ich bin gekommen, weil ich einen Drink brauche«, sage ich.
Haymitch prustet los und knallt die Flasche vor mir auf den Tisch. Ich wische mit dem Ärmel darüber und trinke ein paar Schlucke, bis mir die Luft wegbleibt. Es dauert eine Weile, bis ich wieder zu Atem komme, und selbst dann noch läuft mir das Wasser aus Augen und Nase. Aber in meinem Innern brennt der Alkohol wie Feuer und das ist ein gutes Gefühl.
»Vielleicht solltest du gehen«, sage ich sachlich und ziehe mir einen Stuhl heran. »Du verabscheust das Leben doch sowieso.«
»Wie wahr«, sagt Haymitch. »Und da ich letztes Mal versucht habe, dir das Leben zu retten … da ist es doch meine Pflicht, diesmal dem Jungen zu helfen.«
»Noch ein guter Grund«, sage ich, putze mir die Nase und hebe wieder die Flasche.
»Peeta argumentiert, dass ich, da ich mich für dich entschieden hatte, jetzt ihm einen Gefallen schulde. Egal, welchen. Und er will die Chance, wieder in die Arena zu gehen und dich zu beschützen«, sagt Haymitch.
Ich wusste es. In dieser Hinsicht ist Peeta ziemlich berechenbar. Während ich mich in dem Keller auf dem Boden gewälzt und nur an mich gedacht habe, war er hier und hat - auch nur an mich gedacht. Das Wort Scham reicht nicht aus, um das zu beschreiben, was ich empfinde. »Und wenn du hundert Leben hättest, du würdest ihn immer noch nicht verdienen, weißt du das?«, sagt Haymitch.
»Jaja«, sage ich schroff. »Keine Frage, er ist der Beste von uns dreien. Und, was willst du jetzt machen?«
»Ich weiß nicht.« Haymitch seufzt. »Vielleicht mit dir in die Arena gehen, wenn ich kann. Es spielt keine Rolle, ob bei der Ernte mein Name gezogen wird. Er wird sich einfach freiwillig melden.«
Eine Weile sitzen wir schweigend da. »Es war schlimm für dich in der Arena, oder? Wo du doch alle kennst«, sage ich.
»Ach, ich glaub, wir können beruhigt annehmen, dass es überall unerträglich ist, wo ich bin.« Er macht eine Kopfbewegung zu der Flasche. »Kann ich die jetzt mal wiederhaben?«
»Nein«, sage ich und schlinge die Arme darum. Haymitch holt eine weitere Flasche unter dem Tisch hervor und öffnet sie. Doch mir wird klar, dass ich nicht nur zum Trinken gekommen bin. Da ist noch etwas, das ich von Haymitch will. »Also gut, ich weiß jetzt, worum ich dich bitten will«, sage ich. »Wenn Peeta und ich bei den Spielen mitmachen, dann versuchen wir diesmal, ihm das Leben zu retten.«
Irgendetwas flackert in seinen blutunterlaufenen Augen auf. Schmerz.
»Wie du schon gesagt hast, schlimm wird es so oder so. Und ganz egal, was Peeta will, diesmal ist er dran. Das sind wir ihm beide schuldig.« Meine Stimme nimmt einen flehenden Ton an. »Außerdem hasst mich das Kapitol so sehr, ich bin sowieso schon so gut wie tot. Er hat vielleicht noch eine Chance. Bitte, Haymitch. Sag, dass du mir hilfst.«
Mit gerunzelter Stirn schaut er auf seine Flasche, denkt über meine Worte nach. »Also gut«, sagt er schließlich.
»Danke«, sage ich. Jetzt müsste ich zu Peeta gehen, doch ich will nicht. In meinem Kopf dreht sich alles vom Alkohol, und ich bin so fertig - wer weiß, wozu er mich überreden könnte? Nein, jetzt muss ich nach Hause und meiner Mutter und Prim gegenübertreten.
Als ich die Stufen zu unserem Haus hinauftaumele, geht die Tür auf und Gale nimmt mich in die Arme. »Ich hatte unrecht. Wir hätten abhauen sollen, als du es gesagt hast«, flüstert er.
»Nein«, sage ich. Ich kann kaum geradeaus gucken, und immer wieder schwappt Schnaps aus meiner Flasche und läuft Gale hinten über die Jacke, aber das scheint ihm nichts auszumachen.
»Es ist nicht zu spät«, sagt er.
Über seine Schulter hinweg sehe ich meine Mutter und Prim in der Tür, die sich in den Armen halten. Wir laufen weg. Sie sterben. Und jetzt muss ich auch Peeta beschützen. Damit ist das Thema vom Tisch. »Doch, es ist zu spät.« Meine Knie geben nach und er hält mich. Als der Alkohol mein Denken überwältigt, höre ich die Glasflasche klirrend zu Boden fallen. Es erscheint mir passend, denn ganz offensichtlich habe ich nichts mehr im Griff.
Als ich wieder aufwache, schaffe ich es gerade noch zur Toilette, bevor mir der Schnaps wieder hochkommt. Er brennt genauso wie beim Runterschlucken und schmeckt doppelt so übel. Nachdem ich mich übergeben habe, zittere und schwitze ich, aber wenigstens ist jetzt der größte Teil von dem Zeug wieder draußen. Trotzdem ist so viel in meinem Blut gelandet, dass ich pochende Kopfschmerzen habe, einen ausgetrockneten Mund und ein heißes Gefühl im Magen.
Ich drehe die Dusche auf und stelle mich eine Minute unter den warmen Regen, bis ich merke, dass ich immer noch in Unterwäsche bin. Meine Mutter hat mir wohl nur die schmutzige Oberbekleidung ausgezogen und mich dann ins Bett gesteckt. Ich werfe die nasse Unterwäsche ins Waschbecken und kippe mir Shampoo auf den Kopf. Meine Hände brennen und da sehe ich die kleinen, gleichmäßigen Schnitte in der einen Hand und an der Seite der anderen. Ich erinnere mich dunkel daran, dass ich gestern Nacht eine Fensterscheibe eingeschlagen habe. Ich schrubbe mich von Kopf bis Fuß ab und halte nur inne, um mich mitten in der Dusche erneut zu übergeben. Es ist hauptsächlich Galle, die zusammen mit dem süß duftenden Schaum im Abfluss verschwindet.
Als ich endlich sauber bin, ziehe ich den Bademantel über und gehe wieder ins Bett, obwohl ich klatschnasse Haare habe. Ich krieche unter die Decke und denke, dass es sich so anfühlen muss, wenn man eine Vergiftung hat. Als ich Schritte auf der Treppe höre, kommt meine Panik von gestern Nacht zurück. Ich bin nicht dafür gewappnet, meine Mutter und Prim zu sehen. Ich muss mich zusammenreißen, um ruhig und zuversichtlich zu wirken, so wie beim Abschied am Tag der letzten Ernte. Ich muss stark sein. Mühsam setze ich mich auf, streiche mir die nassen Haare von den pochenden Schläfen und reiße mich zusammen. Sie erscheinen mit Tee und Toast und sorgenvollen Gesichtern in der Tür. Ich öffne den Mund zu einer witzigen Bemerkung und breche in Tränen aus.
So viel zum Thema Starksein.
Meine Mutter setzt sich auf den Bettrand und Prim schmiegt sich an mich, und sie halten mich, trösten mich leise, bis ich mich einigermaßen ausgeweint habe. Dann holt Prim ein Handtuch und trocknet mir die Haare ab, kämmt die Knoten heraus, während meine Mutter mir Tee und Toast aufdrängt. Sie ziehen mir einen warmen Schlafanzug an und legen mir noch mehr Decken aufs Bett und ich dämmere wieder ein.
Als ich aufwache, verrät mir das Licht, dass es spät am Nachmittag ist. Auf meinem Nachttisch steht ein Glas Wasser und ich stürze es durstig hinunter. Ich fühle mich immer noch wackelig im Magen und im Kopf, aber viel besser als vorher. Ich stehe auf, ziehe mich an und flechte die Haare zu einem Zopf. Bevor ich nach unten gehe, bleibe ich auf der Treppe stehen. Ich schäme mich ein wenig dafür, wie ich auf die Neuigkeit vom Jubel-Jubiläum reagiert habe. Meine ziellose Flucht, die Sauferei mit Haymitch, die Tränen. Unter den Umständen ist es wohl in Ordnung, dass ich mich einen Tag habe gehen lassen. Trotzdem bin ich froh, dass keine Kamera in der Nähe war.
Unten umarmen meine Mutter und Prim mich abermals, doch sie wirken nicht übertrieben bewegt. Ich weiß, dass sie sich beherrschen, um es mir leichter zu machen. Wenn ich Prim ins Gesicht sehe, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie dasselbe schwache kleine Mädchen ist, das ich vor neun Monaten am Tag der Ernte zurückgelassen habe. Diese Tortur und all das, was danach kam - die Grausamkeiten im Distrikt, der Aufmarsch der Kranken, die sie jetzt häufig selbst behandelt, wenn meine Mutter alle Hände voll zu tun hat -, hat sie um Jahre altern lassen. Sie ist auch ganz schön gewachsen; wir sind jetzt fast gleich groß, aber das ist es nicht, was sie so viel älter erscheinen lässt.
Meine Mutter schöpft mir Brühe in einen Becher und ich bitte sie um einen zweiten Becher für Haymitch. Dann gehe ich über den Rasen zu seinem Haus. Er ist gerade erst aufgewacht und nimmt den Becher kommentarlos entgegen. Beinahe friedlich sitzen wir da, nippen unsere Brühe und schauen durch sein Wohnzimmerfenster zu, wie die Sonne untergeht. Im Stockwerk über uns höre ich jemanden herumlaufen und nehme an, dass es Hazelle ist, doch ein paar Minuten später kommt Peeta herunter. Mit einer endgültigen Geste wirft er einen Pappkarton mit leeren Schnapsflaschen auf den Tisch.
»So, das hätten wir«, sagt er.
Haymitch braucht seine gesamte Energie, um den Blick auf die leeren Flaschen zu richten, also übernehme ich das Reden. »Was hätten wir?«
»Ich hab den ganzen Schnaps weggekippt«, sagt Peeta.
Das scheint Haymitch aus seiner Starre zu reißen, ungläubig wühlt er in dem Karton. »Du hast was?«
»Ich hab alles weggekippt«, sagt Peeta.
»Er kauft sich doch einfach neuen«, sage ich.
»Das wird er nicht«, sagt Peeta. »Ich hab heute Morgen Ripper ausfindig gemacht und ihr gesagt, ich zeige sie an, sobald sie einem von euch beiden was verkauft. Sicherheitshalber hab ich ihr auch was gezahlt, aber ich glaube nicht, dass sie scharf darauf ist, wieder von den Friedenswächtern geschnappt zu werden.«
Haymitch holt mit seinem Messer aus, doch Peeta wehrt es so mühelos ab, dass es erbärmlich wirkt. Wut steigt in mir auf. »Was geht es dich an, was er macht?«
»Das geht mich sogar sehr viel an. Ganz gleich, wie es ausgeht, zwei von uns müssen in die Arena und der Dritte wird Mentor sein. Wir können uns in diesem Team keine Säufer leisten. Dich schon gar nicht, Katniss«, sagt Peeta zu mir.
»Was?«, stoße ich empört hervor. Es würde überzeugender klingen, wenn ich nicht immer noch so verkatert wäre. »Gestern Nacht war ich zum ersten Mal in meinem Leben betrunken.«
»Ja, und schau dir an, in was für einem Zustand du bist«, sagt Peeta.
Ich weiß nicht, was ich von meiner ersten Begegnung mit Peeta nach der Verkündung erwartet hatte. Ein paar Umarmungen und Küsse. Vielleicht ein wenig Trost. Nicht das hier. Ich wende mich an Haymitch. »Keine Angst, ich besorg dir schon was zu trinken.«
»Dann zeige ich euch beide an und ihr könnt am Pranger ausnüchtern«, sagt Peeta.
»Was soll das?«, fragt Haymitch.
»Zwei von uns werden aus dem Kapitol zurückkommen. Ein Mentor und ein Sieger«, sagt Peeta. »Effie schickt mir Aufnahmen aller lebenden Sieger. Wir werden uns ihre Spiele anschauen und alles Menschenmögliche darüber lernen, wie sie kämpfen. Wir werden an Gewicht zulegen und stark werden. Wir werden uns aufführen wie die Karrieros. Und einer von uns wird wieder gewinnen, ob es euch beiden passt oder nicht!« Er saust aus dem Zimmer und knallt die Haustür hinter sich zu.
Haymitch und ich zucken zusammen.
»Ich kann selbstgerechte Menschen nicht leiden«, sage ich.
»Wer redet hier von leiden können?«, sagt Haymitch und saugt den letzten Rest aus den leeren Flaschen.
»Wenn es nach ihm geht, sollen wir beide nach Hause zurückkehren, du und ich«, sage ich.
»Tja, dann ist er der Gelackmeierte«, sagt Haymitch.
Doch nach ein paar Tagen erklären wir uns einverstanden, die Karrieros zu spielen, denn das ist die beste Methode, auch Peeta einzustimmen. Jeden Abend schauen wir uns die alten Zusammenfassungen der vergangenen Spiele und ihre Sieger an. Mir wird bewusst, dass wir auf der Tour der Sieger keinen von ihnen kennengelernt haben, was mir im Nachhinein merkwürdig vorkommt. Als ich das erwähne, sagt Haymitch, Präsident Snow wollte auf keinen Fall zeigen, wie Peeta und ich - vor allem ich - uns mit anderen Siegern in möglicherweise aufständischen Distrikten verbünden. Sieger haben einen besonderen Status, und wenn sie meinen offenen Ungehorsam gegen das Kapitol unterstützt hätten, wäre das politisch gefährlich gewesen. Mir wird bewusst, dass einige unserer Gegner schon betagt sein könnten, was einerseits traurig ist, andererseits beruhigend. Peeta macht ausgiebig Notizen, Haymitch liefert Informationen über die Persönlichkeit der Sieger, und langsam lernen wir die Konkurrenz kennen.
Jeden Morgen machen wir Übungen, um unsere Körper zu trainieren. Wir laufen, heben Gewichte und dehnen unsere Muskeln. Nachmittags üben wir uns in Kampftechniken, im Messerwerfen und Ringen; ich bringe ihnen sogar bei, auf Bäume zu klettern. Offiziell sollen die Tribute nicht trainieren, aber niemand versucht uns davon abzuhalten. Selbst in den gewöhnlichen Jahren zeigt sich, dass die Tribute aus den Distrikten 1, 2 und 4 mit dem Speer und mit dem Schwert umgehen können. Dagegen ist das hier gar nichts.
Nach so vielen Jahren des schlechten Lebenswandels will Haymitchs Körper sich nicht erholen. Er hat immer noch erstaunliche Kräfte, aber wenn er nur ein kleines bisschen läuft, gerät er gleich außer Atem. Und man sollte doch meinen, dass jemand, der jede Nacht mit einem Messer schläft, in der Lage sein sollte, eine Hauswand damit zu treffen, aber seine Hände zittern so schlimm, dass es Wochen dauert, bis er wenigstens das zustande bringt.
Peeta und mir dagegen bekommt der neue Tagesablauf sehr gut. So habe ich etwas zu tun. So haben wir alle etwas zu tun, etwas anderes, als uns geschlagen zu geben. Meine Mutter stellt unsere Ernährung um, damit wir zunehmen. Prim behandelt unsere geschundenen Muskeln. Madge stibitzt für uns die Zeitungen, die das Kapitol ihrem Vater schickt. Bei den Prognosen, wer der Sieger der Sieger wird, gehören wir zu den Favoriten. Selbst Gale taucht sonntags auf, obwohl er weder Peeta noch Haymitch ins Herz geschlossen hat, und zeigt uns alles, was er über das Fallenstellen weiß. Für mich ist es merkwürdig, mit Peeta und Gale gleichzeitig zu reden, aber die beiden scheinen ihre Konkurrenz um mich beiseitelassen zu können.
Eines Abends, als ich Gale zurück in die Stadt begleite, gibt er sogar zu: »Zu dumm, dass es so schwer ist, ihn zu hassen.«
»Wem sagst du das«, antworte ich. »Wenn ich ihn in der Arena einfach hätte hassen können, hätten wir jetzt nicht so ein Chaos. Dann wäre er tot und ich eine glückliche kleine Siegerin, ganz allein.«
»Und wo wären wir dann, Katniss?«, fragt Gale.
Ich zögere, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, wo wäre ich mit meinem angeblichen Cousin, der nicht mein Cousin wäre, wenn es Peeta nicht gäbe? Hätte er mich trotzdem geküsst und hätte ich seinen Kuss erwidert, wenn ich frei gewesen wäre? Hätte ich mich ihm geöffnet, wenn ich mich durch Geld und Lebensmittel in Sicherheit gewiegt hätte, wenn ich an die Illusion von Unverwundbarkeit geglaubt hätte, wie man es als Sieger unter anderen Umständen tun könnte? Doch auch dann hätte die Ernte über uns, über unseren Kindern gelauert. Ganz gleich, was ich gewollt hätte …
»Auf der Jagd. Wie jeden Sonntag«, sage ich. Ich weiß, dass er die Frage nicht wörtlich gemeint hat, aber mehr als das kann ich nicht sagen, wenn ich ehrlich sein will. Gale weiß, dass ich ihn Peeta vorgezogen habe, als ich nicht weggelaufen bin. Ich sehe keinen Sinn darin, über das zu reden, was hätte sein können. Selbst wenn ich Peeta in der Arena getötet hätte, würde ich niemanden heiraten wollen. Ich habe mich nur verlobt, um Leben zu retten, und das ist nach hinten losgegangen.
Auf jeden Fall habe ich Angst, dass ein Gefühlsausbruch Gale zu einer drastischen Handlung treiben könnte. Dass er zum Beispiel einen Aufstand in den Minen anzetteln könnte. Denn, wie Haymitch sagt, dafür ist Distrikt 12 noch nicht bereit. Womöglich sogar noch weniger als vor der Verkündung des Jubel-Jubiläums, denn am Morgen darauf sind weitere hundert Friedenswächter mit dem Zug angekommen.
Da ich nicht vorhabe, ein zweites Mal lebend aus der Arena herauszukommen, ist es gut, wenn Gale mich so bald wie möglich loslässt. Nach der Ernte möchte ich ihm ein, zwei Sachen sagen, wenn sie uns eine Stunde zum Abschiednehmen gewähren. Er soll wissen, wie wichtig er all die Jahre für mich war. Wie viel besser mein Leben war, weil ich ihn gekannt habe. Und ihn geliebt habe, wenn auch nur auf die eingeschränkte Art, zu der ich fähig bin.
Aber dazu soll ich keine Gelegenheit bekommen.
Am Tag der Ernte ist es heiß und schwül. Schwitzend und schweigend warten die Bewohner von Distrikt 12 auf dem Platz, während Maschinengewehre auf sie gerichtet sind. Ich stehe allein in einer kleinen abgesperrten Ecke, Peeta und Haymitch neben mir, auch sie eingepfercht. Die Ernte dauert nur eine Minute. Effie mit einer metallic glänzenden Goldperücke lässt den üblichen Schwung vermissen. Sie muss die Loskugel der Mädchen eine ganze Weile herumdrehen, ehe sie den einzigen Zettel herauszieht, auf dem, wie alle wissen, mein Name steht. Dann erwischt sie Haymitchs Namen. Er hat kaum Zeit, mir einen unglücklichen Blick zuzuwerfen, da hat Peeta sich schon freiwillig gemeldet.
Wir werden sofort ins Justizgebäude geführt, wo der Oberste Friedenswächter Thread auf uns wartet. »Neues Verfahren«, sagt er mit einem Lächeln. Wir werden zur Hintertür hinausgebracht und dann mit einem Wagen zum Bahnhof gefahren. Keine Kameras auf dem Bahnsteig, keine Zuschauer, die uns verabschieden. Haymitch und Effie tauchen auf, begleitet von Wachen. Friedenswächter scheuchen uns alle in den Zug und knallen die Türen zu. Die Räder setzen sich in Bewegung.
Und mir bleibt nichts anderes übrig, als aus dem Fenster zu starren, während Distrikt 12 aus meiner Sicht verschwindet und der Abschied auf meinen Lippen hängen bleib
14
Ich bleibe noch lange am Fenster stehen, auch als sich schon längst der Wald zwischen mich und meine Heimat geschoben hat. Diesmal habe ich nicht die geringste Hoffnung auf Rückkehr. Damals, vor meinen ersten Spielen, hatte ich Prim versprochen, dass ich alles tun würde, um zu gewinnen, aber nun habe ich mir selbst geschworen, alles zu tun, damit Peeta am Leben bleibt. Diesmal wird es kein Zurück geben.
Ich hatte mir sogar schon letzte Worte an meine Angehörigen zurechtgelegt. Hatte mir überlegt, wie ich die Türen am besten verschließen und meine Lieben voller Trauer, aber in Sicherheit hätte zurücklassen können. Doch auch das hat das Kapitol mir gestohlen.
»Wir schreiben ihnen, Katniss«, sagt Peeta hinter mir. »Das ist bestimmt sowieso besser. Dann haben sie etwas von uns, woran sie sich festhalten können. Haymitch wird die Briefe für uns überbringen, falls … sie überbracht werden müssen.«
Ich nicke. Dann gehe ich auf direktem Weg in mein Abteil und setze mich aufs Bett. Ich weiß, dass ich diese Briefe nie schreiben werde. Wie die Rede, die ich niederzuschreiben versucht habe, um Rue und Thresh in Distrikt 11 zu ehren. In meinem Kopf und auch als ich zu der Menge sprach, war alles klar, aber aus dem Stift wollten die Worte einfach nicht herausfließen. Abgesehen davon mussten diese Worte von Umarmungen und Küssen begleitet werden, ich müsste Prim dabei übers Haar fahren, Gale übers Gesicht streichen, Madge die Hand drücken. Unmöglich können sie zusammen mit einer Holzkiste überbracht werden, in der mein erkalteter steifer Körper liegt.
Ich bin zu traurig, um zu weinen. Ich will mich nur noch auf dem Bett zusammenkauern und schlafen, bis wir morgen früh das Kapitol erreichen. Aber ich habe eine Mission. Nein, mehr als eine Mission. Es ist mein Letzter Wille. Peeta retten. So unwahrscheinlich es angesichts der Wut des Kapitols auch scheinen mag, dass mir das gelingt, so wichtig ist es, dass ich alles gebe. Und das kann ich nur, wenn ich meinen Lieben zu Hause nicht länger nachtrauere. Lass sie los, sage ich mir. Sag Lebewohl und vergiss sie. Ich gebe mein Bestes, denke an jeden Einzelnen, entlasse sie wie Vögel aus den schützenden Käfigen in mir und verschließe die Türen, damit sie nicht zurückkönnen.
Als Effie anklopft und mich zum Abendessen ruft, fühle ich mich leer. Aber diese Leichtigkeit kommt mir nicht ganz ungelegen.
Die Stimmung beim Essen ist gedrückt. So gedrückt, dass lange Zeit überhaupt niemand etwas sagt und das Schweigen nur durch das Abräumen des einen Gangs und das Auftragen des nächsten unterbrochen wird. Eine kalte passierte Gemüsesuppe. Fischfrikadellen in Limonencreme. Diese Hühnchen in Orangen-Sahne-Soße, dazu Wildreis und Brunnenkresse. Schokoladenpudding, garniert mit Kirschen.
Ab und zu versuchen Peeta und Effie eine Unterhaltung in Gang zu bringen, die aber bald erstirbt.
»Ich finde deine neue Frisur toll«, sagt Peeta.
»Danke. Sie sollte extra zu Katniss’ Brosche passen. Wenn wir noch ein goldenes Armkettchen für dich finden und für Haymitch vielleicht einen goldenen Armreif oder so was, dann sehen wir aus wie ein Team, dachte ich«, erklärt Effie.
Offenbar weiß sie nicht, dass meine Spotttölpelbrosche inzwischen den Rebellen als Erkennungszeichen dient. Zumindest in Distrikt 8. Im Kapitol ist der Spotttölpel immer noch eine nette Erinnerung an eine besonders aufregende Ausgabe der Hungerspiele. Was auch sonst? Echte Rebellen tragen ihre geheimen Erkennungszeichen doch nicht auf etwas so Beständigem wie einem Schmuckstück. Sie prägen sie in ein Stück Brot, das notfalls binnen einer Sekunde aufgegessen werden kann.
»Ich halte das für eine großartige Idee«, sagt Peeta. »Was meinst du, Haymitch?«
»Von mir aus«, sagt Haymitch. Er verkneift sich das Trinken, aber ich weiß, dass er es nur zu gern täte. Als Effie bemerkt, wie viel Kraft es ihn kostet, hat sie auch ihr eigenes Glas Wein abräumen lassen, aber Haymitch geht trotzdem auf dem Zahnfleisch. Wäre er selbst der Tribut, dann wäre er Peeta nichts schuldig und könnte sich nach Herzenslust betrinken. So jedoch muss er alles daransetzen, dass Peeta in einer Arena überlebt, in der es von alten Freunden wimmelt, und wahrscheinlich wird er scheitern.
»Vielleicht können wir für dich ja auch eine Perücke bekommen?«, sage ich und bemühe mich, ungezwungen zu klingen. Haymitch schleudert mir nur einen Blick zu, der besagt, dass ich ihn in Ruhe lassen soll, und wir essen schweigend unseren Pudding auf.
»Wollen wir uns jetzt die Zusammenfassung der Ernten anschauen?«, fragt Effie in die Runde, während sie sich mit einer weißen Leinenserviette die Mundwinkel abtupft.
Peeta geht hinaus, um seine Notizen über die noch lebenden Sieger zu holen, und wir versammeln uns in dem Abteil mit dem Fernseher, um zu sehen, mit wem wir es in der Arena zu tun bekommen. Die Hymne erklingt und die alljährliche Zusammenfassung der Erntezeremonien in den zwölf Distrikten beginnt.
Die Geschichte der Spiele weist fünfundsiebzig Sieger aus. Neunundfünfzig von ihnen sind noch am Leben. Ich erkenne viele der Gesichter wieder, entweder weil ich sie bei früheren Spielen als Tribute oder Mentoren gesehen habe, oder von den Siegervideos, die wir uns vor Kurzem angeschaut haben. Manche Sieger sind so alt oder von Krankheit, Drogen und Alkohol derart gezeichnet, dass ich sie nicht einordnen kann. Wie zu erwarten, stellen die Karrieretribute aus den Distrikten 1, 2 und 4 die stärkste Gruppe. Doch immerhin kann jeder Distrikt einen weiblichen und einen männlichen Sieger vorweisen.
Die Ernten sind rasch vorbei. Peeta macht in seinem Notizblock hinter die Namen der Ausgelosten eifrig Sternchen. Haymitch schaut mit ausdruckslosem Gesicht zu, wie seine Freunde hervortreten und auf die Bühne steigen. Effie gibt leise, bekümmerte Kommentare von sich wie »Oh nein, nicht Cecelia« oder »Na, Chaff hat ja noch nie einen Kampf ausgelassen« und seufzt häufig auf.
Ich für meinen Teil versuche mir die anderen Tribute, so gut es geht, einzuprägen, aber wie letztes Jahr bleiben nur ein paar Gesichter hängen. Aus Distrikt 1 kommt das Geschwisterpaar, klassische Schönheiten, sie gewannen die Spiele in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, als ich noch klein war. Brutus, ein Freiwilliger aus Distrikt 2, der mindestens vierzig sein muss und es augenscheinlich gar nicht erwarten kann, wieder in die Arena zu kommen. Finnick, der hübsche Junge aus Distrikt 4 mit dem bronzefarbenen Haar, der vor zehn Jahren im Alter von 14 zum Sieger gekrönt wurde. Ebenfalls in Distrikt 4 wird eine hysterische junge Frau mit wallendem braunen Haar ausgelost, jedoch rasch durch eine Freiwillige ersetzt, eine etwa Achtzigjährige, die einen Gehstock braucht, um zur Bühne zu kommen. Dann ist da noch Johanna Mason, die einzige überlebende Siegerin aus Distrikt 7, die vor einigen Jahren gewann, indem sie so tat, als könnte sie keiner Fliege etwas zuleide tun. Die Frau aus Distrikt 8, die Effie Cecelia nennt, sieht aus wie dreißig und muss sich von drei Kindern lösen, die sich an sie klammern. Chaff, ein Mann aus Distrikt 11, von dem ich weiß, dass er zu Haymitchs engen Freunden gehört, ist auch dabei.
Ich werde aufgerufen, dann Haymitch. Und Peeta meldet sich freiwillig. Die Sprecherin bekommt eine weinerliche Stimme, weil die Chancen mal wieder schlecht stehen für uns, das tragische Liebespaar aus Distrikt 12. Dann reißt sie sich zusammen und verkündet allen, sie gehe jede Wette ein, dies würden »die besten Spiele aller Zeiten!«.
Wortlos verlässt Haymitch das Abteil. Effie macht noch ein paar zusammenhanglose Kommentare über diesen und jenen Tribut und sagt dann Gute Nacht. Ich sitze nur da und sehe Peeta zu, wie er die Seiten der Sieger herausreißt, die nicht ausgelost wurden.
»Warum legst du dich nicht ein bisschen hin?«, fragt er.
Weil ich mit den Albträumen nicht fertigwerde. Nicht ohne dich, denke ich. Und heute Nacht werde ich mit Sicherheit entsetzliche Albträume haben. Aber ich kann Peeta schlecht fragen, ob er bei mir schläft. Wir haben uns kaum berührt seit dem Abend, an dem Gale ausgepeitscht wurde. »Was hast du vor?«, frage ich.
»Ich will meine Notizen noch mal durchgehen. Mir ein genaues Bild machen, mit wem wir es zu tun bekommen. Morgen früh können wir das Ganze besprechen. Geh schlafen, Katniss«, sagt er.
Also gehe ich schlafen und wache natürlich nach wenigen Stunden aus einem Albtraum auf, in dem die alte Frau aus Distrikt 4 sich in ein großes Nagetier verwandelt und an meinem Gesicht knabbert. Ich muss geschrien haben, aber niemand kommt. Nicht Peeta, nicht mal einer von den Dienern des Kapitols. Um die Gänsehaut, die über meinen Körper kriecht, zu vertreiben, ziehe ich einen Bademantel über. Ich kann unmöglich in meinem Abteil bleiben, deshalb beschließe ich, jemanden aufzutreiben, der mir einen Tee oder Kakao oder sonst was macht. Vielleicht ist Haymitch ja noch wach. Er schläft bestimmt nicht.
Bei einem Diener bestelle ich eine warme Milch, das Beruhigendste, was mir einfällt. Ich höre Geräusche aus dem Fernsehabteil, gehe hinein, und da ist Peeta. Neben ihm auf dem Sofa steht die Kiste voller Videos mit Aufzeichnungen früherer Hungerspiele, die Effie zusammengestellt hat. Ich erkenne die Folge, als Brutus Sieger wurde.
Als Peeta mich sieht, steht er auf und holt das Band heraus. »Konntest du nicht schlafen?«
»Nicht sehr lange«, sage ich. Ich muss wieder an die alte Frau denken, die sich in ein Nagetier verwandelt hat, und ziehe den Bademantel fester um mich.
»Möchtest du darüber reden?«, fragt er. Manchmal hilft das, aber ich schüttele nur den Kopf und fühle mich schwach, weil ich schon jetzt von Leuten heimgesucht werde, mit denen ich noch gar nicht gekämpft habe.
Als Peeta die Arme ausstreckt, lasse ich mich sofort hineinfallen. Es ist das erste Mal seit der Verkündung des Jubel-Jubiläums, dass er mir irgendeine Art von Zuwendung gewährt. Bisher war er eher ein sehr strenger Trainer gewesen, der Haymitch und mich ständig angetrieben und gefordert hat, damit wir schneller rennen, mehr essen, Details über unseren Feind erfahren. Keine Spur mehr vom einstigen Geliebten. Er tat nicht einmal mehr so, als wäre er mein Freund. Schnell schlinge ich die Arme fest um seinen Hals, bevor er mir befehlen kann, Liegestütze zu machen oder so. Er zieht mich an sich und vergräbt sein Gesicht in meinem Haar. Von dort, wo seine Lippen meinen Hals berühren, breitet sich langsam Wärme in mir aus. Es fühlt sich so gut an, so unfassbar gut, dass ich weiß, ich werde mich bestimmt nicht als Erste aus der Umarmung lösen.
Warum auch? Ich habe Gale Lebewohl gesagt. Ich werde ihn nie wiedersehen, das ist ganz sicher. Was ich auch tue, ihn kann es nicht mehr verletzen. Er wird es nicht sehen, oder er wird denken, ich schauspielere für die Kameras. Immerhin eine Last weniger auf meinen Schultern.
Der Diener kommt herein und wir lösen uns voneinander. Er stellt ein Tablett mit einem dampfenden Keramikkrug warmer Milch und zwei große Tassen auf den Tisch. »Ich hab noch eine Tasse mitgebracht«, sagt er.
»Danke«, antworte ich.
»Ich habe Honig in die Milch getan, zum Süßen. Und etwas Gewürz …« Er sieht uns an, als wollte er noch etwas sagen, dann schüttelt er nur leise den Kopf und verlässt den Raum.
»Was ist denn mit dem los?«, frage ich.
»Wahrscheinlich tun wir ihm leid«, meint Peeta.
»Ganz bestimmt«, sage ich und gieße die Milch ein.
»Das meine ich ernst. Im Kapitol sind bestimmt nicht alle froh darüber, dass wir noch mal in die Arena müssen«, sagt Peeta. »Oder die anderen. Sie haben ihre Sieger lieb gewonnen.«
»Schätze, sie werden drüber wegkommen, wenn erst mal Blut fließt«, halte ich dagegen. Wenn ich für eins nun wirklich keine Zeit habe, dann, darüber nachzudenken, wie sich das Jubel-Jubiläum auf die Stimmung im Kapitol auswirkt. »Und, schaust du dir alle Bänder noch mal an?«
»Nein. Ich will nur herausfinden, welche Kampftechnik die Leute so draufhaben«, sagt Peeta.
»Welches kommt als Nächstes?«, frage ich.
»Nimm irgendeins«, sagt Peeta und hält mir die Kiste hin.
Auf den Bändern stehen das Jahr der Spiele und der Name des Siegers. Ich krame ein bisschen und halte plötzlich ein Band in der Hand, das wir noch nicht angeschaut haben. Nummer fünfzig. Das Jahr des zweiten Jubel-Jubiläums. Und der Name des Siegers lautet: Haymitch Abernathy.
»Das haben wir noch nicht gesehen«, sage ich.
Peeta schüttelt den Kopf. »Nein. Haymitch würde es auch nicht wollen, das wusste ich. Wir würden ja auch nicht gern unsere Spiele noch mal durchleben müssen. Und da wir im gleichen Team sind, dachte ich nicht, dass es wichtig wäre.«
»Ist der, der die fünfundzwanzigste Ausgabe gewonnen hat, dabei?«, frage ich.
»Ich glaube nicht. Wer immer das war, er muss inzwischen gestorben sein, denn Effie hat mir nur die Bänder der Sieger geschickt, mit denen wir es möglicherweise zu tun bekommen.« Peeta wiegt Haymitchs Band in der Hand. »Wieso? Meinst du, wir sollten es uns anschauen?«
»Es ist das einzige Jubel-Jubiläum, das wir haben. Vielleicht erfahren wir etwas Brauchbares darüber, was die da so machen«, sage ich. Aber mir ist nicht wohl dabei. Es kommt mir vor wie ein schwerwiegender Eingriff in Haymitchs Privatsphäre. Ich weiß zwar nicht, wieso, das Ganze war schließlich öffentlich, aber trotzdem. Gleichzeitig bin ich wahnsinnig neugierig. »Wir müssen Haymitch ja nicht erzählen, dass wir es uns angeschaut haben.«
»Okay«, stimmt Peeta zu. Er legt das Band ein, und ich kauere mich mit meiner gesüßten und gewürzten Milch, die wirklich köstlich ist, neben ihn und versinke in den fünfzigsten Hungerspielen. Nach der Hymne sieht man Präsident Snow, der den Umschlag für das zweite Jubel-Jubiläum zieht. Er sieht jünger aus, aber genauso abstoßend. Mit der gleichen Grabesstimme wie bei uns liest er von seinem Blatt ab und teilt Panem mit, dass zu Ehren des Jubel-Jubiläums doppelt so viele Tribute teilnehmen werden wie sonst. Schnitt auf die Ernten, wo Name auf Name aufgerufen wird.
Als wir zu Distrikt 12 kommen, bin ich schon überwältigt von der Anzahl der Kinder, die dem sicheren Tod entgegengehen. Eine Frau, allerdings nicht Effie, ruft die Namen von Distrikt 12 auf, und auch sie sagt: »Ladies first!« Sie ruft den Namen eines Mädchens auf - man sieht ihm an, das es aus dem Saum stammt -, und dann höre ich den Namen: »Maysilee Donner.«
»Oh!«, sage ich. »Das war eine Freundin meiner Mutter.« Die Kamera macht sie in der Menge ausfindig, während sie zwei Mädchen umarmt. Alle blond. Und eindeutig Kaufmannstöchter.
»Das ist doch deine Mutter, die sie da umarmt«, sagt Peeta leise. Er hat recht. Als Maysilee Donner sich tapfer löst und zur Bühne geht, erhasche ich einen Blick auf meine Mutter, die damals so alt war wie ich heute. Was ihre Schönheit angeht, hat man nicht übertrieben. Ein zweites Mädchen, das Maysilee sehr ähnlich sieht, hält ihre Hand und weint. Aber dieses Mädchen sieht noch jemandem ähnlich, den ich kenne.
»Madge«, sage ich.
»Ihre Mutter. Sie und Maysilee waren Zwillinge oder so«, sagt Peeta. »Das hat mein Dad mal erzählt.«
Ich denke an Madges Mutter. Die Frau von Bürgermeister Undersee. Die die Hälfte der Zeit von unerträglichen Schmerzen ans Bett gefesselt ist und die Welt ausblendet. Mir ist nie bewusst gewesen, dass es diese Verbindung zwischen ihr und meiner Mutter gibt. Ich denke daran zurück, wie Madge in dem Schneesturm aufgetaucht ist, um das Schmerzmittel für Gale zu bringen. Denke an meine Spotttölpelbrosche und daran, dass sie eine andere Bedeutung hat, seit ich weiß, dass Madges Tante, Maysilee Donner, sie einst getragen hat - ein Tribut, der in der Arena ermordet wurde.
Als Letzter wird Haymitch aufgerufen. Ihn zu sehen, schockiert mich noch mehr als der Anblick meiner Mutter eben.
Jung. Stark. Es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber er sieht echt toll aus. Dunkle Locken, die grauen Augen klar und schon damals gefährlich.
»Mensch, Peeta, er wird doch nicht Maysilee getötet haben, oder?«, bricht es aus mir heraus. Ich weiß nicht, warum, aber die Vorstellung ist mir unerträglich.
»Bei achtundvierzig Spielern? Nicht sehr wahrscheinlich, würde ich behaupten«, sagt Peeta.
Die Wagenparade - bei der die Kinder aus Distrikt 12 in grauenhaften Bergarbeiteroutfits stecken - und die Interviews rauschen vorbei. Man hat kaum Zeit, sich auf einen zu konzentrieren. Aber weil Haymitch der spätere Sieger ist, wird ein Wortwechsel zwischen ihm und Caesar Flickerman gezeigt, der in seinem nachtblauen Glitzeranzug exakt so aussieht wie immer. Nur die dunkelgrün gefärbten Haare, Lider und Lippen sind anders.
»Also, Haymitch, was hältst du davon, dass bei diesen Spielen hundert Prozent mehr Mitstreiter dabei sind als sonst?«, fragt Caesar.
Haymitch zuckt die Achseln. »Ich sehe da keinen großen Unterschied. Sie werden hundert Prozent so dumm sein wie sonst auch und deshalb schätze ich meine Chancen eigentlich gleich ein.«
Die Zuschauer lachen, Haymitch schenkt ihnen ein halbes Lächeln. Höhnisch. Arrogant. Gleichgültig.
»Dafür hat er sich nicht sonderlich verstellen müssen, oder?«, sage ich.
Schnitt auf den Morgen, an dem die Spiele beginnen. Wir erleben aus der Perspektive einer Spielerin mit, wie sie vom Starträum durch den Zylinder in die Arena hinauffährt. Ich schnappe nach Luft. Unglauben zeichnet sich auf den Gesichtern der Spieler ab. Sogar Haymitch hebt erfreut die Augenbrauen, zieht sie dann aber sofort wieder zu einer finsteren Miene zusammen.
Die Szenerie ist atemberaubend. Das goldene Füllhorn thront mitten auf einer grünen Wiese mit lauter prächtigen Blumen. Der Himmel ist azurblau mit bauschigen weißen Wolken. Singvögel flattern fröhlich über den Köpfen der Tribute, von denen einige schnuppernd die Nase recken. Der Duft muss fantastisch sein. Eine Luftaufnahme zeigt, dass die Wiese sich über viele Kilometer erstreckt. In der Ferne liegt in der einen Richtung ein Wald, in der anderen ein schneebedeckter Berg.
Die Spieler lassen sich von der Schönheit des Anblicks verzaubern, und als der Gong ertönt, sehen die meisten aus, als würden sie aus einem Traum erwachen. Nicht so Haymitch. Im Nu ist er beim Füllhorn, hat sich Waffen und einen Rucksack mit Vorräten gesichert. Ehe die anderen auch nur die Metallscheibe verlassen haben, ist er schon auf dem Weg in den Wald.
Achtzehn Tribute werden beim Gemetzel des ersten Tages getötet. Die anderen sterben wie die Fliegen, denn rasch zeigt sich, dass fast alles an diesem bezaubernden Ort - die köstlichen Früchte, die an den Sträuchern baumeln, das Wasser in den kristallklaren Bächen, sogar der Duft der Blumen, wenn man ihn von Nahem einatmet - tödlich giftig ist. Nur das Regenwasser und die Nahrungsmittel aus dem Füllhorn lassen sich gefahrlos konsumieren. Es gibt auch eine große, gut ausgerüstete Karrierotruppe aus zehn Tributen, die auf der Suche nach Opfern die Bergregion durchstreift.
Haymitch in seinem Wald kommt ganz schön in Bedrängnis, weil die flauschigen goldenen Eichhörnchen sich als rudelweise attackierende Fleischfresser herausstellen und die Stiche der Schmetterlinge Höllenqualen hervorrufen - wenn sie nicht sogar tödlich sind. Aber er kämpft sich immer weiter vorwärts, weg von dem fernen Berg hinter ihm.
Maysilee Donner erweist sich als ganz schön erfinderisch für ein Mädchen, das am Füllhorn lediglich einen kleinen Rucksack ergattert hat. Darin findet sie eine Schale, etwas getrocknetes Rindfleisch und ein Blasrohr mit zwei Dutzend Pfeilen. Sie nutzt die üppig vorhandenen Gifte und verwandelt das Blasrohr in eine tödliche Waffe, taucht die Pfeile in hochgiftige Substanzen und schießt sie ins Fleisch ihrer Gegner.
Nach vier Tagen bricht der malerische Berg aus und eliminiert ein weiteres Dutzend Spieler, darunter die Hälfte aller Karrieretribute. Da der Berg flüssiges Feuer spuckt und die Wiese keinerlei Versteck bietet, haben die verbliebenen dreizehn Tribute - einschließlich Haymitch und Maysilee - keine andere Wahl: Sie müssen in den Wald.
Haymitch scheint entschlossen, immer der gleichen Richtung zu folgen, fort von dem Berg, der zum Vulkan geworden ist, doch ein Labyrinth aus dichten Hecken zwingt ihn in einem Bogen zurück in die Mitte des Waldes, wo er auf drei der Karrieretribute trifft. Haymitch zückt sein Messer. Sie sind vielleicht größer und stärker, aber er ist sehr schnell und hat bereits zwei getötet, als er vom dritten überwältigt wird. Der Karriero will ihm gerade die Kehle aufschlitzen, da streckt ihn ein Pfeil zu Boden.
Maysilee Donner tritt zwischen den Bäumen hervor. »Zu zweit würden wir länger leben.«
»Schätze, das hast du soeben bewiesen«, sagt Haymitch und reibt sich den Hals. »Verbündete?« Maysilee nickt. Und mir nichts, dir nichts haben sie plötzlich eins dieser Bündnisse geschlossen, die man irgendwann notgedrungen brechen muss, wenn man jemals zurück nach Hause und seinen Distrikt wiedersehen will.
Wie Peeta und ich sind sie zu zweit besser dran. Sie schlafen mehr, denken sich gemeinsam eine Methode aus, wie sie mehr Regenwasser gewinnen können, kämpfen im Team und teilen das Essen aus den Rucksäcken der toten Tribute. Trotzdem, Haymitch ist immer noch entschlossen, weiterzumarschieren.
»Warum?«, fragt Maysilee immer wieder, doch er ignoriert sie, bis sie sich schließlich weigert, auch nur noch einen Schritt zu machen, solange sie keine Antwort bekommt.
»Weil es doch irgendwo ein Ende geben muss, oder?«, sagt Haymitch. »Die Arena kann nicht unendlich sein.«
»Und was, glaubst du, wirst du dort finden?«, fragt Maysilee.
»Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist da etwas, das wir gebrauchen können«, antwortet er.
Als sie mithilfe eines Schneidbrenners, den sie aus dem Rucksack eines der toten Karrieros haben, endlich die schier unüberwindliche Hecke hinter sich gebracht haben, treten sie auf eine ausgetrocknete Ebene hinaus, die an einer Klippe endet. Weit unten sind zerklüftete Felsen zu erkennen.
»Das ist alles, Haymitch. Lass uns umkehren«, sagt Maysilee.
»Nein, ich bleibe hier«, erwidert er.
»Gut. Nur noch fünf von uns sind übrig. Dann können wir auch jetzt und hier Lebewohl sagen«, sagt sie. »Ich möchte nicht, dass am Ende bloß noch wir beide übrig sind.«
»Okay«, willigt er ein. Mehr nicht. Er hält ihr nicht die Hand hin oder sieht sie an. Und so geht sie fort.
Haymitch folgt dem Rand der Klippe, als grübelte er über etwas. Unter seinem Fuß löst sich ein kleiner Stein, der in den Abgrund fällt, augenscheinlich für immer verschwunden. Aber eine Minute später, Haymitch hat sich inzwischen hingesetzt, um auszuruhen, wird der Stein plötzlich zurückgeschleudert und landet neben ihm. Verdutzt starrt Haymitch den Stein an, dann wird seine Miene seltsam angespannt. Er wirft einen faustgroßen Stein über die Klippe und wartet. Als auch dieser Stein zurückgeflogen kommt und wieder genau in seiner Hand landet, lacht er los.
In diesem Augenblick hört man Maysilee schreien. Das Bündnis ist Vergangenheit, sie hat es gebrochen, deshalb könnte ihm niemand einen Vorwurf machen, wenn er sich nicht um sie kümmern würde. Trotzdem rennt Haymitch los. Er kommt gerade noch rechtzeitig, um mit anzusehen, wie der letzte aus einer Schar bonbonrosafarbener Vögel mit seinem langen, dünnen Schnabel ihren Hals durchbohrt. Während sie stirbt, hält Haymitch ihre Hand, und ich muss die ganze Zeit an Rue denken und dass auch ich zu spät gekommen bin, um sie zu retten.
Später an diesem Tag wird noch ein Tribut im Kampf getötet und ein dritter von einem Rudel dieser flauschigen Eichhörnchen aufgefressen, sodass nur noch Haymitch und ein Mädchen aus Distrikt 1 um den Sieg wetteifern. Sie ist größer als Haymitch und genauso schnell, und als es zu dem unvermeidlichen Kampf kommt, ist er blutig und schrecklich, und beide haben bereits Verletzungen erlitten, die tödlich sein könnten. Da steht Haymitch plötzlich ohne Waffe da. Er taumelt durch den schönen Wald, drückt die Eingeweide zurück in den Bauch, während das Mädchen hinter ihm herstolpert, in der Hand die Axt, mit der sie ihm den Todesstoß versetzen will. Auf kürzestem Weg steuert Haymitch auf seine Klippe zu und ist eben an der Felskante angekommen, als das Mädchen die Axt schleudert. In diesem Augenblick lässt Haymitch sich fallen und die Axt fliegt über ihn hinweg in den Abgrund. Jetzt, da sie ebenfalls unbewaffnet ist, steht das Mädchen nur da und versucht das Blut zu stillen, das aus ihrer leeren Augenhöhle rinnt. Vielleicht denkt sie, sie könne Haymitch, der sich auf dem Boden windet, überleben. Aber im Gegensatz zu ihm kennt sie das Geheimnis des Abgrunds nicht, und als die Axt plötzlich wieder über die Kante geflogen kommt, gräbt sie sich in den Schädel des Mädchens. Die Kanone knallt, die Leiche wird fortgeschafft, die Fanfaren verkünden Haymitchs Sieg.
Peeta schaltet das Band ab, wir bleiben eine Zeit lang schweigend sitzen.
Endlich sagt Peeta: »Dieses Kraftfeld unterhalb der Klippe erinnert mich an das Kraftfeld rings um das Dach des Trainingscenters. Das schleudert einen auch zurück, wenn man versucht, hinunterzuspringen und sich umzubringen. Haymitch hat einen Weg gefunden, es als Waffe einzusetzen.«
»Und nicht nur gegen die anderen Tribute, auch gegen das Kapitol«, sage ich. »Damit hatten sie bestimmt nicht gerechnet. Es war nicht als Teil der Arena gedacht. Sie haben nie geplant, dass irgendjemand das Kraftfeld als Waffe einsetzen sollte. Als Haymitch es dennoch schaffte, standen sie ganz schön dumm da. Es hat bestimmt eine Weile gedauert, bis sie sich eine passende Story dazu ausgedacht haben. Wahrscheinlich habe ich es deshalb auch nicht im Fernsehen gesehen. Das ist ja fast so schlimm wie wir mit den Beeren!«
Ich pruste los, zum ersten Mal seit Monaten kann ich richtig lachen. Peeta schüttelt nur den Kopf, als hätte ich den Verstand verloren - vielleicht ist es auch ein bisschen so.
»Fast, aber nicht ganz«, sagt Haymitch hinter uns. Ich fahre herum und befürchte, er könne verärgert sein, weil wir sein Band angesehen haben, aber er grinst nur und nimmt einen tiefen Schluck aus einer Weinflasche. So viel zum Thema nüchtern bleiben. Wahrscheinlich müsste ich jetzt wütend sein, weil er wieder trinkt, doch mich beschäftigt etwas anderes.
In den zurückliegenden Wochen habe ich mich nur darum gekümmert zu erfahren, wer meine zukünftigen Konkurrenten sind, und keinen Gedanken daran verschwendet, wer meine Teamkameraden sind. Jetzt aber macht sich eine neue Art von Zuversicht in mir breit, weil ich glaube, dass ich endlich über Haymitch Bescheid weiß. Und ich weiß allmählich auch, wer ich bin. Und zwei Leute, die dem Kapitol so viel Ärger eingebrockt haben, werden bestimmt einen Weg finden, Peeta lebend wieder nach Hause zu bringen.
15
Ich habe ja schon einige Vorbereitungssitzungen mit Flavius, Venia und Octavia hinter mir, weshalb das für mich eigentlich alles Routine sein müsste, die ich nur irgendwie überstehen muss. Aber die emotionale Tortur, die mich diesmal erwartet, habe ich nicht vorausgesehen. Mindestens zweimal im Verlauf der Vorbereitung bricht jeder von ihnen in Tränen aus und Octavia wimmert den ganzen Vormittag über vor sich hin. Offenbar haben sie mich tatsächlich ins Herz geschlossen, und die Vorstellung, dass ich noch einmal in die Arena zurückmuss, macht sie völlig fertig. Dass sie zusammen mit mir auch die Zutrittsberechtigung zu all den großen gesellschaftlichen Anlässen - insbesondere meiner Hochzeit - verlieren werden, macht es vollends unerträglich. Der Gedanke, für einen anderen stark zu sein, ist ihnen noch nie gekommen, und daher bin jetzt plötzlich ich es, die sie trösten muss. Das nervt ein bisschen, schließlich soll ich mich abschlachten lassen, nicht sie.
Aber es ist doch interessant, was Peeta über den Diener im Zug gesagt hat - er sei nicht glücklich darüber, dass die Sieger noch mal kämpfen müssen. Und es gebe auch Leute im Kapitol, die das nicht gut fänden. Meiner Meinung nach wird all das zwar vergessen sein, sobald der Gong ertönt und die Spiele beginnen, aber dass die Leute im Kapitol überhaupt etwas für uns empfinden, ist schon eine kleine Offenbarung. Mit anzusehen, wie Jahr für Jahr aufs Neue junge Menschen getötet werden, bereitet ihnen anscheinend keinerlei Problem. Aber über die Sieger und besonders über die, die seit ewigen Zeiten Berühmtheiten sind, wissen sie vielleicht zu viel, um zu vergessen, dass wir auch Menschen sind. Plötzlich müssen sie selbst den eigenen Freunden beim Sterben zusehen. Als hätten sich die Distrikte die Spiele ausgedacht!
Als Cinna sich blicken lässt, bin ich vom vielen Trösten gereizt und erschöpft, vor allem, weil das ständige Geheule mich an die Tränen erinnert, die zweifellos zu Hause um uns vergossen werden. Wie ich so in meinem dünnen Gewand dastehe und auf der Haut und im Herzen die Stiche spüre, wird mir bewusst, dass ich noch so einen mideidvollen Blick nicht ertrage. Deshalb blaffe ich Cinna, als er durch die Tür kommt, sofort an: »Wenn du jetzt auch noch weinst, bringe ich dich auf der Stelle um, das schwöre ich.«
Cinna lächelt nur. »War’s feucht heute Vormittag, oder was?«
»Du könntest mich auswringen«, erwidere ich.
Cinna legt mir den Arm um die Schultern und führt mich an den Mittagstisch. »Keine Bange. Ich lasse meine Gefühle nur in meine Arbeit einfließen. Auf diese Weise tue ich niemandem weh außer mir selbst.«
»Ich steh das nicht noch mal durch«, warne ich ihn.
»Ich weiß. Ich werde mit ihnen reden«, sagt Cinna.
Das Mittagessen tut mir gut. Fasan in juwelenfarbenem Aspik, Miniaturausgaben echter Gemüse, in Butter geschwenkt, sowie Kartoffelbrei mit Petersilie. Zum Nachtisch tunken wir Obststücke in einen Topf mit flüssiger Schokolade. Ich löffele das Zeug pur in mich hinein, sodass Cinna einen zweiten Topf bestellen muss.
»Und was werden wir bei der Eröffnungsfeier tragen?«, frage ich schließlich, während ich den zweiten Topf auskratze. »Stirnlampen oder Feuer?« Ich weiß, dass Peeta und ich während der Wagenparade irgendetwas an uns haben müssen, das mit Kohle zu tun hat.
»Etwas in der Art«, sagt Cinna.
Als es Zeit ist, die Kostüme für die Eröffnungsfeier anzulegen, erscheint mein Vorbereitungsteam wieder, doch Cinna schickt sie fort mit der Bemerkung, sie hätten ihren Job am Vormittag so fantastisch erledigt, dass nichts mehr zu tun sei. Dankbar ziehen sie sich zurück, um sich zu erholen, und überlassen mich Cinnas Händen. Als Erstes steckt er mein Haar in Zöpfen hoch, wie meine Mutter es gezeigt hat, dann widmet er sich meinem Make-up. Letztes Jahr hat er nur sehr wenig benutzt, damit das Publikum mich in der Arena wiedererkennt. Doch jetzt wirkt mein Gesicht mit den dramatischen Highlights und dunklen Schatten ganz fremd. Stark gewölbte Augenbrauen, markante Wangenknochen, glühende Augen, tiefviolette Lippen. Mein Outfit macht auf den ersten Blick nicht viel her, ein maßgeschneiderter schwarzer Overall, der mich vom Hals abwärts umschließt, mehr nicht. Cinna setzt mir eine halbe Krone auf den Kopf, die so aussieht wie die Krone, die ich als Siegerin aufgesetzt bekommen habe, nur dass diese hier nicht aus Gold ist, sondern aus schwerem schwarzem Metall. Dann dimmt er das Licht im Raum zu einem Halbdunkel und drückt auf einen Knopf im Stoff unten am Ärmel. Ich schaue nach unten und sehe fasziniert, wie mein Kostüm langsam zum Leben erwacht, ein sanftes goldenes Licht, das sich nach und nach in das Orangerot eines Kohlenfeuers verwandelt. Ich sehe aus, als wäre ich in glühende Kohle gekleidet - nein, ich bin ein Stück glühende Kohle aus dem Kamin. Die Farben werden heller und dunkler, wechseln und verschmelzen, wie bei Kohle.
»Wie hast du das denn hingekriegt?«, frage ich staunend.
»Portia und ich haben viele Stunden ins Feuer geguckt«, sagt Cinna. »Jetzt kannst du dich anschauen.«
Er dreht mich zu einem Spiegel hin, damit ich die Wirkung im Ganzen erkennen kann. Was ich sehe, ist kein Mädchen und auch keine Frau, sondern eine überirdische Erscheinung, die aussieht, als wäre sie in dem Vulkan zu Hause, der bei Haymitchs Jubiläumsspielen so viele Tribute vernichtet hat. Die schwarze Krone, die nun glühend rot ist, wirft seltsame Schatten auf mein dramatisch geschminktes Gesicht. Katniss, das Mädchen, das in Flammen stand, hat Feuerzungen, juwelenverzierte Umhänge und sanfte Kerzenlichtkleider abgelegt. Sie ist so gefährlich wie das Feuer selbst.
»Ich glaube … genau das habe ich gebraucht, um den anderen gegenüberzutreten«, sage ich.
»Ja, ich finde, die Zeit der roten Lippenstifte und Haarbänder liegt hinter dir«, sagt Cinna. Er berührt den Knopf an meinem Ärmel noch einmal und löscht das Licht. »Damit die Batterie nicht zu sehr strapaziert wird. Wenn du diesmal auf dem Wagen stehst, dann kein Winken, kein Lächeln. Ich möchte, dass du nur geradeaus schaust, als würdest du all die Zuschauer gar nicht wahrnehmen.«
»Endlich mal etwas, was ich gut kann«, sage ich.
Cinna muss sich noch um Verschiedenes kümmern, deshalb beschließe ich, ins Erdgeschoss des Erneuerungsstudios hinunterzufahren, wo die Tribute und ihre Wagen in einer riesigen Halle daraufwarten, dass die Eröffnungsfeier beginnt. Ich hatte gehofft, dort Peeta und Haymitch zu treffen, aber sie sind noch nicht da. Anders als letztes Jahr, als die Tribute praktisch an ihren Wagen klebten und keinen Kontakt suchten, geht es diesmal regelrecht gesellig zu. Die Sieger, also die Jubiläumstribute und ihre Mentoren, stehen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich. Natürlich, sie kennen sich ja alle, nur ich kenne niemanden, aber ich bin sowieso nicht der Typ, der herumgeht und sich vorstellt. Deshalb tätschele ich nur einem meiner Pferde den Rücken und versuche, nicht aufzufallen.
Klappt aber nicht.
Ich höre ein krachendes Kauen, noch ehe ich merke, dass er neben mir steht: Ich drehe den Kopf und da sind die berühmten meergrünen Augen von Finnick Odair nur wenige Zentimeter von meinen entfernt. Er wirft sich noch einen Zuckerwürfel in den Mund und lehnt sich gegen mein Pferd.
»Hallo, Katniss«, sagt er, als würden wir uns seit Jahren kennen. Dabei sind wir uns noch nie begegnet.
»Hallo, Finnick«, sage ich beiläufig, obwohl mir in seiner Nähe unwohl ist, besonders weil er so viel nackte Haut zeigt.
»Möchtest du einen?«, fragt er und hält mir die Hand hin, auf der ein ganzer Berg Zuckerwürfel liegt. »Sind eigentlich für die Pferde, aber was soll’s? Sie haben noch viele Jahre Zeit, Zucker zu essen, während du und ich … na, wir zwei sollten ja wohl besser zugreifen, wenn wir was Süßes sehen.«
Finnick Odair ist eine Art lebende Legende in Panem. Mit vierzehn hat er die fünfundsechzigsten Hungerspiele gewonnen, und deshalb ist er immer noch einer der jüngsten Sieger überhaupt. Er stammt aus Distrikt 4 und war ein Karrieretribut, weshalb die Chancen sowieso gut für ihn standen. Aber was kein Trainer für sich verbuchen konnte, war Finnicks außergewöhnliche Schönheit. Groß gewachsen, athletisch, mit goldener Haut und bronzefarbenem Haar und diesen unglaublichen Augen. Während andere Tribute dieses Jahrgangs von den Sponsoren kaum mal eine Handvoll Getreide oder Streichhölzer geschenkt bekamen, mangelte es Finnick weder an Essen noch an Medikamenten oder Waffen. Als seine Konkurrenten nach einer Woche endlich begriffen hatten, dass sie vor allem ihn töten mussten, war es schon zu spät. Mit den Speeren und Messern, die er im Füllhorn gefunden hatte, konnte er schon geschickt umgehen. Aber als er einen silbernen Fallschirm mit einem Dreizack bekam - wohl das teuerste Geschenk, das ich je gesehen habe -, war die Sache gelaufen. Distrikt 4 lebt für die Fischerei. Sein ganzes Leben hat Finnick auf Booten verbracht. Der Dreizack war eine natürliche, tödliche Verlängerung seines Arms. Aus Lianen knüpfte er ein Netz, wickelte seine Gegner darin ein und durchbohrte sie mit dem Dreizack. Innerhalb weniger Tage hatte er die Krone errungen.
Seitdem waren die Bewohner des Kapitols ihm verfallen.
Aufgrund seiner Jugend durften sie ihn in den ersten ein, zwei Jahren nicht anrühren. Aber seit er sechzehn ist, wird er während seiner alljährlichen Aufenthalte im Rahmen der Hungerspiele von glühenden Verehrerinnen geradezu belagert. Keiner schenkt er seine Gunst lange. Manchmal hat er in einem Jahr vier oder fünf Liebschaften nacheinander. Ob alt oder jung, hübsch oder hässlich, reich oder megareich - er leistet ihnen Gesellschaft und nimmt ihre extravaganten Geschenke an, aber er bleibt nie, und wenn er einmal fort ist, kommt er nie zurück.
Ich kann nicht bestreiten, dass Finnick einer der umwerfendsten und sinnlichsten Menschen auf unserem Planeten ist. Und doch ist es die Wahrheit, wenn ich sage, dass ich ihn nie anziehend fand. Vielleicht, weil er zu hübsch ist, vielleicht auch, weil er zu leicht zu haben ist - oder zu leicht zu verlieren.
»Nein danke«, sage ich zu dem angebotenen Zucker. »Aber dein Outfit würd ich mir gern irgendwann mal ausleihen.«
Er ist nur in ein goldenes Netz gehüllt, das geschickt in der Leiste zusammengeknotet ist, sodass man ihn streng genommen nicht als nackt bezeichnen kann. Viel nackter könnte er aber nicht sein. Sein Stylist hält es offenbar für vorteilhaft, wenn das Publikum so viel wie möglich von Finnick zu sehen bekommt.
»In dieser Aufmachung jagst du mir echt Angst ein. Was ist aus den hübschen Kleinmädchen-Kleidern geworden?«, fragt er. Er benetzt mit der Zunge leicht die Lippen. Wahrscheinlich macht das die meisten Leute völlig verrückt. Aber aus irgendeinem Grund muss ich an den alten Cray denken, der über einer armen, hungernden jungen Frau geifert.
»Bin rausgewachsen«, sage ich.
Finnick fasst an den Kragen meines Overalls und reibt den Stoff zwischen den Fingern. »Zu dumm, diese Sache mit dem Jubiläum. Du hättest im Kapitol wie die Made im Speck leben können. Schmuck, Geld, alles, was du willst.«
»Ich mag keinen Schmuck, und Geld habe ich mehr, als ich ausgeben kann. Wofür gibst du deins denn so aus, Finnick?«, frage ich ihn.
»Och, mit so gewöhnlichen Dingen wie Geld habe ich seit einer Ewigkeit nichts mehr am Hut«, antwortet er.
»Und womit lässt du dir dann das Vergnügen deiner Gesellschaft vergüten?«, frage ich.
»Mit Geheimnissen«, sagt er sanft. Er neigt den Kopf nach vorn, sodass sich unsere Lippen fast berühren. »Was ist eigentlich mit dir, Mädchen in Flammen? Hast du irgendwelche Geheimnisse, die meine Zeit wert wären?«
Aus irgendeinem albernen Grund werde ich rot, aber ich zwinge mich, nicht zurückzuweichen. »Nein, ich bin ein offenes Buch«, flüstere ich zurück. »Anscheinend glaubt jeder, meine Geheimnisse zu kennen, bevor ich selbst sie kenne.«
Er lächelt. »So leid es mir tut - aber ich glaube, das stimmt.« Sein Blick zuckt zur Seite. »Da kommt Peeta. Schade, dass ihr eure Hochzeit abblasen müsst. Ich weiß, wie niederschmetternd das für dich sein muss.« Er wirft sich noch einen Zuckerwürfel in den Mund und schlendert davon.
Peeta stellt sich neben mich, er ist genauso gekleidet wie ich. »Was wollte der denn?«, fragt er.
Ich drehe mich um, bringe meine Lippen ganz nah an Peetas und senke die Lider genau wie Finnick. »Er hat mir Zucker angeboten und wollte alle meine Geheimnisse erfahren«, sage ich, so verführerisch ich kann.
Peeta lacht. »Igitt. Das gibt’s doch nicht.«
»Oh doch«, antworte ich. »Den Rest erzähl ich dir, wenn die Gänsehaut weg ist.«
»Meinst du, wenn nur einer von uns beiden gewonnen hätte, wären wir auch so geendet?«, fragt er und wirft einen Blick auf die anderen Sieger. »Als Teil dieser Freakshowr?«
»Na klar. Vor allem du«, sage ich.
»Ach, und warum vor allem ich?«, fragt er und lächelt.
»Weil du eine Schwäche für die schönen Dinge hast und ich nicht«, sage ich mit einem Anflug von Überlegenheit. »Wenn sie dich mit der Lebensart des Kapitols locken würden, wärst du vollkommen verloren.«
»Einen Sinn für Schönheit zu haben, ist doch keine Schwäche«, sagt Peeta. »Außer vielleicht, was dich betrifft.« Die Musik beginnt, die großen Tore öffnen sich für den ersten Wagen, die Menge tobt. »Wollen wir?« Er reicht mir die Hand und hilft mir auf den Wagen.
Ich klettere hinauf und ziehe ihn nach. »Halt still«, sage ich und richte seine Krone. »Hast du deinen Overall in eingeschaltetem Zustand gesehen? Wir werden wieder fantastisch aussehen.«
»Und ob. Portia sagt, wir sollen diesmal über allem stehen. Kein Winken oder so was«, sagt er. »Wo stecken die beiden eigentlich?«
»Ich weiß nicht.« Ich suche die Prozession der Wagen ab. »Vielleicht sollten wir uns lieber selbst einschalten.« Das tun wir, und sobald wir aufleuchten, deuten die anderen auf uns und fangen an zu tuscheln. Ich weiß, dass wir auch diesmal das Gesprächsthema Nummer eins der Eröffnungsfeier sein werden. Wir sind fast am Tor. Ich recke den Hals, doch weder Portia noch Cinna, die voriges Jahr bis zur letzten Sekunde bei uns waren, sind irgendwo zu sehen. »Sollen wir dieses Jahr auch Händchen halten?«, frage ich.
»Ich glaube, das wollen sie uns überlassen«, sagt Peeta.
Ich schaue in diese blauen Augen, die kein noch so dramatisches Make-up gefährlich erscheinen lassen kann, und denke daran, dass ich noch vor einem Jahr bereit war, ihn zu töten. Weil ich überzeugt war, dass er versuchen würde, mich zu töten. Nun ist es genau umgekehrt. Ich bin entschlossen, ihn zu retten, und ich weiß, dass es mich mein eigenes Leben kosten wird, aber der Teil von mir, der nicht so tapfer ist, wie ich es gern hätte, ist froh, dass jetzt Peeta neben mir steht und nicht Haymitch. Ohne weitere Diskussion finden sich unsere Hände. Keine Frage, wir werden uns dieser Sache gemeinsam stellen.
Als wir in die Abenddämmerung hinausrollen, bricht die Menge in Geschrei aus, aber keiner von uns beiden reagiert. Ich starre einfach auf einen Punkt in der Ferne und tue so, als gäbe es keine Zuschauer, keine Hysterie. Unwillkürlich fällt mein Blick auf die riesigen Bildschirme entlang der Strecke und ich erhasche ein paar Bilder von uns: Wir sind nicht nur schön, wir sind düster, mächtig. Mehr noch. Das tragische Liebespaar aus Distrikt 12, das so viel gelitten hat und die Früchte des Sieges so wenig hat auskosten dürfen, sucht nicht nach der Gunst der Fans, schenkt ihnen kein Lächeln, fängt nicht ihre Küsse auf. Wir sind unversöhnlich.
Und ich genieße es. Endlich mal ich selbst sein.
Als wir in den Kreisverkehr des Zentralen Platzes einbiegen, stelle ich fest, dass ein paar von den anderen Stylisten Cinnas und Portias Idee geklaut und ihre Tribute beleuchtet haben. Die mit kleinen elektrischen Lämpchen übersäten Outfits aus Distrikt 3, wo Elektronik hergestellt wird, haben ja noch einen gewissen Sinn. Aber die Viehhüter aus Distrikt 10, die angezogen sind wie Kühe mit brennenden Gurten um den Bauch? Wollen die sich selbst grillen? Lächerlich.
Peeta und ich dagegen in unserem sich dauernd verändernden Kohle-Kostüm wirken so hypnotisierend, dass die meisten anderen Tribute uns nur anstarren. Besonders fasziniert ist offenbar das Paar aus Distrikt 6, von dem bekannt ist, dass sie Morfixer sind: beide klapperdürr und mit schlaffer gelblicher Haut. Sie können die übergroßen Augen gar nicht abwenden, selbst dann nicht, als Präsident Snow auf seinem Balkon zu reden beginnt und uns alle zum Jubel-Jubiläum willkommen heißt. Die Hymne erklingt, und während wir das letzte Stück fahren - irre ich mich? Oder starrt sogar der Präsident mich an?
Peeta und ich warten, bis die Tore des Trainingscenters sich wieder hinter uns geschlossen haben. Erst dann entspannen wir uns. Cinna und Portia erwarten uns, sie sind angetan von unserem Auftritt, und dieses Jahr ist sogar Haymitch erschienen, nur dass er nicht zu uns kommt, sondern am Wagen von Distrikt 11 steht. Ich sehe, wie er in unsere Richtung nickt, und dann kommen sie allesamt herüber, um uns zu begrüßen.
Chaff kenne ich vom Sehen, ich habe jahrelang im Fernsehen verfolgt, wie er sich mit Haymitch die Flasche teilt. Er ist dunkelhäutig, gut eins achtzig groß, und einer seiner Arme endet in einem Stumpf, weil er die dazugehörige Hand in den Hungerspielen verloren hat, die er vor dreißig Jahren gewann. Bestimmt hat man ihm künstlichen Ersatz angeboten wie Peeta, als dem der Unterschenkel amputiert werden musste, aber wie es aussieht, hat er abgelehnt.
Die Frau, Seeder, sieht mit ihrer olivfarbenen Haut und dem glatten schwarzen Haar mit den silbernen Strähnen fast aus, als stammte sie aus dem Saum. Nur ihre goldbraunen Augen verraten den fremden Distrikt. Sie dürfte um die sechzig sein, aber sie sieht immer noch stark aus, und nichts deutet darauf hin, dass sie sich über die Jahre in Alkohol oder Morfix oder sonst eine chemische Substanz geflüchtet hätte. Bevor einer von uns etwas sagen kann, umarmt sie mich. Wegen Rue und Thresh, denke ich. Ich kann mich nicht bremsen und flüstere: »Und was ist mit den Familien?«
»Sie leben«, erwidert sie sanft und lässt mich los.
Chaff schlingt seinen gesunden Arm um mich und drückt mir einen Schmatz direkt auf den Mund. Erschrocken zucke ich zurück, während er und Haymitch schallend loslachen.
Mehr Zeit bleibt uns nicht, denn die Bediensteten des Kapitols scheuchen uns in Richtung Aufzüge. Ich habe den Eindruck, dass ihnen eine solche Verbrüderung unter den Siegern nicht recht ist, aber denen ist das vollkommen egal. Während ich mich, immer noch Hand in Hand mit Peeta, auf den Weg zu den Aufzügen mache, pirscht sich noch jemand an mich heran, eine junge Frau, die ihre Kopfbedeckung aus Blätterzweigen abzieht und achtlos hinter sich wirft.
Johanna Mason. Aus Distrikt 7. Holz und Papier, deshalb das Geäst. Sie hat ihre Spiele gewonnen, indem sie sich sehr überzeugend als schwach und hilflos darstellte, sodass die anderen sie weitgehend ignorierten. Aber dann bewies sie ein gemeines Talent zum Morden. Sie fährt sich durchs dornige Haar und verdreht die weit auseinanderstehenden braunen Augen. »Ist das nicht ein grässliches Kostüm? Ich habe die dämlichste Stylistin des Kapitols. Seit vierzig Jahren staffiert sie unsere Tribute als Bäume aus. Ich hätte auch mal gern so einen wie Cinna. Du siehst fantastisch aus.«
Mädchengeplapper. Was ich schon immer schlecht konnte. Meinungen äußern über Kleidung, Haare, Make-up. Also lüge ich. »Ja, er hat mir geholfen, meine eigene Kleiderkollektion zu entwerfen. Du müsstest mal sehen, was er aus Samt alles machen kann.« Samt. Der einzige Stoff, der mir auf die Schnelle eingefallen ist.
»Hab ich. Auf deiner Siegertour. Das Schulterfreie, das du in Distrikt 2 anhattest? Das Tiefblaue mit den Diamanten? Es war so umwerfend, dass ich am liebsten durch den Bildschirm gegriffen und es dir vom Leib gerissen hätte«, sagt Johanna.
Das glaube ich gern, denke ich. Und ein paar Zentimeter meines Fleisches gleich mit.
Während wir auf die Aufzüge warten, schält Johanna sich aus dem Rest ihres Baums, lässt ihn zu Boden fallen und kickt ihn angewidert weg. Bis auf ihre waldgrünen Slipper trägt sie jetzt keinen Fetzen mehr am Leib. »So ist’s besser.«
Wir fahren im selben Aufzug, und die ganze Fahrt bis in den siebten Stock plaudert sie mit Peeta über seine Gemälde, während das Licht seines noch immer glühenden Kostüms von ihren nackten Brüsten reflektiert wird. Als sie ausgestiegen ist, tue ich so, als wäre nichts, aber ich weiß, dass er grinst. Erst als sich die Tür hinter Chaff und Seeder schließt und wir allein sind, stoße ich seine Hand weg. Er prustet los.
»Was ist?«, fahre ich ihn an, als wir auf den Gang treten.
»Das ist deinetwegen, Katniss. Merkst du das nicht?«, sagt er.
»Was ist meinetwegen?«, frage ich zurück.
»Na, dass die sich alle so benehmen. Finnick mit seinen Zuckerwürfeln und Chaff, der dich küsst, und der Striptease von Johanna.« Er versucht, etwas ernsthafter zu klingen, aber es will ihm nicht gelingen. »Sie spielen mit dir, weil du so … du weißt schon.«
»Nein, weiß ich nicht«, sage ich. Ich habe wirklich keinen Schimmer, wovon er redet.
»Na, damals in der Arena, da wolltest du mich nicht mal nackt angucken, als ich schon halb tot war. Du bist so … rein«, sagt er schließlich.
»Bin ich nicht!«, entgegne ich. »Letztes Jahr habe ich dir doch jedes Mal, wenn eine Kamera in der Nähe war, die Kleider vom Leib gerissen!«
»Schon, aber … ich meine, für das Kapitol bist du rein«, sagt er beschwichtigend. »Für mich bist du genau richtig. Sie wollen dich nur ein bisschen aufziehen.«
»Nein, die wollen sich über mich lustig machen, genau wie du!«, rufe ich.
»Nein.« Peeta schüttelt den Kopf, aber er unterdrückt noch immer ein Lächeln. Ich bin drauf und dran, noch mal zu überdenken, wer von uns beiden lebend aus diesen Spielen rauskommen soll, als sich der andere Aufzug öffnet.
Haymitch und Effie gesellen sich zu uns und sehen irgendwie zufrieden aus. Plötzlich verhärtet sich Haymitchs Gesichtsausdruck.
Was habe ich jetzt schon wieder angestellt?, will ich gerade sagen, aber da merke ich, dass er über meine Schulter hinweg auf den Eingang zum Speisesaal starrt.
Effie guckt in die gleiche Richtung, doch sie strahlt, als sie sagt: »Offenbar bekommt ihr dieses Jahr zwei im Partnerlook.«
Ich drehe mich um und sehe das rothaarige Avoxmädchen, das mich letztes Jahr bis zum Beginn der Spiele bedient hat. Ich freue mich schon, hier eine Freundin zu haben, als mir auffällt, dass der junge Mann neben ihr, auch ein Avox, ebenfalls rotes Haar hat. Das muss Effie mit Partnerlook gemeint haben.
Dann überläuft mich ein Schauer. Ihn kenne ich auch. Nicht aus dem Kapitol, sondern vom Hob, wo wir all die Jahre miteinander geplaudert und bei einer Suppe von Greasy Sae gescherzt haben, und von diesem letzten Tag, als er bewusstios auf dem Platz lag, während Gale zu verbluten drohte.
Unser neuer Avox ist Darius.
16
Haymitch packt mich am Handgelenk, als wollte er mich zurückhalten, aber ich bin so unfähig zu sprechen wie Darius. Haymitch hat mir mal erzählt, dass die Folterknechte des Kapitols irgendwas mit den Zungen der Avoxe anstellen, damit sie nie mehr sprechen können. In meinem Kopf höre ich Darius’ Stimme, wie sie hell und ausgelassen über den Hob schallt und mich aufzieht. Aber nicht so, wie die anderen Sieger mich jetzt hänseln, denn wir mochten uns wirklich. Wenn Gale ihn sehen könnte …
Jede Bewegung auf Darius zu, jede Geste des Erkennens würde ihm unweigerlich eine Bestrafung einbringen, das weiß ich. Und so starren wir einander nur an. Darius, der jetzt ein stummer Sklave ist; ich, die dem Tod entgegengeht. Was sollten wir uns auch sagen? Dass es uns um das Schicksal des anderen leidtut? Dass wir mit dem anderen leiden? Dass wir froh sind, dass wir uns kennenlernen durften?
Nein, Darius hat keinen Grund, froh darüber zu sein, dass er mich kennengelernt hat. Wäre ich damals da gewesen und hätte Thread gestoppt, wäre er nicht vorgetreten, um Gale zu retten. Dann wäre er jetzt kein Avox. Wäre er jetzt nicht mein Avox, um genau zu sein, denn Präsident Snow hat ihn zweifellos zu meinem ganz persönlichen Wohlbefinden hierher beordert. Ich winde mein Handgelenk aus Haymitchs Griff, stapfe zu meinem alten Schlafzimmer und schließe die Tür hinter mir ab. Ich setze mich auf die Bettkante, die Ellbogen auf den Knien, die Stirn auf den Fäusten, betrachte meinen in der Dunkelheit glühenden Overall und stelle mir vor, ich säße in meinem alten Zuhause in Distrikt 12, zusammengekauert neben dem Kamin. Die Batterie wird schwächer und langsam wird der Lichtschein von Schwarz überlagert.
Als irgendwann Effie an die Tür klopft, um mich zum Abendessen zu rufen, stehe ich auf und ziehe meinen Anzug aus, falte ihn ordentlich und lege ihn zusammen mit der Krone auf den Tisch. Im Bad wasche ich mir die dunklen Make-up-Streifen aus dem Gesicht. Ich ziehe ein einfaches T-Shirt und eine Hose an und gehe hinunter in den Flur zum Speisesaal.
Während des Essens bekomme ich nicht viel mit, außer dass Darius und das rothaarige Avoxmädchen uns bedienen. Effie, Haymitch, Cinna, Portia und Peeta sind da und unterhalten sich, vermutlich über die Eröffnungsfeier. Doch wirklich anwesend bin ich eigentlich nur ein einziges Mal, als ich absichdich eine Schüssel mit Erbsen zu Boden fallen lasse und mich, bevor jemand eingreifen kann, bücke, um sie aufzulesen. Darius hockt sich neben mich, ich schiebe die Schüssel zu ihm hin, und für kurze Zeit arbeiten wir Seite an Seite, für niemanden sichtbar, und sammeln die Erbsen ein. Einen kurzen Augenblick lang berühren sich unsere Hände. Unter der butterigen Soße der Erbsen spüre ich seine raue Haut. In der kurzen, verzweifelten Verschränkung unserer Finger drücken wir all die Worte aus, die wir uns niemals werden sagen können. Dann gackert Effie hinter mir: »Das ist nicht deine Aufgabe, Katniss!«, und er lässt los.
Als wir hinübergehen, um uns die Aufzeichnung der Eröffnungsfeier anzusehen, zwänge ich mich zwischen Haymitch und Cinna aufs Sofa, ich will nicht neben Peeta sitzen. Das schreckliche Erlebnis mit Darius gehört zu mir und Gale, vielleicht noch zu Haymitch, aber nicht zu Peeta. Vielleicht kannte er Darius vom flüchtigen Grüßen, aber Peeta gehörte nicht auf den Hob wie wir. Abgesehen davon bin ich immer noch sauer auf ihn, weil er mich zusammen mit den anderen Siegern ausgelacht hat, und Mitgefühl und Trost von ihm ist das Letzte, was ich jetzt möchte. Ich will ihn in der Arena retten, das ja, aber mehr bin ich ihm nicht schuldig.
Es ist ja in normalen Jahren schon schlimm, dass sie uns in Kostüme stecken und auf Wagen durch die Straßen ziehen lassen, überlege ich, während ich mir die Prozession um den Zentralen Platz anschaue. Jugendliche in Kostümen sind schon lächerlich, aber alternde Sieger sind, wie man sieht, einfach nur bemitleidenswert. Ein paar Jüngere wie Johanna und Finnick oder solche, deren Körper noch nicht vom Verfall gezeichnet sind, wie Seeder und Brutus, können immerhin ein wenig Würde wahren. Aber die, die Opfer von Alkohol, Morfix oder Krankheit sind, und das sind die meisten, sehen in ihren Kostümen, die Kühe oder Bäume oder Brotlaibe darstellen, einfach grotesk aus. Letztes Jahr haben wir uns über jeden Konkurrenten ausführlich unterhalten, aber heute fällt nur hier und da mal ein Kommentar. Kein Wunder, dass die Menge durchdreht, als Peeta und ich erscheinen, denn in unseren fantastischen Kostümen sehen wir wahnsinnig jung und stark und schön aus. Genau so, wie Tribute aussehen sollen.
Sobald die Sendung vorüber ist, stehe ich auf, danke Cinna und Portia für ihre tolle Arbeit und gehe schlafen. Effie erinnert noch daran, dass wir uns zeitig zum Frühstück treffen wollen, um unsere Trainingsstrategie zu besprechen, aber selbst ihre Stimme klingt hohl. Arme Effie. Mit Peeta und mir hatte sie endlich mal ein anständiges Jahr bei den Spielen, und jetzt ist alles so durcheinandergeraten, dass selbst sie das Ganze nicht ins Positive drehen kann. Und das, nehme ich an, ist für Leute aus dem Kapitol eine echte Tragödie.
Gleich nachdem ich mich hingelegt habe, klopft es leise an meine Tür, aber ich ignoriere es. Ich möchte Peeta heute Nacht nicht bei mir haben. Schon gar nicht, wenn Darius in der Nähe ist. Das ist fast so schlimm, als ob Gale hier wäre. Gale. Wie könnte ich ihn loslassen, während Darius durch die Flure spukt?
In meinen Albträumen sind diesmal Zungen die Hauptdarsteller. Erst schaue ich starr und hilflos zu, wie behandschuhte Hände die blutige Amputation in Darius’ Mund ausführen. Dann bin ich auf einer Party, wo alle Masken tragen und jemand mit einer zuckenden nassen Zunge - Finnick, nehme ich an - mir nachstellt, doch als er mich fängt und seine Maske abzieht, ist es Präsident Snow, und von seinen Wulstlippen tropft blutiger Speichel. Schließlich bin ich wieder in der Arena, meine Zunge ist so trocken wie Sandpapier, während ich versuche, einen Wassertümpel zu erreichen, der jedes Mal, wenn ich ihn berühren will, zurückweicht.
Ich wache auf, taumele ins Bad, trinke Wasser aus dem Hahn, bis ich nicht mehr kann. Ich streife die verschwitzten Kleider ab, lasse mich nackt zurück ins Bett fallen und schlafe irgendwie wieder ein.
Am nächsten Morgen trödele ich so gut es geht, denn ich habe nicht die geringste Lust, unsere Trainingsstrategie zu besprechen. Was gibt es da zu besprechen? Jeder Sieger weiß doch bereits, was die anderen draufhaben. Oder mal draufgehabt haben. Peeta und ich werden weiter die Verliebten spielen, mehr nicht. Irgendwie ist mir nicht danach, darüber zu reden, besonders wenn Darius stumm dabeisteht. Ich dusche ausgiebig, ziehe gemächlich die Sachen an, die Cinna mir fürs Training bereitgelegt hat, und bestelle über eine Sprechanlage von der Speisekarte Essen aufs Zimmer. Kurz darauf erscheinen Würstchen, Eier, Bratkartoffeln, Brot, Saft und heiße Schokolade. Ich esse mich satt und versuche das Ganze bis zehn Uhr in die Länge zu ziehen, wenn wir hinunter ins Trainingscenter müssen. Um halb zehn wummert ein offenbar stinksaurer Haymitch gegen die Tür und befiehlt mir, in den Speisesaal zu kommen, und zwar SOFORT! Aber ich putze mir erst noch gemächlich die Zähne, bevor ich mich aufmache, den Flur hinunterzuschlendern, womit ich weitere fünf Minuten schinde.
Der Speisesaal ist leer bis auf Peeta und Haymitch, dessen Gesicht von Alkohol und Ärger gerötet ist. Am Arm trägt er einen massiv goldenen Armreif mit Flammenmuster, den er unglücklich dreht - das muss sein Beitrag zu Effies Partnerlook-Plan sein. Ein wirklich hübscher Armreif, aber die Bewegung lässt ihn so aussehen wie etwas, das einengt, eher eine Fessel als ein Schmuckstück. »Du kommst zu spät«, schnauzt Haymitch mich an.
»Tut mir leid. Ich hab verschlafen, nachdem ich die halbe Nacht von verstümmelten Zungen geträumt habe.« Ich möchte feindselig klingen, doch am Ende des Satzes stockt meine Stimme.
Haymitch wirft mir einen finsteren Blick zu, dann lenkt er ein. »Okay, macht nichts. Heute beim Training hast du zwei Aufgaben. Nummer eins: verliebt sein.«
»Natürlich«, sage ich.
»Nummer zwei: Freundschaften schließen«, fährt Haymitch fort.
»Nein«, sage ich. »Ich traue keinem von denen, die meisten kann ich nicht ausstehen. Ich würde mich lieber nur auf uns beide verlassen.«
»Das habe ich auch erst gesagt, aber …«, hebt Peeta an.
»Aber das wird nicht reichen«, sagt Haymitch mit Nachdruck. »Diesmal werdet ihr mehr Verbündete brauchen.«
»Warum?«, frage ich.
»Weil ihr im Nachteil seid. Eure Konkurrenten kennen einander seit Jahren. Was glaubst du also, wen werden sie als Erste ins Visier nehmen?«, fragt er.
»Uns. Und gegen alte Freundschaften kommen wir sowieso nicht an«, sage ich. »Warum also einen Gedanken darauf verschwenden?«
»Weil ihr kämpfen könnt. Die Leute mögen euch. Das könnte euch durchaus zu erstrebenswerten Verbündeten machen. Aber nur, wenn ihr den anderen zeigt, dass ihr bereit seid, euch mit ihnen zusammenzutun«, sagt Haymitch.
»Wir sollen dieses Jahr also mit der Meute der Karrieros gemeinsame Sache machen?«, frage ich und kann meinen Widerwillen nicht verhehlen. Traditionell schließen sich die Tribute aus den Distrikten 1, 2 und 4 zusammen, nehmen manchmal noch ein paar herausragende Kämpfer von den anderen in ihren Kreis auf und machen Jagd auf die Schwächeren.
»War das nicht unsere Strategie? Zu trainieren wie die Karrieros?«, entgegnet Haymitch. »Und wer zur Meute der Karrieros gehört, das wird normalerweise schon vor Beginn der Spiele ausgemacht. Letztes Jahr hat Peeta es nur mit Ach und Krach noch geschafft, aufgenommen zu werden.«
Ich erinnere mich gut, welchen Abscheu ich bei den letzten Spielen empfand, als ich mitbekam, dass Peeta mit den Karrieros gemeinsame Sache machte. »Wir sollen uns also mit Finnick und Brutus gut stellen - willst du das sagen?«
»Nicht unbedingt. Alle dort sind Sieger. Wenn ihr es für richtig haltet, könnt ihr auch eure eigene Meute zusammenstellen. Nehmt, wen ihr wollt. Ich schlage Chaff und Seeder vor. Und Finnick sollte man auch nicht außer Acht lassen«, sagt Haymitch. »Tut euch mit denen zusammen, die euch nützlich sein können. Vergesst nicht, ihr seid nicht mehr Teil einer bibbernden Kinderschar. Diese Leute sind allesamt erfahrene Killer, auch wenn sie nicht so aussehen.«
Möglicherweise hat er recht. Nur, wem könnte ich trauen? Seeder vielleicht. Aber möchte ich mit ihr wirklich einen Pakt schließen, nur um sie später womöglich töten zu müssen? Nein. Obwohl, mit Rue habe ich mich damals unter den gleichen Umständen auch verbündet. Ich sage Haymitch, dass ich es versuchen werde, doch insgeheim denke ich, dass ich dabei ziemlich schlecht aussehen werde.
Effie erscheint ein bisschen früher, um uns nach unten zu bringen, denn im vergangenen Jahr waren wir die Letzten, obwohl wir pünktlich kamen. Aber Haymitch möchte nicht, dass sie mit uns hinunter in die Turnhalle fährt. Keiner der anderen Sieger wird in Begleitung eines Babysitters erscheinen, und da wir die Jüngsten sind, ist es umso wichtiger, selbstsicher aufzutreten. So muss sie sich damit zufriedengeben, uns zum Aufzug zu begleiten und den Knopf zu drücken, während sie sich über unsere Frisuren aufregt.
Die Fahrt ist so kurz, dass keine Zeit für eine Unterhaltung bleibt, doch als Peeta meine Hand nimmt, ziehe ich sie nicht weg. Gestern Nacht habe ich ihn zurückgewiesen, aber beim Training müssen wir als Einheit auftreten.
Effie hätte sich gar keine Sorgen machen müssen, dass wir zu spät kommen. Nur Brutus und Enobaria, die Frau aus Distrikt 2, sind da. Enobaria ist um die dreißig, und ich weiß über sie nur noch, dass sie in einem Handgemenge einen Tribut getötet hat, indem sie ihm mit den Zähnen die Kehle aufgerissen hat. Dadurch wurde sie so berühmt, dass sie sich nach ihrem Sieg die Zähne neu machen ließ. Sie laufen jetzt alle spitz zu wie Reißzähne und haben ein Goldinlay. Über fehlende Bewunderer im Kapitol kann Enobaria sich nicht beklagen.
Um zehn Uhr ist erst etwa die Hälfte der Tribute da. Atala, die das Training leitet, lässt sich davon nicht beeindrucken und beginnt pünktlich mit ihrer Ansprache. Vielleicht hatte sie schon damit gerechnet, dass viele nicht auftauchen würden. Ich bin irgendwie erleichtert, denn das bedeutet, dass ein Dutzend weniger Leute da ist, denen ich Freundschaft vorheucheln muss. Atala geht die einzelnen Stationen mit den Kampf-und Überlebenstechniken durch und entlässt uns ins Training.
Ich schlage Peeta vor, dass wir uns aufteilen, um auf breiterer Front vorzugehen. Er gesellt sich zu Brutus und Chaff, gemeinsam schleudern sie Speere, während ich zur Knotenstation gehe.
Kaum jemand macht sich je die Mühe, dort vorbeizuschauen. Ich mag den Trainer, und er ist beglückt, mich zu sehen, vielleicht weil ich letztes Jahr schon bei ihm war. Er freut sich, als ich ihm zeige, dass ich immer noch die Falle beherrsche, durch die der gefangene Feind an einem Bein von einem Baum baumelt. Bestimmt hat er mitbekommen, welche Fallen ich letztes Jahr in der Arena gestellt habe, und sieht in mir nun eine fortgeschrittene Schülerin. Deshalb bitte ich ihn, alle Knoten zu wiederholen, die nützlich sein könnten, sowie ein paar, die ich wahrscheinlich nie anwenden werde. Ich wäre froh, wenn ich den Vormittag mit ihm allein verbringen könnte, aber nach anderthalb Stunden legt mir jemand von hinten die Arme um und vollendet mit seinen Fingern mühelos den komplizierten Knoten, mit dem ich mich gerade abgemüht habe. Finnick natürlich, der in seiner Kindheit offenbar nichts anderes getan hat, als Dreizacke zu schwingen und Schnüre auf raffinierte Weise zu Netzen zu verknoten. Eine Weile schaue ich zu, wie er ein Tauende nimmt, eine Schlinge macht und dann mir zu Gefallen so tut, als würde er sich erhängen.
Ich verdrehe die Augen und gehe weiter zur nächsten leeren Station, wo die Tribute lernen können, wie man Feuer macht. Ich kann schon hervorragend Feuer machen, aber nicht ohne Streichhölzer. Deshalb lässt mich der Trainer mit Feuerstein, Stahl und verkohlten Lumpen üben. Das ist viel schwerer, als es aussieht, und obwohl ich so konzentriert wie möglich arbeite, brauche ich eine Stunde, bis ich ein Feuer in Gang habe. Als ich mit triumphierendem Lächeln aufschaue, stelle ich fest, dass ich Gesellschaft bekommen habe.
Die beiden Tribute aus Distrikt 3 stehen neben mir, mühen sich mit Streichhölzern ab und entfachen doch nur ein bescheidenes Feuerchen. Am liebsten würde ich weitergehen, aber erstens möchte ich zu gern noch mal den Feuerstein ausprobieren, und außerdem muss ich Haymitch nachher ja berichten können, dass ich versucht habe, mich anzufreunden, und die zwei scheinen erträglich zu sein. Beide sind klein, haben aschgraue Haut und schwarzes Haar. Wiress, die Frau, ist etwa so alt wie meine Mutter, sie spricht mit ruhiger, intelligenter Stimme. Aber mir fällt sofort auf, dass sie oft mitten im Satz abbricht, als ob sie die Anwesenheit ihres Gegenübers völlig vergessen hätte. Beetee, der Mann, ist älter und ein unruhiger Typ. Er trägt eine Brille, guckt aber die ganze Zeit drunter durch. Die beiden sind irgendwie schräg, doch immerhin kann ich bei ihnen ziemlich sicher sein, dass sie mir die Peinlichkeit ersparen werden, sich nackt auszuziehen. Und außerdem sind sie aus Distrikt 3. Vielleicht können sie meine Vermutung bestätigen, dass es dort einen Aufstand gegeben hat.
Ich sehe mich im Trainingscenter um. Peeta steht inmitten einer lärmenden Runde von Messerwerfern. Die Morfixer aus Distrikt 6 befinden sich an der Tarnstation und bemalen einander die Gesichter mit hellrosa Kringeln. Der männliche Tribut aus Distrikt 5 ist bei den Schwertkämpfern und erbricht gerade einen Schwall Wein. Finnick und die alte Frau aus seinem Distrikt üben sich im Bogenschießen. Johanna Mason ist wieder nackt und reibt sich für die Ringerübung die Haut mit Öl ein. Ich beschließe zu bleiben, wo ich bin.
Wiress und Beetee entpuppen sich als unaufdringliche Zeitgenossen. Sie wirken freundlich, horchen mich aber nicht aus. Wir unterhalten uns über unsere Talente; sie erzählen, dass sie beide Erfinder sind, was mein vermeintliches Interesse an Mode ziemlich schwach erscheinen lässt. Wiress erwähnt irgendein Nähutensil, an dem sie gerade tüftelt.
»Es spürt selbstständig die Dicke des Stoffes und wählt danach die Stärke …«, sagt sie, doch bevor sie weitersprechen kann, wird sie von einem trockenen Grashalm abgelenkt.
»… die Stärke des Fadens«, führt Beetee die Erläuterung zu Ende. »Automatisch. Menschliches Versagen ausgeschlossen.« Dann spricht er über seinen jüngsten Erfolg, einen Musikchip, der so klein ist, dass er Platz in einer Glitzerpaillette hat und trotzdem mehrere Stunden Musik speichern kann. Ich erinnere mich, dass Octavia während der Hochzeitsaufnahmen davon gesprochen hat, und ich sehe eine Chance, auf den Aufstand anzuspielen.
»Oh ja. Mein Vorbereitungsteam war vor ein paar Monaten ganz sauer darüber, dass sie nicht mehr zu kriegen waren«, sage ich beiläufig. »Ich schätze, eine Menge Bestellungen aus Distrikt 3 mussten warten.«
Beetee mustert mich unter seiner Brille hindurch. »Allerdings. Hattet ihr in der Kohleförderung dieses Jahr auch solche Verzögerungen?«, fragt er.
»Nein. Wir haben nur ein paar Wochen verloren, als wir einen neuen Obersten Friedenswächter samt Mannschaft bekommen haben, aber nichts Gravierendes«, sage ich. »Was die Produktion betrifft, meine ich. Zwei Wochen zu Hause herumzusitzen und nichts zu tun, bedeutet für die meisten Leute allerdings, zwei Wochen zu hungern.«
Ich glaube, sie verstehen, was ich sagen will. Dass es bei uns keinen Aufstand gegeben hat. »Oh. Das ist aber schade«, sagt Wiress leicht enttäuscht. »Ich fand euren Distrikt sehr …« Sie verstummt, abgelenkt von irgendeinem Gedanken.
»… interessant«, ergänzt Beetee. »Fanden wir beide.«
Ich bin etwas betreten, denn ich weiß, dass ihr Distrikt viel mehr gelitten haben muss als unserer. Ich fühle mich genötigt, meine Leute in Schutz zu nehmen. »Wisst ihr, wir sind nicht viele in Distrikt 12«, sage ich. »Das kann man heutzutage ja nicht mehr an der Truppenstärke der Friedenswächter erkennen. Aber ich glaube, wir sind interessant genug.«
Als wir zur Schutzstation hinübergehen, bleibt Wiress stehen und sieht hoch zu den Tribünen, auf denen die Spielmacher herumschlendern, essen und trinken und manchmal auch zu uns herunterschauen. »Guck mal«, sagt sie und nickt sachte in ihre Richtung. Ich schaue auf und sehe Plutarch Heavensbee in seinem prächtigen purpurfarbenen Gewand mit dem Pelzkragen, das ihn als Obersten Spielmacher kennzeichnet. Er nagt an einem Truthahnbein.
Ich weiß zwar nicht, weshalb das der Erwähnung wert ist, aber ich sage trotzdem: »Ja, er ist dieses Jahr zum Obersten Spielmacher befördert worden.«
»Nein, nein. Da, an der Tischecke. Du kannst es gerade noch …«, sagt Wiress.
Beetee schielt unter seiner Brille hindurch. »… erkennen.«
Ratlos starre ich in die angegebene Richtung. Aber dann sehe ich es. An der Ecke des Tisches ist ein Fleck, der fast zu vibrieren scheint, etwa fünfzehn Quadratzentimeter groß. Als würde sich die Luft in winzigen sichtbaren Wellen kräuseln und dabei die scharfen Kanten des Holzes und das Weinglas verzerren, das jemand dort abgestellt hat.
»Ein Kraftfeld. Sie haben ein Kraftfeld zwischen den Spielmachern und uns installiert. Ich frage mich, weshalb«, sagt Beetee.
»Wegen mir wahrscheinlich«, gestehe ich. »Letztes Jahr habe ich während meiner Einzelstunde einen Pfeil auf sie abgeschossen.« Beetee und Wiress schauen mich neugierig an. »Sie haben mich provoziert. Haben denn alle Kraftfelder so einen Fleck?«
»Punkt«, sagt Wiress vage.
»Einen wunden Punkt gewissermaßen«, erklärt Beetee. »Im Idealfall wäre das Kraftfeld unsichtbar, nicht wahr?«
Ich würde gern noch mehr darüber erfahren, doch da werden wir zum Mittagessen gerufen. Ich suche Peeta, aber er hat sich einer Gruppe von ungefähr zehn Siegern angeschlossen, deshalb beschließe ich, mit Distrikt 3 zu essen. Vielleicht stößt Seeder ja noch dazu.
Als wir in den Speisesaal kommen, wird deutlich, dass ein paar aus Peetas Gruppe etwas anderes vorhaben. Sie schieben die kleinen Tische zu einer großen Tafel zusammen, sodass wir alle zusammen essen müssen. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Schon in der Schule habe ich es immer vermieden, an einem voll besetzten Tisch zu essen. Wahrscheinlich hätte ich immer allein gesessen, wäre nicht Madge dazu übergegangen, sich zu mir zu setzen. Am liebsten hätte ich wohl mit Gale gegessen, aber er war zwei Klassen über mir und wir hatten unterschiedliche Pausenzeiten.
Ich nehme ein Tablett und gehe an den mit Essen beladenen Wagen entlang, die ringsum stehen. Beim Eintopf gesellt sich Peeta zu mir. »Wie läuft’s?«
»Gut. Prima. Die Sieger aus Distrikt 3 finde ich nett«, sage ich. »Wiress und Beetee.«
»Wirklich?«, fragt er. »Die anderen machen sich über sie lustig.«
»Wieso überrascht mich das nicht?«, sage ich. Ich erinnere mich daran, dass Peeta in der Schule immer mit einer Schar Freunde herumhing. Komisch, dass er mich überhaupt wahrgenommen hat außer als irgendwie merkwürdig.
»Johanna nennt sie nur Plus und Minus«, sagt er. »Ich glaube, Wiress ist Plus und Beetee ist Minus.«
»Aha, ich bin also blöd, weil ich glaube, dass sie nützlich sein können. Wegen irgendeines Spruchs, den Johanna Mason von sich gegeben hat, während sie ihre Brüste fürs Ringen eingeölt hat«, entgegne ich scharf.
»Ich glaube, ehrlich gesagt, diese Spitznamen tragen sie schon seit Jahren. Und ich hab’s nicht als Beleidigung gemeint. Ich gebe nur Informationen weiter«, sagt er.
»Wiress und Beetee sind schlau. Sie sind Erfinder. Sie erkennen mit bloßem Auge, dass zwischen uns und den Spielmachern ein Kraftfeld installiert wurde. Wenn wir schon Verbündete brauchen, dann möchte ich sie.« Ich werfe den Schöpflöffel zurück in den Topf und spritze uns beide mit Suppe voll.
»Wieso bist du so sauer?«, fragt Peeta, während er sich die Suppe vom T-Shirt wischt. »Weil ich dich im Aufzug geneckt habe? Das tut mir leid. Ich dachte, du würdest darüber lachen.«
»Vergiss es«, sage ich und schüttele den Kopf. »Es hat viele Gründe.«
»Darius«, sagt er.
»Darius. Die Spiele, Haymitch, der meint, wir mussten uns mit anderen verbünden«, sage ich.
»Wir beide allein ginge auch, das weißt du«, sagt er.
»Ich weiß. Vielleicht hat Haymitch ja auch recht«, sage ich. »Sag’s ihm bitte nicht weiter, aber was die Spiele anbelangt, hat er eigentlich immer recht.«
»Na ja, du kannst ja das letzte Wort haben, was unsere Verbündeten betrifft. Ich für meinen Teil gehe jetzt zu Chaff und Seeder«, sagt Peeta.
»Seeder ist genehmigt, Chaff nicht«, sage ich. »Zumindest noch nicht.«
»Komm und iss mit ihm. Ich verspreche, ich werde verhindern, dass er dich noch mal küsst«, sagt Peeta.
Beim Mittagessen macht Chaff gar keinen schlechten Eindruck. Er ist nüchtern. Er spricht zwar zu laut und reißt dauernd schlechte Witze, aber die meisten gehen auf seine Kosten. Ich begreife, warum er Haymitch mit seinen düsteren Gedanken guttut. Aber ich weiß noch nicht recht, ob ich bereit bin, mich mit ihm zu verbünden.
Ich bemühe mich, geselliger zu sein, nicht nur, was Chaff betrifft, sondern gegenüber der ganzen Gruppe. Nach dem Essen gehe ich an die Essbare-Insekten-Station, wo schon die Tribute aus Distrikt 8 stehen: Cecelia, die drei Kinder zu Hause hat, und Woof, ein alter Bursche, der schwerhörig ist und offenbar nicht recht weiß, worum es hier geht, denn er versucht, sich giftige Käfer in den Mund zu stopfen. Ich würde gern meine Begegnung mit Bonnie und Twill in den Wäldern erwähnen, aber ich weiß nicht, wie. Cashmere und Gloss, das Geschwisterpaar aus Distrikt 1, winken mich zu sich, und wir flechten eine Weile Hängematten. Die beiden sind höflich, aber kühl, und ich muss die ganze Zeit daran denken, wie ich letztes Jahr Glimmer und Marvel, die beiden Tribute aus ihrem Distrikt, getötet habe.
Wahrscheinlich kannten sie sie, vielleicht waren sie sogar ihre Mentoren. Sowohl meine Hängematte als auch mein Versuch, Kontakt herzustellen, gelingen mehr schlecht als recht. Ich gehe zu Enobaria beim Schwertkampf, wir wechseln ein paar Bemerkungen, doch es ist offensichtlich, dass sich keine mit der anderen verbünden will. Ich bekomme gerade Tipps zum Fischen, als Finnick wieder auftaucht, aber diesmal möchte er mir einfach nur Mags vorstellen, die ältere Frau, die wie er aus Distrikt 4 stammt. Wegen ihres Distriktakzents und ihrer brabbeligen Aussprache - vemudich hat sie einen Schlaganfall hinter sich - verstehe ich nur ein Viertel von dem, was sie sagt. Aber dafür kann sie buchstäblich aus allem Angelhaken herstellen - aus Dornen, dem Schlüsselbein eines Vogels, einem Ohrring. Nach einer Weile höre ich nicht mehr auf das, was der Trainer sagt, sondern versuche nur noch nachzumachen, was Mags tut. Als ich aus einem krummen Nagel einen ordentlichen Haken fabriziere und ihn an eine Schnur aus Strähnen meiner Haare binde, schenkt sie mir ein zahnloses Lächeln und einen unverständlichen Kommentar, möglicherweise ein Lob. Plötzlich fällt mir wieder ein, wie sie sich anstelle der hysterischen jungen Frau aus ihrem Distrikt freiwillig gemeldet hat. Bestimmt nicht, weil sie sich Chancen ausgerechnet hat, die Spiele zu gewinnen. Sie wollte das Mädchen retten, so wie ich mich letztes Jahr gemeldet habe, um Prim zu retten. Ich beschließe, dass Mags zu meinem Team gehören soll.
Großartig. Jetzt muss ich Haymitch sagen, dass ich eine Achtzigjährige sowie Plus und Minus als Verbündete haben will. Das findet er bestimmt toll.
Ich geb’s auf, Freunde finden zu wollen, und gehe zur Erholung hinüber zum Bogenschießstand. Es ist wunderbar, all die verschiedenen Bogen und Pfeile auszuprobieren. Als Tax, der Trainer, merkt, dass stehende Ziele für mich keine Herausforderung sind, wirft er Stoffvögel hoch in die Luft, und ich muss sie abschießen. Erst kommt mir das albern vor, aber dann macht es doch Spaß. Sogar mehr, als ein Lebewesen zu jagen. Da ich alles treffe, was er hochwirft, beginnt er mehrere Vögel gleichzeitig zu werfen. Ich vergesse die Turnhalle um mich herum und die Sieger und mein Unglück und gebe mich ganz dem Schießen hin. Als ich fünf Vögel auf einmal abschieße, wird es um mich herum so ruhig, dass ich höre, wie sie einzeln auf dem Boden aufschlagen. Ich drehe mich um und sehe, dass fast alle Sieger ihr Treiben unterbrochen haben und mir zuschauen. In ihren Gesichtern spiegelt sich alles, von Neid über Hass bis zu Bewunderung.
Nach dem Training lungern Peeta und ich herum und warten, dass Haymitch und Effie erscheinen. Als wir zum Abendessen gerufen werden, stürzt sich Haymitch sofort auf mich. »Mindestens die Hälfte der Sieger hat ihre Mentoren angewiesen, dich als Wunschverbündete anzugeben. Kann mir nicht vorstellen, dass es wegen deines sonnigen Wesens ist.«
»Sie haben sie schießen gesehen«, sagt Peeta lächelnd. »Und ich habe sie auch zum ersten Mal richtig schießen gesehen. Ich trage mich mit dem Gedanken, ebenfalls einen förmlichen Antrag zu stellen.«
»Bist du wirklich so gut?«, fragt Haymitch mich. »So gut, dass Brutus dich will?«
Ich zucke die Schultern. »Aber ich will Brutus nicht. Ich will Mags und die beiden aus Distrikt 3.«
»Das war ja klar«, seufzt Haymitch und bestellt eine Flasche Wein. »Ich werde allen sagen, du überlegst noch.«
Nach meiner Schießdarbietung kommt nur noch hier und da mal eine Stichelei, aber ich fühle mich nicht mehr verspottet. Es kommt mir vor, als wäre ich erst jetzt in den Kreis der Sieger aufgenommen worden. An den folgenden beiden Tagen verbringe ich viel Zeit mit fast jedem, der in die Arena muss. Sogar mit den Morfixern, die mich mit Peetas Hilfe anmalen und in ein Feld aus gelben Blumen verwandeln. Sogar mit Finnick, der mir im Tausch für eine Stunde Bogenschießen eine Stunde lang beibringt, wie man mit dem Dreizack umgeht. Und je besser ich diese Leute kennenlerne, desto schlimmer wird es. Denn ich hasse sie ja nicht. Manche mag ich sogar. Und viele sind so lädiert, dass ich sie eigentlich instinktiv beschützen möchte. Aber sie alle müssen sterben, damit ich Peeta retten kann.
Der letzte Tag des Trainings endet mit unseren Einzelstunden. Jeder hat fünfzehn Minuten, um die Spielmacher mit seinen Fähigkeiten für sich einzunehmen, aber ich weiß nicht, was wir ihnen zeigen könnten. Beim Mittagessen machen wir uns darüber lustig. Darüber, was wir tun könnten. Singen, tanzen, strippen, Witze erzählen. Mags, die ich jetzt ein bisschen besser verstehe, meint, sie werde einfach ein Nickerchen halten. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Ein paar Pfeile abschießen, schätze ich mal. Haymitch hat gesagt, dass wir sie möglichst überraschen sollen, nur fällt mir absolut nichts ein.
Ich bin das Mädchen aus Distrikt 12 und deshalb komme ich als Letzte dran. Je mehr Tribute zu ihrem Auftritt gerufen werden, desto stiller wird es im Speisesaal. Zu mehreren fällt es leichter, respektlos und unbesiegbar zu wirken, wie wir es uns alle angewöhnt haben. Bei jedem, der durch die Tür geht, denke ich unwillkürlich, dass er höchstens noch ein paar Tage zu leben hat.
Schließlich sind nur noch Peeta und ich übrig. Er fasst über den Tisch meine Hände. »Hast du dich schon entschieden, was du den Spielmachern zeigen willst?«
Ich schüttele den Kopf. »Ich kann sie nicht noch einmal als Zielscheibe benutzen, wegen des Kraftfelds. Vielleicht bastele ich ein paar Angelhaken. Und du?«
»Keine Ahnung. Ich wünsche mir die ganze Zeit, ich könnte einen Kuchen backen oder so was«, sagt er.
»Mach was mit Tarnung«, schlage ich vor.
»Falls die Morfixer mir etwas übrig gelassen haben«, sagt er spöttisch. »Das ganze Training über sind sie an dieser einen Station geblieben wie festgeklebt.«
Wir sitzen eine Weile still da, dann platze ich mit der Sache heraus, die uns beiden auf der Seele liegt. »Wie sollen wir es nur anstellen, diese Leute zu töten, Peeta?«
»Ich weiß es nicht.« Er legt die Stirn auf unsere umschlungenen Hände.
»Ich will sie nicht als Verbündete haben. Warum wollte Haymitch, dass wir sie kennenlernen?«, sage ich. »Das wird es viel schwieriger machen als beim letzten Mal. Rue einmal ausgenommen. Aber ich glaube, sie hätte ich sowieso nie töten können. Sie war Prim einfach zu ähnlich.«
Peeta schaut zu mir hoch, die Brauen nachdenklich zusammengezogen. »Ihr Tod war der abscheulichste, nicht wahr?«
»Keiner war besonders schön«, sage ich und muss an Glimmers und Catos Ende denken.
Dann wird Peeta hereingerufen und ich warte ganz allein. Fünfzehn Minuten vergehen, eine halbe Stunde. Erst nach fast vierzig Minuten werde ich aufgerufen.
Als ich hineinkomme, nehme ich den scharfen Geruch von Putzmittel wahr und bemerke, dass eine der Matten in die Mitte des Raums gezogen wurde. Die Stimmung ist ganz anders als letztes Jahr, als die Spielmacher halb betrunken und eigentlich nur damit beschäftigt waren, Leckerbissen vom Büfett zu picken. Sie flüstern miteinander und wirken leicht ungehalten. Was hat Peeta getan? Hat er sie gegen sich aufgebracht?
Plötzlich mache ich mir Sorgen. Das ist nicht gut. Ich möchte nicht, dass Peeta den Zorn der Spielmacher auf sich zieht. Das ist meine Aufgabe. Peeta aus der Schusslinie zu bringen. Aber womit hat er sie bloß gegen sich aufgebracht? Ich würde es ihm gern gleichtun, und noch mehr. Die selbstgefällige Fassade dieser Leute durchbrechen, die ihren Grips darauf verwenden, sich amüsante Todesarten für uns auszumalen. Ihnen klarzumachen, dass nicht nur wir den Grausamkeiten des Kapitols schutzlos ausgesetzt sind, sondern auch sie selbst.
Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie sehr ich euch hasse?, denke ich. Euch, die ihr eure Talente in den Dienst der Spiele stellt?
Ich versuche, Plutarch Heavensbee in die Augen zu schauen, aber er scheint mich genauso demonstrativ zu ignorieren wie während der ganzen Trainingsphase schon. Mir fällt ein, wie er mich zum Tanzen aufgefordert hat, wie erfreut er war, als er mir den Spotttölpel auf seiner Uhr zeigte. Für derartige Freundlichkeiten ist hier kein Platz. Wie auch, schließlich bin ich ein einfacher Tribut und er ist der Oberste Spielmacher. So mächtig, so unerreichbar, so sicher …
Plötzlich weiß ich, was ich tun werde. Etwas, das alles, was Peeta getan haben mag, in den Schatten stellen wird. Ich gehe zur Knotenstation und nehme ein Seil. Ich versuche mich an einem bestimmten Knoten, aber es ist schwer, denn diesen Knoten habe ich noch nie selbst gemacht. Ich habe nur ein Mal Finnicks geschickten Fingern dabei zugeschaut, und damals ist alles so schnell gegangen. Nach zehn Minuten habe ich dann aber doch eine passable Schlinge zustande gebracht. Ich befestige sie an einer Klimmzugstange, ziehe eine der Zielpuppen in die Mitte des Raums, hebe sie hoch und lege ihr die Schlinge um den Hals, sodass sie an der Stange herunterbaumelt. Ich könnte ihr jetzt noch die Hände auf den Rücken binden, das wäre ein nettes Detail, aber dafür wird die Zeit vielleicht zu knapp. Ich renne zur Tarnstation, wo irgendwelche Tribute, bestimmt die Morfixer, eine Riesensauerei veranstaltet haben. Trotzdem finde ich noch einen angebrochenen Behälter mit blutrotem Beerensaft, der für meine Zwecke vollkommen ausreicht. Der fleischfarbene Stoff der Puppenhaut bildet eine gute, aufnahmefähige Leinwand. Sorgfältig und so, dass die Spielmacher es nicht sehen können, male ich mit den Fingern zwei Wörter auf den Puppenkörper. Dann trete ich rasch beiseite, um die Reaktion in den Gesichtern der Spielmacher zu beobachten, als sie den Namen auf der Puppe lesen.
SENECA CRANE.
17
Die Wirkung auf die Spielmacher ist prompt und zufriedenstellend. Einige stoßen spitze Schreie aus. Anderen fällt das Weinglas aus der Hand und zerschellt mit Getöse auf dem Boden. Zwei scheinen in Ohnmacht fallen zu wollen. Allenthalben erschrockene Gesichter.
Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von Plutarch Heavensbee. Während ihm der Saft des Pfirsichs, den er in der Hand zerquetscht hat, durch die Finger rinnt, starrt er mich schweigend an. Schließlich räuspert er sich und sagt: »Sie können jetzt gehen, Miss Everdeen.«
Ich nicke ehrerbietig und wende mich zum Gehen, doch dann kann ich nicht widerstehen und werfe die Dose mit dem Beerensaft hinter mich. Ich höre, wie der Inhalt gegen die Puppe klatscht, während weitere Weingläser zerschellen. Kurz bevor sich die Tür des Aufzugs schließt, sehe ich gerade noch, dass niemand sich gerührt hat.
Damit haben sie nicht gerechnet, denke ich. Es war unüberlegt und gefährlich und zweifellos werde ich zehnfach und mehr dafür bezahlen müssen. Doch für den Augenblick empfinde ich fast so etwas wie Euphorie und genieße es einfach.
Ich möchte sofort zu Haymitch und ihm von meiner Einzelstunde erzählen, aber es ist niemand da. Vermutlich machen sie sich alle fürs Abendessen zurecht, also beschließe ich, auch zu duschen, denn meine Hände kleben von dem Saft. Unter dem Wasserstrahl überlege ich, ob es klug war, was ich da eben gemacht habe. Mein Handeln sollte jetzt eigentlich immer von der Frage geleitet werden: »Helfe ich damit Peeta, am Leben zu bleiben?« Für diese Aktion trifft das wohl nicht zu, wenn auch indirekt. Was beim Training geschieht, ist streng geheim, und wenn niemand erfährt, was ich angestellt habe, gibt es auch keinen Grund, gegen mich vorzugehen. Letztes Jahr wurde ich für meine Dreistigkeit sogar belohnt. Doch das hier ist eine Art Verbrechen. Wenn die Spielmacher wütend auf mich sind und beschließen, mich in der Arena zu bestrafen, könnte auch Peeta davon betroffen sein. Vielleicht war ich zu impulsiv. Trotzdem … ich kann nicht behaupten, dass ich es bereue.
Als wir uns alle zum Abendessen versammeln, sehe ich Farbflecken auf Peetas Händen, obwohl seine Haare noch feucht sind vom Duschen. Anscheinend hat er doch irgendeine Tarnung vorgeführt. Als die Suppe serviert wird, spricht Haymitch direkt an, was alle beschäftigt. »Und, wie ist eure Einzelstunde gelaufen?«
Ich tausche einen Blick mit Peeta. Irgendwie bin ich nicht so scharf darauf, das, was ich getan habe, in Worte zu fassen. In der Stille des Speisesaals wirkt es so ungeheuerlich. »Du zuerst«, sage ich. »Das muss ja wirklich was Besonderes gewesen sein. Ich musste vierzig Minuten warten, bis ich reindurfte.«
Peeta wirkt ebenso unwillig wie ich. »Also, ich … ich hab diese Tarnungsnummer vorgeführt, wie du vorgeschlagen hast, Katniss.« Er zögert. »Tarnung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich meine, ich hab was mit Farben gemacht.«
»Und was?«, fragt Portia.
Mir fällt wieder ein, wie ungehalten die Spielmacher wirkten, als ich zu meiner Einzelstunde in die Turnhalle kam. Der Geruch nach Putzmittel. Die Matte über dem Fleck in der Mitte der Turnhalle. Wollten sie damit etwas verdecken, was sich nicht entfernen ließ? »Du hast was gemalt, oder? Ein Bild.«
»Hast du es gesehen?«, fragt Peeta.
»Nein. Aber sie haben sich große Mühe gegeben, es zu verdecken«, sage ich.
»Das ist ja nichts Besonderes. Kein Tribut darf erfahren, was die anderen gemacht haben«, sagt Effie unbeeindruckt. »Was hast du gemalt, Peeta?« Ihr Blick wird weich. »Ein Bild von Katniss?«
»Wieso sollte er ein Bild von mir malen, Effie?«, frage ich leicht verärgert.
»Um zu zeigen, dass er alles Menschenmögliche tun wird, um dich zu beschützen. Das erwarten sowieso alle im Kapitol. Hat er sich nicht freiwillig gemeldet, um mit dir in die Arena zu gehen?«, sagt Effie, als wäre es das Offensichtlichste auf der Welt.
»Ich habe aber ein Bild von Rue gemalt«, sagt Peeta. »Wie sie aussah, als Katniss sie mit Blumen bedeckt hatte.«
Am Tisch bleibt es lange still, während alle die Worte verdauen.
»Und was genau wolltest du damit bezwecken?«, fragt Haymitch, der sich nur mit Mühe beherrschen kann.
»Ich weiß nicht recht. Ich wollte sie zur Verantwortung ziehen, und sei es nur für einen Augenblick«, sagt Peeta. »Dafür, dass sie das kleine Mädchen ermordet haben.«
»Das ist entsetzlich.« Effie hört sich so an, als würde sie gleich anfangen zu weinen. »So zu denken … das ist verboten, Peeta. Absolut. Damit bringst du dich und Katniss nur in Schwierigkeiten.«
»Da muss ich Effie zustimmen«, sagt Haymitch. Portia und Cinna schweigen, aber ihre Gesichter sind todernst. Natürlich haben sie recht. Doch obwohl es mich mit Sorge erfüllt - ich finde das, was Peeta getan hat, bewundernswert.
»Wahrscheinlich ist das jetzt kein guter Moment zu erwähnen, dass ich eine Puppe erhängt und den Namen Seneca Cranes daraufgeschrieben habe«, sage ich. Meine Worte haben den gewünschten Effekt. Nach einem Augenblick der Fassungslosigkeit trifft mich das gesammelte Missfallen im Raum wie ein Hammer.
»Du … hast … Seneca Crane erhängt?«, sagt Cinna.
»Ja. Ich hab meine neuen Knotentechniken vorgeführt und irgendwie ist er in die Schlinge geraten«, sage ich.
»Oh, Katniss«, sagt Effie gedämpft. »Woher weißt du überhaupt davon?«
»Ist das ein Geheimnis? Präsident Snow hat nicht so getan, als ob es eins wäre. Er schien sogar ganz wild darauf zu sein, dass ich davon erfahre«, sage ich. Effie steht vom Tisch auf und rennt hinaus, eine Serviette vors Gesicht gepresst. »Jetzt habe ich Effie aufgeregt. Ich hätte lügen und erzählen sollen, ich hätte ein paar Pfeile abgeschossen.«
»Man könnte meinen, wir hätten das geplant«, sagt Peeta und sieht mich mit einem schwachen Lächeln an.
»Habt ihr das nicht?«, fragt Portia. Sie hält sich mit den Fingern die Lider zu, als müsste sie die Augen vor einem grellen Licht schützen.
»Nein«, sage ich und schaue Peeta mit neuer Hochachtung an. »Als wir reingingen, hatten wir noch gar keine Ahnung, was wir machen sollten.«
»Und übrigens, Haymitch«, sagt Peeta. »Wir haben beschlossen, dass wir in der Arena keine weiteren Verbündeten haben wollen.«
»Das ist gut. Dann bin ich nicht dafiir verantwortlich, wenn ihr mit eurer Dämlichkeit einen meiner Freunde umbringt«, sagt er.
»Genau das haben wir uns auch gedacht«, sage ich.
Schweigend essen wir zu Ende, aber als wir aufstehen, um in den Salon zu gehen, legt Cinna mir den Arm um und drückt mich. »Komm, jetzt holen wir uns die Bewertungen für die Einzelstunde ab.«
Wir versammeln uns um den Fernseher und Effie gesellt sich mit verweinten Augen dazu. Die Gesichter der Tribute erscheinen, ein Distrikt nach dem anderen, und unter den Porträts leuchten die Punktzahlen auf. Von eins bis zwölf. Die erwartungsgemäß hohen Wertungen für Cashmere, Gloss, Brutus, Enobaria und Finnick. Mittel bis niedrig für die Übrigen.
»Gab es auch schon mal null Punkte?«, frage ich.
»Nein, aber es gibt immer ein erstes Mal«, antwortet Cinna.
Und damit hat er recht. Denn Peeta und ich bekommen beide eine Zwölf und das ist in der Geschichte der Hungerspiele noch nie vorgekommen. Doch niemandem ist nach Feiern zumute.
»Warum haben sie das gemacht?«, frage ich.
»Damit den anderen gar nichts anderes übrig bleibt, als euch ins Visier zu nehmen«, sagt Haymitch rundheraus. »Geht ins Bett. Ich kann euch jetzt nicht mehr sehen.«
Schweigend begleitet Peeta mich zu meinem Zimmer, doch bevor er Gute Nacht sagen kann, schlinge ich die Arme um ihn und lege den Kopf an seine Brust. Seine Hände wandern meinen Rücken hoch und seine Wange ruht an meinem Haar. »Tut mir leid, wenn ich alles noch schlimmer gemacht hab«, sage ich.
»Nicht schlimmer als ich. Warum hast du das denn getan?«, sagt er.
»Ich weiß nicht. Vielleicht, um ihnen zu zeigen, dass ich mehr bin als eine Figur in ihren Spielen.«
Er lacht leise, bestimmt denkt er an letztes Jahr, an die Nacht vor den Spielen. Da waren wir auf dem Dach, keiner von uns konnte schlafen. Damals hat Peeta auch so etwas in der Art gesagt, aber ich verstand nicht, was er meinte. Jetzt verstehe ich es.
»Ich auch«, sagt er. »Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich es nicht versuchen werde. Dich nach Hause zu bekommen, meine ich. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll …«
»Wenn du ganz ehrlich sein sollst, dann glaubst du, dass Präsident Snow Anweisung gegeben hat, dafür zu sorgen, dass wir ohnehin in der Arena sterben«, sage ich.
»Diesen Gedanken hatte ich, ja«, sagt Peeta.
Auch mir ist dieser Gedanke gekommen. Und nicht nur einmal. Doch während ich mir sicher bin, dass ich die Arena auf keinen Fall lebend verlassen werde, hoffe ich noch immer, dass Peeta es schafft. Schließlich hat nicht er die Beeren herausgeholt, sondern ich. Niemand hat je daran gezweifelt, dass Peeta dem Kapitol nur aus Liebe Widerstand geleistet hat. Also lässt Präsident Snow ihn vielleicht lieber am Leben - niedergeschmettert, mit gebrochenem Herzen, als lebende Warnung für andere.
»Aber selbst wenn, werden alle wissen, dass wir gekämpft haben, stimmt’s?«, sagt Peeta.
»Genau«, sage ich. Und zum ersten Mal habe ich Abstand zu meiner eigenen Tragödie, die mich seit der Verkündung des Jubel-Jubiläums beschäftigt hat. Ich denke an den alten Mann, den sie in Distrikt 11 niedergeschossen haben, und an Bonnie und Twill und die Gerüchte über die Aufstände. Ja, alle in den Distrikten werden mir zuschauen, um zu sehen, wie ich mit dieser Todesstrafe umgehe, mit dieser letzten Machtdemonstration von Präsident Snow. Sie werden nach einem Zeichen Ausschau halten, dass ihre Kämpfe nicht vergebens waren. Wenn ich deutlich machen kann, dass ich mich dem Kapitol bis zum Ende widersetze, dann wird man zwar mich getötet haben … nicht jedoch meinen Geist. Gibt es eine bessere Möglichkeit, den Rebellen Hoffnung zu machen?
Das Schöne an dieser Idee ist, dass schon meine Entscheidung, Peeta zu retten, indem ich mein eigenes Leben opfere, einen Akt des Widerstands darstellt. Eine Weigerung, die Hungerspiele nach den Regeln des Kapitols zu spielen. Meine privaten Interessen sind im Einklang mit meinen politischen. Und wenn ich Peeta wirklich retten könnte … Für eine Revolution wäre das optimal. Denn tot bin ich mehr wert als lebendig. Sie können mich zu einer Märtyrerin erheben und mein Gesicht auf Fahnen malen, und das wird die Leute besser mobilisieren, als eine lebende Katniss es könnte. Aber Peeta wird lebendig mehr wert sein, als tragischer Held wird er seinen Schmerz in Worte fassen können, die die Menschen verändern.
Peeta würde ausrasten, wenn er wüsste, dass ich so etwas denke, deshalb sage ich nur: »Und was sollen wir mit unseren letzten Tagen anfangen?«
»Ich würde gern jede Minute meines restlichen Lebens mit dir verbringen«, antwortet er.
»Dann komm«, sage ich und ziehe ihn in mein Zimmer.
Es ist der reine Luxus, wieder mit Peeta in einem Bett zu schlafen. Erst jetzt merke ich, wie sehr es mich nach menschlicher Nähe verlangt. Nach seinem Körper neben mir in der Dunkelheit. Hätte ich die letzten Nächte doch nicht vergeudet, indem ich ihn aussperrte. Ich lasse mich in den Schlaf sinken, eingehüllt in seine Wärme, und als ich die Augen öffne, flutet das Tageslicht durch die Fenster herein.
»Keine Albträume«, sagt er.
»Keine Albträume«, bestätige ich. »Und du?«
»Auch keine. Ich hatte schon ganz vergessen, wie es ist, eine Nacht richtig zu schlafen.«
Eine Weile liegen wir da, wir haben es nicht eilig, den Tag zu beginnen. Morgen Abend sind die Fernsehinterviews, also werden Effie und Haymitch uns heute darauf vorbereiten. Schon wieder hochhackige Schuhe und sarkastische Bemerkungen, denke ich. Doch dann bringt uns das rothaarige Avoxmädchen einen Zettel von Effie, auf dem steht, dass sie und Haymitch nach der Tour durch die Disktrikte der Meinung seien, dass wir uns in der Öffentlichkeit angemessen zu verhalten wüssten. Die Vorbereitungssitzungen sind gestrichen.
»Echt?«, sagt Peeta, nimmt mir den Zettel aus der Hand und wirft einen Blick darauf. »Weißt du, was das heißt? Wir haben den ganzen Tag für uns!«
»Schade, dass wir nirgendwohin können«, sage ich wehmütig.
»Wer sagt das?«, fragt er.
Das Dach. Wir bestellen jede Menge Essen, schnappen uns ein paar Decken und verziehen uns zu einem Picknick aufs Dach. Ein Picknick von morgens bis abends im Blumengarten, in dem überall die Windspiele klimpern. Wir essen. Wir liegen in der Sonne. Ich breche herabhängende Lianen ab und nutze mein neues Wissen aus dem Training, um Knoten zu machen und Netze zu knüpfen. Peeta zeichnet mich. Wir erfinden ein Spiel mit dem Kraftfeld, von dem das Dach umgeben ist - einer wirft einen Apfel hinein, und der andere muss ihn fangen.
Niemand stört uns. Am späten Nachmittag liege ich mit dem Kopf in Peetas Schoß und flechte einen Blumenkranz, während er die Hände in meinem Haar hat, um Knoten zu üben, wie er behauptet. Nach einer Weile verharren seine Hände. »Was ist?«, frage ich.
»Am liebsten würde ich diesen Augenblick anhalten, hier und jetzt, und für immer darin leben«, sagt er.
Normalerweise bekomme ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen und fühle mich schrecklich, wenn er solche Bemerkungen macht und auf seine unsterbliche Liebe zu mir anspielt. Doch in diesem Moment fühle ich mich so warm und entspannt, so weit entfernt von der Sorge um eine Zukunft, die ich niemals haben werde, dass ich das Wort einfach hinausschlüpfen lasse. »Okay.«
Ich höre das Lächeln in seiner Stimme. »Dann lässt du es zu?«
»Ich lasse es zu«, sage ich.
Er vergräbt die Finger wieder in meinem Haar, und ich döse ein, doch zum Sonnenuntergang weckt er mich. Es ist ein spektakulärer gelborangefarbener Lichtschein hinter der Skyline des Kapitols. »Den willst du dir bestimmt nicht entgehen lassen, dachte ich mir«, sagt er.
»Danke«, sage ich. Ich kann die Sonnenuntergänge, die mir noch bleiben, an den Fingern abzählen, und keinen davon möchte ich versäumen.
Zum Abendessen gehen wir nicht zu den anderen, es ruft uns auch niemand.
»Ein Glück. Ich bin es leid, alle um mich herum so unglücklich zu machen«, sagt Peeta. »Zum Weinen zu bringen. Und Haymitch …« Er braucht nicht weiterzusprechen.
Wir bleiben auf dem Dach, bis es Zeit zum Schlafengehen ist, dann huschen wir leise hinunter und in mein Zimmer, ohne jemandem zu begegnen.
Am nächsten Morgen werden wir von meinem Vorbereitungsteam geweckt. Der Anblick von Peeta und mir, wie wir nebeneinander schlafen, ist zu viel für Octavia, sie bricht sofort in Tränen aus. »Denk daran, was Cinna uns gesagt hat«, sagt Venia eindringlich. Octavia nickt und geht schluchzend aus dem Zimmer.
Peeta muss zur Vorbereitung in sein Zimmer und ich bleibe mit Venia und Flavius allein. Das übliche Geplapper fällt heute aus. Es wird überhaupt kaum geredet, höchstens wenn ich das Kinn heben soll oder wenn etwas über eine Schminktechnik gesagt wird. Es ist fast Mittag, als ich merke, dass etwas auf meine Schulter tropft, und als ich mich umdrehe, sehe ich Flavius, wie er mir die Haare schneidet, während ihm stumm die Tränen über das Gesicht laufen. Venia wirft ihm einen strengen Blick zu und da legt er die Schere vorsichtig auf dem Tisch ab und geht.
Dann ist nur noch Venia übrig, ihre Haut ist so blass, dass die Tattoos herauszuspringen scheinen. Fast starr vor Entschlossenheit frisiert sie mich, sie manikürt mir die Nägel und schminkt mich mit schnellen Fingern, so macht sie das Fehlen ihrer Kollegen wett. Die ganze Zeit weicht sie meinem Blick aus. Erst als Cinna kommt, um mich zu begutachten, nimmt sie meine Hände, schaut mir direkt in die Augen und sagt: »Wir möchten dir alle sagen, was für eine … Ehre es war, dich schön machen zu dürfen.« Dann geht sie eilig aus dem Zimmer.
Mein Vorbereitungsteam. Meine albernen, oberflächlichen, liebevollen Schätzchen mit ihren Feder-und Partyticks brechen mir mit ihrem Abschied fast das Herz. Venias letzte Worte zeigen es deutlich: Wir alle wissen, dass ich nicht zurückkehren werde. Weiß es die ganze Welt?, frage ich mich. Ich schaue Cinna an. Er weiß es, ganz bestimmt. Doch er hält sein Versprechen, von ihm drohen keine Tränen.
»Also, was ziehe ich heute Abend an?«, frage ich mit einem Blick auf die Tasche, in der mein Kleid steckt.
»Präsident Snow höchstpersönlich hat die Kleiderordnung festgelegt«, sagt Cinna. Er zieht den Reißverschluss auf, und zum Vorschein kommt eins der Hochzeitskleider, die ich beim Fototermin getragen habe. Schwere weiße Seide mit tiefem Ausschnitt, eng anliegender Taille und Ärmeln, die vom Handgelenk bis zum Boden fallen. Und Perlen über Perlen. Eingestickt in das Kleid und in die Bänder, die ich um den Hals trage, ebenso wie auf der Krone für den Schleier. »Am Abend des Fotoshootings wurde zwar das Jubel-Jubiläum verkündet, aber die Leute haben trotzdem über ihr Lieblingskleid abgestimmt, und das hier hat gewonnen. Der Präsident sagt, du musst es heute Abend tragen. Unsere Einwände blieben ungehört.«
Ich reibe ein Stück Seide zwischen den Fingern und versuche Präsident Snows Gedankengang nachzuvollziehen. Da mich die größte Schuld trifft, will er offenbar meinen Schmerz, meinen Verlust und meine Erniedrigung in den Mittelpunkt rücken. Und hiermit glaubt er das deutlich machen zu können. Es ist so barbarisch, mein Hochzeitskleid zu meinem Totenhemd zu machen, dass es mich hart trifft und einen dumpfen Schmerz in meinem Innern hinterlässt. »Tja, es war ja auch schade um das schöne Kleid«, ist alles, was ich sage.
Vorsichtig hilft Cinna mir in das Kleid. Als ich es auf den Schultern spüre, ziehe ich sie unwillkürlich hoch. »War das immer schon so schwer?«, frage ich. Ich erinnere mich, dass einige der Kleider aus dickem Stoff waren, aber dieses scheint einen Zentner zu wiegen.
»Ich musste es wegen der Beleuchtung ein wenig ändern«, sagt Cinna. Ich nicke, ohne zu verstehen, was das damit zu tun hat. Er zieht mir die Schuhe an und schmückt mich mit Perlen und Schleier. Verleiht meinem Make-up den letzten Strich. Lässt mich ein paar Schritte gehen.
»Du siehst hinreißend aus«, sagt er. »Katniss, das Oberteil ist so passgenau, dass ich dich bitte, die Arme nicht über den Kopf zu heben. Jedenfalls nicht, ehe du dich drehst.«
»Soll ich mich wieder drehen?«, frage ich und denke an mein Kleid vom letzten Jahr.
»Bestimmt wird Caesar dich darum bitten. Und wenn nicht, schlag es selbst vor. Aber nicht gleich. Bewahr es dir für das große Finale auf«, sagt Cinna.
»Gib mir ein Zeichen, damit ich Bescheid weiß, wann es so weit ist«, sage ich.
»Mach ich. Hast du dir für das Interview irgendwas überlegt? Ich weiß, dass Haymitch es ganz euch überlassen hat«, sagt er.
»Nein, dieses Jahr werde ich einfach improvisieren. Komischerweise bin ich überhaupt nicht aufgeregt.« Das bin ich wirklich nicht. Sosehr Präsident Snow mich auch hassen mag, das Publikum im Kapitol gehört mir.
Wir treffen Effie, Haymitch, Portia und Peeta vor dem Aufzug. Peeta trägt einen eleganten Smoking und weiße Handschuhe. So zieht man sich hier im Kapitol als Bräutigam an.
Bei uns zu Hause ist alles so viel bescheidener. Die Frau leiht sich normalerweise ein weißes Kleid, das schon unzählige Male getragen wurde. Der Mann zieht irgendetwas Sauberes an, das er nicht im Bergwerk trägt. Sie füllen im Justizgebäude ein paar Formulare aus und dann wird ihnen ein Haus zugewiesen. Freunde und Verwandte kommen zu einem Essen oder etwas Kuchen zusammen, wenn man es sich leisten kann. Und auch wenn nicht, ein traditionelles Lied wird immer gesungen, wenn das Paar über die Schwelle zum neuen Heim tritt. Und dann haben wir eine kleine Zeremonie: Das Brautpaar zündet sein erstes Feuer an, röstet ein wenig Brot und teilt es. Es mag altmodisch sein, aber bevor man das Brot nicht geröstet hat, fühlt man sich in Distrikt 12 nicht richtig verheiratet.
Die anderen Tribute haben sich bereits hinter den Kulissen versammelt und reden leise miteinander, doch als Peeta und ich kommen, verstummen sie. Ich merke, dass sie alle mein Brautkleid anstarren. Sind sie neidisch, weil es so schön ist? Darauf, dass es vielleicht die Macht hat, die Massen zu beeinflussen?
Schließlich sagt Finnick: »Ich fasse es nicht, dass Cinna dich in dieses Ding gesteckt hat.«
»Er hatte keine Wahl. Präsident Snow hat ihn gezwungen«, sage ich trotzig. Ich lasse es nicht zu, dass jemand etwas gegen Cinna sagt.
Cashmere wirft die blonde Lockenmähne zurück und giftet: »Du siehst lächerlich aus!« Sie fasst ihren Bruder bei der Hand und zieht ihn mit sich, damit sie die Prozession auf die Bühne anführen können. Auch die anderen Tribute stellen sich auf. Ich bin verwirrt, denn irgendwie sind alle wütend, aber manche klopfen uns trotzdem mitfühlend auf die Schulter, und Johanna Mason bleibt sogar stehen, um meine Perlenkette zu richten.
»Zahl es ihm heim, ja?«, sagt sie.
Ich nicke, aber ich weiß nicht, was sie meint. Erst als wir alle auf der Bühne sitzen und Caesar Flickerman, Haare und Gesicht dieses Jahr lavendelfarben, seinen Eröffnungssermon hinter sich gebracht hat und die Tribute mit den Interviews beginnen - erst da wird mir bewusst, wie betrogen sich die meisten Sieger fühlen und wie wütend sie sind. Doch sie sind gerissen, sie drücken es so gekonnt aus, dass alles auf die Regierung und besonders auf Präsident Snow zurückfällt. Zwar gilt das nicht für alle, zum Beispiel nicht für die Unverbesserlichen, Brutus und Enobaria, für die dies einfach nur irgendwelche Spiele sind, und einige andere, die zu verwirrt oder betäubt oder verloren sind, um bei dem Angriff mitzumachen. Doch es gibt genügend Sieger, die den Mut und die Geistesgegenwart besitzen, um zu kämpfen.
Cashmere bringt die Sache ins Rollen, indem sie erzählt, dass sie gar nicht aufhören kann zu weinen, wenn sie daran denkt, wie sehr die Menschen im Kapitol leiden müssen, weil sie uns verlieren werden. Gloss erinnert an den freundlichen Empfang, der ihm und seiner Schwester hier zuteilwurde. Beetee zieht in seiner nervösen, unruhigen Art die Rechtmäßigkeit des Jubel-Jubiläums in Zweifel, er fragt sich, ob die Angelegenheit in letzter Zeit einmal von den Experten überprüft worden sei. Finnick trägt ein selbst verfasstes Gedicht für seine einzige wahre Liebe im Kapitol vor, und an die hundert Damen fallen in Ohnmacht, weil sie sich angesprochen fühlen. Johanna Mason steht auf und fragt, ob man nichts an der Lage ändern könne. Sicher hätten die Erfinder des Jubel-Jubiläums nicht geahnt, dass sich zwischen den Siegern und dem Kapitol eine solche Liebe entwickeln würde. Niemand könne so grausam sein, eine solch tiefe Verbundenheit zu zerstören. Seeder sinniert ruhig darüber, dass in Distrikt 11 alle davon ausgingen, Präsident Snow sei allmächtig. Doch wenn er allmächtig sei, warum schaffe er dieses Jubel-Jubiläum dann nicht ab? Und Chaff, der gleich nach ihr dran ist, behauptet, der Präsident könne dieses Jubel-Jubiläum abschaffen, wenn er wollte, aber er glaube wohl nicht, dass es jemandem viel bedeute.
Als ich vorgestellt werde, ist das Publikum schon völlig fertig. Die Leute weinen, einige sind zusammengebrochen, sogar eine Änderung des Programms wird gefordert. Als ich in meinem Brautkleid aus weißer Seide auftrete, bricht ein Tumult los. Mein Ende, das Ende des tragischen Liebespaars, das glücklich bis in alle Zeit lebt, das Ende der Hochzeit. Selbst Caesars Professionalität bekommt Risse, als er vergeblich versucht, die Menge so weit zu beruhigen, dass ich sprechen kann, doch meine drei Minuten schrumpfen schnell zusammen.
Schließlich tritt eine Ruhepause ein und er kann anbringen: »Tja, Katniss, offenbar ist das für alle eine sehr bewegende Nacht. Möchtest du etwas sagen?«
Als ich spreche, zittert meine Stimme. »Nur, dass es mir so leidtut, dass Sie alle nicht zu meiner Hochzeit kommen können … aber ich bin froh, dass Sie mich wenigstens in dem Kleid sehen können. Ist es nicht … einfach wunderschön?« Ich muss Cinna nicht anschauen, um das Zeichen zu bekommen. Ich weiß, dass jetzt der richtige Moment ist. Langsam beginne ich mich im Kreis zu drehen und hebe die Ärmel des schweren Kleides über den Kopf.
Als ich Schreie in der Menge höre, denke ich, es ist, weil ich so umwerfend aussehe. Da merke ich, dass um mich herum Rauch aufsteigt. Rauch von einem Feuer. Nicht das flackernde Zeug wie letztes Jahr bei der Wagenparade, sondern echte Flammen, die mein Kleid verschlingen. Panik erfasst mich, als der Rauch dichter wird. Verkohlte Fetzen geschwärzter Seide wirbeln in die Luft, Perlen prasseln auf die Bühne. Irgendwie traue ich mich nicht, stehen zu bleiben, denn meine Haut brennt ja gar nicht, und ich weiß, dass Cinna hinter alldem stecken muss. Also drehe ich mich rundherum, rundherum. Kurz bekomme ich keine Luft mehr, bin eingehüllt in die seltsamen Flammen. Dann ist das Feuer ganz plötzlich aus. Langsam bleibe ich stehen, ich frage mich, ob ich wohl nackt bin und warum Cinna es so eingerichtet hat, dass mein Hochzeitskleid verbrennt.
Aber ich bin nicht nackt. Ich trage ein Kleid, das genauso aussieht wie mein Hochzeitskleid, nur dass es die Farbe von Kohle hat und aus winzigen Federn besteht. Erstaunt hebe ich die langen, fließenden Ärmel und in diesem Moment sehe ich mich auf dem Bildschirm. Ganz in Schwarz bis auf die weißen Flecken auf den Ärmeln. Oder sollte ich sagen, auf den Flügeln? Cinna hat mich in einen Spotttölpel verwandelt.
18
Ich glimme immer noch ein wenig, deshalb streckt Caesar die Hand etwas zögerlich aus, um meinen Schleier zu berühren. Das Weiß ist abgebrannt, übrig geblieben ist ein glatter schwarzer Schleier, der hinten über den Halsausschnitt des Kleides fällt. »Federn«, sagt Caesar. »Du siehst aus wie ein Vogel.«
»Wie ein Spotttölpel, oder?«, sage ich und schlage ein wenig mit den Flügeln. »Das ist der Vogel auf der Brosche, die ich als Glücksbringer getragen habe.«
Ein Schatten der Erkenntnis huscht über Caesars Gesicht, er weiß, dass der Spotttölpel nicht nur mein Glücksbringer ist. Dass er jetzt für so viel mehr steht. Dass das, was im Kapitol als spektakulärer Gag wahrgenommen wird, in den Distrikten einen ganz anderen Widerhall findet. Doch er macht das Beste daraus.
»Also, Hut ab vor deinem Stylisten. Es wird wohl keiner bestreiten, dass wir so etwas Spektakuläres in einem Interview noch nie zu sehen bekommen haben. Cinna, eine Verbeugung bitte!« Caesar gibt Cinna mit einer Geste zu verstehen, dass er sich erheben soll. Er tut es und macht eine kleine, elegante Verbeugung. Und auf einmal habe ich riesige Angst um ihn. Was hat er getan? Etwas furchtbar Gefährliches. Ein rebellischer Akt. Und er hat es für mich getan. Ich erinnere mich an seine Worte …
»Keine Bange. Ich lasse meine Gefühle in meine Arbeit einfließen. Auf diese Weise tue ich niemandem weh außer mir selbst.«
Und ich fürchte, er hat sich so wehgetan, dass es nicht wiedergutzumachen ist. Die tiefere Bedeutung meiner feurigen Verwandlung kann Präsident Snow nicht entgangen sein.
Das Publikum ist erst starr vor Staunen und applaudiert dann heftig. Ich höre kaum den Signalton, der anzeigt, dass meine drei Minuten um sind. Caesar dankt mir und ich gehe wieder zu meinem Platz, mein Kleid fühlt sich jetzt leichter an als Luft.
Ich begegne Peeta, der nach mir dran ist, aber er weicht meinem Blick aus. Vorsichtig setze ich mich hin, doch abgesehen von einigen Rauchspuren scheine ich unversehrt zu sein, und so richte ich meine Aufmerksamkeit auf ihn.
Seit ihrem Auftritt vor einem Jahr sind Caesar und Peeta ein eingespieltes Team. Die Leichtigkeit, mit der sie sich die Bälle zuspielen, die treffsicheren Pointen und der gekonnte Übergang zu Herz und Schmerz wie damals, als Peeta seine Liebe zu mir eingestanden hat, haben ihnen großen Erfolg beim Publikum beschert. Mühelos eröffnen sie das Gespräch mit ein paar witzigen Bemerkungen über Feuer und Federn und verbranntes Geflügel. Aber man sieht, dass Peeta mit den Gedanken weit weg ist, deshalb spricht Caesar direkt das Thema an, das allen am Herzen liegt.
»Erzähl mal, wie das war, Peeta, als du, nach allem, was du durchgemacht hattest, die Neuigkeit vom Jubel-Jubiläum erfuhrst«, sagt Caesar.
»Es war ein Schock für mich. Eben noch hatte ich Katniss gesehen, so wunderschön in all den Hochzeitskleidern, und im nächsten Augenblick …« Der Satz bleibt in der Luft hängen.
»Da wurde dir klar, dass es niemals eine Hochzeit geben wird?«, fragt Caesar sanft.
Peeta schweigt lange, als müsse er etwas überdenken. Er sieht zu den gebannten Zuschauern, dann auf den Boden, dann schließlich zu Caesar. »Caesar, meinst du, unsere Freunde hier können ein Geheimnis für sich behalten?«
Ein unbehagliches Lachen ist im Publikum zu hören. Was meint er wohl damit? Vor wem sollen sie ein Geheimnis bewahren? Die ganze Welt schaut uns zu.
»Da bin ich mir ganz sicher«, sagt Caesar.
»Wir sind bereits verheiratet«, sagt Peeta ruhig. Das Publikum reagiert mit Erstaunen, und ich muss das Gesicht in meinem Kleid verbergen, damit man meine Verwirrung nicht sieht. Worauf will er bloß hinaus?
»Aber … wie ist das möglich?«, fragt Caesar.
»Oh, es war keine offizielle Hochzeit. Wir sind nicht zum Justizgebäude gegangen oder so. Aber wir haben in Distrikt 12 so ein Hochzeitsritual. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Distrikten ist. Wir machen da etwas ganz Spezielles«, sagt Peeta und beschreibt kurz die Sache mit dem Brot.
»Waren eure Familien dabei?«, fragt Caesar.
»Nein, wir haben niemandem davon erzählt. Nicht einmal Haymitch. Und Katniss’ Mutter wäre bestimmt nicht einverstanden gewesen. Aber wir wussten ja, wenn wir im Kapitol heiraten, dann findet das Ritual nicht statt. Und wir wollten beide nicht länger warten. Also haben wir es eines Tages einfach gemacht«, sagt Peeta. »Und wir fühlen uns mehr verheiratet, als wir es durch irgendein Stück Papier oder eine große Feier könnten.«
»Dann war das also vor der Ankündigung des Jubel-Jubiläums?«, fragt Caesar.
»Ja, natürlich war das vorher. Bestimmt hätten wir es niemals getan, nachdem wir davon wussten«, sagt Peeta. Er redet sich in Rage. »Aber wer hätte das kommen sehen? Niemand. Wir haben die Spiele durchgemacht, wir wurden Sieger, alle schienen so begeistert zu sein, uns zusammen zu sehen, und dann, aus dem Nichts - ich meine, wie hätten wir das vorhersehen können?«
»Das konntet ihr nicht, Peeta.« Caesar legt ihm einen Arm um die Schultern. »Wie du sagst, das konnte niemand. Doch ich muss zugeben, ich bin froh, dass ihr beide wenigstens ein paar glückliche Monate miteinander hattet.«
Tosender Applaus. Als wäre ich dadurch ermutigt, hebe ich den Blick von den Federn und zeige dem Publikum zum Dank ein tragisches Lächeln. Von dem Rauch in den Federn tränen mir passenderweise die Augen.
»Ich bin nicht froh«, sagt Peeta. »Mir wäre es lieber, wir hätten bis zur offiziellen Trauung gewartet.«
Das überrascht sogar Caesar. »Aber selbst eine kurze Zeit ist doch besser als gar nichts, oder?«
»Vielleicht würde ich auch so denken, Caesar«, sagt Peeta bitter. »Wenn das Baby nicht wäre.«
Da. Er hat es schon wieder geschafft. Hat eine Bombe hochgehen lassen, die alle Anstrengungen der Tribute vor ihm zunichtemacht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er dieses Jahr nur eine Bombe gezündet, die die Sieger selbst gebaut haben. In der Hoffnung, dass jemand sie zur Explosion bringen würde. Zum Beispiel ich in meinem Brautkleid. Sie wissen ja nicht, wie abhängig ich von Cinnas Talenten bin, während Peeta nur seinen Grips benötigt.
Als Echo auf die Bombe fliegen Vorwürfe in alle Richtungen: ungerecht, barbarisch, grausam. Selbst der Kapitolhörigste, Spielehungrigste, Blutrünstigste im Publikum kann nicht übersehen, wenigstens für einen Augenblick, wie entsetzlich das alles ist.
Ich bin schwanger.
Die Zuschauer können die Neuigkeit nicht sofort erfassen. Sie muss erst geschluckt und verarbeitet und von anderen Stimmen bestätigt werden, ehe Laute zu hören sind wie von einer Herde verwundeter Tiere, sie stöhnen, schreien und rufen um Hilfe. Und ich? Ich weiß, dass mein Gesicht in Großaufnahme auf dem Bildschirm zu sehen ist, doch ich unternehme keine Anstrengung, es zu verbergen. Denn einen Moment lang muss selbst ich das verarbeiten, was Peeta gerade gesagt hat. Ist es nicht genau das, was mich am meisten an der Hochzeit, an der Zukunft geängstigt hat - dass ich meine Kinder an die Spiele verlieren könnte? Und jetzt könnte es Wirklichkeit werden. Wenn ich nicht mein Leben lang Abwehrmauern errichtet hätte, bis ich schon bei der bloßen Andeutung von Heirat oder Familie zurückschrecke.
Caesar bekommt die Menge nicht mehr in den Griff, nicht einmal, als das Signal ertönt. Peeta nickt zum Abschied und geht ohne ein weiteres Wort zurück zu seinem Platz. Ich sehe, wie Caesars Lippen sich bewegen, doch im Publikum herrscht der reinste Aufruhr und ich verstehe kein Wort. Einzig das Getöse der Nationalhymne, so laut aufgedreht, dass es mir durch Mark und Bein geht, zeigt uns an, wo wir mit dem Programm angekommen sind. Ich stehe automatisch auf und spüre, dass Peeta nach meiner Hand fasst. Als ich sie ergreife, laufen ihm Tränen über das Gesicht. Wie echt sind die Tränen? Sind sie ein Zeichen dafür, dass er von denselben Ängsten verfolgt wird wie ich? Wie jeder Sieger? Wie alle Eltern in jedem Distrikt von Panem?
Ich schaue wieder ins Publikum, doch die Gesichter von Rues Mutter und Vater schieben sich vor meine Augen. Ihre Trauer. Ihr Verlust. Ich drehe mich spontan zu Chaff um und reiche ihm die Hand. Meine Finger schließen sich um den Stumpf, in dem sein Arm jetzt ausläuft, und halten ihn fest.
Und dann geschieht es. Von einem Ende der Reihe bis zum anderen reichen sich die Sieger die Hände. Einige spontan, wie die Morfixer und Wiress und Beetee. Andere unsicher, aber mitgerissen durch die Aufforderung der anderen, wie Brutus und Enobaria. Als die letzten Töne der Hymne erklingen, stehen wir alle vierundzwanzig in einer geschlossenen Reihe - seit den Dunklen Tagen ist das wohl die erste öffentliche Demonstration von Einheit unter den Distrikten. Man sieht, wie diese Erkenntnis durchdringt, als die Bildschirme einer nach dem anderen schwarz werden. Doch zu spät. In der allgemeinen Verwirrung haben sie uns nicht rechtzeitig abgeschaltet. Alle haben es gesehen.
Auch auf der Bühne bricht Chaos aus, die Scheinwerfer erlöschen, und wir stolpern zurück zum Trainingscenter. Ich habe Chaff verloren, aber Peeta führt mich zu einem Aufzug. Finnick und Johanna wollen mit hinein, doch ein gestresster Friedenswächter versperrt ihnen den Weg, und wir sausen allein nach oben.
In dem Moment, als wir den Aufzug verlassen, fasst Peeta mich bei den Schultern. »Wir haben nicht viel Zeit, also sag es mir jetzt. Muss ich mich für irgendetwas entschuldigen?«
»Für gar nichts«, sage ich. Es war ein gewagter Schritt ohne meine Einwilligung, aber ich bin nur froh, dass ich nichts davon wusste und keine Zeit hatte, ihm reinzureden; froh, dass mein schlechtes Gewissen Gale gegenüber meine Gefühle für das, was Peeta getan hat, nicht schmälern konnte. Und ich fühle mich gestärkt.
Irgendwo in weiter Ferne gibt es einen Distrikt 12, wo meine Mutter, meine Schwester und meine Freunde mit den Folgen dieses Abends leben müssen. Nur einen kleinen Flug mit dem Hovercraft entfernt liegt eine Arena, wo auf Peeta und mich und die anderen Tribute unsere Strafe wartet. Doch selbst wenn wir alle ein schreckliches Ende finden, ist heute Abend auf der Bühne etwas passiert, das nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Wir Sieger haben unseren eigenen Aufstand inszeniert und vielleicht, ganz vielleicht, wird es dem Kapitol nicht gelingen, ihn zu unterdrücken.
Wir warten auf die anderen, doch als die Fahrstuhltür aufgeht, erscheint nur Haymitch. »Das ist Wahnsinn da draußen. Sie haben alle nach Hause geschickt und die Zusammenfassung der Interviews im Fernsehen ist gestrichen.«
Peeta und ich laufen schnell zum Fenster und versuchen, in dem Tumult weit unter uns auf den Straßen etwas zu erkennen. »Was sagen sie?«, fragt Peeta. »Fordern sie den Präsidenten auf, die Spiele zu stoppen?«
»Ich glaube nicht, dass sie wissen, was sie fordern sollen. Die ganze Situation ist beispiellos. Schon die Vorstellung, sich den Plänen des Kapitols zu widersetzen, verwirrt die Leute hier«, sagt Haymitch. »Aber es ist ausgeschlossen, dass Snow die Spiele absetzt. Das wisst ihr doch, oder?«
Ich weiß es. Natürlich kann er jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als zurückzuschlagen, und zwar mit voller Härte. »Sind die anderen nach Hause gegangen?«, frage ich.
»Das wurde ihnen befohlen. Ich weiß nicht, ob sie heil durch die Menschenmenge kommen«, sagt Haymitch.
»Dann werden wir Effie nie wiedersehen«, sagt Peeta. Im letzten Jahr haben wir sie am Morgen der Spiele nicht getroffen. »Richte ihr unseren Dank aus.«
»Mehr als das. Mach etwas ganz Besonderes daraus. Es ist schließlich Effie«, sage ich. »Sag ihr, wie sehr wir ihre Hilfe zu schätzen wissen, dass sie die beste Betreuerin aller Zeiten war, und sag ihr … sag ihr ganz liebe Grüße.«
Eine Zeit lang stehen wir nur schweigend da und zögern das Unvermeidliche hinaus. Dann spricht Haymitch es aus. »Und jetzt müssen wir uns wohl auch verabschieden.«
»Irgendeinen letzten Ratschlag?«, fragt Peeta.
»Bleibt am Leben«, sagt Haymitch schroff. Das ist schon fast ein Running Gag zwischen uns. Er nimmt uns beide kurz in den Arm, und ich weiß, dass es das Äußerste ist, was er ertragen kann. »Geht ins Bett. Ihr müsst euch ausruhen.«
Ich weiß, dass ich Haymitch eine ganze Menge sagen müsste, aber mir fällt nichts ein, was er nicht schon weiß, und außerdem ist meine Kehle so zugeschnürt, dass ich wahrscheinlich sowieso keinen Ton herausbringen würde. Also lasse ich schon wieder Peeta für uns beide sprechen.
»Pass auf dich auf, Haymitch«, sagt er.
Wir sind schon im Flur, als Haymitchs Stimme uns aufhält. »Katniss, wenn du in der Arena bist«, sagt er. Dann stockt er. Er blickt so finster, dass ich mir sicher bin, ihn jetzt schon enttäuscht zu haben.
»Was dann?«, frage ich abwehrend.
»Dann vergiss nicht, wer der Feind ist«, sagt Haymitch. »Das ist alles. Jetzt los. Raus mit euch.«
Wir gehen den Flur entlang. Peeta will in sein Zimmer, um die Schminke abzuwaschen, und in ein paar Minuten nachkommen, aber das lasse ich nicht zu. Wenn eine Tür zwischen uns zugeht, wird sie garantiert verschlossen, und dann muss ich die Nacht ohne ihn verbringen. Außerdem gibt es in meinem Zimmer auch eine Dusche. Ich weigere mich, seine Hand loszulassen.
Schlafen wir? Ich weiß es nicht. Wir verbringen die Nacht eng umschlungen, in einem Land zwischen Träumen und Wachen. Wir reden nicht. Keiner will den anderen stören und wir hoffen, so ein paar kostbare Minuten der Ruhe zu gewinnen.
Cinna und Portia kommen mit dem Morgengrauen, und ich weiß, dass Peeta gehen muss. Die Tribute müssen allein in die Arena. Er gibt mir einen flüchtigen Kuss. »Bis bald«, sagt er.
»Ja, bis bald«, antworte ich.
Cinna, der mir beim Ankleiden für die Spiele helfen wird, begleitet mich hinaus aufs Dach. Ich will schon die Leiter ins Hovercraft hinaufsteigen, als es mir einfällt. »Ich hab mich nicht von Portia verabschiedet.«
»Ich werde es ihr ausrichten«, sagt Cinna.
Der elektrische Strom hält mich oben auf der Leiter, bis der Arzt mir den Aufspürer in den linken Unterarm einpflanzt. Damit können sie mich in der Arena jederzeit finden. Das Hovercraft hebt ab, und ich schaue aus dem Fenster, bis es schwarz wird. Cinna drängt mich zu essen und dann, als er damit keinen Erfolg hat, zu trinken. Ich schaffe es, kleine Schlucke Wasser zu trinken, ich denke an die Tage im letzten Jahr, als ich so ausgetrocknet war, dass ich fast gestorben wäre. Und ich denke daran, dass ich meine Kraft brauche, um Peeta zu retten.
Als wir im Startraum der Arena ankommen, gehe ich unter die Dusche. Cinna flicht mir einen Zopf, ich ziehe einfache Unterwäsche an, und Cinna hilft mir mit dem Rest. In diesem Jahr gehen die Tribute in einem eng anliegenden blauen Overall aus hauchdünnem Stoff, der vorn mit einem Reißverschluss zugezogen wird. Dazu ein fünfzehn Zentimeter breiter gepolsterter Gurt aus glänzendem lila Plastik. Nylonschuhe mit Gummisohlen.
»Was hältst du davon?«, frage ich und halte Cinna den Stoff hin, damit er ihn fühlen kann.
Mit gerunzelter Stirn reibt er das dünne Material zwischen den Fingern. »Ich weiß nicht. Er wird wenig Schutz gegen Kälte oder Nässe bieten.«
»Und gegen Sonne?«, frage ich und stelle mir gleißende Sonne über einer öden Wüste vor.
»Vielleicht. Wenn er behandelt ist«, sagt er. »Ach, das hier hätte ich fast vergessen.« Er holt meine goldene Spotttölpelbrosche aus der Tasche und steckt sie mir an den Overall.
»Mein Kleid gestern Abend war wundervoll«, sage ich. Wundervoll und waghalsig. Aber das weiß Cinna natürlich.
»Ich dachte mir, dass es dir gefallen könnte«, sagt er mit einem gezwungenen Lächeln.
Genau wie letztes Jahr sitzen wir Hände haltend da, bis die Stimme mir sagt, ich soll mich startklar machen. Er begleitet mich zu der runden Metallplatte und zieht den Reißverschluss oben ganz zu. »Nicht vergessen, Mädchen in Flammen«, sagt er. »Ich setze immer noch auf dich.« Er küsst mich auf die Stirn und tritt zurück, als sich die Glasglocke über mich senkt.
»Danke«, sage ich, obwohl er mich wahrscheinlich nicht hören kann. Ich hebe das Kinn, trage den Kopf hoch, wie er mir immer rät, und warte darauf, dass die Metallplatte abhebt. Aber nichts passiert. Und immer noch nicht.
Ich schaue Cinna an und hebe fragend die Augenbrauen. Er schüttelt nur leicht den Kopf, genauso verwirrt wie ich. Weshalb die Verzögerung?
Plötzlich wird die Tür hinter ihm aufgerissen und drei Friedenswächter stürmen in den Raum. Zwei drehen Cinna die Arme auf den Rücken und legen ihm Handschellen an, während der dritte ihm mit solcher Gewalt gegen die Schläfe schlägt, dass er auf die Knie sinkt. Doch sie schlagen ihn mit ihren metallbesetzten Handschuhen immer weiter, bis er überall im Gesicht und am Körper klaffende Wunden hat. Ich schreie wie am Spieß, schlage gegen das Glas, das nicht nachgibt, und versuche, zu ihm zu gelangen. Die Friedenswächter beachten mich gar nicht, sie ziehen Cinnas schlaffen Körper aus dem Raum. Nur die Blutspuren auf dem Boden bleiben übrig.
Elend und panisch merke ich, wie die Metallplatte abhebt. Ich bin immer noch an das Glas gelehnt, als mir eine Brise in die Haare fährt und ich mich zwinge, aufrecht zu stehen. Gerade noch rechtzeitig, denn jetzt entfernt sich das Glas und ich stehe ungeschützt in der Arena. Irgendetwas scheint mit meinen Augen nicht zu stimmen. Der Boden ist zu hell und leuchtend und hört nicht auf zu schwanken. Mit zusammengekniffenen Augen schaue ich auf meine Füße und sehe, dass die Metallplatte von blauen Wellen umgeben ist, die über meine Stiefel schwappen. Langsam hebe ich den Blick und sehe das Wasser, das sich in alle Richtungen erstreckt.
Ich kann nur einen klaren Gedanken fassen.
Das ist kein Ort für ein Mädchen in Flammen.
Teil 3
Der Feind
19
»Meine Damen und Herren, die fünfundsiebzigsten Hungerspiele sind eröffnet!« Die Stimme von Claudius Templesmith, dem Moderator der Hungerspiele, hämmert mir in den Ohren. Ich habe weniger als eine Minute Zeit, mich zu orientieren. Dann wird der Gong ertönen und die Tribute können sich von ihren Metallplatten entfernen. Doch wohin?
Ich kann nicht klar denken. Die ganze Zeit habe ich Cinna vor Augen, wie er blutig am Boden liegt. Wo ist er jetzt? Was tun sie ihm an? Foltern sie ihn? Bringen sie ihn um? Verwandeln sie ihn in einen Avox? Offenbar sollte der Anschlag auf ihn mich aus dem Gleichgewicht bringen, genauso wie Darius’ plötzliches Auftauchen in meinem Quartier. Und er hat mich wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht. Am liebsten würde ich auf meiner Metallplatte zusammenbrechen. Aber nach allem, was ich gerade mit angesehen habe, ist das kaum möglich. Ich muss stark sein. Das bin ich Cinna schuldig, der alles riskiert hat, indem er Präsident Snow verhöhnt und mein Brautkleid in das Gefieder eines Spotttölpels verwandelt hat. Und ich bin es den Rebellen schuldig, die, durch Cinnas Beispiel ermutigt, in diesem Moment vielleicht kämpfen, um das Kapitol zu stürzen. Meine Weigerung, die Spiele nach den Regeln des Kapitols zu spielen, soll mein letzter rebellischer Akt sein. Also beiße ich die Zähne zusammen und mache gute Miene zum bösen Spiel.
Wo bin ich? Ich werde aus meiner Umgebung immer noch nicht schlau. Wo bin ich?! Ich verlange eine Antwort von mir und langsam bekommt die Welt Konturen. Blaues Wasser. Rosa Himmel. Weiß gleißende Sonne, die vom Himmel knallt. Ach ja, da ist das Füllhorn aus goldglänzendem Metall, etwa vierzig Meter entfernt. Erst sieht es so aus, als befände es sich auf einer runden Insel. Doch bei genauerem Hinsehen erkenne ich schmale Streifen Land, die strahlenförmig von der Füllhorninsel ausgehen wie die Speichen eines Rades. Es sind schätzungsweise zehn bis zwölf und sie scheinen alle den gleichen Abstand voneinander zu haben. Zwischen den Speichen ist nur Wasser. Wasser und je zwei Tribute.
So ist das also. Es gibt zwölf Speichen, dazwischen jeweils zwei Tribute, die sich auf Metallplatten halten. Der zweite Tribut in meinem Wasserkeil ist der alte Woof aus Distrikt 8. Er befindet sich zu meiner Rechten, etwa genauso weit entfernt wie der Landstreifen zu meiner Linken. Jenseits des Wassers liegt, wohin man auch blickt, ein schmaler Strand und dahinter dichtes Grün. Ich suche den Kreis nach Tributen ab, halte nach Peeta Ausschau, doch das Füllhorn versperrt mir den Blick.
Ich schöpfe eine Handvoll Wasser und rieche daran. Dann berühre ich mit dem nassen Finger meine Zunge. Salzwasser, ganz wie ich gedacht habe. Genau wie die Wellen, die Peeta und ich auf unserem kurzen Abstecher zum Strand in Distrikt 4 gesehen haben. Aber immerhin scheint es sauber zu sein.
Es gibt keine Boote, keine Seile, nicht mal ein bisschen Treibholz, an dem man sich festhalten könnte. Nein, es gibt nur einen Weg zum Füllhorn. Als der Gong ertönt, zögere ich nicht und tauche nach links. Es ist weiter, als ich gewohnt bin, und durch die Wellen zu schwimmen, ist nicht so einfach wie das Schwimmen in meinem ruhigen See zu Hause, doch mein Körper fühlt sich eigenartig leicht an, und ich gleite mühelos durchs Wasser. Vielleicht liegt es an dem Salz. Tropfnass ziehe ich mich an Land und renne über den Sand bis zum Füllhorn. Ich sehe niemanden, der sich von meiner Seite her nähert, allerdings versperrt mir das goldene Horn zu einem Gutteil die Sicht. Doch ich lasse mich von dem Gedanken an mögliche Gegner nicht bremsen. Ich denke jetzt wie ein Karriero und als Erstes will ich mir eine Waffe schnappen.
Im letzten Jahr waren die Vorräte ziemlich weit um das Füllhorn herum verstreut und die wertvollsten Sachen befanden sich ganz nah am Horn. Doch in diesem Jahr scheint die Beute an der gut sechs Meter hohen Öffnung gestapelt zu sein. Mein Blick fällt sofort auf einen goldenen Bogen in Reichweite und ich reiße ihn heraus.
Da ist jemand hinter mir. Eine leichte Bewegung im Sand oder vielleicht nur eine Veränderung des Luftstroms hat mich alarmiert. Ich ziehe einen Pfeil aus dem Köcher, der immer noch in dem Stapel eingeklemmt ist, und während ich mich umdrehe, spanne ich die Sehne.
Da steht ein paar Meter von mir entfernt Finnick in all seiner Pracht, er hält einen Dreizack bereit. An seiner anderen Hand baumelt ein Netz. Er lächelt ein wenig, aber die Muskeln seines Oberkörpers sind schon gespannt. »Du kannst ja auch schwimmen«, sagt er. »Wo hast du das in Distrikt 12 gelernt?«
»Wir haben eine große Badewanne«, gebe ich zurück.
»Sieht ganz so aus«, sagt er. »Gefällt dir die Arena?«
»Nicht besonders. Aber dir doch sicherlich. Sie haben sie bestimmt extra für dich erbaut«, sage ich eine Spur bitter. So sieht es jedenfalls aus, mit all dem Wasser, denn garantiert kann nur eine Handvoll der Sieger schwimmen. Und im Trainingscenter gab es kein Schwimmbecken, keine Chance, es zu lernen. Entweder kommt man als Schwimmer hierher oder man sollte es schleunigst lernen. Selbst wer nur an dem anfänglichen Blutbad teilnehmen will, muss erst mal zwanzig Meter Wasser durchqueren. Damit hat Distrikt 4 einen gewaltigen Vorteil.
Einen Augenblick lang sind wir wie erstarrt, schätzen einander ab, die Waffen des anderen, sein Geschick. Da grinst Finnick plötzlich los. »Gut, dass wir Verbündete sind. Oder?«
Ich wittere eine Falle und will den Pfeil schon abschießen, in der Hoffnung, dass er sein Herz durchbohrt, bevor ich von dem Dreizack aufgespießt werde, doch da bewegt er die Hand, und etwas auf seinem Handgelenk blitzt in der Sonne auf. Ein Armreif aus massivem Gold mit Flammenmuster. Derselbe, den ich heute Morgen an Haymitchs Handgelenk gesehen habe, als ich mit dem Training anfing. Ganz kurz überlege ich, ob Finnick ihn gestohlen hat, um mich reinzulegen, aber irgendwie weiß ich, dass es nicht so ist. Haymitch hat ihm den Armreif gegeben. Als Zeichen für mich. Oder besser als Befehl. Ich soll Finnick vertrauen.
Ich höre weitere Schritte näher kommen. Ich muss mich sofort entscheiden. »Na gut!«, sage ich schroff, denn auch wenn Haymitch mein Mentor ist und versucht, mir das Leben zu retten, ärgert es mich. Warum hat er mir nichts von diesem Arrangement erzählt? Wahrscheinlich, weil Peeta und ich Verbündete ausgeschlossen hatten. Da hat Haymitch einfach selbst einen ausgesucht.
»Duck dich!«, kommandiert Finnick mich mit durchdringender Stimme, die so ganz anders ist als sein einschmeichelndes Gesäusel, dass ich gehorche. Sein Dreizack saust über meinen Kopf und ich höre einen ekelerregenden Schlag, als er sein Ziel trifft. Der Mann aus Distrikt 5, der Trinker, der sich bei der Schwertkampfstation übergeben hat, sinkt auf die Knie, während Finnick den Dreizack aus seiner Brust zieht. »1 und 2 darfst du nicht trauen«, sagt Finnick.
Es bleibt keine Zeit, das infrage zu stellen. Ich ziehe den Köcher mit den Pfeilen aus dem Stapel heraus. »Jeder eine Seite?«, sage ich. Er nickt und ich sause um den Stapel herum. Etwa vier Speichen weiter schaffen es Enobaria und Gloss gerade an Land. Entweder sind sie langsame Schwimmer, oder sie dachten, im Wasser könnten andere Gefahren lauern, was auch gut möglich ist. Manchmal sollte man sich gar nicht zu viele Gedanken machen. Aber jetzt, da sie am Strand sind, werden sie in wenigen Sekunden bei uns sein.
»Irgendwas Brauchbares?«, höre ich Finnick rufen.
Schnell suche ich den Stapel auf meiner Seite ab und finde Keulen, Schwerter, Pfeil und Bogen, Dreizacke, Messer, Speere, Äxte, Metallgegenstände, die ich nicht benennen kann … und sonst nichts.
»Waffen!«, rufe ich. »Nichts als Waffen!«
»Hier auch«, gibt er zur Antwort. »Schnapp dir irgendwas und dann weg hier!«
Ich schieße einen Pfeil auf Enobaria ab, die gefährlich nah gekommen ist, doch sie hat damit gerechnet und taucht wieder ins Wasser, ohne getroffen zu werden. Gloss ist nicht ganz so schnell, und ich jage ihm einen Pfeil in die Wade, als er in die Wellen springt. Ich hänge mir noch einen Bogen und einen zweiten Köcher mit Pfeilen um und stecke mir zwei lange Messer und eine Ahle, so ein spitzes Ding, mit dem man Löcher in Ledergürtel macht, in den Gurt. Dann laufe ich zurück zu Finnick.
»Mach was dagegen, ja?«, sagt er und deutet auf Brutus, der auf uns zugerannt kommt. Er hat den Gurt abgenommen und hält ihn wie einen Schild zwischen den Händen. Ich ziele und schieße, doch er wehrt den Pfeil mit dem Gurt ab, bevor er ihm die Leber durchbohren kann. Dort, wo der Pfeil den Gurt durchsticht, spritzt eine lilafarbene Flüssigkeit heraus und Brutus ins Gesicht. Als ich die Sehne erneut spanne, wirft er sich flach auf den Boden, rollt sich ein paar Meter bis zum Wasser und taucht unter. Ich höre, wie hinter mir etwas Metallisches zu Boden fällt. »Lass uns abhauen«, sage ich zu Finnick.
Während ich mit Brutus zugange war, haben Enobaria und Gloss es klammheimlich bis zum Füllhorn geschafft. Brutus ist in Schussweite und irgendwo ganz in der Nähe wird auch Cashmere sein. Diese vier klassischen Karrieros sind garantiert schon längst Verbündete. Wenn ich nur meine eigene Sicherheit zu bedenken hätte, würde ich es vielleicht mit ihnen aufnehmen, mit Finnick an meiner Seite. Doch ich denke an Peeta. Da entdecke ich ihn, er sitzt immer noch auf seiner Metallplatte. Ich laufe los, und Finnick folgt mir, ohne Fragen zu stellen, als hätte er gewusst, dass ich genau das tun würde. Als ich so nah wie möglich bei Peeta bin, ziehe ich die Messer aus meinem Gurt, ich will zu ihm schwimmen und ihn irgendwie an Land bringen.
Finnick legt mir eine Hand auf die Schulter. »Ich hole ihn.«
Misstrauen lodert in mir auf. Könnte das nur ein Trick sein? Erst mein Vertrauen gewinnen und dann zu Peeta schwimmen und ihn ertränken? »Das mach ich schon«, beharre ich.
Doch Finnick hat bereits alle Waffen fallen lassen. »Streng dich lieber nicht zu sehr an. Nicht in deinem Zustand«, sagt er und tätschelt mir den Bauch.
Ach ja, ich bin ja schwanger, denke ich. Während ich überlege, was er wohl denkt und wie ich mich verhalten soll - vielleicht mich übergeben oder so -, hat Finnick sich schon ans Ufer gestellt.
»Gib mir Deckung«, sagt er und taucht mit einem gekonnten Kopfsprung ins Wasser.
Ich halte den Bogen hoch, um alle Angreifer, die uns verfolgen könnten, vom Füllhorn fernzuhalten, aber anscheinend legt es niemand darauf an. Wie zu erwarten, haben sich Gloss, Cashmere, Enobaria und Brutus schon zusammengerottet und überlegen nun, welche Waffen sie nehmen sollen. Ein schneller Rundumblick verrät mir, dass die meisten Tribute immer noch auf ihren Platten festsitzen. Nein, Moment mal, da steht jemand auf der Speiche links neben mir, gegenüber von Peeta. Es ist Mags. Doch weder steuert sie das Füllhorn an, noch versucht sie zu fliehen. Stattdessen hüpft sie ins Wasser und paddelt auf mich zu, ihre grauen Haare tauchen immer wieder auf. Sie ist zwar alt, aber nach achtzig Jahren in Distrikt 4 kann sie sich vermutlich noch immer problemlos über Wasser halten.
Finnick ist jetzt bei Peeta und schleppt ihn ab, einen Arm um seine Brust gelegt, während er mit dem anderen mit leichten Schlägen durchs Wasser rudert. Peeta lässt sich willig mitziehen. Ich weiß nicht, wie Finnick ihn überzeugt hat, sich ihm zu überlassen - vielleicht hat er ihm den Armreif gezeigt. Vielleicht hat es Peeta auch genügt, dass ich auf ihn warte. Als sie den Strand erreichen, helfe ich dabei, Peeta aufs Trockene zu ziehen.
»Da bin ich wieder«, sagt er und gibt mir einen Kuss. »Wir haben Verbündete.«
»Ja. Ganz in Haymitchs Sinn«, sage ich.
»Hilf mir mal auf die Sprünge, haben wir sonst noch eine Abmachung mit irgendwem?«, fragt Peeta.
»Nur mit Mags, glaube ich.« Ich mache eine Kopfbewegung zu der alten Frau, die sich stoisch in unsere Richtung vorwärtskämpft.
»Mags kann ich nicht im Stich lassen«, sagt Finnick. »Sie ist eine der wenigen, die mich wirklich mögen.«
»Ich hab nichts gegen Mags«, sage ich. »Vor allem jetzt, wo ich die Arena sehe. Mit Mags’ Angelhaken haben wir bestimmt die besten Chancen, zu einer Mahlzeit zu kommen.«
»Katniss wollte sie ja schon vom ersten Tag an als Verbündete«, sagt Peeta.
»Katniss hat ein erstaunlich gutes Urteilsvermögen«, sagt Finnick. Er fasst mit der Hand ins Wasser und hebt Mags heraus, als wäre sie so leicht wie ein Hündchen. Sie macht irgendeine Bemerkung, in der ich das Wort »treiben« herauszuhören meine, dann klopft sie auf ihren Gurt.
»Guck mal, sie hat recht. Und da hat es noch jemand rausgekriegt.« Finnick zeigt auf Beetee. Er rudert mit den Armen wild durch die Wellen, schafft es aber, den Kopf über Wasser zu halten.
»Was?«, frage ich.
»Die Gurte. Das sind Schwimmhilfen«, sagt Finnick. »Bewegen muss man sich aus eigener Kraft, aber immerhin bewahren die Dinger einen vor dem Ertrinken.«
Fast hätte ich Finnick gebeten, auf Beetee und Wiress zu warten und sie mitzunehmen, aber Beetee ist drei Speichen weit entfernt und Wiress sehe ich nicht mal. Ich schätze, Finnick würde sie genauso schnell umbringen wie den Tribut aus Distrikt 5, deshalb schlage ich lieber vor weiterzugehen. Ich reiche Peeta einen Bogen, einen Köcher mit Pfeilen und ein Messer, den Rest behalte ich für mich. Doch Mags zieht mich am Ärmel und redet auf mich ein, bis ich ihr die Ahle gebe. Erfreut klemmt sie sich den Griff zwischen den zahnlosen Kiefer und streckt die Arme nach Finnick aus. Er wirft sein Netz über die Schulter, hebt Mags hoch, nimmt den Dreizack in die freie Hand, und dann rennen wir davon, fort vom Füllhorn.
Hinter dem Strand erhebt sich ein Wald mit hohen Bäumen. Nein, eigentlich kein Wald. Jedenfalls nicht so einer, wie ich ihn kenne. Ein Dschungel. Das fremde, fast schon veraltete Wort fällt mir ein. Ich habe es in irgendwelchen Hungerspielen gehört oder von meinem Vater gelernt. Die meisten Bäume kenne ich nicht, sie haben glatte Stämme und nur wenige Äste. Die Erde ist ganz schwarz und schwammig, an vielen Stellen wird sie verdeckt von einem Rankengewirr mit bunten Blüten. Die Sonne ist gleißend, die Luft feuchtwarm und schwer; ich habe das Gefühl, dass man hier niemals richtig trocken wird. Der dünne blaue Stoff meines Overalls lässt das Meerwasser schnell verdunsten, aber jetzt klebt er schon vor Schweiß an mir.
Peeta übernimmt die Führung, er bahnt sich mit dem langen Messer einen Weg durchs dichte Gestrüpp. Ich lasse Finnick an zweiter Stelle gehen, denn auch wenn er der Stärkste ist, mit Mags hat er alle Hände voll zu tun. Außerdem kann er zwar großartig mit dem Dreizack umgehen, aber der ist hier im Dschungel weniger nützlich als meine Pfeile. Bei der Hitze und den Steigungen dauert es nicht lange, bis wir außer Atem geraten. Doch Peeta und ich haben hart trainiert, und Finnick hat so eine außergewöhnliche Konstitution, dass er sogar mit Mags über der Schulter eineinhalb Kilometer zügig marschiert, ehe er um eine Pause bittet. Und selbst dann scheint er das eher für Mags zu tun als für sich selbst.
Durch das Laub ist das Rad im Wasser nicht mehr zu sehen, deshalb klettere ich auf einen Baum mit gummiartigen Ästen, um etwas zu erkennen. Ich bereue es sofort.
Um das Füllhorn herum scheint der Boden zu bluten, das Wasser ist dunkelrot gefleckt. Leichen liegen auf dem Boden und treiben im Wasser, doch aus dieser Entfernung kann ich nicht erkennen, wer tot ist und wer lebt, zumal alle die gleiche Kleidung tragen. Ich sehe nur, dass einige der kleinen blauen Gestalten immer noch kämpfen. Nun ja, was hatte ich erwartet? Dass die geschlossene Kette der Sieger gestern Abend eine Art allgemeinen Waffenstillstand in der Arena bedeuten würde? Nein, das habe ich nie gedacht. Aber ich hatte wohl gehofft, dass die Leute ein bisschen … Zurückhaltung zeigen würden? Oder wenigstens Widerstreben. Bevor sie sich ins Gemetzel stürzen. Dabei kanntet ihr euch alle, denke ich. Man hatte den Eindruck, ihr wärt Freunde.
Ich habe nur einen richtigen Freund hier drin. Und der stammt nicht aus Distrikt 4.
Ich lasse mir von der schwachen, feuchten Brise die Wangen kühlen, während ich zu einer Entscheidung gelange. Trotz des Armreifs sollte ich es einfach hinter mich bringen und Finnick erschießen. Dieses Bündnis hat einfach keine Zukunft. Und er ist zu gefährlich, um ihn laufen zu lassen. Vielleicht ist jetzt, da wir sein zögerliches Vertrauen haben, meine einzige Chance, ihn zu töten. Ich könnte ihm leicht einen Pfeil in den Rücken schießen, während wir gehen. Das ist natürlich verachtenswert, aber wird es weniger verachtenswert, wenn ich warte? Ihn besser kennenlerne? Ihm noch mehr zu verdanken habe? Nein, jetzt ist der richtige Moment. Von meinem Baum aus schaue ich ein letztes Mal zu den Kämpfenden, auf die blutige Erde, um mich in meinem Entschluss zu bestärken, dann lasse ich mich zu Boden gleiten.
Doch als ich unten ankomme, merke ich, dass Finnick mit meinen Gedanken Schritt gehalten hat. Als wüsste er, was ich gesehen habe und wie es auf mich gewirkt haben muss. Er hat seinen Dreizack in einer lässigen Verteidigungshaltung erhoben.
»Was ist da unten los, Katniss? Halten sie sich alle an den Händen? Haben sie die Waffen ins Meer geworfen, um dem Kapitol die Stirn zu bieten?«, fragt Finnick.
»Nein«, sage ich.
»Nein«, wiederholt er. »Denn was gestern passiert ist, war gestern. Keiner in dieser Arena ist zufällig Sieger geworden.« Er wirft einen Seitenblick zu Peeta. »Außer vielleicht Peeta.«
Dann weiß Finnick also, was Haymitch und ich wissen. Über Peeta. Dass er wirklich und wahrhaftig besser ist als wir anderen. Finnick hat diesen Tribut aus Distrikt 5 umgelegt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wie lange habe ich gebraucht, um mich zum Töten zu entschließen? Ich habe auf Enobaria und Gloss und Brutus gezielt. Peeta hätte wenigstens erst mal versucht zu verhandeln. Hätte versucht, ein breiteres Bündnis herzustellen. Aber mit welchem Ziel? Finnick hat recht. Und ich habe recht. Diejenigen, die jetzt und hier in der Arena sind, wurden nicht für ihre Barmherzigkeit zu Siegern gekrönt.
Ich halte seinem Blick stand, schätze ab, wer von uns beiden schneller ist. Die Zeit, die ich brauche, um ihm einen Pfeil durchs Hirn zu jagen, gegen die Zeit, die sein Dreizack bis zu mir braucht. Ich sehe, wie er darauf wartet, dass ich den ersten Schritt mache. Er wägt ab, ob er sich lieber schützen oder direkt zum Angriff übergehen soll. Ich spüre, dass wir beide so weit sind, als Peeta sich zwischen uns stellt.
»Wie viele sind tot?«, fragt er.
Aus dem Weg, du Idiot, denke ich. Aber er weicht nicht von der Stelle.
»Schwer zu sagen«, antworte ich. »Mindestens sechs, glaube ich. Und sie kämpfen immer noch.«
»Kommt, wir gehen weiter. Wir brauchen Wasser«, sagt er.
Bis jetzt gibt es keinen Hinweis auf einen Bach oder Tümpel und das Salzwasser kann man nicht trinken. Wieder denke ich an die letzten Spiele, als ich fast verdurstet wäre.
»Wir sollten zusehen, dass wir schnell welches finden«, sagt Finnick. »Heute Nacht müssen wir uns verstecken, da machen die anderen Jagd auf uns.«
Wir. Uns. Jagd. Na gut, vielleicht wäre es etwas voreilig, Finnick jetzt umzubringen. Bisher war er hilfsbereit. Haymitch hat ihn abgesegnet. Und wer weiß, was die Nacht bereithält?
Schlimmstenfalls kann ich ihn immer noch abmurksen, während er schläft. Also lasse ich die Gelegenheit verstreichen. Wie Finnick.
Die Tatsache, dass wir kein Wasser haben, verstärkt meinen Durst. Ich halte gut Ausschau, während wir weiter bergauf gehen, doch ohne Erfolg. Nach einem weiteren Kilometer sehe ich das Ende des Waldes und schließe daraus, dass wir gleich auf dem Gipfel des Hügels angelangt sind. »Vielleicht haben wir auf der anderen Seite mehr Glück. Vielleicht finden wir da eine Quelle oder so.«
Aber es gibt keine andere Seite. Das weiß ich als Erste, obwohl ich am weitesten vom Gipfel entfernt bin. Mein Blick fällt auf ein merkwürdiges geriffeltes Viereck, das wie eine verzogene Fensterscheibe in der Luft hängt. Erst denke ich, es ist der Glanz der Sonne oder die Hitze, die über dem Boden flimmert. Doch es bleibt immer an derselben Stelle, wandert nicht mit, als ich weitergehe. Urplötzlich stelle ich die Verbindung zwischen dem Viereck und Wiress und Beetee im Trainingscenter her, und ich begreife, was da vor uns liegt. Ich habe den Warnruf auf den Lippen, aber er kommt zu spät: Peeta schwingt schon das Messer, um einige Ranken wegzuschlagen.
Ein lautes Zischeln ertönt. Einen Moment lang sind die Bäume verschwunden und auf einem kleinen Fleck sehe ich die nackte Erde. Dann wird Peeta von dem Kraftfeld zurückgeschleudert und reißt Finnick und Mags mit zu Boden.
Ich renne zu ihm, reglos liegt er in einem Geflecht aus Ranken. »Peeta?« Es riecht schwach nach versengten Haaren. Wieder rufe ich seinen Namen, rüttele an ihm, doch er reagiert nicht. Ich streiche über seine Lippen, und dort ist kein warmer Atem, obwohl er eben noch gekeucht hat. Ich lege das Ohr an seine Brust, dorthin, wo ich immer den Kopf ausruhe, wo ich den starken, gleichmäßigen Schlag seines Herzens höre. Aber es ist ganz still.
20
»Peeta!«, schreie ich. Ich rüttele fester, gebe ihm sogar eine Ohrfeige, aber es hat keinen Sinn. Sein Herz hat versagt. Meine Schläge gehen ins Leere. »Peeta!«
Finnick lehnt Mags an einen Baum und schiebt mich beiseite. »Lass mich mal.« Er berührt Punkte an Peetas Hals, fährt über seine Rippen und die Wirbelsäule. Dann hält er Peeta die Nase zu.
»Nein!«, schreie ich und stürze mich auf Finnick. Bestimmt will er sich vergewissern, dass Peeta tot ist, dass keine Hoffnung besteht, er könne je wieder zum Leben erwachen. Finnick hebt die Hand und schlägt mir so fest vor die Brust, dass ich gegen den nächsten Baumstamm fliege. Einen Augenblick lang bin ich benommen von dem Schmerz und versuche nur, wieder zu Atem zu kommen. Finnick hält Peeta wieder die Nase zu. Im Sitzen ziehe ich einen Pfeil heraus, lege an und will ihn schon abschießen, als Finnick sich herunterbeugt und Peeta küsst. Und das ist selbst für Finnicks Verhältnisse so absurd, dass ich innehalte. Aber nein, er küsst ihn nicht. Er hält Peeta die Nase zu, den Mund jedoch geöffnet, und jetzt bläst er ihm Luft in die Lunge. Ich kann es sehen, ich sehe regelrecht, wie Peetas Brust sich hebt und senkt. Dann öffnet Finnick den Reißverschluss von Peetas Overall und presst die Handballen auf Peetas Herz. Jetzt, da ich den Schock überwunden habe, begreife ich, was er macht.
Ich habe meine Mutter schon mal bei so was beobachtet, allerdings nur ganz selten. Wenn in Distrikt 12 jemandem das Herz versagt, schafft die Familie es meist nicht, ihn rechtzeitig zu meiner Mutter zu bringen. Ihre Patienten haben gewöhnlich Verbrennungen erlitten, sie sind verwundet oder krank. Oder ausgehungert natürlich.
Aber Finnick kommt aus einer anderen Welt. Er weiß, was er tut, das hat er auf jeden Fall schon öfter gemacht. Er geht methodisch vor, in einem festgelegten Rhythmus. Ich lasse den Pfeil zu Boden sinken, lehne mich zurück und warte verzweifelt auf ein Zeichen des Erfolgs. Quälende Minuten verstreichen und meine Hoffnung schrumpft. Als ich zu dem Schluss komme, dass es zu spät ist, dass Peeta tot ist, weitergezogen, für immer unerreichbar, hustet er leicht, und Finnick lehnt sich zurück.
Ich werfe meine Waffen weg und stürze zu ihm. »Peeta?«, flüstere ich. Ich streiche ihm die feuchten blonden Haarsträhnen aus der Stirn, spüre, wie der Puls an seinem Hals gegen meine Finger pocht.
Seine Lider gehen flatternd auf und er schaut mir in die Augen. »Pass auf«, sagt er schwach. »Da vorn ist ein Kraftfeld.«
Ich lache, aber Tränen laufen mir über die Wangen.
»Muss stärker sein als das im Trainingscenter«, sagt er. »Aber mir geht’s gut. Bin nur ein bisschen fertig.«
»Du warst tot! Dein Herz stand still!«, platze ich heraus, ehe ich darüber nachdenken kann, ob das klug ist. Ich schlage mir die Hand vor den Mund, denn jetzt kommen diese schrecklichen erstickten Laute heraus, wie immer, wenn ich schluchze.
»Na, jetzt scheint’s ja wieder zu schlagen«, sagt er. »Es ist alles gut, Katniss.« Ich nicke, doch die Geräusche hören nicht auf. »Katniss?« Jetzt macht Peeta sich Sorgen um mich, was das Ganze noch verrückter macht.
»Alles okay. Sind nur ihre Hormone«, sagt Finnick. »Wegen des Babys.« Ich schaue auf. Finnick kniet da und lehnt sich zurück, immer noch ein wenig keuchend vom Anstieg und der Hitze und der Anstrengung, Peeta wieder zum Leben zu erwecken.
»Nein. Das ist es nicht …«, stoße ich hervor, aber da werde ich von einem noch hysterischeren Heulkrampf übermannt, eine weitere Bestätigung für Finnicks Bemerkung mit dem Baby. Er schaut mir in die Augen und ich starre ihn durch die Tränen hindurch wütend an. Ich weiß, es ist idiotisch, dass ich mich so über ihn ärgere. Ich wollte Peeta unbedingt das Leben retten, ich konnte es nicht, und Finnick konnte es, also müsste ich ihm einfach nur dankbar sein. Das bin ich ja auch. Aber zugleich bin ich wütend, denn es bedeutet, dass ich Finnick Odair für immer und ewig zu Dank verpflichtet sein werde. Wie soll ich ihn da umbringen, während er schläft?
Ich hätte einen selbstzufriedenen oder sarkastischen Gesichtsausdruck erwartet, doch er sieht seltsam verwirrt aus. Er schaut zwischen Peeta und mir hin und her, als wollte er etwas herausfinden, dann schüttelt er leicht den Kopf, als könnte er so besser denken. »Wie geht es dir?«, fragt er Peeta. »Meinst du, du kannst weiter?«
»Nein, er muss sich ausruhen«, sage ich. Meine Nase läuft wie verrückt, und ich habe nicht mal einen Stofffetzen, den ich als Taschentuch benutzen könnte. Mags reißt eine Handvoll loses Moos von einem Ast ab und gibt es mir. Ich bin zu durcheinander, um mich darüber zu wundern. Ich putze mir lautstark die Nase und wische mir die Tränen ab. Das Moos fühlt sich schön an. Es ist saugfähig und überraschend weich.
Ich bemerke etwas Goldschimmerndes auf Peetas Brust. Ich strecke die Hand aus und fasse es an: eine Scheibe, die an einer Kette um seinen Hals hängt. Darauf ist mein Spotttölpel eingraviert. »Ist das dein Talisman?«, frage ich.
»Ja. Stört es dich, dass ich deinen Spotttölpel übernommen habe? Ich wollte, dass wir das gleiche Zeichen haben«, sagt er.
»Nein, warum sollte mich das stören?«, sage ich. Ich zwinge mich zu einem Lächeln. Dass Peeta mit einem Spotttölpel in der Arena auftaucht, ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits gibt es den Rebellen in den Distrikten bestimmt Auftrieb. Andererseits wird Präsident Snow es kaum übersehen, und das macht es noch schwieriger, Peeta das Leben zu retten.
»Wollt ihr euch hier häuslich niederlassen, oder was?«, fragt Finnick.
»Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre«, antwortet Peeta. »Ohne Wasser und ohne Schutz hierzubleiben. Mir geht es wirklich schon wieder ganz gut. Wir müssen eben langsam gehen.«
»Besser langsam als gar nicht.« Finnick hilft Peeta auf und ich reiße mich zusammen. Seit ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mit angesehen, wie Cinna zu Brei geschlagen wurde, ich bin zum zweiten Mal in einer Arena gelandet und habe Peeta sterben sehen. Ich bin froh, dass Finnick die Schwangerschaft für mich ins Feld führt, denn aus Sicht eines Sponsors mache ich meine Sache nicht besonders gut.
Ich überprüfe meine Waffen, obwohl ich weiß, dass sie völlig in Ordnung sind, aber so sieht es aus, als hätte ich alles im Griff. »Ich gehe voran«, verkünde ich.
Peeta will widersprechen, doch Finnick schneidet ihm das Wort ab. »Nein, lass sie das machen.« Er sieht mich mit finsterer Miene an. »Du wusstest, dass da ein Kraftfeld war, stimmt’s? Im allerletzten Moment wolltest du uns warnen.« Ich nicke. »Woher wusstest du es?«
Ich zögere. Es könnte gefährlich sein, wenn ich verrate, dass ich den Trick von Beetee und Wiress habe. Ich weiß nicht, ob die Spielmacher es beim Training mitbekommen haben. Ich bin im Besitz einer sehr wertvollen Information. Und wenn sie das wissen, könnten sie das Kraftfeld so verändern, dass ich das Flimmern nicht mehr erkenne. Also lüge ich. »Ich weiß nicht. Es ist fast, als könnte ich es hören. Horcht mal.« Wir sind alle still. Wir hören Insekten, Vögel, den leichten Wind in den Blättern.
»Ich höre nichts«, sagt Peeta.
»Doch«, sage ich. »Es ist wie in Distrikt 12, wenn der Zaun angeschaltet ist, nur viel, viel leiser.« Wieder lauschen sie konzentriert. Auch ich lausche, obwohl es nichts zu hören gibt. »Da!«, sage ich. »Hört ihr? Genau aus der Richtung, wo Peeta den Schlag gekriegt hat.«
»Ich höre auch nichts«, sagt Finnick. »Aber wenn du es hörst, dann geh auf jeden Fall voran.«
Ich beschließe, das Spiel auf Teufel komm raus weiterzuspielen. »Komisch«, sage ich. Ich drehe den Kopf hin und her, als wäre ich ganz verwundert. »Ich höre es nur mit dem linken Ohr.«
»Mit dem Ohr, das die Ärzte repariert haben?«, fragt Peeta.
»Ja«, sage ich, dann zucke ich die Achseln. »Vielleicht haben sie es besser hingekriegt, als sie dachten. Weißt du, manchmal höre ich links echt komische Sachen. Sachen, von denen man gar nicht denkt, dass sie Geräusche machen. Zum Beispiel Insektenflügel. Oder Schnee, der auf den Boden fällt.« Genial. Jetzt werden sie sich auf die Chirurgen stürzen, die mein taubes Ohr nach den Spielen im letzten Jahr operiert haben, und die werden erklären müssen, wieso ich auf einmal hören kann wie eine Fledermaus.
»Du«, sagt Mags. Sie schiebt mich vorwärts und ich übernehme die Führung. Da wir sowieso langsam gehen müssen, möchte Mags einen Ast als Gehhilfe. Im Handumdrehen hat Finnick ihr einen Spazierstock gebastelt. Für Peeta macht er auch einen Stock, und das ist gut so, denn Peeta protestiert zwar, aber ich glaube, dass er sich eigentlich am liebsten hinlegen würde. Finnick bildet das Schlusslicht, sodass wir wenigstens jemanden haben, der nach hinten absichert.
Das Kraftfeld zu meiner Linken, weil das ja angeblich die Seite mit meinem übermenschlichen Ohr ist, bewege ich mich vorwärts. Doch da das alles frei erfunden ist, schneide ich sicherheitshalber ein paar harte Nüsse ab, die wie Trauben an einem Baum hängen, und werfe sie vor mich, denn ich habe das Gefühl, dass mir die Flecken, an denen man ein Kraftfeld erkennt, meist entgehen. Immer wenn eine Nuss auf das Feld trifft, entsteht eine Rauchwolke, und dann landet die Nuss, schwarz und mit aufgebrochener Schale, zu meinen Füßen.
Nach einer Weile höre ich hinter mir ein schmatzendes Geräusch. Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie Mags eine Nuss aus der Schale pellt und in ihren bereits vollen Mund stopft. »Mags!«, schreie ich. »Spuck sie aus. Die könnten giftig sein.«
Sie murmelt irgendwas, beachtet mich jedoch nicht weiter und leckt sich genüsslich die Lippen. Ich schaue Hilfe suchend zu Finnick, aber der lacht nur. »Das werden wir schon merken«, sagt er.
Ich gehe weiter und wundere mich über Finnick, der die alte Mags gerettet hat, aber nichts dagegen unternimmt, dass sie unbekannte Nüsse isst. Den Haymitch abgesegnet hat. Der Peeta wieder zum Leben erweckt hat. Warum hat er ihn nicht einfach sterben lassen? Man hätte ihm nichts vorwerfen können. Ich hätte nie gedacht, dass es in seiner Macht stünde, ihn wiederzubeleben. Warum wollte er Peeta bloß retten? Und warum war er so wild entschlossen, sich mit mir zu verbünden? Und mich notfalls auch zu töten. Wobei er die Entscheidung, ob wir gegeneinander kämpfen, mir überlassen hat.
Ich gehe weiter, werfe meine Nüsse, entdecke hier und da einen Zipfel des Kraftfelds, versuche mich weiter links zu halten, einen Durchschlupf zu finden, weg vom Füllhorn und hoffentlich hin zu einer Wasserquelle. Doch nach etwa einer Stunde merke ich, dass es zwecklos ist. Wir kommen nicht weiter nach links. Der Weg scheint in einem Bogen um das Kraftfeld herum zu verlaufen. Ich bleibe stehen und schaue zu der humpelnden Mags, sehe den Schweiß auf Peetas Gesicht glänzen. »Kommt, wir machen hier eine Pause«, sage ich. »Ich muss mir das noch mal von oben angucken.«
Ich suche mir einen Baum aus, der noch höher gewachsen ist als die anderen. Ich klettere die gewundenen Aste hinauf und halte mich so dicht wie möglich am Stamm. Ich weiß ja nicht, wie schnell diese gummiartigen Äste brechen können. Trotzdem klettere ich höher, als ich sollte; ich muss sehen, was da los ist. Ich klammere mich an einen Ast, der nicht dicker ist als ein Setzling und in der feuchten Brise hin und her schwankt, und finde meinen Verdacht bestätigt. Es ist völlig klar, weshalb wir nicht weiter nach links kommen und auch nie kommen werden. Von diesem gewagten Aussichtspunkt kann ich zum ersten Mal die Form der gesamten Arena erkennen. Es ist ein vollkommener Kreis. Mit einem vollkommenen Rad in der Mitte. Der Himmel über diesem Kreis ist gleichmäßig rosa gefärbt. Und ich meine, zwei von diesen welligen Vierecken zu erkennen, die wunden Punkte, wie Wiress und Beetee sie genannt haben, denn sie verraten etwas, das verborgen bleiben soll, und sind deshalb Schwachstellen. Nur um ganz sicherzugehen, schieße ich einen Pfeil in die Luft über den Bäumen. Ein Lichtstrahl, ein Aufblitzen des echten blauen Himmels, dann fällt der Pfeil zurück in den Dschungel. Ich klettere vom Baum, um den anderen die schlechte Nachricht zu überbringen.
»Das Kraftfeld hält uns in einem Kreis gefangen. In einer Kuppel, genauer gesagt. Ich weiß nicht, wie hoch sie ist. Es gibt das Füllhorn, das Meer und den Dschungel drum herum. Ganz exakt. Ganz symmetrisch. Und nicht besonders groß«, sage ich.
»Hast du irgendwo Wasser gesehen?«, fragt Finnick.
»Nur das Salzwasser vom Anfang der Spiele«, sage ich.
»Es muss noch irgendwo anders Wasser geben«, sagt Peeta mit gerunzelter Stirn. »Sonst sind wir alle in wenigen Tagen tot.«
»Tja, das Laub ist dicht. Vielleicht gibt es irgendwo Tümpel oder Quellen«, sage ich zweifelnd. Mein Gefühl sagt mir, dass das Kapitol diese unpopulären Spiele vielleicht so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Möglicherweise hat Plutarch Heavensbee schon den Befehl erhalten, uns zu erledigen. »Jedenfalls hat es keinen Zweck zu gucken, was hinter diesem Hügel ist, denn die Antwort lautet: Nichts.«
»Zwischen dem Kraftfeld und dem Rad muss es irgendwo Trinkwasser geben«, beharrt Peeta. Wir wissen alle, was das heißt. Wieder nach unten. Zurück zu den Karrieros und dem Blutbad. Und das, wo Mags kaum laufen kann und Peeta zu schwach zum Kämpfen ist.
Wir beschließen, ein paar Hundert Meter bergab dem Kreis zu folgen. Vielleicht gibt es auf dieser Höhe Wasser. Ich gehe wieder voran, pfeffere hin und wieder eine Nuss nach links, doch das Kraftfeld ist jetzt weiter weg. Die Sonne brennt auf uns herab, verwandelt die Luft in Dampf, spielt unseren Augen Streiche. Am Nachmittag ist klar, dass Peeta und Mags nicht mehr weiterkönnen.
Finnick wählt für die Rast einen Platz etwa zehn Meter unterhalb des Kraftfelds aus, er sagt, wir könnten es als Waffe einsetzen, indem wir unsere Feinde dorthin lenken, wenn sie uns angreifen. Dann pflücken er und Mags Blätter von dem harten Gras, das in zwei Meter hohen Büschen wächst, und weben daraus Matten. Da Mags die Nüsse offenbar gut vertragen hat, sammelt Peeta weitere und röstet sie, indem er sie gegen das Kraftfeld wirft. Geduldig pellt er die Schale ab und sammelt die Kerne auf einem Blatt. Ich stehe Wache, unruhig und schwitzend und mitgenommen von den Eindrücken des Tages.
Durst. Ich hab solchen Durst. Schließlich halte ich es nicht mehr aus. »Finnick, halt du doch mal Wache und ich suche noch ein bisschen nach Wasser«, sage ich. Keiner ist begeistert von meiner Idee, allein loszuziehen, aber die Gefahr auszutrocknen schwebt über uns.
»Keine Angst, ich gehe nicht weit«, verspreche ich Peeta.
»Ich komme mit«, sagt er.
»Nein, ich will auch auf die Jagd gehen, wenn möglich«, sage ich. Ich füge nicht hinzu: »Und du kannst nicht mitkommen, weil du zu laut bist.« Aber das versteht sich von selbst. Er würde die Beute verscheuchen und mich mit seinem schweren Schritt in Gefahr bringen. »Ich bleib nicht lange weg.«
Ich schleiche zwischen den Bäumen hindurch und stelle erfreut fest, dass man sich auf dem Boden hier sehr gut geräuschlos bewegen kann. Ich gehe schräg bergab, doch außer noch mehr üppigem Grün finde ich nichts.
Ein Kanonendonner lässt mich innehalten. Das anfängliche Gemetzel am Füllhorn ist offenbar vorbei. Jetzt können wir die Zahl der Toten erfahren. Ich zähle die Schüsse, jeder Schuss bedeutet einen toten Sieger. Acht. Weniger als letztes Jahr. Doch es kommt mir mehr vor, weil ich die meisten mit Namen kenne.
Ich fühle mich plötzlich schwach und lehne mich an einen Baum, um zu verschnaufen. Ich spüre, wie die Hitze meinem Körper wie einem Schwamm das Wasser entzieht. Schon jetzt fällt es mir schwer zu schlucken, ich beginne mich matt zu fühlen. Ich streiche mit der Hand über meinen Bauch in der Hoffnung, dass draußen im Kapitol eine mitfühlende Schwangere mich sponsert und dass Haymitch ein wenig Wasser schicken kann. Vergeblich. Ich sinke zu Boden.
Während ich so still dasitze, sehe ich die Tiere: merkwürdige Vögel mit prächtigem Gefieder, Baumleguane mit zuckender blauer Zunge und etwas, das aussieht wie eine Kreuzung aus Ratte und Opossum und sich an den Ästen nah am Stamm festhält. Ich erschieße eins, um es mir genauer anzuschauen. Es ist hässlich, keine Frage, ein großes Nagetier mit grau geflecktem Fell und zwei fiesen Nagezähnen, die über den Unterkiefer ragen. Während ich es ausnehme und häute, fällt mir noch etwas anderes auf. Die Schnauze ist nass. Als hätte das Tier aus einem Bach getrunken. Aufgeregt mache ich mich auf die Suche. Die Wasserquelle des Tiers kann nicht weit entfernt sein.
Nichts. Ich finde nichts. Nicht mal einen Tautropfen. Weil ich weiß, dass Peeta sich Sorgen um mich macht, kehre ich schließlich zu unserem Lager zurück, mir ist noch heißer als vorher und ich bin noch frustrierter.
Die anderen haben inzwischen das Lager wohnlich gemacht. Aus Grasmatten haben Mags und Finnick eine Art Hütte gebaut, an einer Seite offen, doch mit drei Wänden, einem Fußboden und einem Dach. Mags hat auch einige Schalen geflochten, die Peeta mit gerösteten Nüssen gefüllt hat. Hoffnungsvoll schauen die drei mich an, doch ich schüttele den Kopf. »Nichts. Kein Wasser. Aber es muss welches da sein. Das Tier hier wusste auch, wo«, sage ich und hebe das gehäutete Nagetier hoch, sodass alle es sehen können. »Kurz bevor ich es von seinem Baum herunterschoss, muss es getrunken haben, aber ich konnte die Quelle nicht finden. Ich hab in einem Umkreis von dreißig Metern jeden Fleck abgegrast.«
»Kann man es essen?«, fragt Peeta.
»Weiß nicht. Aber sein Fleisch sieht so ähnlich aus wie das eines Eichhörnchens. Es müsste gebraten werden …« Bei der Vorstellung, hier aus dem Nichts ein Feuer anzuzünden, zögere ich. Selbst wenn es mir gelingen sollte, ist da immer noch der Rauch. In dieser Arena sind wir alle so nah beieinander, dass ein Feuer nicht unentdeckt bliebe.
Peeta hat eine andere Idee. Er schneidet ein Stück Fleisch heraus, steckt es auf einen spitzen Stock und wirft diesen gegen das Kraftfeld. Ein scharfes Zischen ist zu hören, dann kommt der Stock zurückgeflogen. Der Fleischwürfel ist außen schwarz, innen jedoch gut durchgebraten. Wir klatschen Beifall, aber da fällt uns ein, wo wir sind, und wir halten schnell inne.
Als wir uns in der Hütte zusammensetzen, versinkt die weiße Sonne im rosigen Himmel. Ich traue den Nüssen immer noch nicht so ganz, aber Finnick sagt, dass Mags sie aus früheren Spielen kennt. Diesmal habe ich beim Training keine Zeit an der Station mit den essbaren Pflanzen verbracht, weil mir das im letzten Jahr so wenig genützt hat. Jetzt bereue ich es. Bestimmt wären dort einige der unbekannten Pflanzen um mich herum vorgekommen. Und ich hätte vielleicht eine Ahnung gehabt, wohin die Reise geht. Aber Mags scheinen sie gut zu bekommen, sie futtert diese Nüsse schon seit Stunden. Also nehme ich eine und knabbere ein wenig daran. Die Nuss hat einen milden, süßlichen Geschmack, ein bisschen wie eine Esskastanie. Ich komme zu dem Schluss, dass sie genießbar ist. Das Nagetier schmeckt streng nach Wild, ist aber überraschend saftig. Für unseren ersten Abend in der Arena ist das gar keine üble Mahlzeit. Wenn wir nur etwas zum Runterspülen hätten.
Finnick fragt mich über das Nagetier aus, das wir Baumratte nennen. Auf welcher Höhe es im Baum saß, wie lange ich es beobachtet habe, ehe ich schoss, und was es gemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass es groß was gemacht hätte. Es hat nach Insekten geschnüffelt oder so.
Mir graut vor der Nacht. Immerhin bieten die dicht geflochtenen Grasmatten etwas Schutz vor dem, was nach einbrechender Dunkelheit womöglich über den Dschungelboden kriechen wird. Doch kurz nachdem die Sonne hinter den Horizont geglitten ist, geht ein blasser Mond auf, sodass wir gerade genug sehen können. Unsere Gespräche verstummen, denn wir wissen, was jetzt kommt. Wir stellen uns am Eingang der Hütte in einer Reihe auf und Peeta schiebt seine Hand in meine.
Der Himmel wird hell erleuchtet vom Wappen des Kapitols, das aussieht, als würde es im Himmel schweben. Während ich der Hymne lausche, denke ich: Für Finnick und Mags wird es schwerer. Aber dann ist es auch für mich schwer, die Gesichter der acht toten Sieger zu sehen, die in den Himmel projiziert werden.
Der Mann aus Distrikt 5, den Finnick mit seinem Dreizack umgebracht hat, erscheint als Erster. Das bedeutet, dass alle Tribute von 1 bis 4 noch am Leben sind - die vier Karrieros, Beetee und Wiress und natürlich Mags und Finnick. Auf den Mann aus Distrikt 5 folgen der männliche Morfixer aus 6, Cecelia und Woof aus 8, die beiden aus 9, die Frau aus 10 und Seeder aus 11. Danach erscheint wieder das Wappen des Kapitols mit ein wenig abschließender Musik und dann wird der Himmel dunkel bis auf den Mond.
Keiner sagt etwas. Ich kann nicht behaupten, ich hätte einen der Toten gut gekannt. Aber ich denke an die drei Kinder, die sich an Cecelia geklammert haben, als sie fortgebracht wurde.
Daran, wie freundlich Seeder bei unserer Begegnung im Trainingscenter zu mir war. Selbst der Gedanke an den Morfixer mit den glasigen Augen, wie er mir gelbe Blumen auf die Wangen malt, versetzt mir einen Stich. Alle tot. Alle weg.
Ich weiß nicht, wie lange wir noch so dagestanden hätten, wäre nicht ein silberner Fallschirm durch die Blätter geglitten und vor uns gelandet. Niemand streckt die Hände danach aus.
»Was glaubt ihr, für wen das ist?«, sage ich schließlich.
»Keine Ahnung«, sagt Finnick. »Was haltet ihr davon, wenn Peeta ihn bekommt? Weil er heute gestorben ist.«
Peeta knotet die Schnur auf und breitet das kreisrunde Stück Seide auf dem Boden aus. Auf dem Fallschirm liegt ein kleiner Metallgegenstand, den ich nicht einordnen kann. »Was ist das?«, frage ich. Keiner weiß es. Wir lassen ihn von Hand zu Hand gehen und untersuchen ihn der Reihe nach. Es ist ein Metallrohr, das sich am einen Ende leicht verjüngt. Am anderen Ende hat es eine kleine, nach unten gebogene Tülle. Es kommt mir vage bekannt vor. Ein Teil, das von einem Fahrrad abgefallen sein könnte, von einer Gardinenstange, es könnte alles Mögliche sein.
Peeta bläst hinein, um zu prüfen, ob es einen Ton macht. Macht es nicht. Finnick steckt den kleinen Finger hinein, um es als Waffe auszuprobieren. Unbrauchbar.
»Kannst du damit fischen, Mags?«, frage ich. Mags, die mit fast allem fischen kann, schüttelt den Kopf und grunzt.
Ich lege das Rohr auf meine Hand und lasse es hin und her rollen. Da wir Verbündete sind, arbeitet Haymitch bestimmt mit den Mentoren von Distrikt 4 zusammen. Er hat das Geschenk mit ausgesucht. Das bedeutet, dass es wertvoll ist. Uns sogar das Leben retten kann. Ich erinnere mich an letztes Jahr, als ich so nötig Wasser brauchte und er es mir nicht geschickt hat, weil er wusste, dass ich es finden konnte, wenn ich mir Mühe gab. In Haymitchs Geschenken oder in ihrem Ausbleiben verstecken sich wichtige Botschaften. Ich kann fast hören, wie er mich anknurrt: Streng dein Gehirn an, falls du eins hast. Was ist das?
Ich wische mir den Schweiß aus den Augen und halte das Geschenk ins Mondlicht. Ich drehe und wende es, schaue es aus verschiedenen Winkeln an, bedecke einzelne Teile und gebe sie dann wieder frei. Damit es mir seinen Zweck verrät. Schließlich stecke ich frustriert ein Ende in die Erde. »Ich geb’s auf. Vielleicht kriegen Beetee und Wiress es raus, wenn wir uns mit ihnen zusammentun.«
Ich strecke mich, lege die heiße Wange auf die Grasmatte, starre verärgert auf das Ding. Peeta reibt einen verspannten Punkt zwischen meinen Schultern und ich werde ein wenig lockerer. Ich frage mich, warum es sich kein bisschen abgekühlt hat, jetzt, da die Sonne untergegangen ist. Ich frage mich, was sie zu Hause wohl machen.
Prim. Meine Mutter. Gale. Madge. Ich stelle mir vor, wie sie mir zu Hause zuschauen. Jedenfalls hoffe ich, dass sie zu Hause sind. Nicht von Thread verhaftet. Oder bestraft wie Cinna. Wie Darius. Bestraft wegen mir. Alle.
Jetzt sehne ich mich nach ihnen, nach meinem Distrikt, meinem Wald. Ein anständiger Wald mit kräftigen Hartholzbäumen, reichlich Nahrung, mit Wild, vor dem man sich nicht ekeln muss. Rauschende Bäche. Kühle Brisen. Nein, kalte Winde, die diese erstickende Hitze wegblasen. Ich beschwöre einen solchen Wind mit meinen Gedanken, lasse mir von ihm kalte Wangen machen und taube Finger, und auf einmal hat das Metallding, das halb in der schwarzen Erde steckt, einen Namen.
»Ein Zapfen!«, rufe ich und setze mich kerzengerade auf.
»Was?«, fragt Finnick.
Ich ziehe das Ding aus der Erde und wische es sauber. Schließe die Hand um das sich verjüngende Ende, verberge es und schaue auf die Tülle. Ja, so ein Ding habe ich schon mal gesehen. An einem kalten, windigen Tag vor langer Zeit, als ich mit meinem Vater im Wald war. Es steckte fest in einem Loch, das in den Stamm eines Ahornbaums gebohrt war. Eine Öffnung für den Saft, der dann in unseren Eimer floss. Mit Ahornsirup wurde selbst unser fades Brot zu einer Leckerei. Nach dem Tod meines Vaters blieben seine Zapfhähne verschwunden, ich wusste nicht, was mit ihnen passiert war. Wahrscheinlich hatte er sie irgendwo im Wald versteckt. Wo niemand sie je finden wird.
»Das ist ein Zapfen. So was wie ein Hahn. Man steckt ihn in einen Baum und dann kommt Saft raus.« Ich schaue auf die kräftigen grünen Stämme um mich herum. »Na ja, es muss die richtige Sorte Baum sein.«
»Saft?«, sagt Finnick. Am Meer wächst auch nicht die richtige Sorte Bäume.
»Für Sirup«, sagt Peeta. »Aber in diesen Bäumen muss etwas anderes sein.«
Plötzlich sind wir alle auf den Beinen. Unser Durst. Der Mangel an Wasserquellen. Die spitzen Vorderzähne der Baumratte und ihr nasses Maul. In diesen Bäumen kann es nur eines geben, was begehrenswert ist. Finnick will den Zapfhahn schon mit einem Stein in die grüne Rinde eines kräftigen Baums hämmern, doch ich halte ihn zurück. »Warte. Nachher machst du ihn noch kaputt. Wir müssen erst ein Loch bohren«, sage ich.
Wir haben nichts zum Bohren, also bietet Mags ihre Ahle an, und Peeta schiebt sie direkt in die Rinde, sodass der Stift fünf Zentimeter tief im Stamm steckt. Abwechselnd vergrößern Peeta und Finnick das Loch mit der Ahle und den Messern, bis der Zapfhahn hineinpasst. Vorsichtig schiebe ich ihn in das Loch und dann treten wir alle erwartungsvoll zurück.
Zunächst passiert gar nichts. Dann rollt ein Wassertropfen an der Tülle herab und landet in Mags’ Hand. Sie leckt ihn ab und streckt die Hand wieder aus.
Wir bewegen den Zapfhahn hin und her, bis ein dünner Strahl herausfließt. Abwechselnd halten wir den Mund unter den Hahn und benetzen unsere ausgedörrte Zunge. Mags bringt eine Schale herbei, das Gras ist so fest geflochten, dass sie das Wasser hält. Wir füllen die Schale und lassen sie herumgehen, nehmen große Schlucke, und später, als unser Durst gelöscht ist, spritzen wir uns Wasser ins Gesicht und waschen uns. Der reine Luxus. Das Wasser ist eher warm wie alles hier, aber wir können jetzt nicht wählerisch sein.
Jetzt, wo wir nicht mehr an den Durst denken müssen, merken wir, wie erschöpft wir sind, und treffen Vorbereitungen für die Nacht. Letztes Jahr habe ich nachts immer versucht, meine Sachen zu packen für den Fall, dass ich schnell verschwinden müsste. Diesmal gibt es keinen Rucksack, den ich bereithalten könnte. Nur meine Waffen, die ich sowieso immer festhalte. Der Zapfhahn fällt mir ein und ich hole ihn aus dem Baumstamm. Ich befreie eine kräftige Ranke von ihren Blättern, ziehe sie durch die Röhre und binde den Zapfhahn sorgfältig an meinem Gurt fest.
Finnick will als Erster Wache halten und ich lasse ihn. Einer von uns beiden muss das übernehmen, bis es Peeta wieder gut geht. Ich strecke mich in der Hütte neben Peeta aus und sage Finnick, er soll mich wecken, wenn er müde wird. Nach ein paar Stunden werde ich von etwas aus dem Schlaf gerissen, das sich wie ein Glockenschlag anhört. Dong! Dong! Es klingt nicht genauso wie die Glocke, die an Neujahr im Justizgebäude läutet, aber doch so ähnlich, dass ich das Geräusch erkenne. Peeta und Mags schlafen einfach weiter, aber Finnick scheint genauso wachsam zu sein wie ich. Die Glocke verstummt.
»Ich hab zwölf gezählt«, sagt er.
Ich nicke. Zwölf. Was bedeutet das? Ein Glockenschlag für jeden Distrikt? Vielleicht. Aber warum? »Meinst du, das hat was zu bedeuten?«
»Keine Ahnung«, sagt er.
Wir warten auf weitere Anweisungen, zum Beispiel eine Nachricht von Claudius Templesmith. Eine Einladung zu einem Festmahl. Das einzig Bemerkenswerte passiert in weiter Ferne. Ein greller Blitz schlägt in einen hohen Baum ein und dann bricht ein Gewitter los. Ich vermute, das kündigt Regen an, eine Wasserquelle für alle, die keinen so schlauen Mentor wie Haymitch haben.
»Leg dich schlafen, Finnick. Ich bin jetzt sowieso mit der Wache dran«, sage ich.
Finnick zögert, aber niemand kann ewig wach bleiben. Er legt sich an den Eingang der Hütte, einen Dreizack in der Hand, und gleitet in einen unruhigen Schlaf.
Ich sitze mit Pfeil und Bogen da und schaue in den Dschungel, der im Mondlicht gespenstisch bleich und grün ist. Nach etwa einer Stunde lassen die Blitze nach. Dann höre ich, wie der Regen einsetzt und ein paar Hundert Meter entfernt auf die Blätter prasselt. Ich warte darauf, dass er bis zu uns kommt, aber das passiert nicht.
Beim Donnern der Kanone zucke ich zusammen, während meine schlafenden Gefährten davon unbeeindruckt bleiben. Es hat keinen Zweck, sie deswegen zu wecken. Ein weiterer Sieger tot. Ich will nicht darüber nachdenken, wer es sein mag.
Der undefinierbare Regen versiegt plötzlich, wie der Sturm letztes Jahr in der Arena.
Wenige Augenblicke darauf sehe ich, wie aus der Richtung, wo eben der Schauer fiel, ein Nebel leise heranschwebt. Eine ganz normale Reaktion, denke ich. Kühler Regen auf dem heißen Boden. Der Nebel kommt gleichmäßig näher. Kleine Zipfel schieben sich vor und formen sich zu Krallen, als würden sie den Rest hinter sich herziehen. Plötzlich stellen sich mir die Nackenhaare auf. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Nebel. Er rollt zu gleichförmig heran, um natürlich zu sein. Und wenn er nicht natürlich ist …
Ein widerlich süßer Geruch dringt mir in die Nase, und ich wende mich panisch den anderen zu, rufe, dass sie aufwachen sollen.
In den paar Sekunden, die es braucht, sie zu wecken, beginnt meine Haut Blasen zu werfen.
21
Kleine glühend heiße Stiche. Überall, wo die Nebeltröpfchen meine Haut berühren.
»Weg hier!«, schreie ich den anderen zu. »Schnell!«
Finnick ist sofort auf den Beinen, bereit, sich auf den Feind zu stürzen. Als er die Nebelwand sieht und begreift, wirft er sich die noch schlafende Mags über die Schulter und rennt los. Peeta ist ebenfalls aufgestanden, aber noch nicht ganz da. Ich packe ihn am Arm und ziehe ihn hinter Finnick her durch den Dschungel.
»Was ist? Was ist?«, fragt er verwirrt.
»Irgendein Nebel. Giftgas. Schnell, Peeta!«, dränge ich. Jetzt merke ich, dass die Folgen des Stromschlags doch gewaltig sind, auch wenn Peeta das am Tag bestritten hat. Er ist langsam, viel langsamer als sonst. Und das Gewirr aus Ranken und Gestrüpp, das mich manchmal aus dem Gleichgewicht bringt, lässt ihn bei jedem Schritt straucheln.
Ich drehe mich nach dem Nebel um, der sich wie ein Wall in alle Richtungen erstreckt. Ein schrecklicher Impuls zu fliehen, Peeta im Stich zu lassen und meine eigene Haut zu retten, durchzuckt mich. Es wäre so leicht, blitzschnell wegzurennen, vielleicht sogar auf einen Baum zu klettern, über die Nebelwand hinweg, die etwa zehn Meter hoch ist. Genau das habe ich bei den letzten Spielen getan, überlege ich, als die Mutationen auftauchten. Da bin ich losgerannt und habe erst wieder an Peeta gedacht, als ich das Füllhorn erreicht hatte. Diesmal bezwinge ich meine Panik, und bleibe bei ihm. Diesmal geht es nicht um mein Überleben, sondern um seins. Ich denke an die Menschen in den Distrikten, die auf die Bildschirme starren, darauflauern, ob ich wegrenne, wie das Kapitol es will, oder ob ich bleibe.
Ich verschränke meine Finger fest mit seinen und sage: »Guck auf meine Füße. Versuch in meine Fußstapfen zu treten.« Das hilft. So kommen wir ein wenig schneller voran, allerdings nicht schnell genug, um eine Pause einlegen zu können, der Nebel bleibt uns dicht auf den Fersen. Einzelne Tröpfchen lösen sich aus den Schwaden. Sie brennen, aber nicht wie Feuer. Es ist weniger heiß als schmerzhaft, wenn die chemische Substanz auf die Haut trifft, sich festbeißt und durch die Hautschichten frisst. Unsere Overalls helfen kein bisschen. Sie bieten so wenig Schutz, dass wir ebenso gut in Seidenpapier eingepackt sein könnten.
Finnick, der zunächst losgestürmt war, bleibt stehen, als er mitkriegt, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Aber hier geht es nicht darum, etwas zu bekämpfen, man kann nur versuchen zu entkommen. Er ruft uns aufmunternde Worte zu, bemüht sich, uns anzuspornen, und seine Stimme ist für uns ein Wegweiser, aber mehr auch nicht.
Peeta verfängt sich mit seinem künstlichen Bein in einem Knäuel aus Schlingpflanzen, und ehe ich ihn auffangen kann, fällt er hin. Als ich ihm aufhelfe, bemerke ich etwas, das noch beunruhigender ist als die Blasen, noch bedrohlicher als die Verbrennungen. Seine linke Gesichtshälfte ist erschlafft, als wäre in den Muskeln kein Leben mehr. Das Lid hängt herab und verdeckt fast sein Auge. Sein Mund ist in einem merkwürdigen Winkel nach unten verzerrt. »Peeta …«, sage ich. Und in diesem Moment merke ich, wie ein Krampf meinen Arm durchzuckt.
Aus welchen chemischen Substanzen dieser Nebel auch besteht, er brennt nicht nur, er zielt auf unsere Nerven. Eine ganz neue Art von Angst durchfährt mich, und ich zerre Peeta weiter, was nur dazu führt, dass er erneut stolpert. Als ich ihn wieder hochgezogen habe, zucken meine Arme unkontrollierbar. Der Nebel ist jetzt ganz nah, weniger als einen Meter entfernt. Irgendetwas stimmt nicht mit Peetas Beinen, er versucht zu gehen, aber sie bewegen sich spastisch, marionettenhaft.
Irgendwie taumelt Peeta weiter, und da erst merke ich, dass Finnick zurückgekommen ist und Peeta mitschleift. Ich zwänge die eine Schulter, die ich offenbar noch in der Gewalt habe, unter Peetas Arm und gebe mein Bestes, um mit Finnicks schnellem Schritt mitzuhalten. Etwa zehn Meter liegen zwischen uns und dem Nebel, als Finnick stehen bleibt.
»Das bringt nichts. Ich muss ihn tragen. Kannst du Mags nehmen?«, fragt er mich.
»Ja«, sage ich entschlossen, obwohl mir das Herz in die Hose rutscht. Mags wiegt zwar höchstens dreißig Kilo, aber ich bin auch nicht gerade kräftig. Trotzdem, ich habe bestimmt schon Schwereres getragen. Wenn nur meine Arme nicht so wild zucken würden. Ich hocke mich hin, und sie legt sich über meine Schulter, wie sie es auch bei Finnick immer macht. Langsam strecke ich die Beine und mit durchgedrückten Knien schaffe ich es. Finnick trägt Peeta jetzt auf dem Rücken, und so gehen wir weiter, Finnick vorneweg, ich in der Spur, die er uns durchs Gestrüpp bahnt.
Der Nebel schiebt sich näher heran, still und regelmäßig und gleichförmig bis auf die greifenden Krallen. Während ich instinktiv wegrennen will, geht Finnick den Hügel schräg hinunter. Er versucht das Gas auf Distanz zu halten und zugleich das Wasser um das Füllhorn zu erreichen. Ja, Wasser, denke ich, während sich die Säuretropfen tiefer in mich hineinbohren. Jetzt bin ich so dankbar, dass ich Finnick nicht umgebracht habe, denn wie hätte ich Peeta ohne ihn lebend hier rausbekommen? So dankbar, dass jemand mir beisteht, wenn auch nur vorübergehend.
Mags kann nichts dafür, dass ich ins Straucheln gerate. Sie versucht sich leicht zu machen, aber Tatsache ist, dass ich so viel Gewicht nicht tragen kann. Zumal jetzt auch noch mein rechtes Bein steif zu werden scheint. Die ersten beiden Male rappele ich mich wieder auf, doch als ich das dritte Mal hinfalle und wieder hochkommen will, spielt mein Bein einfach nicht mehr mit. Es versagt und Mags rollt vor mir auf die Erde. Ich rudere mit den Armen, versuche mich an Ranken und Asten hochzuziehen.
Im Nu ist Finnick wieder bei mir, Peeta auf dem Rücken. »Es hat keinen Zweck«, sage ich. »Kannst du sie beide tragen? Geh nur weiter, ich hole euch schon ein.« Ein etwas zweifelhafter Vorschlag, aber ich sage es mit aller Zuversicht, die ich zustande bringe.
Ich sehe Finnicks Augen, grün im Mondlicht. Ich sehe sie so klar wie den hellen Tag. Fast wie Katzenaugen, seltsam reflektierend. Vielleicht, weil Tränen darin glänzen. »Nein«, sagt er. »Ich kann sie nicht beide tragen. Meine Arme machen nicht mit.« Es stimmt. Seine Arme zucken unkontrolliert an seinem Körper. Seine Hände sind leer. Von seinen drei Dreizacken ist nur noch einer übrig und den hält Peeta. »Es tut mir leid, Mags. Ich schaffe es nicht.«
Was dann passiert, geht so schnell und ist so sinnlos, dass ich keine Chance habe, es zu verhindern. Mags rappelt sich hoch, drückt Finnick einen Kuss auf die Lippen und humpelt dann geradewegs in den Nebel hinein. Sofort wird ihr Körper von wilden Zuckungen erfasst und in einem schrecklichen Tanz fällt sie zu Boden.
Ich möchte schreien, doch meine Kehle brennt wie Feuer. Ich höre den Kanonenschuss und weiß, dass ihr Herz aufgehört hat zu schlagen, dass sie tot ist, und doch mache ich einen unsinnigen Schritt in ihre Richtung. »Finnick?«, rufe ich heiser, aber er hat sich schon abgewandt und entfernt sich von dem Nebel. Weil mir nichts Besseres einfällt, taumele ich hinter ihm her, das unbrauchbare Bein nachziehend.
Zeit und Raum verlieren ihre Bedeutung, während der Nebel in mein Gehirn einzudringen scheint, mir die Gedanken verwirrt, alles unwirklich macht. Irgendein tief verwurzelter Überlebenstrieb sorgt dafür, dass ich hinter Finnick und Peeta herstolpere, mich weiterbewege, obwohl ich wahrscheinlich schon halb tot bin. Teile von mir sind tot oder jedenfalls im Begriff abzusterben. Und Mags ist tot. Immerhin das weiß ich, oder vielleicht glaube ich es auch nur zu wissen, denn das alles ist völlig widersinnig.
Mondlicht, das auf Finnicks bronzefarbenem Haar schimmert, brennend heiße Tropfen wie Nadelstiche, mein zu Holz gewordenes Bein. Ich gehe Finnick hinterher, bis er zusammenbricht, Peeta immer noch auf dem Rücken. Ich kann einfach nicht anhalten und laufe weiter, bis ich über ihre liegenden Körper stolpere und wir einen einzigen Haufen bilden. Jetzt werden wir alle sterben, genau so, denke ich. Doch das ist nur ein abstrakter Gedanke, weit weniger beängstigend als die Schmerzen in meinem Körper. Ich höre Finnick stöhnen und klettere irgendwie von den anderen herunter. Ich sehe die Nebelwand, die jetzt perlweiß aussieht. Vielleicht spielen meine Augen mir einen Streich, oder es liegt am Mondlicht, aber der Nebel scheint sich zu verwandeln. Ja, er wird dichter, als würde er gegen eine Glasscheibe gedrückt. Ich kneife die Augen zusammen und sehe, dass die Krallen nicht mehr da sind. Der Nebel hat aufgehört, sich vorwärtszubewegen. Wie andere Schrecken, die ich in der Arena gesehen habe, hat er die Grenze seines Gebiets erreicht. Entweder das - oder die Spielmacher haben beschlossen, uns jetzt noch nicht zu töten.
»Es hat aufgehört«, will ich sagen, doch aus meinem geschwollenen Mund kommt nur ein fürchterliches Krächzen. »Es hat aufgehört«, sage ich wieder, offenbar deutlicher, denn Peeta und Finnick schauen beide zum Nebel, der sich jetzt langsam hebt, als würde er von einem riesigen Staubsauger in den Himmel gesaugt. Wir schauen zu, bis alles weg ist, selbst der letzte Fetzen.
Peeta lässt sich von Finnick herunterrollen und der dreht sich auf den Rücken. Keuchend und zuckend liegen wir da, Geist und Körper vom Gift durchdrungen. Nach ein paar Minuten zeigt Peeta undeutlich nach oben. »A-hen.« Ich schaue nach oben und sehe zwei Tiere, vermutlich Affen. Ich habe noch nie einen lebendigen Affen gesehen - in unserem Wald zu Hause gibt es nichts dergleichen. Aber irgendwo muss ich schon mal einen Affen auf einem Bild gesehen haben oder vielleicht in einer früheren Ausgabe der Spiele, denn beim Anblick der Tiere kommt mir dasselbe Wort in den Sinn. Es ist schwer zu erkennen, aber ich glaube, diese hier haben orangefarbenes Fell und sind etwa halb so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Ich nehme die Affen als gutes Zeichen. Bestimmt würden sie hier nicht herumspringen, wenn die Luft vergiftet wäre. Eine Weile beobachten wir einander stumm, Menschen und Affen. Dann rappelt Peeta sich auf die Knie und kriecht den Hügel hinunter. Wir kriechen alle, denn Gehen ist für uns so unmöglich wie Fliegen; wir kriechen, bis das Gestrüpp zu einem schmalen Streifen Sandstrand wird und das warme Wasser rings um das Füllhorn uns das Gesicht benetzt. Ich zucke zurück, als hätte ich eine offene Flamme berührt.
Salz in die Wunde streuen. Zum ersten Mal verstehe ich diese Redewendung voll und ganz, denn das Salzwasser in den Wunden tut so weh, dass ich fast ohnmächtig werde. Aber ich spüre noch etwas anderes - als würde etwas herausgezogen. Ich probiere es aus, indem ich erst nur eine Hand behutsam ins Wasser halte. Es ist qualvoll, ja, aber dann schon weniger. Durch die blaue Wasserschicht sehe ich, wie eine milchige Substanz aus den Wunden tritt. Und in dem Maß, in dem das Weiß schwächer wird, lässt auch der Schmerz nach. Ich schnalle den Gurt ab und ziehe den Overall aus, der kaum mehr ist als ein durchlöcherter Stofffetzen. Meine Schuhe und die Unterwäsche sind erstaunlicherweise unversehrt. Nach und nach, Stück für Stück und einen Körperteil nach dem anderen, wasche ich das Gift aus meinem Körper. Peeta scheint das Gleiche zu tun. Finnick dagegen ist bei der ersten Berührung mit dem Wasser zurück gezuckt und liegt jetzt mit dem Gesicht nach unten im Sand, unwillig oder unfähig, sich zu säubern.
Als ich das Schlimmste überstanden habe, die Augen unter Wasser geöffnet, Wasser in die Nebenhöhlen gezogen und ausgeschnäuzt und sogar mehrmals gegurgelt habe, um meine Kehle auszuwaschen, funktioniere ich so weit, dass ich Finnick helfen kann. Im Bein habe ich jetzt wieder ein bisschen Gefühl, aber meine Arme werden immer noch von Zuckungen geplagt. Ich kann Finnick nicht ins Wasser ziehen, vielleicht würde der Schmerz ihn sowieso umbringen. Also schöpfe ich mit zittrigen Händen Wasser und schütte es auf seine Fäuste. Da er nicht unter Wasser ist, tritt das Gift aus seiner Haut, wie es auch hineingekommen ist, in Nebelschwaden, vor denen ich mich sehr in Acht nehme. Peeta hat sich jetzt so weit erholt, dass er mir helfen kann. Er schneidet Finnick aus dem Overall heraus. Irgendwo findet er zwei Muscheln, mit denen man viel besser Wasser schöpfen kann als mit den Händen. Als Erstes nehmen wir uns Finnicks Arme vor, weil sie so schwer mitgenommen sind, und obwohl eine Menge weißes Zeug herauskommt, merkt er nichts. Er liegt einfach nur mit geschlossenen Augen da und stöhnt hin und wieder.
Ich schaue mich um, und mir wird zunehmend bewusst, in welch gefährlicher Lage wir uns befinden. Es ist zwar Nacht, doch der Mond spendet so viel Licht, dass wir leicht entdeckt werden können. Es ist reines Glück, dass uns noch niemand angegriffen hat. Wenn sie vom Füllhorn kämen, könnten wir sie zwar kommen sehen, aber alle vier Karrieros auf einmal würden uns leicht überwältigen. Und selbst wenn sie uns nicht direkt sehen, Finnicks Stöhnen würde uns bald verraten.
»Wir müssen ihn weiter ins Wasser ziehen«, flüstere ich. Doch wir können ihn nicht mit dem Gesicht zuerst eintauchen, nicht solange er in diesem Zustand ist. Peeta macht eine Kopfbewegung zu Finnicks Füßen. Wir fassen jeder einen, drehen Finnick ganz herum und ziehen ihn langsam ins Salzwasser. Immer nur ein paar Zentimeter. Bis zu den Knöcheln. Ein paar Minuten warten. Dann bis zur Wade. Warten. Bis zu den Knien. Weiße Wolken wirbeln um seinen Körper, Finnick stöhnt. Wir entgiften ihn immer weiter, Stückchen für Stückchen. Ich merke, dass es mir umso besser geht, je länger ich im Wasser sitze. Nicht nur meine Haut, auch mein Gehirn erholt sich, und ich habe meine Muskeln wieder in der Gewalt. Ich sehe, wie Peetas Gesicht langsam wieder normal wird, sein Lid zieht sich hoch, der Mund ist nicht mehr so verzerrt.
Allmählich kommt wieder Leben in Finnick. Er öffnet die Augen, schaut uns an und begreift, dass wir ihm helfen. Ich lege seinen Kopf in meinen Schoß und wir lassen ihn zehn Minuten im Wasser, er ist vom Hals an abwärts ganz eingetaucht. Als er die Arme übers Wasser hebt, lächeln Peeta und ich uns an.
»Jetzt nur noch der Kopf, Finnick. Das ist das Schlimmste, aber wenn du das aushältst, wird es dir anschließend viel besser gehen«, sagt Peeta. Wir helfen Finnick auf, und er hält sich an unseren Händen fest, während er Augen, Nase und Mund reinigt. Seine Kehle ist immer noch so rau, dass er nicht sprechen kann.
»Ich versuche mal einen Baum anzuzapfen«, sage ich. Ich fummele an meinem Gurt herum und finde den Zapfhahn, der immer noch an der Ranke hängt.
»Warte, ich bohre erst ein Loch«, sagt Peeta. »Du bleibst bei ihm. Du bist die Heilerin.«
Haha, denke ich. Aber ich sage es nicht laut, denn Finnick hat so schon genug Probleme. Er hat am meisten von dem Nebel abbekommen, warum auch immer. Vielleicht, weil er der Größte von uns ist, oder vielleicht, weil er sich am meisten anstrengen musste. Und dann natürlich die Sache mit Mags. Ich verstehe immer noch nicht, was das sollte. Weshalb er sie praktisch im Stich gelassen hat, um Peeta zu tragen. Und weshalb sie das nicht nur nicht infrage gestellt hat, sondern, ohne zu zögern, geradewegs in den Tod gelaufen ist. Vielleicht weil ihre Tage ohnehin gezählt waren? Dachte sie, Finnick hätte mit Peeta und mir als Verbündeten bessere Chancen zu gewinnen? Ein Blick in Finnicks verzerrtes Gesicht sagt mir, dass jetzt nicht der richtige Moment ist zu fragen.
Also versuche ich lieber, mich zu sortieren. Ich rette die Spotttölpelbrosche von meinem zerfetzten Overall und befestige sie am Träger meines Unterhemds. Der Schwimmgurt scheint säureresistent zu sein, er sieht aus wie neu. Ich kann schwimmen, brauche den Gurt also eigentlich nicht, aber da Brutus meinen Pfeil mit seinem Gurt abgewehrt hat, denke ich mir, dass er vielleicht etwas Schutz bieten kann, und lege ihn wieder an. Ich löse den Zopf und kämme die Haare mit den Fingern, wodurch ich sie ziemlich ausdünne, die Nebeltröpfchen haben einigen Schaden angerichtet. Dann flechte ich die verbliebenen Haare wieder zu einem Zopf.
Etwa zehn Meter von dem schmalen Strand entfernt hat Peeta einen guten Baum entdeckt. Peeta ist kaum zu sehen, aber das Geräusch seines Messers am Baumstamm ist kristallklar. Ich frage mich, was mit der Ahle passiert ist. Mags muss sie entweder fallen gelassen oder mit sich in den Nebel genommen haben. So oder so ist sie weg.
Ich bin jetzt ein bisschen weiter im seichten Wasser und lasse mich abwechselnd auf dem Bauch und auf dem Rücken treiben. Peeta und mich hat das Salzwasser geheilt, aber Finnick scheint es regelrecht zu verwandeln. Langsam fängt er an, sich zu bewegen, probiert zunächst seine Glieder aus und schwimmt dann los. Aber nicht so, wie ich schwimme, gleichmäßig, mit rhythmischen Zügen. Es ist, als würde ein seltsames Meereswesen zum Leben erwachen. Er taucht unter und wieder auf, spuckt Wasser, kullert in einer verrückten Korkenzieherbewegung herum, von der mir schon beim Zuschauen schwindelig wird. Und dann, als er so lange unter Wasser bleibt, dass ich schon denke, er ist ertrunken, taucht sein Kopf direkt neben mir wieder auf, und ich zucke zusammen.
»Lass das«, sage ich.
»Was? Hochkommen oder unter Wasser bleiben?«, sagt er.
»Beides. Keines von beidem. Egal. Bleib einfach im Wasser und benimm dich«, sage ich. »Wenn es dir so gut geht, lass uns lieber Peeta helfen.«
Während wir die paar Schritte zum Rand des Dschungels gehen, merke ich, dass etwas anders ist. Vielleicht liegt es an der jahrelangen Jagderfahrung, vielleicht funktioniert mein repariertes Ohr wirklich besser, als es sollte. Jedenfalls nehme ich die vielen warmen Körper wahr, die über uns lauern. Sie brauchen nicht zu schnattern oder zu schreien. Ihr bloßes Atmen genügt.
Ich berühre Finnick am Arm und er folgt meinem Blick nach oben. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, sich so leise anzuschleichen. Vielleicht waren sie auch gar nicht leise. Wir waren nur damit beschäftigt, uns wiederherzustellen. Währenddessen haben sie sich versammelt. Nicht fünf oder zehn - es sitzen so viele Affen in den Dschungelbäumen, dass sich die Äste biegen. Die beiden, die wir gesehen haben, als wir vor dem Nebel geflohen sind, waren wohl nur das Empfangskomitee. Von dieser Menge geht etwas Unheilvolles aus.
Ich hole zwei Pfeile heraus und Finnick hält den Dreizack bereit. »Peeta«, sage ich, so ruhig ich kann. »Ich brauche mal deine Hilfe.«
»Okay, einen Moment. Ich glaube, ich hab’s gleich«, sagt er. Er macht sich immer noch an dem Baum zu schaffen. »Na also. Hast du mal den Zapfhahn?«
»Ja. Aber wir haben hier etwas entdeckt, das du dir besser mal ansehen solltest«, sage ich beherrscht. »Aber komm ganz ruhig her, damit du es nicht aufschreckst.« Aus irgendeinem Grund will ich nicht, dass er die Affen bemerkt oder auch nur in ihre Richtung schaut. Es gibt Lebewesen, die schon bloßen Blickkontakt als Herausforderung verstehen.
Peeta dreht sich zu uns, er ist außer Atem von der Arbeit an dem Baum. An dem merkwürdigen Ton, in dem ich gesprochen habe, merkt er, dass irgendetwas nicht stimmt. »Na gut«, sagt er lässig. Er geht durch den Dschungel, und ich weiß, dass er sich alle Mühe gibt, leise zu sein, doch das war noch nie seine Stärke, selbst als er noch zwei gesunde Beine hatte. Aber immerhin kommt er, und die Affen bleiben, wo sie sind. Er ist nur noch fünf Meter vom Strand entfernt, als er sie bemerkt. Ganz kurz nur schnellt sein Blick nach oben, doch es ist, als hätte er eine Bombe gezündet. Die Affen werden zu einer kreischenden Masse aus orangefarbenem Fell und stürmen auf ihn los.
Noch nie habe ich Tiere gesehen, die sich so schnell bewegt haben. Sie gleiten an den Lianen herab, als wären die Dinger geschmiert. Springen über unglaubliche Entfernungen von Baum zu Baum. Die Zähne gebleckt, die Nackenhaare gesträubt, die Klauen ausgefahren wie Springmesser. Ich kenne mich zwar nicht mit Affen aus, aber so verhalten sich Tiere in der Natur nicht. »Mutationen!«, stoße ich hervor, als Finnick und ich uns ins Gestrüpp stürzen.
Ich weiß, dass jeder Pfeil treffen muss, und das gelingt auch. Einen Affen nach dem anderen bringe ich in dem gespenstischen Licht zur Strecke, ziele auf Augen, Herz, Kehle, sodass jeder Treffer den Tod bedeutet. Doch selbst das würde nicht ausreichen, wären da nicht Finnick, der die Viecher wie Fische aufspießt und zur Seite schleudert, und Peeta, der mit dem Messer um sich stößt. Ich spüre, wie sich Klauen in mein Bein und meinen Rücken bohren, bis jemand den Angreifer erledigt. Die Luft wird schwer von den zertrampelten Pflanzen, dem Geruch von Blut und dem muffigen Geruch der Affen. Rücken an Rücken stellen Peeta, Finnick und ich uns ein paar Meter voneinander entfernt in einem Dreieck auf. Als ich den letzten Pfeil losschnellen lasse, rutscht mir das Herz in die Hose. Da fällt mir ein, dass auch Peeta einen Köcher hat. Und er schießt nicht, er stößt mit dem Messer zu. Jetzt ziehe auch ich das Messer, doch die Affen sind schneller, sie springen so schnell hin und her, dass ich kaum reagieren kann.
»Peeta!«, rufe ich. »Deine Pfeile!«
Peeta dreht sich um, sieht meine missliche Lage und will seincn Köcher abnehmen, als es passiert. Ein Affe stürzt sich aus einem Baum und wird Peeta im nächsten Moment auf die Brust springen. Ich habe keinen Pfeil, keine Möglichkeit zu schießen. Ich höre den dumpfen Schlag von Finnicks Dreizack und weiß, dass er anderswo im Einsatz ist. Peeta kann mit der Hand, in der er das Messer hält, nichts machen, weil er versucht, den Köcher abzunehmen. Ich ziele mit meinem Messer auf den heranrasenden Affen, doch er weicht mit einem Purzelbaum aus und prescht weiter vor.
Hilflos, ohne Waffe, tue ich das Einzige, was mir einfällt. Ich laufe zu Peeta, um ihn umzuwerfen und seinen Körper mit meinem zu schützen, obwohl ich weiß, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen werde.
Aber sie schafft es. Wie aus dem Nichts taucht sie auf und wirbelt plötzlich vor Peeta herum. Blutüberströmt, den Mund zu einem schrillen Schrei geöffnet, die Pupillen so groß, dass ihre Augen aussehen wie schwarze Löcher.
Die verrückte Morfixerin aus Distrikt 6 reißt die knochigen Arme hoch, als wollte sie den Affen umarmen, und der Affe schlägt die Zähne in ihre Brust.
22
Peeta lässt den Köcher fallen und stößt dem Affen das Messer in den Rücken. Immer und immer wieder sticht er auf ihn ein, bis das Tier den Biss lockert. Mit einem Tritt befördert er die Mutation beiseite und steht da in Erwartung weiterer. Ich habe jetzt Peetas Pfeile und einen gespannten Bogen, Finnick steht hinter mir, er keucht, aber er kämpft nicht mehr.
»Los, kommt schon! Kommt schon!«, brüllt Peeta wütend. Doch irgendetwas ist passiert. Die Affen ziehen sich zurück, wieder rauf auf die Bäume, zurück in den Dschungel, wie von einer unhörbaren Stimme gerufen. Der Stimme eines Spielmachers, die sagt, dass es genug ist.
»Trag du sie«, sage ich zu Peeta. »Wir geben dir Deckung.« Behutsam hebt Peeta die Morfixerin hoch und trägt sie die letzten Meter zum Strand. Finnick und ich lauern schussbereit, doch bis auf die orangefarbenen Kadaver auf dem Boden sind die Affen verschwunden. Peeta legt die Morfixerin auf dem Sand ab. Ich schneide den Stoff über ihrer Brust auf und lege vier tiefe Bisswunden frei. Das Blut sickert so langsam heraus, dass sie gar nicht so gefährlich aussehen. Doch die eigentlichen Verletzungen liegen innen. Die Öffnungen sind an Stellen, wo sich lebenswichtige Organe befinden, möglicherweise hat das Biest einen Lungenflügel zerfetzt, vielleicht sogar das Herz.
Wie ein Fisch auf dem Trockenen liegt die Morfixerin auf dem Sand und schnappt nach Luft. Ihre Haut ist schlaff und blassgrün, die Rippen stehen hervor wie bei einem hungernden Kind. Bestimmt hätte sie sich Lebensmittel leisten können, aber anscheinend hat sie sich dem Morfix verschrieben, wie Haymitch sich dem Trinken. Alles an ihr verrät, dass es zu Ende geht - ihr Körper, der leere Blick. Ich halte ihre zuckende Hand und weiß nicht, ob die Bewegung von dem Nervengift herrührt, vom Schock des Angriffs oder vom Entzug jener Droge, die ihr Nahrung war. Wir können nichts tun. Nur bei ihr bleiben, während sie stirbt.
»Ich sehe mich mal bei den Bäumen um«, sagt Finnick und entfernt sich. Ich möchte auch weg von hier, doch sie hält meine Hand so fest, dass ich mich gewaltsam befreien müsste, und für so eine Grausamkeit habe ich nicht die Kraft. Ich überlege, ob ich ihr wie Rue ein Lied singen soll. Doch ich kenne nicht mal den Namen der Morfixerin, und ob sie gern Lieder hört, weiß ich schon gar nicht. Ich weiß nur, dass sie stirbt.
Peeta geht auf der anderen Seite in die Hocke und streicht ihr übers Haar. Als er mit sanfter Stimme zu sprechen beginnt, verstehe ich erst nicht, was das soll, aber die Worte sind auch gar nicht für mich. »Mit meinem Malkasten zu Hause kann ich jede erdenkliche Farbe mischen. Rosa. So blass wie Babyhaut. Oder so tiefdunkel wie Rhabarber. Grün wie Frühlingsgras. Blau, das schimmert wie Eis auf Wasser.«
Die Morfixerin starrt Peeta in die Augen und klammert sich an seine Worte.
»Einmal habe ich drei Tage lang nach dem richtigen Farbton für Sonnenlicht auf weißem Pelz gesucht. Weißt du, ich dachte die ganze Zeit, es müsse Gelb sein, aber es war viel mehr. Alle möglichen Farben. In Schichten, eine über der anderen«, sagt Peeta.
Die Morfixerin schnappt jetzt nur noch flach nach Luft. Mit der freien Hand zeichnet sie in dem Blut auf ihrer Brust die kleinen Wirbel, die sie so gern gemalt hat.
»Den Regenbogen habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Er kommt und geht so plötzlich. Ich habe nie genug Zeit, um ihn einzufangen. Nur ein bisschen Blau hier und Lila da. Und schon verblasst er wieder. Geht wieder in der Luft auf«, sagt Peeta.
Peetas Worte scheinen die Morfixerin zu hypnotisieren. Als wäre sie in Trance. Sie hebt die zitternde Hand und zeichnet auf Peetas Wange etwas, das ich als Blume deute.
»Danke«, flüstert er. »Sieht wunderschön aus.«
Einen Augenblick lang verzieht sich das Gesicht der Morfixerin zu einem Grinsen und sie gibt ein leises Quieken von sich. Dann sinkt ihre blutbefleckte Hand zurück auf die Brust, sie atmet ein letztes Schnaufen aus, und die Kanone wird abgefeuert. Der Griff um meine Hand lockert sich.
Peeta trägt sie ins Wasser. Dann kommt er zurück und setzt sich neben mich. Die Morfixerin treibt eine Zeit lang auf das Füllhorn zu, bis das Hovercraft erscheint und ein Greifer mit vier Klauen sich herabsenkt, sie packt und in den Nachthimmel hinaufträgt. Dann ist sie fort.
Finnick gesellt sich wieder zu uns. In der Hand hat er meine Pfeile, an denen noch das Affenblut klebt. Er wirft sie neben mich in den Sand. »Dachte, die hättest du vielleicht gern wieder.«
»Danke«, sage ich. Ich wate ins Wasser und wasche das Blut ab, von meinen Waffen, meinen Wunden. Als ich in den Dschungel gehe, um ein bisschen Moos zum Abtrocknen zu sammeln, sind die Affenkörper allesamt verschwunden. »Wo sind sie hin?«, frage ich.
»Ich weiß nicht. Die Ranken haben sich beiseitegeschoben und weg waren sie«, sagt Finnick.
Benommen und erschöpft starren wir in den Dschungel. In der Stille fällt mir auf, dass sich über den Stellen, an denen die Nebeltropfen meine Haut berührt haben, eine Kruste gebildet hat. Die Stellen tun nicht mehr weh, sie jucken jetzt. Und zwar sehr. Ich versuche, das als gutes Zeichen zu nehmen. Dass sie heilen. Ich schaue zu Peeta und Finnick und sehe, dass beide sich im lädierten Gesicht kratzen. Sogar Finnicks Schönheit hat in dieser Nacht Schaden genommen.
»Nicht kratzen«, sage ich, dabei würde ich es am liebsten selbst tun. Meine Mutter würde das Gleiche raten. »Dadurch entzündet es sich nur. Meint ihr, wir können es wagen, noch mal Wasser zu zapfen?«
Wir gehen zurück zu dem Baum, an dem Peeta sich zu schaffen gemacht hatte, bevor die Affen angriffen. Während er den Zapfhahn einschlägt, stehen Finnick und ich mit gezückten Waffen da, aber es taucht nichts Bedrohliches auf. Peeta hat eine gute Ader gefunden und das Wasser fließt heraus. Wir stillen unseren Durst, lassen das warme Wasser über unsere juckenden Körper laufen. Wir füllen Muschelschalen mit Wasser und gehen zurück zum Strand.
Es ist immer noch Nacht, obwohl die Dämmerung nicht mehr weit sein kann. Es sei denn, die Spielmacher haben andere Pläne. »Ruht euch ein bisschen aus«, sage ich zu den beiden. »Ich halte so lange Wache.«
»Nein, das übernehme ich«, sagt Finnick. Ich schaue in seine Augen, sein Gesicht und sehe, dass er nur mühsam die Tränen zurückhalten kann. Mags. Wenigstens das kann ich für ihn tun - ihm ein bisschen Raum geben, um sie zu betrauern.
»Na gut, Finnick, danke«, sage ich. Ich lege mich in den Sand neben Peeta, der sofort wegdämmert. Während ich in die Nacht starre, kommt mir der Gedanke, was sich an einem Tag doch alles verändern kann. Gestern Morgen stand Finnick noch auf meiner Abschussliste und heute lasse ich ihn bereitwillig über meinen Schlaf wachen. Er hat Peeta gerettet und Mags sterben lassen, und ich weiß nicht, warum. Nur, dass ich es nie wiedergutmachen kann. In diesem Moment kann ich nur schlafen und ihn in Ruhe trauern lassen. Also mache ich das.
Als ich die Augen wieder öffne, ist es Vormittag. Peeta liegt neben mir und schläft. An den Zweigen über uns hat jemand eine Grasmatte befestigt, die unsere Gesichter vor dem Sonnenlicht schützt. Ich setze mich auf und stelle fest, dass Finnick auch sonst nicht untätig gewesen ist. In zwei geflochtenen Schalen schwappt frisches Wasser. Eine dritte enthält einen Haufen Muscheln.
Finnick setzt sich in den Sand und bricht die Schalen mit einem Stein auf. »Frisch schmecken sie am besten«, sagt er, während er ein Stück Fleisch aus einer Muschel reißt und sich in den Mund steckt. Seine Augen sind geschwollen, aber ich tue so, als würde ich es nicht bemerken.
Bei dem Geruch von Essen fängt mein Magen an zu knurren und ich will mir eine Muschel nehmen. Als ich meine blutverkrusteten Fingernägel sehe, halte ich inne. Ich muss mir im Schlaf die Haut aufgekratzt haben.
»Wenn du kratzt, entzündet es sich, das weißt du doch«, sagt Finnick.
»Ach nee«, sage ich. Ich gehe ins Salzwasser und wasche das Blut ab, während ich überlege, was ich schlimmer finde, den Schmerz oder das Jucken. Restlos bedient stapfe ich auf den Strand, schaue nach oben und blaffe: »He, Haymitch, falls du nicht zu betrunken bist, wir könnten was für unsere Haut brauchen.«
Es ist fast schon ulkig, wie schnell der Fallschirm heruntergesegelt kommt. Ich strecke den Arm aus und die Tube landet direkt in meiner geöffneten Hand. »Wurde aber auch Zeit«, sage ich, schaffe es jedoch nicht, weiter böse zu gucken. Haymitch. Was gäbe ich darum, nur fünf Minuten mit ihm reden zu können.
Ich lasse mich neben Finnick in den Sand fallen und schraube den Deckel von der Tube. Darin ist eine dickflüssige schwarze Salbe, die einen beißenden Geruch verströmt, eine Mischung aus Teer und Kiefernnadeln. Ich rümpfe die Nase, während ich einen Klecks Salbe auf die Handfläche drücke und damit mein Bein einreibe. Im Nu lässt der Juckreiz nach und ein wohliges Seufzen entfährt mir. Das Zeug färbt meine schorfige Haut scheußlich graugrün. Ich nehme mir das zweite Bein vor und werfe die Tube dann Finnick zu. Er schaut mich skeptisch an.
»Das sieht ja aus, als würdest du verwesen«, sagt er. Aber offenbar gewinnt das Jucken die Oberhand, denn kurz darauf reibt auch Finnick seine Haut ein. Die Kombination aus Schorf und Salbe sieht wirklich ekelhaft aus. Ich kann der Versuchung, mich über seine Verzweiflung lustig zu machen, nicht widerstehen.
»Armer Finnick. Ist wohl das erste Mal in deinem Leben, dass du nicht hübsch aussiehst, hm?«, sage ich.
»Allerdings. Ein völlig neues Gefühl. Wie hast du das all die Jahre ausgehalten?«, fragt er.
»Einfach alle Spiegel meiden. Dann vergisst man’s«, erwidere ich.
»Nicht, wenn man dich dauernd vor Augen hat«, sagt er.
Wir beschmieren uns tüchtig, reiben uns sogar gegenseitig den Rücken ein, wo die Unterhemden die Haut nicht geschützt haben. »Ich wecke jetzt Peeta«, sage ich.
»Nein, warte«, sagt Finnick. »Wir wecken ihn gemeinsam. Damit er unsere beiden Gesichter sieht.«
In meinem jetzigen Leben gibt es so wenig Raum für Spaß, dass ich zustimme. Wir hocken uns rechts und links von Peeta hin, beugen uns vor, bis unsere Gesichter nur wenige Zentimeter vor seiner Nase sind, und rütteln ihn wach. »Peeta, Peeta, aufwachen«, säusele ich.
Seine Lider zucken, und als er die Augen öffnet, springt er auf wie von der Tarantel gestochen. »Aaaa!«
Finnick und ich lassen uns nach hinten in den Sand fallen und lachen uns kaputt. Immer, wenn wir aufhören wollen, schauen wir zu Peeta, der sich bemüht, eine verächtliche Miene zu wahren, und prusten wieder los. Als wir uns endlich zusammenreißen, kommt mir der Gedanke, dass Finnick Odair vielleicht doch ganz in Ordnung ist. Oder zumindest nicht so ein eitler Wichtigtuer, wie ich immer dachte. Wirklich gar nicht übel. Und just in dem Augenblick, als ich zu diesem Schluss komme, landet ein Fallschirm mit einem Laib Brot neben uns. Vom letzten Jahr weiß ich noch, dass Haymitch den Zeitpunkt für seine Geschenke häufig so wählt, dass er damit eine Botschaft übermittelt, deshalb präge ich mir ein: Freundet euch mit Finnick an. Dann bekommt ihr Essen.
Finnick dreht das frische Brot in seinen Händen hin und her und betrachtet die Kruste. Ein bisschen sehr besitzergreifend. Dabei wäre das gar nicht nötig. Das Brot hat die typische grüne Farbe von Seetang, wie alles Brot aus Distrikt 4. Jeder weiß, dass es ihm gehört. Vielleicht ist ihm eben erst klar geworden, wie wertvoll es ist und dass er jetzt möglicherweise zum letzten Mal einen solchen Laib zu Gesicht bekommt. Vielleicht ist mit der Kruste auch irgendeine Erinnerung an Mags verbunden. Doch er sagt nur: »Das schmeckt bestimmt gut zu den Muscheln.«
Während ich Peeta helfe, seine Haut mit der Salbe einzureiben, löst Finnick geschickt das Fleisch aus den Muscheln. Wir setzen uns zusammen hin und essen das köstliche süße Fleisch mit dem salzigen Brot aus Distrikt 4.
Wir sehen zwar fürchterlich aus - die Salbe bewirkt, dass sich an einigen Stellen der Schorf löst -, aber ich freue mich über die Arznei. Nicht nur, weil sie den Juckreiz lindert, sondern auch, weil sie vor der sengenden weißen Sonne am rosa Himmel schützt. An ihrem Stand lese ich ab, dass es fast zehn Uhr sein muss, wir sind also schon einen ganzen Tag in der Arena. Elf von uns sind tot. Dreizehn leben. Zehn von ihnen verstecken sich irgendwo im Dschungel. Drei bis vier sind Karrieros. Ich hab keine Lust, mir die anderen ins Gedächtnis zu rufen.
Der Dschungel hat sich für mich schnell von einem schützenden Ort in eine teuflische Falle verwandelt. Mir ist klar, dass wir irgendwann gezwungen sein werden, erneut in seine Tiefen einzutauchen, um zu jagen oder gejagt zu werden, doch fürs Erste habe ich nicht vor, unseren kleinen Strand zu verlassen. Peeta und Finnick scheinen das genauso zu sehen. Eine Weile wirkt der Dschungel fast statisch, summend und schillernd, keine Spur von den Gefahren, die er birgt. Doch plötzlich hören wir von fern Schreie und gegenüber beginnt ein Stück Dschungel zu vibrieren. Eine riesige Welle türmt sich bis über den Hügel auf, schwappt über die Bäume hinweg und rast tosend den Abhang hinunter. Sie trifft mit solcher Wucht auf das Meerwasser, dass die Gischt trotz der Entfernung um unsere Knie aufschäumt und unsere wenigen Habseligkeiten mit sich zu reißen droht. Mit vereinten Kräften gelingt es uns, die Sachen einzusammeln, ehe sie weggeschwemmt werden. Nur unsere durchlöcherten Overalls lassen wir davonschwimmen, sie sind von dem Nervengift so zerfressen, dass wir nicht an ihnen hängen.
Eine Kanone knallt. Über dem Gebiet, wo die Welle ihren Ausgang nahm, taucht ein Hovercraft auf und pflückt einen Körper von den Bäumen. Zwölf, denke ich.
Der Ring aus Wasser hat die Riesenwelle geschluckt und kommt allmählich zur Ruhe. Wir deponieren unsere Sachen wieder auf dem nassen Sand. Als wir uns schon darauf niederlassen wollen, sehe ich sie. Drei Gestalten, die zwei Radspeichen entfernt auf den Strand taumeln. »Da«, sage ich ganz ruhig und nicke in ihre Richtung. Peeta und Finnick folgen meinem Blick. Wie auf Kommando ziehen wir uns ins Dunkel des Dschungels zurück.
Das Trio ist reichlich mitgenommen, das sieht man sofort. Einer schleift einen anderen mit sich und der Dritte torkelt wie geistesgestört in irren Kreisen umher. Ihre Haut ist knallrot, als hätte jemand sie in Farbe getaucht und zum Trocknen rausgehängt.
»Wer ist das?«, fragt Peeta. »Oder was? Mutationen?«
Ich lege einen Pfeil ein und mache mich angriffsbereit. Aber nichts geschieht, außer dass der eine, der mitgeschleppt wurde, plötzlich am Strand zusammenbricht. Sein Helfer stampft frustriert mit dem Fuß auf. Er fährt herum, schubst den Verwirrten, der im Kreis gelaufen ist, vor sich her, lässt seine Wut an ihm aus.
Finnicks Miene hellt sich auf: »Johanna!«, ruft er und rennt auf die roten Gestalten zu.
»Finnick!«, antwortet Johanna.
Ich tausche einen Blick mit Peeta. »Was nun?«, frage ich.
»Wir können Finnick nicht ziehen lassen«, sagt er.
»Wahrscheinlich nicht. Na, dann komm«, sage ich missmutig. Selbst wenn ich eine Liste mit möglichen Verbündeten hätte, Johanna Mason stünde bestimmt nicht darauf. Wir stapfen den Strand entlang dorthin, wo Finnick und Johanna sich gerade treffen. Als wir näher kommen, erkenne ich ihre Gefährten und bin verwirrt. Es sind Beetee und Wiress, der eine liegt rücklings auf dem Boden, die andere hat sich aufgerappelt und geht wieder im Kreis. »Sie hat Wiress und Beetee dabei.«
»Plus und Minus?«, fragt Peeta, gleichfalls erstaunt. »Wie mag es dazu gekommen sein?«
Als wir die anderen erreichen, deutet Johanna zum Dschungel und redet auf Finnick ein. »Wir dachten, es wäre Regen, weißt du, wegen der Blitze, und wir hatten alle solchen Durst. Aber als es herunterprasselte, merkten wir, dass es Blut war.
Dickes, heißes Blut. Man konnte nichts sehen, und man konnte nichts sagen, weil man es sonst schluckte. Wir sind herumgeirrt und haben einen Ausweg gesucht. Und dabei ist Blight in das Kraftfeld geraten.«
»Das tut mir leid, Johanna«, sagt Finnick. Es dauert einen Augenblick, bis ich Blight eingeordnet habe. Ich glaube, er war Johannas Mitspieler aus Distrikt 7, aber ich kann mich kaum an ihn erinnern. Wenn ich mich nicht irre, hat er sich nicht einmal beim Training blicken lassen.
»Ach, weißt du, er war keine große Hilfe, aber er war aus der Heimat«, sagt Johanna. »Und er hat mich mit den beiden da alleingelassen.« Mit dem Schuh stupst sie Beetee an, der kaum bei Bewusstsein ist. »Er hat am Füllhorn ein Messer in den Rücken gekriegt. Und die da …«
Wir schauen hinüber zu Wiress, die, mit getrocknetem Blut bedeckt, im Kreis herumirrt und die ganze Zeit »Tick, tack. Tick, tack« vor sich hin murmelt.
»Ja, wir haben’s gehört. Tick, tack. Plus hat einen Schock«, sagt Johanna. Das scheint Wiress anzulocken, sie torkelt gegen Johanna, die sie grob auf den Sand stößt. »Einfach unten bleiben, kapiert?«
»Lass sie in Ruhe!«, blaffe ich sie an.
Johannas Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen, durch die sie mich hasserfüllt anschaut. »Ich soll sie in Ruhe lassen?«, faucht sie. Ehe ich reagieren kann, macht sie einen Schritt nach vorn und langt mir eine, dass ich Sternchen sehe. »Was glaubst du eigentlich, wer sie für dich aus dem blutenden Dschungel rausgeholt hat, du …« Bevor sie weiterreden kann, schnappt Finnick sich Johanna, wirft sie trotz heftiger Gegenwehr über die Schulter und trägt sie ins Wasser. Dort taucht er sie mehrmals unter, während sie mir üble Beleidigungen an den Kopf schmeißt. Doch ich schieße nicht. Weil Finnick bei ihr ist und weil sie gesagt hat, dass sie Wiress und Beetee für mich rausgeholt hat.
»Was sollte das heißen, sie hat sie für mich da rausgeholt?«, frage ich Peeta.
»Ich weiß es nicht. Du wolltest die beiden doch als Verbündete«, sagt er.
»Stimmt. Wollte ich mal.« Aber das ist keine Erklärung. Ich schaue auf Beetees leblosen Körper. »Jedenfalls, lange werden sie nicht meine Verbündeten sein, wenn wir nicht bald was unternehmen.«
Peeta hebt Beetee hoch, ich nehme Wiress bei der Hand und wir gehen zurück zu unserem kleinen Strandlager. Ich setze Wiress ins flache Wasser, damit sie sich ein bisschen säubern kann, doch sie klatscht nur in die Hände und murmelt ab und zu »Tick, tack«. Ich löse Beetees Gürtel und entdecke, dass er mit Ranken einen schweren Metallgegenstand daran festgebunden hat. Ich kann nicht erkennen, was es ist, eine Art Spule vielleicht, doch wenn Beetee meinte, es retten zu müssen, dann werde ich es nicht einfach wegschmeißen. Ich binde die Spule los und werfe sie in den Sand. Die blutgetränkten Kleider kleben so an Beetees Körper, dass Peeta ihn ins Wasser tauchen muss, während ich sie löse. Als ich endlich den Overall ausgezogen bekomme, stellen wir fest, dass sich auch die Unterwäsche mit Blut vollgesogen hat. Wir haben keine Wahl, wir müssen ihn ganz ausziehen, aber ehrlich gesagt, lässt mich so etwas mittlerweile ziemlich kalt. Dieses Jahr haben zu viele nackte Männer auf unserem Küchentisch gelegen. Nach einer Weile gewöhnt man sich irgendwie dran.
Wir bauen Finnicks Sonnenschutz ab und legen Beetee bäuchlings darauf, damit wir seinen Rücken untersuchen können. Vom Schulterblatt bis unter die Rippen verläuft eine fünfzehn Zentimeter lange klaffende Wunde. Zum Glück ist sie nicht allzu tief. Aber er hat eine Menge Blut verloren - das erkennt man an der blassen Hautfarbe - und die Wunde eitert.
Ich hocke mich hin und versuche nachzudenken. Welche Hilfsmittel stehen mir zur Verfügung? Salzwasser? Die erste Maßnahme meiner Mutter war immer Schnee, wenn ich mich recht erinnere. Ich schaue hinüber zum Dschungel. Dort gäbe es bestimmt eine Menge Arzneien - wenn ich nur wüsste, wie man sie anwendet. Aber das sind nicht meine Pflanzen. Mir fällt das Moos ein, das Mags mir zum Naseputzen gegeben hat. »Bin gleich wieder da«, rufe ich Peeta zu. Zum Glück kommt das Zeug ziemlich häufig im Dschungel vor. Von den umstehenden Bäumen rupfe ich ein ordentliches Büschel ab und trage es zurück zum Strand. Ich forme ein dickes Polster, lege es auf Beetees Wunde und schnüre es mit Ranken an seinem Körper fest. Wir flößen ihm etwas Wasser ein und legen ihn dann in den Schatten am Rand des Dschungels.
»Ich fürchte, das ist alles, was wir für ihn tun können«, sage ich.
»Das reicht. Du bist gut im Verarzten«, sagt Peeta. »Es liegt dir im Blut.«
»Nein«, sage ich und schüttele den Kopf. »Ich habe das Blut meines Vaters.« Blut, das beim Jagen schneller fließt, nicht bei einer Epidemie. »Ich werde mal nach Wiress sehen.«
Ich gehe zu Wiress ins flache Wasser. Sie wehrt sich nicht, als ich sie ausziehe und mit einer Handvoll Moos das Blut abwasche. Doch ihre Augen sind schreckgeweitet, und als ich sie anspreche, antwortet sie nicht, sagt nur mit immer größerer Dringlichkeit »Tick, tack«. Offenbar versucht sie mir etwas damit zu sagen, aber ohne Beetee, der ihre Gedanken entschlüsselt, bin ich völlig aufgeschmissen.
»Ja, tick, tack. Tick, tack«, sage ich. Das scheint sie ein wenig zu beruhigen. Ich wasche ihren Overall aus, bis kaum noch etwas von dem Blut zu sehen ist, und helfe ihr, wieder hineinzuschlüpfen. Er ist nicht so beschädigt wie unsere. Ihr Gurt ist noch in Ordnung und ich binde ihn ihr um. Dann befestige ich ihre Unterwäsche mit einem Stein neben der von Beetee und lasse sie einweichen.
Unterdessen haben sich eine jetzt wieder blitzsaubere Johanna und ein sich schälender Finnick zu uns gesellt. Johanna trinkt hastig Wasser und schlingt Muschelfleisch herunter, und ich versuche, auch Wiress zu überreden, etwas zu essen. Finnick erzählt mit unbeteiligter, fast gefühlskalter Stimme von dem Nebel und den Affen, verschweigt aber das wichtigste Detail der Geschichte.
Alle bieten an, Wache zu halten, während die anderen sich ausruhen, doch schließlich fällt die Wahl auf Johanna und mich. Auf mich, weil ich tatsächlich ausgeruht bin, auf Johanna, weil sie sich um keinen Preis hinlegen will. Wir setzen uns ans Wasser und schweigen, bis die anderen eingeschlafen sind.
Johanna wirft Finnick einen Blick zu, um sicherzugehen, dass er wirklich schläft, und wendet sich dann an mich: »Wie habt ihr Mags verloren?«
»Im Nebel. Finnick hatte Peeta auf der Schulter, ich Mags. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Finnick meinte, beide auf einmal könne er nicht tragen. Da gab sie ihm einen Kuss und ging geradewegs ins Gift«, sage ich.
»Du weißt ja wohl, dass sie Finnicks Mentorin war«, sagt Johanna anklagend.
»Nein, das wusste ich nicht«, erwidere ich.
»Sie gehörte fast zur Familie«, sagt Johanna nach einer kurzen Pause, schon etwas versöhnlicher.
Wir schauen zu, wie das Wasser über die Wäsche schwappt. »Und wie kommt’s, dass du Plus und Minus bei dir hast?«, frage ich.
»Hab ich doch gesagt - ich habe sie für dich mitgeschleppt. Haymitch meinte, falls wir uns verbünden, müsste ich sie zu dir bringen«, sagt Johanna. »Das hast du ihm doch gesagt, oder?«
Nein, denke ich. Trotzdem nicke ich. »Danke. Ich weiß es zu schätzen.«
»Das will ich hoffen.« Sie wirft mir einen verächtlichen Blick zu, als wäre ich die größte Plage in ihrem Leben. So ähnlich muss es sich wohl anfühlen, wenn man eine große Schwester hat, die einen aus tiefstem Herzen hasst.
»Tick, tack«, höre ich hinter mir. Ich drehe mich um und sehe, dass Wiress zu uns herübergekrochen ist. Sie starrt auf den Dschungel.
»Ach du Schreck, da ist sie ja wieder. Okay, ich geh schlafen. Ihr könnt ja zusammen Wache halten, du und Plus«, sagt Johanna. Sie geht hinüber zu den anderen und wirft sich neben Finnick auf den Sand.
»Tick, tack«, flüstert Wiress. Ich ziehe sie zu mir herunter, damit sie sich hinlegt, und streichele ihren Arm, um sie zu beruhigen. Sie dämmert weg, bewegt sich dabei aber pausenlos und seufzt ab und zu »Tick, tack«.
»Tick, tack«, sage ich bestätigend. »Schlafenszeit. Tick, tack. Schön einschlafen.«
Die Sonne klettert weiter, bis sie direkt über uns steht. Es muss Mittag sein, denke ich abwesend. Nicht, dass es wichtig wäre. Jenseits des Wassers, zur Rechten, sehe ich es plötzlich gewaltig aufblitzen. Der Lichtblitz trifft den Baum und der elektrische Sturm bricht wieder los. Genau im gleichen Gebiet wie letzte Nacht. Jemand muss in seine Reichweite gekommen sein und die Attacke ausgelöst haben. Ich sitze eine Zeit lang da und beobachte den Blitz, während ich Wiress beruhige, die vom Plätschern des Wassers in einen Zustand des Friedens gewiegt wird. Ich denke an letzte Nacht, als der Blitz, unmittelbar nachdem die Glocke geschlagen hatte, einsetzte. Zwölf Schläge.
»Tick, tack«, sagt Wiress, als sie kurz zu Bewusstsein kommt. Dann versinkt sie wieder.
Zwölf Schläge letzte Nacht. Wie um Mitternacht. Dann die Blitze. Jetzt die Sonne über uns. Wie um zwölf Uhr mittags. Und Blitze.
Langsam stehe ich auf und suche die Arena ab. Dort der Blitz. Im nächsten Sektor kam der Blutregen, in dem Johanna, Wiress und Beetee gefangen waren. Wir müssen im dritten Abschnitt gewesen sein, gleich rechts davon, als der Nebel aufkam. Und als er endlich eingesogen wurde, tauchten im vierten gleich die Affen auf. Tick, tack. Ich drehe den Kopf schnell zur anderen Seite. Vor ein paar Stunden, gegen zehn, kam diese Welle aus dem zweiten Abschnitt, links von der Stelle, wo jetzt der Blitz einschlägt. Mittag. Mitternacht. Mittag.
»Tick, tack«, sagt Wiress im Schlaf. Als der Blitz erstirbt und gleich rechts davon der Blutregen einsetzt, erkenne ich die Logik in ihren Worten.
»Oh«, sage ich leise. »Tick, tack.« Ich lasse den Blick einmal im Kreis um die ganze Arena schweifen und sehe, dass sie recht hat: »Tick, tack. Das ist eine Uhr.«
23
Eine Uhr. Auf einmal sehe ich fast, wie die Zeiger über das zwölfgeteilte Antlitz der Arena laufen. Zu jeder neuen Stunde beginnt ein neuer Horror der Spielmacher und löst den vorangegangenen ab. Blitze, Blutregen, Nebel, Affen - das sind die vier ersten Stunden auf der Uhr. Und um zehn die Welle. Ich weiß nicht, was in den anderen sieben passiert, aber ich weiß, dass Wiress recht hat.
Gerade in diesem Augenblick fällt der Blutregen und wir befinden uns am Strand unterhalb des Affensegments, viel zu nah am Nebel für meinen Geschmack. Ob sich die Attacken nur innerhalb des Dschungels ereignen? Das ist nicht gesagt. Bei der Welle war es zum Beispiel nicht so. Und wenn dieser Nebel über den Dschungel hinauswabern würde oder die Affen herauskämen …
»Aufstehen«, befehle ich und rüttele Peeta, Finnick und Johanna wach. »Aufstehen, wir müssen los.« Ich kann ihnen gerade noch die Theorie mit der Uhr erläutern. Also was es mit Wiress’ Tick-tack auf sich hat und dass die unsichtbaren Zeiger in jedem Sektor eine neue tödliche Gewalt auslösen.
Alle, die bei Sinnen sind, kann ich überzeugen, bis auf Johanna, die aus Prinzip gegen alles ist, was ich vorschlage. Aber selbst sie ist der Meinung, dass man sich besser rechtzeitig in Sicherheit bringt, als es hinterher zu bereuen.
Während die anderen unsere wenigen Habseligkeiten einsammeln und Beetee wieder in seinen Overall stecken, wecke ich Wiress. Sie erwacht mit einem panischen »Tick, tack!«.
»Ja, tick, tack, die Arena ist eine Uhr. Eine Uhr, Wiress, du hattest recht«, sage ich. »Du hattest recht.«
In ihrem Gesicht zeichnet sich Erleichterung ab - wahrscheinlich, weil endlich jemand begriffen hat, was sie schon beim ersten Glockenschlag gewusst hat. »Mitternacht.«
»Um Mitternacht geht es los«, bestätige ich.
Eine Erinnerung dringt mit Macht in mein Bewusstsein. Ich sehe eine Uhr. Nein, eine Taschenuhr, sie liegt in Plutarch Heavensbees Hand. »Um Mitternacht geht es los«, hat Plutarch gesagt. Und dann leuchtete kurz mein Spotttölpel auf und verschwand wieder. Im Nachhinein wirkt das, als wollte er mir einen Tipp für die Arena geben. Aber warum hätte er das tun sollen? Damals war ich genauso wenig Tribut in diesen Spielen wie er. Vielleicht dachte er, das würde mir bei meiner Aufgabe als Mentor helfen. Oder der Plan stand damals schon fest.
Wiress nickt zu dem Blutregen hin. »Halb zwei«, sagt sie.
»Genau. Halb zwei. Und um zwei erhebt sich dort drüben ein schrecklicher Giftnebel«, sage ich und deute auf den benachbarten Dschungelabschnitt. »Wir müssen uns in Sicherheit bringen.« Sie lächelt und steht folgsam auf. »Hast du Durst?« Ich gebe ihr die geflochtene Schale und sie trinkt mindestens einen Liter. Finnick reicht ihr den letzten Rest Brot und sie beginnt daran zu nagen. Nachdem die Kommunikationsschwierigkeiten überwunden sind, funktioniert sie wieder.
Ich kontrolliere meine Waffen. Verschnüre Zapfhahn und Arzneitube in einem Fallschirm und befestige ihn mit Ranken an meinem Gürtel.
Beetee ist noch immer ziemlich neben der Spur, doch als Peeta Anstalten macht, ihn hochzuheben, protestiert er. »Sie muss auch mit«, sagt er.
»Hier ist sie doch«, sagt Peeta. »Wiress geht’s gut. Sie kommt auch mit.«
Aber Beetee wehrt sich immer noch. »Sie muss auch mit«, beharrt er.
»Ach, ich weiß, was er will«, sagt Johanna ungeduldig. Sie geht über den Strand und hebt die Rolle auf, die wir von seinem Gürtel gelöst haben, um ihn zu baden. Sie ist mit einer dicken Schicht aus geronnenem Blut überzogen. »Dieses wertlose Ding. Draht oder so was. Dafür hat er sich abstechen lassen. Am Füllhorn, da musste er das hier unbedingt holen. Keine Ahnung, was das für eine Waffe sein soll. Man könnte vielleicht eine Würgeschlinge oder so was draus machen. Aber mal ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, wie Beetee jemanden erdrosselt?«
»Mithilfe von Draht hat er seine Spiele gewonnen. Er hat den anderen eine Stromfalle gestellt«, sagt Peeta. »Eine bessere Waffe gibt’s gar nicht.«
Irgendwie ist es merkwürdig, dass Johanna nicht darauf gekommen ist. Es kommt mir unwahrscheinlich vor. Verdächtig. »Aber du musst doch so etwas in der Art gedacht haben«, sage ich. »Wo du ihn doch Minus genannt hast.«
Johannas Augen verengen sich zu Schlitzen, die mich gefährlich anfunkeln. »Ach, wie dumm von mir, was?«, sagt sie. »Ich war wohl abgelenkt, als ich deinen kleinen Freunden hier das Leben gerettet habe. Während du … was getan hast? Mags hast krepieren lassen?«
Meine Finger schließen sich um den Messergriff am Gürtel.
»Na, mach schon. Versuch’s doch. Es ist mir egal, ob du schwanger bist, ich reiß dir die Kehle raus«, sagt Johanna.
Ich weiß, dass ich sie hier und jetzt nicht töten kann. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann macht eine von uns die andere kalt.
»Vielleicht sollten wir alle besser aufpassen, wo wir hintreten«, sagt Finnick und blitzt mich an. Er nimmt die Drahtrolle und legt sie Beetee auf die Brust. »Da ist dein Draht, Minus. Pass gut auf, wo du ihn reinstöpselst.«
Peeta schultert Beetee, der jetzt keinen Widerstand mehr leistet. »Wohin?«
»Ich möchte noch mal zum Füllhorn und nachschauen. Um sicherzugehen, dass wir mit der Uhr richtigliegen«, sagt Finnick. Der Plan ist nicht schlechter als jeder andere. Abgesehen davon würde ich auch gern noch mal die Waffen dort begutachten. Und jetzt sind wir zu sechst. Selbst wenn man Beetee und Wiress außer Acht lässt, haben wir vier gute Kämpfer. Eine völlig andere Situation für mich als vor einem Jahr, damals war ich ganz auf mich allein gestellt. Ja, Verbündete sind toll. Solange man den Gedanken ausblenden kann, dass man sie irgendwann töten muss.
Beetee und Wiress werden wahrscheinlich schon selbst dafür sorgen, dass sie sterben. Falls wir vor etwas wegrennen müssen, kommen sie nicht weit. Johanna könnte ich, ehrlich gesagt, ohne mit der Wimper zu zucken umbringen, wenn ich Peeta beschützen müsste. Oder ihr das Maul stopfen. Aber ich brauche unbedingt jemanden, der Finnick für mich aus dem Weg räumt, das würde ich beim besten Willen nicht über mich bringen. Nicht nach all dem, was er für Peeta getan hat. Vielleicht könnte ich ihn in eine Konfrontation mit den Karrieros lotsen. Das ist kaltblütig, ich weiß. Aber was bleibt mir anderes übrig? Jetzt, da wir über die Uhr Bescheid wissen, wird er wohl kaum im Dschungel sterben, also muss ihn jemand im Kampf töten.
Weil der Gedanke daran so abstoßend ist, versuche ich krampfhaft, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Doch ich kann mich höchstens ablenken, indem ich mir ausmale, wie ich Präsident Snow töten werde. Keine besonders netten Tagträume für eine Siebzehnjährige, aber sehr befriedigend.
Wir laufen über den nächstgelegenen Streifen Sand und nähern uns vorsichtig dem Füllhorn, für den Fall, dass sich die Karrieros dort verstecken. Ich bezweifle das, denn wir waren viele Stunden am Strand und es gab kein Lebenszeichen von ihnen. Wie zu erwarten, ist das Gelände verlassen. Nur das große goldene Horn und der durchwühlte Stapel mit den Waffen sind noch da.
Nachdem Peeta Beetee im spärlichen Schatten des Füllhorns abgesetzt hat, ruft der Wiress zu sich. Sie hockt sich neben ihn und er drückt ihr die Drahtrolle in die Hände. »Mach sie sauber, ja?«, bittet er sie.
Wiress nickt, trippelt zum Ufer und taucht die Rolle ins Wasser. Dabei singt sie ein lustiges Liedchen über eine Maus, die an einer Uhr hochläuft. Offenbar ein Kinderlied, aber es scheint sie glücklich zu machen.
»Oh nein, nicht schon wieder dieses Lied«, sagt Johanna und verdreht die Augen. »Stundenlang ging das so, bis sie mit ihrem Tick-tack anfing.«
Plötzlich richtet Wiress sich kerzengerade auf und deutet auf den Dschungel. »Zwei«, sagt sie.
Ich folge ihrem Finger zu der Stelle, wo die Nebelwand sich gerade auf den Strand wälzt. »Ja, schaut, Wiress hat recht. Es ist zwei Uhr und der Nebel ist aufgezogen.«
»Wie ein Uhrwerk«, sagt Peeta. »Ganz schön clever, dass du das herausgefunden hast, Wiress.«
Wiress lächelt und macht sich wieder daran, zu singen und die Rolle ins Wasser zu tauchen. »Nicht nur clever«, sagt Beetee. »Sie hat auch Intuition.« Alle schauen zu Beetee, der wieder unter den Lebenden zu weilen scheint. »Sie spürt die Dinge lange vor allen anderen. Wie ein Kanarienvogel bei euch im Bergwerk.«
»Was hat es damit auf sich?«, fragt Finnick.
»Bei uns nehmen sie einen Kanarienvogel mit runter in die Kohlestollen. Er soll die Leute warnen, wenn sich die Luft dort unten mit Gas anreichert«, erkläre ich.
»Und was tut er dann, umfallen und sterben?«, fragt Johanna.
»Er hört auf zu singen. Dann sollte man schleunigst machen, dass man rauskommt. Aber wenn die Luft zu schlecht ist, stirbt er, ja. Und alle anderen auch.« Ich möchte nicht über sterbende Singvögel reden. Das weckt Gedanken an den Tod meines Vaters und an den von Rue und an den von Maysilee Donner und an meine Mutter, die Maysilees Singvogel geerbt hat. Na toll, und schon denke ich an Gale, tief unten in dieser schrecklichen Mine, und über ihm schwebt Präsident Snows Drohung. Dort unten ist es so leicht, einen Unfall zu arrangieren. Ein stummer Kanarienvogel, ein Funke, mehr braucht es nicht.
Jetzt stelle ich mir wieder vor, wie ich den Präsidenten kaltmache.
Trotz ihres Ärgers über Wiress ist Johanna so vergnügt, wie ich sie in der Arena noch nie gesehen habe. Während ich meinen Vorrat an Pfeilen ergänze, wühlt sie in dem Stapel herum, bis sie mit zwei martialisch aussehenden Äxten wieder zum Vorschein kommt. Komische Wahl, denke ich, bis ich mit ansehe, wie sie eine davon mit solcher Kraft schleudert, dass sie in dem von der Sonne aufgeweichten Gold des Füllhorns stecken bleibt. Natürlich. Johanna Mason. Distrikt 7. Holz. Sie hat schon Äxte durch die Gegend geworfen, ehe sie laufen konnte. Wie Finnick mit seinem Dreizack. Oder Beetee mit seinem Draht. Rue mit ihrem Wissen über Pflanzen. Mir wird bewusst, dass die Tribute aus Distrikt 12 in all den Jahren noch mit einem weiteren Nachteil zu kämpfen hatten. Wir gehen erst mit achtzehn ins Bergwerk. Offenbar erlernen alle anderen ihr Handwerk viel früher. Im Bergwerk tut man Dinge, die sich bei den Spielen als nützlich erweisen könnten. Eine Spitzhacke schwingen. Sprengen. Damit kann man sich einen Vorteil verschaffen. Wie ich mit dem Jagen. Aber wir lernen diese Dinge zu spät.
Während ich mich mit den Waffen beschäftigte, hat Peeta sich auf den Boden gehockt und mit der Messerspitze etwas auf ein großes weiches Blatt gemalt, das er aus dem Dschungel mitgenommen hat. Ich schaue ihm über die Schulter. Er zeichnet eine Karte von der Arena. In der Mitte steht das Füllhorn auf seinem Ring aus Sand mit den zwölf Strahlen, die davon abgehen. Wie eine in zwölf gleiche Stücke unterteilte Torte.
Ein weiterer Kreis stellt die Wasserlinie dar und ein noch etwas weiterer bezeichnet den Rand des Dschungels. »Sieh dir mal die Position des Füllhorns an«, sagt er.
Ich betrachte das Füllhorn und sehe, was er meint. »Das spitze Ende weist auf zwölf Uhr«, sage ich.
»Genau, das ist also oben bei der Uhr«, sagt er und ritzt flink die Zahlen eins bis zwölf aufs Ziffernblatt. »Von zwölf bis eins blitzt es.« In kleinen Buchstaben schreibt er Blitz in das entsprechende Tortenstück und in die folgenden Stücke trägt er im Uhrzeigersinn Blut, Nebel und Affen ein.
»Und zwischen zehn und elf kommt die Welle«, sage ich. Er fügt auch diese hinzu. Finnick und Johanna stoßen zu uns, bis an die Zähne mit Dreizacken, Äxten und Messern bewaffnet.
»Ist euch in den anderen Sektoren irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen?«, frage ich Johanna und Beetee, denn vielleicht haben sie ja etwas gesehen, das wir nicht bemerkt haben. Aber alles, was sie gesehen haben, war eine Menge Blut. »Da könnte so ziemlich alles auf uns warten.«
»Ich werde markieren, wo die Waffen der Spielmacher uns auch außerhalb des Dschungels verfolgen, damit wir diese Abschnitte meiden«, sagt Peeta und streicht die Strände bei Nebel und Welle durch. Dann setzt er sich wieder. »Na, da wissen wir doch schon viel mehr als heute Morgen.«
Wir nicken und in diesem Augenblick fällt mir plötzlich die Stille auf. Unser Kanarienvogel hat aufgehört zu singen.
Ich verliere keine Zeit. Während ich herumfahre, lege ich einen Pfeil ein. Ich sehe Gloss, der tropfnass dasteht und Wiress zu Boden gleiten lässt, ihre aufgeschlitzte Kehle sieht aus wie ein hellrotes Lächeln. Die Spitze meines Pfeils verschwindet in seiner rechten Schläfe, und in dem kurzen Augenblick, den es braucht, um einen neuen Pfeil einzulegen, schmettert Johanna eine Axt in Cashmeres Brust. Finnick wehrt den Speer ab, den Brutus auf Peeta geschleudert hat, und bekommt dafür Enobarias Messer in den Oberschenkel. Wäre da nicht das Füllhorn, das ihnen Deckung gibt, wären sie jetzt tot, die beiden Tribute aus Distrikt 2. Ich nehme die Verfolgung auf. Bum! Bum! Bum! Die Kanone bestätigt, dass für Wiress jede Hilfe zu spät kommt und es nicht mehr nötig ist, Gloss oder Cashmere den Rest zu geben. Meine Verbündeten und ich rennen um das Horn herum, wir machen uns an die Verfolgung von Brutus und Enobaria, die über einen Sandstreifen auf den Dschungel zuhetzen.
Plötzlich ruckt der Boden unter meinen Füßen und ich werde seitwärts in den Sand geschleudert. Der Ring aus Land rund um das Füllhorn beginnt sich zu drehen, immer schneller, bis der Dschungel zu einem verschwommenen Etwas wird. Ich spüre die Fliehkraft, die mich zum Wasser zieht, und grabe auf der Suche nach Halt Hände und Füße in den Sand. Umherwirbelnder Sand und Schwindelgefühl zwingen mich, die Augen fest zu schließen. Ich kann buchstäblich nichts tun außer durchhalten, bis wir ohne Vorankündigung abrupt wieder anhalten.
Hustend und würgend setze ich mich langsam auf und stelle fest, dass es meinen Gefährten genauso ergangen ist. Finnick, Johanna und Peeta haben sich halten können. Die drei Toten sind hinaus ins Salzwasser geschleudert worden.
Von dem Zeitpunkt an, da Wiress aufgehört hat zu singen, sind nicht mehr als ein oder zwei Minuten vergangen. Keuchend sitzen wir da und pulen uns den Sand aus dem Mund.
»Wo ist Minus?«, fragt Johanna plötzlich. Im Nu sind wir auf den Beinen, wenn auch wackelig. Ein Gang rund um das Füllhorn bestätigt, dass er fort ist. Finnick entdeckt ihn zwanzig Meter entfernt verzweifelt strampelnd im Wasser und schwimmt hinaus, um ihn zu bergen.
In diesem Moment fällt mir die Drahtrolle ein, die so wichtig für Beetee ist. Hektisch schaue ich mich um. Wo ist sie? Wo ist sie? Dann entdecke ich sie, Wiress hält sie immer noch fest, weit draußen im Wasser. Bei dem Gedanken, was ich jetzt tun muss, zieht sich mir der Magen zusammen. »Gebt mir Deckung«, sage ich zu den anderen. Ich werfe meine Waffen weg und laufe den Streifen entlang, der ihrem Körper am nächsten ist. Ohne abzubremsen, springe ich ins Wasser und schwimme auf sie zu. Aus dem Augenwinkel erkenne ich das Hovercraft, das über uns erscheint, und den Greifer, der heruntergelassen wird, um Wiress fortzuschaffen. Aber ich werde nicht langsamer. Ich schwimme, so schnell ich kann, rassele in ihren Körper. Keuchend tauche ich auf, versuche so wenig wie möglich von dem Wasser zu schlucken, das sich mit dem Blut aus der offenen Wunde an ihrem Hals vermischt. Wiress treibt auf dem Rücken, ihr Gürtel und der Tod halten sie über Wasser, die Augen starren in die erbarmungslose Sonne. Während ich Wasser trete, entreiße ich ihren Fingern, die nichts mehr hergeben wollen, gewaltsam die Drahtrolle. Ich kann nichts mehr für sie tun, außer ihr die Lider zu schließen, ihr Lebewohl zuzuflüstern und sie dann sich selbst zu überlassen. Als ich die Drahtrolle auf den Sand werfe und mich aus dem Wasser ziehe, ist ihr Körper schon fort. Aber ich schmecke noch immer ihr Blut, vermischt mit Meersalz.
Ich gehe zurück zum Füllhorn. Finnick hat Beetee wiederbelebt, der reichlich Wasser geschluckt hat. Er setzt sich auf und prustet. Zum Glück hat er daran gedacht, seine Brille festzuhalten, so kann er wenigstens sehen. Ich lege ihm die Drahtrolle in den Schoß. Sie ist blitzsauber, kein Blut mehr daran zu sehen. Er wickelt ein Stück Draht ab und lässt es durch die Finger laufen. Zum ersten Mal sehe ich genauer hin. Dieser Draht ist ganz anders als der, den ich kenne. Er ist blassgolden und so dünn wie ein Haar. Er muss viele Kilometer lang sein, wenn ich mir die Rolle so anschaue. Aber ich frage nicht, weil ich weiß, dass Beetee mit den Gedanken bei Wiress ist.
Ich schaue in die ernsten Gesichter der anderen. Alle haben sie nun ihre Distriktpartner verloren, Finnick, Johanna und Beetee. Ich gehe hinüber zu Peeta und schlinge die Arme um ihn und eine Zeit lang sagt keiner was.
»Lasst uns von dieser stinkenden Insel verschwinden«, sagt Johanna schließlich. Unsere Waffen haben wir weitgehend retten können. Zum Glück halten die Ranken hier was aus und der Fallschirm mit Zapfhahn und Salbe hängt noch fest an meinem Gürtel. Finnick zieht das Unterhemd aus und bindet es um die Wunde, die Enobarias Messer in seinem Schenkel hinterlassen hat; sie ist nicht tief. Beetee meint, dass er jetzt laufen kann, wenn wir langsam gehen, ich helfe ihm hoch. Wir beschließen, zum Zwölf-Uhr-Strand zu gehen. Dort dürften wir ein paar Stunden Ruhe haben, ohne mit giftigen Dämpfen rechnen zu müssen. Aber dann laufen Peeta, Johanna und Finnick jeder in eine andere Richtung.
»Zwölf Uhr, oder?«, sagt Peeta. »Die Spitze zeigt auf die Zwölf.«
»Das hat sie, bevor sie uns durcheinandergewirbelt haben«, sagt Finnick. »Ich orientiere mich lieber an der Sonne.«
»Die Sonne sagt dir nur, dass es bald vier Uhr ist, Finnick«, sage ich.
»Wenn ich recht verstehe«, mischt Beetee sich ein, »will Katniss sagen, dass wir zwar wissen, wie viel Uhr es ist, aber nicht unbedingt, wo auf der Uhr sich die Vier befindet. Wir haben vielleicht eine ungefähre Ahnung, in welche Richtung es geht. Vorausgesetzt, sie haben den äußeren Ring nicht auch versetzt.«
Nein, Katniss wollte nichts derart Ausgefeiltes sagen. Beetees Theorie geht weit über meine Bemerkung zur Sonne hinaus. Aber ich nicke nur, als wäre genau das mein Gedanke gewesen. »Ja, und das bedeutet, dass jeder dieser Sandstreifen zur Zwölf führen könnte«, sage ich.
Wir umrunden das Füllhorn und erforschen den Dschungel. Er ist verwirrend gleichförmig. Ich erinnere mich an den großen Baum, in den um zwölf Uhr der erste Blitz einschlug, doch in jedem Sektor gibt es einen ähnlichen Baum. Johanna schlägt vor, den Spuren von Brutus und Enobaria zu folgen, aber sie sind verweht oder weggewaschen worden. Es ist unmöglich, irgendetwas zu erkennen. »Hätte ich die Uhr doch nie erwähnt«, sage ich verbittert. »Jetzt haben sie uns auch noch diesen Vorteil genommen.«
»Nur vorübergehend«, sagt Beetee. »Um zehn, wenn die Welle kommt, sind wir wieder auf Kurs.«
»Genau, die ganze Arena können sie nicht neu designen«, stimmt Peeta zu.
»Was soll’s«, sagt Johanna ungeduldig. »Du musstest es uns sagen, sonst hätten wir doch nie unser Lager abgebrochen, Dummerchen.« Eigenartig, aber ihre logische, wenn auch erniedrigende Antwort ist die einzige, die mich tröstet. Ja, ich musste es ihnen sagen, damit sie sich aufraffen. »Vorwärts, ich brauche Wasser. Hat einer ein gutes Bauchgefühl?«
Wir entscheiden uns für irgendeinen Streifen und folgen ihm, ohne zu wissen, auf welche Ziffer wir uns zubewegen. Als wir den Dschungel erreichen, spähen wir hinein und versuchen zu erraten, was uns dort erwarten mag.
»Müsste eigentlich die Affenstunde sein. Aber ich kann keine Affen entdecken«, sagt Peeta. »Ich schau mal, ob ich einen Baum anzapfen kann.«
»Nein, ich bin dran«, sagt Finnick.
»Dann gebe ich dir wenigstens Rückendeckung«, erklärt Peeta.
»Das kann Katniss übernehmen«, sagt Johanna. »Dich brauchen wir, um eine neue Karte zu zeichnen. Die andere ist doch weggespült worden.« Sie reißt ein großes Blatt von einem Baum und reicht es ihm.
Einen Augenblick lang keimt in mir der Verdacht auf, sie wollen Peeta und mich trennen und uns beide töten. Aber das ist unlogisch. Solange Finnick sich an dem Baum zu schaffen macht, bin ich im Vorteil, und Peeta ist viel stärker als Johanna. Also folge ich Finnick etwa fünfzehn Meter in den Dschungel hinein, wo er einen brauchbaren Baum findet und mit seinem Messer ein Loch hineinzustechen beginnt.
Wie ich so dastehe, mit schussbereitem Bogen, werde ich das beklemmende Gefühl nicht los, dass hier etwas vorgeht und dass es mit Peeta zu tun hat. Ich gehe die Ereignisse durch, von dem Moment an, als der Gong ertönte, und suche nach dem Grund für mein Unbehagen. Finnick, der Peeta von seiner Metallscheibe wegzieht. Finnick, der Peeta wiederbelebt, nachdem das Kraftfeld sein Herz zum Stillstand brachte. Mags, die in den Nebel rennt, damit Finnick Peeta tragen kann. Die Morfixerin, die sich zwischen Peeta und den Affen wirft. Der Kampf mit den Karrieros ging so schnell und war im Nu wieder vorbei, aber hat Finnick nicht Brutus’ Speer abgefangen, bevor er Peeta traf, obwohl er dadurch Enobaria Gelegenheit gab, ihm ihr Messer ins Bein zu rammen? Und jetzt will Johanna, dass er eine Karte zeichnet, anstatt sich den Gefahren des Dschungels auszusetzen …
Keine Frage. Aus mir völlig unerklärlichen Gründen versuchen einige der anderen Sieger, Peeta das Leben zu retten, selbst wenn es bedeutet, dass sie ihr eigenes opfern müssen.
Ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Zum einen ist das doch meine Aufgabe. Und zum anderen weiß ich überhaupt nicht, was das soll. Nur einer von uns kommt hier heraus. Wieso haben sie dann beschlossen, Peeta zu beschützen? Was mag Haymitch ihnen gesagt haben, was hat er zum Tausch angeboten, damit sie Peetas Leben über ihr eigenes stellen?
Ich kenne meine ganz persönlichen Gründe, weshalb ich will, dass Peeta überlebt. Er ist mein Freund, auf diese Weise biete ich dem Kapitol die Stirn, untergrabe ihre schrecklichen Spiele. Doch wenn mich nichts mit ihm verbinden würde, weshalb sollte ich ihn retten wollen, damit er überlebt und nicht ich? Er ist tapfer, sicher, aber alle anderen sind auch tapfer genug gewesen, ihre Spiele zu überleben. Er hat ein besonders gutes Herz, das ist kaum zu übersehen, aber trotzdem … und da endlich fällt mir ein, was Peeta so viel besser kann als wir anderen. Er kann mit Worten umgehen. In beiden Interviews hat er die Konkurrenz in Grund und Boden geredet. Und vielleicht liegt es an seinem guten Herzen, dass er durch seine Art zu reden eine Menschenmenge auf seine Seite ziehen kann. Ein ganzes Land.
Ich weiß noch, dass ich mal dachte, genau diese Gabe müsse der Führer unserer Revolution haben. Hat Haymitch die anderen davon überzeugt? Dass Peetas Zunge eine viel mächtigere Waffe gegen das Kapitol wäre als alle physische Stärke, die wir anderen geltend machen könnten? Ich weiß es nicht. Es erscheint mir immer noch ein sehr großer Sprung über den eigenen Schatten für einige der Tribute. Für Johanna Mason zum Beispiel. Doch welche andere Erklärung kann es für ihre entschlossenen Bemühungen, sein Leben zu retten, geben?
»Gibst du mir mal den Zapfhahn, Katniss?«, fragt Finnick und holt mich zurück in die Wirklichkeit. Ich schneide die Ranke durch, mit der ich den Hahn an meinem Gürtel befestigt habe, und reiche ihn Finnick.
In diesem Augenblick höre ich sie schreien. So voller Angst und Schmerz, dass mir das Blut in den Adern gefriert. Und so vertraut. Ich lasse den Hahn fallen, vergesse, wo ich bin und was vor mir liegt, ich weiß nur, dass ich zu ihr muss, sie beschützen. Wie wild geworden renne ich in den Dschungel hinein, der Stimme nach, achtlos gegenüber der Gefahr, breche durch Ranken und Geäst, durch alles, was mir den Weg zu ihr versperrt.
Den Weg zu meiner kleinen Schwester.
24
Wo ist sie? Was machen sie mit ihr? »Prim!«, schreie ich. »Prim!« Die Antwort ist nur ein weiterer gequälter Schrei. Wie ist sie hergekommen? Warum ist sie Teil der Spiele? »Prim!«
Zweige schneiden mir in Gesicht und Arme, Kriechpflanzen greifen nach meinen Füßen. Aber ich komme ihr näher. Immer näher. Bin ihr jetzt ganz nah. Der Schweiß rinnt mir übers Gesicht, sticht in die halb verheilten Säurewunden. In der feuchtwarmen, sauerstoffarmen Luft ringe ich nach Atem. Prim gibt einen Laut von sich, so ein verlorenes, endgültiges Geräusch, dass ich mir nicht vorstellen mag, was sie mit ihr gemacht haben.
»Prim!« Ich breche durch eine grüne Wand auf eine kleine Lichtung, und der Laut erklingt erneut, direkt über mir. Abrupt lege ich den Kopf in den Nacken. Hängt sie gefangen in den Bäumen? Verzweifelt suche ich das Geäst ab, aber ich kann nichts entdecken. »Prim?«, flehe ich. Ich höre sie, doch ich kann sie nicht sehen. Der nächste Klagelaut erklingt, klar wie eine Glocke, und da besteht kein Zweifel mehr. Er kommt aus dem Schnabel eines kleinen schwarzen Vogels mit einer Haube auf dem Kopf, der sich etwa drei Meter über mir auf einem Zweig niedergelassen hat. Und dann begreife ich.
Es ist ein Schnattertölpel.
Ich habe noch nie einen gesehen, ich hatte gedacht, es gäbe keine mehr. Ich lehne mich gegen einen Baumstamm, presse die Hand auf meine stechenden Seiten und betrachte ihn. Die Mutation, die Urversion, der Stammvater. Vor meinem inneren Auge lasse ich eine Spottdrossel erstehen, verschmelze sie mit einem Schnattertölpel und erkenne, wie aus den beiden mein Spotttölpel geworden ist. Nichts an dem Vogel verrät, dass er eine Mutation ist. Nichts außer der täuschend echten Imitation von Prims Stimme, die aus seinem Schnabel kommt. Mit einem Pfeil in die Kehle bringe ich ihn zum Schweigen. Der Vogel fällt zu Boden. Ich ziehe den Pfeil heraus und drehe dem Vogel den Hals um, sicherheitshalber. Dann schleudere ich das widerliche Ding in den Dschungel. Kein Hunger der Welt könnte mich in Versuchung führen, ihn zu essen.
Das war nicht real, sage ich mir. So wie letztes Jahr die mutierten Wölfe nicht die echten toten Tribute waren. Das ist nur ein sadistischer Trick der Spielmacher.
Finnick bricht auf die Lichtung, als ich gerade meinen Pfeil mit Moos abwische. »Katniss?«
»Alles in Ordnung. Ich bin okay«, sage ich, obwohl ich mich ganz und gar nicht okay fühle. »Ich dachte, ich hätte meine Schwester gehört, aber …« Ein durchdringender Schrei unterbricht mich. Diesmal ist es eine andere Stimme, nicht die von Prim, vielleicht von einer jungen Frau. Ich erkenne sie nicht. Doch auf Finnick macht sie unmittelbar Eindruck. Alle Farbe weicht aus seinem Gesicht und die Pupillen weiten sich vor Schreck. »Bleib hier, Finnick!«, rufe ich und strecke die Hand aus, um ihn zu beruhigen, doch er ist schon auf und davon. Losgestürzt auf der Suche nach dem Opfer, genauso kopflos wie ich, als ich Prim hinterherjagte. »Finnick!«, rufe ich, aber ich weiß, dass er nicht umkehren und warten wird, um sich eine vernünftige Erklärung anzuhören. Mir bleibt nur, mich an seine Fersen zu heften.
Er ist schnell, aber es ist nicht schwer, ihm zu folgen, denn er hinterlässt eine deutliche Bresche. Doch der Vogel ist gut einen halben Kilometer entfernt, meist geht es bergauf, und als ich Finnick endlich einhole, bin ich völlig außer Atem. Er läuft um einen riesigen Baum herum. Der Stamm ist über einen Meter dick, die ersten Äste beginnen in gut sieben Metern Höhe. Der Schrei der Frau kommt irgendwo aus dem Grün über uns, doch der Schnattertölpel ist gut versteckt. Auch Finnick schreit, immer und immer wieder: »Annie! Annie!« Er ist voller Panik, nicht ansprechbar, deshalb tue ich, was ich sowieso getan hätte. Ich besteige einen benachbarten Baum, suche, bis ich den Schnattertölpel ausfindig gemacht habe, und erledige ihn mit einem Pfeil. Er fällt Finnick direkt vor die Füße. Finnick hebt ihn auf, langsam dämmert es ihm, doch als ich mich herunterlasse und zu ihm gehe, sieht er noch verzweifelter aus.
»Alles in Ordnung, Finnick. Das ist nur ein Schnattertölpel. Sie spielen uns einen Streich«, sage ich. »Das ist nicht real. Es ist nicht deine … Annie.«
»Nein, es ist nicht Annie. Aber die Stimme gehörte ihr. Schnattertölpel imitieren, was sie hören. Woher haben sie diese Schreie, Katniss?«, fragt er.
Als mir klar wird, was das bedeutet, spüre ich, wie jetzt ich blass werde. »Finnick, du meinst doch nicht etwa, die …«
»Doch. Meine ich. Genau das denke ich«, sagt er.
Ich stelle mir Prim vor, in einem weißen Raum, an einem Tisch festgeschnallt, während maskierte Gestalten in langen Gewändern ihr diese Laute entlocken. Irgendwo foltern sie sie oder haben sie gefoltert, um an diese Laute zu kommen. Meine Knie geben nach und ich sinke zu Boden. Finnick will mir etwas sagen, doch ich kann ihn nicht verstehen. Dafür höre ich plötzlich einen Vogel, der irgendwo zu meiner Linken anfängt zu singen. Und diesmal gehört die Stimme Gale.
Ehe ich losrennen kann, packt Finnick mich am Arm. »Nein. Das ist er nicht.« Er zerrt mich bergab, zum Strand. »Wir müssen hier raus!« Doch Gales Stimme ist so voller Schmerz, dass ich versuche, mich loszureißen und zu ihm zu laufen. »Das ist nicht er, Katniss! Das ist eine Mutation!«, schreit Finnick mich an. »Los jetzt!« Halb schleift er mich, halb trägt er mich weiter, bis ich begreife, was er gesagt hat. Er hat recht, das ist nur ein Schnattertölpel. Gale hat nichts davon, wenn ich den Vogel töte. Trotzdem, es ist Gales Stimme, und irgendwer hat ihn irgendwo und irgendwann dazu gebracht, solche Laute auszustoßen.
Aber ich wehre mich nicht mehr gegen Finnick. Wie in der Nacht mit dem Nebel fliehe ich vor etwas, gegen das ich nicht ankämpfen kann. Das mir nur Leid zufügen kann. Nur dass es diesmal mein Herz ist, das verätzt wird, und nicht mein Körper. Mit Sicherheit sind die Vögel eine weitere Waffe der Uhr. Vier Uhr, vermute ich mal. Wenn die Zeiger auf vier Uhr rücken, gehen die Affen nach Hause und die Schnattertölpel kommen hervor und spielen auf. Finnick hat recht: Wir müssen so schnell wie möglich raus hier. Nur dass Haymitch uns diesmal todsicher nichts per Fallschirm wird schicken können, das Finnick und mir hilft, diese Wunden zu heilen.
Am Dschungelrand stehen Peeta und Johanna, was mich erleichtert und zugleich wütend macht. Wieso ist Peeta mir nicht zu Hilfe gekommen? Wieso ist uns keiner gefolgt? Selbst jetzt noch zögert er, die Hände erhoben, die Handflächen uns zugewandt, die Lippen bewegen sich, doch die Worte erreichen uns nicht. Warum?
Die Wand ist so transparent, dass wir in vollem Lauf dagegenprallen und auf den Dschungelboden zurückgeschleudert werden. Ich habe Glück, meine Schulter hat den Aufprall weitgehend abgefangen. Aber Finnick ist mit dem Gesicht voll dagegengeknallt und jetzt schießt das Blut nur so aus seiner Nase. Deshalb also sind Peeta und Johanna und auch Beetee, der hinter ihnen traurig den Kopf schüttelt, uns nicht zu Hilfe gekommen. Eine unsichtbare Barriere versperrt den Zugang zum Strand. Kein Kraftfeld diesmal. Man kann die harte, glatte Oberfläche nach Belieben berühren. Doch weder Peetas Messer noch Johannas Axt vermag ihr auch nur einen Kratzer zuzufügen. Ich gehe ein paar Meter nach einer Seite und stelle fest, dass die Wand wohl den gesamten Sektor zwischen vier und fünf Uhr einschließt. Dass wir wie die Mäuse in der Falle sitzen, bis die Stunde vorbei ist.
Peeta presst die Hand gegen die Oberfläche, und ich halte meine dagegen, als könnte ich ihn durch die Wand hindurch spüren. Ich sehe, dass er die Lippen bewegt, doch ich kann ihn nicht hören, kann überhaupt nichts hören außerhalb unseres Segments. Ich versuche zu erraten, was er sagt, aber ich kann mich nicht konzentrieren, deshalb starre ich nur auf sein Gesicht und bemühe mich, meine fünf Sinne beisammenzuhalten.
Dann kommen die Vögel angeflogen. Einer nach dem anderen. Lassen sich auf den Ästen um uns herum nieder. Und aus ihren Schnäbeln ergießt sich ein sorgsam abgestimmter Chor des Grauens. Finnick kapituliert sofort, er sinkt zu Boden und presst die Hände auf die Ohren, als wollte er seinen Schädel zerquetschen. Eine Zeit lang versuche ich mich zu wehren. Ich verschieße den Inhalt meines Köchers auf die verhassten Vögel. Doch sobald einer tot herunterfällt, nimmt ein anderer seinen Platz ein. Schließlich gebe auch ich auf. Ich rolle mich neben Finnick zusammen und versuche die unerträglichen Schreie auszublenden, die Schreie von Prim, Gale, meiner Mutter, Madge, Rory, Vick und sogar Posy, der wehrlosen kleinen Posy …
Als ich Peetas Hand spüre, weiß ich, dass es vorbei ist. Ich merke, wie ich hochgehoben und aus dem Dschungel getragen werde. Trotzdem habe ich die Augen noch immer fest geschlossen, halte mir die Ohren zu, bleibe verkrampft und kann nicht lockerlassen. Peeta bettet mich in seinen Schoß, wiegt mich sanft und redet beruhigend auf mich ein. Es dauert lange, bis sich der eiserne Griff, in dem sich mein Körper befindet, lockert. Und da fange ich an zu zittern.
»Es ist alles gut, Katniss«, flüstert er.
»Du hast sie nicht gehört«, antworte ich.
»Ich hab Prim gehört. Gleich am Anfang. Aber das war nicht sie«, sagt er. »Es war ein Schnattertölpel.«
»Das war sie. Irgendwo. Der Schnattertölpel hat es sich nur gemerkt«, sage ich.
»Nein, sie wollen, dass du das denkst. So wie ich mich letztes Jahr gefragt habe, ob diese Mutation wirklich Glimmers Augen hatte. Aber es waren nicht Glimmers Augen. Und das hier war nicht Prims Stimme. Oder wenn doch, dann haben sie sie vielleicht aus einem Interview und den Klang verzerrt. Damit sie sich so anhörte, wie sie es wollten«, sagt er.
»Nein, sie haben sie gefoltert«, erwidere ich. »Wahrscheinlich ist sie tot.«
»Prim ist nicht tot, Katniss. Wie könnten sie Prim töten? Bald sind nur noch acht von uns übrig. Du weißt doch, was dann geschieht, oder?«, sagt Peeta.
»Sieben von uns werden sterben«, sage ich ohne Hoffnung.
»Nein, zu Hause, meine ich. Was geschieht, wenn nur noch acht Tribute dabei sind?« Er hebt mein Kinn hoch, sodass ich ihn ansehen muss. Zwingt mich, ihm in die Augen zu schauen. »Was geschieht dann? Bei den letzten acht?«
Ich weiß, dass er mir zu helfen versucht, also überlege ich. »Bei den letzten acht?«, wiederhole ich. »Sie interviewen unsere Familien und Freunde in der Heimat.«
»Stimmt genau«, sagt Peeta. »Sie interviewen unsere Familien und Freunde. Und wäre das möglich, wenn sie alle getötet hätten?«
»Nicht?«, frage ich, immer noch unsicher.
»Nein. Daher wissen wir, dass Prim noch lebt. Sie wird ja wohl die Erste sein, die sie interviewen, oder?«, sagt er.
Ich möchte ihm glauben. Unbedingt. Es ist nur … diese Stimmen …
»Erst Prim. Dann deine Mutter. Deinen Cousin, Gale. Madge«, fährt er fort. »Es war ein Trick, Katniss. Ein grausamer Trick. Aber nur wir können dadurch verletzt werden. Wir sind in den Spielen. Nicht sie.«
»Glaubst du wirklich?«, frage ich.
»Ja, das glaube ich wirklich«, sagt Peeta. Ich schwanke, ich denke daran, dass Peeta die Menschen dazu bringen kann, alles zu glauben. Ich schaue zu Finnick hinüber und warte auf eine Bestätigung, sehe, dass er Peetas Worten gebannt lauscht. »Glaubst du das, Finnick?«, frage ich.
»Möglich wär’s. Ich weiß nicht«, sagt er. »Könnten sie das, Beetee? Die echte Stimme von jemandem nehmen und sie so verändern, dass sie …«
»Aber ja. Das ist gar nicht mal so schwer, Finnick. Bei uns lernen die Kinder so was in der Schule«, sagt Beetee.
»Natürlich hat Peeta recht«, sagt Johanna im Brustton der Überzeugung. »Das ganze Land vergöttert Katniss’ kleine Schwester. Wenn sie sie wirklich auf diese Weise getötet hätten, dann hätten sie wahrscheinlich einen Aufstand am Hals. Und das wollen sie doch nicht, was?« Sie wirft ihren Kopf zurück und schreit. »Das ganze Land in Aufruhr? Das würden sie bestimmt nicht wollen!«
Mir bleibt der Mund offen stehen, so geschockt bin ich. Niemand spricht so etwas in den Spielen aus. Nie. Todsicher haben sie Johanna ausgeblendet und schneiden sie jetzt eilig heraus. Doch ich habe sie gehört und ich werde nie mehr so über sie denken können wie bisher. Einen Preis für Freundlichkeit wird sie niemals bekommen, aber mutig ist sie auf jeden Fall. Oder verrückt. Sie hebt ein paar Muschelschalen auf, sagt: »Ich geh mal Wasser holen«, und macht sich auf den Weg in den Dschungel.
Als sie an mir vorübergeht, greife ich unwillkürlich nach ihrer Hand. »Geh nicht da rein. Die Vögel …« Die Vögel müssen zwar verschwunden sein, aber ich möchte trotzdem nicht, dass wieder jemand hineingeht. Nicht mal sie.
»Die können mir nichts anhaben. Ich bin nicht wie ihr. Von meinen Lieben ist keiner mehr da«, sagt Johanna und schüttelt mich ungeduldig ab. Als sie zurückkommt und mir eine Muschelschale voll Wasser reicht, nicke ich zum Dank, sage aber nichts, denn ich weiß, dass sie für das Mitleid in meiner Stimme nur Verachtung übrig hätte.
Während Johanna Wasser und meine Pfeile holt, fummelt Beetee an seinem Draht herum, und Finnick macht sich auf den Weg ans Ufer. Ich müsste mich auch mal waschen, aber ich bleibe in Peetas Armen, ich bin noch immer zu aufgewühlt, um mich zu bewegen.
»Wen haben sie auf Finnick angesetzt?«, fragt er.
»Jemanden namens Annie«, sage ich.
»Das muss Annie Cresta sein«, sagt er.
»Wer?«, frage ich.
»Annie Cresta. Das Mädchen, an deren Stelle Mags sich freiwillig gemeldet hat. Sie hat vor fünf oder sechs Jahren gewonnen«, sagt Peeta.
Das müsste dann der Sommer nach dem Tod meines Vaters gewesen sein, als ich begann, meine Familie zu ernähren, als meine ganze Existenz damit ausgefüllt war, gegen den Hunger zu kämpfen. »An diese Spiele kann ich mich kaum erinnern«, sage ich. »War das das Jahr mit dem Erdbeben?«
»Ja. Annie ist durchgedreht, als ihr Distriktpartner enthauptet wurde. Rannte allein los und versteckte sich. Doch bei dem Erdbeben brach ein Damm und der größte Teil der Arena wurde überflutet. Sie gewann, weil sie am besten schwimmen konnte«, sagt Peeta.
»Hat sich ihr Zustand seitdem gebessert?«, frage ich. »Ihr Geisteszustand, meine ich.«
»Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals noch bei den Spielen gesehen zu haben. Aber bei der Ernte neulich wirkte sie nicht gerade stabil.«
Das also ist die Frau, die Finnick liebt, denke ich. Nicht die schicken Mätressen im Kapitol. Sondern ein armes, verrücktes Mädchen in der Heimat.
Eine Kanone ertönt und wir laufen alle am Strand zusammen. Ein Hovercraft erscheint dort, wo wir den Sechs-bis-sieben-Sektor vermuten. Wir schauen zu, wie der Greifer fünfmal herunterfährt, um die verschiedenen Teile eines zerfetzten Körpers aufzusammeln. Unmöglich zu erkennen, um wen es sich handelt. Was immer um sechs in diesem Sektor passiert, ich möchte es nie erfahren.
Auf einem Blatt zeichnet Peeta eine neue Karte und fügt im Vier-bis-fünf-Feld ST für Schnattertölpel ein, und in das Feld, wo gerade die Einzelteile des Tributs eingesammelt wurden, schreibt er einfach nur Bestie. Von sieben Stunden der Uhr haben wir jetzt eine recht genaue Vorstellung. Und wenn der Angriff der Schnattertölpel irgendetwas Gutes hat, dann dass wir wieder wissen, an welcher Stelle der Uhr wir uns befinden.
Finnick flicht einen neuen Wasserkorb und knüpft ein Netz zum Fischen. Ich schwimme ein bisschen und reibe meine Haut mit Salbe ein. Dann setze ich mich ans Ufer, säubere die Fische, die Finnick fängt, und schaue zu, wie die Sonne hinter dem Horizont versinkt. Der helle Mond geht bereits auf und taucht die Arena in dieses seltsame Zwielicht. Wir wollen uns gerade zu unserem Mahl aus rohem Fisch niederlassen, als die Hymne erklingt. Dann erscheinen die Gesichter …
Cashmere. Gloss. Wiress. Mags. Die Frau aus Distrikt 5. Die Morfixerin, die sich für Peeta geopfert hat. Blight. Der Mann aus Distrikt 10.
Acht tot. Plus die acht vom ersten Abend. Innerhalb von anderthalb Tagen sind zwei Drittel von uns gestorben. Das dürfte Rekord sein.
»Die verheizen uns ja regelrecht«, sagt Johanna.
»Wer ist noch übrig? Abgesehen von uns fünf und den beiden aus Distrikt 2?«, fragt Finnick.
»Chaff«, sagt Peeta, ohne darüber nachdenken zu müssen. Vielleicht hat er nach ihm Ausschau gehalten, wegen Haymitch.
Ein Fallschirm mit einem Stapel mundgerechter viereckiger Brötchen segelt herab. »Die sind aus deinem Distrikt, stimmt’s, Beetee?«, fragt Peeta.
»Ja, aus Distrikt 3«, sagt er. »Wie viele sind es?«
Finnick zählt sie, wobei er jedes Einzelne in den Händen dreht und wendet, bevor er sie nach einem bestimmten Muster anordnet. Keine Ahnung, was Finnick mit Brot hat, aber irgendwie scheint er davon besessen zu sein. »Vierundzwanzig«, sagt er.
»Genau zwei Dutzend also?«, fragt Beetee. »Exakt vierundzwanzig«, sagt Finnick. »Wie sollen wir sie teilen?«
»Jeder isst drei, und wer beim Frühstück noch am Leben ist, kann über den Rest bestimmen«, sagt Johanna. Ich weiß nicht, warum ich darüber kichern muss. Wahrscheinlich, weil es aufrichtig ist. Johanna wirft mir einen fast anerkennenden Blick zu. Nein, nicht anerkennend. Aber leicht erfreut vielleicht.
Wir warten, bis die Riesenwelle den Zehn-bis-elf-Sektor überrollt hat und das Wasser zurückgewichen ist, dann gehen wir an den Strand dort, um unser Lager aufzuschlagen. Theoretisch mussten wir jetzt zwölf Stunden vor dem Dschungel in Sicherheit sein. Aus dem Elf-bis-zwölf-Sektor kommt ein unangenehmer Chor aus Klicklauten, wahrscheinlich irgendeine üble Insektenart. Doch was dieses Geräusch auch verursachen mag, es bleibt innerhalb des Dschungels, und wir meiden diesen Teil des Strandes, falls die Viecher doch nur auf einen unvorsichtigen Schritt warten, um auszuschwärmen.
Ich begreife nicht, wie Johanna sich noch auf den Beinen halten kann. Seit Beginn der Spiele hat sie nur eine Stunde geschlafen. Peeta und ich melden uns freiwillig für die erste Wache, weil wir ausgeruhter sind und weil wir ein bisschen Zeit für uns haben möchten. Die anderen schlafen sofort tief und fest. Nur Finnicks Schlaf ist unruhig, ab und zu höre ich, wie er Annies Namen flüstert.
Peeta und ich setzen uns nebeneinander, aber voneinander abgewandt auf den feuchten Sand, meine rechte Schulter und Hüfte berühren seine. Er schaut auf den Dschungel und ich aufs Wasser, was mir guttut. Die Stimmen der Schnattertölpel verfolgen mich noch immer und die Insekten können das nicht übertönen. Nach einer Weile lehne ich den Kopf gegen Peetas Schulter. Er streicht mir über das Haar.
»Katniss«, sagt er sanft, »es hat keinen Sinn, so zu tun, als wussten wir nicht, was der andere vorhat.« Nein, wahrscheinlich nicht. Aber darüber reden ist auch nicht gerade angenehm. Zumindest nicht für uns. Dafür werden die Zuschauer im Kapitol jetzt an ihren Geräten kleben, um nur ja kein Wort zu verpassen.
»Ich weiß nicht, was für einen Deal du mit Haymitch gemacht zu haben glaubst, aber du sollst wissen, dass er mir auch Versprechungen gemacht hat.« Natürlich, das weiß ich selbst. Er hat Peeta eingeflüstert, sie könnten irgendwie mein Leben retten, damit er keinen Verdacht schöpft. »Wir können daher davon ausgehen, dass er einen von uns angelogen hat.«
Jetzt horche ich auf. Ein Doppeldeal. Ein doppeltes Versprechen. Und nur Haymitch weiß, welches ernst gemeint ist. Ich hebe den Kopf und begegne Peetas Blick. »Warum fängst du ausgerechnet jetzt davon an?«
»Weil du nicht vergessen sollst, dass ich in einer ganz anderen Lage bin als du. Wenn du stirbst und ich überlebe, gibt es für mich zu Hause in Distrikt 12 keinen Grund zum Weiterleben mehr. Du bist mein ganzes Leben. Ich könnte nie mehr glücklich sein.« Ich versuche zu widersprechen, doch er legt mir einen Finger auf die Lippen. »Für dich ist das anders. Ich sage nicht, dass es nicht hart wäre für dich. Aber du hast andere Menschen, für die es sich lohnen würde weiterzuleben.«
Peeta zieht die Kette mit dem flachen Goldanhänger an seinem Hals hervor. Er hält sie ins Mondlicht, sodass ich den Spotttölpel deutlich sehen kann. Dann fährt er mit dem Daumen über einen Verschluss, der mir bisher nicht aufgefallen ist, und ein Deckel springt auf. Der Anhänger ist nicht massiv, wie ich dachte, er ist ein Medaillon. Mit Fotos darin. Rechts meine Mutter und Prim, beide lachend. Links Gale. Tatsächlich lächelnd.
Nichts auf der Welt könnte mich in diesem Augenblick mürber machen als diese drei Gesichter. Nach allem, was ich heute Nachmittag mit anhören musste … ist das die perfekte Waffe.
»Deine Familie braucht dich, Katniss«, sagt Peeta.
Meine Familie. Meine Mutter. Meine Schwester. Und Gale, mein angeblicher Cousin. Es ist offensichtlich, was Peeta damit sagen will. Gale ist Teil meiner Familie, oder er wird es sein, falls ich überlebe. Ich werde ihn heiraten. Peeta schenkt mir also sein Leben und Gale obendrein. Damit ich weiß, dass ich daran nie zweifeln soll. Alles soll ich von Peeta nehmen.
Ich erwarte eigentlich, dass er das Baby erwähnt, für die Kameras, doch er schweigt. Und da wird mir bewusst, dass das hier nichts mit den Spielen zu tun hat. Dass er mir seine wahren Gefühle offenbart.
»Mich braucht eigentlich keiner«, sagt er, ganz ohne Selbstmitleid. Es stimmt, seine Familie braucht ihn nicht. Sie werden ihn beweinen, zusammen mit ein paar Freunden, die man an einer Hand abzählen kann. Aber sie werden darüber hinwegkommen. Wie auch Haymitch, mithilfe einer Menge klarem Schnaps. Nur ein einziger Mensch würde unwiderruflich Schaden nehmen, wenn Peeta stirbt. Ich.
»Doch, ich«, sage ich. »Ich brauche dich.« Er wirkt erschrocken. Er atmet tief ein, als wollte er zu einer langen Erklärung ansetzen, und das ist nicht gut, ganz und gar nicht, denn dann spricht er wieder von Prim und meiner Mutter und allem, und das würde mich nur verwirren. Deshalb verschließe ich seine Lippen schnell mit einem Kuss.
Ich spüre es wieder. Was ich erst einmal gespürt habe. Letztes Jahr, in der Höhle, als ich Haymitch dazu bewegen wollte, uns Nahrung zu schicken. Während dieser Spiele und danach habe ich Peeta tausendmal geküsst. Aber nur bei einem Kuss hat sich in mir drin etwas gerührt. Nur bei diesem einen Kuss wollte ich mehr. Doch dann fing meine Kopfwunde wieder an zu bluten, und er meinte, ich solle mich hinlegen.
Diesmal unterbricht uns nichts. Und nach ein paar Ansätzen gibt Peeta auf. In mir wird es immer wärmer, und die Wärme strömt von meiner Brust durch den ganzen Körper, durch Arme und Beine bis in die Spitzen. Doch die Küsse stellen mich nicht zufrieden, im Gegenteil, ich will immer mehr. Ich dachte, in Sachen Hunger wüsste ich Bescheid, aber dies hier ist etwas ganz Neues.
Das erste Krachen des Gewitters - der Blitz, der um Mitternacht in den Baum einschlägt - bringt uns in die Wirklichkeit zurück. Auch Finnick wacht davon auf. Mit einem gellenden Schrei fährt er hoch. Er gräbt die Finger in den Sand und vergewissert sich, dass sein Albtraum nicht Wirklichkeit ist.
»Ich kann sowieso nicht mehr schlafen«, sagt er. »Einer von euch soll sich ausruhen.« Erst dann sieht er unsere Gesichter und dass wir eng umschlungen dasitzen. »Oder beide. Ich kann allein Wache halten.«
Doch das lässt Peeta nicht zu. »Zu gefährlich«, sagt er. »Ich bin nicht müde. Leg du dich hin, Katniss.« Ich protestiere nicht, denn wenn ich dafür sorgen soll, dass er am Leben bleibt, muss ich jetzt schlafen. Er begleitet mich zu den anderen. Dann legt er mir die Kette mit dem Medaillon um und hält seine Hand auf die Stelle, wo angeblich unser Baby heranwächst. »Du wirst bestimmt eine großartige Mutter«, sagt er. Er küsst mich ein letztes Mal und geht zurück zu Finnick.
Seine Bemerkung über das Baby zeigt mir, dass unsere Auszeit von den Spielen vorbei ist. Dass er weiß, dass die Zuschauer sich fragen, wieso er nicht das überzeugendste Argument eingesetzt hat, das ihm zur Verfügung steht. Dass die Sponsoren manipuliert werden müssen.
Oder steckt noch mehr dahinter?, frage ich mich, als ich mich in den Sand lege. Wollte er mich daran erinnern, dass ich eines Tages auch mit Gale Kinder haben könnte? Falls es das gewesen sein sollte, dann war es ein Fehler. Denn erstens hatte ich sowieso nie vor, Kinder zu bekommen. Und zweitens: Wenn einer von uns Kinder haben sollte, dann Peeta, das sieht jeder.
Während ich wegdämmere, versuche ich mir diese Welt vorzustellen, irgendwann in der Zukunft, ohne die Spiele, ohne das Kapitol. Ein Ort wie die Weide in dem Lied, das ich für Rue sang, als sie starb. Wo Peetas Kind in Sicherheit wäre.
25
Als ich aufwache, verspüre ich ein kurzes, köstliches Glücksgefühl, das irgendwie mit Peeta zusammenhängt. Ein absurdes Gefühl, natürlich, denn so, wie die Dinge stehen, werde ich innerhalb des nächsten Tages tot sein. Jedenfalls, wenn alles nach Plan läuft und ich die übrigen Mitspieler einschließlich meiner selbst eliminieren kann, damit Peeta zum Sieger des Jubel-Jubiläums gekürt wird. Trotzdem, dieses Gefühl kommt so unerwartet und ist so süß, dass ich es festhalte, wenn auch nur für wenige Augenblicke. Bis der grobe Sand, die heiße Sonne und meine juckende Haut mich zwingen, in die Wirklichkeit zurückzukehren.
Die anderen sind schon aufgestanden und beobachten einen Fallschirm, der gerade auf den Strand gesegelt kommt. Ich geselle mich zu ihnen. Wieder eine Lieferung Brot. Exakt das gleiche wie gestern Abend. Vierundzwanzig Brötchen aus Distrikt 3. Damit haben wir insgesamt dreiunddreißig. Jeder nimmt fünf, acht bleiben als Reserve. Nach dem nächsten Toten unter uns ließe sich acht prima teilen, aber das spricht keiner aus. Irgendwie ist der Scherz, wer noch da sein wird, um diese Brötchen zu essen, bei Tageslicht nicht mehr so witzig.
Wie lange können wir dieses Bündnis aufrechterhalten? Es hat wohl keiner damit gerechnet, dass die Anzahl der Tribute so schnell zusammenschmelzen würde. Was, wenn ich mich geirrt habe und die anderen Peeta gar nicht beschützen wollten? Wenn alles nur Zufall war oder Strategie, um unser Vertrauen zu gewinnen, uns zur leichten Beute zu machen, oder wenn ich überhaupt nicht durchblicke, was hier eigentiich vor sich geht? Halt, da gibt es nichts zu deuteln. Ich blicke tatsächlich nicht durch. Und deshalb ist es höchste Zeit für Peeta und mich, von hier zu verschwinden.
Ich setze mich neben Peeta in den Sand und esse meine Brötchen. Aus irgendeinem Grund fällt es mir schwer, ihn anzuschauen. Vielleicht wegen der Küsserei gestern Abend, obwohl das Küssen ja eigentlich nichts Neues für uns ist. Für ihn hat es sich womöglich auch gar nicht anders angefühlt. Vielleicht liegt es auch an dem Wissen, dass uns nur noch so wenig Zeit bleibt. Und dass wir diametral entgegengesetzte Ziele verfolgen werden, sollten nur noch wir beide übrig bleiben.
Nach dem Essen nehme ich seine Hand und ziehe ihn zum Wasser. »Komm, ich bring dir Schwimmen bei.« Ich muss ihn von den anderen weglotsen, um in Ruhe zu besprechen, wie wir von hier verschwinden. Es wird nicht leicht werden, denn sobald die anderen mitbekommen, dass wir uns davonmachen wollen, werden wir umgehend von Verbündeten zu Gejagten.
Wenn ich ihm wirklich das Schwimmen beibringen wollte, müsste er den Gurt ausziehen, der ihn oben hält, aber was spielt das jetzt für eine Rolle? Ich zeige ihm also nur die grundlegenden Bewegungen und lasse ihn zur Übung in hüfthohem Wasser hin und her schwimmen. Anfangs, bemerke ich, lässt Johanna uns nicht aus den Augen, doch irgendwann verliert sie das Interesse und legt sich hin. Finnick knüpft aus Ranken ein neues Netz und Beetee spielt mit seinem Draht. Jetzt.
Während Peeta seine Schwimmübungen macht, fällt mir etwas auf. Der verbliebene Schorf beginnt sich zu lösen. Ich nehme etwas Sand und reibe damit vorsichtig über meinen Arm, bis ich die restliche Kruste abgerubbelt und die darunterliegende neue Haut freigelegt habe. Ich rufe Peeta und zeige ihm, wie auch er sich vom juckenden Schorf befreien kann, und als wir so schrubben, lenke ich das Gespräch auf die Flucht.
»Hör zu, jetzt sind wir nur noch zu acht. Ich denke, es ist Zeit abzuhauen«, flüstere ich, obwohl mich keiner der Tribute hören könnte.
Peeta nickt, und ich sehe, wie er über meinen Vorschlag nachdenkt. Abwägt, wie die Chancen für uns stehen. »Pass auf«, sagt er. »Lass uns hierbleiben, bis Brutus und Enobaria tot sind. Wenn ich richtigliege, tüftelt Beetee gerade an einer Falle für sie. Danach werden wir gehen, ich verspreche es.«
Ich bin nicht ganz überzeugt. Doch wenn wir jetzt gehen, sitzen uns zwei gegnerische Gruppen im Nacken. Vielleicht sogar drei, denn wer weiß, was Chaff im Schilde führt. Plus die Uhr, mit der wir zu kämpfen haben. Und dann ist da noch Beetee. Johanna hat ihn nur meinetwegen hergebracht, und wenn wir weg sind, wird sie ihn mit Sicherheit töten. Da fällt es mir wieder ein. Ich kann Beetee sowieso nicht beschützen. Es kann nur einen Sieger geben und das muss Peeta sein. Das muss ich akzeptieren. Alle Entscheidungen, die ich treffe, müssen auf sein Überleben ausgerichtet sein.
»In Ordnung«, sage ich. »Wir bleiben hier, bis die Karrieros tot sind. Aber dann ist Schluss.« Ich drehe mich um und winke Finnick zu. »He, Finnick, komm ins Wasser! Wir wissen jetzt, wie wir dich wieder schön machen können!«
Zu dritt scheuern wir uns die Krusten vom Körper, helfen einander mit dem Rücken, und als wir aus dem Wasser steigen, sind wir so rosig wie der Himmel. Noch einmal tragen wir die Salbe auf, weil die Haut so wirkt, als brauchte sie einen Sonnenschutz, doch auf weicher Haut sieht sie nicht halb so schlimm aus, und im Dschungel wird sie eine gute Tarnung sein.
Beetee ruft uns zu sich, und wir erfahren, dass er während all der Stunden, die er dagesessen und an seinem Draht gefummelt hat, tatsächlich einen Plan ausgeheckt hat. »Wir dürften uns einig sein, dass wir als Nächstes Brutus und Enobaria töten müssen«, sagt er sanft. »Ich glaube nicht, dass sie uns noch einmal offen angreifen werden, jetzt, da sie so in der Minderheit sind. Wir könnten uns wohl an ihre Fersen heften, aber das wäre gefährlich und anstrengend.«
»Meinst du, sie haben das mit der Uhr rausgekriegt?«, frage ich.
»Wenn nicht, werden sie es bald rauskriegen. Vielleicht nicht so exakt wie wir. Aber sie mussten wissen, dass zumindest einige Sektoren für Angriffe ausgerüstet sind und diese in regelmäßigen Abständen immer wieder auftreten. Und es wird ihnen nicht entgangen sein, dass unser letzter Kampf durch das Eingreifen der Spielmacher unterbunden wurde. Wir wissen, dass das ein Versuch war, uns die Orientierung zu nehmen, doch auch sie werden sich fragen, was der Grund dafür war, und am Schluss könnten sie zu der Erkenntnis gelangen, dass die Arena eine Uhr ist«, sagt Beetee. »Daher denke ich, dass wir ihnen am besten eine Falle stellen.«
»Warte, ich gehe Johanna holen«, sagt Finnick. »Sie wird stinksauer sein, wenn sie mitbekommt, dass wir ohne sie über so wichtige Dinge sprechen.«
»Oder auch nicht«, brumme ich in mich hinein, denn eigentlich ist sie immer sauer. Aber ich halte ihn nicht auf, denn wenn man mich in diesem Augenblick von einem Plan ausschließen würde, wäre ich auch ganz schön stinkig.
Als sie dazugestoßen ist, scheucht Beetee uns allesamt ein Stück zurück, damit er mehr Platz hat. Rasch zeichnet er einen Kreis in den Sand und unterteilt ihn in zwölf Segmente. Das ist die Arena, nicht mit Peetas präzisen Strichen, sondern mit den groben Strichen eines Mannes, der mit anderen, weit komplexeren Dingen beschäftigt ist. »Wenn ihr Brutus und Enobaria wärt und nun über den Dschungel Bescheid wusstest, wo würdet ihr euch am sichersten fühlen?«, fragt Beetee. Seine Stimme hat nichts Herablassendes, trotzdem erinnert er mich an einen Lehrer, der die Schüler zum Mitmachen animieren will. Vielleicht liegt es am Altersunterschied oder einfach daran, dass Beetee wahrscheinlich hunderttausendmal schlauer ist als wir anderen.
»Wo wir sind, am Strand«, sagt Peeta. »Das ist der sicherste Ort.«
»Und warum sind sie dann nicht am Strand?«, fragt Beetee.
»Weil wir hier sind«, sagt Johanna ungeduldig.
»Exakt. Wir sind hier und beanspruchen den Strand für uns. Und wo würdet ihr dann hingehen?«, fragt Beetee.
Ich denke an den tödlichen Dschungel, den besetzten Strand. »Ich würde mich am Rand des Dschungels verstecken. Dann könnte ich fliehen, wenn eine Attacke kommt. Und ich könnte uns ausspionieren.«
»Auch um zu essen«, sagt Finnick. »Im Dschungel wimmelt es von unbekannten Tieren und Pflanzen. Aber wer uns beobachtet, weiß, dass die Nahrung aus dem Meer sicher ist.«
Beetee lächelt uns an, als hätten wir seine Erwartungen übertroffen. »Sehr gut. Ihr habt’s begriffen. Jetzt hört euch meinen Vorschlag an: Wir schlagen um zwölf Uhr zu. Was passiert genau um Mittag und um Mitternacht?«
»Der Blitz schlägt in den Baum ein«, sage ich.
»Genau. Deshalb schlage ich vor, dass wir nach dem nächsten Mittagsblitz und vor dem Mitternachtsblitz meinen Draht von diesem Baum bis ins Salzwasser spannen, das, wie ihr wisst, ein sehr guter Leiter ist. Wenn der Blitz einschlägt, wird die Spannung über den Draht nicht nur ins Wasser geleitet, sondern auch in den umliegenden Strand, der noch von der Zehn-Uhr-Welle feucht sein wird. Jeder, der in diesem Augenblick Wasser oder Sand berührt, wird von dem Stromschlag getötet«, sagt Beetee.
Es entsteht eine längere Pause, in der wir Beetees Plan verdauen. Mir erscheint er fantastisch bis unmöglich. Aber warum eigentlich? Ich habe doch selbst unzählige Fallen gestellt. Ist das nicht einfach eine größere, ausgeklügeltere Falle? Kann sie vielleicht wirklich funktionieren? Dürfen wir das überhaupt infrage stellen, wir Tribute, die darauf abgerichtet sind, Fisch, Holz und Kohle zu gewinnen? Was wissen wir schon darüber, wie man die Kräfte des Himmels nutzbar macht?
Peeta hakt nach. »Hält der Draht das denn aus, so viel Energie weiterzuleiten, Beetee? Er sieht so zart aus, als würde er sofort durchschmoren …«
»Genau das wird er auch. Aber erst, nachdem der Strom hindurchgelaufen ist. Er funktioniert wie eine Sicherung. Nur, dass er Strom leitet«, sagt Beetee.
»Woher weißt du das?«, fragt Johanna, ganz und gar nicht überzeugt.
»Weil ich ihn erfunden habe«, sagt Beetee und klingt leicht überrascht. »Das ist kein herkömmlicher Draht. Genauso wenig, wie der Blitz ein natürlicher Blitz und der Baum ein natürlicher Baum ist. Du kennst dich am besten von uns allen mit Bäumen aus, Johanna. Er müsste doch inzwischen längst zerstört sein, oder?«
»Ja«, sagt sie mürrisch.
»Macht euch keine Sorgen um den Draht - er wird tun, was ich sage«, versichert Beetee uns.
»Und wo werden wir sein, wenn es passiert?«, fragt Finnick.
»Tief genug im Dschungel, dass uns nichts passieren kann«, antwortet Beetee.
»Aber dann kann den Karrieros auch nichts passieren, es sei denn, sie halten sich in der Nähe des Wassers auf«, werfe ich ein.
»Stimmt«, sagt Beetee.
»Aber das ganze Meeresgetier wird dabei doch gekocht«, sagt Peeta.
»Vermutlich mehr als gekocht«, sagt Beetee. »Ziemlich wahrscheinlich, dass wir diese Nahrungsquelle dabei vernichten. Aber du hast im Dschungel doch andere Dinge entdeckt, die man essen kann, nicht wahr, Katniss?«
»Ja. Nüsse und Ratten«, sage ich. »Und wir haben Sponsoren.«
»Na, dann sehe ich darin kein Problem«, sagt Beetee. »Aber da wir Verbündete sind und dieser Plan unsere vereinten Kräfte erfordert, liegt die Entscheidung darüber, ob wir es versuchen wollen oder nicht, bei euch vieren.«
Wir sind wie Schulkinder. Unser Horizont reicht gerade so weit, dass wir seine Theorie unter den elementarsten Gesichtspunkten betrachten können. Und die haben im Grunde gar nichts mit seinem eigentlichen Plan zu tun. Ich schaue in die ratlosen Gesichter der anderen. »Warum nicht?«, sage ich. »Wenn es schiefgeht, schadet’s nicht. Wenn es funktioniert, stehen die Chancen gut, dass sie getötet werden. Und selbst wenn uns das nicht gelingt und wir nur die Fische töten, verlieren Brutus und Enobaria auch eine Nahrungsquelle.«
»Ich sage, wir versuchen es«, sagt Peeta. »Katniss hat recht.«
Finnick hebt die Brauen und sieht Johanna an. Ohne sie wird er nicht zustimmen. »Also gut«, sagt sie schließlich. »Auf jeden Fall besser, als ihnen im Dschungel hinterherzujagen. Und ich glaube nicht, dass sie hinter unseren Plan kommen, wir kapieren ihn ja selbst kaum.«
Bevor Beetee an dem Baum herumbastelt, möchte er ihn in Augenschein nehmen. Dem Stand der Sonne nach ist es etwa neun Uhr morgens. Wir müssen unseren Strand sowieso bald verlassen. Also brechen wir das Lager ab, gehen hinüber zu dem Strand, der an den Gewittersektor grenzt, und dringen in den Dschungel ein. Beetee ist noch immer zu schwach, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu bewältigen, deshalb tragen Finnick und Peeta ihn abwechselnd. Ich überlasse Johanna die Führung, denn zum Baum geht es ziemlich geradeaus, sie könnte uns kaum in die Irre führen. Und ich kann mit einem Köcher voller Pfeile sehr viel mehr ausrichten als sie mit den beiden Äxten. Deshalb ist es am klügsten, wenn ich die Nachhut bilde.
Die dichte, feuchtwarme Luft lastet auf mir. Seit die Spiele begonnen haben, sind wir ihr ununterbrochen ausgesetzt. Mir wäre lieber, Haymitch würde statt Brot aus Distrikt 3 mal wieder welches aus Distrikt 4 schicken, in den letzten beiden Tagen habe ich eimerweise Schweiß vergossen, und trotz all des Fischs lechze ich nach Salz. Ein Stück Eis wäre auch nicht schlecht. Oder kaltes Wasser. Ich bin durchaus dankbar für die Flüssigkeit aus den Bäumen, doch sie hat die gleiche Temperatur wie das Salzwasser und die Luft und die anderen Tribute und ich. Wir sind allesamt ein großer warmer Eintopf.
Als wir uns dem Baum nähern, schlägt Finnick vor, dass ich die Führung übernehme. »Katniss kann das Kraftfeld hören«, erklärt er Beetee und Johanna.
»Hören?«, fragt Beetee.
»Nur mit dem Ohr, das im Kapitol wiederhergestellt wurde«, sage ich. Beetee kann ich mit der Story natürlich nicht kommen. Bestimmt erinnert er sich noch daran, dass er mir gezeigt hat, wie man ein Kraftfeld entdeckt, wahrscheinlich ist es sogar unmöglich, Kraftfelder zu hören. Aber er verkneift sich einen Kommentar, aus welchem Grund auch immer.
»Dann lasst unbedingt Katniss vorgehen«, sagt er, während er einen Augenblick stehen bleibt, um seine beschlagenen Brillengläser zu putzen. »Mit Kraftfeldern ist nicht zu spaßen.«
Der Gewitterbaum überragt die anderen so sehr, dass er nicht zu verfehlen ist. Ich suche mir ein Büschel mit Nüssen und lasse die anderen anhalten, während ich langsam den Hang hinaufgehe und Nüsse vor mich werfe. Doch ich sehe das Kraftfeld, noch ehe es von einer Nuss getroffen wird, es ist nur fünfzehn Meter entfernt. Ich entdecke die wellige Fläche hoch oben zu meiner Rechten, als ich die Wand aus Grün vor mir absuche. Ich werfe eine Nuss direkt vor mich und höre sie zur Bestätigung zischen.
»Haltet euch unter dem Gewitterbaum«, rufe ich den anderen zu.
Wir verteilen die Aufgaben. Finnick deckt Beetee, der den Baum untersucht, Johanna zapft Wasser, Peeta sammelt Nüsse, und ich gehe in der Nähe jagen. Die Baumratten scheinen keine Angst vor Menschen zu haben, ich erlege sie mühelos. Das Geräusch der Zehn-Uhr-Welle erinnert mich daran, dass es Zeit ist umzukehren, also gehe ich zurück zu den anderen und nehme die Beute aus. Zur Warnung ziehe ich ein paar Meter vor dem Kraftfeld eine Linie in den Boden, dann lassen Peeta und ich uns davor nieder, um Nüsse zu rösten und Rattenwürfel zu braten.
Beetee ist noch immer mit dem Baum beschäftigt, womit genau, weiß man nicht, er misst wohl irgendwas aus. Irgendwann reißt er ein Stück Rinde ab, kommt zu uns und wirft es Richtung Kraftfeld. Die Rinde prallt zurück und landet glühend auf dem Boden. Nach kurzer Zeit hat sie wieder ihre ursprüngliche Farbe angenommen. »Nun, das erklärt einiges«, sagt Beetee. Ich werfe Peeta einen Blick zu und muss mir auf die Lippe beißen, um nicht zu lachen. Das erklärt gar nichts, außer vielleicht für Beetee.
Da hören wir aus dem benachbarten Sektor die Klickgeräusche. Also ist es jetzt elf Uhr. Im Dschungel sind sie viel lauter als gestern Abend am Strand. Wir lauschen konzentriert.
»Mechanisch ist das nicht«, sagt Beetee entschieden.
»Ich tippe auf Insekten«, sage ich. »Käfer oder so.«
»Irgendwas mit Zangen«, meint Finnick.
Das Geräusch schwillt an, als würden unsere Worte die Nähe von lebendigem Fleisch verheißen. Was immer diese Geräusche verursacht, ich wette, es könnte uns in Sekundenschnelle bis auf die Knochen abnagen.
»Jedenfalls sollten wir zusehen, dass wir hier wegkommen«, sagt Johanna. »In weniger als einer Stunde kommt der Blitz.«
Weit gehen wir nicht. Nur bis zu dem Zwillingsbaum im Blutregensektor. Wir lassen uns zu einer Art Picknick nieder, essen unsere Dschungelnahrung und warten auf den Blitz, der anzeigt, dass es Mittag ist. Als das Klicken nachlässt, klettere ich auf Beetees Geheiß in die Baumkrone. Der Blitzeinschlag ist so grell, dass er selbst mich an meinem Platz blendet, trotz des gleißenden Sonnenlichts. Er umschließt den fernen Baum ganz, lässt ihn blauweiß erglühen und die Luft in der Umgebung elektrisch knistern. Ich klettere wieder hinunter und erstatte Beetee Bericht, der zufrieden wirkt, obwohl ich mich nicht sonderlich wissenschaftlich ausdrücke.
In einem Bogen gehen wir zurück zum Zehn-Uhr-Strand. Der Sand ist weich und feucht und von der jüngsten Welle gesäubert. Den Nachmittag gibt Beetee uns mehr oder weniger frei, während er mit dem Draht hantiert. Da es sich um seine Waffe handelt und wir anderen uns ganz auf sein Wissen verlassen, stellt sich das eigenartige Gefühl ein, als hätten wir früher Schulschluss. Anfangs legen wir uns abwechselnd am Rand des Dschungels in den Schatten und schlafen ein Ründchen, doch am späten Nachmittag sind alle wach und voller Anspannung. Da dies unsere letzte Gelegenheit sein könnte, an Meeresgetier zu kommen, beschließen wir, ein Festmahl auszurichten. Unter Finnicks Führung gehen wir mit dem Speer auf die Jagd nach Fischen und sammeln Muscheln, tauchen sogar nach Austern. Das gefällt mir am besten, aber nicht, weil ich so versessen auf Austern wäre. Ich habe nur einmal welche gegessen, damals im Kapitol, und konnte mich mit ihrer schleimigen Konsistenz einfach nicht anfreunden. Aber es ist schön so tief unten im Wasser, wie in einer anderen Welt. Das Wasser ist sehr klar und Schwärme von Fischen in leuchtenden Farben und merkwürdige Seeblumen zieren den Sandboden.
Johanna hält Wache, während Finnick, Peeta und ich unseren Fang säubern und bereitlegen. Peeta bricht eine Auster auf und muss lachen: »He, schaut euch das mal an!« Er hält eine glänzende, vollkommene Perle hoch, so groß wie eine Erbse. »Du weißt ja, wenn man nur genug Druck auf die Kohle ausübt, werden daraus Perlen«, sagt er ganz ernst zu Finnick.
»Stimmt doch gar nicht«, sagt Finnick abschätzig. Aber ich lache mich halb tot. Ich erinnere mich, wie die unbedarfte Effie Trinket uns letztes Jahr, als uns noch kein Mensch kannte und wir noch keine Berühmtheiten waren, den Zuschauern im Kapitol angepriesen hat. Als Kohle, die durch unsere gewichtige Existenz zu Perlen gepresst wurde. Schönheit, die aus Schmerz entstand.
Peeta spült die Perle im Wasser ab und reicht sie mir. »Für dich.« Ich lege sie auf meine Handfläche und betrachte die im Sonnenlicht schimmernde Oberfläche. Ja, ich werde sie behalten. In den wenigen Stunden, die mir in diesem Leben bleiben, werde ich sie bei mir tragen. Dieses letzte Geschenk von Peeta. Das einzige, das ich auch annehmen kann. Vielleicht gibt es mir im letzten Augenblick die nötige Kraft.
»Danke«, sage ich und schließe die Faust. Ungerührt schaue ich in die blauen Augen des Menschen, der nun mein größter Gegner ist; der mein Leben retten will, und wenn es seins kostet. Und ich gebe mir das Versprechen, dass ich seinen Plan durchkreuzen werde.
Aus seinen Augen weicht das Lachen, und er schaut mich so intensiv an, als könnte er meine Gedanken lesen. »Das Medaillon hat nicht gewirkt, was?«, sagt Peeta, obwohl Finnick dabeisteht. Obwohl jeder ihn hören kann. »Katniss?«
»Es hat gewirkt«, sage ich.
»Aber nicht so, wie ich wollte«, sagt er und wendet den Blick ab. Er hat jetzt nur noch Augen für die Austern.
Als wir uns über das Essen hermachen wollen, kommt ein Fallschirm mit zwei Anhängseln herabgesegelt. Ein kleiner Topf mit einer scharfen roten Soße und noch mehr Brötchen aus Distrikt 3. Finnick zählt sie natürlich sofort durch. »Wieder vierundzwanzig«, sagt er.
Macht insgesamt zweiunddreißig Brötchen. Jeder nimmt wieder fünf, sieben bleiben übrig, die wir niemals gerecht aufteilen können. Brot für den einen, der übrig bleiben wird.
Das salzige Fischfleisch, die saftigen Muscheln. Sogar die Austern schmecken, vor allem jetzt mit der Soße. Wir schlagen uns die Bäuche voll, bis keiner mehr papp sagen kann, trotzdem schaffen wir nicht alles. Aber die Reste werden sich nicht halten, deshalb werfen wir sie zurück ins Wasser, damit die Karrieros sie sich nicht unter den Nagel reißen, wenn wir fort sind.
Keiner achtet auf die Muschelschalen. Die Welle wird sie wegschwemmen.
Jetzt können wir nur noch warten. Peeta und ich sitzen am Wasser, Hand in Hand, wortlos. Er hat gestern Abend seine letzte Rede gehalten, doch sie hat bei mir nicht zu einem Sinneswandel geführt, und nichts, was ich sagen könnte, wird bei ihm einen Sinneswandel bewirken. Für überzeugende Geschenke ist es jetzt zu spät.
Trotzdem habe ich die Perle zusammen mit dem Zapfhahn und der Salbe in einen Fallschirm gewickelt und mit Ranken an meine Hüfte gebunden. Ich hoffe, sie schafft es zurück nach Distrikt 12.
Meine Mutter und Prim werden schon einen Weg finden, sie Peeta zurückzugeben, bevor ich begraben werde.
26
Die Hymne erklingt, doch heute Abend erscheinen keine Gesichter am Himmel. Die Zuschauer werden ungeduldig sein, sie dürsten nach Blut. Aber Beetees Falle ist so vielversprechend, dass die Spielmacher keine weiteren Attacken gestartet haben. Vielleicht sind sie einfach neugierig darauf, wie sie funktioniert.
Als Finnick und ich meinen, es ist neun Uhr, verlassen wir alle gemeinsam das mit Muschelschalen übersäte Lager, gehen hinüber zum Zwölf-Uhr-Strand und machen uns im Mondschein heimlich, still und leise auf den Weg zum Gewitterbaum. Mit vollem Bauch sind wir alle kurzatmig und der Aufstieg fällt uns schwerer als am Morgen. Ich bereue schon das letzte Dutzend Austern.
Beetee möchte, dass Finnick ihm hilft, die anderen halten Wache. Bevor Beetee den Draht am Baum befestigt, wickelt er mehrere Meter ab. Finnick soll sie an einem abgebrochenen Ast festbinden und diesen auf den Boden legen. Dann stellen sie sich rechts und links vom Baum auf und reichen sich abwechselnd die Spule, sodass der Draht viele Male um den Baumstamm gewickelt wird. Erst sieht es planlos aus, dann erkenne ich im Mondlicht auf Beetees Seite ein Muster, wie ein kompliziertes Labyrinth. Ich frage mich, ob es von Bedeutung ist, wie der Draht angebracht wird, oder ob das nur dazu dient, die Spekulationen der Zuschauer anzuheizen. Die meisten von ihnen dürften von Elektrizität genauso wenig Ahnung haben wie ich.
Die Arbeit am Baumstamm ist just in dem Augenblick beendet, als wir die Welle hören. Ich habe bisher nicht herausgefunden, wann genau sie hervorbricht. Irgendwo muss sie sich aufbauen, dann bricht sie hervor, und dann kommen die Nachwirkungen. Der Himmel sagt mir, dass es halb elf ist.
Jetzt verrät Beetee uns, wie es weitergehen soll. Weil Johanna und ich die wendigsten sind, sollen wir die Rolle durch den Dschungel nach unten tragen und unterwegs den Draht abwickeln, ihn quer über den Zwölf-Uhr-Strand verlegen und die Metallrolle mit dem restlichen Draht tief im Wasser versenken. Anschließend wieder in den Dschungel zurückrennen. Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, und zwar sofort, mussten wir auf der sicheren Seite sein.
»Ich möchte als Wache mitgehen«, sagt Peeta sofort. Nach der Sache mit der Perle ist er noch weniger bereit, mich aus den Augen zu lassen.
»Du bist zu langsam. Und außerdem brauche ich dich an diesem Ende. Katniss passt schon auf«, sagt Beetee. »Wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren. Tut mir leid. Wenn die Mädchen lebend da rauskommen sollen, müssen sie jetzt los.« Er gibt Johanna die Rolle.
Mir gefällt der Plan genauso wenig wie Peeta. Wie soll ich ihn aus der Entfernung beschützen? Aber Beetee hat recht. Mit seinem Bein ist Peeta zu langsam, er würde den Abhang nicht schnell genug schaffen. Johanna und ich sind die Schnellsten und haben den sichersten Tritt auf dem Dschungelboden. Ich sehe keine Alternative. Und wenn ich hier irgendwem traue außer Peeta, dann ist es Beetee.
»Das geht in Ordnung«, sage ich zu Peeta. »Wir werfen nur schnell die Rolle ins Wasser und kommen sofort wieder rauf.«
»Aber nicht ins Blitzgebiet«, erinnert mich Beetee. »Rennt zu dem Baum im Ein-bis-zwei-Sektor. Wenn ihr merkt, dass euch nicht genug Zeit bleibt, rückt eins weiter. Aber geht bloß nicht zurück zum Strand, bevor ich den Schaden in Augenschein genommen habe.«
Ich nehme Peetas Gesicht in meine Hände. »Mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns um Mitternacht.« Ich küsse ihn, und ehe er noch etwas einwenden kann, lasse ich ihn los und frage Johanna: »Fertig?«
»Wieso nicht?«, sagt Johanna achselzuckend. Sie ist augenscheinlich nicht erfreuter als ich, dass wir zusammenarbeiten sollen. Aber wir sind alle in Beetees Falle gefangen. »Du passt auf, ich wickele ab. Später können wir mal tauschen.«
Ohne weitere Diskussion machen wir uns auf den Weg. Wir reden überhaupt nicht viel. So schnell es geht, rennen wir den Abhang hinunter, die eine mit der Rolle, die andere Ausschau haltend. Auf halber Strecke hören wir plötzlich das Klicken, es ist also nach elf.
»Lass uns schnell machen«, sagt Johanna. »Ich möchte so weit wie möglich vom Wasser weg sein, wenn der Blitz einschlägt. Nur für den Fall, dass Minus falsch gerechnet hat.«
»Jetzt nehme ich mal die Rolle«, sage ich. Es ist anstrengender, den Draht abzuwickeln, als Ausschau zu halten, und sie hat das jetzt schon lange genug gemacht.
»Bitte sehr«, sagt Johanna und reicht mir die Rolle.
In dem Augenblick, als unsere beiden Hände die Rolle halten, spüren wir ein leichtes Vibrieren. Plötzlich schnellt der dünne goldene Draht von oben zu uns herunter und windet sich um unsere Handgelenke. Das lose Ende schlängelt sich zu unseren Füßen.
Es dauert keine Sekunde, bis wir begriffen haben, was los ist. Johanna und ich schauen uns an, doch keine von uns muss es aussprechen. Jemand, der nicht allzu weit entfernt sein kann, hat den Draht durchtrennt. Und dieser Jemand wird sich jeden Moment auf uns stürzen.
Ich befreie meine Hand aus dem Draht und schließe sie gerade um die Federn eines Pfeils, als mir jemand mit voller Wucht einen Gegenstand gegen den Kopf schlägt. Als Nächstes merke ich, dass ich auf dem Rücken in den Ranken liege und meine rechte Schläfe schrecklich wehtut. Irgendwas stimmt nicht mit meinen Augen. Immer wieder verschwimmt das Bild, als ich versuche, die beiden Monde am Himmel in Deckung zu bringen. Das Atmen fällt mir schwer, und plötzlich sehe ich auch, warum. Johanna sitzt auf meiner Brust und drückt mit den Knien meine Schultern auf den Boden.
Da spüre ich ein Stechen im linken Unterarm. Ich versuche Johanna abzuschütteln, aber ich bin immer noch nicht recht bei Sinnen. Johanna gräbt die Spitze ihres Messers - zumindest nehme ich an, dass es das ist - ins Fleisch meines Unterarms und dreht sie hin und her. Ich spüre ein unerträgliches Reißen, dann rinnt etwas Warmes an meinem Handgelenk herunter und sammelt sich in meiner Handfläche. Johanna drückt meinen Arm nach unten und schmiert mir das halbe Gesicht mit Blut ein.
»Unten bleiben!«, faucht sie. Plötzlich spüre ich nicht länger ihr Gewicht auf mir, ich bin allein.
Unten bleiben?, denkeich. Was soll das? Was ist los? Ich schließe die Augen, sperre die schwankende Welt aus und versuche mir einen Reim auf meine Lage zu machen.
Ich muss daran denken, wie Johanna Wiress auf den Sand stieß. »Einfach unten bleiben, kapiert?« Aber damals hat sie Wiress ja nicht angegriffen. Zumindest nicht so. Und ich bin ja auch nicht Wiress. Ich bin nicht Plus. »Einfach unten bleiben, kapiert?«, echot es in meinem Kopf.
Schritte kommen näher. Zwei Paar. Schwer, versuchen nicht, sich zu verstecken.
Brutus’ Stimme. »Da, die ist so gut wie tot! Weiter, Enobaria!« Schritte, die sich in der Nacht verlieren.
Und ich? Ich dämmere zwischen Bewusstsein und Ohnmacht und suche nach einer Antwort. Bin ich so gut wie tot? Meine Lage erlaubt mir nicht, zu widersprechen. Überhaupt kann ich nur mit Mühe einen klaren Gedanken fassen. So viel steht fest. Johanna hat mich attackiert. Mir diese Drahtrolle an den Kopf geschleudert. In meinen Arm geschnitten und meinen Adern wahrscheinlich irreparable Schäden zugefügt, doch bevor sie mich erledigen konnte, sind Brutus und Enobaria aufgetaucht.
Das Bündnis ist Vergangenheit. Finnick und Johanna müssen sich abgesprochen haben, dass sie heute Nacht über uns herfallen. Ich hab’s doch gesagt, dass wir uns heute Morgen hätten absetzen müssen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite Beetee steht. Aber ich bin eine leichte Beute, genau wie Peeta.
Peeta! Panisch reiße ich die Augen auf. Peeta wartet oben am Baum, völlig arglos. Vielleicht hat Finnick ihn bereits getötet. »Nein«, flüstere ich. Den Draht haben die Karrieros ganz in der Nähe durchtrennt. Finnick und Peeta und Beetee - sie können nicht wissen, was hier unten vor sich geht. Sie können sich nur fragen, was passiert ist, warum der Draht schlaff geworden ist, falls er sich nicht aufgrund der Zugspannung sogar um den Baum gewickelt hat. Das allein kann doch kein Zeichen sein, loszuschlagen, oder? Bestimmt hat Johanna allein beschlossen, dass es Zeit ist, mit uns zu brechen. Mich zu töten. Vor den Karrieros abzuhauen. Und dann Finnick so schnell wie möglich dazuzuholen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich zurück zu Peeta muss, um ihn zu retten. Mit letzter Willenskraft setze ich mich auf, ein Baumstamm ganz in der Nähe hilft mir, mich hochzurappeln. Ich bin heilfroh, dass ich etwas zum Anlehnen habe, denn der Dschungel schwankt hin und her. Ohne Vorwarnung beuge ich mich vor und erbreche das üppige Festmahl, so lange, bis keine einzige Auster in meinem Körper zurückgeblieben sein kann. Zitternd und schweißbedeckt prüfe ich meinen körperlichen Zustand.
Als ich meinen verletzten Arm hebe, spritzt mir das Blut ins Gesicht und die Welt kippt wieder bedenklich. Ich schließe die Augen und klammere mich an den Baum, bis meine Umgebung etwas stabiler geworden ist. Ich mache ein paar Schritte auf den Nachbarbaum zu, zupfe etwas Moos ab und wickele es fest um meinen Arm, ohne die Wunde näher zu untersuchen. Besser so. Es ist ganz sicher besser, wenn ich sie nicht anschaue. Dann erlaube ich meiner Hand, vorsichtig die Wunde am Kopf zu betasten. Eine große Beule, aber nur wenig Blut. Offenbar liegt der Schaden innen, aber Gefahr zu verbluten besteht wohl nicht. Zumindest nicht durch den Kopf.
Ich wische die Hände an Moos ab und greife mit dem verletzten linken Arm unsicher nach dem Bogen. Lege einen Pfeil in die Sehne ein. Befehle meinen Füßen, den Hang hinaufzustapfen.
Peeta. Mein letzter Wunsch. Mein Versprechen. Sein Leben zu retten. Ein bisschen leichter ums Herz wird mir, als mir einfällt, dass keine Kanone abgefeuert wurde und er also noch leben muss. Vielleicht hat Johanna auf eigene Faust gehandelt, weil sie wusste, dass Finnick sich ihr anschließen würde, wenn ihre Absichten erst mal klar wären. Obwohl man einfach nicht durchblickt, was zwischen den beiden läuft. Ich muss daran denken, wie er zu ihr hinsah und ihre Zustimmung abwartete, bevor er sich mit Beetees Falle einverstanden erklärte. Das Bündnis zwischen ihnen geht viel tiefer, es beruht auf jahrelanger Freundschaft und wer weiß was noch. Wenn Johanna mich angegriffen hat, darf ich Finnick nicht länger über den Weg trauen.
Ich bin kaum zu dieser Schlussfolgerung gelangt, da höre ich, wie jemand den Hang heruntergerannt kommt. Peeta oder Beetee können es nicht sein, so schnell sind sie nicht. Gerade noch rechtzeitig ducke ich mich hinter einem Vorhang aus Ranken. Finnick fliegt an mir vorbei, seine Haut ist fleckig von der Salbe, er springt durchs Unterholz wie ein Hirsch. Im Nu erreicht er den Ort der Attacke, jetzt muss er das Blut entdeckt haben. »Johanna! Katniss!«, ruft er. Ich rühre mich nicht vom Fleck, bis er fort ist, in die Richtung, die Johanna und die Karrieros eingeschlagen haben.
Ich bewege mich, so schnell ich kann, ohne dass die Welt sich wieder dreht. In meinem Kopf hämmert es im Rhythmus meines rasenden Herzschlags. Das Klicken der Insekten, die wahrscheinlich vom Blutgeruch erregt sind, schwillt in meinen Ohren zu einem steten Gebrüll an. Oder nein. Vielleicht klingeln mir auch die Ohren von dem Schlag mit der Drahtrolle. Ich werde erst Gewissheit haben, wenn die Insekten still sind. Doch wenn die Insekten verstummen, kommt der Blitz. Ich muss schneller laufen. Ich muss zu Peeta.
Der Knall einer Kanone lässt mich abrupt stehen bleiben. Einer ist gestorben. Jetzt, da alle bewaffnet und voller Angst durch die Gegend laufen, könnte es jeder sein. Aber wer immer es auch sein mag, sein Tod wird der Startschuss für ein allgemeines Gemetzel heute Nacht sein. Die Leute werden erst töten, über ihre Motive werden sie dann hinterher nachdenken. Ich zwinge meine Beine zu rennen.
Etwas verhakt sich in meinen Füßen und ich falle der Länge nach hin. Ich spüre, wie sich etwas um mich wickelt, und plötzlich bin ich in Fasern gefangen, die in die Haut schneiden. Ein Netz! Das muss eins von Finnicks tollen Netzen sein, die er ausgelegt hat, um mich zu fangen, und er wartet bestimmt schon ganz in der Nähe mit erhobenem Dreizack. Ich schlage wild um mich, wodurch ich mich nur noch mehr in dem Netz verheddere. Dann betrachte ich es im Mondlicht genauer. Verwirrt hebe ich den Arm und sehe, dass es aus schimmernden Goldfaden besteht. Das ist gar keins von Finnicks Netzen, das ist Beetees Draht. Vorsichtig stehe ich auf und stelle fest, dass ich über ein Stück Draht gestolpert bin, das sich an einem Baumstamm verheddert hat, als es zum Gewitterbaum zurückgeschnellt ist. Vorsichtig befreie ich mich, halte von nun an einen Sicherheitsabstand zum Draht ein und haste weiter bergauf.
Die gute Nachricht ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin und durch die Kopfverletzung immerhin nicht meinen Orientierungssinn verloren habe. Die schlechte ist das drohende Gewitter, an das der Draht mich erinnert hat. Noch höre ich die Insekten, aber sind sie nicht schon leiser geworden?
Beim Rennen halte ich mich an den Draht, der ein paar Meter links von mir in Schleifen daliegt, aber ich gebe gut acht, dass ich ihm nicht zu nah komme. Sobald die Insekten verstummen und der erste Blitz in den Baum einschlägt, wird er sich mit voller Wucht in diesen Draht entladen, und jeder, der damit in Berührung kommt, wird sterben.
Der Baum kommt in Sicht, sein Stamm ist wie mit Gold verziert. Ich bremse ab, versuche mich unauffällig zu bewegen, aber ich kann von Glück sagen, dass ich nicht umkippe. Ich suche nach Lebenszeichen der anderen. Nichts. Keiner da. »Peeta?«, rufe ich leise. »Peeta?«
Als Antwort kommt ein leises Stöhnen. Ich fahre herum und entdecke weiter oben auf dem Boden eine Gestalt. »Beetee!«, rufe ich. Ich renne zu ihm und knie hin. Das Stöhnen muss unwillkürlich gekommen sein. Er ist nicht bei Bewusstsein, obwohl ich keine Wunde sehe außer einem tiefen Schnitt unterhalb der Armbeuge. Ich klaube etwas Moos zusammen und verbinde damit provisorisch den Arm, während ich versuche, ihn wach zu rütteln: »Beetee! Beetee, was ist hier los? Woher hast du diese Wunde? Beetee!« Ich schüttele ihn, wie man einen Verletzten niemals schütteln sollte, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Er stöhnt wieder auf und hebt kurz die Hand, um mich abzuwehren.
Da erst bemerke ich das Messer in seiner Hand, ein Messer, das, soweit ich weiß, zuvor Peeta bei sich trug und das nun lose mit Draht umwickelt ist. Verdutzt stehe ich auf, ziehe an dem Draht und stelle fest, dass er mit dem Baum verbunden ist. Erst da fällt mir das zweite Stück Draht ein, das Beetee ganz am Anfang, bevor er sich dem Stamm widmete, um einen Ast gewickelt und Finnick gereicht hatte, damit der es auf den Boden legt. Ich hatte gedacht, das Stück hätte irgendeine Funktion für die Falle und Beetee wollte es später einbauen. Aber offenbar hatte er etwas anderes im Sinn, denn hier liegt es noch, gut zwanzig bis fünfundzwanzig Meter Draht.
Ein Blick den Hügel hinauf sagt mir, dass wir uns ganz in der Nähe des Kraftfelds befinden. Da ist die verräterische freie Stelle, weit rechts über mir, genau wie heute Morgen. Was hatte Beetee vor? Hat er tatsächlich versucht, das Messer in das Kraftfeld zu stoßen, wie Peeta, nur mit voller Absicht? Und was soll das mit dem Draht? War das sein Plan B? Wollte er für den Fall, dass es nicht gelingen sollte, das Wasser unter Strom zu setzen, die Blitzenergie ins Kraftfeld leiten? Was würde dann wohl geschehen? Nichts? Oder die Katastrophe? Würden wir alle gegrillt? Ich nehme an, dass auch das Kraftfeld hauptsächlich aus Energie besteht. Das im Trainingscenter war unsichtbar gewesen. Dieses hier scheint irgendwie den Dschungel widerzuspiegeln. Doch als es von Peetas Messer und meinen Pfeilen getroffen wurde, habe ich gesehen, wie es ins Wanken geriet. Die wahre Welt liegt gleich dahinter.
In meinen Ohren klingelt es nicht mehr. Also waren es die Insekten. Das weiß ich jetzt, weil sie rasch leiser werden und ich nur noch die üblichen Dschungelgeräusche höre. Beetee ist keine Hilfe. Ich bekomme ihn einfach nicht wach. Ich kann ihn nicht retten. Ich weiß nicht, was er mit dem Messer und dem Draht vorhatte, und er ist nicht in der Lage, es mir zu erklären. Die Moosbandage um meinen Arm hat sich mit Blut vollgesogen, ich brauche mir nichts vorzumachen. Ich bin so benommen, dass ich in den nächsten Minuten das Bewusstsein verlieren werde. Ich muss machen, dass ich von diesem Baum wegkomme, und - »Katniss!« Ich höre seine Stimme, obwohl er weit weg ist. Was tut er denn da? Auch Peeta muss doch inzwischen begriffen haben, dass jetzt alle hinter uns her sind. »Katniss!«
Ich kann ihn nicht beschützen. Ich kann mich weder schnell noch weit bewegen, und meine Schießkünste sind bestenfalls fragwürdig. Ich tue das Einzige, womit ich die Aufmerksamkeit der Angreifer von ihm abziehen und auf mich lenken kann. »Peeta!«, schreie ich. »Peeta! Ich bin hier! Peeta!« Ja, ich werde sie anlocken, alle her zu mir, weg von Peeta, zu mir und dem Gewitterbaum, der bald selbst zur Waffe werden wird. »Ich bin hier! Ich bin hier!« Er wird es nicht schaffen. Nicht mit seinem Bein bei Dunkelheit. Er wird es nie und nimmer rechtzeitig schaffen. »Peeta!«
Es funktioniert. Ich höre sie kommen. Sie sind zu zweit. Sie brechen durch den Dschungel. Meine Knie geben nach und ich sacke neben Beetee zusammen, mein Gewicht ruht auf den Fersen. Ich hebe Pfeil und Bogen. Wenn ich sie erledige, wird Peeta die Übrigen überleben?
Enobaria und Finnick erreichen den Gewitterbaum. Sie können mich nicht sehen, weil ich oberhalb von ihnen sitze, am Hang, und durch die Salbe auf meiner Haut getarnt bin. Ich ziele auf Enobarias Hals. Wenn ich Glück habe, wird Finnick sich, sobald ich sie getötet habe, genau in dem Augenblick hinter dem Gewitterbaum verschanzen, wenn der Blitz einschlägt. Und das wird jeden Moment geschehen. Nur noch vereinzeltes Klicken der Insekten. Ich kann sie jetzt töten. Ich kann sie beide töten.
Noch ein Kanonendonner.
»Katniss!« Peeta schreit meinen Namen. Aber diesmal antworte ich nicht. Neben mir atmet Beetee immer noch schwach. Er und ich werden gleich sterben. Finnick und Enobaria werden sterben. Peeta ist am Leben. Zwei Kanonen sind abgefeuert worden. Brutus, Johanna, Chaff. Zwei von ihnen sind bereits tot. Peeta braucht dann nur noch einen Tribut zu töten. Mehr kann ich nicht für ihn tun. Ein Feind.
Feind. Feind. Das Wort zerrt an einer frischen Erinnerung. Zieht sie in mein Bewusstsein. Der Ausdruck auf Haymitchs Gesicht. »Katniss, wenn du in der Arena bist …« Der finstere Blick, die Zweifel. »Was dann?« Ich höre, wie meine Stimme schärfer wird, gereizt wegen des unausgesprochenen Vorwurfs. »Dann vergiss nicht, wer der Feind ist«, sagt Haymitch. »Das ist alles.«
Haymitchs letzter Rat für mich. Wieso sollte er mich daran erinnern müssen? Ich habe immer gewusst, wer der Feind ist. Der, der uns hungern lässt und quält und in der Arena tötet. Der bald alle töten wird, die ich liebe.
Ich lasse den Bogen sinken, als mir der Sinn seiner Worte klar wird. Ja, ich weiß, wer der Feind ist. Und es ist nicht Enobaria.
Endlich sehe ich klar und deudich, was es mit Beetees Messer auf sich hat. Mit zitternden Händen schiebe ich den Draht vom Griff des Messers, wickele ihn genau unterhalb der Federn um den Pfeil und sichere ihn mit einem Knoten, den ich beim Training gelernt habe.
Ich stehe auf, wende mich dem Kraftfeld zu. Ich zeige mich in voller Größe, aber das ist mir jetzt egal. Ich konzentriere mich einzig und allein darauf, wohin ich die Spitze richten muss, wohin Beetee das Messer geworfen hätte, wenn er gekonnt hätte. Ich richte den Bogen auf das flimmernde Viereck, die Schwachstelle, den … wie hat er es damals genannt? Den wunden Punkt. Ich schieße den Pfeil ab, sehe, wie er sein Ziel trifft und mit dem goldenen Faden im Schlepptau verschwindet.
Im selben Augenblick stehen mir plötzlich buchstäblich die Haare zu Berge und der Blitz schlägt in den Baum ein.
Ein weißer Lichtstrahl rast den Draht entlang und einen Augenblick lang erstrahlt die Kuppel in grellblauem Licht. Ich werde rückwärts zu Boden geschleudert, mein Körper reglos, gelähmt, die Augen aufgerissen, während kleine flauschige Stückchen auf mich herabregnen. Ich kann nicht zu Peeta. Ich kann nicht mal meine Perle hervorholen. Meine Augen weiten sich, um ein letztes Bild der Schönheit einzufangen, das ich mitnehmen werde.
Kurz bevor die Explosionen einsetzen, entdecke ich einen Stern.
27
Alles scheint auf einmal zu explodieren. Die Erde zerplatzt in Schauern aus Schmutz und Pflanzenteilen. Bäume werden zu Fackeln. Sogar der Himmel füllt sich mit leuchtend bunten Lichtblüten. Ich begreife nicht, weshalb der Himmel beschossen wird, bis mir der Gedanke kommt, dass die Spielmacher ein Feuerwerk abschießen, zur Untermalung der Zerstörung, die sich am Boden abspielt. Nur für den Fall, dass es nicht unterhaltsam genug ist, die Vernichtung der Arena und der verbliebenen Tribute anzuschauen. Vielleicht soll auch unser blutiges Ende hell erleuchtet werden.
Werden sie einen von uns überleben lassen? Wird es einen Sieger der fünfundsiebzigsten Hungerspiele geben? Diesmal womöglich nicht. Denn gedacht ist dieses Jubel-Jubiläum … Wie las es Präsident Snow noch von seiner Karte ab? »… als Erinnerung für die Rebellen daran, dass nicht einmal die Stärksten unter ihnen die Macht des Kapitols überwinden können.«
Nicht mal der Stärkste der Starken wird triumphieren. Vielleicht war es nie geplant, dass diese Spiele überhaupt einen Sieger haben. Oder vielleicht hat mein letzter Akt der Auflehnung sie in Zugzwang gebracht?
Tut mir leid, Peeta, denke ich. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Ihn retten? Als ich das Kraftfeld zerstörte, habe ich ihn wahrscheinlich noch um seine letzte Chance gebracht.
Hätten wir uns alle an die Spielregeln gehalten, hätten sie ihn vielleicht am Leben gelassen.
Ohne Vorwarnung erscheint das Hovercraft über mir. Wäre es still gewesen und ein Spotttölpel in der Nähe, dann hätte ich vielleicht gehört, wie der Dschungel verstummt wäre, und dann den Vogelschrei, der das Erscheinen der Luftfähre ankündigt, die vom Kapitol geschickt wurde. Aber in all dem Krach muss ein so zartes Geräusch untergehen.
Der Greifer wird aus der Luke an der Unterseite gefahren, bis er direkt über mir hängt. Die stählernen Zähne schieben sich unter mich. Ich möchte schreien, weglaufen, mir einen Weg bahnen, doch ich bin wie erstarrt und kann nichts tun, als inständig zu hoffen, dass ich sterbe, bevor ich die schemenhaften Gestalten erreicht habe, die mich dort oben erwarten. Sie haben mein Leben nicht verschont, um mich zum Sieger zu küren, sondern damit ich so langsam und öffentlich sterbe wie möglich.
Meine schlimmsten Befürchtungen werden bestätigt, als Plutarch Heavensbee persönlich mich willkommen heißt, der Oberste Spielmacher. Was habe ich nur angerichtet mit diesen schönen Spielen mit der ausgeklügelten Uhr und der Siegerschar. Er wird für sein Versagen bezahlen müssen, wahrscheinlich wird er mit dem Leben bezahlen, aber vorher wird er mich bestrafen. Er streckt die Hand aus - um mich zu schlagen, denke ich, aber dann tut er etwas, das noch schlimmer ist. Mit Daumen und Zeigefinger schließt er meine Lider und verurteilt mich zur Finsternis. Jetzt bin ich schutzlos, sie können alles mit mir anstellen und ich werde es nicht einmal kommen sehen.
Mein Herz pocht so heftig, dass das Blut unter meinem vollgesogenen Moosverband heraussickert. Mein Denken wird vernebelt. Wahrscheinlich werde ich verblutet sein, ehe sie mich wiederbelebt haben. Ich danke Johanna still für die perfekte Wunde, die sie mir beigebracht hat, dann werde ich ohnmächtig.
Als ich langsam wieder zu Bewusstsein komme, liege ich auf einem gepolsterten Tisch. Ich spüre das Zwicken von Schläuchen in meinem linken Arm. Sie versuchen, mich am Leben zu erhalten, denn wenn ich heimlich, still und leise in den Tod hinübergleiten würde, hätte ich ja gewonnen. Ich kann mich immer noch nicht rühren, die Augen öffnen oder den Kopf heben. Dafür ist ein bisschen Kraft in meinen rechten Arm zurückgekehrt. Er hängt schlaff über meinem Körper, wie eine Flosse, nein, lebloser, wie eine Keule. Ich habe keine Koordination, keinen Beweis, dass ich noch Finger besitze. Immerhin schaffe ich es, den Arm so weit zu bewegen, dass ich die Schläuche herausreiße. Ein Piepsen ertönt, doch ich bleibe nicht lange genug bei Bewusstsein, um mitzubekommen, wen es herbeiruft.
Als ich das nächste Mal zu mir komme, sind meine Hände am Tisch festgebunden und die Schläuche stecken wieder in meinem Arm. Dafür kann ich die Augen öffnen und den Kopf etwas heben. Ich befinde mich in einem großen, in silbriges Licht getauchten Raum mit niedriger Decke. Zwei Reihen Betten stehen einander gegenüber. Ich höre ein Atmen, das vermutlich von den anderen Mitspielern stammt. Direkt gegenüber erkenne ich Beetee, der an mindestens zehn Apparate angeschlossen ist. Lasst uns doch einfach sterben!, schreie ich innerlich. Ich schlage den Kopf, so fest ich kann, gegen den Tisch und sacke wieder weg.
Als ich endgültig aufwache, sind die Fesseln nicht mehr da. Ich hebe die Hand und sehe, dass meine Finger mir wieder gehorchen. Mit einem Ruck setze ich mich auf und halte mich an dem gepolsterten Tisch fest, bis ich den Raum scharf sehe. Mein linker Arm ist verbunden, die Schläuche baumeln an Gestellen neben dem Bett.
Ich bin allein, nur Beetee liegt noch immer mir gegenüber und wird durch ein Heer von Apparaten am Leben erhalten. Aber wo sind die anderen? Peeta, Finnick, Enobaria und … und … noch einer, oder? Entweder Johanna oder Chaff oder Brutus waren noch am Leben, als es mit den Bomben losging. Ich bin sicher, dass sie an uns allen ein Exempel statuieren wollen. Aber wohin haben sie sie gebracht? Aus dem Krankenhaus ins Gefängnis?
»Peeta …«, flüstere ich. Ich hätte ihn so gern beschützt. Bin immer noch fest dazu entschlossen. Wenn es mir schon nicht gelungen ist, ihm ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen, muss ich ihn jetzt finden und töten, bevor das Kapitol eine sadistische Todesart für ihn ausgewählt hat. Ich schwinge die Beine vom Tisch und sehe mich nach einer Waffe um. Auf einem Tisch neben Beetees Bett liegen ein paar steril verpackte Spritzen. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Luft, und dann hinein damit in seine Vene.
Ich halte einen Moment inne und überlege, ob ich auch Beetee töten soll. Aber dann fangen bestimmt die Monitore an zu piepsen, und ich werde geschnappt, bevor ich Peeta gefunden habe. Ich leiste das stille Versprechen, dass ich zurückkommen und ihn töten werde, falls ich kann.
Ich trage nur ein dünnes Nachthemd, darunter bin ich nackt. Deshalb verstecke ich die Spritze unter dem Verband, der die Wunde an meinem Arm bedeckt. Die Tür ist unbewacht. Bestimmt bin ich Kilometer unter dem Trainingscenter oder an irgendeinem Stützpunkt des Kapitols und die Chancen auf Flucht sind gleich null. Egal. Ich will nicht fliehen, ich will nur meine Aufgabe zu Ende fuhren.
Ich schleiche einen schmalen Flur entlang bis zu einer angelehnten Metalltür. Dahinter ist jemand. Ich hole die Spritze hervor und halte sie ganz fest. Ich drücke mich gegen die Wand und lausche auf die Stimmen in dem Raum.
»Kein Kontakt zu 7, 10 und 12. Dafür hat 11 inzwischen die Verkehrswege unter Kontrolle, jetzt haben wir zumindest Hoffnung, dass sie ein paar Lebensmittel rausschaffen können.«
Plutarch Heavensbee. Denke ich sofort. Obwohl ich eigentlich nur einmal mit ihm gesprochen habe. Eine heisere Stimme stellt eine Frage.
»Nein, tut mir leid. Ich kann dich auf keinen Fall nach 4 bringen. Aber ich habe einen Sonderbefehl gegeben, sie rauszuholen, falls möglich. Mehr kann ich nicht tun, Finnick.«
Finnick. Mein Hirn müht sich, den Sinn der Unterhaltung zu begreifen, die Tatsache, dass sie zwischen Plutarch Heavensbee und Finnick stattfindet. Ist er dem Kapitol so lieb und teuer, dass er von seinen Verbrechen freigesprochen wird? Oder hatte er wirklich keine Ahnung, was Beetee vorhatte? Krächzend fügt er etwas hinzu. Etwas Gewichtiges, voller Verzweiflung.
»Sei nicht töricht. Das ist das Schlimmste, was du tun könntest. Das wäre ihr sicherer Tod. Solange Au am Leben bist, werden sie sie am Leben lassen, als Köder«, sagt Haymitch.
Haymitch! Ich platze durch die Tür und taumele in den Raum. Haymitch, Plutarch und ein übel zugerichteter Finnick sitzen um einen Tisch, auf dem eine Mahlzeit steht, die keiner angerührt hat. Tageslicht fällt durch die gewölbten Fenster und in der Ferne sehe ich einen Wald - von oben. Wir fliegen.
»Na, hast du dich selbst ausgeknockt, Süße?«, fragt Haymitch, und der Verdruss in seiner Stimme ist nicht zu überhören. Doch als ich vorwärtsstürze, springt er auf, packt meine Handgelenke und hält mich fest. Er schaut auf meine Hand. »Ach nee, du und eine Spritze gegen das Kapitol? Jetzt weißt du, warum keiner dich mit der Planung betraut.« Ich starre ihn an und begreife nicht. »Lass fallen.« Ich spüre, dass der Druck auf mein rechtes Handgelenk zunimmt, bis ich notgedrungen die Hand öffne und die Spritze loslasse. Er drückt mich auf einen Stuhl neben Finnick.
Plutarch stellt mir eine Schale mit Brühe hin. Legt ein Brötchen dazu. Steckt mir einen Löffel in die Hand. »Iss«, sagt er viel freundlicher als Haymitch.
Haymitch sitzt mir direkt gegenüber. »Ich erklär dir jetzt, was passiert ist, Katniss. Und du stellst keine Fragen, ehe ich fertig bin. Hast du verstanden?«
Ich nicke wie betäubt. Und dann legt er los.
Schon von dem Moment an, da das Jubel-Jubiläum verkündet wurde, bestand der Plan, uns dort herauszuholen. Die Siegertribute aus den Distrikten 3, 4, 6, 7, 8 und 11 waren eingeweiht, manche mehr, manche weniger. Plutarch Heavensbee gehört seit mehreren Jahren einer Untergrundorganisation an, deren Ziel es ist, das Kapitol zu stürzen. Er hat dafür gesorgt, dass Draht unter den Waffen war. Beetees Aufgabe war es, ein Loch in das Kraftfeld zu sprengen. Das Brot, das wir in die Arena geschickt bekamen, war ein geheimer Code für den Zeitpunkt der Rettung. Der Distrikt, aus dem das Brot kam, zeigte den Tag an: drei. Die Anzahl der Brötchen die Uhrzeit: vierundzwanzig. Das Hovercraft stammt aus Distrikt 13. Bonnie und Twill, die Frauen aus Distrikt 8, denen ich im Wald begegnet bin, hatten recht mit ihrer Vermutung, dass Distrikt 13 existiert und besondere Verteidigungswaffen besitzt. In diesem Augenblick fliegen wir auf Umwegen nach Distrikt 13. Mittlerweile befinden sich fast alle Distrikte Panems in Aufruhr.
Haymitch unterbricht sich. Er schaut, ob ich folgen kann. Vielleicht ist er auch nur etwas erschöpft.
Es ist verdammt viel, was ich verstehen soll, dieser ausgefeilte Plan, in dem ich eine Spielfigur war, so wie ich eine Figur bei den Hungerspielen sein sollte. Ohne meine Zustimmung, ohne mein Wissen. Nur dass ich bei den Hungerspielen wenigstens wusste, dass ich ihr Spielball war.
Meine angeblichen Freunde waren deutlich geheimniskrämerischer.
»Ihr habt mir nichts davon gesagt.« Meine Stimme klingt genauso ramponiert wie Finnicks.
»Weder du noch Peeta seid eingeweiht worden. Das Risiko wäre zu groß gewesen«, sagt Plutarch. »Ich hatte sogar Angst, du könntest während der Spiele die Unbesonnenheit mit meiner Uhr erwähnen.« Er holt seine Taschenuhr hervor und fährt mit dem Daumen über das Glas, sodass der Spotttölpel aufleuchtet. »Ich wollte dir natürlich einen Tipp über die Arena geben. Dir als Mentor. Ich dachte, es wäre ein erster Schritt, dein Vertrauen zu gewinnen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass du noch mal ein Tribut werden würdest.«
»Ich verstehe immer noch nicht, weshalb Peeta und ich nicht in den Plan eingeweiht wurden«, sage ich.
»Weil ihr beide die Ersten gewesen wärt, die sie zu fangen versucht hätten, nachdem das Kraftfeld in die Luft gegangen wäre. Es war besser, ihr wusstet so wenig wie möglich«, sagt Haymitch.
»Die Ersten? Warum?« Ich versuche seinem Gedankengang zu folgen.
»Aus dem gleichen Grund, aus dem wir anderen einwilligten zu sterben, damit ihr am Leben bleibt«, sagt Finnick.
»Stimmt nicht. Johanna hat versucht, mich zu töten«, sage ich.
»Johanna hat dich k.o. geschlagen, um den Aufspürer aus deinem Arm herauszuschneiden und Brutus und Enobaria von dir abzulenken«, sagt Haymitch.
»Was?« Mein Kopf tut unheimlich weh, sie sollen aufhören, so viel sinnloses Zeug zu reden. »Was willst du damit …«
»Wir mussten dich retten, weil du der Spotttölpel bist, Katniss«, sagt Plutarch. »Solange du lebst, lebt die Revolution.«
Der Vogel, die Brosche, das Lied, die Beeren, die Uhr, der Kräcker, das Kleid, das in Flammen aufgeht. Ich bin der Spotttölpel. Die, die den Plänen des Kapitols zum Trotz überlebt. Das Symbol der Rebellion.
Das war es, was ich vermutet hatte, als ich Bonnie und Twill auf der Flucht im Wald traf. Obwohl ich die Größenordnung nie richtig begriffen habe. Aber das sollte ich ja auch gar nicht. Mir fällt ein, wie Haymitch meinen Plan, aus Distrikt 12 zu fliehen und meinen eigenen Aufstand zu machen, und die bloße Idee, Distrikt 13 könne existieren, verspottet hat. Nichts als List und Täuschung. Wenn er das hinter seiner Maske aus Sarkasmus und Trunkenheit so überzeugend und lange tun konnte, worüber hat er dann noch gelogen? Ich weiß, worüber.
»Peeta«, flüstere ich, und das Herz rutscht mir in die Hose.
»Die anderen haben Peeta gerettet, weil wir wussten, dass du das Bündnis aufgekündigt hättest, wenn er gestorben wäre«, sagt Haymitch. »Und wir konnten nicht das Risiko eingehen, dich ohne Schutz zu lassen.« Seine Worte sind sachlich, seine Miene ist unverändert, nur die Graufärbung im Gesicht kann er nicht verbergen.
»Wo ist Peeta?«, fauche ich ihn an.
»Er wurde zusammen mit Johanna und Enobaria vom Kapitol geschnappt«, sagt Haymitch. Endlich hat er den Takt, seinen Blick zu senken.
Objektiv gesehen bin ich unbewaffnet. Aber man sollte nicht unterschätzen, welchen Schaden man mit Fingernägeln anrichten kann, besonders wenn das Opfer nicht darauf vorbereitet ist. Mit einem Satz springe ich über den Tisch und grabe meine Nägel in Haymitchs Gesicht, Blut quillt hervor, und ein Auge wird verletzt. Dann schreien wir einander schreckliche, wirklich schreckliche Dinge entgegen, während Finnick versucht, mich fortzuzerren, und ich weiß, dass Haymitch seinen ganzen Willen aufbringen muss, um mich nicht in Stücke zu reißen, doch ich bin der Spotttölpel. Ich bin der Spotttölpel, und es ist so schon schwer genug, mein Leben zu retten.
Andere Hände kommen Finnick zu Hilfe, und kurz darauf liege ich wieder auf meinem Tisch, den Körper festgeschnallt, die Handgelenke festgebunden, und deshalb schlage ich vor Wut immer und immer wieder mit dem Kopf gegen den Tisch. Eine Nadel bohrt sich in meinen Arm, und mein Kopf tut so weh, dass ich aufgebe und nur noch entsetzlich vor mich hin jaule, wie ein sterbendes Tier, bis meine Stimme versagt.
Das Beruhigungsmittel zeigt Wirkung, doch ich schlafe nicht, ich dämmere vor mich hin, bin für immer - oder so kommt es mir vor - gefangen in einem verschwommenen, dumpf schmerzenden Elend. Sie stecken mir wieder ihre Schläuche in den Arm und sprechen beruhigend auf mich ein, doch ihre Stimmen erreichen mich nicht. Ich kann nur an Peeta denken, der irgendwo auf einem ähnlichen Tisch liegt, während sie versuchen, seinen Willen zu brechen und Informationen aus ihm herauszupressen, die er gar nicht hat.
»Katniss. Katniss, es tut mir leid.« Finnicks Stimme kommt von dem Bett neben mir und schiebt sich in mein Bewusstsein. Vielleicht, weil wir einen ähnlichen Schmerz empfinden. »Ich wollte zurück und ihn und Johanna holen, aber ich konnte mich nicht bewegen.«
Ich gebe keine Antwort. Finnicks gute Absichten haben keinerlei Bedeutung.
»Er ist besser dran als Johanna. Die werden bald merken, dass er nichts weiß. Und sie werden ihn nicht töten, solange sie denken, sie können ihn gegen dich einsetzen«, sagt Finnick.
»Als Köder?«, sage ich zur Zimmerdecke. »So, wie sie Annie als Köder benutzen werden, Finnick?«
Ich höre ihn weinen, aber das ist mir egal. Wahrscheinlich werden sie sie nicht mal befragen, sie ist schon zu weit abgedriftet. Seit damals bei ihren Spielen. Sehr gut möglich, dass ich auf dem gleichen Weg bin. Vielleicht bin ich schon dabei, verrückt zu werden, und keiner hat den Mut, es mir zu sagen. Verrückt genug fühle ich mich.
»Wenn sie doch nur tot wäre«, sagt er. »Wenn sie alle tot wären und wir auch. Das wäre das Beste.«
Tja, darauf weiß ich keine Antwort. Ich kann es auch schlecht bestreiten, schließlich bin ich eben noch mit einer Spritze rumgerannt, um Peeta zu töten. Will ich wirklich, dass er tot ist? Am liebsten … am liebsten hätte ich ihn wieder. Aber ich werde ihn nie mehr wiederhaben. Selbst wenn die Rebellentruppen das Kapitol irgendwie stürzen könnten, wäre es garantiert Präsident Snows letzte Tat, Peeta die Kehle durchzuschneiden. Nein. Ich werde ihn nie mehr zurückbekommen. Also ist tot das Beste.
Weiß Peeta das oder wird er weiterkämpfen? Er ist so stark und kann so gut lügen. Ob er glaubt, dass er eine Chance hat? Bedeutet ihm das Überleben überhaupt etwas? Er hat sowieso nicht damit gerechnet. Er hatte schon mit dem Leben abgeschlossen. Wenn er erfährt, dass ich gerettet wurde, ist er vielleicht sogar glücklich. Dann weiß er, dass er seine Mission, mir das Leben zu retten, erfüllt hat.
Ich glaube, ich hasse ihn noch mehr als Haymitch.
Ich gebe auf. Sage nichts mehr, antworte nicht mehr, verweigere Nahrung und Wasser. Sollen sie mir doch in den Arm pumpen, was sie wollen, es braucht mehr als das, um einen Menschen am Leben zu erhalten, wenn er erst einmal den Lebenswillen verloren hat. Mir kommt sogar ein lustiger Gedanke. Denn falls ich sterben sollte, darf Peeta vielleicht weiterleben. Nicht als freier Mensch, aber als Avox oder so, der die zukünftigen Tribute aus Distrikt 12 bedient. Vielleicht findet er dann eines Tages eine Möglichkeit zu fliehen. Mein Tod könnte ihn noch immer retten.
Und wenn nicht, ist es auch egal. Es gibt genug Gründe zu sterben. Um Haymitch zu bestrafen, der von allen Menschen in dieser verfaulenden Welt Peeta und mich zu Figuren in seinen Spielchen auserkoren hat. Ich habe ihm vertraut. Ich habe alles, was wertvoll war, in Haymitchs Hände gelegt. Und er hat mich verraten.
Jetzt weißt du, warum keiner dich mit der Planung betraut, hat er gesagt.
Das stimmt. Niemand, der bei Verstand ist, würde mich mit der Planung betrauen. Denn offensichtlich kann ich Freund und Feind nicht unterscheiden.
Viele Leute kommen vorbei und wollen mit mir reden, aber ich lasse ihre Worte einfach so klingen wie das Klicken der Insekten im Dschungel. Bedeutungslos und fern. Gefährlich, aber nur von Nahem. Immer, wenn die Wörter verständlich werden, stöhne ich, bis sie mir noch mehr Schmerzmittel geben und alles wieder in Ordnung kommt.
Bis ich auf einmal die Augen öffne und jemand zu mir herunterschaut, den ich nicht ausblenden kann. Jemand, der nicht drängt oder erklärt oder denkt, er könnte mich durch Beschwörungen von meinem Vorhaben abbringen, weil nur er allein wirklich weiß, worauf ich anspreche.
»Gale«, flüstere ich.
»Hallo, Kätzchen.« Er streckt die Hand aus und streicht mir eine Haarsträhne aus den Augen. Auf einer Seite des Gesichts hat er eine frische Brandnarbe. Sein Arm steckt in einer Schlinge und unter dem Bergarbeiterhemd erkenne ich einen Verband. Was ist ihm zugestoßen? Wie kommt er überhaupt hierher? Zu Hause müssen schlimme Dinge passiert sein.
Das größte Problem ist nicht, Peeta zu vergessen, sondern mich nicht an die anderen zu erinnern. Ich brauche Gale nur einmal anzuschauen und sie kommen alle herauf in die Gegenwart und fordern Beachtung. »Prim?«, stoße ich hervor.
»Sie lebt. Deine Mutter auch. Ich habe sie rechtzeitig rausgeschafft«, sagt er.
»Sie sind nicht in Distrikt 12?«, frage ich.
»Nach den Spielen haben sie Flugzeuge geschickt. Brandbomben abgeworfen.« Er zögert. »Na, du weißt ja, was mit dem Hob passiert ist.«
Ja, das weiß ich. Ich habe gesehen, wie er in Flammen aufging. Das alte Lagerhaus voller Kohlenstaub. Der ganze Distrikt ist mit dem Zeug bedeckt. Ein neues Grauen steigt in mir auf, als ich mir vorstelle, wie die Brandbomben den Saum treffen.
»Sie sind nicht mehr in Distrikt 12?«, frage ich noch einmal. Als könnte ich die Wahrheit damit irgendwie abwenden.
»Katniss«, sagt Gale sanft.
Ich kenne diese Stimme. Mit dieser Stimme geht er auf verletzte Tiere zu, bevor er ihnen den Todesstoß versetzt. Instinktiv hebe ich die Hand, um seine Worte abzuwehren, doch er packt sie und hält sie fest.
»Nein«, flüstere ich.
Aber Gale ist keiner, der etwas vor mir geheim halten würde. »Katniss, es gibt keinen Distrikt 12 mehr.«
ENDE DES ZWEITEN BUCHS
Impressum
Die Tribute von Panem.
Gefährliche Liebe
von Suzanne Collins (Autor),
Sylke Hachmeister (Übersetzer),
Peter Klöss (Übersetzer)
Preis: EUR 17,95
Gebundene Ausgabe: 400 Seiten
Verlag: Verlag Friedrich Oetinger (19. Mai 2010)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3789132195
ISBN-13: 978-3789132193
Originaltitel: The Hunger Games 2. Catching Fire
ebook Erstellung - Mai 2010 - TUX
Ende

Table of Contents
Die Tribute von PANEM Gefährliche Liebe
Teil 1
Der Funke 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 2
Das Jubiläum 10
11
12
13
14
15
16
17
18
Teil 3
Der Feind 19
20
21
22
23
24
25
26
27
Impressum